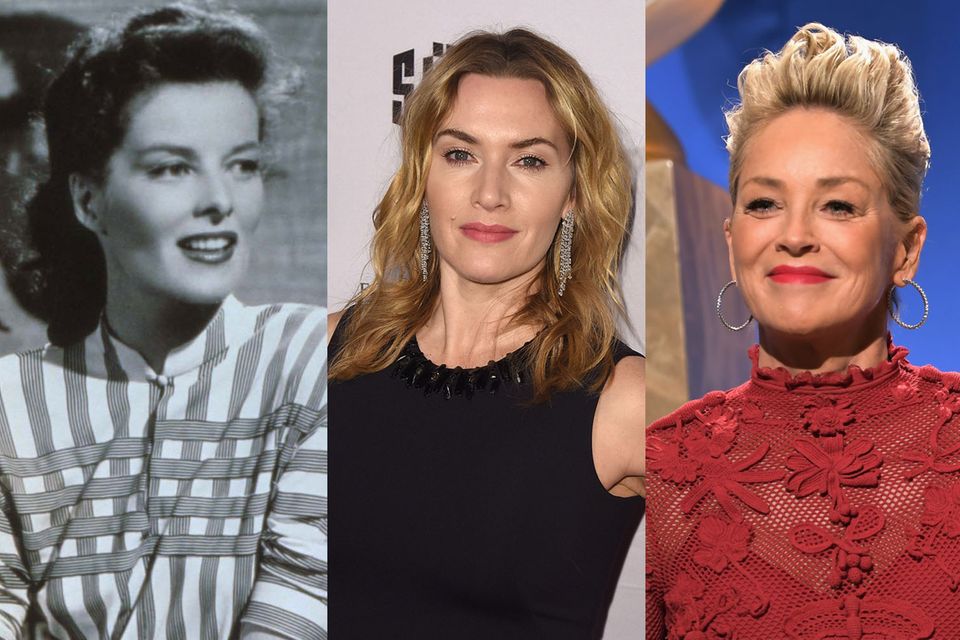In diesem Jahr war ich auf einer Kommunion, und dort bin ich Gott begegnet. Peinlich, das zu erzählen; diese Art von Bekenntnis will man eigentlich nicht hören. Es war aber auch nur indirekt. Eigentlich gehe ich nicht in Gottesdienste, ich bin nicht mal evangelisch, geschweige denn katholisch; meine Eltern sind lange vor meiner Geburt aus der Kirche ausgetreten. Sie haben Wert darauf gelegt, dass wir als Kinder zum Religionsunterricht gingen und als Touristen in Kirchen, aber meine religiöse Prägung ist minimal: Unser Top-Weihnachtslied ist das eher areligiös zuversichtliche "O Tannenbaum". Ich würde sagen, dass es bei vielen Gästen der Kommunionsfeier ähnlich war: QuasiChristen, Halbchristen und Ex-Christen, die bestenfalls zu hohen Familienfesten in die Kirchen gehen. Da die Kommunion im Rahmen eines öffentlichen Gottesdienstes stattfand, saß neben mir in der Kirchenbank eine ältere Dame, die nicht zu unserer Festgesellschaft gehörte. Dies erkannte man nicht zuletzt daran, dass sie bei allen Liedern voll Inbrunst und mit zwar brüchiger, aber auch geübter Stimme mitsang. Und daran, wie innig und leidenschaftlich sie die mir fremden Gebete sprach.
Ich betrachtete sie aus dem Augenwinkel, während ich so tat, als würde ich mit den Händen, Knien und meiner Kopfhaltung etwas im weitesten Sinne Religiöses tun, und ich wurde bei ihrem Anblick von einer seltsamen Rührung überfallen: Wie schön musste es sein, so glauben zu können, so sehr Teil von etwas zu sein, das größer ist als man selbst. Und wie schön es schon allein war zu sehen, wie jemand bereit war, mit Ritualen, Gesten und Gesang auszudrücken, dass es etwas gibt, was weit über all den vergänglichen Alltagskram hinausgeht. In mir mischten sich Gottes-Neid und Glaubensrespekt, und gegen Abend lösten sie sich auf in Richtung einer leichten Sehnsucht. Merkwürdig, wie selten wir Gott begegnen. Wir hören von ihm, wenn Fanatiker in seinem Namen Unheil stiften, oder wenn wir ihn und seinen Sohn zu Weihnachten geistesabwesend besingen, ohne groß auf den Text zu achten, weil alle in Gedanken beim Essen oder beim Familienstreit sind. Aber so wie vor einem halben Jahr bei dieser Kommunion: So nah bin ich Gott vielleicht noch nie gewesen. Weil ich so selten in der Nähe von Menschen bin, die vorbehaltlos und voll Hingabe glauben.
Die Menschen, die ich kenne, haben eher eine vage Sehnsucht, an so etwas wie eine überirdische Instanz zu glauben. Vielleicht im Sinne des englischen Schriftstellers Julian Barnes, der gesagt hat: "Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn." Viele Freunde und Kolleginnen, mit denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe, sagen aber auch, sie würden "an Gott glauben" oder "an einen Gott" oder "irgendwie schon irgendwas glauben", niemand davon gehört aber aktiv zu einer christlichen oder anderen Religionsgemeinschaft; die meisten Menschen aus meiner Welt leben mit einer Art selbst gemachtem Kinderglauben. Darum eins gleich vorweg: Wenn Sie glücklich glaubendes Mitglied einer Religionsgemeinschaft sind, werden Sie möglicherweise wenig Verständnis dafür haben, wenn jemand wie ich zu Gott in prosaischen Momenten die gleiche Einstellung hat wie zu Hühneraugenpflastern: Im Moment brauche ich Gott nicht, aber es ist gut zu wissen, dass es ihn gibt.
Wenn Sie aber zu denen gehören, die sich im Laufe der Jahre so etwas wie eine eigene kleine Privatreligion zusammengebastelt haben und die hin und wieder das Gefühl beschleicht, das Ganze wäre vielleicht ausbaufähig, bei Gelegenheit - dann sind Sie hier in dieser kleinen Laienpredigt richtig. Die Sehnsucht nach Glauben, nach einer übergeordneten Instanz, lässt sich in Zahlen beschreiben: 58 Prozent der Deutschen glauben an einen Gott (zwei Drittel der Frauen und die Hälfte der Männer). Gleichzeitig sinken die Mitgliederzahlen der christlichen Kirchen ebenso wie die Zahl der Gottesdienstteilnehmer. Die EsoterikIndustrie setzt in Deutschland im Jahr schätzungsweise 10 Milliarden Euro mit Seelenflüsterkursen, Heilsteinen und Engelseminaren um; an die Kraft des positiven Denkens glauben zwei Drittel, an ausgleichende Gerechtigkeit und an das Schicksal mehr als 40 Prozent. 43 Prozent glauben, sie hätten einen persönlichen Schutzengel.
Der Schweizer Theologe Anton A. Bucher, Professor für Religionspädagogik an der Uni Salzburg, erklärt mir, dass die Religionsforschung zwischen der "Säkularisierungstheorie" und der "Transformationstheorie" unterscheidet. Die erste geht davon aus, dass Religiosität an Bedeutung verliert, weil sich unsere Gesellschaft immer mehr zum Weltlichen orientiert, zum Materiellen, Wissenschaftlichen. Die zweite Theorie - der er zuneigt - beschreibt, dass Religiosität sich wandelt: weg vom traditionellen Glauben als Mitglied einer Religionsgemeinschaft, hin zu einer allgemeinen, viel persönlicheren Spiritualität. Bucher erzählt, wie er zu einer Lehrveranstaltung mit dem Titel "Psychologie der Religiosität" kaum Anmeldungen hatte, und als er sie umbenannte in "Psychologie der Spiritualität", war der Hörsaal überfüllt. Spiritualität ist ein Mode wort geworden, ein Wort, das sich mit allem Möglichen verbinden lässt: mit Achtsamkeitsmeditation, Büchern von Paolo Coelho, Fastenwandern, Sinnsuche oder Edelsteinwasser. "Spiritualität" bedeutet "Geistigkeit" und meint eine Art Offenheit für alles, was unsere unmittelbaren sinnlichen Erfahrungen übersteigt. Womit wir noch einen weiteren spirituellen und religiösen Fachbegriff erledigt hätten: Transzendenz, "das Übersteigen", wenn also etwas über unsere Erfahrungswelt hinaus ins Spirituelle geht.
Spiritualität ist vielen vielleicht deshalb ein angenehmeres Wort als "Gott", weil es nicht nach einem himmlischen Vorgesetzten klingt, sondern nach einer spannenden unirdischen Welt voller Möglichkeiten. Einer Art Selbstbedienungsladen des Seelenheils. Und warum auch nicht? "Whatever gets you through the night/ it's alright, alright", textete John Lennon: Was auch immer dir hilft, durch die Nacht zu kommen, ist in Ordnung. Religionsforscher Bucher sagt, dass zwar "die traditionellen religiösen Bezüge zurückgegangen sind", dass wir aber gleichzeitig in "außerordentlich religionsproduktiver Zeit" leben. Also, ganz überspitzt: Immer weniger gehen noch in die Kirche, immer mehr erfinden sich einen Glauben, der zu ihnen passt. Im Grunde sieht er dies als eine relativ normale Entwicklung, geschichtlich gesehen: An Religion sei schon immer "herumgebastelt" worden, "auch das reine Christentum hat es nie gegeben". Manchmal wird die Sehnsucht nach Spiritualität etwas konkreter, und dann kommen wir zumindest dem Wort nach wieder zu Gott oder landen in seiner Nähe.
Kann es denn sein, dass das alles einfach nur so da ist?
Natürlich sitzt niemand zu Hause auf dem Sofa und seufzt: Ach, ich hab so Sehnsucht nach Gott, aber ich finde keinen, oder: Ich brauche einen Gott; so wie man in bestimmten Situationen davon überzeugt ist, eine Tafel Schokolade, ein Bier oder eine Umarmung zu brauchen. Aber vielleicht findet man sich irgendwann in einer von diesen zwei Gefühlslagen, in denen Gott einem naheliegend erscheint: wenn erstens alles ganz friedlich ist oder wenn zweitens alles ganz dramatisch wird. Friedlich im Sinne von: Hier und jetzt ist es so wahnsinnig schön, dass sich ein großer Frieden ausbreitet in einem und man sich fragt: Kann es wirklich sein, dass das alles von selbst so wunderbar und einzigartig ist? Dieser Sonnenaufgang über einem See in den Bergen, und der Dunst steigt von der grünblauen Wasseroberfläche, dass es fast nicht sein kann, dass das alles einfach nur so da ist, ohne Sinn, als Laune einer desinteressierten und geistlosen Natur.
Der Fuß eines Neugeborenen; der Geruch in der Halsbeuge am Morgen nach der ersten gemeinsamen Nacht; eine Melodie, die vertrauten Harmonien eines alten Lieblingssongs. Kann sein, dass Vitello tonnato und der High Line Park in Manhattan seltsam wunderbare Zufälle menschlichen Tuns sind und dass die Blumen so bunt und die Bienen so schlau sind, weil das der Natur auf eine Weise nützt, die sie in Jahrmillionen nur für sich selbst hervorgebracht hat. Aber durch welchen Zufall sollte in all dem Chaos nach dem Urknall Musik entstanden sein, wenn nicht durch einen göttlichen? Friedliche Momente, in denen es sich anfühlt, als wäre es noch schöner, wenn man kurz und ohne viel Aufhebens einer überirdischen Instanz danken könnte. Und dann die anderen Momente, die dramatischen, in denen Gott einem sozusagen rausrutscht. Du warst seit Jahren nicht in der Kirche, bist vielleicht nicht mal getauft, aber woran denkst du, wenn du im Auto sitzt und das Handy klingelt, und du gehst doch ran, weil es das Heim ist, und sie sagen, du sollst dich beeilen, sie ist wieder gestürzt, und jetzt geht es zu Ende?
Der Gedanke an Gott scheint uns in solchen Momenten ein Reflex zu sein wie "Scheiße!" zu schreien!
Oder wenn die Herztöne des ungeborenen Kindes nicht mehr auf dem Monitor sind und die, die eben noch so burschikos zuversichtlich waren, dich rennend über den Gang schieben, wobei die Schöße ihrer Kittel tatsächlich flattern wie in einer dämlichen Krankenhausserie? Der Gedanke an Gott scheint uns in solchen Momenten ein Reflex zu sein wie "Scheiße!" zu schreien, wenn man sich auf den Daumen gehämmert hat. Weil es gut wäre, wenn zur überschaubaren eigenen Kraft und zur überschaubaren Hilfe der anderen Menschen noch eine Portion Übersinnliches dazukäme. Weil es auf seltsame Weise zumindest für Sekunden ein winziges bisschen besser geht. Ohne das Vertrauen darauf, dass es dann wirklich besser wird, ist die Geschichte der Menschheit nicht denkbar: "Wenn unsere Vorfahren nicht bereits diesen existenziellen Optimismus gehabt hätten, diese Bereitschaft zu glauben, dann wären wir gar nicht da", sagt der Theologe Bucher. Lieber Gott.
Manchmal hilft es sogar schon zu wissen oder sich daran zu erinnern, dass die anderen an ihn glauben. Weil man dann nicht mehr so allein ist. In Amerika haben vor etwa 100 Jahren die Mitglieder des Gideonbundes angefangen, in Hotels Bibeln auszulegen. Und auch wenn ich nicht daran glaube, was in dieser Bibel steht, dann tröstet mich doch, sie in der Nachttischschublade eines Hotels zu finden, in dem ich niedergeschlagen und voller Heimweh bin. Weil sie mir zeigt, dass unzählige andere genau den gleichen Trost gebraucht haben wie ich. Allein dadurch, dass ich für Momente bereit bin, in diesem leicht schmierigen FreiExemplar zwischen Minibar und fest installierter Fernbedienung nach etwas zu suchen, macht mich für Augenblicke zum Teil einer Gemeinschaft, und das tröstet.
Eine meiner Schulfreundinnen ist Pfarrerin geworden, an der Französischen Friedrichstadtkirche in Berlin-Mitte, auch bekannt als Französischer Dom auf dem Gendarmenmarkt. "Ich kann das, was du als Patchwork-Spiritualität bezeichnest, durchaus verstehen", sagt Meike Waechter, die Pfarrerin. "Aber ich stelle mir so etwas, sagen wir mal: Selbstgemachtes doch auch als Überforderung vor für einen Menschen." Sie betont das Wort "einen". Weil bei der Privatreligion die Gemeinde fehlt? "Es ist natürlich etwas anderes, wenn man am spirituellen und menschlichen Reichtum einer Gemeinde teilhaben kann, in der man verwurzelt ist und die einen ein Leben lang begleitet: Das ist ein sehr großer Schatz, gewissermaßen ein Geschenk, das man sich selbst nicht einfach machen kann. Und ehrlich gesagt stelle ich es mir schwierig vor, auf Fragen, die die Menschen seit hunderten und vielleicht tausenden von Jahren beschäftigen, selber eine Antwort finden zu müssen. Als Mitglied einer Kirche und Gemeinde ist man da doch eher in eine Tradition eingebettet von Menschen, die vor einem ganz ähnliche Fragen gestellt und Antworten gesucht haben." Vielleicht aber ist das gerade ein Reiz unser kleinen, liebenswerten Privatreligionen: dass wir uns in ihnen fühlen dürfen, als wären wir die Ersten und die Einzigen, die Fragen nach dem Sinn und der Ungerechtigkeit von allem stellen.
Mit den großen und kleinen Gefühlen angesichts des Unerklärlichen lieber allein bleiben zu wollen, hat nämlich immer auch etwas von Selbstliebe: Wir richten uns ein in einer spirituellen Komfortzone, einem behaglichen Bereich, in den wir nur hereinlassen, was zu uns, unserem Leben und unserem Weltbild passt. Ein bisschen Yoga, ein bisschen Meditation, ein bisschen buddhistische Gelassenheit, etwas christliche Nächstenliebe, eine gewisse Portion Volks- und Aberglaube, die wir auf den Bereich der Technik ausdehnen (vielleicht hält die Smartphone-Batterie länger, wenn ich das Gerät beschwörend zwischen den Handflächen reibe); überhaupt: eine ganze Menge Technikgläubigkeit. Und nicht zuletzt, auch in der Mischung: eine Notrufnummer für Krisenfälle - Lieber Gott, bitte mach . . . Dazu ein kindliches Staunen angesichts der Schöpfung, ein kindisches Bild vom Himmel und vom Jenseits, zu dem uns dann doch immer erst mal Wolken und alle Menschen von früher einfallen. Uns? Natürlich ist die Privatreligion bei allen, die eine haben, individuell verschieden; daher der Name.
Jeder Mensch hat eine Art Gott-Begabung
Meine sieht vielleicht ein bisschen so aus wie die eben beschriebene, minus Yoga. Melanie Wolfers ist Ordensfrau in Wien, sie gehört zu den Salvatorianerinnen, eine Frau in meinem Alter, die sich für ein ganz anderes Leben entschieden hat. Sie ist die Co-Autorin eines klugen, anregenden Buches, das wie viele populär-theologische Bücher einen etwas kitschigen Titel hat: "Glaube, der nach Freiheit schmeckt". Es handelt davon, wie man zum Glauben findet und was Glaube eigentlich ist: eine Art Horizont, der kaum zu beschreiben ist, vor dessen Hintergrund man alles andere aber klarer und deutlicher erkennt. Das Buch beschreibt, dass jeder Mensch eine Art "Gott-Begabung" hat und dass, wer sich nach Glauben sehnt, im Grunde schon glaubt. Es ist offen und mit viel Raum für inneren Widerspruch geschrieben, und auch im persönlichen Gespräch ist Melanie Wolfers alles andere als dogmatisch. Über das, was ich Privatreligion nenne, sagt sie: "Wenn ich mir meine Religion selbst nach meinen eigenen Bedürfnissen zusammenstelle, dann besteht natürlich die Gefahr, dass sie am Ende nicht mehr ist als ein Spiegelbild meiner Bedürfnisse, ein Spiegelbild meiner selbst."
Dem Bild von der Komfortzone stimmt sie zu, weil es einen Raum beschreibt, in dem man mit sich allein bleibt. "Die Chance der Offenbarungsreligionen ist, dass einem seine Bewegung entgegenkommt, etwas, womit man sich auseinandersetzen kann, das einen herausfordert." Glaube ist Abenteuer, steht in ihrem Buch, und auch wenn mir vieles an den "Offenbarungsreligionen" eher abenteuerlich denn als Abenteuer erscheint, muss ich natürlich zugeben: Meine Privatreligion ist alles andere als ein Abenteuer, sie ist mehr wie eine freundliche Fernsehserie, die auf einem Abenteuer basiert, bei der aber darauf geachtet wurde, dass alles nicht zu kompliziert wird. Mit "Offenbarungsreligionen" sind in erster Linie das Judentum, das Christentum und der Islam gemeint; Religionen, die einen einzigen Gott haben, der sich einem oder mehreren Propheten offenbart hat. Einen vergleichbaren Anspruch hat natürlich keine Privatreligion. Mag sein, dass eine Freundin ihren Yogalehrer als "Guru" bezeichnet oder dass ich finde, ein Buch sei eine solche "Offenbarung", dass ich Erkenntnisse daraus in meine Privatreligion einbaue.
58% der Deutschen glauben an Gott
Aber wenn überhaupt, dann hören wir in unseren eigenen kleinen Glaubenssystemen nur entfernte Echos der großen Erschütterungen, von denen die heiligen Schriften der großen Religionen handeln. Wir sind zufrieden damit, nicht zu nah an der Quelle zu sitzen: vielleicht, weil es da zu heiß, zu wild und zu unbequem ist. ine Bekannte von mir hat unsere Art zu glauben als "so eine Art Kinderglauben" bezeichnet, sie meinte damit auch ihre eigene Überzeugung, dass es schon einen Gott gibt, aber außerhalb der Kirche. Und dass der sich aber im Grunde nur im Guten, oder nur wenn es wirklich schlecht läuft, für sie interessiert und sich ansonsten eher wie ein diskreter älterer Herr in die Kulissen zurückzieht. Als ich Melanie Wolfers gegenüber das Wort "Kinderglauben" verwende, um unsere Privatreligionen mit dem leichten Zuckerguss des Staunenden und freundlich Naiven zu überziehen, sagt sie: "Das Wort deutet ja aber schon an, dass da etwas in den Kinderschuhen stecken geblieben ist und mehr mit Mythologischem, fast mit Fantasy zu tun hat, ohne sich jemals angemessen weiterentwickelt zu haben. Wie auch, denn zum Glauben gehört: sich bilden." Und ich ertappe mich bei einem Gedanken, der vielleicht am meisten die Gläubigen von den einfach nur Sehnsüchtigen unterscheidet.
Kann Glaube nicht einfach Trost und Anregung sein?
Der Gedanke lautet: Was denn noch alles? Kann Glaube nicht einfach Trost und Anregung sein, muss auch Glauben wieder mit Bildung, Anstrengung und Auseinandersetzung zu tun haben? Für eine Gläubige muss das eine absurde Einstellung sein, denn wie könnte etwas zu viel sein, das die Grundlage von allem und eben nicht einfach ein weiteres Feature ist? Einerseits möchte ich gern einfach froh und dankbar für meine kleine spirituelle Komfortzone sein; im Moment komme ich ganz gut mit ihr aus. Andererseits: Falls eines Tages mehr daraus werden sollte, wie ginge das dann eigentlich? Die Wahrscheinlichkeit, dass Gott wie in einem Monty-Python-Cartoon aus der Wolke auf mich und andere Vertreter von Privatreligionen zeigt, um auf seine Existenz hinzuweisen, halte ich für außerordentlich gering. Fast so gering wie die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich von der "Schwarzbrot-Spiritualität" des evangelischen Theologen Fulbert Steffensky überzeugen lasse, die überspitzt zusammengefasst meint, man müsse einfach stur so lange in die Kirche gehen, bis man akzeptieren kann, dass das Glaube ist: in die Kirche zu gehen und Predigten zu hören.
17% der Deutschen lesen in der Bibel
So lange, bis man, mit einer schönen Formulierung aus seinem Klassiker "Spiritualität im Alltag", den anderen ihren Glauben glauben kann. Einmal habe ich es ja schon erlebt. Aber jeden Sonntag? Das wäre, wie man so sagt, schon rein zeitlich ein Problem. Was also wäre ein erster Schritt, mit dem man die "Gott-Begabung" in sich fördern könnte, mit dem man anfangen könnte, das Glauben zu lernen? Die Ordensfrau Melanie Wolfers zitiert auf diese Frage den Dichter Rainer Maria Rilke: "Gott ist der Leiseste von allen." Sie sagt: "Glaube beginnt mit Unterbrechung. Mit produktiver Unterbrechung. Also damit, sich einfach immer mal wieder rauszuziehen aus allem. Damit, Zeit zu haben, um still zu werden. Und einfach zu sehen, wohin die eigenen Gedanken einen führen, wenn man nicht ständig unterbrochen wird." Es klingt wie ein sehr kleiner Schritt.
Aber vielleicht wäre er in Wahrheit ziemlich groß, und vielleicht ist er genau das, wonach wir uns ursprünglich sehnen, wenn wir uns nach Transzendenz und Spiritualität sehnen: nach Unterbrechung, danach, dass das ganze wahnsinnige Karussell der relativ sinnleeren Geschäftigkeit und Wichtigtuerei mal anhält. Vielleicht ist es am Ende egal, ob dieser Schritt uns zu etwas führt, was wir "Gott" nennen wollen, oder, wie der Theologe Bucher es nennt, "zu einem breiteren Konzept von Glauben: Glaube als Sinn und Zusammenhalt eines Lebens, Glaube als das, was mich motiviert, morgens aufzustehen. Glaube in Richtung Vertrauen in das Leben, und auch an uns selbst". Und wer weiß, vielleicht bringt genau dieser kleine Schritt alle Sehnsüchtigen, Gleichgültigen und Zweiflerinnen doch wieder ein bisschen in Richtung Glaube.
Zum Weiterlesen
Melanie Wolfers und Andreas Knapp: "Glaube, der nach Freiheit schmeckt. Eine Einladung an Zweifler und Skeptiker" (350 S., 9,95 Euro, Herder) Fulbert Steffensky: "Spiritualität im Alltag" (200 S., 17,95 Euro, Kreuz)
Till Raether ist freier Autor in Hamburg. Er ist verheiratet (nicht kirchlich) und hat zwei Kinder (ungetauft). Für BRIGITTE schreibt er über Psychologie und gesellschaftliche Themen. Bei der Arbeit an diesem Text wurde ihm klar, dass sein religiöses Verständnis zu großen Teilen auf dem Film "Der Himmel soll warten" (Warren Beatty, 1978) beruht.