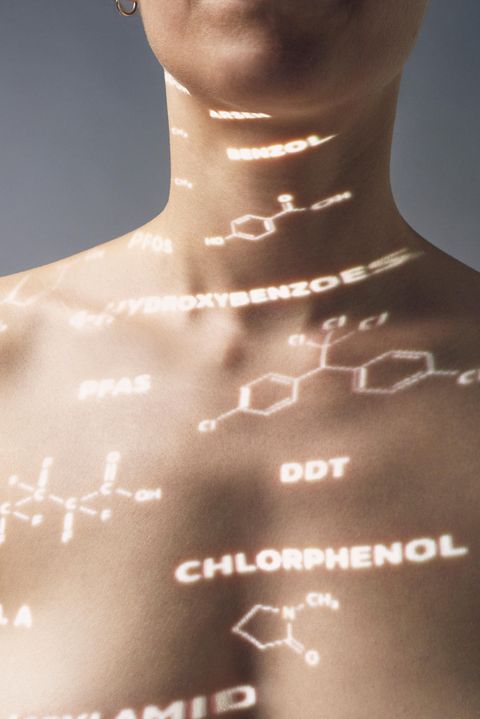Die Hufeisen-Azurjungfer ist eine Libelle, die man anhand ihres namensgebenden Merkmals bestimmen kann: der markanten schwarzen Zeichnung auf dem zweiten Segment ihres leuchtend blauen Hinterleibs. Mit diesen Worten hat es mir der Biologe Thomas Behrends erklärt, am 5. Juni des Jahres 1999.
Wir standen an einem Tümpel westlich des Flusses Wakenitz bei Lübeck, zusammen mit einem guten Dutzend weiterer Experten für Libellen, Käfer, Schnecken, Pflanzen und sonstige Lebewesen, die in naturnahen Kleingewässern zu Hause sind. Oder auch auf Heide- und Moorflächen, im Wald und in sauberen Flüssen.
Die Wakenitzniederung war Schauplatz des ersten GEO-Tags der Artenvielfalt. Und es hatte gute Gründe, dass die Premiere der Natur-Inventur gerade hier stattfand: Dieses weder als Nationalpark noch als Biosphärenreservat ausgewiesene Gebiet an der ehemaligen innerdeutschen Grenze versammelte – und versammelt noch heute – auf nur zwölf Quadratkilometern ein Mosaik verschiedenster Biotope. Sie sind für zahlreiche Landschaften Deutschlands charakteristisch – oder waren es zumindest einmal: Naturnahe Eichen- und Buchenwälder, in denen Bäume zu mehrhundertjährigen Riesen heranwachsen dürfen, Flussläufe, die frei durch Erlenbruchwälder mäandern. Und schließlich Varianten jenes Biotops, das Thomas Behrends und seine Kollegen als „Nordeuropas Antwort auf den tropischen Regenwald“ bezeichneten – offenes Grasland, teils sumpfig, teils trocken und, hervorstechendstes Merk mal: verschont von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung. So konnte sich dort eine Lebensgemeinschaft aus Hunderten von Tier- und Pflanzenarten erhalten, die aus der Normallandschaft verschwunden sind.
Die Hufeisen-Azurjungfer war nur eine von 2066 Spezies, die an jenem 5. Juni 1999 entdeckt wurden, von 102 Expertinnen und Experten für sämtliche in Mitteleuropa heimischen Artengruppen – von Säugetieren über Vögel, Fische, Insekten und Spinnen bis zu Algen, Flechten, Totholzpilzen. 2066 Arten in nur 24 Stunden: Das waren mehr als doppelt so viele, wie wir uns zum Ziel gesetzt hatten.
Dabei ging es uns niemals allein darum, beeindruckende Zahlen zu präsentieren. Der „B-Day“, wie wir ihn redaktionsintern getauft haben – das B steht für Biodiversität –, war von Anfang an auch als ein Festival für die Natur gedacht, mit der Zielsetzung, so viele Menschen wie möglich für das Leben vor der Haustür zu begeistern. Zu zeigen, dass biologische Vielfalt nicht nur ein Kennzeichen von tropischen Regenwäldern oder von Korallenriffen ist, sondern auch in der heimischen Umwelt existiert: so etwa bei den Libellen, von denen allein in Deutschland 81 Spezies vorkommen. Und das sind noch eher wenige im Vergleich zu Käferarten (mehr als 6500), Pflanzen (9500) und Pilzen (14 400).
Das Wort „Artenvielfalt“ ist lang und klingt eher abstrakt. Deswegen haben wir im Jahr 2017 die alljährliche Sichtung der Zehntausend umbenannt in GEO-Tag der Natur. Das schließt Vielfalt natürlich mit ein – mit der ja nicht nur die Vielfalt der Arten gemeint ist, sondern auch die der Lebensräume und Ökosysteme sowie der genetischen Varianten innerhalb einer Art. So jedenfalls lautet die umfassende Übersetzung des Begriffs „Biodiversität“.
Als wir im Jahr 1999 zum ersten GEO-Tag einluden, war „Biodiversität“ noch relativ unbekannt. Geprägt hatten den Begriff US-amerikanische Naturschützer und -wissenschaftler wie der Evolutionsbiologe Edward O. Wilson, dessen Bestseller „Biodiversity“, 1988 erschienen, auch die Anregung für unsere Aktion lieferte. Nicht nur für diese: 1992 war in Rio de Janeiro das „Übereinkommen über die biologische Vielfalt“ verabschiedet worden, in dem sich 168 Staaten verpflichteten, ebendiese Vielfalt konsequenter als bisher zu schützen.
Zu den Unterzeichnern gehörte auch Deutschland. Das die „Nationale Biodiversitätsstrategie“ entwickelte, die 2007 verabschiedet wurde. Ihr erklärtes Ziel: den Rückgang biologischer Vielfalt bis 2010 aufzuhalten – und danach umzukehren. Das Datum wurde bald auf 2020 verschoben, das Ziel aber blieb bestehen; 430 Einzelmaßnahmen sollen die Umsetzung garantieren – von der Renaturierung von Flussauen über die Weiterentwicklung des „Grünen Bandes“ entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze bis hin zu Projekten der Umweltbildung.
Die Liste der Ziele und Maßnahmen liest sich beeindruckend. Die Frage ist, was die Natur davon hat. Was die politischen Initiativen zum Schutz der Biodiversität gebracht haben, aber auch publikumswirksame Aktionen wie der GEO-Tag der Natur. Der Blick auf Zahlen und Statistiken zum Zustand heimischer Arten und Biotope lässt befürchten: nicht so viel.
Mehr als ein Viertel aller Pflanzen- und 36 Prozent aller Tierarten Deutschlands sind in ihrem Bestand bedroht, zwei beziehungsweise drei Prozent ausgestorben oder verschollen. Über 70 Prozent der für unsere Landschaft charakteristischen Lebens räume werden als „gefährdet“ eingestuft.
Und die Bestandsrückgänge und Biotopverluste haben sich nicht nur fortgesetzt, sondern vielfach noch beschleunigt: etwa bei den Vögeln, jener Artengruppe, die seit jeher am gründlichsten beobachtet und gezählt wird – auch deshalb, weil ihr Vorkommen als Indikator für den ökologischen Zustand ganzer Landschaften gilt. Allein zwischen 1998 und 2009 ist die Zahl aller Vogelbrutpaare in Deutschland um 12,7 Millionen gesunken – das ist ein Minus von 15 Prozent. Und im gleichen Zeitraum verschwanden mehr als 75 Prozent des Bestands an Fluginsekten – nicht der Arten, sondern der schieren Biomasse.
Wie lässt sich dieser Schwund aufhalten? Was muss geschehen, damit das Ziel der Nationalen Biodiversitätsstrategie – Stopp des Artenrückgangs und Trendumkehr – nicht bloß Fiktion bleibt? Welchen Naturschutz brauchen wir, damit Deutschland wieder lebendiger wird?
Das habe ich vier Menschen gefragt, die dazu sehr viel zu erzählen haben. Neben Thomas Behrends, Naturschutzbund Deutschland (NABU), sind es Detlef Kolligs, Schmetterlings forscher bei der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, der Käferexperte Roland Suikat, ebenfalls beim NABU aktiv, und Lutz Fähser, Leitender Forstdirektor im Ruhestand und bis 2010 verantwortlich für die Entwicklung des Lübecker Stadtwalds. Alle vier verbindet, dass sie, zum einen, am ersten GEO-Tag der Natur teilgenommen haben. Zum anderen haben sie die ökologische Entwicklung der damals untersuchten Gebiete genau beobachtet, teilweise sogar mitgestaltet. Wie viele andere engagierte Experten für Biodiversität haben die vier, außer „ihren“ Arten und Revieren, auch die Natur im gesamten Land im Blick behalten.
Sie haben genauer als flüchtige Beobachter registriert, wie diese sich im Zuge menschlicher Eingriffe verändert hat. Zu gleich wissen sie, wie mühsam der Kampf um den Erhalt der letzten Vielfalts-Refugien ist. Weshalb Magerrasen, feuchte Wiesen und tümpelreiche Niedermoore zu den bedrohtesten Biotopen Deutschlands gehören, weshalb naturnahe Wälder bis heute nur einen kleinen Bruchteil der gesamten Waldfläche einnehmen. Sie können darüber Auskunft geben, was zum Schutz dieser Lebensräume geschehen muss.
Die Antworten unserer vier Experten ergeben, in der Summe, eine radikale, aber auch praxisnahe To-do-Liste zur Rettung der Artenvielfalt. Sie decken sich mit zahlreichen Befunden und Handlungsempfehlungen von Naturschutzexperten im ganzen Land. Ich habe einige wesentliche Punkte daraus zusammengefasst.
1. Schutzgebiete gehören wirklich geschützt
Die Grönauer Heide, 367 Hektar groß und westlich der Wakenitz gelegen, hat nicht nur die meisten Artenfunde für den ersten GEO-Tag im Jahr 1999 „geliefert“ – sie ist auch bis heute das artenreichste Gebiet in Schleswig-Holstein geblieben, Wattenküste und Salzwiesen eingeschlossen.
Diesen Spitzenplatz konnte sie auch deshalb bewahren, weil sie seit 2006 Naturschutzgebiet ist.
Naturschutz-, Vogelschutz- und Landschaftsschutzgebiete, Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks: Es gibt eine Vielzahl von Etiketten für Lebensräume, die sich aufgrund ihres Artenreichtums und ihrer Eigenart von der Normallandschaft abheben. Doch viele dieser Etiketten sind mehr oder weniger unverbindlich; nur in einem kleinen Teil der als geschützt bezeichneten Gebiete hat die Natur auch per Gesetz Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen – etwa von Investoren und Politikern, die Bauland ausweisen, Umgehungsstraßen planen oder Windparks errichten wollen.
Und auch dieser Vorrang gilt nur im Prinzip: So sind in Naturschutzgebieten und in Biosphärenreservaten Fischerei, Forst- und Landwirtschaft erlaubt, sofern sie den Grundsätzen der „guten fachlichen Praxis“ entsprechen. Diese schließt das Fällen alter Bäume und den Einsatz schwerer Maschinen ebenso ein wie das Aussetzen von Fischen, das Bearbeiten von Feldern während der Brutzeit sowie das Ausbringen von Dünger und Pestiziden. Also eigentlich sämtliche Eingriffe, die zum Verlust von Artenvielfalt führen. Weshalb viele Schutzgebiete auch wenig bis nichts zu deren Erhalt beitragen.
Die Grönauer Heide hatte das „Glück“, seit jeher zu sandig und zu sumpfig zu sein für eine land- oder forstwirtschaftliche Nutzung. Aus diesem Grund blieb ihr reiches Inventar an seltenen, auf magere Böden spezialisierten Arten vor Zerstörung bewahrt.
Was an der Wakenitz Ergebnis eines historischen Zufalls war, muss auch in anderen Schutzgebieten zur Regel werden: Ihre Nutzung hat sich am Wohl der darin lebenden Flora und Fauna zu orientieren. Eingriffe, die diese gefährden, werden verboten oder zumindest stark eingeschränkt.
Das wäre eine Erste-Hilfe-Maßnahme für die heimische Natur. Aber nicht die einzig notwendige. Denn:
2. Tiere und Pflanzen brauchen Wanderwege durchs Land
8743 Schutzgebiete gibt es in Deutschland. Das klingt viel. Aber alle zusammen nehmen gerade 3,9 Prozent des Bundesgebiets ein – das sind bloß ein Drittel mehr als die Gesamtfläche aller Haus- und Kleingärten. Und etwa 60 Prozent aller Naturschutzgebiete sind weniger als 50 Hektar groß – zu klein, um ihre Artengemeinschaft zu erhalten. Denn diese ist auf „Zuwanderer“ angewiesen, die Verluste etwa von Insektenpopulationen nach kalten Frühjahren ausgleichen. Die Zuzügler bleiben aus, wenn das Schutzgebiet von Siedlungen oder intensiv bewirtschafteten Feldern umgeben ist. Auf Dauer verödet die Insel – und mit ihr die Natur im gesamten Land.
Weil dies in ganz Europa zu beobachten ist, und zwar seit Jahrzehnten, hat die EU 1992 ein zweites Schutzinstrument geschaffen: die „Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie“ (FFH). Mit ihr sollen nicht nur bedrohte Arten, sondern auch deren Lebensräume umfassender geschützt werden – in einem Netzwerk namens „Natura 2000“, das 18 Prozent der gesamten EU-Landfläche umfasst, in Deutschland 15 Prozent.
Auch der größte Teil der Grönauer Heide ist seit dem Jahr 2007 Natura-2000-Gebiet, ebenso rund 40 Prozent des Lübecker Stadtwalds. Insgesamt enthalten die Schutzgebiete an der Wakenitz gut zwei Dutzend der 231 Lebensraumtypen, die der FFH-Richtlinie zufolge schützenswert sind. Zu diesen 231 gehören norddeutsche Schwingrasenmoore, Binnendünen und Waldmeister-Buchenwälder ebenso wie Berg-Mähwiesen und temporäre Karstseen.
Um die Zukunft vieler dieser Lebensräume ist es jedoch schlecht bestellt. Denn der Schutz knapp der Hälfte aller FFH-Gebiete steht bislang nur auf dem Papier; es mangelt an rechtsverbindlichen Verordnungen, um ihn wirksam werden zu lassen. Diese zu erstellen wäre Aufgabe der Naturschutzbehörden von Bundesländern und Kommunen, die auch Pflege- und Managementpläne für die Gebiete entwickeln sollten. Aber die Behörden kommen mit beidem kaum nach, weil sie überlastet und zudem unter finanziert sind.
Wir brauchen eine Politik, die auf Bundes-, Landes- wie Kommunalebene den Naturschutz nicht mehr länger als Randthema behandelt. Und die im Fall von Konflikten zwischen Naturschützern und -nutzern nicht mehr Letzeren Vorrang einräumt.
Die Vernachlässigung der Natur lässt sich in Zahlen ausdrücken. Nur 15 Millionen Euro stellt die Bundesregierung jährlich für das „Bundesprogramm Biologische Vielfalt“ zur Verfügung. Dem stehen 57 Milliarden Euro an umweltschädlichen Subventionen gegenüber, etwa für Dieselprivileg, Braunkohleförderung oder die reduzierte Mehrwertsteuer auf Fleisch.
Auf keinem anderen Gebiet zeigt sich die mangelnde Wertschätzung der Natur so deutlich wie bei der Agrarpolitik. Seit Jahrzehnten fordern Biodiversitätsexperten daher unisono:
3. Bauern sollten sich wieder um Naturschutz kümmern
Gut 50 Prozent des Bundesgebiets werden landwirtschaftlich genutzt. Und es sind genau diese Flächen, die noch vor wenigen Jahrzehnten die größte Vielfalt an Arten aufwiesen.
Die vielen Tausend Pflanzen-, Insekten-, Amphibien-, Vogel- und Säugetierarten, die in der Agrarlandschaft heimisch sind, verbindet eine Eigenschaft: Sie sind Einwanderer. Ihre natürliche Heimat sind die baum- und strauchlosen Grassteppen Asiens, die sich am Ende der letzten Kaltzeit, vor rund 12 500 Jahren, bis nach Mitteleuropa erstreckten.
Dass Steppenbewohner wie Lerchen, Feldhasen, Sonnenröschen, Scheckenfalter und Sandbienen bei uns überleben konnten, verdanken sie unseren Vorfahren, genauer, den Bauern unter ihnen. Diese drängten die Wälder zurück, um Platz für Äcker und Wiesen zu schaffen – offene Flächen, deren Bewuchs durch Sense und Weidevieh kurz gehalten wurde.
Natürlich hatten die Bauern nie die Absicht, Lebensräume für ehemalige Steppenbewohner zu erhalten. Im Gegenteil: Landwirtschaft war seit jeher Kampf gegen die Natur, gegen Unkräuter, Schädlinge, Überschwemmungen und Dürren, die karge, auf mageren Böden gewachsene Ernten vernichteten. Über Jahrtausende konnte die Natur sich behaupten in diesem Kampf – bis die Menschen ab der Wende zum 20. Jahrhundert machtvolle Innovationen ins Feld führten: von Kunstdünger über chemische Pflanzenschutzmittel bis hin zu effizienten Maschinen, die binnen Stunden erledigten, was Tage mühevoller Arbeit gekostet hatte.
Die Intensivierung der Landwirtschaft ist auch ein Segen, denn sie hat erreicht, was vor wenigen Generationen Utopie war: die ganzjährige Versorgung der Bevölkerung mit preisgünstigen Lebensmitteln. Zugleich aber hat sie sich zur mit Abstand größten Bedrohung der Artenvielfalt entwickelt. Drei Faktoren vor allem machen Tieren und Pflanzen zu schaffen:
- Infolge der Flurbereinigung, insbesondere durch die Schaffung großer, maschinengerechter Felder, verschwand ab den 1950er Jahren das Biotopnetzwerk der Agrarlandschaft: blütenreiche Feldraine, Brachen, Tümpel und Hecken. Allein in Schleswig-Holstein wurden seit den 1950er Jahren 30 000 Kilometer Wallhecken, die typischen „Knicks“, zerstört — von ursprünglich 75 000.
- Pestizide greifen das Ökosystem Feldflur gleich auf mehreren Ebenen an: Herbizide wie Glyphosat vernichten Ackerwildkräuter und damit die Nahrungsgrundlage vieler Insekten. Insektizide wie Neonicotinoide wirken nicht nur auf Schädlinge toxisch, sondern auch auf Wildbienen und Wasserorganismen. Durch den Rückgang von Insekten und samentragenden Kräutern schrumpft wiederum das Nahrungsangebot für zahlreiche Vögel. Trotz des Verbots einiger Wirkstoffe ist eine Reduktion der Giftfracht bislang nicht in Sicht: Seit 1995 ist in Deutschland der Absatz von Pestiziden von 35 000 auf 47 000 Tonnen gestiegen.
- Mehr noch als Glyphosat und Co. bedroht Stickstoff die Vielfalt der Arten. Seit Jahrzehnten wird weitaus mehr Dünger und Gülle auf den Feldern ausgebracht, als die Nutzpflanzen verwerten können. Hinzu kommen Stickstoffverbindungen aus dem Autoverkehr. Die Überschüsse reichern sich im Boden an, sickern ins Grundwasser und entweichen in die Luft. Zwischen 20 und 40 Kilogramm Stickstoff gehen alljährlich auf jeden Hektar Boden in Deutschland nieder – natürlich wären ein oder zwei Kilogramm.
Die Folgen sind selbst in abgelegenen Naturschutzgebieten zu beobachten: von Algenwuchs getrübte, übersäuerte Gewässer; Magerwiesen, die von Löwen zahn, Brennnesseln und Moos überwuchert werden.
Nicht nur Insekten verlieren dadurch ihre Habitate, sondern auch Amphibien und bodenbrütende Vögel.
Der Feldzug gegen die Natur wird forciert durch eine Agrarpolitik, die seit Jahrzehnten einseitig auf Konzentration und Ertragssteigerung setzt.
6,5 Milliarden Euro Agrarsubventionen der EU flossen 2017 nach Deutschland; der größte Teil wurde in Form von Flächenprämien direkt an Landwirte ausgezahlt, genau gesagt: an Landbesitzer. Die Höhe der Prämie bemisst sich allein nach der Größe der bestellten Fläche; sie ist kaum an Umweltauflagen gebunden.
Landwirte müssen mehr finanzielle Anreize bekommen, um die Natur in der Agrarlandschaft zu erhalten.
Umweltverbände, aber auch Wissenschaftler fordern bereits seit Langem, die Zahlungen aus dem EU-Agrarfonds an Auflagen für den Natur- und Klimaschutz sowie den Erhalt von Arbeitsplätzen zu binden – nach dem Prinzip: „öffentliches Geld nur für öffentliche Leistungen“.
Ob und wann die vielbeschworene „Agrarwende“ kommen wird, steht in den Sternen. Die im Mai 2018 veröffentlichten Pläne der EU-Kommission für die Agrarförderpolitik ab 2020 wecken wenig Hoffnung: Sie zielen im Wesentlichen darauf, das bisherige System beizubehalten.
Bis auf Weiteres werden viele heimische Arten also auf künstliche Refugien angewiesen bleiben. Ob sie aber dort überleben können, hängt auch von ihren Beobachtern und ihren Betreuern ab. Diese müssen mehr als bisher einen Grundsatz beherzigen:
4. Wildnis wagen? Oder Natur pflegen? Beides!
Naturschutz und Artenschutz sind keineswegs dasselbe. Wer Biodiversität erhalten will, muss die jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen Arten kennen – und dafür zielgenaue Konzepte entwickeln. Wie diametral verschieden diese sein können, lässt sich an der Wakenitz besichtigen.
Im Lübecker Stadtwald hat Forstdirektor Lutz Fähser vor 24 Jahren das Prinzip der geringstmöglichen Einmischung eingeführt: Der Wald darf im Wesentlichen wachsen, wie er will. Er wird nicht ständig durchforstet, nicht entwässert, gedüngt oder mit schweren Maschinen befahren; es gibt in ihm weder Kahlschläge noch Anpflanzungen. Der Wald produziert seinen Nachwuchs selbst, und dieser darf nicht nur groß, sondern auch viel älter werden als in normalen Wirtschaftsforsten, bevor er gefällt wird. Und was vor der Zeit stirbt, bleibt stehen oder liegen – zum Wohl jenes Heers von Insekten und Pilzen, die auf Totholz spezialisiert sind. Deren Artenzahl liegt in einigen Lübecker Waldstücken schon annähernd auf Urwaldniveau.
Mehr Wildnis wagen: Sie macht einen Wald nicht nur vielfältiger und lebendiger, sondern steigert auch seine Fähigkeit, Kohlendioxid zu absorbieren, sowie seine Widerstandskraft gegen Klimaveränderungen. Naturnahe Wälder sind wirtschaftlich produktiver, wie Lutz Fähser erfahren hat: Langfristig bringen sie nicht nur mehr, sondern auch hochwertigeres Holz hervor – bei deutlich geringerem Pflegeaufwand.
Mehr Wildnis wagen: Für die Grönauer Heide wäre dieses Prinzip der Untergang. Sie ist, im Gegensatz zum Wald, ein Ganzjahres-Pflegefall.
Die Refugien der einstigen Steppenbewohner sind heute, paradoxerweise, solche Biotope, die durch brachiale Eingriffe des Menschen entstanden sind: Abraumhalden, Braunkohletagebaue, Industriebrachen, Truppenübungsplätze, manche Autobahnrandstreifen und Eisenbahndämme.
Die Grönauer Heide ist ein Beispiel dafür, wie permanente Störung Lebensräume schafft und erhält. Jahrzehntelang diente ihr nördliches Gebiet als Übungsgelände für den Bundesgrenzschutz; Fahrzeuge und Querfeldeinmärsche hielten das Gelände offen, den Bewuchs kurz – und sorgten so dafür, dass „Nordeuropas Antwort auf den Regenwald“ überlebte.
Als sich die Beamten zurückzogen, begann die Heide, sich in Buschland und Birkenwald zu verwandeln. Erst das Engagement der lokalen Artenkenner stoppte die „Renaturierung“. Das Schutzkonzept folgt dem Prinzip der gezielten, permanenten Einmischung: Schafe, Ziegen und Robustrinder halten den Bewuchs kurz, und zwar so, dass Pflanzen genügend Zeit zum Blühen und Versamen bleibt – und so die nächste Generation von Insekten und Vögeln heranwachsen kann.
Diese Form des Naturschutzes ist aufwendig. Sie ist jedoch die einzige Chance, einen großen Teil unserer heimischen Tier- und Pflanzenvielfalt zu bewahren – und zwar jenen, der mit Abstand am bedrohtesten ist.
Das allerdings erfordert den verstärkten Einsatz solcher Menschen, die ihrerseits fast schon zu einer bedrohten Spezies geworden sind.
5. Wer Arten erhalten will, der muss sie kennen
Wenn Käferkundler, Falterexperten und Botaniker sich treffen, dann liegt das Durchschnittsalter häufig jenseits der 50, berichtet Detlef Kolligs. Artenkennern geht der Nachwuchs aus. Das hat zwei Gründe: Zum einen wachsen Kinder zunehmend naturfern auf; immer weniger haben die Gelegenheit, unbeaufsichtigt durch Wälder, Wiesen oder auch nur Stadtparks zu streifen – was aber eine Voraussetzung wäre, um Interesse für bestimmte Artengruppen zu entwickeln.
Zum anderen hat sich, parallel zum Artenschwund, ein Fächersterben in der Forschung vollzogen: An Universitäten wird immer weniger Taxonomie gelehrt, die Wissenschaft von der Bestimmung der Arten. Sie gilt vielfach als antiquiert und wenig förderungswürdig; Drittmittel fließen eher in „moderne“ Fächer wie Molekulargenetik.
Irgendwann könnten insbesondere unscheinbare Lebewesen wie Insekten, Pilze, Amphibien ohne jeden Schutz dastehen: Denn wer sollte diesen einfordern, wenn es niemanden gibt, der sie auch nur zu benennen weiß?
Es gibt allerdings auch Anzeichen dafür, dass es so schlimm nicht kommen wird. Wenn etwa der NABU-Experte Thomas Behrends eine Exkursion zu dem eher spröden Thema „Pflanzen und Gräser im Grünland“ anbietet, kommen gut und gern zwei Dutzend Interessierte – viel mehr als noch vor einigen Jahren. Seine Kollegen berichten ebenfalls über wachsenden Zuspruch zu ihren Angeboten. Veranstaltungen wie der „Lange Tag der Stadtnatur“ in Hamburg und Berlin ziehen Tausende Besucher an; der diesjährige GEO-Tag der Natur verzeichnete rund 500 Veranstaltungen mit mehr als 11 000 Teilnehmern. In Umfragen bezeichnen sich nicht nur 90 Prozent der Deutschen als Naturliebhaber; ebenso viele betonen auch, dass Biodiversität für zukünftige Generationen erhalten werden müsse. Und immer mehr engagieren sich persönlich für dieses Ziel. Davon weiß Lutz Fähser zu berichten.
Der Lübecker Stadtwald war lange Zeit eine Insel in der Waldlandschaft, die ansonsten von an Ökologie eher uninteressierten Landwirtschaftsministerien und Landesforstämtern geprägt ist. Das scheint sich allmählich zu verändern: Immer mehr Bürger begehren gegen den massiven Holzeinschlag in öffentlichen Wäldern auf. Und gegen eine Nutzungweise, die auf maximale kurzfristige Erträge zielt, um Löcher in den Haushalten von Bundesländern und Kommunen zu stopfen.
Der Bürgerprotest hat bereits vielerorts Erfolg: Mehrere deutsche Städte haben das Lübecker Modell einer naturnahen Waldwirtschaft übernommen. Und sorgen so dafür, dass Wälder wieder ihre wichtigste Funktion erfüllen: Orte der Erholung zu sein, die die Artenvielfalt bewahren – und Menschen eine Ahnung dessen vermitteln, was Wildnis ist.
In einem sind sich die Experten von der Wakenitz einig: Als Natur- und Artenschützer braucht man einen langen Atem und hohe Frustrationstoleranz. Das gilt besonders beim Aushandeln von Kompromissen zwischen Naturschutz und Nutzungsinteressen; die laufen zumeist auf eines hinaus: Wieder wird ein Stück natürlicher Lebensraum umgepflügt oder zugebaut.
So wie der Tümpel, in dem Thomas Behrends 1999 am ersten GEO-Tag der Artenvielfalt die Hufeisen-Azurjungfer entdeckte. Vor 15 Jahren wurde der kleine Teich zugeschüttet, um Platz für eine Landebahn des Lübecker Flughafens zu schaffen. Mit dem „unscheinbaren“ Kleingewässer verschwand eine Gemeinschaft seltener Wasserpflanzen und -tiere, die in Schleswig-Holstein vermutlich einzigartig war.
Ein kleiner Trost: Die Libelle ist vermutlich nach wie vor an der Wakenitz heimisch. Sie gehört – noch – zu den häufigeren Arten ihrer Familie.