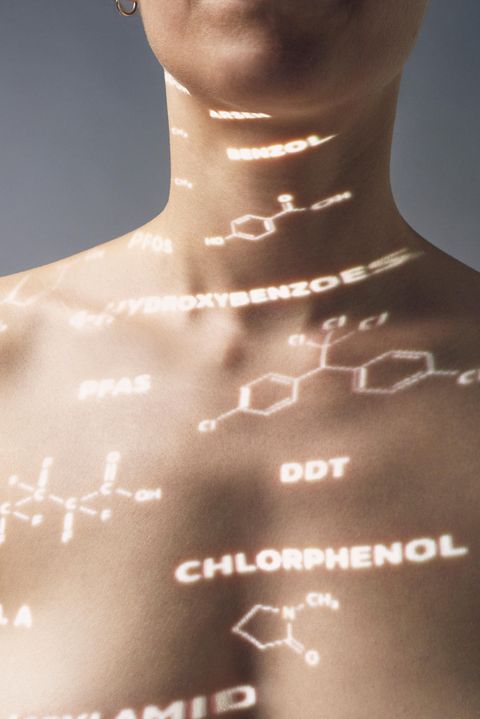Wer Wild isst, glaubt oft den Tierschutz auf seiner Seite: Ein Leben in Freiheit und dann "peng!" und Schluss. Ist doch sehr viel besser als das Elend in den Mastställen und Schlachthöfen. Das stimmt zwar. Aber nur bis zu dem Moment, da das Projektil den Lauf verlässt: Der Todeskampf des getroffenen Tieres dauert oft Stunden.
Beispiel Reh: Jedes Jahr werden zwischen Flensburg und Mittenwald knapp 1,3 Millionen von ihnen getötet. Tendenz: steigend. Neuerdings drängen sogar die Umweltverbände darauf, dass mehr sogenanntes Schalenwild zur Strecke gebracht wird. Weil die Paarhufer inzwischen als Waldschädlinge gelten, die durch ihre Vorliebe für junges Blattgrün die wünschenswerte natürliche Waldverjüngung ausbremsen. Der Slogan der klimabewegten Waldschützer: „Wald vor Wild“. Eine Formel, die Tierschutzprobleme ausblendet.
Schlechte Treffer verursachen unnötiges Leid
Denn wie ein Reh stirbt, wissen wir nicht. Der Jäger ist oft allein mit seinem Opfer. Toten Tieren sieht man kaum an, wie lange sie leiden mussten. Und die, die im Verborgenen starben, zählt niemand.
Selbst ein Blattschuss – also ein Schuss in die Herzgegend – ist nicht immer sofort tödlich. Der Todeskampf kann Sekunden dauern, das getroffene Tier sogar noch flüchten. Aus Tierschutzsicht noch weit problematischer sind „schlechte“ Treffer. Also Schüsse, die wahllos am Körper große Wunden reißen. Ins Bein, in die Lunge, in den Bauch, in Ober- oder Unterkiefer.
Selbst mit heraushängendem Gedärm können panische Tiere noch Hunderte Meter weit flüchten, um sich zu verstecken. Je nach Schwere und Art der Verletzung verenden die Tiere dann qualvoll innerhalb von Stunden oder sogar Tagen. Noch schlimmer: Sie werden vom Jäger aufgestöbert, flüchten erneut und sind wieder unauffindbar. Oder sie verhungern, weil sie nicht mehr fressen können. Oder sie werden von unkontrollierten Hunden gestellt und zerrissen.
Waidgerecht ist das nicht. Und tierschutzkonform schon gar nicht. „Niemand“, so steht es im ersten Paragrafen des Tierschutzgesetzes, „darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schaden zufügen.“
Belastbare Zahlen zum Thema sucht man allerdings vergebens. Kein Jäger möchte als Versager dastehen. Und die Jagd genießt in Teilen der Öffentlichkeit ohnehin keinen guten Ruf. Es gibt zwar einige wenige Untersuchungen zur Fleischqualität von erlegtem Wild, die sich auch mit Schussverletzungen befassen. Repräsentativ sind die aber nicht. Die spärlichen Angaben zu Tieren, die nur verletzt wurden, liegen im ein- bis zweistelligen Prozentbereich.
Die Nachsuche bringt Inkompetenz zum Vorschein
Aber es gibt noch andere Quellen. Nämlich die Erfahrungen von Nachsucheführern, also Experten mit speziell ausgebildeten Hunden, so genannten Schweißhunden, die von Jägern gerufen werden, um das verletzte Tier zu finden und von seinen Qualen zu erlösen.
Ulrich Umbach, ein erfahrener Nachsucheführer, schätzt, dass etwa drei Prozent aller beschossenen Rehe nicht sofort tot sind. „Nicht darin enthalten sind die Tiere, die noch mit einer kurzen Todesflucht zur Strecke kommen.“ Das klingt nicht nach viel. Doch drei Prozent von 1,3 Millionen sind immerhin 39.000 Tiere, die jedes Jahr qualvoll verenden. Hinzu kommt: Nicht jeder Jäger, der nicht richtig getroffen hat, verständigt einen Nachsucheführer. Und nicht jede Nachsuche ist erfolgreich. Auch dazu gibt es naturgemäß keine belastbaren Zahlen.
Die gibt es nur von den offiziell erfassten Tieren. Rehe werden demnach zwar am häufigsten getötet. Doch die komplette Jagdstrecke beläuft sich jedes Jahr auf über vier Millionen Lebewesen: neben Rehen auch knapp 600.000 Wildschweine, mehr als 420.000 Füchse, über 190.000 Hasen und über 166.000 Waschbären. Fasst man die 24 Tierarten zusammen, die der Deutsche Jagdverband für die Jagdsaison 2018/19 auflistet, ergibt sich rechnerisch: Alle acht Sekunden stirbt irgendwo in Deutschland ein Tier durch ein Projektil. Mal schneller, mal langsamer.
Tierschützer fordern Nachweis der Treffsicherheit
Dürfen wir Tiere töten? Und wenn ja, mit welcher Begründung? Was ist für den Wald das Beste? Welche Jagdstrategien sind für Wild und Wald am schonendsten? All diese Fragen können und müssen in der Gesellschaft diskutiert werden. Aber die unnötige Quälerei im Unterholz muss sofort beendet werden.
Töten ist keine Freizeitbeschäftigung. Und dass ein Jäger heute seine Treffsicherheit nicht regelmäßig unter Beweis stellen muss, ist ein Skandal. Seit langem fordert darum nicht nur der Deutsche Tierschutzbund einen jährlichen Leistungstest als Zugangsvoraussetzung zu Jagden. Nützen könnte das nicht zuletzt den Jägern selbst.
Ein Kollege von Ulrich Umbach, der Nachsucheführer Bernd Krewer, schrieb in seinem Buch Über Hirsche, Hunde und Nachsuchen: „Wenn es den ‚Tierschützern’ gelänge, einen viel beschäftigten Schweißhundeführer ‚umzukrempeln’, wären wir einen Tag später die Jagd endgültig los. Es muss sich vieles im Tun und Lassen der Jägerei ändern, wollen wir vor der immer kritischer werdenden Bevölkerung bestehen und von ihr das Mandat für den Fortbestand unserer Jagd bekommen.“
An diesem Befund hat sich auch zwei Jahrzehnte später nichts geändert: Wer derart kapitale Tierschutzprobleme erzeugt, braucht sich über mangelnde Akzeptanz in der Bevölkerung nicht zu wundern.