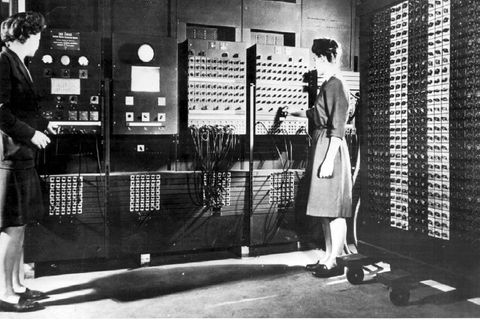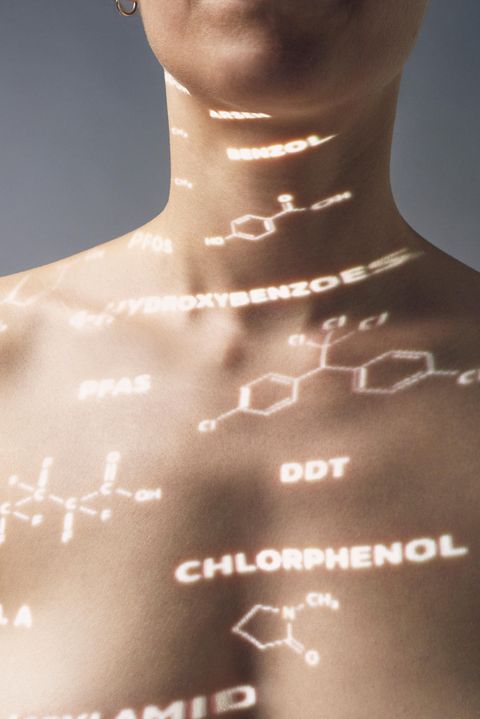Che Guevara: Das Ende einer Legende
Der Tote hat große Ähnlichkeit mit Jesus Christus, darin sind sich die Nonnen des Krankenhauses und die Frauen des Ortes einig. In dem Gewimmel aus Reportern, Fotografen, Soldaten und Schaulustigen beugt sich immer wieder jemand zu dem Aufgebahrten hinunter und schneidet sich eine Strähne der Haare ab, als Talisman.
Die erloschenen Augen stehen offen. Sie wirken seltsam lebendig, die Gesichtszüge sanft. Der Bart gestutzt, das Kinn hochgebunden. In den Hals hat ein Arzt einen Schnitt gesetzt und Formaldehyd in die Schlagader gespritzt, damit der Leichnam nicht so schnell verwest. Jemand hat ihn gewaschen und gekämmt.
Der Mann sieht im Tod besser aus als in den letzten Wochen seines Lebens. Besser auch als seine Mitstreiter, die verkrampft auf dem Boden lagen, bevor man sie verscharrte. Oder die entstellt und aufgedunsen erst nach Tagen aus einem Fluss gezogen wurden.
Kugeln haben Arme und Beine des Mannes getroffen, der letzte, tödliche Schuss hat sich ihm in die Brust gebohrt: Sein Henker hat darauf geachtet, das Gesicht nicht zu treffen. Denn die Männer, die den Toten am Nachmittag des 9. Oktober 1967 der Öffentlichkeit präsentieren, im Waschhaus hinter dem Hospital Nuestro Señor de Malta in Vallegrande im Hochland Boliviens: Sie werden verbreiten, der Mann sei im Kampf gestorben.
Und sie wollen keinen Zweifel zulassen an seiner Identität. Der Tote hat viele Namen getragen in seinem 39 Jahre währenden Leben: geboren als Ernesto, Ende 1966 in La Paz angekommen als Adolfo Mena González, von seinen Kameraden im bolivianischen Dschungel Fernando genannt oder Ramón.
Die Welt aber, die bald die Fotos sehen wird von der christusgleichen Leiche, kennt ihn unter dem Kampfnamen, den er sich vor einem Jahrzehnt in der Kubanischen Revolution erworben hat: Comandante Che Guevara. Am nächsten Abend wird man ihm zwei Totenmasken und die Fingerabdrücke abnehmen, man wird ihm die Hände abschneiden und sie in Formaldehydlösung einlegen.
Dann wird man ihn mehrere Meter tief neben der Landebahn von Vallegrande vergraben, die Stätte mit Bulldozern einebnen und das Gerücht verbreiten, die Leiche sei verbrannt worden. So endet das letzte Abenteuer des Mannes, der geglaubt hatte, in Südamerika einen Guerillakrieg entfachen zu können. Ein zweites Vietnam für die USA wollte er auslösen und schließlich einen dritten Weltkrieg, an dessen Ende siegreich der Kommunismus stehen würde.
Er hat immer die Gefahr gesucht und das Unmögliche, dieser Ernesto Guevara de la Serna aus Argentinien. Der asthmatische Junge, der sich mit den Nachbarskindern prügelte, bis sie ihn nach Hause tragen mussten. Der Schüler, der sich von Brücken baumeln ließ, über Schluchten balancierte. Der Medizinstudent, der per Anhalter übers Land fuhr und später auf dem Motorrad zu einer Reise quer durch den Kontinent aufbrach. Der die berühmte Inka-Bergfestung Machu Picchu bestieg, Ruinen besuchte und Leprakrankenhäuser.
Der Sohn einer verarmten Familie aus der Oberschicht, dem alle Möglichkeiten offenstanden, der sich in der Schule kaum für Politik interessierte und sich dann auf seinen Reisen dem Marxismus verschrieb. Der schließlich begann, Stalin zu verehren, und dem nur eine Lösung möglich schien für die schreiende Ungerechtigkeit, die ihm überall auf dem Kontinent begegnete: die Weltrevolution.
Im Kampf findet Che Guevara seine Bestimmung
"El Che Argentino" nennen ihn die kubanischen Exilanten, die er 1954 in Guatemala trifft. Nach seiner typisch argentinischen Angewohnheit, ständig das indianische Füllwort che in seine Sätze zu streuen, "he, du".
Seine zweite große Reise durch den Kontinent hat Guevara nach Guatemala getrieben. Er atme, schreibt er nach Hause, „die Luft der Freiheit“: Seit einigen Jah- ren regiert dort der linke Oberst Jacobo Árbenz Guzmán, der die meisten Ländereien der United Fruit Company verstaatlichen will. Doch das mächtige US-Unterneh- men, das fast überall in Lateinamerika als Großgrundbesitzer und mancherorts wie ein Sklavenhalter auftritt, hat beste Beziehungen zum Chef der CIA und zu seinem Bruder, dem Außenminister.
Ein Dreivierteljahr vor Guevaras Ankunft hat die United Fruit Company bereits mit Unterstützung des US-Geheimdienstes einen Aufstand organisiert. Auch Guatemalas Nachbarn fürchten, das Beispiel der Regierung Árbenz könnte auf ihre Länder übergreifen.
Hunderte Exilanten und junge Linke kommen nach Guatemala. Guevara kann sich nicht losreißen von der Stimmung in den Straßen, von dem Gefühl, etwas Großes zu erleben. Er lernt Kubaner kennen, die in Guatemala im Exil leben: Mitstreiter des Rechtsanwalts Fidel Castro, der auf Kuba in Haft sitzt, zu 15 Jahren verurteilt, weil er versucht hat, den Diktator Fulgencio Batista zu stürzen.
Ernesto „Che“ Guevara ist beeindruckt von den Männern, die in einem Aufstand ihr Leben gewagt haben. Im Juni 1954 greift eine von der CIA unterstützte Armee Guatemala an. Guevara hat keine Angst vor den Bomben, die auf Guatemala-Stadt niedergehen, im Gegenteil, er findet sie „erhebend“.
Der 26-Jährige patrouilliert als Mitglied der kommunistischen Jugendbrigaden nachts in den Straßen, um die Verdunklung zu überwachen, und versucht wiederholt, zum Präsidenten durchzudringen. Er will Árbenz überzeugen, die Guatemalteken zu bewaffnen für einen Guerillakrieg in den Bergen.
Doch Árbenz wird gestürzt, und Guevara geht nach Mexiko, wo er bald seine kubanischen Freunde wiedertrifft. Zum Muttertag 1955 entlässt Batista Castro aus der Haft. Der gründet, kaum in Freiheit, in Havanna eine Geheimgesellschaft, die Batista stürzen soll. Dann folgt er seinem Bruder Raúl nach Mexiko, um dort eine Guerillatruppe für eine Invasion auszubilden.
Schon wenige Stunden nach einem ersten gemeinsamen Abendessen fordert er Guevara auf, sich ihnen anzuschließen. „El Che“ soll die Gruppe als Arzt begleiten. Der Abenteurer, der Gefahrensucher, der überzeugte Marxist sagt zu.
Er bewährt sich als guter Schütze, beweist in den Worten seines Ausbilders „hervorragende Disziplin, hervorragende Führungseigenschaften, hervorragende körperliche Ausdauer“.
Ernesto Guevara de la Serna hat seine Bestimmung gefunden: den Guerillakrieg.
Von Bolivien aus will Che Guevara die Welt in einen Krieg stürzen
Die Ereignisse der folgenden Jahre werden ihn berühmt machen. Und sie werden ihn elf Jahre später in einen gewaltsamen Tod in Bolivien führen. Mit der Yacht „Granma“ landen Che und 81 weitere Männer im Dezember 1956 an der kubanischen Küste. Vieles geht schief, keine zwei Dutzend Kämpfer überstehen die ersten Tage.
Doch Bauern beherbergen und verpflegen sie, viele schließen sich ihnen an. Auch aus den Städten kommen neue Rekruten in die Berge. Che Guevara, der sich bereits in den ersten Tagen als inoffizieller Anführer seiner kleinen versprengten Gruppe behauptet hat, ist neuen Kämpfern gegenüber unnachgiebig. Immer wieder fordert er die Todesstrafe für Disziplinlosigkeit und Desertion.
Als sich niemand findet, um einen Verräter zu exekutieren, schießt Guevara dem Mann in die Schläfe. Er bringt Verwundete in Sicherheit und baut eine zweite Kolonne auf. Castro ernennt ihn zum comandante, zum Major. Che trägt den höchsten Rang der Rebellenarmee. Einen Rang, den sonst zunächst nur Castro selbst innehat.
Im Januar 1959 flieht Batista in die USA: Gegen alle Wahrscheinlichkeit und eine überlegene Armee haben die Guerilleros gesiegt. Guevara wird Kommandant einer Militärfestung. Die führenden Mitarbeiter des Regimes haben sich rechtzeitig abgesetzt oder sind in ausländische Botschaften geflohen. Doch die Revolutionäre nehmen Tausende Kriegsgefangene, zumeist Unteroffiziere oder Folterknechte der Polizei.
Che ist Chefankläger und oberste Berufungsinstanz in einem. Alle Angeklagten erhalten ein Verfahren, das allerdings nur wenige Stunden dauert. Wer des Mordes, Totschlags oder extremer Folter als überführt gilt, wird hingerichtet. In den ersten drei Monaten sterben so rund 550 Menschen vor Erschießungskommandos, bevor Castro die Exekutionen einstellen lässt – gegen Ches Widerstand.
Guevara wird Präsident der Nationalbank und schließlich Industrieminister in der neuen sozialistischen Regierung. Sein Barett mit dem Majorsstern setzt er selten ab, die grüne Uniform wird er selbst vor der UN-Vollversammlung tragen.
Einige Jahre lang widmet sich Che dem Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft. Er heiratet, zeugt vier Kinder. Er bleibt Castros engster Vertrauter, reist auf diplomatischer Mission durch die Welt.
Er ist es, der 1962 mit dem Kreml einen Vertrag zur Stationierung von Atomraketen auf Kuba aushandelt. In der folgenden Krise mit den USA einigt sich Nikita Chruschtschow im letzten Moment mit John F. Kennedy und verhindert so einen dritten Weltkrieg. Che wütet gegen die Moskauer Genossen: Wenn die Kubaner die Kontrolle gehabt hätten, dann wären die Raketen gezündet worden.
Spätestens seit Guatemala verspürt Guevara einen kalten Hass auf die yanquis. Doch er widerspricht auch der sowjetischen Lehre. Nicht die Partei sei die Spitze des Proletariats, sondern die Guerilla. Nicht die Kader in den Städten leiteten die Revolution, sondern die Kämpfer in den Bergen. Und auch in einer rückständigen Gesellschaft lasse sich ein erfolgreicher Umsturz erreichen, mit wenigen Dutzend entschlossener Guerilleros im Hinterland.
Das ist die Lehre, die Guevara aus der Kubanischen Revolution gezogen hat und die er in seinem Buch „Der Partisanenkrieg“ verbreitet. Er gibt sie den lateinamerikanischen Studenten mit, die er auf Kuba zu Guerilleros ausbildet: "Im unterentwickelten Lateinamerika muss der bewaffnete Kampf vor allem auf dem Land ausgetragen werden."
Im Laufe der 1960er Jahre schickt Guevara mehrere Guerillagruppen aufs Festland, unter anderem in sein Geburtsland Argentinien. Alle enden schnell im Desaster. Weil es, glaubt der Comandante, an einer charismatischen, unbestechlichen militärischen Führungsperson fehlt. An jemandem wie ihm.
1965 verlässt er seine Familie für einen Kampfeinsatz im Kongo (so wie er bereits seine erste Frau und seine erste Tochter für die „Granma“ verlassen hat). Doch der Versuch, die Kubanische Revolution nach Afrika zu exportieren, scheitert.
Guevara sucht gemeinsam mit Castros Geheimdienst einen neuen Ort aus, wo er seine Lehre vom Guerillakrieg beweisen kann: Bolivien.
Mit Halbglatze zieht die Ikone in den Kampf
Einiges scheint dafür zu sprechen, dass dieses Land die Keimzelle einer Revolution sein könnte, die den ganzen Kontinent erfassen soll. Bolivien grenzt an fünf andere Staaten: Peru, Brasilien, Paraguay, Argentinien und Chile. Das Land erfährt seit den 1950er Jahren einen Aufschwung, die Bauern aber leben weiter in Armut.
Präsident Barrientos hat sich an die Macht geputscht und sich 1966 in Wahlen bestätigen lassen, den Widerstand der Bergarbeiter hat er zum Teil mit Gewalt gebrochen. Seine Armee ist schwach und wird von den USA unterstützt. Hat nicht auch der Vietnamkrieg mit einigen amerikanischen Militärberatern begonnen?
Dies ist Che Guevaras Plan: Er will nicht bloß in einem sich ausbreitenden Guerillakrieg sozialistische Regierungen überall in Südamerika installieren – sondern die yanquis in diesen Krieg hineinziehen, „zwei, drei, viele Vietnam“ schaffen. Moskau müsste die Genossen dann schon bald unterstützen, es würde zu einem Weltkrieg kommen, der den Imperialismus schließlich in dessen Brutstätte besiegt.
Am 3. November 1966 kommt der uruguayische Wirtschaftsfachmann Adolfo Mena González in La Paz an. Weißes Haar umrahmt seine Halbglatze, die Augen liegen hinter einer Hornbrille, er ist glatt rasiert und trägt einen makellosen Anzug. Comandante Che Guevara hat Bolivien betreten. Ihm bleiben noch elf Monate zu leben.
Sein Plan, mit ein paar Dutzend Männern einen Weltkrieg zu entfachen, wäre selbst unter günstigsten Bedingungen sehr ambitioniert. Doch die Bedingungen sind nicht günstig. In den Monaten zuvor hat die kommunistische Partei Boliviens alles getan, um Ches Aktion zu verhindern. Ihr Generalsekretär Monje ist nach Havanna geflogen, nach Moskau.
Dennoch hat er, wie befohlen, im Südosten Boliviens ein Grundstück gekauft: 15 Quadratkilometer Wildnis als Basislager für die Guerilleros. Doch er hat es ohne besondere Sorgfalt ausgewählt – was sich schon bald rächen wird. Denn das Land dort ist dünn besiedelt.
Dabei ist die Truppe darauf angewiesen, dass Einheimische sie mit Essen, Informationen und Rekruten versorgen. Die wenigen Bauern sind unpolitisch oder Anhänger der Regierung. Von den aufzuwiegelnden Minenarbeitern trennen Guevaras Leute Hunderte Kilometer und die Gipfel der Anden.
Schon bald nach seiner Ankunft überwirft sich Che mit Monje wegen der Frage, wer das Unternehmen militärisch leiten soll. Der Comandante unterschätzt den Nationalismus der Genossen: eine bolivianische Guerilla unter kubanischer Führung? Inakzeptabel. Monje entzieht Guevara die Hilfe seiner Partei.
Che muss Kubas Revolution unter viel schlechteren Bedingungen wiederholen: ohne eine Untergrundorganisation, die ihn unterstützt; ohne ein Umfeld, das ihm Männer und Material liefern kann.
Und er muss sich in Geduld üben. Es wird Monate dauern, Jahre vielleicht, um die Kerngruppe aus einem guten Dutzend kampferfahrenen Kubanern sowie rund 30 Bolivianern, einigen Peruanern und Argentiniern zu einer schlagkräftigen Armee auszubauen. Er muss neue Rekruten anwerben. Und auf Hilfe aus Kuba warten.
Die bolivianischen Verhältnisse sind komplizierter als erwartet
Bereits im Januar 1967 entdeckt die bolivianische Armee das Anwesen von Guevaras Gruppe. Noch gehen die Offiziere davon aus, es gehöre Schmugglern, einer Drogenbande vielleicht. In Höhlen vergraben die Guerilleros ihre Medikamente und Waffen, machen Übungen und Erkundungsstreifzüge im Wald, in dem es unablässig von den Bäumen tropft: Es ist Regenzeit.
Die ersten beiden Opfer dieses Krieges fallen nicht im Kampf, sie ertrinken in Gebirgsflüssen. Im März desertieren zwei Bolivianer. Sie verraten der Armee, woher die Männer in den Bergen kommen. Zwar weiß die Regierung nicht, dass der berühmte Che die Gruppe anführt. Doch sie bittet die USA um Hilfe. Wenig später erschießen die Guerilleros einen Soldaten.
Die Armee riegelt das Gebiet ab. Waf- fenlieferungen werden unmöglich. Kuba zieht seinen Verbindungsagenten aus La Paz ab. Fortan sind Guevara und seine Leute auf der Flucht. Die Guerilleros hungern fast ständig, schlachten gelegentlich eines der Pferde oder kaufen bei Bauern ein Schwein. Che keucht unter Asthmaanfällen, die Medikamente sind in den Höhlen im Basislager zurückgeblieben.
Er will eine zweite Front eröffnen, gibt zwei Besuchern eine verschlüsselte Nachricht an Castro mit: Er soll die Kämpfer schicken, außerdem ein neues Funkgerät. Doch die Boten laufen der Armee in die Arme. Und erzählen im Verhör mehr, als sie müssten. So erfährt die Regierung, dass Che Guevara die Guerilla anführt.
Täglich ertönt Propaganda im Radio, attackiert Regierungschef Barrientos die Guerilleros als Agenten des „Castro-Kommunismus“. Erfolgreich stellt er die Aktion als ausländische Invasion dar, misstrauisch begegnen die Bewohner der Gegend den bewaffneten Fremden. Die bolivianischen Verhältnisse sind komplizierter, als die Kubaner gedacht hatten: Die indigenen Bauern warten keineswegs darauf, befreit zu werden, viele von ihnen teilen den Nationalismus der Militärs. Hunderte Soldaten durchkämmen das Gebiet.
In seinem Tagebuch, einem kleinen, grünen Kalender, notiert Guevara in winzigen Buchstaben die Verluste und beklagt die fehlende Unterstützung: „Von einer Mobilisierung der Bauern kann keine Rede sein.“ Er trennt eine Nachhut von seiner Truppe ab, schlägt sich mit den anderen zwei Dutzend Männern allein durch den Wald, mit Macheten müssen sie sich den Weg freihacken. Der Sommer vergeht zwischen schneidend kaltem Wind und unerträglicher Hitze. Den Kontakt zur zweiten Gruppe verlieren sie schnell.
Ohne falsche Bescheidenheit hat Che seine Gruppe Ejército de Liberación Nacio- nal getauft, „Nationale Befreiungsarmee“, und verfasst in ihrem Namen Kommuniqués: „Compañero Bergarbeiter – die Guerilleros der ELN erwarten dich mit geöffneten Armen.“ Dabei hat seine Truppe nur noch ein Ziel: das nackte Überleben.
Ständig suchen die Männer nach Was- ser und Essen, sie streiten, stehlen einander die Kondensmilch. Che bringt selten die Energie auf, ihre Konflikte zu schlichten. Doch er liest und schreibt bis spät in die Nacht, mit einer Stirnlampe. Einmal hält er in einem Dorf vor 15 erstaunten Bauern einen Vortrag über die Ziele der Revolution. Meist jedoch fliehen die Einheimischen, nur mit Gewalt bekommen die Guerilleros Nahrung von ihnen. Sie schießen Papageien und Affen, essen Gürteltiere. Gelegentlich gelingen ihnen Hinterhalte, den gefangenen Soldaten nehmen sie Waffen und Kleider ab.
Guevara führt seine Leute im Zickzack durch ein Gebiet von etwa 200 Kilometer Länge und 100 Kilometer Breite. Selten laufen sie mehr als ein paar Stunden, meist vom Morgen bis zum Nachmittag. Sie durchwaten Bäche, erklimmen Höhen, schicken Kundschafter aus oder treffen auf Spähtrupps der Armee. Die Schlachten der ELN sind Scharmützel mit wenigen Opfern – für Guevaras Gruppe aber ist jeder Tote oder Verwundete ein schwerer Verlust.
Trotzdem gelingen ihr einige spektakuläre Aktionen. Die Kämpfer dringen in eine Garnison ein, setzen die Soldaten außer Gefecht: um in der Apotheke einzukaufen. Allerdings nehmen sie die falschen Medikamente mit – das von Che dringend benötigte Asthmamittel bringen sie nicht mit zurück ins Lager.
Bereits im April sind US-Antiterrorkämpfer in Bolivien gelandet, von der Regierung ebenso begrüßt wie von Che, der davon im Radio erfährt und in seinem Tagebuch notiert: „Vielleicht erleben wir das erste Kapitel eines neuen Vietnam.“ Doch die Amerikaner sollen nur Soldaten ausbilden, Washington verbietet ihnen, das Guerillagebiet zu betreten. Vergebens fordern die Bolivianer Waffen vom US-Botschafter. Die Eskalation bleibt aus.
"Patria o muerte, Vaterland oder Tod"
Anfang August 1967 führen Deserteure die Armee zu den Höhlen, in denen Waffen, Dokumente und Medizin von Ches Truppe versteckt liegen. Der Comandante leidet neben seinem Asthma oft an Durchfall; er verbringt einen ganzen Tag bewusstlos im eigenen Kot, von seinen Männern in einer Hängematte durch das Unterholz getragen, bekommt eine Leberkolik.
Sein Tonbandgerät hat er verloren und kann die verschlüsselten Nachrichten nicht mehr aufnehmen, die ihm Castro über Radio Havanna schickt – und sie deshalb auch nicht mehr decodieren.
Vier Gruppen sind noch an der Operation beteiligt: eine Zelle aus Unterstützern in La Paz, die seit dem Abzug des kubanischen Agenten den Kontakt nach Havanna und damit auch zu den Guerilleros verloren hat; Ches Gruppe, die in totaler Isolation durch den Wald flüchtet; die Nachhut, die weder mit Che noch mit der Außenwelt in Verbindung steht. Und die kubanische Regierung, die nur noch aus Zeitungen und dem Radio erfährt, was in Bolivien vor sich geht.
Ende August gerät die Nachhut in einen Hinterhalt. Die Regierung lässt die Leichen ausstellen und dann verscharren. Zunächst hält Che die im Radio verbreitete Nachricht für Propaganda. Auf der Flucht und noch immer in der Hoffnung, wieder auf die andere Gruppe zu treffen, verstößt er gegen fast alle Regeln des Guerillakriegs: Er führt seine Männer oft durch offenes Gelände, ohne zu wissen, was vor und hinter ihm geschieht, ohne Hilfe der Einheimischen – und obwohl die Armee seinen Weg kennt.
Immer hat er gepredigt, wie gut Guerilleros ihr Gebiet kennen müssten. Seinen Leuten aber ist das von tiefen Schluchten durchzogene Terrain fremd geblieben. Selbst die Bolivianer im Team stammen aus anderen Teilen des Landes.
Guevara hat in den Jahren zuvor häufig davon gesprochen, dass ein Guerillero zum Sterben bereit sein müsse, zum größtmöglichen Opfer. Patria o muerte, Vaterland oder Tod. „In einer Revolution siegt man, oder man stirbt.“
Immer enger zieht sich der Ring der Soldaten um Che Guevaras Gruppe. Die US-Spezialisten haben ein Ranger-Bataillon der bolivianischen Armee ausgebildet, haben den Rekruten unter anderem beigebracht, sich nachts zu bewegen, Sprengfallen zu erkennen, im Nahkampf zu bestehen. Nun landen die Ranger im Guerillagebiet. Mit den anderen Einheiten wetteifern sie darum, wer den Comandante zur Strecke bringen wird.
Bolivien befiehlt seinen Tod, die USA schauen zu
Am Morgen des 8. Oktober 1967 führt Guevara seine verbliebenen 16 Kämpfer durch eine tiefe Schlucht in der Nähe des Dorfes La Higuera. Da sehen sie auf einer Hügelkette Soldaten: Ein Bauer hat ihre Position verraten. Sie sitzen in der Falle. Einige Stunden lang belauern sich die Gegner. Dann wagen sich einige von Guevaras Männern aus der Deckung – die Soldaten beschießen sie mit Mörsern und Maschinengewehren. Die Eingekesselten verlieren sich aus den Augen.
Che versteckt sich in einem Kartoffelfeld hinter einem Felsen und feuert. Eine Einheit klettert in die Schlucht hinunter, im Schusswechsel versucht der Comandante, die Felswand zu erklettern, eine Maschinengewehrsalve trifft ihn im Bein, eine Kugel zerstört sein Gewehr. Ein bolivianischer Mitstreiter schleppt ihn aus der Schusslinie, da tritt ein Feldwebel vor die beiden Guerilleros und richtet seine Waffe auf sie.
Guevara hat keine Wahl, als sich zu ergeben. Seine Kleider hängen in Fetzen, um die Füße hat er Lederbandagen gewickelt, sein Haar ist verfilzt. Ein herbeigerufener Offizier fragt ihn, wie er heißt. Und der Mann, der in den vergangenen Monaten nur „Comandante Ramón“ war, nennt seinen richtigen Namen.
Das Gefecht geht noch einige Stunden weiter, dann ist die bolivianische Revolution zu Ende. Der Gefangene wird in die Schule von La Higuera gebracht. Ein Offizier verhört ihn, am nächsten Morgen auch ein CIA-Agent, der das Tagebuch und andere Dokumente abfotografiert.
Was anschließend geschieht, ist nicht mehr zu klären, die Berichte der Anwesenden widersprechen sich. Sicher ist: Mittags kommt der Befehl aus La Paz, Che zu töten. Die bolivianische Regierung fürchtet die politischen Folgen eines Prozesses. Die USA tun nichts, um Guevaras Tod zu verhindern, obwohl die Nachricht von seiner bevorstehenden Hinrichtung sie rechtzeitig erreicht.
Der Feldwebel Mario Terán meldet sich freiwillig. Er hat beim Gefecht am Tag zuvor drei Kameraden verloren. Terán betritt das Klassenzimmer, weist den gefesselten Guerillero an, sich hinzusetzen. „Nein, ich bleibe dafür stehen“, entgegnet Guevara. Und dann noch: „Sie töten einen Menschen.“ Terán zögert, dann hebt er sein Gewehr und drückt ab.
Guevara, an Armen und Beinen getroffen, windet sich vor Schmerzen am Boden, beißt sich ins Handgelenk, wohl, um nicht zu schreien. Dann schießt ihm sein Henker in die Brust. Ernesto Guevara de la Serna, „El Che“, stirbt am 9. Oktober 1967 um 13.10 Uhr, im Alter von 39 Jahren.
Am Nachmittag wird seine Leiche auf einer Bahre an die Kufen eines Helikopters geschnallt, dann in die nächste größere Stadt Vallegrande geflogen, zurechtgemacht und der Öffentlichkeit präsentiert, um jeden Zweifel am Tod des berühmten Revolutionshelden auszuräumen. Anschließend verschwindet sie 30 Jahre lang: Erst 1997 wird man Guevaras Überreste neben der Landebahn wiederfinden.
Boliviens Regierung, die ihn verscharrt, um ihn loszuwerden, um keinen Wallfahrtsort zu schaffen, erreicht genau das Gegenteil: Sie macht Che unsterblich. Die Bilder seiner heiligengleichen Gestalt gehen um die Welt. Er, der viele Vietnam schaffen wollte, wird zur Ikone einer Jugendbewegung, die in Washington, Paris, Berlin gegen den Krieg protestiert.
Von Ernesto Guevara bleibt Che, der Mythos. Die sanften Augen, die dunklen Haare, der Ausspruch „Hasta la victoria siempre“, eine diffuse Revolutionsromantik. Dass er brutal war und rücksichtslos, dass er die Menschheit in einen dritten Weltkrieg gestürzt hätte, wenn er gekonnt hätte, dass er Männer eigenhändig hingerichtet hat – all das verblasst vor seinem Sterben. Davor, dass er bereit war, für seine Sache in den Tod zu gehen.