Leseprobe
INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
ZUSAMMENFASSUNG
ABSTRACT
EINLEITUNG
THEORETISCHER TEIL
1. DIE PANIKSTÖRUNG
1.1. DEFINITION UND DIAGNOSEKRITERIEN
1.2. EPIDEMIOLOGIE UND VERLAUF
1.3. NEUROBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN VON PANIKATTACKEN
1.4. PSYCHOPHYSIOLOGISCHE BESONDERHEITEN DER PANIKSTÖRUNG
2. PSYCHOPHYSIOLOGISCHE GRUNDLAGEN
2.1. EVOZIERTE POTENTIALE
2.1.1. P3 UND POSITIVE SLOW WAVE (PSW)
2.1.2. CONTINGENT NEGATIVE VARIATION (CNV)
2.2. STARTLE -REFLEX
2.3. HAUTLEITFÄHIGKEIT
3. EMOTIONSTHEORIEN
3.1. ÜBERSICHT
3.2. DIE EMOTIONSTHEORIE VON LANG
3.2.1. GRUNDLAGEN
3.2.2. METHODIK
3.2.3. BEFUNDE ZUR EMOTIONALEN BILDBETRACHTUNG BEI GESUNDEN PERSONEN
3.2.4. BEFUNDE ZUR VERARBEITUNG EMOTIONALER REIZE BEI HOCHÄNGSTLICHEN PERSONEN UND PERSONEN MIT ANGSTSTÖRUNGEN
4. THEORIEN ZUR ENTSTEHUNG DER PANIKSTÖRUNG
4.1. KONDITIONIERUNGSTHEORIEN
4.1.1. THEORETISCHE GRUNDLAGEN
4.1.2. BEFUNDE ZUR DEN KONDITIONIERUNGSTHEORIEN
4.2. KOGNITIVE THEORIEN
4.2.1. THEORETISCHE GRUNDLAGEN
4.2.2. BEFUNDE ZU DEN KOGNITIVEN THEORIEN
4.3. DIE THEORIE DER ANXIETY SENSITIVITY
5. DER COVARIATION BIAS
5.1. BEGRIFFSBESTIMMUNG UND THEORETISCHER HINTERGRUND
5.2. DAS PARADIGMA DER ILLUSORISCHEN KORRELATION : BEFUNDE
5.2.1. COVARIATION BIAS BEI HOCHÄNGSTLICHEN PROBANDEN UND ANGSTPATIENTEN
5.2.2. COVARIATION BIAS UND STARTLE-REFLEX
5.3. COVARIATION BIAS UND CONTINGENT NEGATIVE VARIATION (CNV)
5.3.1. BEFUNDE ZUR CNV BEI ANGSTPATIENTEN
5.3.2. BEFUNDE ZUM ZUSAMMENHANG VON COVARIATION BIAS UND CNV
6. RISIKOFAKTOREN FÜR ENTSTEHUNG UND VERLAUF DER PANIKSTÖRUNG
6.1. ÜBERBLICK ÜBER MÖGLICHE RISIKOFAKTOREN
6.2. ANXIETY SENSITIVITY ALS RISIKOFAKTOR FÜR ENTSTEHUNG UND VERLAUF DER PANIKSTÖRUNG
6.2.1. DER ANXIETY SENSITIVITY INDEX (ASI)
6.2.2. ZUSAMMENHANG ZWISCHEN ANXIETY SENSITIVITY UND PANIKATTACKEN
6.2.3. ANXIETY SENSITIVITY ALS PRÄDIKTOR FÜR PANIKATTACKEN BEI GESUNDEN
6.2.4. ANXIETY SENSITIVITY ALS PRÄDIKTOR FÜR DEN VERLAUF DER PANIKSTÖRUNG
6.2.5. DIE ROLLE DER ANXIETY SENSITIVITY BEI DER REAKTION AUF STREßINDUKTION UND PANIKPROVOKATION
6.2.6. PARALLELEN ZWISCHEN HOHER ANXIETY SENSITIVITY UND PANIKATTACKEN
6.2.6.1. Kognitive Verarbeitungsprozesse bei hoher Anxiety Sensitivity
6.2.6.2. Beeinflussung von Anxiety Sensitivity durch Therapie
6.2.7. ZUSAMMENFASSUNG
6.3. NICHT - KLINISCHE PANIKATTACKEN ALS RISIKOFAKTOR FÜR DIE PANIKSTÖRUNG
6.3.1. KOGNITIVE VERARBEITUNGSPROZESSE BEI PERSONEN MIT NICHT-KLINISCHER PANIK
6.3.2. REAKTION AUF STREßINDUKTION UND PANIKPROVOKATION BEI PERSONEN MIT NICHT- KLINISCHER PANIK
6.3.3. ZUSAMMENFASSUNG
7. ZIELSETZUNG UND ALLGEMEINE HYPOTHESEN
EMPIRISCHER TEIL
8. VORVERSUCH : MODULATION PSYCHOPHYSIOLOGISCHER VARIABLEN DURCH EMOTIONALE B ILDREIZE BEI GESUNDEN PROBANDEN
8.1. ZIELSETZUNG
8.2. METHODIK
8.2.1. REKRUTIERUNG DER VERSUCHSTEILNEHMER
8.2.2. VERSUCHSMATERIAL
8.2.3. VERSUCHSABLAUF UND VERSUCHSDESIGN
8.2.4. AUFZEICHNUNG UND VORAUSWERTUNG DER PSYCHOPHYSIOLOGISCHEN DATEN
8.2.5. STATISTISCHE ANALYSE
8.3. HYPOTHESEN
8.4. ERGEBNISSE
8.4.1. BESCHREIBUNG DER VERSUCHSTEILNEHMER
8.4.2. VALENZ- UND AROUSALRATINGS UND BETRACHTUNGSZEIT
8.4.3. EEG-DATEN
8.4.4. STARTLE-REFLEX
8.4.5. SCR
8.4.6. KORRELATIONEN ZWISCHEN SUBJEKTIVEN UND PSYCHOPHYSIOLOGISCHEN VARIABLEN
8.5. ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION
9. HAUPTVERSUCH I: VERARBEITUNG EMOTIONALER REIZE BEI RISIKOGRUPPEN FÜR DIE PANIKSTÖRUNG
9.1. ZIELSETZUNG
9.2. METHODIK
9.2.1. REKRUTIERUNG DER VERSUCHSTEILNEHMER
9.2.2. AUSWAHLKRITERIEN
9.2.3. VERSUCHSMATERIAL
9.2.4. VERSUCHSABLAUF UND VERSUCHSDESIGN
9.2.5. AUFZEICHNUNG UND VORAUSWERTUNG DER PSYCHOPHYSIOLOGISCHEN DATEN
9.2.6. STATISTISCHE ANALYSE
9.3. HYPOTHESEN
9.4. ERGEBNISSE
9.4.1. BESCHREIBUNG DER VERSUCHSTEILNEHMER
9.4.2. ASI-DATEN
9.4.3. TRAIT-VARIABLEN
9.4.4. ALLGEMEINE UND KÖRPERBEZOGENE ÄNGSTE WÄHREND DES VERSUCHS
9.4.5. VALENZRATINGS
9.4.6. AROUSALRATINGS
9.4.7. BETRACHTUNGSZEIT
9.4.8. HÄUFIGKEIT DER BILDER UND UNANGENEHMHEIT DES STARTLE-TONS
9.4.9. KOVARIATIONSSCHÄTZUNGEN
9.4.10. EEG
9.4.11. STARTLE-REFLEX
9.4.12. SCR
9.5. ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION
9.5.1. FRAGEBOGENDATEN
9.5.2. SUBJEKTIVE MAßE ZU DEN EINZELNEN BILDKATEGORIEN
9.5.3. PSYCHOPHYSIOLOGISCHE MAßE
9.5.4. FAZIT
10. HAUPTVERSUCH II: VERÄNDERTE ZUSAMMENHANGSERWARTUNGEN FÜR PANIKRELEVANTE REIZE BEI PANIKPATIENTEN
10.1. ZIELSETZUNG
10.2. METHODIK
10.2.1. REKRUTIERUNG DER VERSUCHSTEILNEHMER UND AUSWAHLKRITERIEN
10.2.2. VERSUCHSMATERIAL
10.2.3. VERSUCHSABLAUF UND VERSUCHSDESIGN
10.2.4. AUFZEICHNUNG UND VORAUSWERTUNG DER PSYCHOPHYSIOLOGISCHEN DATEN
10.2.5. STATISTISCHE ANALYSE
10.3. HYPOTHESEN
10.4. ERGEBNISSE
10.4.1. BESCHREIBUNG DER VERSUCHSTEILNEHMER
10.4.2. EXPECTANCY RATINGS
10.4.3. ERSTER BLOCK
10.4.3.1. Häufigkeit der Bilder und Unangenehmheit des Startle-Tons
10.4.3.2. Kovariationsschätzungen
10.4.3.3. EEG-Daten
10.4.3.4. Startle-Reflex
10.4.3.5. SCR-Kennwerte
10.4.4. ZWEITER BLOCK
10.4.4.1. Häufigkeit der Bilder und Unangenehmheit des Startle-Tons
10.4.4.2. Kovariationsschätzungen
10.4.4.3. EEG-Daten
10.4.4.4. Peripherphysiologische Daten
10.4.5. DRITTER BLOCK
10.4.5.1. Häufigkeit der Bilder und Unangenehmheit des Startle-Tons
10.4.5.2. Kovariationsschätzungen
10.4.5.3. EEG-Daten
10.4.5.4. Peripherphysiologische Daten
10.5. ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION
10.5.1. ERSTER BLOCK
10.5.2. ZWEITER UND DRITTER BLOCK
10.5.3. METHODISCHE GESICHTSPUNKTE
10.5.4. FAZIT
11. A LLGEMEINE DISKUSSION UND AUSBLICK
11.1. RELEVANZ DER STUDIENERGEBNISSE
11.2. GRENZEN UND METHODISCHE KRITIKPUNKTE DER STUDIEN
11.3. AUSBLICK
12. LITERATURVERZEICHNIS
ANHANG
ANHANG 1: VERGLEICH DER SELBSTENTWICKELTEN ASI-VERSION MIT DER VERSION VON MARGRAF UND E HLERS (1993 A )
ANHANG 2: ÜBERPRÜFUNG VON GESCHLECHTSEFFEKTEN IM HAUPTVERSUCH I
ANHANG 3: INSTRUKTIONEN DER DREI VERSUCHE
ANHANG 4: VERWENDETES BILDMATERIAL
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Beispiel für die Self-Assessment-Manikin (SAM)-Skalen Valenz und Arousal
Abbildung 2: EEG-Verlauf für positive, neutrale und negative Bilder bei den Midline- und den lateralen Elektroden
Abbildung 3: T-transformierte Startle-Magnituden bei positiven, neutralen und negativen Bildern
Abbildung 4: Log-transformierte SCR-Amplituden bei positiven, neutralen und negativen Bildern
Abbildung 5: EEG-Verlauf in den ersten 2 s nach Bildonset für die vier Versuchsbedingungen in der Gruppe AS-n, einzeln für die neun verwendeten Elektroden
Abbildung 6: EEG-Verlauf in den ersten 2 s nach Bildonset für die vier Versuchsbedingungen in der Gruppe AS-h, einzeln für die neun verwendeten Elektroden
Abbildung 7: EEG-Verlauf in den ersten 2 s nach Bildonset für die vier Versuchsbedingungen in der Gruppe AS-P, einzeln für die neun verwendeten Elektroden
Abbildung 8: T-transformierte Startle-Magnituden für die Baseline und die vier Bildkategorien, getrennt für die Gruppen AS-n, AS-h und AS-P
Abbildung 9: Log-transformierte SCR-Amplituden für die vier Bildkategorien, getrennt für die Gruppen AS-n, AS-h und AS-P
Abbildung 10: EEG-Verlauf in den sechs Sekunden der Bilddarbietung für die drei Bildkategorien in der Patientengruppe
Abbildung 11: EEG-Verlauf in den sechs Sekunden der Bilddarbietung für die drei Bildkategorien in der Kontrollgruppe
Abbildung 12: T-transformierte Startle-Magnituden für Pilz-, Spinnen- und Notfallbilder im ersten Block, getrennt für Patienten und Kontrollpersonen
Abbildung 13: Log-transformierte Third Interval Omission Response (TOR)- Amplituden für Pilz-, Spinnen- und Notfallbilder im ersten Block, getrennt für Patienten und Kontrollpersonen
Abbildung 14: Log-transformierte TOR-Amplituden nach Pilz-, Spinnen- und Notfallbildern im zweiten Block, jeweils für die Spinnen- und Notfallgruppe innerhalb der Patienten bzw. der Kontrollper- sonen.
Abbildung 15: Log-transformierte TOR-Amplituden nach Pilz-, Spinnen- und Notfallbildern im dritten Block, getrennt für die Spinnen- und Notfallgruppe innerhalb der Patienten bzw. der Kontroll- personen
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Mittlere Valenz- und Arousalwerte (berechnet aus den IAPS-Normwerten) für die im Vor- versuch verwendeten positiven, neutralen und negativen Bilder
Tabelle 2: Valenz- und Arousalratings (Skala jeweils von 1 bis 9) sowie Betrachtungszeit (in Sekunden) für positive, neutrale und negative Bilder
Tabelle 3: Übersicht über die varianzanalytische Auswertung der einzelnen EEG-Abschnitte für die Midline- und die lateralen Elektroden
Tabelle 4: Mittlere Valenz- und Arousalwerte der in Hauptversuch I verwendeten positiven, neutralen, negativen und panikrelevanten Bilder
Tabelle 5: ASI-Mittelwerte der drei Versuchsgruppen in der Vorerhebung (ASI-1) und während des Versuchs (ASI-2).
Tabelle 6: Ergebnisse der Trait-Fragebögen ACQ-T, BSQ-T und SCL-90-r (Gesamtwert GSI)
Tabelle 7: Ergebnisse der während des Versuchs erhobenen State-Fragebögen
Tabelle 8: Übersicht über die Mittelwerte der Valenzratings (invertiert) für die jeweiligen Versuchs- bedingungen, getrennt für die drei Versuchsgruppen
Tabelle 9: Übersicht über die Mittelwerte der Arousalratings (invertiert) für die jeweiligen Versuchs- bedingungen, getrennt für die drei Versuchsgruppen
Tabelle 10: Übersicht über die Mittelwerte der Betrachtungszeit (in Sekunden) für die jeweiligen Ver- suchsbedingungen, getrennt für die drei Versuchsgruppen
Tabelle 11: Geschätzte Häufigkeit der Bilder (Skala von 0 bis 100) und Beurteilung der Unangenehm- heit des Startle-Tons (Skala von 0 bis 10) in den vier Bildkategorien, getrennt für die drei Versuchs- gruppen
Tabelle 12: Geschätzte Häufigkeit des Startle-Tons bei den Bildern der vier Bildkategorien (Skala von 0 bis 100), getrennt für die drei Versuchsgruppen
Tabelle 13: Übersicht über die varianzanalytische Auswertung der einzelnen EEG-Abschnitte und der P3
Tabelle 14: Mittlere Valenz- und Arousalwerte der drei im Hauptversuch II verwendeten Bildkategorien
Tabelle 15: Erwartete Häufigkeit des Startle-Tons für die drei Bildkategorien (Skala von 1 bis 100), getrennt für Patienten und Kontrollpersonen.
Tabelle 16: Schätzung der Häufigkeit der Bilder (Skala von 1 bis 100) und Beurteilung der Unange-nehmheit des Startle-Tons (Skala von 1 bis 10) für die drei Bildkategorien nach dem ersten Block, getrennt für Patienten und Kontrollpersonen
Tabelle 17: Geschätzte Häufigkeit des Startle-Tons für die drei Bildkategorien (Skala von 1 bis 100) nach dem ersten Block, getrennt für Patienten und Kontrollpersonen
Tabelle 18: Übersicht über die varianzanalytische Auswertung der frühen und späten CNV-Komponente sowie der P3 im ersten Block.
Tabelle 19: Log-transformierte First Interval Response (FIR) und Unconditioned Response (UCR) für die drei Bildkategorien im ersten Block, getrennt für Patienten und Kontrollpersonen
Tabelle 20: Schätzung der Häufigkeit der Bilder (Skala von 1 bis 100) und Beurteilung der Unange- nehmheit des Startle-Tons (Skala von 1 bis 10) für die drei Bildkategorien nach dem zweiten Block, getrennt für die Spinnen- und Notfallgruppe innerhalb der Patienten bzw. der Kontrollpersonen
Tabelle 21: Geschätzte Häufigkeit des Startle-Tons für die drei Bildkategorien (Skala von 1 bis 100) nach dem zweiten Block, getrennt für die Spinnen- und die Notfallgruppe innerhalb der Patienten bzw. der Kontrollpersonen
Tabelle 22: Übersicht über die varianzanalytische Auswertung der frühen und späten CNV-Komponente sowie der P3 im zweiten Block
Tabelle 23: Mittelwerte von Startle-Reflex-Magnituden (T-transformiert), FIR- und UCR-Amplituden (log-transformiert) für die drei Bildkategorien im zweiten Block, getrennt für die Spinnen- und Not- fallgruppe innerhalb der Patienten bzw. der Kontrollpersonen.
Tabelle 24: Schätzung der Häufigkeit der Bilder (Skala von 1 bis 100) sowie Beurteilung der Unange-nehmheit des Startle-Tons (Skala von 1 bis 10) für die drei Bildkategorien nach dem dritten Block, getrennt für die Spinnen- und Notfallgruppe innerhalb der Patienten bzw. der Kontrollpersonen
Tabelle 25: Schätzung der Häufigkeit des Startle-Tons nach den drei Bildkategorien (Skala von 1 bis 100) nach dem dritten Block, getrennt für die Spinnen- und die Notfallgruppe innerhalb der Patienten bzw. der Kontrollpersonen
Tabelle 26: Übersicht über die varianzanalytische Auswertung der frühen und späten CNV-Komponente und der P3 im dritten Block.
Tabelle 27: Mittelwerte von FIR- und UCR-Amplituden (log-transformiert) für die drei Bildkategorien im dritten Block, jeweils für die Spinnen- und Notfallgruppe innerhalb der Patienten bzw. der Kontroll- personen
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zusammenfassung
Ziel der vorliegenden Dissertation war es, Besonderheiten bei der Verarbeitung emotionaler Bild-reize bei Panikpatienten und bei Risikogruppen für die Panikstörung zu untersuchen. Eine Vorun-tersuchung zeigte, daß sich die Reaktionen gesunder Probanden auf emotional positive, neutrale und negative Bilder anhand von subjektiven Ratings und anhand von elektrokortikalen (P3, lang-same positive Potentiale) und peripherphysiologischen Maßen (Startle-Reflex, SCR) unterscheiden lassen.
In einer ersten Studie wurden daher untersucht, ob sich Personen mit einem erhöhten Risiko für die Panikstörung (Personen mit hoher Anxiety Sensitivity sowie Personen mit hoher Anxiety Sensitivity und nicht-klinischen Panikattacken) und gesunde Vergleichspersonen mit niedriger Anxiety Sensitivity in ihren Reaktionen auf emotionale Bilder unterscheiden. Neben positiven, neutralen und negativen Bildern wurden auch panikrelevante Bilder (medizinische Notfallsituationen) darge-boten. Nur panikrelevante Bilder wurden von beiden Gruppen mit hoher Anxiety Sensitivity als ne-gativer und höher erregend eingeschätzt als von der Kontrollgruppe. Personen mit nicht-klinischen Panikattacken zeigten spezifisch für panikrelevante Bilder eine stärkere SCR als die beiden ande-ren Gruppen. Für Startle-Reflex und EEG-Parameter wurden dagegen keine spezifischen Unter-schiede zwischen den Gruppen gefunden. Diese Ergebnisse sprechen für eine abweichende Ver-arbeitung panikrelevanter Reize in beiden Risikogruppen, die sich jedoch deutlicher bei Personen mit nicht-klinischen Panikattacken, und deutlicher in subjektiven als in psychophysiologischen Ma-ßen zeigt.
Da verschiedene Studien nachweisen konnten, daß Angstpatienten nach angstbezogenen Reizen verstärkt negative Konsequenzen erwarten, wurde dieser sogenannte „Covariation Bias“ in einer weiteren Studie bei Panikpatienten untersucht. Den Probanden wurden panikrelevante Notfallbil-der, neutrale Pilzbilder und phobierelevante Spinnenbilder dargeboten, die in 50 % der Fälle von einem unangenehmen Ton gefolgt waren. Panikpatienten zeigten im Vergleich zur Kontrollgruppe zwar keine subjektive Überschätzung der unangenehmen Konsequenz nach panikrelevanten Bil-dern, wiesen jedoch für diese Bilder eine erhöhte CNV auf, die als psychophysiologischer Indikator der Erwartung angesehen wird. Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, daß Panikpatienten auf psychophysiologischer Ebene eine abweichende Verarbeitung panikrelevanter Reize aufweisen. Diese konnte jedoch möglicherweise in den subjektiven Maßen nur unzureichend abgebildet wer-den, da Zusammenhangsschätzungen nur jeweils am Ende eines Durchgangs erhoben wurden.
Zusammenfassend zeigen die in dieser Dissertation beschriebenen Studien, daß Panikpatienten und Personen mit einem erhöhten Risiko für die Panikstörung auf panikrelevante Reize stärker reagieren als gesunde Vergleichspersonen bzw. Personen mit niedriger Anxiety Sensitivity. Eine Zielsetzung für zukünftige Studien könnte sein, zu untersuchen, inwieweit die gefundenen Beson-derheiten als Prädiktoren für den Verlauf der Panikstörung, den Therapieerfolg und den Beginn einer Panikstörung bei Risikogruppen geeignet sind.
Abstract
The aim of the present dissertation was to examine particularities in the processing of emotional picture stimuli in panic disorder patients and risk groups for panic disorder. A pre-study with healthy participants showed that their reactions to emotionally positive, neutral and negative pictures can be differentiated on the basis of subjective ratings, electrocortical (P3, slow positive potentials) and peripheral physiological measures (startle reflex, SCR).
Therefore, the aim of the first study was to examine whether subjects with an increased risk for panic disorder (subjects with high anxiety sensitivity, and subjects with high anxiety sensitivity and non-clinical panic attacks) and healthy control subjects with low anxiety sensitivity differ in their reactions to emotional stimuli. Aside from positive, neutral and negative pictures, panic-relevant pictures (medical emergency situations) were presented to the subjects. Only panic-relevant pictures were rated as more negative and more arousing by both groups with high anxiety sensitivity, compared to the control group. Subjects with non-clinical panic attacks showed a higher SCR than both other groups specifically for panic-relevant pictures. For startle reflex and EEG parameters, no specific differences between groups were found. These results support the idea of an altered processing of panic-relevant stimuli in both risk groups; yet, this alteration is more pronounced in subjects with non-clinical panic attacks, and more pronounced for subjective than for psychophysi-ological measures.
As several studies have shown that anxiety disorder patients have an elevated expectancy of negative consequences after fear-relevant stimuli, this "covariation bias" was examined in a further study with panic disorder patients. Panic-relevant medical emergency pictures, neutral mushroom pictures and phobia-relevant spider pictures were presented to the subjects, with half of the pictures of each category being followed by an unpleasant startle sound. Panic patients, as compared to control subjects, did not show a subjective overestimation of the unpleasant consequence after panic-relevant pictures, but revealed a higher CNV amplitude - considered as a psychophysiologi-cal indicator of expectancy - for these pictures. These findings indicate that, on a psychophysi-ological level, panic patients show an altered processing of panic-relevant stimuli. This altered processing was possibly only insufficiently reflected in subjective measures because covariation estimates were registered only at the end of each run.
Taken together, the studies described in this dissertation show that panic patients and individuals with an elevated risk for panic disorder react more intensely to panic-relevant stimuli than healthy controls or individuals with low anxiety sensitivity. A direction for future studies could be to examine if these particularities can serve as predictors for the course of panic disorder, for treatment outcome, and for the onset of panic disorder in risk groups.
Einleitung
Die Panikstörung ist eine typische Angsterkrankung, die wie andere Angststörungen Veränderun-gen bei der Verarbeitung emotionaler Reize nach sich zieht, die wiederum zur Aufrechterhaltung der Erkrankung beitragen können. Im Unterschied zu anderen Angsterkrankungen handelt es sich bei der Panikstörung jedoch um eine relativ schwere Störung, die, wenn sie nicht frühzeitig erkannt und adäquat behandelt wird, einen ungünstigen Verlauf nehmen kann. Somit ist es besonders wich-tig, detaillierte Kenntnisse über die Panikstörung sowie über Mechanismen, die deren Entstehung und Verlauf beeinflussen, zu erlangen.
Besonderheiten bei der Reaktion auf panikbezogene Reize, auf Streß oder auf die Provokation von Panikattacken wurden sowohl bei Panikpatienten als auch bei Personen mit einem erhöhten Risiko für die Panikstörung in verschiedenen Studien untersucht. Eine wichtige Rolle bei der Erforschung von Besonderheiten bei der Reizverarbeitung in diesen Personengruppen kommt psychophysiologi-schen Maßen zu. Diese können, in Ergänzung zu subjektiven Berichten, Aufschluß über neurophy-siologische und peripherphysiologische Auffälligkeiten bei der Verarbeitung emotionaler bzw. pa-nikbezogener Reize geben. Psychophysiologische Maße sind zum einen möglicherweise ein sensib-lerer Indikator emotionaler Prozesse als verbale Berichte, zum anderen könnten sie mit den körper-lichen Vorgängen, die bei Panikattacken stattfinden, in Zusammenhang stehen.
Das Auffinden von subjektiven und psychophysiologischen Besonderheiten bei der Verarbeitung panikrelevanter Reize, welches Thema der vorliegenden Dissertation ist, kann eine wichtige Grund-lage dafür darstellen, Prädiktoren für Krankheitsentstehung und -verlauf sowie für Bedingungsfak-toren des Therapieerfolgs bei Panikpatienten und Personen mit einem erhöhten Risiko für die Pa-nikstörung in längsschnittlich angelegten Studien aufzudecken.
Im theoretischen Teil dieser Dissertation werden die theoretischen Grundlagen der drei empirischen Untersuchungen erläutert. Zunächst werden die Diagnosekriterien der Panikstörung, epidemiologi-sche Fakten sowie neurobiologische und psychophysiologische Besonderheiten der Panikstörung dargestellt (Kapitel 1). Anschließend werden psychophysiologische Meßmethoden und Parameter erklärt, die für diese Arbeit von Bedeutung sind (Kapitel 2). Emotionstheorien, insbesondere die Emotionstheorie von Lang, die für die Konzeption der Versuche eine wichtige Rolle spielt, werden in Kapitel 3 beschrieben. In Kapitel 4 folgen die wichtigsten Theorien zur Entstehung und Auf-rechterhaltung der Panikstörung: Konditionierungstheorien, kognitive Theorien und die Theorie der Anxiety Sensitivity. Das Konzept des Covariation Bias, einer kognitiven Besonderheit bei der Ver-arbeitung angstrelevanter Reize, die in dieser Dissertation näher untersucht wurde, wird in Kapitel 5 erläutert. Weiterhin werden mögliche Risikofaktoren für die Entstehung der Panikstörung beschrie-ben (Kapitel 6), wobei nach einem allgemeinen Überblick näher auf die beiden für diese Dissertation wichtigsten Risikofaktoren (erhöhte Anxiety Sensitivity und nicht-klinische Panikattacken) ein-gegangen wird. Schließlich wird ein Überblick über die Zielsetzung und die allgemeinen Hypothe-sen der empirischen Arbeiten gegeben (Kapitel 7). Im empirischen Teil wird zunächst ein Vorver-such beschrieben, in dem die Auswirkungen emotionaler Bildreize auf EEG, Startle-Reflex und Hautleitfähigkeit bei gesunden Probanden untersucht wurden (Kapitel 8). Der erste Hauptversuch, in dem es um die Verarbeitung emotionaler Bildreize bei Personen mit unterschiedlich hohem Risi-ko für die Panikstörung (Personen mit niedriger und hoher Anxiety Sensitivity sowie Personen mit Panikattacken in der Vorgeschichte und hoher Anxiety Sensitivity) ging, wird in Kapitel 9 darges-tellt. Anschließend wird der zweite Hauptversuch, in dem subjektive und psychophysiologische Korrelate des Covariation Bias bei Panikpatienten untersucht wurden, beschrieben (Kapitel 10). Die Kapitel 8, 9 und 10 setzen sich jeweils aus den Unterpunkten Zielsetzung, Methoden, Ergebnisse, sowie einer Zusammenfassung und Diskussion zusammen. In Kapitel 11 werden die Ergebnisse der drei Untersuchungen nochmals in Bezug auf die Literatur diskutiert. Weiterhin wird hier ein Aus-blick auf die Implikationen der Ergebnisse für Prävention und Intervention der Panikstörung sowie auf weitere mögliche Untersuchungen gegeben.
Theoretischer Teil
1. Die Panikstörung
Nach Margraf und Schneider (1996) leitet sich der Begriff „Panik“ vom Namen des griechischen Gottes Pan ab, der bei gelegentlichen Wutanfällen Menschen und Vieh in panischen Schrecken ver-setzte. Die Symptome der Panikstörung sind ebenfalls schon seit dem Altertum bekannt. Die Krankheit galt lange als kaum behandelbar, und wird auch heute noch als eine schwere Störung angesehen, die langfristig ohne adäquate Behandlung einen eher ungünstigen Verlauf nimmt und zu einer starken Beeinträchtigung der Lebensqualität führt (Margraf & Schneider, 1996). Problema-tisch ist ebenfalls, daß die vielfältigen körperlichen Symptome häufig zu einer Fehldiagnose mit Annahme einer organischen Ursache und somit zu falscher Behandlung führen.
Erst in den achtziger Jahren wurde das Paniksyndrom zu einem zentralen Gegenstand der For-schung, was auch die Entwicklung adäquater Behandlungsansätze förderte. Weitreichende Verände-rungen ergaben sich durch die Abgrenzung von Panikattacken von anderen Formen der Angst, die im DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, dritte Auflage; American Psychiatric Association [APA], 1980) vollzogen wurde, und durch die Erfassung der Auftretenshäufig-keit und Auftretensbedingungen der Panikstörung in groß angelegten epidemiologischen Studien, wie z. B. im Epidemiological Catchment Area Programm (Weissmann, Leaf, Blazer, Boyd & Florio, 1986) in den USA oder der Münchner Follow-Up-Studie (Wittchen, 1986) in Deutschland. Zu-dem trug die Entwicklung kognitiv-verhaltenstherapeutischer Techniken für die Panikstörung (z. B. Margraf & Ehlers, 1986) zu einer Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten bei.
1.1. Definition und Diagnosekriterien
Zentrales Kriterium der Panikstörung ist nach DSM-IV (APA, 1994) das wiederkehrende Auftreten unerwarteter, plötzlich einsetzender, zeitlich umgrenzter Episoden starker Angst (sogenannter Pa-nikanfälle), die mit unangenehmen körperlichen Symptomen einhergehen. Weiterhin umfaßt die Definition im DSM-IV kognitive Symptome, die mit der Interpretation der Anfälle zusammenhän-gen, sowie bedeutsame Verhaltensänderungen.
Im einzelnen lauten die DSM-VI-Kriterien für die Panikstörung:
I. Es treten wiederholte, unerwartete Panikattacken auf.
II. Es kommt zu einer deutlichen psychosozialen Beeinträchtigung aufgrund der Panikatta-cken. Entweder besteht die anhaltende Sorge, an einer schweren körperlichen Erkran-kung zu leiden, oder beständige Angst vor dem erneuten Auftreten von Angstanfällen, oder es kommt zu einer deutlichen Verhaltensänderung aufgrund der Attacken (Vermei-dung von Orten oder Aktivitäten).
III. Bei einer Attacke beginnen die Symptome plötzlich und erreichen innerhalb weniger Minuten einen Höhepunkt.
IV. Während einer Attacke treten mindestens vier körperliche Symptome auf (aus einer Lis-te von 13 möglichen Symptomen, wie z. B. Herzrasen, Atembeschwerden, Magen-Darm-Beschwerden).
V. Die Symptome sind nicht die physiologische Folge einer Substanz oder eines medizini-schen Krankheitsfaktors.
Eine Panikstörung liegt dann vor, wenn diese Kriterien innerhalb des letzten Monats erfüllt sind. Die Panikstörung kann mit oder ohne Agoraphobie auftreten, wobei Agoraphobie nach DSM-IV definiert ist als Angst vor Situationen oder Orten, in denen bei einer unerwarteten Panikattacke kei-ne schnelle Hilfe verfügbar wäre, oder aus denen die Flucht schwierig oder peinlich wäre. Diese Situationen werden entweder vermieden oder nur unter starker Angst ertragen.
1.2. Epidemiologie und Verlauf
In großangelegten epidemiologischen Studien (z. B. Epidemiological Catchment Area Programm, Weissmann et al., 1986; Houston Community Survey, Salge, Beck & Logan, 1988; Münchner Fol-low-Up-Studie, Wittchen, 1986; Zürich-Studie, Angst, 1998) wurden Prävalenz und Zeitverlauf der Panikstörung untersucht.
Die Lebenszeitprävalenz der Panikstörung wird übereinstimmend mit 1,4 bis 2,4 % angegeben. Bei Frauen liegt die Erkrankungsrate etwa doppelt so hoch wie bei Männern. Bei mehr als 50 % der Patienten läßt sich eine familiäre Häufung der Krankheit nachweisen, was für eine erbliche Kompo-nente spricht (Angst, 1998). Die geschätzte Erblichkeit der Panikstörung wird in einer Studie von Kendler et al. (1995) mit 41-44 % angegeben. Im Vergleich zur Zahl der Panikpatienten liegt die Zahl der Personen, die schon einmal mindestens eine Panikattacke erlebt haben, wesentlich höher, nämlich bei 9 % (Wittchen, 1986) bis 14 % (Salge et al., 1988).
Nach Margraf & Schneider (1990) beginnt die Störung häufig im Alter von 20 bis 30 Jahren, wobei jedoch die Streuung des Erkrankungsalters groß ist. Der Verlauf der Störung kann kurz- und lang-fristige Fluktuationen (z. B. mehrmonatige anfallsfreie Zeiten) aufweisen. Vollständige Spontanre-missionen treten nach einer Dauer von mehr als einem Jahr nur selten auf; in einer Studie von Witt-chen (1991) kam es nur bei 14 % der Teilnehmer innerhalb von sieben Jahren zu einer Spontanre-mission. Ohne adäquate Behandlung kommt es bei vielen Betroffenen zu einer starken psychosozia-len Beeinträchtigung und zu einer hohen Inanspruchnahme medizinischer und psychologischer Ein-richtungen (Margraf & Schneider, 1996). Eine therapeutische Behandlung der psychischen Proble-me führt jedoch bei mehr Panikpatienten zu einer Verbesserung als zu einer Verschlechterung der Erkrankung (Angst, 1998).
Die Komorbidität mit anderen psychischen Erkrankungen ist hoch. Nur bei 14,2 % der Patienten tritt keine komorbide psychische Erkrankung auf (Margraf & Schneider, 1996). Im Vordergrund stehen dabei laut Angst (1998) depressive Erkrankungen (depressive Episode: 46,5 %, Major Depression: 37,2 %, Dysthymie: 23,3 %), sowie andere Angststörungen (spezifische Phobie: 15,5 %, Agoraphobie: 25,6 %, soziale Phobie: 30,2 %, generalisierte Angststörung: 30,2 %). Weiterhin läßt sich bei Panikpatienten auch ein hoher Prozentsatz (10-15 %) an Alkohol- und Tranquilizer- Mißbrauch feststellen. Während Alkohol- und Substanzmißbrauch eher eine Folge der Erkrankung sind, gehen andere psychische Erkrankungen der Panikstörung eher voraus (Angst, 1998). Faktoren, die Entstehung und Verlauf der Panikstörung beeinflussen, werden in Kapitel 6 beschrie-ben.
1.3. Neurobiologische Grundlagen von Panikattacken
Eine Übersicht über neuroanatomische Regionen und neurochemische Botenstoffe, die bei der Ent-stehung von Panikattacken eine Rolle spielen, geben Bandelow (2001) und Gorman, Kent, Sullivan und Coplan (2000). Einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung der an einer Angstreaktion betei-ligten Hirnregionen leisteten dabei die Arbeiten von Le Doux (z. B. Le Doux, 1990) und Davis (1992). Nach Bandelow (2001) sind die wichtigsten Gebiete, die bei der Entstehung einer Angst-reaktion bzw. einer Panikattacke beteiligt sind, die Amygdala, der Hippocampus, bestimmte Kern-gebiete des Hypothalamus, der Locus Coeruleus, die Raphé-Kerne und das periaquäduktale Grau. Weitere bei der Verarbeitung von Angstreizen beteiligte Gehirnregionen sind der Thalamus und der Cortex, und hierbei insbesondere der präfrontale Cortex, der entorhinale Cortex und sensorische Assoziationsgebiete des Cortex.
Im einzelnen gelangen wahrgenommene Gefahrenreize nach Bandelow (2001) und Gorman et al. (2000) über den Thalamus und über primäre und sekundäre sensorische Rindenfelder des Cortex zu Amygdala und Hippocampus. Diese beiden Strukturen stellen eine wichtige Schaltstelle dar, die die eingehenden Informationen verarbeitet und die anschließenden Reaktionen subkortikaler und korti-kaler Regionen steuert. Efferenzen, die von der Amygdala ausgehen, führen zum Nucleus paravent-ricularis (Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse) sowie zum Nucleus lateralis (Aktivierung des sympathischen Nervensystems) des Hypothalamus, zum Locus Coe-ruleus (Anstieg von Herzrate und Blutdruck), zum periaquäduktalen Grau (Freezing, Verteidigungs-reaktion) und zum Nucleus parabrachialis in der Pons (Erhöhung der Atemfrequenz). Die beschrie-benen Prozesse finden bei Tieren auf konditionierte Angstreize hin statt, sind aber bei einer Panikat-tacke sehr ähnlich (Gorman et al., 2000). Nach Bandelow (2001) kommt dabei insbesondere dem periaquäduktalen Grau eine wesentliche Rolle bei der Entstehung starker, attackenartiger Angst zu. Der präfrontale Cortex ist für die Bewertung der bedrohlichen Reize bedeutsam, wodurch die schnell ablaufenden subkortikalen Prozesse modifiziert werden können; der entorhinale Cortex wird dagegen mit Kontextlernen in Verbindung gebracht wird (Bandelow, 2001).
Die Raphé-Kerne projizieren über serotonerge Bahnen zu verschiedenen Gebieten, die an der Ver-arbeitung von Angstreizen beteiligt sind. Eine Dysfunktion der Raphé-Kerne bzw. des serotonergen Systems wird daher auch als eine wichtige mögliche Ursache der Panikstörung diskutiert, wobei der genaue Mechanismus jedoch noch unbekannt ist (Gorman et al., 2000). Weitere neurochemische Systeme, die bei der Entstehung von Panikattacken möglicherweise eine Rolle spielen, sind das noradrenerge System sowie die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse. Andere Neurotransmittersysteme scheinen dagegen nicht in Zusammenhang mit der Panikstörung zu ste-hen, oder wurden bisher noch ungenügend untersucht (Bandelow, 2001).
Insgesamt gesehen sind nach Bandelow (2001) weitere Forschungsarbeiten nötig, um die genauen neurobiologischen Mechanismen der Entstehung von Panikattacken aufzuklären.
1.4. Psychophysiologische Besonderheiten der Panikstörung
Psychophysiologische Besonderheiten bei der Panikstörung wurden sowohl im Normalzustand (au-ßerhalb von Panikattacken), als auch als Reaktion auf Streßinduktion, während künstlich ausgelös-ter und während spontaner Panikattacken untersucht. Bereits im Normalzustand (außerhalb von Panikattacken) unterscheiden sich Panikpatienten von Gesunden. Sie weisen z. B. eine höhere Herz-rate, einen höheren Blutdruck und eine höhere Frontalis-EMG-Aktivität auf (Hoehn-Saric, McLeod & Zimmerli, 1991). Weiterhin haben sie eine höhere Herzratenvariablilität (Anastasiades et al., 1990), ein höheres Hautleitfähigkeitsniveau (Skin Conductance Level, SCL; Hoehn, Braune, Scheibe & Albus, 1997) und ein höheres Atemvolumen sowie eine größere respiratorische Instabilität (Wilhelm, Trabert & Roth, 2001) als Gesunde. Dractu und Bond (1998) fanden außerdem im Ver-gleich zu Gesunden eine vermehrte Slow-Wave-Aktivität im EEG, die möglicherweise in Zusam-menhang mit Hyperventilation stehen könnte.
Die Erwartung von Streß führt bei Panikpatienten zu einem stärkeren Herzraten- und Blutdruckans-tieg (Ehlers, Margraf & Roth, 1985; Hoehn-Saric et al., 1991) sowie zu einem stärkeren SCL-Anstieg (Braune, Albus, Fröhler, Hoehn & Scheibe, 1994) als bei Gesunden. Während der Streß-aufgabe zeigen Panikpatienten im Vergleich zum Ruhezustand eine stärkere Erhöhung des SCL, jedoch keinen stärkeren Anstieg der Herzrate (Hoehn et al., 1997) als Gesunde. Roth, Wilhelm und Trabert (1998) berichten, daß Panikpatienten sich nach einer Streßaufgabe auch schlechter entspan-nen können als Gesunde, was sich in einer geringeren Abnahme des SCL sowie in stärkeren Fluk-tuationen des SCL zeigt.
Die Provokation von Panikattacken durch CO2-Inhalation oder bestimmte chemische Substanzen führt bei Panikpatienten im Vergleich zu Gesunden zu einem stärkeren Herzratenanstieg (Abelson, Nesse, Weg & Curtis, 1996), einer größeren Herzraten- und Blutdruckvariabilität (Bystritsky & Shapiro, 1992) sowie zu einer stärkeren Zunahme von Atemfrequenz und Atmungsvariabilität (Papp et al., 1997). Margraf (1986) fand allerdings während einer Panikprovokation keine Unter-schiede zwischen Panikpatienten und Kontrollpersonen hinsichtlich Herzraten-, Blutdruck- und SCR-Veränderungen.
Unter Zusammenfassung mehrerer Studien geben Margraf (1990) und Rau, Pauli und Birbaumer (1996) an, daß Panikpatienten während spontan auftretender Attacken etwas höhere Herzraten- und Blutdruckwerte als im Normalzustand (außerhalb von Attacken) haben, wobei die Herzrate jedoch oft bereits 15 Minuten vor einer Attacke erhöht ist. Bei Panikattacken, die aus einer Entspannungs-phase heraus entstehen, kommt es zuerst zu einem Abfall von Herzrate und Frontalis-EMG, dann jedoch zu einem plötzlichen Anstieg, wie eine explorative Studie an zwei Patienten (Cohen, Barlow & Blanchard, 1985) ergab. Aufgrund dieser physiologischen Auffälligkeiten, die auch außerhalb von Attacken vorhanden sind, konnte bislang noch kein psychophysiologischer Indikator gefunden werden, der zuverlässig zwischen Panikattacken und dem Normalzustand ohne Panikattacken unter-scheiden könnte (Freedman, Ianni, Ettedgui, Pohl & Rainey, 1984).
Somit sind psychophysiologische Besonderheiten bei Panikpatienten in verschiedenen Situationen nachgewiesen worden. Dennoch ist es schwer, eine Panikattacke allein anhand physiologischer Reaktionsmuster zu bestimmen, da bei Panikprovokation auch bei Gesunden physiologische Verän-derungen auftreten, und da sich physiologische Parameter während und außerhalb von Panikatta-cken nicht deutlich genug unterscheiden.
2. Psychophysiologische Grundlagen
In diesem Kapitel werden psychophysiologische Maße und Indikatoren erläutert, die für die empiri-schen Untersuchungen eine wichtige Rolle spielen. Weiterhin wird auf die mögliche Bedeutung der verschiedenen Maße eingegangen.
2.1. Evozierte Potentiale
Bei der Entstehung von evozierten Potentialen spielen der Thalamus und der frontale Cortex eine wichtige Rolle (Birbaumer, Elbert, Canavan & Rockstroh, 1990). Für die psychologische Forschung sind vor allem die endogenen evozierten Potentiale von Bedeutung, die weniger durch die physika-lischen Reizeigenschaften beeinflußt werden, als viel mehr durch kognitive Prozesse, die bei der Reizverarbeitung eine Rolle spielen (Rockstroh, Elbert, Birbaumer & Lutzenberger, 1982).
Nach Rockstroh et al. (1982) erhält man durch Mittelung des Spontan-EEGs über mehrere ähnliche Reizdarbietungen einen charakteristischen Kurvenverlauf, der in den ersten paar hundert Millise-kunden mehrere positive und negative Gipfel aufweist. Wichtige Komponenten dieser Peaks sind Latenz, Amplitude und Skalpverteilung. Ab etwa 500 ms nach Reizdarbietung beginnen die lang-samen Potentialverschiebungen, die entweder positiver oder negativer Art sein können.
2.1.1. P3 und Positive Slow Wave (PSW)
Wichtige Komponenten evozierter Potentiale bei der Untersuchung emotionaler Verarbeitungspro-zesse sind die P3 (ein positiver Gipfel, der etwa 250 bis 500 ms nach Reizbeginn auftritt und ein zentro-parietales Maximum aufweist) und die langsame positive Potentialveränderung (Positive Slow Wave, PSW), die ab etwa 400 ms nach Reizbeginn anfängt und mehrere hundert Millisekun-den bis mehrere Sekunden andauern kann. Positivierungen im EEG deuten, allgemein gesehen, auf kortikale Hemmung hin, die eine verminderte Aufnahme neuer Reize während kognitiver Verarbei-tungs- und Speicherprozesse bewirkt (z. B. Birbaumer et al., 1990).
Auf kognitive Komponenten bezogene Experimente zeigten, daß die P3 mit der tatsächlichen bzw. subjektiv wahrgenommenen Auftretenswahrscheinlichkeit eines Reizes, mit der Bedeutsamkeit des Reizes und mit der aktiven Aufmerksamkeit zusammenhängt (Rockstroh, Elbert, Canavan, Lutzen-berger & Birbaumer, 1989). Öhman (1979) geht davon aus, daß die P3 dann entsteht, wenn der dar-gebotene Reiz entweder nicht mit im Kurzzeitgedächtnis gespeicherten Mustern übereinstimmt und somit eine Orientierungsreaktion auslöst, oder wenn ein Reiz wiedererkannt und als wichtig einges-tuft wird. Donchin (1987) nimmt zusätzlich an, daß die P3 mit der Speicherung neuer Inhalte im Gedächtnis zusammenhängt. Bei der Entstehung der P3 scheint der Hippocampus eine Rolle zu spielen (Squires, Halgren, Wilson & Crandall, 1983), der Hauptgenerator ist jedoch der Cortex (Lutzenberger, Elbert & Rockstroh, 1987).
Die Positive Slow Wave ist eine länger anhaltende Positivierung, die vor allem parietal ausgeprägt ist, während sie frontal auch negative Werte annehmen kann (Rockstroh et al., 1989). Sie hängt sowohl mit der Reizwahrscheinlichkeit als auch mit der Stärke der Anstrengung bei kontrollierten Verarbeitungsprozessen (Rösler, 1986) zusammen, und spielt bei der Bewertung der Bedeutsamkeit eines Reizes und bei der Speicherung im Arbeitsgedächtnis (Rohrbaugh, Newlin, Varner & Ellingson, 1984) eine Rolle. Zusammenfassend kann man sagen, daß die PSW abschließende Bewer-tungsprozesse widerspiegelt (Ruchkin, Munson & Sutton, 1982).
Die Modulation von P3 und PSW durch emotionale Reize wurde bisher weniger oft untersucht. Bei der Darbietung emotionaler Reize zeigte die P3 eine konsistente, parietal betonte Erhöhung für negative und positive im Vergleich zu neutralen Reizen (z. B. Palomba, Angrilli & Mini, 1997; Diedrich, Naumann, Maier, Becker & Bartussek, 1997). Dieses Ergebnis weist darauf hin, daß emotional bedeutsame positive und negative Reize tiefer verarbeitet werden als neutrale. Für die PSW sind die Befunde weniger konsistent: Einige Autoren fanden keinen Zusammenhang zwischen der Stärke der PSW und dem emotionalen Gehalt von Bildreizen (z. B. Johnston, Miller & Burleson, 1986), andere konnten analog zur P3 eine Erhöhung der PSW bei positiven und negativen im Vergleich zu neutralen Reizen nachweisen (z. B. Cacioppo, Crites, Gardner & Berntson, 1994; Palomba et al., 1997).
2.1.2. Contingent Negative Variation (CNV)
Die Contingent Negative Variation (CNV) ist eine negative Potentialverschiebung im EEG mit ei-ner Amplitude zwischen etwa -10 und -20 µV (Rockstroh et al., 1989). Negativierungen im EEG werden mit kortikalen Aktivierungsprozessen in Verbindung gebracht, die eine vorbereitende Funk-tion für die Ausführung nachfolgender kognitiver Prozesse haben (Birbaumer et al., 1990). Die CNV wird meist mit einem Zwei-Stimulus-Paradigma evoziert: Ein Hinweisreiz (S1) kündigt einen zweiten Reiz (S2) an, der nach einem konstanten Zeitintervall (500 ms bis mehrere Sekunden) folgt. Unterschiedlichen Paradigmen ist dabei gemeinsam, daß die Vorbereitung auf einen Reiz, eine Ver-haltensantwort oder eine Entscheidung gefordert wird (Gaillard, 1986). Zwischen S1 und S2 ent-steht die CNV, die Aufmerksamkeit, Motivation, Erwartung und Reaktionsvorbereitung bezüglich des S2 widerspiegelt (Rockstroh et al., 1982). Weiterhin hängt die CNV-Amplitude auch mit dem Arousal zusammen, wobei sie zunächst mit größer werdendem Arousal zunimmt, ab einem be-stimmten Punkt aber wieder geringer wird, was möglicherweise an einer vermehrten Ablenkung bei sehr hohem Arousal liegen könnte (Tecce & Cattanach, 1987).
Wenn das Intervall zwischen S1 und S2 lang genug (mindestens vier Sekunden lang) ist, lassen sich eine frühe (initial CNV oder iCNV) und eine späte (terminal CNV oder tCNV) Komponente unter-scheiden. Die iCNV tritt etwa ein bis zwei Sekunden nach S1 auf und ist vor allem frontal betont, während die tCNV etwa eine Sekunde vor S2 auftritt und zentral am stärksten ausgeprägt ist. Die iCNV spiegelt vor allem die Verarbeitung der S1-S2-Kontingenz und der Information, die der S1 über diese Kontingenz enthält, wider (Rockstroh et al, 1989). Die tCNV hängt dagegen vor allem mit der vorbereitenden Aktivierung auf den S2 zusammen, wobei sie auch unabhängig von der Er-wartung einer motorischen Antwort auftritt (Ruchkin, Sutton, Mahaffey & Glaser, 1986). Sie weist einen Zusammenhang mit der motivationalen Bedeutsamkeit und der emotionalen Qualität des S2, mit der erwarteten Reaktion auf den S2 und mit den erwarteten Konsequenzen dieser Reaktion (z. B. Beenden eines aversiven S2) auf (Rockstroh et al., 1982). Die Modulation der späten CNV-Komponente durch die emotionale Bedeutsamkeit des S2 wurde in verschiedenen Studien mit un-terschiedlichen S2-Reizen (emotionale Bilder, elektrische Schocks, aversive Töne) nachgewiesen (z. B. Rockstroh, Elbert, Lutzenberger & Birbaumer, 1979). Für die Amplitude der späten CNV-Komponente scheint dabei die Intensität der auftretenden Emotionen eine größere Rolle zu spielen als die Art der Emotion, wobei jedoch die Modulation der CNV durch die Intensität bei aversiven Reizen stärker ausgeprägt ist als bei positiven Reizen (Birbaumer et al., 1990).
Die Analyse des Zusammenhangs zwischen S1 und S2 erlaubt es den Probanden auch, Vorhersagen über die Auftretenswahrscheinlichkeit des S2 zu treffen. Hier läßt sich die CNV mit dem Covariati-on Bias, d. h., mit der Überschätzung der Wahrscheinlichkeit negativer Konsequenzen nach be-stimmten Reizen, in Verbindung bringen. Entsprechende Befunde werden in Abschnitt 5.3.2. dar-gestellt.
2.2. Startle-Reflex
Der Schreckreflex (Startle-Reflex) ist eine schnelle, durch mehrere reflexorische Bewegungen ge-kennzeichnete Reaktion auf einen plötzlichen sensorischen Reiz, die dem Schutz des Organismus dient (Lang, Bradley & Cuthbert, 1997). Der Startle-Reflex setzt sich zusammen aus einem obliga-torischen Reflexkreis, der nur durch die Reizeigenschaften des sensorischen Inputs moduliert wird, und einem modulatorischen Schaltkreis, der die emotionale Bewertung des sensorischen Reizes beinhaltet (z. B. Davis, 1989). Der direkte Reflexkreis umfaßt afferente Bahnen von den Neuronen der Cochlea zur Formatio Reticularis und efferente Bahnen von der Formatio Reticularis über die Rückenmarkneurone zu den Reflex-Effektoren. Am modulatorischen Reflexkreis sind zusätzlich die Amygdala und das zentrale Grau beteiligt (Lang, 1995). Die Amygdala spielt für das Erlernen von Angst und defensivem Vermeidungsverhalten eine zentrale Rolle, das zentrale Grau ist für die Aus-führung des Startle-Reflexes bedeutsam.
Die schnellste (25-40 ms nach Reizbeginn) und am zuverlässigsten meßbare Komponente des Schreckreflexes ist der Lidschlußreflex, der daher meist zur Quantifizierung des Startle-Reflexes verwendet wird. Dazu werden zwei Elektroden unterhalb des Auges in Höhe des Orbicularis Oculi-Muskels, der am Lidschluß beteiligt ist, angebracht. Der Startle-Reflex wird am häufigsten mit Hil-fe eines unmittelbar beginnenden, ca. 100 dB lauten, 50 ms langen Tons (meist weißes Rauschen) ausgelöst.
Nach der Emotionstheorie von Lang (1985; siehe Abschnitt 3.2.1.) sollte der Startle-Reflex in ei-nem negativen emotionalen Zustand erhöht, in einem positiven emotionalen Zustand jedoch verrin-gert sein. Verschiedene Studien (z. B. Vrana, Spence & Lang, 1988; Lang, Bradley & Cuthbert, 1998) konnten diese Annahme bestätigen und zeigen, daß der Startle-Reflex ein sensibler Indikator für emotionale Reaktionen, insbesondere für Angst, ist (siehe Abschnitte 3.2.3. und 3.2.4).
2.3. Hautleitfähigkeit
Bei der Hautleitfähigkeit, die durch Anlegen einer konstanten Spannung (meist 0,5 V) an den In-nenflächen von Fingern oder Hand gemessen werden kann, lassen sich tonische Aktivierungspro-zesse (Skin Conductance Level, SCL) und phasische Leitwertsveränderungen (Skin Conductance Response, SCR) unterscheiden (Schandry, 1996). Eine durch einen Reiz hervorgerufene Reaktion wird dadurch definiert, daß der Gipfelpunkt der Reaktion in einem bestimmten Zeitintervall (meist 1,5 bis 6,5 s) nach Reizdarbietung auftreten muß (Schandry, 1996). Die SCR wurde in unterschied-lichen Paradigmen als Maß der Aktivierung, der Orientierungsreaktion, der Defensivreaktion oder der Streßreaktion verwendet.
Verschiedene Untersuchungen mit emotionalen Bildreizen (z. B. Greenwald, Cook & Lang, 1989) oder der Vorstellung emotionaler Situationen (z. B. VanOyen Witvliet & Vrana, 1995) fanden einen Zusammenhang zwischen SCR und dem durch die Reize hervorgerufenen Arousal, der unabhängig von der Art der induzierten Emotion ist (siehe auch Abschnitt 3.2.).
Für die Konzeption des zweiten Hauptversuchs ist wichtig, daß in Konditionierungversuchen ver-schiedene Komponenten der SCR unterschieden werden (nach Prokasy & Klumpfer, 1973), die jeweils im Zeitbereich 1-4 s nach dem entsprechenden Reiz bestimmt werden. Dies sind die Unconditioned Response (UCR), die als Reaktion auf einen unkonditionierten (Straf-)Reiz auftritt und mit der Stärke der negativen Konsequenz zusammenhängt, die First Interval Response (FIR), die nach einem konditionierten Reiz zustandekommt und als Ausdruck einer Orientierungsreaktion aufgefaßt wird, und schließlich die Third Interval Omission Response (TOR), die nach einem konditionierten Reiz beim Ausbleiben einer negativen Konsequenz beobachtet werden kann. Die TOR drückt die „Überraschung“ über das Ausbleiben der negativen Konsequenz aus und hängt mit der Stärke der Erwartung der negativen Konsequenz zusammen (De Jong & Merckelbach, 1991).
3. Emotionstheorien
3.1. Übersicht
Nach einer Definition von Öhman und Birbaumer (1993) werden emotionale Phänomene durch externe oder interne Reize, die für die Person bedeutsam sind, hervorgerufen. Eine emotionale Reaktion kann dabei Verhaltensantworten, physiologische Reaktionen und Veränderungen im sub-jektiven Erleben beinhalten. Diese Definition umfaßt gleichzeitig die drei Bereiche, in denen sich emotionale Veränderungen beobachten lassen: Offenes Verhalten (mimisches Ausdrucksverhalten, Annäherungs- und Vermeidungsverhalten), physiologische Reaktionen (autonome Maße, Muskel-aktivität) und verbale Berichte über das subjektive Erleben (z. B. über Gefühle oder Gedanken). Da diese drei Bereiche jedoch nur geringe Interkorrelationen zeigen (Öhman, 1987), sollten Maße aus allen drei Bereichen erhoben werden, um ein differenziertes Bild des jeweiligen emotionalen Zu-standes zu erhalten.
Verschiedene Befunde zu den drei genannten Bereichen führten zur Entwicklung von Theorien, deren Ziel es ist, die grundlegenden Dimensionen von Emotionen zu identifizieren. Auf der einen Seite steht die Theorie der Basisemotionen, die z. B. von Plutchik (1962) und Izard (1977) vertreten wurde, und die davon ausgeht, daß es eine bestimmte Anzahl von basalen Emotionen (z. B. Furcht, Ärger, Freude) gibt, aus denen sich wiederum andere, komplexere emotionale Reaktion ableiten lassen. Diese Theorie stützt sich u. a. auf den Befund kulturunabhängigen, emotionsspezifischen mimischen Ausdrucksverhaltens (z. B. Ekman, 1972). Weiterhin postuliert sie spezifische neuro-physiologische Korrelate der einzelnen Emotionen, die jedoch empirisch nur zum Teil nachgewie-sen werden konnten (z. B. Panksepp, 1982). Auf der anderen Seite steht die Emotionstheorie von Lang, die von nur zwei grundlegenden Dimensionen der Emotion ausgeht. Da dieser Ansatz für die später beschriebenen empirischen Arbeiten eine wichtige Rolle spielt, wird er in Abschnitt 3.2. aus-führlicher dargestellt.
3.2. Die Emotionstheorie von Lang
3.2.1. Grundlagen
Die Emotionstheorie von Lang (Lang, 1985; Lang et al., 1998) geht von zwei basalen Motivations-systemen, einem Annäherungs- und einem Vermeidungssystem, aus. Diese haben sich nach Lang herausgebildet, da sie vorteilhaft für das Überleben des Individuums sind. Beide Motivationssyste-me werden durch das Arousal, definiert als metabolische oder mentale Aktivierung der beiden Sys-teme, moduliert. Als Belege für sein Modell führt Lang an, daß unkonditionierte Reflexe sich in appetitive und aversive Reflexe einteilen lassen (Konorski, 1967), und daß die Beurteilung einer großen Anzahl von emotionalen Wörtern durch sehr viele Personen eine eindeutige Verteilung ent-lang der zwei Dimensionen „Annäherung – Vermeidung“ und „Arousal“ ergab (Osgood, Suci & Tannenbaum, 1957).
Lang nimmt an, daß es für appetitives und aversives Verhalten spezifische neuronale Schaltkreise gibt, die die sensorische Reizaufnahme und -verarbeitung, die Reizbewertung sowie autonome und motorische Verhaltensantworten steuern. Emotionen stellen in Lang’s Theorie Handlungsdisposi-tionen dar. Dies bedeutet, daß durch eine bestimmte Emotion bestimmte neuronale Schaltkreise aktiviert werden, wodurch die Auftretenswahrscheinlichkeit für zugehörige efferente Prozesse (Ge-danken, autonome und motorische Reaktionen) erhöht wird („Priming“), während die Auftretens-wahrscheinlichkeit für zu diesem Schaltkreis inkongruente Prozesse verringert wird. Emotionen steuern somit auch die Aufmerksamkeit, die wiederum die Auswahl und Bewertung motivational bedeutsamer Reize reguliert. Allerdings ist für das Auftreten emotionaler Bewertungsprozesse nach Lang nicht unbedingt bewußtes Erkennen eines Reizes notwendig.
Lang konzipiert die Dimensionen Valenz und Arousal als grundlegende, „strategische“ Dimensio-nen des emotionalen Empfindens und Handelns, die jedoch aufgrund verschiedener Aspekte der jeweiligen Situation moduliert werden, und so erst zu einem spezifischen emotionalen Zustand füh-ren. Bestimmte emotionale Reiz-Reaktionsverbindungen sind in diesem Modell genetisch determi-niert, die weitere Spezifizierung in bestimmten Kontexten wird durch Lernprozesse moduliert.
3.2.2. Methodik
Da eine Vielzahl von Untersuchungen ergeben hat, daß Abbildungen der Realität in Bildern oder Filmen ähnliche emotionale Reaktionen hervorrufen wie die entsprechenden realen Situationen (siehe Lang et al., 1997, für eine Übersicht), wurden diese in verschiedenen Experimenten zur Aus-lösung emotionaler Reaktionen verwendet. Vorteile der Darbietung emotionaler Bilder sind nach Lang et al. (1997), daß die Art und Darbietungszeit des emotionalen Reizes experimentell kontrol-lierbar sind und daß die Versuchsperson bei der Bildbetrachtung passiv ist, was das Auftreten von emotionalen Reaktionen begünstigt.
Lang, Öhman und Vaitl (1988) entwickelten das International Affective Picture System (IAPS), ein Set von über 500 emotionalen Bildern, von dem es inzwischen eine aktualisierte und erweiterte Version (Lang, Bradley & Cuthbert, 1995) gibt. Aufgrund der Ratings einer großen Personenzahl liegen für jedes Bild standardisierte Werte für Valenz und Arousal vor. Zur Beurteilung der Bilder wurde dabei das Self Assessment Manikin (SAM; Lang, 1980) verwendet, in dem die Dimensionen Valenz und Arousal bildlich veranschaulicht werden, wobei Einstufungen jeweils auf einer neunstu-figen Skala gemacht werden können (siehe Abbildung 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Beispiel für die Self-Assessment-Manikin (SAM)-Skalen Valenz und Arousal. Die Skala Valenz reicht von sehr positiv (1) bis sehr negativ (9), die Skala Arousal von sehr erregt (1) bis sehr ruhig (9).
Zur Untersuchung emotionaler Reaktionen werden in einem von Lang entwickelten Paradigma Bil-der mit negativer, neutraler und positiver Valenz dargeboten. Neben subjektiven Einschätzungen (Valenz, Arousal, Interesse) und Verhaltensmaßen (Betrachtungszeit) werden physiologische Maße erhoben, wie z. B. evozierte Potentiale, SCR, Herzrate, Startle-Reflex und mimische Reaktionen.
3.2.3. Befunde zur emotionalen Bildbetrachtung bei gesunden Personen
Mehrere Studien, in denen Bilder mit unterschiedlicher Valenz dargeboten wurden (z. B. Greenwald et al., 1989; Vrana, Cuthbert & Lang, 1989; Lang, Greenwald, Bradley & Hamm, 1993; Cuthbert, Schupp, Bradley, Birbaumer & Lang, 2000), untersuchten den Zusammenhang zwischen sub-jektiven und psychophysiologischen Variablen. Dabei ergaben sich über alle Studien hinweg sehr konsistente Befunde. So hängen die Positive Slow Wave und die SCR mit dem Arousal der Bildrei-ze zusammen: Bei positiven und negativen Bildern, die im Vergleich zu neutralen Bildern ein höhe-res Arousal aufweisen, sind PSW (bis 5 s nach Reizbeginn) und SCR im Vergleich zu neutralen Bildern erhöht. Auch die subjektiven Interesse-Ratings sowie die Betrachtungszeit hängen mit dem Arousal zusammen. Die Herzrate, die mimische Aktivität (z. B. des Corrugator-Muskels, der bei Stirnrunzeln beteiligt ist) sowie die Amplitude des Startle-Reflexes korrelieren dagegen mit der Valenz der Bildreize: Die Herzrate zeigt für negative Reize eine stärkere Dezeleration als für positive und neutrale Reize, und die Reaktionen von Corrugator-Muskel und Startle-Reflex werden mit zunehmender negativer Valenz der Bilder stärker. Weiterhin ergab eine Faktorenanalyse mit subjek-tiven und psychophysiologischen Daten (Lang et al., 1998) eine deutliche Zwei-Faktoren-Struktur, in der die beiden Dimensionen Valenz und Arousal bestätigt werden konnten.
Weitere Untersuchungen zum Startle-Reflex (Schupp, Cuthbert, Bradley, Birbaumer & Lang, 1997; Hamm, Cuthbert, Globisch & Vaitl, 1997) zeigten, daß der Zusammenhang mit der Valenz unab-hängig von der Art der induzierten negativen Emotion (z. B. Trauer, Ärger oder Angst) vorhanden ist, und daß die valenzinduzierte Modulation des Startle-Reflexes bei hoch-erregenden Bildern stär-ker ausfällt als bei niedrig-erregenden (d. h., der Startle-Reflex bei negativen Bildern ist für hoch-erregende Bilder stärker als für niedrig-erregende, der Startle-Reflex bei positiven Bildern ist für hoch-erregende Bilder schwächer als für niedrig-erregende). In einem sehr frühen Zeitbereich der Bildpräsentation (bis 300 ms nach Bildbeginn) wird der Startle-Reflex jedoch nicht durch die Va-lenz der Bildreize moduliert, sondern ist bei positiven und negativen Bildern geringer als bei neutra-len Bildern (sogenannte „Prepulse Inhibition“; Bradley, Cuthbert & Lang, 1993). Dies ist auf eine stärkere Aufmerksamkeitszuwendung bei den positiven und negativen Bilder zurückzuführen, die sich hemmend auf den Startle-Reflex auswirkt.
3.2.4. Befunde zur Verarbeitung emotionaler Reize bei hochängstlichen Personen und Personen mit Angststörungen
Sowohl bei hochängstlichen Personen als auch bei Personen mit unterschiedlichen Angststörungen finden sich Besonderheiten bei der Verarbeitung emotionaler Bildreize. In einer Studie von Cook, Davis, Hawk, Spence & Gautier (1992) zeigten Hochängstliche bei negativen, hoch erregenden Bildern im Vergleich zu neutralen Bildern erhöhte Startle-Reaktionen und eine höhere Herzrate,
während Niedrigängstliche sich nicht zwischen den Bedingungen unterschieden. Zudem hatten die Hochängstlichen in dieser Studie insgesamt höhere Startle-Reaktionen als die Niedrigängstlichen. Eine Studie, die Startle-Reaktionen auf emotionale Wortreize in einem Stroop-Paradigma unter-suchte (Miller, 1999), fand bei hochängstlichen Personen im Gegensatz zu niedrigängstlichen Per-sonen erhöhte Startle-Reaktionen auf bedrohliche im Vergleich zu nicht-bedrohlichen Wörtern in einer Bedrohungsbedingungen (Ankündigung elektrischer Schocks). Diese Befunde legen nahe, dal3 Hochängstliche bei negativen bzw. bedrohlichen Reizen eine stärkere Defensivreaktionen zeigen als Niedrigängstliche.
Auch bei Angstpatienten finden sich Abweichungen zu den Befunden bei gesunden Probanden. Phobiker, die mit Bildern bzw. Schilderungen ihres phobischen Objektes konfrontiert werden, zei-gen im Vergleich zur Kontrollgruppe erhöhte Startle-Reaktionen (Lang et al., 1998). Sie weisen im Gegensatz zur Kontrollgruppe bei angstrelevanten Reizen höhere SCR- und Blutdruckwerte auf als bei neutralen Reizen (Globisch, Hamm, Esteves & Öhman, 1999), und reagieren beim Betrachten angstrelevanter Bilder mit einer Herzraten-Akzeleration, während die Kontrollpersonen mit einer Dezeleration reagieren (Hamm et al., 1997). Aul3erdem betrachten Phobiker angstrelevante Reize kürzer und schätzen sie als negativer und höher erregend ein als die Kontrollgruppe (Hamm et al., 1997). Die erwähnten psychophysiologischen Besonderheiten treten bei Angstpatienten auch dann auf, wenn die Reize sehr kurz (150 ms lang) präsentiert werden, was für Abweichungen bei schnel-len, automatisierten Verarbeitungsprozessen spricht (Globisch et al., 1999). Bei Panikpatienten ist es schwerer, psychophysiologische Besonderheiten durch die Darbietung spezifischer störungsbe-zogener Reize nachzuweisen. Beispielsweise zeigen sie erhöhte Startle-Reaktionen eher in einer allgemein angstauslösenden Situation als bei einer spezifisch panikrelevanten Schilderung (siehe Lang et al., 1998).
Insgesamt gesehen deuten die Befunde darauf hin, dal3 hochängstliche Personen und Patienten mit Angststörungen im Vergleich zu Gesunden verstärkte autonome Reaktionen auf aversive bzw. angstrelevante (Bild-)Reize zeigen, was für eine verstärkte Defensivreaktion bei diesen Personen-gruppen spricht (siehe Fanselow, 1994).
4. Theorien zur Entstehung der Panikstörung
Die wichtigsten Theorien zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Panikangst sind Konditionie-rungstheorien, kognitive Theorien und die Theorie der Anxiety Sensitivity. Konditionierungstheo-rien nehmen eher unbewul3te, assoziative Lernprozesse als Ursache für die Entstehung von Panikat-tacken an. Kognitive Theorien sehen die Entstehung von Panikattacken als Folge der Angst vor der Angst, wobei hier bewul3ten Bewertungsprozessen eine besondere Bedeutung zukommt. Die Theo-rie der Anxiety Sensitivity weist gewisse Ähnlichkeiten mit den kognitiven Theorien auf, stellt je-doch die Bewertung angstbezogener körperlicher Empfindungen in den Vordergrund.
4.1. Konditionierungstheorien
4.1.1. Theoretische Grundlagen
Frühe Konditionierungstheorien versuchten, die Entstehung von Agoraphobie durch konditionierte Reaktionen auf externe Reize (z. B. Eysenck & Rachman, 1965) und die Entstehung von Panikatta-cken durch konditionierte körperliche Angstreaktionen auf interozeptive Reize (Goldstein & Chambless, 1978) zu erklären. An diesen Modellen wurde vor allem bemängelt, daß sie zu verein-fachend seien und keinen Spielraum für zusätzliche, modulierende Faktoren ließen. Das Modell von Goldstein und Chambless wurde zudem dahingehend kritisiert, daß hier konditionierter Reiz und konditionierte Reaktion konzeptionell schwer zu trennen seien (McNally, 1999).
Bouton, Mineka und Barlow (2001) traten dieser Kritik entgegen, indem sie ein neues, erweitertes Modell zur Entstehung der Panikstörung durch Konditionierungsprozesse vorstellten. Sie schlagen zunächst eine konzeptuelle Trennung von Angst (einem antizipatorischen Zustand, der bei der Vor-bereitung auf Gefahrensituationen auftritt) und Panik (einer extremen Angst, die bei der Verarbei-tung eines momentan stattfindenden traumatischen Ereignisses auftritt) vor, um das Entstehen der Panikstörung besser erklären zu können. Nach Bouton et al. (2001) entsteht die Panikstörung da-durch, daß durch das Erleben einer Panikattacke exterozeptive und interozeptive Reize, die mit der Panikattacke zusammenhängen, mit Angst konditioniert werden. Die konditionierte Angst vor der nächsten Attacke führt zum verstärkten Auftreten von körperlichen Symptomen, einer erhöhten Aufmerksamkeit auf diese körperlichen Symptome sowie zu einem erhöhten Arousal, wodurch wiederum die Wahrscheinlichkeit für die nächste Panikattacke erhöht wird.
Das erweiterte Konditionierungsmodell schließt nicht aus, daß weitere modulierende Prozesse, wie z. B. kognitive Faktoren oder eine erhöhte Anxiety Sensitivity, an der Entstehung der Panikstörung beteiligt sein können, es mißt jedoch nicht-bewußten Lernprozessen eine bedeutsamere Rolle zu. Weiterhin nimmt das Modell eine Reihe von zusätzlichen Konditionierungsmechanismen an, die verschiedene Charakteristika der Panikstörung erklären können. So können z. B. individuelle Erfah-rungen mit dem konditionierten Reiz, Summation von mehreren konditionierten Reizen, gleichzei-tiges Vorhandensein von inhibitorischen Reizen oder die modulierende Wirkung von Kontextreizen die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Panikattacke beeinflussen. Faktoren, die einen Ein-fluß auf die Stärke der Angstkonditionierung haben, können nach Bouton et al. (2001) die Unvor-hersagbarkeit und die Unkontrollierbarkeit von aversiven Reizen sowie eine (neurobiologische) Sensitivierung gegenüber gelernten Angstreizen sein. Zudem nimmt das erweiterte Konditionie-rungsmodell bestimmte Vulnerabilitätsfaktoren für die Panikstörung an, wobei vor allem Lernfakto-ren wie die frühe Erfahrung der Kontrollierbarkeit von Ereignissen, das Rollenverhalten der Eltern oder das Erlernen von Angst auf bestimmte körperliche Symptome eine wichtige Rolle spielen.
Letztendlich hat das erweiterte Konditionierungsmodell laut Bouton et al. (2001) gegenüber ande-ren Theorien den Vorteil, daß es eine genaue Analyse und experimentelle Prüfung der Faktoren erlaubt, die beim Erlernen und Wiederauftreten von Angst bzw. Panik eine Rolle spielen.
4.1.2. Befunde zur den Konditionierungstheorien
Für das Modell von Goldstein und Chambless (1978) spricht der Befund, daß auf einen bestimmten interozeptiven Reiz eine andere interozeptive Reaktion konditioniert werden kann (z. B. Stegen, De Bruyne, Rasschaert, Van de Woestijne & Van den Bergh, 1999). Befunde dieser Art widersprechen auch der Kritik, daß konditionierter Reiz und konditionierte Reaktion im Modell von Goldstein und Chambless nicht getrennt werden könnten.
Belege für das erweiterte Konditionierungsmodell von Bouton et al. (2001) stammen zum Teil aus Versuchen zur Konditionierung angstrelevanter Reize bei Tieren, gesunden Probanden und Perso-nen mit verschiedenen Angststörungen, zum Teil aus Untersuchungen mit Panikpatienten. Hier werden nur Befunde dargestellt, die für die Entstehung der Panikstörung besonders wichtig sind.
Im Zusammenhang mit der Bedeutsamkeit von Kontextreizen konnte gezeigt werden, daß eine Angstreaktion auf einen bestimmten Reiz über verschiedenen Kontexte hinweg konditioniert wer-den kann (z. B. Hall & Honey, 1989). Panikpatienten zeigen außerdem in einer bedrohlichen Situation (Ankündigung von elektrischen Schocks) stärkere Startle-Reaktionen als gesunde Kontrollper-sonen (Grillon, Ameli, Goddard, Woods & Davis, 1994), was die Annahme unterstützt, daß die Modulation bzw. Verstärkung von Angstreaktionen durch Kontextfaktoren bei Panikpatienten eine wichtige Rolle spielt.
Für die Annahme, daß Angst die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Panikattacken erhöht, spricht, daß die meisten Patienten berichten, ihren Panikattacken sei immer Angst vorausgegangen (Basoglu, Marks & Sengün, 1992). Weiterhin fanden Öst und Hugdahl (1983), daß die meisten Pa-nikpatienten sich an die erste, traumatische Paniksituation erinnern, und anschließend relativ rasch Vermeidungsverhalten entwickelten, was dafür spricht, daß die Panikstörung mit einer Konditionie-rungsepisode beginnt.
Eine Reihe von Befunden unterstützt die Annahme, daß Unvorhersagbarkeit und Unkontrollierbar-keit von aversiven Reizen die Stärke von Angstkonditionierung bzw. von Angstreaktionen beeinf-lussen. So reagierten Gesunde auf unvorhersagbare elektrische Schocks mit stärkeren Startle-Reaktionen und mehr Angst als auf vorhersagbare elektrische Schocks (Ameli, Ip & Grillon, 2001). In einer klinischen Studie zeigten Panikpatienten mehr Angst und Beunruhigung nach unvorhersag-baren als nach vorhersagbaren Panikattacken (Craske, Glover & DeCola, 1995). Außerdem wiesen Panikpatienten, die glaubten, die Menge des eingeatmetem CO2 in einem Panikprovokationsver-such kontrollieren zu können, geringere physiologische Reaktionen auf das CO2 auf als Patienten, die glaubten, keine Kontrolle zu haben (Sanderson, Rapee & Barlow, 1989).
Insgesamt liegen bisher zu den Konditionierungsmodellen der Panikstörung vor allem klinische Befunde vor, die zwar die verschiedenen Annahmen des erweiterten Konditionierungsmodells un-terstützen, aber keine direkte Prüfung dieser Annahmen darstellen. Auch Bouton et al. (2001) beto-nen, daß in Zukunft Experimente nötig sind, die die verschiedenen Hypothesen des erweiterten Konditionierungsmodells gezielt überprüfen.
4.2. Kognitive Theorien
4.2.1. Theoretische Grundlagen
Im Gegensatz zu den Konditionierungstheorien sehen die kognitiven Theorien der Panikstörung die Interpretation körperlicher Empfindungen als einen wichtigen Faktor für die Entstehung von Panik-attacken an. Wichtige kognitive Ansätze stammen von Clark (1986), Margraf und Schneider (1990) und Foa (1988). Alle kognitiven Theorien ist gemeinsam, daß sie zusätzliche Entstehungsfaktoren von Panikattacken (z. B. biologische Prädispositionen), die in Wechselwirkung mit den kognitiven Faktoren stehen können, nicht ausschließen.
Nach Clark (1986) entstehen Panikattacken durch die Fehlinterpretation körperlicher Symptome - insbesondere solcher, die durch Angst ausgelöst werden, wie Herzrasen oder Atemlosigkeit - als Zeichen einer bevorstehenden Gefahr. Dadurch kommt es zu einem Teufelskreis: Externe und vor allem interne Reize werden als bedrohlich interpretiert, was zum Auftreten von Angst führt. Durch diese entstehen weitere körperliche Symptome, die wiederum fehlinterpretiert werden, usw., bis es schließlich zu einer voll ausgeprägten Panikattacke kommt. Weitere Faktoren, die in diesem Modell zur Aufrechterhaltung von Angst beitragen, sind eine ständige erhöhte Aufmerksamkeit (Hypervigi-lanz) für körperliche Empfindungen sowie ein mehr oder weniger ausgeprägtes Vermeidungsverhal-ten, das die realistische Einschätzung der Konsequenzen von körperlichen Empfindungen verhin-dert. Biologische Prädispositionen können nach Clark einen Einfluß auf die Wahrscheinlichkeit, körperliche Empfindungen als gefährlich einzuschätzen, auf die allgemeine Variabilität physiologi-scher Reaktionen und auf die Stärke physiologischer Reaktionen auf bedrohliche Reize haben.
Auch Margraf und Schneider (1990) gehen von einem Modell aus, in dem durch die Wahrnehmung körperlicher Veränderungen und deren Assoziation mit Gefahr Angst entsteht, die wiederum kör-perliche Veränderungen hervorruft, usw., bis es schließlich in diesem Teufelskreis zu einer Panikat-tacke kommt. Margraf und Schneider betonen weiterhin, daß diese positiven Rückkoppelungspro-zesse schnell ablaufen, während negative Rückkoppelungsprozesse, die dem Angstanfall entgegen-wirken, eher langsam vonstatten gehen. Dies führt dazu, daß Panikattacken oft als unvorhergesehen und nicht kontrollierbar erlebt werden. Ergänzende Faktoren bei der Entstehung eines Angstanfalls sind im Modell von Margraf und Schneider situationale Ursachen wie körperliche Anstrengung, Einnahme chemischer Substanzen oder emotionale Reaktionen, aber auch individuelle Prädisposi-tionen wie z. B. ein tonisch erhöhtes Erregungsniveau.
Foas Theorie der Emotionsverarbeitung (1988) orientiert sich an der Idee des emotionalen Gedäch-tnisses als semantisches Netzwerk (Lang, 1979), in dem bestimmte Bedeutungsinhalte miteinander verknüpft sind und somit gleichzeitig aktiviert werden. Dabei werden für verschiedene Emotionen unterschiedliche Netzwerke angenommen (Lang, 1985), wobei semantische Netzwerke Elemente der Reizverarbeitung, der Bedeutungserfassung und der Steuerung der Verhaltensantwort umfassen (Lang, 1984). Foa und Mitarbeiter (Foa & Kozak, 1986) konzentrierten sich in ihren Forschungsar-beiten auf die Elemente, die sich auf die Interpretation der Situation beziehen. Foa (1988) geht da-von aus, daß bei Angststörungen Fehlinterpretationen hinsichtlich Reiz-Reiz-Beziehungen (z. B. bei Herzrasen Gedanke an Herzinfarkt) und Reiz-Reaktions-Beziehungen (z. B. Glaube, der Gefahr des Herzinfarkts durch Flucht aus einer Situation zu entkommen) eine wichtige Rolle spielen. Diese Fehlinterpretationen könnten dadurch erklärt werden, daß Angstpatienten ein besonders engmaschi-ges, stabiles und schnell aktivierbares semantisches Netzwerk für angstrelevante Reize aufweisen (Lang, 1984). Panikpatienten sollten daher bei der Verarbeitung angstrelevanter Reize Besonderhei-ten aufweisen, und zwar hinsichtlich Aufmerksamkeit, Interpretation und Erinnerung von angstrele-vanten Reizen.
Kritisiert wird an den kognitiven Theorien, daß nicht sicher nachgewiesen ist, ob kognitive Bewer-tungsprozesse wirklich ursächlich für das Entstehen von Panikattacken sind (z. B. McNally, 1999), und daß die Operationalisierung der katastrophalen Gedanken eher unpräzise erfolgt (Bouton et al., 2001).
4.2.2. Befunde zu den kognitiven Theorien
Eine Reihe von Belegen unterstützt die kognitiven Modelle und kann direkt mit den verschiedenen kognitiven Biases in Verbindung gebracht werden. Für einen Aufmerksamkeitsbias spricht, daß Panikpatienten im Gegensatz zu Gesunden in einer Stroop-Aufgabe bei bedrohlichen Wörtern eine stärkere Interferenz zeigen als bei neutralen Wörtern (McNally et al., 1994). Zudem erkennen Pa-nikpatienten bei tachistoskopischer Darbietung mehr somatische als nicht-somatische Wörter, wäh-rend dieser Unterschied in einer Kontrollgruppe nicht besteht (Pauli et al., 1997). Hinweise auf ei-nen interpretativen Bias geben Befunde von Clark et al. (1988) und Ebert (1993), nach denen bei Panikpatienten die Wahrscheinlichkeit, uneindeutige körperliche Empfindungen (z. B. Schwindel-gefühl) als bedrohlich einzuschätzen, erhöht ist. Weiterhin konnte nachgewiesen werden, daß die Aktivierung kognitiver Fehlinterpretationen (induziert durch das Lesen von Assoziationspaaren wie „Atemlosigkeit – Ersticken“) Panikattacken auslösen kann (Clark et al., 1988). Für einen Gedäch-tnis-Bias spricht, daß Panikpatienten angstbesetzte Situationen (Becker, Rinck & Margraf, 1994) bzw. angstbezogene Wörter (McNally, Foa & Donnell, 1989) besser erinnern als neutrale Situatio-nen bzw. Wörter.
Schließlich wurde in mehreren Studien nachgewiesen, daß eine kognitive Verhaltenstherapie, die die kognitiven Fehlinterpretationen gezielt aufdeckt und verändert, die Häufigkeit von Panikatta-cken vermindert (z. B. Clark, Salkovskis & Chalkley, 1985). Für die bedeutsame Rolle kognitiver Fehlinterpretationen für die Aufrechterhaltung der Panikstörung spricht, daß die Stärke der Verän-derung bestimmter kognitiver Merkmale (z. B. Einschätzung der Gefährlichkeit körperlicher Symp-tome) durch eine Therapie stark mit dem langfristigen Therapieerfolg zusammenhängt (Margraf & Schneider, 1993).
4.3. Die Theorie der Anxiety Sensitivity
Die Theorie der Anxiety Sensitivity (AS) von Reiss & McNally (1985) ist der dritte wichtige An-satz zur Erklärung der Entstehung von Panikangst. Nach Reiss (1991) gibt es drei fundamentale Ängste („fundamental fears“): die Angst vor Krankheit, Verletzungen und Tod, die Angst vor nega-tiven Bewertungen sowie die Angst vor der Angst („anxiety sensitivity“). Aus diesen fundamenta- len Ängsten entstehen wiederum die gelernten Ängste („common fears“), die sich auf Dinge bezie-hen, die nicht inhärent aversiv sind (z. B. Angst vor Höhen).
Anxiety Sensitivity ist definiert als Überzeugung, daß körperliche Begleiterscheinungen von Angst gefährlich und gesundheitsschädlich seien. Die körperlichen Empfindungen müssen jedoch in dieser Theorie – im Unterschied zu den kognitiven Theorien – nicht notwendig bewußt als Folgen von Angst erkannt werden, um Angst auszulösen. AS umfaßt nach Reiss und McNally (1985) sowohl kognitive als auch emotionale Aspekte und stellt eine Trait-Variable dar, die über die Zeit stabil ist, sich aber nur unter Angst-Bedingungen manifestiert. Reiss und McNally gehen dabei von einem Erwartungs-mal-Wert-Modell aus, in dem sich die in einer bestimmten Situation vorhandene Angst aus der Erwartung von Angst in dieser Situation, multipliziert mit der individuellen Stärke der Anxiety Sensitivity, ergibt.
An der Theorie der Anxiety Sensitivity wurde vor allem kritisiert, daß unklar ist, ob es sich bei AS tatsächlich um eine „fundamentale“ Angst handelt. Faktorenanalytische Untersuchungen fanden z. B. eine Korrelation zwischen AS und Trait-Angst, so daß Lilienfeld, Turner und Jacob (1993) post-ulierten, AS sei ein Unterfaktor des übergeordneten Konstruktes Trait-Angst. In weiteren Studien wurden jedoch nur moderate Korrelationen (.0 bis .36) zwischen beiden Variablen gefunden (siehe Reiss, 1991, für eine Übersicht). Weiterhin ergaben faktorenanalytische Untersuchungen, die den Anxiety Sensitivity Index (ASI), Fragebögen zur Angst vor negativen Bewertungen und Fragebö-gen zur Angst vor Krankheit und Verletzung einbezogen, eine dreifaktorielle Lösung, in der die drei gefundenen Faktoren relativ gut mit den drei fundamentalen Ängsten nach Reiss (1991) übereins-timmten (Taylor, 1993). Eine weiterer Kritikpunkt an der Theorie der Anxiety Sensitivity ist, daß sie die Mechanismen nicht näher erklärt, durch die eine erhöhte AS zustandekommt bzw. durch die erhöhte AS zu Panikattacken führt (Bouton et al., 2001).
Befunde zur Anxiety Sensitivity als Risikofaktor der Panikstörung werden in Abschnitt 6.2 darges-tellt.
5. Der Covariation Bias
5.1. Begriffsbestimmung und theoretischer Hintergrund
Der Covariation Bias (CB) ist eine Besonderheit bei der Verarbeitung angstrelevanter Reize, der sich auf die Einschätzung von Zusammenhängen (Kovariationen) zwischen Reizen bezieht. Allge-mein gesehen ist die Einschätzung von Zusammenhängen eine wichtige Fähigkeit des Menschen, die es ihm ermöglicht, Geschehnisse in der Vergangenheit zu erklären, in der Gegenwart zu kontrol-lieren und in der Zukunft vorherzusagen (De Jong & Merckelbach, 1991). Bei Personen mit erhöh-ter Ängstlichkeit oder Angststörungen kommt es jedoch häufig zu einer Überschätzung des Zu-sammenhangs zwischen angstrelevanten Reizen und negativen Konsequenzen, die als Covariation Bias bezeichnet wird. Ist die Erwartung negativer Konsequenzen nach angstrelevanten Reizen be-reits vor einer bedrohlichen Situation erhöht, spricht man von einem Expectancy Bias (EB), der den in einer konkreten Angstsituation auftretenden Covariation Bias beeinflussen kann. Determinanten des Expectancy Bias bzw. dessen Modulation im Laufe eines Versuchs sind laut Davey (1992) die geschätzte Gefahr, die von der Situation ausgeht, die bereits vorher vorhandene Angst sowie die wahrgenommene Ähnlichkeit zwischen Reiz und Konsequenz. Aufgrund von Expectancy Bias und Covariation Bias werden angstrelevante Reize als gefährlicher wahrgenommen, interpretiert und erinnert als sie tatsächlich sind.
Aus evolutionsbiologischer Sicht sind EB und CB sinnvolle Phänomene, da sie es ermöglichen, Zusammenhänge über Gefahren schnell zu lernen bzw. zu aktivieren, und somit die Überlebens-wahrscheinlichkeit erhöhen (Tomarken, Mineka & Cook, 1989). Treten sie aber in sehr starker und überdauernder Form auf, wie dies bei Angstpatienten häufig der Fall ist, können sie sich negativ auswirken und zu starker psychosozialer Beeinträchtigung führen.
Bei der Entstehung des Covariation Bias werden evolutionsbiologische Theorien und Lerntheorien diskutiert. Die Theorie der evolutionsbiologischen „Preparedness“ (Seligman, 1970) postuliert, daß evolutionäre Faktoren eine Rolle dabei spielen, wie leicht der Zusammenhang zwischen Reizen gelernt wird. Daher wird z. B. angenommen, daß Phobien vor allem bei phylogenetisch, nicht je-doch bei ontogenetisch relevanten Reizen auftreten (z. B Davey, 1995), und daß Phobien für phylo-genetische Reize besonders leicht erlernbar und sehr resistent gegen Extinktion sind (Seligman, 1971). Lerntheoretische Ansätze gehen dagegen davon aus, daß eine verstärkte Konditionierbarkeit angstrelevanter Reize bzw. ein erhöhter Widerstand gegen Extinktion mit der semantischen bzw. affektiven Ähnlichkeit zwischen unkonditioniertem und konditioniertem Reiz zusammenhängen (Hugdahl & Johnson, 1989; Tomarken, Sutton & Mineka, 1995). In einem Versuch, Elemente aus beiden Theorien zu verbinden, postuliert Davey (1992), daß ein Expectancy Bias sowohl für phylo-genetisch als auch für ontogenetisch relevante Angstreize vorhanden sein könne. Er könne jedoch durch die Erfahrung eines objektiv zufälligen Zusammenhangs zwischen Reiz und Konsequenz bei phylogenetischen Reizen schlechter korrigiert werden als bei ontogenetischen Reizen. Letztendlich spielen bei der Entstehung des Covariation Bias vermutlich evolutionsbiologische und lerntheoreti-sche Aspekte eine Rolle, sind jedoch in der Praxis oftmals schlecht zu trennen.
5.2. Das Paradigma der illusorischen Korrelation: Befunde
5.2.1. Covariation Bias bei hochängstlichen Probanden und Angstpatienten
Das Phänomen des Covariation Bias wird meist mit Hilfe des sogenannten Paradigmas der illusori-schen Korrelation untersucht. Dabei werden den Versuchspersonen angstrelevante (fear-relevant, FR) und angstirrelevante (fear-irrelevant, FI) Reize dargeboten, wobei nach den Reizen der ver-schiedenen Kategorien jeweils gleich häufig eine bestimmte Konsequenz folgt. Somit gibt es keine Korrelation zwischen einer bestimmten Reizkategorie und einer bestimmten Konsequenz. Die Pro-banden haben meist die Aufgabe, während oder nach dem Versuch die Häufigkeit einzuschätzen, mit der die Reize einer bestimmten Kategorie von einer bestimmten Konsequenz gefolgt sind bzw. waren.
In der ersten Untersuchung mit diesem Paradigma (Tomarken et al., 1989) wurden den Probanden, einer Gruppe hochängstlicher und einer Gruppe niedrigängstlicher Personen, FR-Reize (Bilder von Spinnen und Schlagen) und FI-Reize (Bilder von Pilzen und Blumen) gezeigt, die jeweils in 33 % der Fälle von einer negativen Konsequenz (elektrischer Schock), einer neutralen Konsequenz (neut- raler Ton) oder keiner Konsequenz gefolgt waren. Nur die hochängstlichen Personen zeigten einen Covariation Bias, d. h., sie überschätzten den Zusammenhang „angstrelevanter Reiz – Schock“ im Vergleich zum Zusammenhang „neutraler Reiz – Schock“. Außerdem wurde der elektrische Schock bei FR-Reizen von Hochängstlichen, nicht jedoch von Niedrigängstlichen, als schmerzhafter und angstauslösender eingeschätzt als der Schock bei FI-Reizen.
Weitere Studien zum Covariation Bias ergaben, daß sowohl hoch- als auch niedrigängstliche Personen einen Expectancy Bias für angstrelevante Reize zeigen, ein CB jedoch nur in der Gruppe der Hochängstlichen auftritt (Kennedy, Rapee & Mazurski, 1997; Amin & Lovibond, 1997). Auch bei Phobikern konnte ein CB in mehreren Studien (z. B. De Jong, van den Hout & Merckelbach, 1995; Tomarken et al., 1995) nachgewiesen werden. Bei niedrigängstlichen Personen scheinen so-mit zunächst (z. B. vor einem Versuch) die gleichen Angstschemata zu bestehen wie bei hoch-ängstlichen Personen und Angstpatienten. Niedrigängstliche scheinen jedoch ihre vorhandenen Er-wartungen durch Informationen über den tatsächlichen Zusammenhang zwischen angstrelevantem Reiz und negativer Konsequenz besser korrigieren zu können als Hochängstliche und Personen mit Angststörungen.
Faktoren, die für das Auftreten eines CB eine Rolle zu spielen scheinen, sind die phylogenetische Relevanz der Reize (z. B. Kennedy et al., 1997), die Spezifität der Reize für die jeweilige Angststö-rung (Cavanagh & Davey, 2000), die Ähnlichkeit zwischen Reiz und Konsequenz (Hugdahl & Johnson, 1989; Tomarken et al., 1995) sowie die aversive Qualität von Reiz und Konsequenz (Ho-neybourne, Matchett & Davey, 1993). Auch bei niedrigängstlichen Personen kann ein CB für angst-relevante Reize induziert werden, wenn zuvor die Wahrscheinlichkeit der negativen Konsequenz insgesamt (bei allen Reizkategorien) erhöht war (Tomarken et al., 1989), oder wenn die Kontingenz zwischen angstrelevanten Reizen und negativer Konsequenz erhöht war (Pauli, Montoya & Martz, 1996). In diesen Fällen scheinen auch niedrigängstliche Personen nicht mehr in der Lage zu sein, den tatsächlichen Zusammenhang von angstbezogenen Reizen und negativer Konsequenz richtig einzuschätzen.
Auf die klinische Relevanz des Covariation Bias weisen Befunde hin, die zeigen, daß die Stärke des CB bei unbehandelten Phobikern stärker ist als bei solchen, die einen Therapie erhalten haben (De Jong, Merckelbach, Arntz & Nijman, 1992), und daß die Stärke des CB nach einer Therapie ein signifikanter Prädiktor für die Angststärke zwei Jahre später ist (De Jong, van den Hout & Merckel-bach, 1995). Diese Ergebnisse sprechen dafür, daß dem Covariation Bias eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung irrationaler Ängste zukommt, und daß eine gezielte therapeutische Beeinflus-sung des CB für den Behandlungserfolg bedeutsam ist.
Erste Ergebnisse zu Expectancy Bias und Covariation Bias liegen auch für Panikpatienten und Per-sonen mit panikbezogenen Ängsten vor. In zwei Versuchen (Pauli, Montoya & Martz, 1996; 2001) konnte ein CB für panikrelevante Reize bei Personen mit einem erhöhten Risiko für die Panikstö-rung nachgewiesen werden. In beiden Versuchen wurden Personen mit hohen Werten im Agoraphobic Cognitions Questionnaire (ACQ; deutsche Version: Ehlers & Margraf, 1993a) mit Personen mit niedrigen ACQ-Werten verglichen. In beiden Versuchen, in denen als negative Konsequenz ein elektrischer Schock verwendet wurde, wurde nur bei Personen mit hohen ACQ-Werten einen CB für panikrelevante Bilder (medizinische Notfallsituationen), nicht jedoch für panikirrelevante neut-rale (Pilze) und positive Bilder (erotische Paare) gefunden. Allerdings verschwand der CB für pa-nikrelevante Bilder, wenn der Zusammenhang zwischen diesen Bildern und der negativen Konse-quenz zuvor sehr niedrig gewesen war. Bei Panikpatienten wurde in einer Studie (Wiedemann, Pauli & Dengler, 2001) ein EB gefunden, der spezifisch bei panikrelevanten Bildern auftrat. Weiterhin konnte bei Panikpatienten mit dem gleichen Paradigma wie bei Pauli et al. (1996; 2001) auch ein CB nachgewiesen werden, der spezifisch für panikrelevante Bilder war (Kleisz, 1999).
5.2.2. Covariation Bias und Startle-Reflex
Wenn tatsächlich die affektive Übereinstimmung zwischen angstrelevantem Reiz und negativer Konsequenz die entscheidende Rolle für die Entstehung des Covariation Bias spielt (siehe Tomar-ken et al., 1995), dann sollte es auch einen positiven Zusammenhang zwischen CB und Startle-Reflex geben. Verstärkte Startle-Reaktionen auf aversive Bilder lassen nämlich auf eine stärkere affektive Übereinstimmung zwischen Bildreiz und Startle-Reiz schließen, so daß bei aversiven Bil-dern auch ein stärkerer CB vorhanden sein sollte.
Diese Annahme wurde in Studien von VanOyen Witvliet und Vrana (2000) und Pauli, Diedrich und Müller (submitted) überprüft, wobei in beiden Studien der Einfluß von Valenz und Arousal der dar-gebotenen Reize untersucht wurde. In der Studie von VanOyen Witvliet und Vrana (2000) wurden negativ-hocherregende, negativ-niedrigerregende, positiv-hocherregende und positiv-niedrig-erregende Skripts dargeboten, auf die mit gleicher Häufigkeit ein Startle-Ton als aversive Konse-quenz folgte. Sowohl Startle-Reflex als auch CB wurden stärker vom Arousal als von der Valenz der jeweiligen Bedingungen moduliert: Bei hocherregenden Skripts waren Startle-Reflex und CB deutlich stärker als bei niedrigerregenden Skripts, und bei negativen Skripts waren Startle-Reflex und CB etwas stärker als bei positiven Skripts. In dieser Studie wurde also ein enger Zusammen-hang zwischen Startle-Reflex und Covariation Bias gefunden, wobei die Modulation von Startle-Reflex und Covariation Bias jedoch nicht davon abhing, wie aversiv der Startle-Reiz eingeschätzt wurde. Bei Pauli et al. (submitted) wurden positive, neutrale und negative Bilder gezeigt, die gleich häufig von einem Startle-Ton gefolgt waren. In dieser Untersuchung war der Startle-Reflex bei ne-gativen Bildern stärker als bei neutralen und positiven Bildern, während der CB bei negativen und positiven Bildern stärker war als bei neutralen Bildern. Pauli et al. schlossen daraus, daß der Startle-Reflex eher von der Valenz der Bildreize beeinflußt wird, während der CB eher durch das Arousal der Bilder moduliert wird.
Aufgrund der unterschiedlichen Ergebnisse der beiden Studien kann noch nicht endgültig entschie-den werden, ob es einen hohen Zusammenhang zwischen CB und Startle-Reflex gibt, oder ob beide durch unterschiedliche Reizcharakteristika moduliert werden.
5.3. Covariation Bias und Contingent Negative Variation (CNV)
5.3.1. Befunde zur CNV bei Angstpatienten
Da mehrere Studien (z. B. Rockstroh et al., 1979) gezeigt haben, daß emotionale und motivationale Faktoren bei der Entstehung der CNV eine Rolle spielen, wurden auch Angstpatienten mit dem CNV-Paradigma untersucht. In älteren Studien wurden oft inkonsistente Ergebnisse gefunden, d. h. zum Teil erhöhte (z. B. Barbas, Solyom & Dubrovsky, 1978), zum Teil verringerte (z. B. McCallum & Walter, 1968) und zum Teil gleich hohe CNV-Amplituden bei Angstpatienten im Vergleich zu Gesunden. Die Inkonsistenzen könnten jedoch darauf zurückzuführen sein, daß in diesen Studien neutrale (McCallum & Walter, 1968) oder nicht explizit angstrelevante Reize (z. B. Knott & Irwin, 1973) verwendet wurden.
Verringerte CNV-Amplituden bei Angstpatienten im Vergleich zu Gesunden (z. B. McCallum & Walter, 1968; Rizzo, Spadaro, Albani & Morocutti, 1983) wurden zum einen damit erklärt, daß die CNV bei Angstpatienten während des Versuchs aufgrund einer starken ängstlichen Erwartung gene-rell erhöht ist, so daß sie auf den Zielreiz hin nicht mehr höher ausfallen kann (Knott & Irwin, 1968). Eine alternative Erklärung wäre, daß ein bei Angstpatienten generell erhöhtes Arousal eine erhöhte Ablenkbarkeit verursacht, so daß die Reaktion auf den Zielreiz geringer ausfällt als bei Ge-sunden (z. B. Pritchard, 1986). Bestätigung für diese Auffassung lieferte ein Versuch von Proulx und Picton (1984), die zeigen konnten, daß Hochängstliche aufgrund einer erhöhten Ängstlichkeit während des Versuchs Assoziationen zwischen Reizen schlechter lernen. Sobald sie aber der Zu-sammenhang zwischen den Reizen erkannt haben, weisen sie höhere CNV-Amplituden als Niedrig-ängstliche auf.
Ein weiterer Einflußfaktor auf die CNV-Amplitude scheint die Kontrollierbarkeit des aversiven Reizes zu sein. Bei der Untersuchung dieser Fragestellung wurde meist ein neutraler Hinweisreiz als S1 verwendet, ein angstrelevanter Bildreiz als S2. Dabei wurden bei Phobikern erhöhte CNV-Amplituden bei angstrelevanten im Vergleich zu neutralen Reizen gefunden, wenn der S2 kontrol-lierbar war (Dubrovsky, Solyom & Barbas, 1978), während reduzierte CNV-Amplituden gefunden wurden, wenn der S2 unkontrollierbar war (Lumsden, Fenton & Howard, 1980). Regan und Howard (1991) fanden bei Gesunden ebenfalls eine Verminderung der CNV-Amplitude bei einem un-kontrollierbaren S2, während die CNV-Amplituden von Angstpatienten bei kontrollierbaren und unkontrollierbaren FR Reizen gleichermaßen hoch waren.
Somit sind die Ergebnisse zur CNV bei Angstpatienten relativ inkonsistent. Verringerte CNV-Amplituden für angstrelevanten Reize bei Angstpatienten scheinen zum einen mit dem Gefühl der Unkontrollierbarkeit des aversive Reizes zusammenzuhängen, zum anderen mit dem Erlernen des S1-S2-Zusammenhangs.
5.3.2. Befunde zum Zusammenhang von Covariation Bias und CNV
Für die später beschriebenen empirischen Untersuchungen sind Studien, die den Zusammenhang zwischen CNV und Covariation Bias untersucht haben, bedeutsamer als allgemeine Untersuchun-gen zur CNV bei Angstpatienten. In frühen Studien zum Zusammenhang von CNV und Auftre-tenswahrscheinlichkeit des S2 wurden keine konsistenten Ergebnisse gefunden. Walter, Cooper, Aldridge, McCallum & Winter (1964) berichteten eine verringerte CNV-Amplitude bei 50 % Auf-tretenswahrscheinlichkeit des S2, Karrer, Kohn und Ivins (1973) dagegen eine erhöhte CNV-Amplitude. McCallum (1988) fand die höchste CNV-Amplitude bei der höchsten Auftretenswahr-scheinlichkeit des S2. In diesen Studien waren die Interstimulus-Intervalle jedoch relativ kurz, so daß keine Unterscheidung zwischen früher und später CNV-Komponente möglich war. Gaillard (1977) benutzte ein längeres Interstimulus-Intervall, und fand einen Zusammenhang mit der Wahr-scheinlichkeit des S2 nur bei der späten CNV-Komponente.
Eine neuere Studie von Backs und Grings (1985) untersuchte den Zusammenhang von Covariation Bias und CNV, indem der aversive S2 entweder mit 17 %, 50 % oder 83 % Auftretenswahrschein-lichkeit nach dem neutralen S1 dargeboten wurde. Die frühe CNV-Komponente war bei 50 % Auf-tretenswahrscheinlichkeit negativer als bei 17 % oder 83 %. Somit war die höchste CNV-Amplitude bei der geringsten Vorhersagbarkeit des S2 vorhanden. In dieser Studie wiesen die Probanden aller-dings keinen subjektiven CB auf, sondern zeigten relativ realistische Häufigkeitsschätzungen.
Regan und Howard (1995) untersuchten die CNV bei Angstkonditionierung bei gesunden Proban-den. In einer Bedingung wurden FR-Reize (Bilder von angsterregenden Tieren) gezeigt, in der an-deren Bedingung FI-Reize (Bilder von Landschaften), wobei jeweils eine Unterkategorie der FR-bzw. FI-Reize mit einem unangenehmen Startle-Ton gepaart war (konditionierter Reiz, CS+), die andere nicht (unkonditionierter Reiz, CS-). In dieser Studie war die CNV sowohl in der Lern- als auch in der Extinktionsphase bei konditionierten FR-Reizen stärker als bei unkonditionierten FR-Reizen, während sie sich für konditionierte und unkonditionierte FI-Reizen nicht unterschied. Die-ser Effekt war besonders ausgeprägt für die späte CNV-Komponente. Dies läßt darauf schließen, daß ein stärkerer Konditionierungseffekt für FR- im Vergleich zu FI-Reizen mit einer verstärkten CNV-Amplitude zusammenhängt.
Der Zusammenhang zwischen Covariation Bias und CNV bei Panikpatienten wurde von Kleisz (1999) mit einem ähnlichen Versuchsdesign wie bei Pauli et al. (1996) untersucht: Es wurden drei Kategorien von Bildern (panikrelevante Notfallbilder, panikirrelevante Pilz- und Erotikbilder) ver-wendet, wobei auf jeweils 33 % der Bilder jeder Bildkategorie ein aversiver Startle-Ton, ein neutra-ler Ton oder keine Konsequenz folgte. Die CNV-Amplitude für Notfallbilder war bei Patienten und Kontrollpersonen negativer als für die beiden anderen Bildkategorien, war jedoch bei Patienten im Trend noch negativer als bei den Kontrollpersonen. Dieses Ergebnis liefern erste Hinweise darauf, daß Panikpatienten für panikrelevante Bilder eine erhöhte CNV-Amplitude aufweisen, die mit der verstärkten Erwartung negativer Konsequenzen für diese Bilder zusammenhängen könnte. Eine weitere Studie zur CNV bei Panikpatienten (Sinyachkin & Voznesenskaya, 1997) konnte auf Streß-reize zwei unterschiedliche Reaktionen feststellen: In einer Subgruppe wurde eine erhöhte CNV-Amplitude und ein erhöhtes EMG im Vergleich zu neutralen Reizen gefunden, in einer zweiten Subgruppe (mit schwererer Symptomatik) dagegen eine verringerte CNV-Amplitude und ein ver-ringertes EMG. Somit ist das Auftreten einer erhöhten CNV-Amplitude für aversive Reize mögli-cherweise durch bestimmte klinische Merkmale der Panikstörung mitbedingt.
Zusammenfassend sind auch die Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen CNV und Erwartung einer bestimmten Konsequenz nicht ganz konsistent, was möglicherweise mit unterschiedlichen Instruktionen, unterschiedlicher Aufgabenschwierigkeit, aber auch unterschiedlichen Probanden-gruppen in den verschiedenen Studien zusammenhängen könnte (Rockstroh et al., 1989). Neuere Untersuchungen ergeben jedoch relativ übereinstimmend einen Zusammenhang zwischen der CNV- Amplitude und der Auftretenswahrscheinlichkeit sowie der Valenz des S2, und liefern Hinweise darauf, daß dieser Zusammenhang auch für Panikpatienten gelten könnte.
[...]
- Arbeit zitieren
- Christine Amrhein (Autor:in), 2003, Kognitive und psychophysiologische Verarbeitungsmechanismen bei der Panikstörung und bei Personen mit einem erhöhten Risiko für die Panikstörung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128106
Kostenlos Autor werden












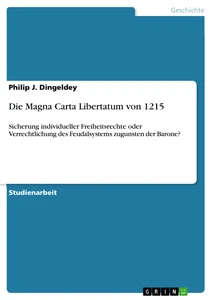

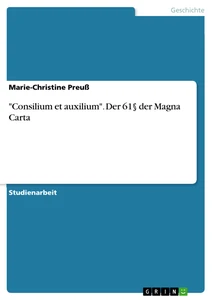





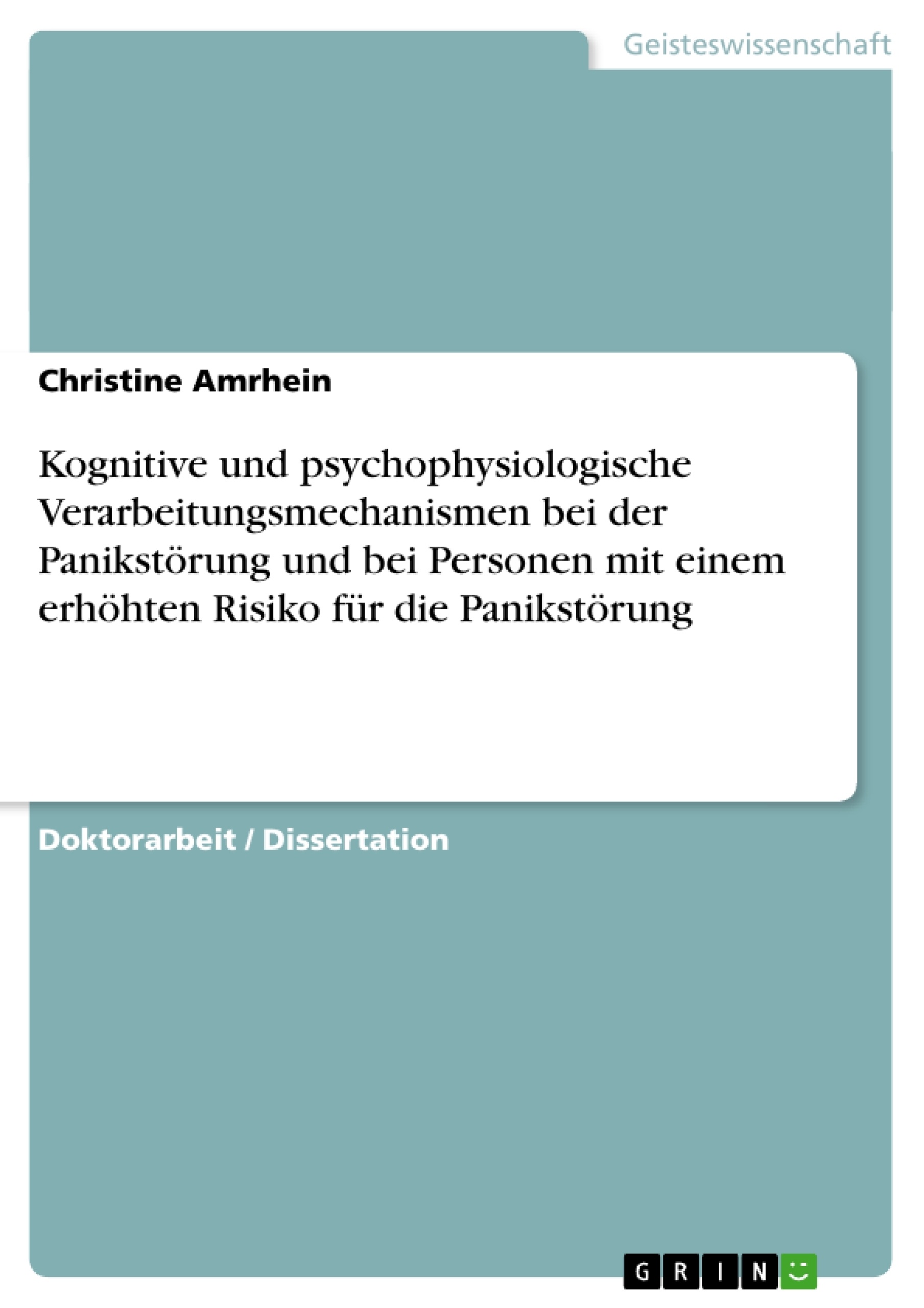

Kommentare