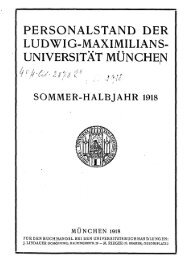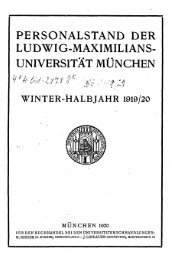Dichterberuf im bürgerlichen Zeitalter. Joseph Viktor von Scheffel ...
Dichterberuf im bürgerlichen Zeitalter. Joseph Viktor von Scheffel ...
Dichterberuf im bürgerlichen Zeitalter. Joseph Viktor von Scheffel ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ROLF SELBMANN<br />
<strong>Dichterberuf</strong> <strong>im</strong> <strong>bürgerlichen</strong> <strong>Zeitalter</strong><br />
<strong>Joseph</strong> <strong>Viktor</strong> <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong><br />
und seine Literatur<br />
Mit 32 Abbildungen<br />
HEIDELBERG 1982<br />
CARL WINTER • UNIVERSITÄTSVERLAG
i C- & V V 0 6 ' f<br />
H<br />
Gedruckt mit Hilfe der Geschwister Boehringer Ingelhe<strong>im</strong> Stiftung für Geisteswissenschaften<br />
in Ingelhe<strong>im</strong> am Rhein<br />
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek<br />
Selbmann, Rolf:<br />
<strong>Dichterberuf</strong> <strong>im</strong> <strong>bürgerlichen</strong> <strong>Zeitalter</strong>: <strong>Joseph</strong> <strong>Viktor</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> u. seine Literatur / Rolf Selbmann. -<br />
Heidelberg: Winter, 1982.<br />
(Beiträge zur neueren Literaturgeschichte:<br />
Folge 3; Bd. 58)<br />
ISBN 3-533-03200-0 kart.<br />
ISBN 3-533-03201-9 Gewebe<br />
NE: Beiträge zur neueren Literaturgeschichte / 03<br />
Universltäts-<br />
Biblic-?hok<br />
München<br />
ISBN 3-533-03200-0 Kart.<br />
ISBN 3-533-03201-9 Ln.<br />
Alle Rechte vorbehalten. © 1982. Carl Winter Universitätsverlag, gegr. 1822, GmbH., Heidelberg<br />
Photomechanische Wiedergabe nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch den Verlag<br />
Impr<strong>im</strong>e en Allemagne. Printed in Germany<br />
Reproduktion und Druck: Carl Winter Universitätsverlag, Abteilung Druckerei, Heidelberg
5<br />
VORWORT<br />
Ginge alles mit rechten Dingen zu, dann hätte die vorliegende<br />
Studie eigentlich in Karlsruhe erscheinen müssen. Doch die<br />
"Literarische Vereinigung" am Geburtsort <strong>Scheffel</strong>s, die sich<br />
nur noch verschämt in Klammern "<strong>Scheffel</strong>bund" nennt, versteht<br />
sich auch heute noch als Huldigungsstätte für den einstmals<br />
volkstümlichsten Dichter Deutschlands. Dort i s t man der Meinung,<br />
daß <strong>Scheffel</strong> "uns heute noch unmittelbar anspricht", i<br />
Gleiches g i l t übrigens mit wenig Variation für Franken, das<br />
<strong>Scheffel</strong> ebenfalls ausführlich besungen hat. Von dort kann<br />
man erfahren, daß "Kritik an <strong>Scheffel</strong> <strong>von</strong> der breiten Öffentlichkeit<br />
nicht akzeptiert wird".<br />
Eine solche allerjüngste Wirkungsgeschichte des ehemals hochberühmten<br />
und heute so gut wie vergessenen Dichters fordert<br />
zu dem Versuch heraus, <strong>Scheffel</strong> wieder zum Gegenstand einer<br />
literaturgeschichtlichen Untersuchung zu erheben. Freilich<br />
s o l l nicht einem Biographismus das Wort geredet werden, der<br />
glaubt, das Historische aus dem Biographischen erklären zu<br />
können. Vielmehr geht es um die Aussagekraft <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>s<br />
Leben und Werk zum Verständnis grundlegender Bewußtseinsprozesse<br />
des 19. Jahrhunderts. Insofern versteht sich die vorliegende<br />
Werkanalyse als sozialgeschichtliche Studie, indem<br />
sie den Spuren des <strong>Scheffel</strong>werks folgt und erst <strong>von</strong> dort her<br />
zu allgemeineren literaturhistorischen Aussagen vorstoßen w i l l .<br />
Zu erwähnen bliebe noch, daß ich <strong>im</strong> 1. Kapitel (S. 12-24-) Gedanken<br />
aufnehme, die ich in der Zeitschrift für die Geschichte<br />
des Oberrheins 126 (1978) S. 285-302 leicht verändert ausgeführt<br />
habe ("Der Dichter und seine Zeit. <strong>Joseph</strong> <strong>Viktor</strong> <strong>von</strong><br />
<strong>Scheffel</strong> und das 19. Jahrhundert").<br />
Zu Dank verpflichtet bin ich Günter Hess für jahrelange Teilnahme<br />
und ermutigenden Zuspruch.<br />
München, <strong>im</strong> August 1982 R. S.
7<br />
INHALT<br />
EINLEITUNG 9<br />
1. Positionen: welches i s t der richtige <strong>Scheffel</strong>? 9<br />
2. Lebensgeschichte als Literaturgeschichte<br />
oder: was erklärt die Biographie? 12<br />
I. DICHTER UND DICHTUNG 25<br />
1. Dichterbewußtsein und Sängerrolle 25<br />
2. Strukturen poetischer Illusion 41<br />
3. "Ach, ich bin ein"Epigone": Vorbilder 52<br />
II. DICHTER UND GESCHICHTE 63<br />
1. Der historische Roman 63<br />
2. Geschichte und Gegenwart 67<br />
3. Geschichte als Wissenschaft 73<br />
III. DICHTER UND WIRKLICHKEIT 77<br />
1 . Geschichte als Erzählung 77<br />
2. Dichter und Realität 79<br />
3. <strong>Scheffel</strong> - ein Realist? 91<br />
IV. DICHTER UND POLITIK 97<br />
1 . Rhetorik und Mythos<br />
<strong>Scheffel</strong>s politisches Selbstverständnis 97<br />
2. Der ewige Student<br />
Von der Burschenschaft zum Stammtisch 107<br />
3. Vom Deutschen Bund zum Deutschen Reich 117<br />
V. DICHTER UND BÜRGERLICHE GESELLSCHAFT 125<br />
1. Der Biirgerdichter 125<br />
2. Der Dichterfürst 128<br />
3. Der Wanderdichter 136
8<br />
VI. DICHTER UND PUBLIKUM U9<br />
1. Schweigen als poetische Leistung 149<br />
2. <strong>Scheffel</strong> und seine Leser 156<br />
3. Der erklärbare Erfolg 1 61<br />
VII. DER ILLUSTRIERTE DICHTER 167<br />
1. Die i l l u s t r i e r t e Prachtausgabe 167<br />
2. Die Illustrationen Anton <strong>von</strong> Werners<br />
2-un ipe./iu4 - QaudeamuA - 7/iompe.te./i <strong>von</strong> Sä/c/cingen 170<br />
3. Bild statt Text<br />
Bildbetrachtung als Literaturrezeption 196<br />
ANMERKUNGEN 200<br />
ZEITTAFEL 221<br />
LITERATURVERZEICHNIS 22 5<br />
ABBILDUNGEN 233
9<br />
EINLEITUNG<br />
1. Positionen: Welches i s t der richtige <strong>Scheffel</strong>?<br />
n<br />
E.kke.h.a/id zählt zu den besten Büchern, die ich gelesen", schreibt<br />
Theodor Fontane Mitte der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts<br />
i<br />
in einer Rezension des Scheffeischen Erfolgsroraans . Wie konnte<br />
sich Fontane so irren? Oder: i r r t e er sich wirklich? Zur Erklärung<br />
eines so enthusiastischen Urteils könnte einiges angeführt<br />
werden (s. Kap. I I ) , zur Rechtfertigung diene vorläufig nur der<br />
Hinweis, daß Fontane mit seiner Meinung keineswegs a l l e i n dastand.<br />
Noch bis in die ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts<br />
galt manchem <strong>Scheffel</strong> als der "volkstümlichste Dichter Deutsch-<br />
2<br />
lands" . Um die Jahrhundertwende erreichten die Auflagen der<br />
3<br />
<strong>Scheffel</strong>werke die Millionengrenze und einer der ersten Biographen<br />
fand 1886, <strong>im</strong> Todesjahr <strong>Scheffel</strong>s, jeder echte Deutsche<br />
habe "neben seiner Bibel nur noch ein Buch <strong>Scheffel</strong>s" <strong>im</strong> Hause.<br />
"Das eine verbindet ihn mit Gott, das andere mit seinem Volke."^<br />
<strong>Scheffel</strong>vereine und -bünde haben, angeblich <strong>im</strong> Sinne <strong>Scheffel</strong>s,<br />
eine nationaldeutsche Poesie gefördert^ und dabei nicht <strong>im</strong>mer<br />
eine glückliche Rolle gespielt.<br />
Als Börries <strong>von</strong> Münchhausen, dessen reaktionäre politische und<br />
poetische Prinzipien außer Zweifel stehen, 1926 den ersten (und<br />
einzigen) Band einer neuen Folge <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>-Jahrbüchern herausgibt,<br />
i s t diese kritiklose nationale Identifikation a l l e r <br />
dings schon in Verruf gekommen. Münchhausen prophezeit zwar<br />
"etwa um 1975" eine <strong>Scheffel</strong>-Renaissance, eine "/ie.4ui/ie.c£ io<br />
a moitui*" <strong>im</strong> Zusammenhang mit <strong>Scheffel</strong>s 150. Geburtstag: "Freilich<br />
eine Auferstehung, die ein wenig nach Reliquie aussieht<br />
und nach Historie schmeckt."^<br />
Der traditionsverbundene Balladendichter formuliert dabei nicht<br />
schlecht seinen eigenen, <strong>von</strong> den Zeitläuften zum Scheitern verurteilten<br />
Versuch, die <strong>Scheffel</strong>-Verehrung gleichsam antiquarisch<br />
und doch zeitlos wiederzubeleben. Aufhorchen läßt indes die<br />
Art und Weise, in der <strong>Scheffel</strong>s Werk vor der Vergessenheit<br />
bewahrt<br />
werden s o l l . In einem merkwürdigen Vorgriff auf moderne<br />
7<br />
Rezeptionstheorien entwickelt Münchhausen ein literarisches
10<br />
Wertungsmodell, anhand dessen historisch erklärt werden s o l l ,<br />
warum <strong>Scheffel</strong> zur Zeit - 1926 - dem Interesse des Lesers verg<br />
loren gegangen i s t . <strong>Scheffel</strong>s Tragik, so Münchhausen, sei es,<br />
daß sich die <strong>Scheffel</strong>rezeption derzeit auf der Stufe interesseloser<br />
Unmodernität befinde. Dieser nachgewiesene Horizontwandel<br />
s o l l nun dazu dienen, den angeblich zeitlosen Anteil an den<br />
Dichtungen <strong>Scheffel</strong>s für die Literaturgeschichte und die Lesernachwelt<br />
zu retten. Im Auseinanderklaffen <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>s "Volkso<br />
tümlichkeit" und den "Nichtigkeiten" manch b i l l i g e r Verschen<br />
liegt das Dilemma, in dem Münchhausen sich windet. Seine Lamentationen<br />
trennen deshalb die falsche <strong>Scheffel</strong>-Rezeption nach<br />
1 0<br />
"dem schlechten Geschmacke der Halbgebildeten" <strong>von</strong> der Forderung,<br />
"den wesentlichen <strong>Scheffel</strong> vom unwesentlichen <strong>Scheffel</strong><br />
zu befreien", d. h. man müsse <strong>Scheffel</strong> "nach seinen &e.4te.n<br />
Werken beurteilen, nicht aber nach denen, die am meisten dem<br />
11<br />
Z e i t s t i l Opfer gebracht haben".<br />
Mit Münchhausens erfolglosem Rettungsversuch hat die Wirkungsgeschichte<br />
<strong>Scheffel</strong>s ein Ende gefunden, sieht man einmal vom<br />
Dritten Reich ab, das sich <strong>Scheffel</strong> als volkstümelnden und ur-<br />
12<br />
deutschen Stammesdichter einzuverleiben versucht hat . Mit dem<br />
Ende der erstaunlichen Wirkungsgeschichte <strong>Scheffel</strong>s sind aber<br />
auch der Dichter und sein Werk als Gegenstand kritischer Analyse<br />
überhaupt verloren gegangen. Zu welchen Ergebnissen eine journalistisch<br />
flotte, aber eben unhistorische Betrachtung kommt,<br />
zeigt ein vereinzelter Versuch der Gegenwart, <strong>Scheffel</strong> und seine<br />
Literatur nach dem Maßstab oberflächlicher Aktualität zu<br />
1 3<br />
beurteilen: "Was i s t mit seinen Texten noch anzufangen?"<br />
1 L<br />
Wenn Literatur nur als "Mittel der Selbsttherapie" gesehen<br />
und die Wirkungsgeschichte <strong>von</strong> Texten als "Werbenummer für den<br />
1 5<br />
Fremdenverkehrsverein" auf die Texte zurückprojiziert wird,<br />
kann das Ergebnis nicht zweifelhaft sein: <strong>Scheffel</strong> i s t "konsum-<br />
16<br />
chic", "schön angepaßt und vollkommen ungefährlich" . Die<br />
1 7<br />
"okkupatorische Identifikation" , die <strong>Scheffel</strong>s Werke ihrem<br />
Publikum anbieten, kann so zwar eingesehen, aber nicht erklärt<br />
werden.<br />
Welches i s t also der richtige <strong>Scheffel</strong>? Wenn es st<strong>im</strong>mt, daß
11<br />
auch die Unterschlagung <strong>Scheffel</strong>s auf eine Methode. Erfolg und<br />
Ansehen <strong>Scheffel</strong>s unter den Zeitgenossen und bis in das erste<br />
Drittel unseres Jahrhunderts korrespondieren nicht zufällig<br />
mit seiner Verdrängung in der gegenwärtigen Literaturwissenschaft.<br />
Diese Verdrängung zeigt die Schwierigkeit auf, mit<br />
einem Gegenstand zurecht zu kommen, der in die allgemeinen Erwartungen<br />
literaturwissenschaftlicher Methodologie nicht recht<br />
passen w i l l . Die bisherigen Versuche, solche und ähnliche<br />
Gegenstände in ein Konzept methodischen Konsenses zu integrieren,<br />
erweisen sich meist als Verlegenheitslösungen. So muß dem<br />
heutigen Betrachter der gestern bejubelte Erfolg <strong>Scheffel</strong>s als<br />
1 8<br />
"beschämend" vorkommen. In diesem Fall scheint die Identifikation<br />
des literaturwissenschaftlichen Lesers mit seinem Gegenstand<br />
oder vielmehr das Gegenteil einer solchen Identifikation<br />
ihre Hand <strong>im</strong> Spiel zu haben.<br />
Gerade <strong>Scheffel</strong> hat seinem Publikum die Identifikation so leicht<br />
gemacht wie kaum ein anderer Dichter. Das erkannte schon der<br />
Verfasser des ersten Nachrufes auf <strong>Scheffel</strong>: "Wie feinsinnig<br />
hat <strong>Scheffel</strong> herausgefühlt, was unsre Welt vom Dichter ver-<br />
1 9<br />
langt" . Man hat deshalb auch dieses Identifikationsangebot<br />
als einen der wichtigsten Gründe für die <strong>Scheffel</strong>rezeption <strong>im</strong><br />
20<br />
19. Jahrhundert angesehen . Autor und Leser treten in eine<br />
umkehrbare Beziehung wechselseitiger Identifikationsangebote,<br />
nämlich "die Neigung des Autors auf das Entgegenkommen des<br />
Publikums und umgekehrt: die Neigung des Publikums auf das<br />
21<br />
Entgegenkommen des<br />
Autors"<br />
Vor einem solchen Hintergrund s t e l l t sich die Frage nach dem<br />
literarischen Rang <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>s Werk insofern neu, als der<br />
Blick auf die höchst eindrucksvolle Wirkungsgeschichte <strong>Scheffel</strong>s<br />
22<br />
<strong>im</strong> 19. Jahrhundert vieles beleuchtet, was den Erfolg erklären,<br />
eine Beurteilung des Wertes aber nicht leisten kann. Sogar die<br />
gründlichste neuere Untersuchung windet sich in diesem Dilemma,<br />
<strong>Scheffel</strong> zwischen einem exotischen und einem sozialhistorischen<br />
Interesse anzusiedeln - <strong>Scheffel</strong>, dessen "literarischer Rang<br />
2 3<br />
unbestritten zweifelhaft i s t " .<br />
Stutzig wird man, wenn man die entsprechenden literaturgeschichtlichen<br />
Handbücher zu Hilfe n<strong>im</strong>mt. Fritz Martini behandelt in
12<br />
zum billigen Bierkneipenton" besonders ausgeprägt findet.<br />
"Dennoch", so meint Martini, " i s t <strong>Scheffel</strong>s Dichten l i t e r a r -<br />
25<br />
historisch für die Situation nach 184-8 symptomatisch . Und<br />
Friedrich Sengle, der sich mit Recht über die humoristischen<br />
Versepen der Biedermeierzeit mokiert, gesteht zu, "daß auch der<br />
7/iompe.te./i <strong>von</strong> Säckinge.n auf die erstaunlich breite Luftbrücke<br />
gehört, die vom Biedermeier über den Realismus hinweg zur Neu-<br />
2 6<br />
romantik und zur He<strong>im</strong>atkunst führt" . Dem bloß kurios h i s t o r i <br />
schen Interesse an <strong>Scheffel</strong> folgt also sogleich das Eingeständnis<br />
einer auch literarhistorischen Bedeutung. Dem schließt sich<br />
die Erkenntnis an, daß sich <strong>Scheffel</strong>s Werk an einer Nahtstelle<br />
der Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts befindet.<br />
2. Lebensgeschichte als Literaturgeschichte oder: was erklärt<br />
die<br />
Biographie?<br />
das> {iß./ikomme.n<br />
Die Lebensdaten <strong>Joseph</strong> <strong>Viktor</strong> <strong>Scheffel</strong>s - geboren am 26. Februar<br />
1826 in Karlsruhe, gestorben am 6. April 1886 ebenda - markieren<br />
schon äußerlich eine Epoche, für deren Einordnung handliche<br />
Begriffe nur schwer passen. Zur gleichen Zeit werden z. B. geboren<br />
C.F.Meyer, Johann Strauß (1825) und Arnold Böcklin (1827),<br />
aber auch Ferdinand Lasalle (1825) und Wilhelm Liebknecht (1826).<br />
Deutlicher als diese Zeitgenossenschaft versinnbildlicht das<br />
Karlsruher Elternhaus <strong>Scheffel</strong>s zwei zentrale, nur scheinbar<br />
disparate Aspekte <strong>im</strong> Denken des gebildeten Bürgertums jener Zeit.<br />
Vater und Mutter vertreten gleichsam modellhaft jene verdich-<br />
27<br />
tete "patriotische St<strong>im</strong>mungswelt" der 40er Jahre. <strong>Scheffel</strong>s<br />
Vater, ein Offizier und Ingenieur, verkörpert dabei eher die<br />
national-politisch ausgerichtete Komponente eines Denkens, das<br />
sich an der Geschichtserfahrung der Befreiungskriege, der Hoffnung<br />
auf Wiederherstellung des Reiches und am staatlichen. Dualismus<br />
des Deutschen Bundes orientiert. Die Grenzlage Badens<br />
mit seiner eigenstaatlichen Tradition nach Französischer Revolution<br />
und Rheinbundzeit tut ein übriges zur Förderung der<br />
nationalen Grundst<strong>im</strong>mung; in der Rheingrenze verbindet sich der<br />
politische Anspruch auf die Reichseinheit mit dem erwachenden
13<br />
kulturellen Selbstbewußtsein einer Nation. Die Rheinkrise des<br />
Jahres<br />
184.0 und der wiederaufgenommene Bau des Kölner Domes als<br />
nationales Symbol sind die Zeichen dafür.<br />
Die Erfahrungen des jungen <strong>Joseph</strong> <strong>Scheffel</strong> mit der Geselligkeitskultur<br />
und der Bildungswelt des Biedermeier entstammen<br />
dagegen weitgehend dem Lebenskreis der Mutter. Die Biographen<br />
wissen zu berichten, daß die Mutter <strong>Scheffel</strong>s "in den geselligen<br />
Kreisen der Residenz eine hervorragende Stellung" einge-<br />
28<br />
nommen habe . Die Mutter führt ein großes Haus, gar einen<br />
Salon, in dem sich die großbürgerliche und adelige Besitz- und<br />
Bildungsschicht ganz Badens bis hin zur großherzoglichen<br />
Familie versammelt, also "alles, was zur Gesellschaft zählte" .<br />
Es i s t indes bezeichnend für den Umbruch dieser 40er Jahre,<br />
daß der Sohn für diese Art geselliger Salonkultur wenig<br />
Interesse zeigt. Er schreibt:<br />
"Für das Qe^eti^cha/t^>te.He.n i s t mir noch <strong>im</strong>mer nicht der<br />
rechte Sinn aufgegangen; aber aus guten Gründen, denn der<br />
Karlsruher Ton und das ganze hiesige feinere Wesen sind<br />
keineswegs <strong>von</strong> der Art, daß man dadurch angeregt werden<br />
könnte. Es i s t zuviel Hofluft, zu v i e l Bürokratie und zuviel<br />
Äußerlichkeit hier" (30)<br />
<strong>Scheffel</strong>s Wunsch, nach "Naturanlage und Neigung" Maler zu werden,<br />
i s t die Konsequenz aus solchen Jugendeindrücken; "Erziehung<br />
31<br />
und Verhältnisse" fordern jedoch ein dem gesellschaftlichen<br />
Stand angemessenes Jurastudium.<br />
Um diese Kluft zwischen seinen idealen Kunstvorstellungen und<br />
der Notwendigkeit eines Brotberufes zu überbrücken, verläßt<br />
<strong>Scheffel</strong> 1843 das Karlsruher Lyceum und beginnt sein Studium<br />
in der Kunststadt München. München hatte f r e i l i c h <strong>im</strong> Jahre<br />
1843 sein Gesicht erheblich verändert. Die Stadt war schon<br />
lange nicht mehr die klassizistische und liberale Kunstmetropole<br />
Ludwigs I., sondern war nach dessen sog. konservativer Wendung<br />
<strong>von</strong> 1837 ein Sammelpunkt des ästhetisch-politischen Katholizismus<br />
geworden. Hier trafen sich die katholische Staatsrestauration,<br />
der Ultramontanismus und die Bildungsaristokratie<br />
<strong>im</strong> Umkreis des Königs. Vor allem der vom antifranzösischen<br />
Nationalhelden zum kämpferischen Katholiken gewandelte <strong>Joseph</strong><br />
Görres zieht <strong>Scheffel</strong>, nicht zuletzt dank Empfehlungsschreiben<br />
des katholischen Elternhauses, in seinen Kreis. Doch pflegt<br />
29
u<br />
<strong>Scheffel</strong> in kritischer Distanz auch den Kontakt zum Kreis des<br />
Protestanten und Klassizisten Friedrich <strong>von</strong> Thiersch. Sein<br />
32<br />
"fledermausartiges Herumstreifen in beiden Cliquen" bringt<br />
<strong>Scheffel</strong> darüber hinaus die lebenslange Freundschaft mit dem<br />
Kunsthistoriker Friedrich Eggers ein, eine später wichtige<br />
Figur <strong>im</strong> Berliner Dichterkreis De./i 7unne.£ ä&e/i de,/i Sp/iee., In<br />
dieser durch Theodor Fontane bekannt gewordenen Dichtervereinigung<br />
verkehrten auch Emanuel Geibel und Paul Heyse, die<br />
seit den 50er Jahren den Kern des Münchner Dichterkreises um<br />
König Max II. bilden werden und mit denen <strong>Scheffel</strong> in freundschaftlichen<br />
Beziehungen stehen wird.<br />
München, so kann man zusammenfassen, i s t für <strong>Scheffel</strong> nicht<br />
3 3<br />
nur die "Stadt der Kunst und des Bieres" , sondern der Ort<br />
der ersten lebendigen Erfahrung <strong>von</strong> den Wechselwirkungen der<br />
Kunst mit den politischen und gesellschaftlichen Strömungen<br />
34.<br />
der Zeit. "Münchnerisch und mittelalterlich" ^ sind für<br />
<strong>Scheffel</strong> noch bis weit über 184.8 hinaus identisch. Denn die<br />
als Restauration politisch gewordene Romantik i s t für <strong>Scheffel</strong><br />
der erste Ansatzpunkt seiner Kunstkritik:<br />
"und zwar sehe ich die Romantik nicht bloß in ihrer Wirksamkeit<br />
in der Poesie, die mehr schon eine vergangene i s t ,<br />
sondern auch praktisch in der bildenden Kunst, sowie in<br />
Kirche und Staat, wo sie noch nicht überwunden i s t , - als<br />
eine durchaus zusammengehörige Erscheinung, als Manifestationen<br />
eines und desselben Prinzips an, - und habe v i e l<br />
Spaß am dem Aufspüren desselben gehabt. Unter dieser Romantik<br />
verstehe ich <strong>im</strong> allgemeinen das Prinzip, statt der<br />
Wirklichkeit einen Roman zu spielen, oder statt des begriffsmäßigen<br />
Erkennens ein poetisches Herumvagieren für<br />
tiefer zu halten. In der Poesie sind diese Romantiker am<br />
unschädlichsten, und haben sogar Treffliches geleistet, -<br />
ich habe an Tieck, Ach<strong>im</strong> <strong>von</strong> Arn<strong>im</strong>, Brentano etc. mich<br />
mannigfach ergötzt, und wenn hie und da ihr Pegasus ein<br />
wenig besoffen die Kreuz und Quer herumreitet, oder wenn<br />
sich der Dichter gar zu zart <strong>von</strong> Tau und Waldhornklängen<br />
nährt, so i s t das seine Sache und schadet niemandem v i e l .<br />
In der Malerei wird's schon bedenklicher, weil die Romantiker<br />
wie Overbeck und Cornelius ihren Schülern geradezu<br />
den Sinn <strong>von</strong> dem, was geraalt werden s o l l , auf das, was nicht<br />
gemalt werden s o l l , hinlenken und statt Künstlern Pfaffen<br />
aus ihnen machen, die glauben, wenn sie einen frommen Gedanken<br />
haben, so gäbe sich die Technik <strong>von</strong> selbst. Die Romantiker<br />
in Kirche und Staat aber, - <strong>von</strong> Gentz und Stahl<br />
bis auf Goerres und den Verfasser der Gespräche in der<br />
Gegenwart/= Radowitz.7 etc, die bilden den Krebsschaden in<br />
der ganzen politischen Entwicklung unserer Zeit und sind -<br />
mit ihrer geschichtlichen Pietät fürs Mittelalter und ihren
15<br />
Romanbegriffen, z. B. Gotteingesetztes Königtum, den Forderungen<br />
der Gegenwart, z. B. konstitutionelle Regierungsform<br />
geradezu feindlich entgegengesetzt; - deshalb zwar zu studieren,<br />
aber abzumucken, wo man kann" (35)<br />
Sicher i s t <strong>Scheffel</strong>s Urteil philosophisch nicht sehr originell -<br />
handelt es sich doch bei seiner Romantikkritik um Gemeinplätze<br />
der hegelianischen Schule. Bemerkenswerter als die politische<br />
Begründung der Romantik<br />
i s t die Ableitung der Restauration<br />
aus der Ästhetik oder deutlicher: die <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> postulierte<br />
direkte Relation der Kunst mit der Zeit. Die Ausrichtung<br />
eines Kunstbegriffs, der die Bestrebungen des Görreskreises<br />
und die Nazarenermalerei umfaßt, an der eigenen Zeit statt an<br />
der Vergangenheit wird zum Leitmotiv aller kritischen Erörterungen<br />
<strong>Scheffel</strong>s und geht dann doch einen Schritt über den<br />
populären Junghegelianismus hinaus. Denn wenn <strong>Scheffel</strong> Zeitund<br />
Kunstwirklichkeit identisch setzt, gewinnt er ein Kriterium<br />
für jeweils beides: die Ubereinst<strong>im</strong>mung mit der Zeit erst<br />
legit<strong>im</strong>iert die Kunst als Wirklichkeit der Gegenwart. Im Gespräch,<br />
das <strong>Scheffel</strong> mit dem ehemaligen Haupt der Nazarener,<br />
Peter <strong>von</strong> Cornelius, 184-6 in Berlin<br />
führt, i s t die heftige<br />
Polemik gegen die Nazarenermalerei nur mehr der Vorwand zur<br />
Entwicklung der eigenen<br />
Kunstvorstellungen:<br />
"Meine Ansicht <strong>von</strong> der Aufgabe der Malerei i s t eine ziemlich<br />
verschiedene <strong>von</strong> der unserer deutschen Maler, die <strong>von</strong> einer<br />
Rückkehr und Vertiefung in Form und Wesen der mittelalterlichen,<br />
besonders der altitalienischen Kunst eine Reorganisation<br />
unsrer Kunstbestrebungen erwarten. Der Zweck der<br />
Malerei, wenn sie irgend eine Stelle in der allgemeinen<br />
geistigen Entwicklung des Volkes einnehmen w i l l , kann nur<br />
der sein, die Ideen und das Bewußtsein der Zeit in künstlerischer<br />
Form darzustellen; das, was das Gefühl hofft und<br />
was die Wissenschaft <strong>im</strong> Begriffe entwickelt, soweit es darstellbar<br />
i s t , mit dem Pinsel auszusprechen, den reichen Inhalt<br />
unsrer Geschichte und Gegenwart in schöner Gestaltung<br />
zu fixieren und so in ihrer Sphäre die Dolmetscherei des<br />
göttlichen Wesens, des Geistes, der sich in a l l unsern<br />
menschlichen Beziehungen offenbart, zu sein. Wenn aber unsre<br />
Künstler wieder ins Mittelalter zurückgehen und dessen engen<br />
Gesichtskreis zu dem ihrigen machen, so verkennen sie die<br />
ganze breite geistige Unterlage, auf der unsere Zeit <strong>im</strong> Vergleich<br />
zu jener steht" (36)<br />
Weiter<br />
heißt es:<br />
"Wenn man aber nur eine religiöse Malerei in letzter Instanz<br />
anerkennt, so gibt man damit nicht etwa, wie die Künstler
I D<br />
mit Overbeck behaupten, den zersplitterten und zerfahrenen<br />
verweltlichten Kunstrichtungen eine höhere Einheit, sondern<br />
man beschränkt borniert die Kunst, tötet sie in ihren besten<br />
Lebensregungen ab und begeht geradezu eine Lüge gegen die<br />
Zeit. Es i s t eine Deportation der Kunst mitten aus ihrer<br />
vollen Wirksamkeit heraus auf eine einsame Insel" (37)<br />
Der so heftige Vorwurf der "Lüge gegen die Zeit" folgt ganz<br />
der Kunstkritik der 40er Jahre und n<strong>im</strong>mt die politische Stoßrichtung<br />
des liberalen Realismusprogramms nach 184-8 vorweg.<br />
Denn die Forderung nach einer Gleichgerichtetheit <strong>von</strong> Kunst und<br />
Zeit verlangt ja die Parallelität <strong>von</strong> künstlerischer und politisch-geschichtlicher<br />
Entwicklung in einem noch ungebrochenen<br />
Fortschrittsglauben, wie er für den Geschichtsopt<strong>im</strong>ismus der<br />
4.0er Jahre typisch i s t . <strong>Scheffel</strong>s Kritik der mittelalterlichen<br />
Manier versteht sich f r e i l i c h schon als historische Kritik;<br />
sollte die Konzeption der Zeitgebundenheit der Kunst scheitern,<br />
so t r i t t das Geschichtsverständnis des Historismus und <strong>Scheffel</strong>s<br />
geschichtliche Arbeiten an ihre Stelle.<br />
In Heidelberg, <strong>Scheffel</strong>s zweitem Studienort 1844/4-5, lagen diese<br />
damals fortschrittlichsten Gedanken in der Luft. Nach dem<br />
Sturz des konservativen Ministeriums Blittersdorff 1843 war in<br />
Baden der Weg endgültig f r e i für die liberale Opposition der<br />
Zweiten Kammer, eine der bedeutendsten Sammelpunkte des Liberalismus<br />
vor 1848. Nach seinen Erfahrungen der Münchner Zeit<br />
gerät <strong>Scheffel</strong> in die akademisch-liberale Aufbruchsst<strong>im</strong>mung<br />
Badens <strong>im</strong> Vormärz. Neben seinem eigentlichen Studienstoff hört<br />
er hier die Vorlesungen des Literaturhistorikers Gervinus,<br />
der das Ende der Kunstperiode proklamiert, der nun die Zeit<br />
der politischen Taten folgen müsse. "Gervinus triumphierte<br />
3 8<br />
über Görres" und bestätigt den Umbruch der Zeit, den <strong>Scheffel</strong><br />
an sich selber erfährt:<br />
"Ich habe <strong>von</strong> Gervinus sehr v i e l gelernt; - in seinen gemäßigt<br />
liberalen leidenschaftslosen Vorträgen hat sich<br />
manches <strong>von</strong> meiner wohl einseitigen Münchner Weltanschauung<br />
durch Görres'sche Augengläser abgeschliffen" (39)<br />
Den politischen Blick des Jurastudenten <strong>Scheffel</strong> schärfen die<br />
staatsrechtlichen Lehren badischer Professoren, <strong>von</strong> denen die<br />
Verfassungsdiskussion in Deutschland und das rechtsstaatliche<br />
Denken des liberalen Konstitutionalismus ausgeht. Die studentische<br />
Geselligkeitspflege der Burschenschaften i s t die andere
17<br />
prägende zeitgeschichtliche Erfahrung <strong>Scheffel</strong>s. Die Briefe<br />
dieser Zeit an den Freund und Burschenschaftler Karl Schwanitz<br />
sind voll <strong>von</strong> Anspielungen auf das politische Tagesgeschehen.<br />
Als "Burschenschaftler <strong>von</strong> entschieden liberalen Grundsätzen"^<br />
lebt auch <strong>Scheffel</strong> wie die Mehrzahl der akademischen Jugend<br />
mit den enttäuschten nationalen Hoffnungen der Freiheitskriege.<br />
In der Restaurationszeit hatten sich die Burschenschaften seit<br />
ihrer Gründung 1815 zum Hauptgegner des Metternichschen Unterdrückungsstaats<br />
entwickelt. Man erinnert sich: die Ermordung<br />
Kotzebues durch den Burschenschaftler Sand 1819 hatte Metternich<br />
zum Anlaß der Verschärfung der restriktiven Maßnahmen genommen,<br />
wie es in den Karlsbader Beschlüssen oder in der<br />
Wiener Schlußakte <strong>von</strong> 1820 zum Ausdruck kommt. Die Erinnerung<br />
an den bürgerlich-akademischen Widerstand des Wartburgfests 1817<br />
und des Hambacher Fests 1832 wird in den 40er Jahren in <strong>im</strong>mer<br />
neuen Verbindungsgründungen und Wartburgfesten<br />
der studentischen<br />
Jugend lebendig gehalten. Diesen studentischen Dreiklang<br />
<strong>von</strong> akademischem Bildungsanspruch, alkoholischem Gemeinschaftssinn<br />
und politischer Opposition bewahren die ersten anonym<br />
erschienenen Trinklieder des Burschenschaftlers <strong>Scheffel</strong> bis in<br />
die<br />
Gedichtsammlung des Gaude.amu.4 v on 1868 hinein.<br />
Das dritte Studienjahr 1845/4-6 in Berlin kann die Erfahrung,<br />
man lebe in einer Ubergangszeit, in <strong>Scheffel</strong> nur verstärken.<br />
Selbst hier, am ehemaligen "Hochsitz der verhegelten Wissen-<br />
ZI<br />
schaft"*', beginnt man sich <strong>von</strong> der totalen Hegelherrschaft<br />
in den Wissenschaften abzuwenden. <strong>Scheffel</strong>s parodistische Ge-<br />
Z.2<br />
dichte, etwa "Zur Phänomänologie des Geistes" (lX,71f) verwenden<br />
Schlagworte der modernen Philosophie als Bausteine<br />
humoristischer Geselligkeits- und Trinklieder. Als <strong>Scheffel</strong><br />
nach diesem Intermezzo zum Abschluß seines Studiums nach<br />
Heidelberg<br />
zurückkehrt, gerät er erneut in die Umbruchst<strong>im</strong>mung<br />
Südwestdeutschlands: "Du kannst Dir kaum<br />
4 3<br />
denken, wie sich bei<br />
uns in Baden die Gedanken kreuzen" 4 , schreibt er dem Burschenschaftler<br />
Schwanitz nach Thüringen.
18<br />
Po tltlAcken. L ike./iatlAmu.A and poetische. Reaktion<br />
<strong>Scheffel</strong>s Kritik der politischen Romantik best<strong>im</strong>mt auch während<br />
der badischen Märzrevolution des Jahres 1848 sein Verhältnis<br />
zur Zeitgeschichte. Die Briefe an Schwanitz nennen den kleinstaatlichen<br />
Absolutismus und den nationalstaatsfeindlichen<br />
Partikularismus der Dynastien als die Kräfte der Restauration,<br />
die es hauptsächlich zu bekämpfen gelte. Kennzeichnend für<br />
<strong>Scheffel</strong>s Denken <strong>im</strong> Sinne seines Herkommens und seiner j u r i s t i <br />
schen Vorbildung i s t die Ubereinst<strong>im</strong>mung seiner politischen<br />
Anschauungen mit dem gemäßigten Professoren-Liberalismus. Dieser<br />
gemäßigte Konstitutionalismus (Vereinbarung <strong>von</strong> Krone und<br />
Parlament, Zensuswahl, großdeutsche Monarchie) mit dem Ziel<br />
einer Revision der Reichsverfassung gerät schon bald in Gegensatz<br />
zu den sog. "radikalen" Demokraten<br />
(Volkssouveränität,<br />
allgemeines Wahlrecht, Republik) und deren Wunsch nach weitergehenden<br />
sozialen Reformen. Dem Dilemma des Liberalismus, nur<br />
verfassungsrechtliche Korrekturen, aber keine sozialen Veränderungen<br />
zu wollen, entgeht auch <strong>Scheffel</strong> nicht. Die berühmten<br />
liberalen Märzforderungen, "Preßfreiheit, Geschworenengerichte,<br />
Volksbewaffnung"^ und "unverzügliche Vertretung<br />
durch ein deutsches Parlament"^ sind keine Min<strong>im</strong>alforderungen<br />
wie bei den Demokraten, sondern bilden den Endpunkt einer<br />
"gesetzlichen Entwickelung" der Revolution ! Weitergehenden<br />
47<br />
Forderungen der Demokraten "<strong>im</strong> Namen der Freiheit" antwortet<br />
der Liberalismus durch das Bündnis mit den restaurativen<br />
Mächten, um die soziale Ordnung aufrecht zu erhalten und die<br />
verfassungsrechtlichen Errungenschaften zu bewahren. Auch für<br />
<strong>Scheffel</strong> i s t mit der Berufung liberaler Parlamentarier in die<br />
sog. Märzministerien die Revolution beendet, weil die verfassungsrechtlichen<br />
Ziele durchgesetzt sind:<br />
"namentlich wollen viele nicht zugestehen, daß wir seit<br />
März eine vollständige Revolution in Deutschland durchgemacht<br />
haben und also auf einem durchaus neuen Rechtsboden<br />
stehen" (48)<br />
In diese Zeit, in der sich die liberalen Prioritäten <strong>von</strong> der<br />
freiheitlichen Komponente zur zunehmenden Betonung des nationalen<br />
Einigkeitswillens wandeln, fällt auch <strong>Scheffel</strong>s Tätigkeit<br />
als Sekretär des badischen Staatsrechtlers Karl Theodor
19<br />
Welcker. <strong>Scheffel</strong>s Position in der Nähe Welckers spiegelt<br />
die schwierige Lage des konservativen Liberalismus. Welcker<br />
i s t einerseits badischer Parlamentarier und Gesandter be<strong>im</strong><br />
restaurativen Bundestag, andererseits i s t er gleichzeitig<br />
Abgeordneter der 'revolutionären 1 Frankfurter Nationalversammlung.<br />
Während die bald gescheiterte Nationalstaatsgründung<br />
die Radikalen in Baden in erfolglose und bald niedergeschlagene<br />
Aufstände treibt, sucht der gemäßigte Liberalismus sein Heil<br />
in einer kleindeutsch-preußischen Lösung. Der <strong>im</strong>mer antipreußisch<br />
und großdeutsch denkende <strong>Scheffel</strong> macht diese Wandlung<br />
des Liberalismus (Welcker!) nicht mit. Seine Abwendung<br />
50<br />
vom politischen Geschehen unter dem Zugriff der Reaktion,<br />
der "Preußischen Statthalter <strong>von</strong> Gottes Gnaden", i s t nicht<br />
ganz f r e i w i l l i g : "ich stehe ja auch auf der roten Liste als<br />
51<br />
Wühler aus den Märztagen und als Begleiter Welckers" . Der<br />
sich nun zum Konservatismus bekennende <strong>Scheffel</strong> läßt seiner<br />
politischen Enttäuschung freien Lauf; sein Pess<strong>im</strong>ismus erlaubt<br />
ihm aber auch erstaunliche Prognosen:<br />
"Eine auf innere Notwendigkeit gegründete, lebenskräftige<br />
konservative Partei i s t in Baden eine Unmöglichkeit; die<br />
Reaktion läßt sich's wohl sein, solang sie obenan i s t , und<br />
bringt ihr Schäfchen in 1 s Trockene, um be<strong>im</strong> ersten Alarmschuß<br />
der Revolution wieder durchzubrennen und gar nicht<br />
mehr oder mit den Russen das nächste Mal zurückzukehren.<br />
Die alte Freischärlerei aber, wenn sie je wieder, durch die<br />
Verwicklung der Ereignisse, das Heft in die Hände bekommt,<br />
wird <strong>im</strong> Namen <strong>von</strong> Uohi^tand, Bildung und T/ie.ihe.L£ eine so<br />
gediegene Sauerei zu Tage fördern, daß niemand der Mund<br />
darnach wässern wird, - am wenigsten einem Karlsruher, denn<br />
die sind schon qua solche übel angeschrieben und kriegen<br />
das nächstemal das Kamisol nicht übel versohlt.<br />
Und so sehe ich mit einem wehmütig indolenten Gefühl der<br />
Zukunft entgegen, die in Baden wenigstens sehr skrofulös<br />
werden wird. Und <strong>im</strong> großen Deutschland wird auch nichts<br />
zustande gebracht. Die Verwerfung der Reichsverfassung trägt<br />
ihre Früchte, der alte Dynastienwahn verhunzt das schöne<br />
Land, und das Universalheilmittel dagegen, die Republik,<br />
i s t unmöglich geworden durch ihre eigenen Vertreter, die<br />
diesen Begriff allmählich zum Synonym <strong>von</strong> Skandal erhoben<br />
haben.-<br />
So zappeln wir ein paar Jahrzehnte, und dann legt sich<br />
Deutschland vielleicht schlafen, - und träumt den alten<br />
Traum weiter, oder das nicht einmal. Oder es gibt eine<br />
große europäische Paukerei, - dann sind wir auch wieder<br />
der Mensurboden, auf dem sie ausgefochten wird, und kommen<br />
zu keiner selbständigen freien Entwicklung" (52)<br />
Auf die politische Enttäuschung reagiert <strong>Scheffel</strong> jedoch nicht
20<br />
nur mit einer Neuformulierung seiner politischen Grundsätze,<br />
sondern auch mit einem Wechsel seines Tätigkeitsfeldes. Auch<br />
darin, in der gegenpolitischen und ästhetischen Wendung,<br />
spiegelt<br />
sein Verhalten den Lebensweg vieler Liberaler nach 184.8,<br />
was an zahllosen Lebensläufen der Zeitgenossen gezeigt werden<br />
könnte: "Die künstlerische Seite in mir hat gegen das positiv<br />
53<br />
Unschöne reagiert" . <strong>Scheffel</strong>s juristischer Alltag in Säckingen,<br />
wo er fast fluchtartig eine Assessorenstelle ann<strong>im</strong>mt, i s t<br />
nicht nur ein geographischer Rückzug aus dem Zugriff der Re-<br />
34.<br />
aktion . In der topographischen Abwendung vom politischen Geschehen<br />
wandelt sich die Revolution sogar nachträglich vom politischen<br />
Ereignis zu k einem poetischen Wert, wenn <strong>Scheffel</strong> <strong>von</strong><br />
nun an da<strong>von</strong> spricht, nach 184-8 habe er "den Glauben an das<br />
Volk auf beiden Teilen und die Poesie der Revolution verloren"<br />
Nun. in den Qe.4ch ictite. is>t Uinktich.ke.it<br />
Auch die Italienreise des Malers <strong>Scheffel</strong> nach der Säckinger<br />
Zeit folgt zwar den Spuren der Goetheschen Italienreise, deren<br />
epigonaler Nachvollzug den eigenen Kunstanspruch legit<strong>im</strong>ieren<br />
s o l l . Doch der frühe Bildungstourismus, der sich seit dem Beginn<br />
des 19. Jahrhunderts in solch obligatorischen Bildungsreisen<br />
des Bürgertums manifestiert, verstellt ein wenig die<br />
seit 1848 <strong>im</strong>plizite politische D<strong>im</strong>ension. Erst jetzt nämlich<br />
erhält die romantisierende<br />
Italiensehnsucht für die enttäuschten<br />
Deutschen <strong>im</strong> nationalen Freiheitskampf Italiens eine direkte<br />
politische Parallele (Italienischer Krieg 1859 beendet).<br />
Auch <strong>Scheffel</strong> entwickelt seine Selbstfindung als Maler aus<br />
einer politisch eingefärbten Erlösungssehnsucht, weshalb er<br />
"auf italischem Boden einen Schluck Lethe trinken wollte, in<br />
dem alle Erinnerungen seit 1848 ausgetilgt würden"^. In der<br />
traditionellen Auseinandersetzung mit dem italienischen Kunstvorbild<br />
und den politischen Verhältnissen in Deutschland auf<br />
der Folie eines sich entwickelnden italienischen Staats- und<br />
Nationalbewußtseins erwächst <strong>Scheffel</strong>s neues GeschichtsVerständnis.<br />
Ein unversöhnlicher Gegensatz <strong>von</strong> poetischer Geschichtserinnerung<br />
und prosaischer Zeitgeschichte i s t jetzt<br />
aufgebrochen<br />
und wird faßbar <strong>im</strong> Wandel des Kunstverständnisses<br />
<strong>Scheffel</strong>s Auseinandersetzung mit den Fragen der Gegenwart in
21<br />
seinen Reisebildern Au* de.n /ikäti*cken Atpe.n 9<br />
das Produkt einer<br />
Graubündener Reise mit dem kleindeutsch-liberalkonservativen<br />
Ludwig Häusser (1851)» benutzt die seit Heine beliebte lockere<br />
Form für politische Anspielungen in der Maske des kulturhistorischen<br />
Berichts. Die geographische Distanz der Schweiz und<br />
deren ganz andere Lösung der Revolution (Sonderbundskrieg 1847)<br />
fordern geradezu den ironischen Vergleich der gesellschaftlichen<br />
Lebensformen und der politischen Verfassung der Graubündener<br />
Bauern mit den badischen Verhältnissen während der jetzt herrschenden<br />
Reaktion. Schon hier verhindert der spezifische<br />
57<br />
Humor <strong>Scheffel</strong>s die direkte tagespolitische Ausmünzung.<br />
Unter diesem Blickwinkel erhält auch <strong>Scheffel</strong>s bekanntere<br />
kulturhistorische Studie Au* de.m Hauen*telnen. Schioa/tzioatd,<br />
geschrieben 1851/52, gedruckt 1853, ihren Stellenwert. Die<br />
Beschreibung historischer, weil frühdemokratischer Zustände<br />
in populärwissenschaftlicher Manier - man denke an die kulturhistorischen<br />
Arbeiten W.H.Riehls oder die sozialkonservativen<br />
"Schwarzwälder Dorfgeschichten" Berthold Auerbachs (1843ff) -<br />
s t e l l t die <strong>von</strong> den Wirkungen der Zivilisation kaum berührten<br />
Schwarzwaldbauern der politischen Lage der badischen Stadtbevölkerung<br />
gegenüber. Die politische Teilnahmslosigkeit der<br />
Bauern gerinnt auf der Folie der eigenen politischen Enttäuschungen<br />
zu einer erstrebenswerten Haltung, wenn man erfährt,<br />
"daß der Hauensteiner zu den revolutionären Bestrebungen in<br />
Baden sich durchaus negativ verhält" (VII,171). Nicht ein<br />
politischer Unschuldszustand wird hier f r e i l i c h postuliert,<br />
sondern ein bewußt unpolitisches Verhalten: der politisch<br />
räsonierende Erzähler <strong>Scheffel</strong> durchschaut zwar die Aussichtslosigkeit<br />
des starr rückwärts gewandten Widerstandes der<br />
Hauensteiner Bauern (VII,191: "Anachronismus"!), versucht aber<br />
ihre Haltung in die kulturhistorische Idylle zu retten.<br />
Der hier erstmals durchgängig historische Zugriff auf den Erzählstoff<br />
wächst sich unter der Hand zu einer Vorstufe der<br />
Geschichtsdichtungen <strong>Scheffel</strong>s aus. Diese Art poetischer Geschichtsschreibung<br />
wird <strong>von</strong> nun an für <strong>Scheffel</strong> die Form, den<br />
direkten Zeitbezug der Geschichte zu erhalten. Daß Geschichte<br />
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weit mehr i s t als<br />
bloßer Bildungsstoff, bewahrheitet sich nicht nur an <strong>Scheffel</strong>,
22<br />
dessen Werke man ohne Mühe zu den Geschichtsopern Richard Wagners<br />
oder den monumentalen Geschichtsmonographien Rankes,<br />
Droysens, Mommsens und Sybels in Bezug setzen kann. Geschichte<br />
i s t dort, ebenso wie <strong>im</strong> Denken <strong>Scheffel</strong>s, nicht nur ein überzeitlicher<br />
Wert, auf den man sich zur Vergewisserung der Hoffnungen<br />
<strong>von</strong> 184.8 berufen kann, diese damit vor dem politischen<br />
Tagesgeschehen bewahrt und in eine zeitlose D<strong>im</strong>ension rettet.<br />
Diese Form der Geschichtsbetrachtung erlaubt zugleich die<br />
dauernde<br />
Aktualisierung des Historischen zur Legit<strong>im</strong>ierung<br />
nationalpolitischer Vorstellungen, wie sie Tendenzhistoriker -<br />
so Heinrich <strong>von</strong> Treitschke - betreiben.<br />
Im Vorwort der Novelle 3-unipe./iu*, 1866(!) erschienen, i s t diese<br />
Doppelbödigkeit der Geschichte schon selbstverständlich. "Die<br />
Hohenstaufischen Kaiser" (11,8), mit denen die Thematik der<br />
Erzählung nichts zu tun hat, brauchen nur noch anzitiert zu<br />
werden: die Verbindung <strong>von</strong> Hohenstaufer und Hohenzoller s t e l l t<br />
sich wie <strong>von</strong> selbst her. Wenn <strong>Scheffel</strong> den Mainzer Hoftag<br />
Barbarossas in ein "herrliches Frühlingsfest deutscher Nationalkraft<br />
und deutschen Geistes", "dieweil <strong>im</strong> Orient langsam die<br />
Wetterwolken aufzogen", umstilisiert, so gewinnt er ein historisch-poetisches<br />
Deutungsmuster für den preußischen Sieg <strong>von</strong><br />
1866, die "Kreuzfahrt" <strong>von</strong> 1870 5 8 und die Versailler Reichsgründung.<br />
Anton <strong>von</strong> Werner, zuerst <strong>Scheffel</strong>s kongenialer I l l u <br />
strator und später repräsentativer Auftragsmaler des neuen<br />
Reiches, wird diese Stilisierung <strong>im</strong> bekannten Bild der Kaiserproklamation<br />
bestätigen. Die "freundlich gemeinte Doppelarbeit<br />
des Dichters und Malers" und die "<strong>von</strong> ernsten St<strong>im</strong>mungen bewegte<br />
Zeit" (11,10) verweisen, vielleicht als künstlerisches Gegenstück<br />
zum hochpolitischen Kaiserstreit zwischen Julius Ficker<br />
und Heinrich <strong>von</strong> Sybel (1859/62), auf die ästhetisch und p o l i <br />
tisch zu lösende Frage der nationalen Einheit. Die poetisch<br />
erfaßte Geschichte s o l l der politischen Gegenwart vorausgehen<br />
und<br />
"Zeugnis ablegen, daß ehrliche deutsche Herzen Nichts wissen<br />
und Nichts wissen wollen <strong>von</strong> Haß, Trennung und Bruderzwist<br />
und daß hier ein Mann vom Oberrhein und ein Mann <strong>von</strong> der Oder<br />
in guter Kameradschaft zusammengearbeitet haben an einem<br />
Werke deutscher Kunst" (11,10)<br />
Doch bemächtigt sich die Gegenwart der Geschichte auf noch
23<br />
direktere Weise. <strong>Scheffel</strong>s Gedichtsammlung <strong>von</strong> 1863, Tiau<br />
Auentiuie., eine Sammlung der lyrischen Einlagen für den nie v o l l <br />
endeten Wartburgroman, lebt <strong>von</strong> einer doppelten Vermittlung der<br />
Geschichte in die Gegenwart. "Die mehr als zufällige<br />
Fügung"(III,8)<br />
eines Kulturraittelpunktes Thüringen - mittelalterlicher Sängerkrieg<br />
auf der Wartburg, Goethes We<strong>im</strong>ar und die <strong>im</strong> 19. Jahrhundert<br />
restaurierte Wartburg mit dem bekannten Sängerkrieg-Fresko<br />
Moritz <strong>von</strong> Schwinds - konstruiert eine übergeschichtliche Kontinuität.<br />
Mit dieser Verknüpfung geschichtlicher Zufälligkeiten<br />
s o l l nicht nur der mäzenatische Kunstanspruch des Großherzogs<br />
59<br />
<strong>von</strong> Sachsen-We<strong>im</strong>ar-Eisenach nach dem Vorbild und in Konkurrenz<br />
zum Münchner Dichterkreis um den bayerischen König Max II. bestätigt<br />
werden. Um die politisch brisante Erinnerung an das<br />
burschenschaftliche Wartburgfest verkürzt, wird die historische<br />
Reihe zur unangreifbaren Rechtfertigung, die poetische Tradition<br />
zur politischen Legit<strong>im</strong>ation: dem thüringischen Kleinstaat des<br />
mäzenatischen Großherzogs, der in solchen Traditionen steht,<br />
kann auch die politische Existenzberechtigung gegen die Vereinnahmungspläne<br />
Preußens nicht abgestritten werden.<br />
Uberhaupt sind <strong>Scheffel</strong>s lebenslanger großdeutscher und antipreußischer<br />
Gesinnung die kleindeutschen Einigungsbestrebungen<br />
unter der Vorherrschaft Preußens suspekt. Schon 1863, während<br />
der erneut ausbrechenden Schleswig-Holstein-Krise als Vorspiel<br />
des deutschen Kriegs <strong>von</strong> 1866, durchschaut <strong>Scheffel</strong> den militärischen<br />
Imperialismus Preußens und ahnt schon den "nationalen"<br />
Krieg <strong>von</strong> 1870 voraus:<br />
"Preußen wird, unter dem Vorwand, das Londoner Protocoll<br />
/=zur Regelung der Schleswig-Holstein-Frage7 aufrecht zu<br />
halten, ein paar deutsche Bundesstaaten als Unruhestifter,<br />
die man s t i l l machen muß, besetzen, Hamburg wegnehmen, etwa<br />
auch Holstein, weil es den Kieler Hafen sehr gut brauchen<br />
kann ... und für diese Dinge wird nicht die gekränkte deutsche<br />
Nation, sondern 7/tank/izich Rechenschaft fordern und der<br />
Krieg am Rhein losbrechen" (60)<br />
Für den Krieg <strong>von</strong> 1870/71, der ihm <strong>im</strong> Gegensatz zur nationalen<br />
Begeisterung anderer Literaten als preußischer Expansionskrieg<br />
61<br />
erscheint, i s t <strong>Scheffel</strong> "kein Enthusiasmus möglich" . Krieg<br />
i s t ihm nicht nur allgemein "für Gedeihen und Selbständigkeit<br />
62<br />
des deutschen Cu£tu/ile.&e.n* verhängnisvoll" ; die Grenzlage<br />
Badens ermöglicht <strong>Scheffel</strong> auch wirklichkeitsnahe Einsichten
24<br />
sehr <strong>im</strong> Kontrast zur akademischen<br />
Kriegsbegeisterung:<br />
"Die Theuerung i s t <strong>im</strong> besten Fortschritt und die armen Rheinbauern<br />
verkaufen ihre Ferkel und jungen Gänse, was <strong>im</strong>mer ein<br />
Barometer des öffentlichen Wohlstandes i s t . Man denkt jetzt<br />
auch gründlich darüber nach, welchen Segen ein ken./i ticken.<br />
Knie.g über die Menschheit bringt" (63)<br />
Noch die militärischen Erfolge und das Uberschwappen der nationalen<br />
Begeisterung nach der Kaiserproklamation in Versailles<br />
lassen <strong>Scheffel</strong> in seiner Reserve^. Der endlich erreichte<br />
Nationalstaat, die Verehrung des Kaisers und die Bewunderung<br />
65<br />
Bismarcks söhnen <strong>Scheffel</strong> mit der Vorherrschaft Preußens nur<br />
allmählich aus. Jetzt erscheint ihm auch wieder die Ubereinst<strong>im</strong>mung<br />
<strong>von</strong> Kunst und Zeit wie vor 1848 möglich; beides, der<br />
ästhetische Anspruch und die Erfordernisse der Zeit, werden<br />
wieder aufeinander bezogen, gelten aber schon nicht mehr für die<br />
eigene Person. An Anton <strong>von</strong> Werner, den Repräsentations- und<br />
Schlachtenmaler des Neuen Reiches, schreibt <strong>Scheffel</strong> aus Karlsruhe<br />
nach Paris, dem Ort des preußischen Triumphes:<br />
"Es freut mich, daß Du diese gewaltige und für Deutschland<br />
ehrenvolle Zeit so mitten <strong>im</strong> Centrum der Ereignisse mit erleben<br />
und studiren kannst ... die beste und ächteste Geschichtsmalerei<br />
i s t die aus der Gegenwart, wenn ich 20 Jahre<br />
jünger wäre und keinen - aus der Dir glücklicherweise unbekannten<br />
Reactionszeit der fünfziger Jahre stammenden Rost in<br />
der Seele angesetzt hätte, so würde ich mit voller Energie<br />
mich ebenfalls diesen Geschichten und den neu angebahnten<br />
hoffentlich schwungvollen Entfaltungen deutscher Kraft und<br />
deutschen Geistes widmen" (66)<br />
Dennoch hat auch <strong>Scheffel</strong> mit seiner Kunst an der neuen Zeit<br />
t e i l . Im "Festlied der Studenten" zur Gründung der deutschen<br />
Universität Straßburg (IX,181f) und in den Skizzen au* dem<br />
££*aß aus dem Jahre 1872 kehrt <strong>Scheffel</strong> <strong>im</strong> Gelegenheitsgedicht<br />
und <strong>im</strong> Reisebild zu seinen Ursprüngen als Dichter zurück. Dort,<br />
wo Zeitgeschichte und Historie auseinander gefallen waren,<br />
kommen sie wieder zusammen, wenn <strong>Scheffel</strong> das militärisch<br />
annektierte Elsaß auch kulturhistorisch wiedergewinnen möchte.<br />
Freilich folgt jetzt die Poesie nur noch den Spuren der P o l i t i k .
25<br />
I. DICHTER UND DICHTUNG<br />
1. Dichterbewußtsein und Sängerrolle<br />
In seiner Mittlerstellung zwischen Autorbewußtsein und Erzählhandlung<br />
steht der Erzähler des £kkzka/id in der realen Welt des<br />
Autors als dessen angenommene Erzählrolle, zugleich gehört er<br />
als eine vom Autor geschaffene Figur selbst in den Bereich der<br />
Fiktion. Diesen Spielraum als 'Sprachrohr des Autorbewußtseins<br />
auszunutzen, i s t ja ein grundsätzlicher Teil der Erzählerfigur.<br />
Auffällig i s t dabei zunächst, wie sehr <strong>Scheffel</strong>s £kke.haid <strong>von</strong><br />
der zu erwartenden Norm abweicht. Im Vergleich mit anderen historischen<br />
Romanen gleicher Entstehungszeit scheint der £kke.ha/id<br />
1<br />
in dieser Hinsicht eine Ausnahmestellung einzunehmen . Als<br />
Präsentator der Erzählhandlung, dessen jeweiliges Verhältnis<br />
zum Text und zur außertextlichen Realität uns interessiert,<br />
steht der Erzähler des £kke.ha/id dem Geschehen nichts weniger<br />
als objektiv gegenüber. Im Gegenteil präsentiert er gleich den<br />
Anfang seines Romans aus einer Uberschau, <strong>von</strong> der aus er durch<br />
Gelehrsamkeit glänzen oder die traditionelle Erzählergemeinsam-<br />
2<br />
keit zwischen sich und dem Leser beschwören kann . In seinem<br />
Recht, sogar nicht behandeltes Geschehen zu deuten, macht der<br />
Erzähler deutlich, worauf es ihm ankommt: sein objektives Vorwissen<br />
schlägt in Belehrung um und wird als Kommentierung der<br />
Erzählung moralisch rechtfertigend und moralisierend. Der Erzähler<br />
"denkt moralisch" . Dieser moralisierende Unterton ergibt<br />
sich aus einem dauernden unhistorischen Vergleicheziehen<br />
zwischen der Erzählgegenwart und der erzählten Vergangenheit,<br />
wobei der Erzähler den historischen Abstand zwischen damals und<br />
heute bewußt negiert:<br />
"Man konnte damals Menschen verschenken, auch kaufen. Freiheit<br />
war nicht jedem eigen. Aber eine Unfreiheit, wie sie<br />
das Griechenkind auf der schwäbischen Herzogsburg zu tragen<br />
hatte, war nicht drückend." (V,17)<br />
Solche Werturteile des Erzählers nehmen die Perspektive einer<br />
historisch weiter entwickelten Zeit in die Erzählung hinein<br />
und erzeugen so eine Kumpanei zwischen Erzähler und Leser über<br />
die Textwirklichkeit: "Der Zustand wohnlicher Einrichtung
26<br />
überhaupt ließ damals manches zu wünschen übrig" (V,21). Diese<br />
Gemeinsamkeit kann der Erzähler nun dadurch ausnutzen, daß er<br />
wie ein feuilletonistischer Reisebegleiter den Leser <strong>im</strong>mer<br />
stärker in seine kulturkritischen Kommentare mit einbezieht:<br />
"Denn heutigentages sind die Klöster seltener und die Wirtshäuser<br />
häufiger, was mit steigender Bildung zusammenhängt/. .7<br />
Es war ein sonderbarer Zug, den jene Glaubensboten <strong>von</strong> Albion<br />
und Erin aufs germanische Festland führte. Genau besehen<br />
ist's ihnen kaum zu allzu hohem Verdienst anzurechnen f. . *J<br />
Sie kamen als Vorfahren der heutigen Touristen f...J Andere<br />
Zeiten, andere Lieder! Heute bauen die Enkel jener Heiligen<br />
den Schweizern für gutes eidgenössisches Geld die Eisenbahn."<br />
(V,24)<br />
Diese Spannung zwischen Erzählgegenwart und erzählter Textwirklichkeit<br />
vermag der Erzähler noch weiter zu forcieren, wenn<br />
er seine traditionelle Allwissenheit aufgibt und absichtlich<br />
Unwissenheit zur Schau s t e l l t . So folgen <strong>im</strong> 22. Kapitel (VI,354ff<br />
Erzähler und Leser über mehrere Seiten einem scheinbar unbekannten<br />
Wanderer, bis der Erzähler endlich die fällige Aufklärung<br />
nachliefert: "Der Fremde kniete vor dem Kreuz nieder und<br />
betete lang.- Es war Ekkehard, - der Ort, wo er betete, das<br />
Wildkirchlein" (VI,356). Am Ende des Romans n<strong>im</strong>mt der Erzähler<br />
aber nicht nur seine Distanz zu seiner eigenen Fiktion wieder<br />
zurück, sondern versucht sogar, eine Identität zwischen sich<br />
und seinem Helden vorzuspiegeln, indem er noch einmal ausdrückl<br />
i c h in die Dichterrolle schlüpft:<br />
"Und der dies Büchlein niedergeschrieben, i s t selber manch<br />
einen Frühlingsabend droben gesessen, /*. . J denn in den<br />
Trümmern des Gemäuers standen die Gestalten, die der Leser<br />
<strong>im</strong> Verlauf unserer Geschichte kennen gelernt, und erzählten<br />
ihm/=Erzähler/ alles, wie es sich zugetragen {...J und<br />
winkten ihm freundlich, daß er's aufzeichne und ihnen zu<br />
neuem Dasein verhelfe." (VI,430f)<br />
Dieser Befund, Autorbewußtsein und Erzählerfigur sehr direkt<br />
aneinander zu fixieren, läßt sich auch am lyrischen Ich festmachen.<br />
Die eindeutig biographische Aussage des Gedichts<br />
"Wiedersehen" <strong>von</strong> 1858 (IX,131) wird als Erlebnisdichtung unter<br />
dem Refrain eines spätraittelalterlichen Minnesängers versteckt<br />
und damit in eine scheinobjektive Sängerrolle hineingenommen:<br />
"Doch alte Lieb', die rostet nicht,<br />
Und Herzog Hans <strong>von</strong> Brabant spricht:<br />
Herba f l o r i fa!" (IX,131)
27<br />
Doch der Und-Anschluß des Refrains wirkt verräterisch; in seiner<br />
inhaltlichen Funktionslosigkeit verrät er die Verkleidung des<br />
direkten persönlichen Bezuges unter der Maske historisch schon<br />
sanktionierter<br />
Formeln.<br />
Die ersten Rezensenten haben übereinst<strong>im</strong>mend in allen Werken<br />
<strong>Scheffel</strong>s die partielle Identität <strong>von</strong> Autor und erzählendem bzw.<br />
lyrischem Ich entdeckt. Da es dem Leser wahrlich nicht schwerfällt,<br />
<strong>Scheffel</strong>s Heldenfiguren "und den Poeten zu identificiren"^,<br />
wird tendenziell jedes sprechende Ich auf den Autor hin ausdeutbar.<br />
<strong>Scheffel</strong> selbst hat diese Leseversion <strong>im</strong>mer wieder<br />
betont. In der Zueignung seines 7 /iompe.te./i4 fällt schon <strong>von</strong> der<br />
Gattungsbedingung des Widmungsgedichts her das lyrische Ich<br />
eindeutig mit dem biographischen zusammen. Echte fiktive Aussagen<br />
müssen trotz des fiktiven Textes in direkter Rede stehen,<br />
so z. B. die ironische Dichter-Selbstcharakterisierung aus dem<br />
Mund des Wirtes Don Pagano:<br />
"Was er sonst noch treibt? - ! s i s t ein Deutscher,<br />
Und wer weiß, was diese treiben?<br />
Doch ich sah in seiner Stube<br />
Viel Papier - unökonomisch<br />
War's nur in der Mitt' beschrieben,<br />
Und ich glaub', es fehlt <strong>im</strong> Kopf ihm,<br />
Und ich glaub', er schmiedet Verse." (1,3)<br />
Die Rollendistanz des Ich-Sprechers als zugleich Handelnder<br />
und Beobachtender macht das Verhältnis <strong>von</strong> erlebter Realität<br />
und deren Eingang in die Zueignung ganz deutlich, wenn man die<br />
Anfangszeilen des 7/tompete/i* dem realen Ereignis konfrontiert:<br />
Im Versepos heißt es:<br />
"Wer i s t dort der blonde Fremde,<br />
Der auf Don Paganos Dache<br />
Wie ein Kater auf und ab geht?" (1,3)<br />
Die reale Situation beschreibt <strong>Scheffel</strong> in einem Brief an<br />
seine Mutter fast gleichlautend, jedoch in eindeutigem Ich-<br />
Bezug ohne die literarische Sprecherrolle:<br />
"ich bin in frischem einsamem Scheffen begriffen, und mein<br />
biederer Wirt Pagano macht oft seltsame Augen, wenn er mich<br />
auf dem flachen Dach des Hauses wie eine Katze speculierend<br />
auf und nieder schreiten sieht." (5)<br />
Daß beide Rollen <strong>im</strong> 7/iompete/i oszillieren, hindert nicht, daß<br />
<strong>Scheffel</strong> sehr genau zwischen den fiktiven "des Lieds Gestal-
28<br />
ten" (1,4-) und dem biographischen Bezug unterscheidet: "Dieser<br />
Fremde / War ich selber" (1,3). Das bestätigt auch die Widmungsformel<br />
und die sich daran anschließende bekannte Abgrenzung<br />
des 7nompe.te.n gegen andere zeitgenössische Produktionen:<br />
"Doch den Sang, der mir in froher<br />
Frühlingsahnung aus dem Herz sprang,<br />
Send' ich grüßend in die He<strong>im</strong>at,<br />
Send' ich Euch, dem Elternpaar.<br />
Manch Gebrechen trägt er, leider<br />
Fehlt ihm tragisch hoher Stelzgang,<br />
Fehlt ihm der Tendenz Verpeff f rung,<br />
Fehlt ihm auch der amarant'ne<br />
Weihrauchdurft der frommen Seele<br />
Und die anspruchsvolle Blässe.<br />
Nehmt ihn, wie er i s t , rotwangig<br />
Ungeschliffner Sohn der Berge,<br />
Tannzweig auf dem schlichten Strohhut.<br />
Was ihm wahrhaft mangelt, deckt es<br />
Mit dem Schleier güt'ger Nachsicht.<br />
Nehmt ihn, nicht als Dank - ich stehe<br />
Schwer <strong>im</strong> Schuldbuch Eurer Liebe -<br />
Doch als Gruß und als ein Zeichen,<br />
Daß auch einer, den die Welt nicht<br />
Auf den grünen Zweig gesetzt hat,<br />
Lerchenfröhlich und gesund doch<br />
Von dem dürren Ast sein Lied singt." (1,6)<br />
Gerade wegen der hier proklamierten Natürlichkeit i s t eine<br />
echte Programmatik der Dichtkunst vermieden. Zwar setzt sich<br />
<strong>Scheffel</strong> gegen klassizistische ("tragisch hoher Stelzgang")<br />
und jungdeutsche Tendenzen ("Tendenz Verpfeff'rung") wie auch<br />
gegen das romantisierend-frömmelnde Verepos des Biedermeier<br />
(0. v. Redwitz mit seinem Am.an.anth.) ironisch ab, nicht ohne die<br />
scheinbaren "Gebrechen" des 7/iompe.te.n als dessen eigentliche<br />
Stärken und Neuerungen vor sich her zu tragen. Den negativen<br />
Abgrenzungen gegenüber verblaßt das positive Programm (rotwangig,<br />
ungeschliffen, lerchenfröhlich, gesund) nicht nur,<br />
weil es rhetorische Formeln des frühen programmatischen Realismus<br />
idyllisch einfärbt; l e t z t l i c h begründet <strong>Scheffel</strong> seine<br />
literarische Absetzung weniger programmatisch als biographisch:<br />
das literarische Ich rettet sich ins biographische. Verdeutl<br />
i c h t wird dies in <strong>Scheffel</strong>s Stellungnahme zur falschen Gleichsetzung<br />
<strong>von</strong> äußerer Biographie und Dichterinspiration auf eine<br />
Anfrage hin:<br />
"Es scheint mir übrigens, als ob der <strong>von</strong> Literaturhistorikern<br />
beliebte Weg, den Autor durch kurzen Abriß seiner
29<br />
Lebensverhältnisse zu erläutern, sehr unfruchtbar sei - weil<br />
die moderne Zeit nur ganz gleichförmige mechanische Schemata<br />
äußerer Entwicklung möglich läßt, und man aus den darauf bezüglichen<br />
Thatsachen keinerlei Aufschluß über das künstlerische<br />
Leben und Entpuppen erhält. Die Impulse der Poesie<br />
kommen aber aus ganz anderen Regionen als aus denen, darin<br />
die Existenz sich äußerlich bewegt." (6)<br />
Daß der Poet "ein eigenes Schicksal" (V,9) hat, das ihn <strong>im</strong><br />
Unterschied zu den übrigen Menschen e r e i l t und ihn dadurch <strong>von</strong><br />
allen trennt, i s t die logische Folge einer solchen Abgrenzung<br />
des Dichterbewußtseins <strong>von</strong> der Normalität. Der Dichter weiß<br />
sich <strong>von</strong> Erscheinungen umgeben:<br />
"Wo Andere, denen die Natur gelehrtes Scheidewasser in die<br />
Adern gemischt, v i e l allgemeine Sätze und lehrreiche Betrachtungen<br />
als Preis der Arbeit herausätzen, wachsen ihm<br />
f=dem Poeten/ Gestalten empor, erst vom wallendem Nebel umflossen,<br />
dann klar und durchsichtig, und sie schauen ihn<br />
ringend an und umtanzen ihn in mitternächtigen Stunden und<br />
sprechen: Verdicht uns!" (V,9)<br />
Dieser <strong>im</strong> Vorwort des tZkk&ka/id beschworene Vorgang war sicher<br />
als Apotheose des poetischen Schöpfungsaktes ernst gemeint;<br />
heute wäre er nur noch als (unfreiwillige) Parodie des Dichtungsprozesses<br />
zu lesen. Als Dichterideologie treten solche<br />
Vorstellungen in <strong>Scheffel</strong>s Werk wiederholt und durchgängig auf.<br />
Charakteristisch i s t jeweils das geisterhaft irrationale Walten<br />
solcher Mächte. Verpflichtung des Dichters i s t es, solche Er-<br />
7<br />
scheinungen zu bannen . Die Poesie kann dann sehr bald "eine<br />
o<br />
verfluchte Sirene" werden, "sie zieht und lockt" . Das romantische<br />
Dichtererbe, die poetische Inspiration als dämonische<br />
Macht, trägt sich in <strong>Scheffel</strong> weiter: "die Gestalten kauern<br />
o<br />
und lauern ungebannt in allen Winkeln" . Gegenüber Otto Müller,<br />
dem Romancier und Herausgeber der Beut ackert B i(L£iothe./c 9<br />
der<br />
Sammlung au*e./ite.*ene/i O/ilginai/iomane., in dessen Reihe als<br />
zweiter Band <strong>Scheffel</strong>s Ckkeka/id erscheint, äußert <strong>Scheffel</strong> den<br />
"frommen Wunsch, daß ich bald <strong>von</strong> den Gestalten erlöst werden<br />
möge, die mich zur Zeit geisterhaft he<strong>im</strong>suchen"^. Die vom<br />
Dichter nicht unbedingt gewollte He<strong>im</strong>suchung durch solche Gestalten<br />
wird <strong>Scheffel</strong> zum Fluch und weitet sich in quasisakrale<br />
Sphären: die Poesie kann zur dämonischen und dämonisierten<br />
Muse werden. So warnt <strong>Scheffel</strong> den Mitdichter Eduard<br />
Dössekel, "sich je <strong>von</strong> der Muse weiter als zu harmlosen Spazier
30<br />
und etwas Koboldisches dabei, wenn man sich tiefer einläßt"<br />
Der Poesiebegriff erhält dabei den Charakter einer undeutlichen,<br />
aber existenziell empfundenen Bedrohung. Dichterische Inspiration<br />
als Fluch der Erkenntnis - diese Selbstdeutung kann <strong>von</strong><br />
der Umwelt als handliche Dichterideologie leicht akzeptiert<br />
werden. <strong>Scheffel</strong>s Mutter, selbst eine Dichterin, wendet diese<br />
Mystifizierung noch ins Banale, wenn sie es auf "ein Kranksein",<br />
1 2<br />
"eine Uberfülle <strong>von</strong> Wissensdrang und Phantasie" reduzieren<br />
möchte. Persönliche Schwächen versteht und verzeiht man mit dem<br />
Verweis auf ein Dichterschicksal, das der Dichter für sich<br />
selbst so ausgegeben hat:<br />
"Aber jeder Mensch hat sein da<strong>im</strong>.on.ion und das, was mich<br />
treibt, habe ich wahrlich nicht aufgesucht, es kam ungerufen<br />
geflattert und s i t z t mir jetzt auf dem Nacken." (13)<br />
<strong>Scheffel</strong> treibt diese Stilisierung noch weiter: "und ganz in der<br />
Ferne steht der Wahnsinn, der als letzte tröstende Macht sich<br />
übers arme Hirn zu senken d r o h t " N i c h t dem in seiner<br />
Existenz bedrohten Dichter des 20. Jahrhunderts i s t damit vorgegriffen,<br />
sondern die Spielmarke poetischer SelbstStilisierung<br />
wird ins Extrem getrieben.<br />
Modern f r e i l i c h , <strong>im</strong> Sinne kritischer Reflexion der poetischen<br />
Existenz, deutet <strong>Scheffel</strong> die Dichterwerdung seines Helden <strong>im</strong><br />
tZk.ke.ha/id. Das Versagen der Sprache als Grundlage des Dichtens<br />
wird allerdings nicht auf der Bewußtseinsstufe reflektiert, wie<br />
man es beispielsweise <strong>von</strong> Hofmannsthals bekanntem Chandos-Brief<br />
gewohnt i s t . Sprachversagen <strong>im</strong> Ckkeka/id bleibt das individuelle<br />
Schicksal der Hauptfigur. Ekkehard w i l l zur Herzogin sprechen,<br />
aber "die Rede blieb, wo sie entstanden - in seinen Gedanken"<br />
(V,33). Die rein mechanische Nachahmung der Hexameter Vergils<br />
bringt Ekkehards erste Dichtungsversuche zum Scheitern: "Es<br />
ging aber nicht so leicht" (V,141). Für diese als Vorstufe seines<br />
späteren Dichtens zu betrachtende Produktion braucht Ekkehard<br />
ein träumerisches Sitzen, bei dem ihm ein "guter Gedanke"<br />
kommt, "als wenn Virgilius ihm in seiner Turmeinsamkeit erschienen<br />
wäre" (V,14-1). Noch gebricht es ihm f r e i l i c h an künstlerischem<br />
Ausdruck (V,14.2), so daß alle seine Verse noch unter der<br />
Schwelle echter Dichtung bleiben. Erst als die Herzogin ihn vom<br />
Vorlesen abbringen w i l l , beginnt Ekkehards echtes Dichten; aus<br />
der Reproduktion s o l l die eigene Produktion erwachsen: "Oder
31<br />
gehet hin und dichtet selber etwas" (VI, 314.) • Ekkehards Unfähigkeit<br />
dazu zeigt sein mißlungener Versuch, eine Parabel zu erzählen<br />
:<br />
"Ihr sollet erzählen!<br />
Ich s o l l erzählen! murmelte er und fuhr mit der Rechten über<br />
die Stirn. Sie war heiß; es stürmte drin.<br />
Ja wohl, - erzählen! Wer spielt mir die Laute dazu?<br />
Er stand auf und sah in die Mondnacht hinaus. Verwundert<br />
schauten die andern sein Gebaren. Er aber hub mit klangloser<br />
St<strong>im</strong>me an:<br />
Es i s t eine kurze Geschichte. Es war einmal ein Licht, das<br />
leuchtete hell und leuchtete <strong>von</strong> einem Berg hernieder und<br />
leuchtete in Regenbogenfarben und trug eine Rose <strong>im</strong> Stirnband<br />
. . .<br />
Eine Rose <strong>im</strong> Stirnband?! brummte Herr Spazzo kopfschüttelnd.<br />
... Und es war einmal ein dunkler Nachtfalter, fuhr Ekkehard<br />
<strong>im</strong> gleichen Ton fort, der flog zum Berg hinauf und flog um<br />
das Licht und wußte, daß er verbrennen müsse, wenn er hineinfliege,<br />
und flog doch hinein, und das Licht verbrannte den<br />
Nachtfalter, da ward er zur Asche und vergaß des Fliegens!<br />
Amen!<br />
Frau Hadwig sprang unwillig auf.<br />
Ist das Eure ganze Geschichte? fragte sie.<br />
Meine ganze Geschichte! sprach er mit unveränderter St<strong>im</strong>me."<br />
(VI,337)<br />
Das Erzählen <strong>im</strong> gleichnishaften Märchenton ("es war einmal")<br />
i s t gattungsmäßig ("Geschichte") und s t i l i s t i s c h ("<strong>im</strong> gleichen<br />
Ton", "und"-Anschlüsse) wie auch <strong>im</strong> mündlichen Vortrag ("mit<br />
klangloser St<strong>im</strong>me") auf der falschen Ebene angesiedelt, so daß<br />
es den idealen Poesievorstellungen Ekkehards nicht entsprechen<br />
kann: "erzählen! Wer spielt mir die Laute dazu?"(VI,337). Erst<br />
auf dem Wildkirchlein findet Ekkehard die rechten Worte: "und<br />
er wunderte sich, daß sie ihm so entströmten" (VI,363). Die<br />
gesteigerte poetische Subjektivität hat ihren adäquaten Ausdruck<br />
gefunden.<br />
Nach seiner körperlichen Gesundung und nachdem das "gestörte<br />
Gleichgewicht" (VI,368) wiederhergestellt i s t , kann sich Ekkehard<br />
an seinen Jugendfreund, den Dichter Konrad <strong>von</strong> Alzey,<br />
erinnern. Das Andenken an ihn (VI,372) macht Ekkehard gleichf<br />
a l l s zum Dichter. Die Erinnerung zeitigt erst jetzt eine so<br />
starke Wirkung, weil Ekkehard urplötzlich erkennt, daß Konrad<br />
ein echter Dichter i s t : "- und was Konrad damals gesprochen,<br />
war hehr und gut, denn er schaute mit dem Aug' eines Dichters<br />
in die Welt" (VI,370). Die Stofffülle Konrads i s t so groß, daß<br />
daß er Ekkehard etwas da<strong>von</strong> abgegen kann:
32<br />
"Für dich wüßt 1 ich auch einen Sang, der i s t einfach und nicht<br />
allzu herb und paßt zu deinem Gemüt /. ../ Und er hatte ihm<br />
die Sage weitläufig erzählt; f...] sing du den Walthari!"<br />
(VI,371)<br />
Die Entwicklung Ekkehards vom Erklärer der Dichtungen des Vergil<br />
zum Produzenten eigener Poesie erklärt er sich selbst aus dem<br />
"großen Schmerz in sich, der ausgetobt werden mußte" (VI,372).<br />
Damit wird, neben der richtigen Dichtweise, dem Singen, die<br />
zweite Bedingung der Dichterwerdung Ekkehards genannt, nämlich<br />
die erlösende Selbstaussprache. Eine dritte Bedingung i s t<br />
schließlich die metaphorisch als Erinnerung bezeichnete Rückbesinnung<br />
auf historische Vorgaben. Wie Ekkehard den ersten Anstoß<br />
eigener Produktion aus dem Vorbild Vergils erhalten hatte,<br />
so steigt ihm jetzt "aus dem Schutt vergangener Zeit" (VI,378)<br />
die Erinnerung an gar nicht selbst erlebte Ereignisse empor, und<br />
"mit Sang und Klang zog der Geist der Dichtung bei ihm ein".<br />
Sind alle drei Bedingungen erfüllt, dann geschieht die Dichterwerdung<br />
urplötzlich: "Er sprang auf und tat einen Satz in die<br />
Luft" (VI,378). Wie <strong>im</strong> Vorwort des Romans die Gestalten zum Erzähler<br />
gesrochen hatten: "Verdicht uns!" (V,9), so wendet sich<br />
Konrad an Ekkehard: "Tu's" (VI,378). Damit wird Dichtung auch<br />
zum Ersatz für eigenes Handeln. Trotzdem Ekkehard "seinen<br />
Schmerz zu versingen" hat, geht er "fröhlich ans Werk"; sein<br />
"Herz i s t wohlgerautet" (VI,378). Nach seinen mißlungenen Erzählversuchen<br />
hat Ekkehard jetzt die ihm gemäße Aussageform gefunden:<br />
er *ingt das Waltharilied.<br />
Denn <strong>im</strong> Dichtungsvorgang vermischen sich für ihn die Künste:<br />
"und die Musica war ein guter Verbündeter dem Werke der Dichtung"<br />
(VI,381). Das Werk, "das erst wie ferner Nebel ihm vorgeschwebt,<br />
verdichtete sich und nahm Gestaltung an und zog in<br />
lebendurchatmeten Bildern/'!/ an ihm vorüber" (VI,381). Wie ein<br />
Maler geht Ekkehard zu Werk, während er gleichzeitig die Augen<br />
vor der Welt verschließt. Im Dichten wird der Mensch nicht nur<br />
zum Seher, sondern die Menschentat wird "zur Tat des Schöpfers,<br />
der eine Welt aus dem Nichts hervorgerufen" (VI,381). In<br />
Schwächeperioden holt sich der Dichter neue Kraft vor der heroischen<br />
Kulisse der einsamen Bergwelt und sucht die Orte wieder<br />
auf, "wo der erste Gedanke des Sangs in ihm aufgestiegen" (VI,382)<br />
aber meistens muß er sich mit der Fixierung seiner Dichtung
33<br />
eher beeilen, so schnell kommen ihm neue Gedanken: "Wenn das<br />
Herz erfüllt i s t <strong>von</strong> Sang und Klang, hat die Hand sich zu sputen,<br />
dem Flug der Gedanken nachzukommen" (VI, 384.). Als fertiges Werk<br />
i s t Ekkehards Dichtung "gesund und gewaltig geworden" (VI,4-17)<br />
und enthält damit in sich schon für den Leser die entsprechende<br />
Wirkung: "echte Dichtung macht den Menschen frisch und gesund"<br />
(VI,4-18). Ekkehard hat rote Backen bekommen, jubelt und lacht;<br />
für ihn i s t das Dichten zur Therapie geworden, die er nach<br />
seiner Genesung nicht mehr nötig hat (VI,419). Der Definition<br />
<strong>von</strong> Poesie als "Hakenfüße und Runen auf Eselshaut" (VI, 4-19), wie<br />
sie ein alter Senn gibt, widerspricht Ekkehard nun nicht mehr.<br />
Er hat Dichtung und Einsamkeit als eine "Schule fürs Leben"<br />
betrachtet und begibt sich nicht nur topographisch "wieder zu<br />
Tale"<br />
(VI,424).<br />
Mit seiner Dichterwerdung i s t Ekkehard zugleich zum Mann ger<br />
e i f t :<br />
"Der Jüngling lag in Träumen, dann kam die dunkle Nacht;<br />
In scharfer Luft der Berge i s t jetzt der Mann erwacht!"<br />
(VI,425)<br />
Als Ekkehard "ausgesungen" und seine Dichtung "an den Nagel"<br />
(VI,425) gehängt hat, verbreitet sich die "Fama" (VI,427) seines<br />
Dichtertums. Der Widerspruch in Spazzos Satz, der Ekkehards<br />
literarisches Anfangsproblem war, i s t für ihn wie für <strong>Scheffel</strong><br />
gelöst: "Wie kann der singen, der nicht einmal erzählen kann?"<br />
(VI,427). Aus der hohen Welt der Berge zieht Ekkehard in die<br />
"weite Welt" und wird Weltmann, nunmehr in "jeglicher Kunst"<br />
erfahren (VI,428). Jetzt meistert er nicht nur sein eigenes<br />
Leben, sondern lenkt auch das anderer in Kirche und Reich.<br />
Daß dieses Dichterbild nicht nur für <strong>Scheffel</strong> charakteristisch<br />
i s t , sondern auch zeittypische Bedeutung hat, i s t offensichtl<br />
i c h . Der Bruch f r e i l i c h , wie er zwischen den inhaltlichen Postulaten<br />
Ekkehards oder des Romanvorworts und den rhetorischen<br />
Formulierungen selbst a u f t r i t t , zeigt deutlich, wie halbherzig<br />
die Best<strong>im</strong>mungen des programmatischen Realismus erfüllt sind.<br />
Idylle und Weltschmerz, rhetorische Kraftmeierei und erzählerische<br />
Extremformulierungen verweisen eher auf die vorrealistische<br />
1 5<br />
Erzählposition . Daß diese Unentschlossenheit zwischen beiden<br />
Positionen ebenfalls auf der Linie der Zeit liegt, wird darin
34<br />
klar, daß für andere Dichter eine ungebrochene Identifikationskraft<br />
<strong>von</strong> der Dichtergestalt des Ekkehard ausgeht. Gerade<br />
Gustav Freytag, einer der entschiedensten Vertreter des programmatischen<br />
Realismus, lobt in einem Brief an seinen Verleger<br />
nicht nur "ein achtes Künstlergemüth" des Roraanhelden, sondern<br />
s t e l l t sich gegen das Lesepublikum auf die Seite des Dichters<br />
mit der Behauptung, "für's große Publikum i s t diese feine,<br />
alterthümliche und außerdem künstlerisch unfertige Arbeit nicht,<br />
wohl aber für unsereinen"^.<br />
Auf welcher Höhe weit über dem "Lesepöbel" <strong>Scheffel</strong> selbst die<br />
Poesie angesiedelt hat, kann ein Blick auf das letzte Gedicht<br />
der T/tau Avantiu/ie., "Auf wilden Bergen" (lll,118f), zeigen.<br />
<strong>Scheffel</strong> s t e l l t hier Heinrich <strong>von</strong> Ofterdingen als den Musterf<br />
a l l poetischer Inspiration in den Rahmen einer wildheroischen<br />
Natur. Aus dem Dichterkreis des sagenhaften mittelalterlichen<br />
Sängerwettstreits auf der Wartburg<br />
i s t der Ofterdinger in die<br />
Welt der "Hochtaleinsamkeit"(III,118), der sprudelnden<br />
Quellen<br />
und des H<strong>im</strong>melblaus gezogen. Die inspirierenden Gestalten und<br />
die einsame Natur bilden zusammen eine Wertaura (beide sind<br />
"rauh"), in der Naturschönheit und göttlich-poetische<br />
Offenbarung<br />
zusammenfallen:<br />
"Wer sich auf Dichten peint, folgt dunkeln Geistern<br />
Und wird dem Weltlauf windsbrautgleich entführt;<br />
Ihr Joch i s t rauh, doch wen sie niemals meistern,<br />
Der hat des Schöpfers Odem nie verspürt.<br />
Sie leiten jeglichen nach seiner Weise,<br />
Daß ihm der Schönheit Offenbarung kund ...<br />
... Mich zu den Gemsen, wo in ewigem Eise<br />
Gehe<strong>im</strong>nisvoll saphirhell gähnt der Schlund." (111,119)<br />
Gleicht der Rückzug des Minnesängers noch stark dem Ekkehards<br />
in die heroische Natur, so steigt <strong>im</strong> 7/iompete./i der Dichtungsbegriff<br />
auf eine andere Höhenebene der Natur. Die Verliebtheit<br />
Jung-Werners veranlaßt den Erzähler zu einem Vergleich der<br />
Liebe mit der Poesie:<br />
"Und es klang und sproßt' und wogte<br />
Wie die ersten Ke<strong>im</strong>e eines<br />
Unvollendeten Gedichts." (I,39f)<br />
Liebe und Lied wollen nicht nur grammatikalisch zusammenfallen<br />
Die vollendete Liebe übersteigt die unvollendete Dichtung; sogar<br />
der Sänger muß jetzt<br />
schweigen:<br />
1 7
35<br />
"Kuß i s t mehr als Sprache, i s t das<br />
Stumme hohe Lied der Liebe,<br />
Und wo Wort nicht ausreicht, ziemt dem<br />
Sänger schweigen f. ..] . " (I,130f)<br />
Man hat denn<br />
auch auf die Vertauschbarkeit der Empfindungswerte<br />
1 8<br />
<strong>von</strong> Liebe und Dichtung bei <strong>Scheffel</strong> hingewiesen . Damit aber<br />
kann für <strong>Scheffel</strong> Kunst zum Ersatz für enttäuschte Liebe werden.<br />
Kunst als Trost - das wäre nun nicht neu. Bei <strong>Scheffel</strong> aber<br />
kann sich dieser Prozeß zugleich auch umkehren und aus diesem<br />
Trost Kunst hervorwachsen lassen; beides verschmilzt dann zu<br />
einem Gebilde eigener Art:<br />
"Oft auch, wenn ich schwer mich quäle.<br />
Klingt ein plötzlich 7no*tgedieht,<br />
Und ich fühle deine Seele,<br />
Die verklärt mit meiner spricht." (19)<br />
Für den alternden und kaum mehr dichtenden <strong>Scheffel</strong> i s t die<br />
Kunst schließlich die einzig mögliche Trösterin <strong>im</strong> Alltag:<br />
"Alles Kautz, alles Flongen,<br />
Alles Hoffen, alles Sorgen<br />
Bringt dir Last und manche Pein:<br />
Alles Hoffen durch dein Streben<br />
Alles ohne Reu' erleben,<br />
Dazu mußt du - Dichter sein." (IX,248)<br />
In einem späten Brief an Anton <strong>von</strong> Werner zieht sich <strong>Scheffel</strong><br />
auf diese nur unsichere, aber letzte Hoffnung zurück: "ich<br />
glaube, es nahen mir die Tage, <strong>von</strong> denen geschrieben steht<br />
20<br />
*ie ge.-f.atte.rt min nicht! Vielleicht tröstet die Kunst!"<br />
Immer - und auch das i s t Teil dieser als existenziell verstandenen<br />
Dichterideologie - i s t <strong>Scheffel</strong>s Dichtertum an der Zeit<br />
bzw. gegen sie ausgerichtet. Ein Vergleich der zu den Neuauflagen<br />
des 7nompeten verfaßten Vorworte kann dies verdeutlichen.<br />
Für die zweite Auflage <strong>von</strong> 1858 redet <strong>Scheffel</strong> sein Werk direkt<br />
an (IX,135). Nochmals grenzt er sich, wie in der Zueignung der<br />
21<br />
Erstausgabe, gegen Kritik und normative Forderungen ab und<br />
s t e l l t positive Best<strong>im</strong>mungen gegenüber, unter denen die Kategorie<br />
des Herzens hervorsticht. Sein eigenes Textverständnis<br />
und ein ideal aufgefaßtes Publikum gehören f r e i l i c h einer vergangenen<br />
Zeit an:<br />
"Doch n<strong>im</strong>mer blüht mir auf den alten Pfaden<br />
Die St<strong>im</strong>mung, die ins Leben einst dich r i e f : " (IX,136)
36<br />
Die veränderte Zeitlage s t e l l t den Dichter zwar vor eine veränderte<br />
Situation, verlangt doch die Schlechtigkeit der "Welt<br />
<strong>von</strong> heut" einen anderen als den "altgewohnten Ton" (IX,136).<br />
Wider bessere Einsicht weigert sich aber der Dichter, sich der<br />
Zeitlage anzupassen. Sein Werk s o l l Jugendwerk bleiben als Erinnerung<br />
an vergangene, bessere Zeiten (IX,137: "Ein frohes<br />
Denkblatt froher Jugendzeit"); "neue Lieder" der neuen Zeit<br />
überläßt er anderen: "flzin Amt ist's nicht" (IX,136). Die<br />
Hoffnung auf bessere Zeiten, denen bessere Lieder entsprechen,<br />
wird in eine unbest<strong>im</strong>mte Zukunft verlegt:<br />
"Lauscht man einst wieder hohen, großen Dingen,<br />
Dann werden andre beßre Lieder singen!" (IX,137)<br />
Für die dritte Auflage 1862 läßt <strong>Scheffel</strong> den Kater Hiddigeigei<br />
über die "sonderbar verkehrte Welt" (IX,16$) reflektieren.<br />
Dichter und Werk treten noch weiter auseinander, wenn das l y r i <br />
sche<br />
Ich sich in die Erzählrolle des Katers zurückzieht und<br />
sich über den Erfolg seines Werkes trotz seiner angeblichen Unzeitgemäßheit<br />
wundert:<br />
"Ich vernehme - blaues Wunder -<br />
Daß man wieder ihn verlegt:" (IX,165)<br />
1862 i s t das Bewußtsein einer gefährlich veränderten Zeit "ob<br />
der Zukunft Dunkelheit" (IX,166) konkreter geworden:<br />
"Und ich spähe sehr bedenklich<br />
Nach des Winds und Wetters Saus:<br />
Zeichen, die den Sturm vermelden,<br />
Fühlt voraus mein fein Gefühl,<br />
Und der Dunstkreis war noch selten<br />
So wie heut, elektrisch schwül." (IX,165)<br />
Indem sie "Erlebnis und Erinn'rung traut erneut" (IX,168), versucht<br />
<strong>Scheffel</strong>s Dichtung <strong>im</strong> Vorwort zur vierten Auflage 1864.<br />
die Verfasserrolle wieder aufzunehmen. Doch muß das Ich die<br />
Fiktion<br />
konstruieren, als wandere es die Stätten des 7/iompe.te./i<br />
ab und könne sich das eigene Werk gleichsam durch das Erwandern<br />
nochmals aneignen. Ansehen und Ruhm Säckingens und des Helden<br />
haben sich verbreitet und verselbständigt, ja sogar materialisiert:<br />
schon sind die Hauptfiguren des Versepos "in Fresko<br />
leichtgemalt" (IX,168). Das lyrische Ich i s t zu einer Rahmenfigur<br />
abgedrängt. Erst <strong>im</strong> neuen Kaiserreich, dessen Situation<br />
das Gedicht zur 50.Auflage <strong>von</strong> 1878 vortrefflich spiegelt,
37<br />
bläst der sonst so zaghafte Trompeter wieder "kräftig" und "mit<br />
neufrischem Mut" (IX,201f). Als Figur i s t er mittlerweile nicht<br />
mehr nur gemalt, sondern entsprechend den Zeichen der Zeit "in<br />
Erz gegossen <strong>von</strong> Meisterhand" (IX,202)! Diese Materialisierung<br />
<strong>von</strong> Werk und Figuren zum Denkmal geht Hand in Hand mit einer<br />
<strong>im</strong>mer weiteren Entfremdung des Werks vom Dichter. So gesteht<br />
<strong>Scheffel</strong> in einer<br />
7/iompe.£e./i-Widmung:<br />
"Versuch 1 ich heut 1 dich zu lesen,<br />
Kaum mahnt mich ein leiser Klang,<br />
Daß ich es selbst einst gewesen,<br />
Der auf Capris Klippen dich sang." (IX,192)<br />
Im Wiederlesen des eigenen Werks versiegt sogar beinahe die<br />
Erinnerung an das eigene Dichten. Mit seinem Werk hat der<br />
Dichter kaum mehr gemeinsam als das Alter (IX,201: "wir wurden<br />
allbeid 1 Jubilare"), <strong>von</strong> ihm selbst bleibt kaum mehr als ein<br />
Gedenken schon zu Lebzeiten (IX,202: "wenn ich nicht mehr hienieden<br />
bin").<br />
Es versteht sich, daß eine so definierte Dichtung keinesfalls<br />
Literatur <strong>im</strong> Sinne rational überprüfbarer Regelhaftigkeit sein<br />
kann und w i l l . Schon der Kater Hiddigeigei des 7/iompete/i hatte<br />
das Dichten ironisch kommentiert: "Laß die Studien,/ Was i s t<br />
a l l antiker Plunder" (1,4.). Daß <strong>Scheffel</strong> aus seiner Figur<br />
spricht, zeigt ein Brief an den Vater, in dem sich <strong>Scheffel</strong><br />
über sein schriftstellerisches Vorgehen äußert:<br />
"Ich habe mich bis jetzt auf raeinen Instinct, oder bon sens,<br />
mehr verlassen als auf Regeln der Welt, und habe mich weniger<br />
getäuscht als viele, die sicherer zu rechnen glaubten."<br />
(22)<br />
Die Bevorzugung des unkontrollierbaren Instinkts statt erlernbarer<br />
Kunst- und Handwerksregeln i s t typisch für <strong>Scheffel</strong>s gesamte<br />
Produktion. Im Briefwechsel mit Paul Heyse sieht <strong>Scheffel</strong><br />
sogar in der Wissenschaft den "Tod aller<br />
2 3<br />
schöpferischen Pro-<br />
duktion" . Dieser vorläufige Gegensatz läßt sich in einen Kontrast<br />
zwischen naturhaftem und gelehrtem Dichten ausweiten. Die<br />
Inspiration versteht <strong>Scheffel</strong> als eine intuitive Erfahrung:<br />
"Ich w i l l mich hier mehr <strong>von</strong> der Natur inspirieren lassen und<br />
bitte deshalb noch nicht um die Bücherkiste", schreibt <strong>Scheffel</strong><br />
24<br />
am 11. J u l i 1859 an seine Mutter . Dieses "noch nicht" macht<br />
aber auch deutlich, daß <strong>Scheffel</strong> durch die Inspiration allein
38<br />
nichts zustande bringt. Immer wieder muß er, trotz oder gerade<br />
wegen der proklamierten Verachtung der Wissenschaft, auf "die<br />
Bücherkiste" zurückgreifen.<br />
Eine der Möglichkeiten, die eigene poetische Inspiration zu<br />
unterstützen, i s t in der Tat der Rückgriff auf poetisch erhobene<br />
Vorbilder. Deshalb sind bei <strong>Scheffel</strong> die Versuche zahllos, die<br />
eigene dichterische Produktion derjenigen großer Dichter parallel<br />
zu setzen oder sich in ihnen zu spiegeln. Im &kke.ha/id i s t dies<br />
Vergil, dessen Ae.ne.1* vom Erzähler, aber auch <strong>von</strong> den Figuren<br />
als Folie der eigentlichen Erzählhandlung betrachtet wird. Zugleich<br />
i s t die Aura des römischen Klassikers das Poetische<br />
schlechthin: "Mit dem Namen Virgilius war auch der Begriff des<br />
Zauberhaften verbunden" (V,65). Als Ekkehard schon anerkannter<br />
Lehrer der Dichtungen Vergils isL, erkennt er erst dessen<br />
Nützlichkeit und Anwendbarkeit für die Alltagspraxis: "wie<br />
mühsam wäre es, eine Sprache zu erlernen, wenn sie uns nur <strong>im</strong><br />
Wörterbuch überliefert wäre" (V,101). Der poetische Text l e i t e t<br />
hier seine Legit<strong>im</strong>ation aus seiner sprachdidaktischen Verwendbarkeit<br />
ab. Ein "fein ersonnener Plan und Inhalt, und die Form<br />
klingt l i e b l i c h drein wie Saitenspiel" (V,101) - auf diese einfache<br />
Formel bringt Ekkehard die Vorzüge der klassisch-antiken<br />
Dichtung. Das Versüßen der Welt i s t das Hauptziel dieser Poesie<br />
und gibt ihr <strong>von</strong> da her ihre Berechtigung. Die Herzogin Hadwig<br />
hingegen setzt Dichtung und Traum gleich: "Dichtung i s t so v i e l<br />
wie Traum" (V,104). Ekkehard, das wird aus seiner Antwort ersichtlich,<br />
trennt zwischen echtem und dichterischem Traum: "so<br />
ihr mich wieder fraget, w i l l ich einen Traum erzählen, auch wenn<br />
ich ihn nicht geträumt habe" (V,104). Dieses Mißverständnis<br />
zwischen beiden, das aus der Vergillektüre resultiert, legt<br />
schon den Ke<strong>im</strong> für den späteren Liebeskonflikt. Erst als die<br />
gemeinsamen Vergillesungen bei Äneas und Dido angelangt sind,<br />
kann die Herzogin wie Ekkehard einen direkten Bezug zur eigenen<br />
Gegenwart herstellen: "Glaubt' ich doch schier ein Abbild<br />
eigener Herrschaftsführung zu hören" (V,106). Diese Bedeutungshaftigkeit<br />
Vergils für den Handlungsverlauf steigert sich noch,<br />
wenn Praxedis den Vergil als "ein zuverlässiger Orakel der<br />
Zukunft als unser Blei/gießen7" bezeichnet (V,150) oder aber<br />
Vergils Kampfbeschreibungen mit dem Gew<strong>im</strong>mel auf dem Burghof<br />
verglichen und auf ihre Wirklichkeitsnähe hin überprüft werden.
39<br />
Das Interesse der Herzogin für Vergil existiert allerdings nur<br />
so lange, als ihr die Parallelen zwischen ihrer Wirklichkeit<br />
und der Dichtung angenehm sind:<br />
"Sie warf sich in ihrem Lehnstuhl zurück und schaute zur<br />
Decke empor. Sie fand keine Beziehungen mehr zwischen sich<br />
und der Frauengestalt des Dichters." (VI,311)<br />
Die erste Aufforderung, selbst zu dichten, richtet die Herzogin<br />
an Ekkehard unter dem Vorzeichen Vergils. Ekkehards poetische<br />
Konkurrenz zu Vergil i s t zunächst nur "das Echo eines Meisters<br />
wie V i r g i l i u s " (VI,314), bevor er zu einer eigenständigen Poesie<br />
vorstößt. Für die Herzogin - und für die Struktur des Romans -<br />
hat jedoch Vergil bald seinen Dienst getan. "Sie g r i f f den Virgilius<br />
und warf ihn f e i e r l i c h unter den Tisch als Zeichen, daß<br />
eine neue Ära beginne" (VI,31$) .<br />
Mit der Erinnerung an Konrad, den Dichter der alten germanischen<br />
Heldensagen, hat Ekkehard wieder ein neues literarisches<br />
Vorbild gefunden, das sich charakteristisch vom antiken Klassiker<br />
unterscheidet und sinnfällig die neue Stufe des Dichters<br />
Ekkehard verdeutlicht. Gleich daneben erscheint der Schmähschriftenschreiber<br />
Gunzo, ein parodistisches Beispiel für den<br />
Schriftstellerberuf. In hochtrabendem Ton spricht Gunzo <strong>von</strong> der<br />
"inneren Haushaltung eines Gedichts" und "der Würde der Dichtkunst"<br />
(VI,26$), ohne beidem in seinen eigenen Werken gerecht<br />
zu werden. Seine ironische Zeichnung gibt Ekkehard die positive<br />
2 6<br />
Legit<strong>im</strong>ation als Dichter<br />
Für die Sängerrollen <strong>Scheffel</strong>s sind andere Dichtergestalten, in<br />
denen sich das eigene Dichter-Ich spiegeln kann, adäquater. Die<br />
Lieder der Tn.au Avant Lüne geben schon <strong>im</strong> Titel den Bezug zum<br />
Minnesang vor. Im ' S t i l ' des Mittelalters werden Textvorlagen<br />
f r e i nachgedichtet und bekannten Minnesängern in den Mund gelegt;<br />
Fußnoten stellen den Bezug zum Original her, wobei sie<br />
in ihrem Verweis auf die Quellen auch die weite Entfernung <strong>von</strong><br />
Neudichtung und Vorbild aufdecken. <strong>Scheffel</strong>s pathetische Tatgebärde<br />
schafft sich in Wolfram <strong>von</strong> Eschenbach eine Bezugsfigur,<br />
in der <strong>Dichterberuf</strong> und weltliches<br />
Rittertum zusammenfallen<br />
sollen:<br />
"Doch be<strong>im</strong> Schrei aus rauher Kehle<br />
Und <strong>im</strong> tobendsten Gewühl<br />
Rauscht es oft <strong>im</strong> Grund der Seele
40<br />
Wie ein fernes Saitenspiel,<br />
Wiegt, dem Speerkrach kaum entritten,<br />
Mich in Träume, weich und traut,<br />
Und je wilder ich gestritten,<br />
Desto milder tönt der Laut.<br />
Viel zu eng deucht mir die Weite,<br />
Viel zu schmal die Breite dann,<br />
Fremd Gebild i s t mein Geleite,<br />
Fremder Zauber starrt mich an.<br />
Nach dem Urborn alles Schönen,<br />
Nach der Dichtung heil'gem Gral<br />
Zielt mein abenteuernd Sehnen,<br />
Und ich selbst bin Parzival." (111,21)<br />
"Je wilder" "desto milder" lösen sich Kriegsspiel und poetische<br />
"Träume" als Lebensformen ab. Das ursprünglich nur durch die<br />
r i t t e r l i c h e Tat erreichbare Ziel <strong>im</strong> Pa/iz Iva £, der Gral, i s t<br />
seiner gehe<strong>im</strong>nisvollen Sphäre enthoben. Er i s t jetzt durch die<br />
Dichtung als deren eigentliches Ziel erreichbar und bereitet<br />
in plumper Eindeutigkeit den Schluß vor, in dem Lyrikerrolle,<br />
Dichtergestalt und Werkvorgabe in eins fallen. In diesem Sinne<br />
s t e l l t das Gedicht "Dem Landgrafen Hermann den Parzival überreichend"<br />
(111,24-27) den Pa/iz Iva ^-Erzähler als völlig identisch<br />
mit Wolfram vor. Damit aber erscheint auch die Übertragung des<br />
Parzivalstoffes zur Einkleidung in ein neues deutsches "Klanggewand"<br />
(111,25) geworden, der Dichtungsprozeß wird dann endl<br />
i c h selbst zum Gegenstand des Dichtens. Schließlich läßt<br />
<strong>Scheffel</strong> seinen Wolfram <strong>von</strong> Eschenbach be<strong>im</strong> Dichten auf und ab<br />
schreiten wie seinen 7/iompe.te./i-Di cht er (111,26 und 1,5). Fast<br />
<strong>im</strong> gleichen Atemzug verläßt dann das lyrische Ich die Wolfram-<br />
Figur und schlüpft <strong>im</strong> "Rügelied"<br />
(111,107-109) in die Gestalt<br />
Heinrichs <strong>von</strong> Ofterdingen. Mit ihm verbindet sich <strong>Scheffel</strong><br />
plötzlich gegen Wolfram <strong>von</strong> Eschenbach und dessen Dichtungsprinzipien<br />
als einem "übereifrigen Nachahmer französischer Art<br />
und Dichtung" (111,107)! Das lyrische Ich <strong>Scheffel</strong>s hat dabei<br />
bruchlos seine vorherige Sängerrolle abgestreift, weil Heinrichs<br />
Wanderschaftsvokabular und seine Verstummensneigung dem<br />
Dichter des 19. Jahrhunderts biographisch näher liegen. Diese<br />
größere biographische Nähe auch als nationalpoetisches Identifikationsangebot<br />
- "Deutsche Mär"(III,109) - wird jetzt gegen<br />
den Gralsstoff ausgespielt.
41<br />
2. Strukturen poetischer Illusion<br />
Untersucht man <strong>Scheffel</strong>s Texte hinsichtlich des Ursprungs solcher<br />
Poesievorstellungen, so stößt man auf den merkwürdigen Befund,<br />
daß für <strong>Scheffel</strong> die Intention seiner Dichtung, ihr Ausgangspunkt<br />
<strong>im</strong> Dichter und ihr Endpunkt <strong>im</strong> Leser zusammenfallen.<br />
Die Begriffe Herz, Seele, Gemüt und Phantasie umschreiben diese<br />
Aura allgemeiner, als poetisch ausgegebener Vorstellungen. Obwohl<br />
diese Begriffe eine zentrale Kategorie für <strong>Scheffel</strong>s Dichtungsverständnis<br />
darstellen, bleiben sie gänzlich unreflektiert,<br />
können beliebige Konnotationen einnehmen und in völlig identi-<br />
27<br />
schem, aber auch in widersprüchlichem Sinn gebraucht werden<br />
Als poetische Kategorie handelt es sich l e t z t l i c h um eine ausfluchtartige<br />
Begrifflichkeit, die dem Dichter als letzter Grund<br />
<strong>im</strong>mer.verfügbar i s t und auf die er jederzeit zurückgreifen kann.<br />
Diese Auffassung kann etwa darin gipfeln, daß Kunst und ihre<br />
Entstehung 'organisch' miteinander verbunden sind: "die ganze<br />
28<br />
Kunst<br />
wurzelt ja <strong>im</strong> Gemüte"<br />
Im &kke.ha/id beschreibt der Begriff des Herzens einen der durchgängigsten<br />
Strukturzüge des Romans. Von den drei Freunden des<br />
Vorworts, die auf historische Uberreste stoßen, i s t weder der<br />
Archäologe noch der Historiker in der Lage, Zusammenhänge aufzudecken.<br />
Erst der dritte, ein Künstler, "erschaut" den inneren<br />
Zusammenhang als Bild: "da stand das Ganze klar vor seiner<br />
Seele" (V,6). Im Sinne dieser Überlegenheit <strong>von</strong> Gemütswerten<br />
gegenüber nur rationalen Fähigkeiten beurteilt auch der Erzähler<br />
den Charakter der Herzogin: "bei scharfem Geist ein rauhes<br />
Herz <strong>im</strong> Busen" (V,1$). Ist so die Heldin schon negativ besetzt,<br />
so g i l t das genaue Gegenteil für die männliche Heldenfigur. Auf<br />
Ekkehards Herz wirken Religion (V,84) und große Landschaft (V,85:<br />
"große Landschaft wirkt jederzeit ernst <strong>im</strong> Gemüt"), seine Verhaftung<br />
schlägt sich in seinem Herzen nieder. Zwar "wogt und<br />
brandet es noch lange stärker als sonst" (VI,349), aber "Ekkehards<br />
Herz war noch nicht gebrochen. Dafür war es zu jung" (VI,<br />
349). Der "Sturm in seinem Herzen" (VI,364) wird zum Signal<br />
weitreichender innerer Veränderungen. Die innere Wandlung kann<br />
dabei reale Aktionen vollgültig ersetzen:
42<br />
"Melancholisch Gemüt zehrt lang an erlittener Beschädigung<br />
und vergißt in seinem Brüten, daß tadelhafte Tat nur durch<br />
nachfolgende bessere <strong>im</strong> Gemüt/!/ der Menschen verwischt<br />
wird." (VI,365)<br />
Vor seiner Dichterwerdung muß Ekkehard schließlich selbst erkennen,<br />
wie wichtig die Instanz des Herzens für ihn i s t : "N<strong>im</strong>m<br />
du mich auf, r i e f er, mein Herz w i l l Ruhe!" (VI,366). Solches<br />
"lindes Gefühl <strong>von</strong> Ruhe" geht mit "aufsprossender Gesundheit"<br />
Hand in Hand (VI,368); beides i s t das Ergebnis <strong>von</strong> Ekkehards<br />
grundsätzlicher Isolierung: "der Mensch muß <strong>von</strong> Stein werden<br />
wie der Säntis und kühlenden Eispanzer ums Herz legen" (VI,368).<br />
Erst hier, in der Einnerung an seinen Freund Konrad und dessen<br />
Dichtertum erkennt Ekkehard, daß er "das Herz am rechten Fleck<br />
hat" (VI,371). Auch Konrad spielt, wenn er <strong>Scheffel</strong> einen Stoff<br />
zum Dichten anbietet, auf diese Instanz an: "Für dich wüßt' ich<br />
auch einen Sang, der i s t einfach und nicht allzuherb und paßt<br />
zu deinem Gemüt" (VI,371). Dieser Vorschlag bleibt wie "ein<br />
triebkräftig Samenkorn" "in des Menschen Herz", bis er bei<br />
Ekkehard aufgeht und zu eigener Dichtung werden kann: "laß<br />
stürzen, Herz, sprach er, was nicht mehr stehen mag, und bau<br />
dir eine neue Welt" (VI,372). In einsamer Natur kann das Herz<br />
29<br />
des Dichters schließlich produktiv werden , um als Dichtung<br />
hervorzuquellen. "Das Herz schwellt" (VI,383), meint auch das<br />
Naturkind Benedicta, und der Erzähler weiß zu berichten, daß<br />
"das Herz erfüllt i s t <strong>von</strong> Sang und Klang" (VI,384). In einer<br />
Art Rückkoppelungsprozeß wirkt das auf diese Weise Produzierte<br />
sogar auf die Natur in Form einer Bärin zurück: "Das labte der<br />
Verlassenen Gemüt" (VI,385). Und schließlich bedauert der Erzähler,<br />
daß es kein rührendes Ende geben werde; ein gebrochenes<br />
Herz Ekkehards wäre ein akzeptabler Erzählschluß gewesen (VI,<br />
418).<br />
Weitläufig wäre die Funktion der Herzmetaphorik für die Lyrik<br />
<strong>Scheffel</strong>s zu belegen, in der echte Kunst einfach dadurch definiert<br />
wird, daß sie aus dem Herzen kommt und zu Herzen geht.<br />
Mit dieser Auffassung steht <strong>Scheffel</strong> nichts weniger als a l l e i n in<br />
seiner Zeit. Sent<strong>im</strong>entalisierende Vertrautheit mit romantischen<br />
Leerformeln, biedermeierliche Innigkeit und die Abwehr tendenziell-politischer<br />
wie abstrakt-philosophischer Dichtungsformen<br />
stehen <strong>im</strong> Hintergrund, wenn poetische 'Natürlichkeit'
43<br />
gefordert wird . Als individual-poetisehe Aussage hingegen i s t<br />
das spezifisch Scheffeische zu interpretieren, einen Gegensatz<br />
<strong>von</strong> "Instinct" und abwertend gesehenen "Regeln der Welt" zu<br />
s t i l i s i e r e n . Es i s t deshalb kein funktionsloses Verweilen,<br />
wenn sich <strong>Scheffel</strong> in seiner kulturhistorischen Studie Au* dam<br />
H.auan*£aine.n S chioa/izioa £d scheinbar ungebührlich lange bei den<br />
altmodischen Kachelöfen der Bauern aufhält. Der Grund dafür<br />
wird sofort klar:<br />
"Dieser Ofen hat eine kulturgeschichtliche Bedeutung. Die<br />
Ofenbank heißt nicht umsonst die Hun*t oder Chau*cht; auf<br />
ihr liegt der Wäldler der edeln und freien Kunst des Nichtstuns<br />
und Schnapstrinkens ob, auf ihr brütet er seine feinsten<br />
Pfiffe und Schliche aus, auf ihr träumt er seine<br />
schönsten Träume. Mag der Elfe in s t i l l e r Mondnacht auf<br />
schwankem Blatt des Farnkrauts sich schaukeln oder aus dem<br />
Kelch der Glockenblume den Tautropfen schlürfen, mag der<br />
Romantiker in der Waldeinsamkeit seinen Waldhornklängen<br />
lauschen: das alles i s t kein Standpunkt gegenüber der Hauensteiner<br />
Kun*t.<br />
Adolf Stahr in seinen Pariser Briefen behauptet zwar: da/i<br />
0{.an i*t Pno*a und nun dan Kamin i*t Poa*ie; - aber ein<br />
Winteraufenthalt zu Herrischried <strong>im</strong> Wald würde ihn v i e l l e i c h t<br />
belehren, daß noch mancherlei irdische Dinge seinen Kategorien<br />
nicht vollkommen adäquat sind, daß unter andern auch<br />
hier in behaglicher Ofenwärme reale Poesie sprießt." (VII,159)<br />
Das ausführliche Zitat i s t auch deshalb gerechtfertigt, weil<br />
sich hinter dem unverbindlich humoristischen Plauderton des<br />
Feuilletonisten Zusammenhänge <strong>von</strong> Poesie, Saufen und Sent<strong>im</strong>entalität<br />
verbergen, auf die noch einzugehen i s t .<br />
Der Ort, an dem sich das poetische Erleben des Dichters am geeignetsten<br />
abspielen kann, i s t f r e i l i c h die Natur. Insofern i s t<br />
die "ganz einzige Art des Naturerlebens", die man an <strong>Scheffel</strong><br />
32<br />
aufgewiesen hat , die notwendige Ergänzung der poetischen Begabung:<br />
"Der Poet gehört in den rauschenden Wald, an fließendes<br />
Wasser, auf sturmumblasenes Hochgebirg f..,J in der Stadt<br />
i s t er <strong>im</strong>mer, wie eine Forelle <strong>im</strong> Gartenteich." (33)<br />
Ist die Natur in ihrer Ausformung als schöne Landschaft die<br />
Voraussetzung für jedes Dichten überhaupt, so i s t sie für den<br />
älteren und nur noch selten dichtenden <strong>Scheffel</strong> zugleich der<br />
einzige verbliebene Gegenstand für ein Gedicht. Im Gedicht<br />
"Der Hegau-Sänger" <strong>von</strong> 1882 (lX,231f) s t e l l t das Gedicht selbst<br />
eine<br />
Poetik des Landschaftsdichters dar. Der Sänger, der in
u<br />
der Verherrlichung seiner He<strong>im</strong>at den Einfluß belegt, den diese<br />
auf sein Dichten genommen hat, zieht als Wander-Sänger durch<br />
die Natur. Seine Dichtung i s t inhaltlich unwichtig geworden, abgesehen<br />
vom Inventar seiner Wanderschaft (Zitter, grünes Band,<br />
Bart mit Eis) und den durchstreiften Gegenden (Dom, Schlucht,<br />
Schwarzwaldhang usw.). Der altgewordene Sänger, und das i s t der<br />
direkte biographische Bezug auf <strong>Scheffel</strong>, gibt in den beiden<br />
Schlußstrophen preis, was er bisher verhe<strong>im</strong>lichen konnte. Der<br />
"Schritt" des Wanderers ist es, der noch "frank und leicht"<br />
geht; das Singen wie "Lerchenschlag" hingegen schützt der<br />
Sänger nur vor (IX,232). Jetzt kann ihn nicht einmal mehr die<br />
Natur neu inspirieren: den beiden letzten Strophen bleibt nur<br />
noch, die beiden ersten wörtlich zu wiederholen!<br />
Hat für den älteren <strong>Scheffel</strong> die Natur also eher den Charakter<br />
einer Rückzugs- und Heilwertfunktion, für den jungen Dichter<br />
i s t die Natur wegen ihrer inspirativen Kraft <strong>im</strong>mer Gegenstand<br />
halbreligiöser Verehrung. Hinter dem pantheistischen Vokabular,<br />
mit dem die Natur angesprochen wird, sch<strong>im</strong>mert durch, daß die<br />
Natur dem Dichter ein Ort der Abwesenheit <strong>von</strong> gesellschaftlichen<br />
Zwängen i s t :<br />
"Den deutschen Grundrechten gemäß, welche die Kirche f r e i <br />
gegeben haben, habe ich mir meine eigene Kirche gebaut und<br />
meinen eigenen Kultus gestiftet, und der haust nicht innerhalb<br />
U geweihter Wände a l l e i n , sondern weiter. Aus allem<br />
Menschengew<strong>im</strong>mel und törichtem Treiben gehe ich, wenn mir's<br />
zu bunt wird, hinaus in den Tannenwald oder steig auf Bergeshöhen<br />
und hör dem Moos zu, wie es wächst, und der Lerche,<br />
wie sie in blaue Luft schmetternd steigt, und wer die Augen<br />
am rechten Fleck hat, der sieht in der Natur, in dem Qe.i*t<br />
in meinem Ande/itAe.in gar manches, wo<strong>von</strong> nichts in den Kompendien<br />
der Theologen steht, und es kommt wieder Harmonie<br />
und ein Hauch des Absoluten ins zerrissene Herz." (34)<br />
Mit dem zunehmenden Ruhm <strong>Scheffel</strong>s und seiner Werke wird auch<br />
die <strong>von</strong> ihm verherrlichte Landschaft bekannt und damit für den<br />
Fremdenverkehr unteressant. <strong>Scheffel</strong> wird zum Dichter, der die<br />
3 5<br />
Landschaft "verklärte und beseelte" . Auch so i s t das Urteil<br />
Hofmannsthals zu verstehen, die Schönheit des £kke.ka/id lebe aus<br />
einer Spannung zwischen den Gestalten, die "zugleich in eine<br />
ferne deutsche Vergangenheit und in eine völlig gegenwärtige<br />
deutsche Landschaft" gestellt sind .<br />
Welche Kräfte in dieser Naturideologie stecken, zeigt das Ge-
45<br />
dicht "Die He<strong>im</strong>kehr" aus der T/iau Auentiu/ie (HI,40f). Im<br />
Munde eines he<strong>im</strong>kehrenden Kreuzfahrers kommen dessen Erfahrungen<br />
in orientalischen Landschaften schlecht weg. Der "Wüstensand"<br />
wird dem "He<strong>im</strong>atwald" (111,40) gegenübergestellt. Die Gefahr<br />
einer nationalchauvinistischen Aufladung der Begriffe, die man<br />
erwartet, kommt jedoch gar nicht auf gegen die heilende Kraft<br />
des<br />
Waldes und der beschworenen Gesundheitsideologie:<br />
"Denn das i s t deutschen Waldes Kraft,<br />
Daß er kein Siechtum leidet<br />
Und alles, was gebrestenhaft,<br />
Aus Leib und Seele schneidet." (111,40)<br />
Dichtung, und auch das erläutert das Lied des Kreuzfahrers,<br />
kommt aus dieser Naturerfahrung und verachtet jede andere<br />
Inspiration:<br />
"Daß ich wieder singen und jauchzen kann,<br />
Daß alle Lieder geraten,<br />
Verdank' ich nur dem Streifen <strong>im</strong> Tann,<br />
Den s t i l l e n Hochwaldpfaden:<br />
Aus schwarzem Buch erlernst du's nicht,<br />
Auch nicht mit Kopfzerdrehen:<br />
0 Tannengrün, o Sonnenlicht,<br />
0 freie Luft der Höhen!" (111,41)<br />
Der deutsche Wald Eichendorffs, der hier anzitiert i s t , erhält<br />
einen sehr konkreten Nützlichkeitsaspekt für den Dichter, der<br />
allein danach fragt, was das Walderlebnis ihm einbringt. Als<br />
akzeptierter romantischer Selbstwert braucht diese Natur in<br />
ihrer Funktion nicht weiter begründet zu werden. Aus einem<br />
solchen Walderlebnis des Dichters entsteht ein "Jagdlied" wie<br />
<strong>von</strong> selbst (111,41).<br />
<strong>Scheffel</strong>s Dichtungen, so entdeckten schon seine ersten Rezensenten,<br />
zeichnen weder eine allzu komplizierte Verflechtung<br />
noch ein sehr verschlungener Aufbau aus. Schon Karl Gutzkow<br />
bezeichnet den 7 /iompete/i als ein Werk, dem "man eine allzu<br />
37<br />
große Verwickelung nicht wird vorwerfen können" . Allerdings<br />
g i l t es für den heutigen Betrachter zu bedenken, daß Begriffe<br />
wie Komposition, Struktur oder Integration <strong>von</strong> Erzählerreflexion<br />
und Handlungsführung an den Vorstellungen des poetischen Reao<br />
o<br />
lismus gewonnen wurden und deshalb für vorrealistische Literaturepochen<br />
nur schwer greifen. Dem Makel der Strukturschwäche<br />
gewinnt deshalb der Rezensent des cZkke.ha.sid ohne Ironie posi-
46<br />
tive<br />
Seiten ab:<br />
"Was aber der Ekkehard am wenigsten i s t , - er i s t nicht ein<br />
Roman in der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes. Die Handlung,<br />
die das Ganze umspannt, i s t nicht kräftig genug, die<br />
Uberfülle der Einzelbilder zusammen zu halten; sie t r i t t<br />
nicht so mächtig heraus, daß alles Andere sich ihr <strong>von</strong> selbst<br />
einordnet." (39)<br />
<strong>Scheffel</strong> hat solche Kritik teilweise schon vorweggenommen, etwa<br />
in seiner Apologie <strong>im</strong> Inompeten (1,6) oder er hat darauf reagiert<br />
wie in der neuen Einleitung zur zweiten Auflage seines<br />
Versepos:<br />
"Sollt' ich dir wohl ein neu Gewand bereiten,<br />
In fein're Fäden ziehn dein Versgespinst<br />
Und kunstgerecht hier kürzen, dort erweitern;<br />
Ich weiß es wohl, du bist nicht zart geraten,<br />
Und dein Trochäenbau steht oftmals schief," (IX,136)<br />
So wie die handwerklich strenge Einhaltung der Versregeln dem<br />
Natürlichkeitspostulat des ungeschliffnen Bergsohns (1,6)<br />
nicht entspräche, so widerlegte eine verschlungene Kompqsition<br />
auch das Naivitätsideal der Versidylle.<br />
Die Strukturschwäche<br />
des Lkkekand verteidigt <strong>Scheffel</strong> mit anderen Argumenten in<br />
einem Brief, in dem er sich schon <strong>im</strong> voraus gegen zu erwartenden<br />
Kritik absichert:<br />
"Ich habe das Ganze etwas hastig gearbeitet und mich <strong>von</strong> den<br />
Wogen des historischen Materials oft scheinbar zwecklos<br />
hin- und herschaufeln lassen, anstatt ihnen mit starker Hand<br />
ihren gemessenen Lauf anzuweisen; dadurch sind die Exkurse<br />
und Episoden mitunter außer Verhältnis gewachsen und haben<br />
sozusagen den Grundgedanken und die Hauptsituationen verdeckt<br />
und mit Schutt überführt.<br />
Denn zu dem Hauptproblem, ioie und unten weichen Venkä£tnitten<br />
kommt <strong>im</strong> X. J-aknkundent Einen dazu, ein epi/>cken Dickten zu<br />
wenden, steht manches Andere allerdings nur <strong>im</strong> Verhältnis<br />
eines äußeren Zusammenhanges." (40)<br />
Gustav Freytag sprach verständnisvoll <strong>von</strong> "freier Composition",<br />
bei der "das Stoffliche u. Episodische vorzugsweise reizt" .<br />
Demgegenüber hat die moderne Kritik Schwierigkeiten mit der<br />
/ 2<br />
Beurteilung und Erklärung dieser Episodenstruktur erkennen<br />
lassen. Man sah nicht nur "die Haupthandlung erdrückt", sondern<br />
wollte <strong>Scheffel</strong> das "Hauptproblem", die Dichterwerdung Ekke-<br />
43<br />
hards, nicht glauben . Im Zusammenhang mit dem Epigonenproblem<br />
versuchte man diesem eigentümlichen Phänomen gerecht zu werden,
47<br />
wiesen oder die "Unterordnung <strong>von</strong> Hauptsachen unter Nebensachen"<br />
als epigonalen Grundzug herausgearbeitet hat^. Erst in jüngster<br />
Zeit hat man die Funktion der Anekdote <strong>im</strong> historischen Roman<br />
nach dem Muster Walter Scotts vorgebildet gesehen^. Damit werde<br />
für <strong>Scheffel</strong> "das Anekdotische als mögliches Material für<br />
eine Theorie der menschlichen Seele als es selbst interessant"^<br />
Auch in den späten Romanen Ludwig Tiecks oder in der lockeren<br />
Episodenstruktur <strong>von</strong> Goethes Uande./ijak/ian sind ja Kompositionsformen<br />
vorgegeben, die eher als Vorbilder heranzuziehen wären<br />
als die Normen realistischer Erzählkunst.<br />
Gattungszwänge <strong>im</strong> Stofflichen und Episodischen des Materials<br />
gesteht <strong>Scheffel</strong> ja selbst ein. Er w i l l sie jedoch nicht entschuldigen,<br />
sondern als notwendig für die "geistige Entwick-<br />
/ 7<br />
lung" seines Helden rechtfertigen:<br />
"Die guten wie die schl<strong>im</strong>men Seiten des Buches liegen also<br />
<strong>im</strong> culturgeschichtlichen Material; das Skelett i s t schwach<br />
<strong>im</strong> Verhältnis zur Corpulenz, die sich darum gefügt hat."(48)<br />
Eine Strukturbeschreibung des Ckkaka/id, wie sie mehrfach und<br />
/ o<br />
wenig befriedigend versucht worden i s t , kann sich also nicht<br />
mit dem Herausarbeiten <strong>von</strong> Höhe- und Wendepunkten begnügen. Zu<br />
folgen wäre vielmehr <strong>Scheffel</strong>s absichtlich bedeutungsvoller<br />
Erzählweise, bei der Parabeln, auf sich selbst verweisende Episoden,<br />
Gleichnisse, Erzählerkommentare und -Weisheiten eingebaut<br />
werden, um Allgemeineres zu 'symbolisieren'.Wenn sich z. B.<br />
schon <strong>im</strong> ersten Kapitel die Herzogin Hadwig und die Griechin<br />
Praxedis gegenüber stehen, dann verfolgt die Beschreibung ihres<br />
Aussehens das Ziel,ihre späteren Aussagen schon jetzt zu bewerten.<br />
Hadwigs körperliche Fehler (V,15: stumpfe Nase, aufgeworfener<br />
Mund, Fehlen eines Grübchens) korrespondieren mit<br />
ihrem Wesen, wie der Erzähler ausdrücklich bemerkt: "Und wessen<br />
Antlitz so beschaffen, der trägt bei scharfem Geist ein rauhes<br />
Herz <strong>im</strong> Busen, und sein Wesen neigt zur Strenge" (V,1$). Praxedis'<br />
fehlerloses Äußeres i s t ein Signal für ihr fehlerfreies<br />
Verhalten <strong>im</strong> weiteren Verlauf des Romans, für das es außer<br />
diesem Merkmal keines weiteren Kommentars bedarf: "sie war<br />
schön" (V,17). Andere Figurenkonstellationen sind bis ins<br />
Sprachliche hinein parallel geführt, etwa wenn Hadumoth ebenso<br />
b i t t e r l i c h weint wie die Herzogin (V,107 und VI,428).
48<br />
Eine Grundstruktur des Scheffeischen Werks kann am Lkkeka/id<br />
exemplarisch heraugearbeitet werden, obwohl sie sich als ein<br />
durchgängiges Moment durch alle Dichtungen <strong>Scheffel</strong>s hindurchzieht.<br />
Es handelt sich dabei um eine p r i n z i p i e l l erfahrene<br />
Polarität <strong>von</strong> oben und unten, <strong>von</strong> Höhe und Tiefe, an deren Extremen<br />
<strong>Scheffel</strong> sein poetisches Weltbild aufhängt. Schon <strong>im</strong><br />
7/iom/?e.£e./i unterscheidet sich der Dichter wie der dichtende Kater<br />
<strong>von</strong> den übrigen schon rein äußerlich dadurch, daß beide<br />
auf den Dächern auf und ab gehen (1,3). Die Höhe als Aufenthaltsort<br />
des Dichters setzt sich die Niederungen der Alltäglichkeit<br />
als Gegenbild. Im £kke.ha/id werden solche Gegenüberstellungen<br />
vom Erzähler als einem weltdeutenden Kommentator<br />
eingeführt (V,53• "denn nicht jedweder gedeiht in den Niederungen<br />
der Menschen") oder scheinen aus den Gleichnissen hervor,<br />
die Ekkehard erzählt:<br />
"Der Vogel heißt Caradrion; wenn seine Fittiche sich zur<br />
Erde senken, s o l l ein siecher Mann genesen; da kehret sich<br />
der Vogel zu dem Manne und tut seinen Schnabel in des Mannes<br />
Mund, n<strong>im</strong>mt des Mannes Unkraft an sich und fährt auf zur<br />
Sonne und läutert sich <strong>im</strong> ewigen Licht: da i s t der Mann gerettet."<br />
(V,54)<br />
Die Verheiratung der gefangenen Hunnen gibt dann Ekkehard Gelegenheit,<br />
über die, "die dort das Erdreich stampfen" (V,255),<br />
zu reflektieren. Denn diese sind nicht nur geographisch Bewohner<br />
der Niederungen und haben "- er deutete nach den sch<strong>im</strong>mernden<br />
Häuptern der Alpen - keine Fernsicht auf Höhen, die<br />
unser Fuß niemals betreten darf" (V,255). Denn Ekkehard und die<br />
Bewohner der Burg sind schon a l l e i n durch ihren höheren Standort<br />
privilegiert und <strong>von</strong> ihrer Umwelt abgesondert. Sie schauen<br />
"vom Gipfel des hohen Twiel", einem "Platz als wie eine Hochwacht",<br />
über Felsen " s t e i l abwärts" "ins tiefe Tal" (VI,315).<br />
Und wer sich mit dem Erzähler am "Ausspähen" freuen kann, "der<br />
mochte Umschau halten über Berg und Fläche und See und Alpengipfel,<br />
keine Schranke hemmte den Blick" (VI,315). Die metaphorische<br />
Höhe enthält <strong>im</strong> freien Blick auch ein gewisses Maß<br />
an gesellschaftlicher Freiheit.<br />
Seiost in Ekkehards Gleichnis vom Nachtfalter, seinem ersten<br />
poetischen Erzählversuch, taucht diese Dichotomie <strong>von</strong> Höhe und<br />
Tiefe<br />
<strong>im</strong>plizit auf:
49<br />
"Es war einmal ein Licht, das leuchtete hell und leuchtete<br />
<strong>von</strong> einem Berg hernieder ... Und es war einmal ein dunkler<br />
Nachtfalter, fuhr Ekkehard in gleichem Ton fort, der flog<br />
zum Berg hinauf ... Es i s t Zeit, daß wir hinaufgehen, sagte<br />
Frau Hadwig stolz." (VI,337)<br />
Bei Nacht und Nebel steigt Ekkehard anschließend auf den Hohenkrähen;<br />
<strong>von</strong> dort blickt er "in die Tiefe; es ging weit, weit<br />
hinab" (VI,339). Bei der entscheidenden Szene zwischen Ekkehard<br />
und Hadwig in der Burgkapelle schlägt der Held der Herzogin die<br />
'Überwindung' dieses Polarität vor, als könnten mit der Auflösung<br />
dieses Gegensatzes auch die Probleme zwischen beiden gelöst<br />
werden:<br />
"Droben <strong>von</strong> des Turmes Zinnen schaut sich's so weit in die<br />
Lande und so t i e f hinunter, so süß und tief und lockend,<br />
was hat die Herzogsburg uns zu halten? Keiner braucht mehr<br />
zu zählen als drei, der hinunter w i l l . " (VI,342)<br />
Nach seiner Verhaftung befindet sich Ekkehard konsequenterweise<br />
<strong>im</strong> Verlies desselben Turms, "in dessen luftigem Stockwerk sein<br />
Stübchen eingerichtet stund" (VI,345). Seine Flucht "den schiefen<br />
Berghang hinunter ins Dunkel der Nacht" (VI,353) verdeutl<br />
i c h t noch einmal die topographische Veränderung als sinnbildhaft<br />
gemeinten inneren Wandel. Noch deutlicher wird der Erzähler,<br />
wenn er den Leser zum Mitvollziehen des gleichen Mechanismus<br />
auffordert:<br />
"Jetzund, vielteurer Leser, umgürte deine Lenden, g r e i f<br />
zum Wanderstab und fahr' mit uns zu Berge. Aus den Niederungen<br />
des Bodensees zieht unsere Geschichte ins helvetische<br />
Alpenland hinüber: dort ragt der hohe Säntis vergnüglich in<br />
die H<strong>im</strong>melsbläue, . ./ und schaut lächelnd in die Tiefen,<br />
wo der Menschen Städte zu eines Ameisenhaufens Größe zusammenschrumpfen;<br />
/. . .7 und was sie/*=die Berge/ über menschliches<br />
Dichten und Treiben sich zuflüstern, klang vor tausend<br />
Jahren schon ziemlich verächtlich und hat sich seither<br />
nicht um vieles gebessert." (VI,354)<br />
Topographische Höhe und reaktionäre Geschichtsbetrachtung f a l <br />
len in eins. Ekkehard, Erzähler und Leser gehen nun "bergaufwärts"<br />
(VI,354) und erreichen damit eine noch höhere Stufe<br />
poetischer Einsicht. Wie der Adler, interpretiert der Leutpriester<br />
Moengal, und weist ihnen den Weg: "Sonnennähe verjüngt.<br />
Tue desgleichen. Ich weiß dir ein gut Plätzlein zum Gesunden."<br />
(VI,356). Die Herrschaftsverhältnisse und -zwänge der unteren<br />
Welt gelten hier nicht: "Des Abts Twing und Bann reicht nicht
50<br />
in unsere Höhen" (VI,362). Dafür herrscht hier eine andere<br />
Macht: "das i s t der hohe Säntis, der i s t Herr in den Bergen,<br />
vor dem schwenken wir den Hut, sonst vor niemand" (VI,362). Der<br />
Säntis aber i s t nicht nur die oberste politische Instanz, sondern<br />
auch eine moralische"^. Als Dichter dieser Höhen verachtet<br />
Ekkehard menschliche Kritik so sehr, daß er sein Werk lieber<br />
einer Bärin vorliest (VI,38$) oder nur die Berge als höchste<br />
kunstrichterliche Instanz anerkennt - aus Angst vor dem Ausgelachtwerden<br />
(VI,378) oder aus seinem Kunstprinzip heraus. In<br />
beiden Verhaltensweisen offenbart sich eine innere Höhe des<br />
Dichters, wie auch der Erzähler bestätigt; unpassende Kritik<br />
i s t mit dem topographischen Tiefland identisch:<br />
"Und wenn es zwischenein wieder vor den Augen des Geistes<br />
dunkelte und Zagheit ihn beschlich f. ..J dann wandelte er<br />
auf dem schmalen Fußsteig draußen auf und nieder und ließ<br />
den Blick auf den Riesenwänden seiner Berge haften, die<br />
gaben ihm Trost und Maß, und er gedachte: Bei allem, was<br />
ich sing' und dichte, w i l l ich mich fragen, ob's dem Säntis<br />
und Kamor drüben recht i s t . Und damit war er auf der rechten<br />
Spur; wer <strong>von</strong> der alten Mutter Natur seine Offenbarung<br />
schöpft, dessen Dichtung i s t wahr und echt, wenn auch die<br />
Leinweber und Steinklopfer und hochständigen Strohspalter<br />
in den Tiefen drunten sie zehntausendmal für Hirngespinst<br />
verschreien." (VI,382)<br />
Daß dieser Strukturzug nicht' auf den Roman beschränkt bleibt,<br />
zeigt ein Blick auf zwei Gedichte <strong>Scheffel</strong>s <strong>im</strong> Umkreis des<br />
£kke.haid. Ekkehard und Hadwig sitzen "auf dem Turme", ihr Gespräch<br />
kommt "vom Hohentwiel" herab (IX,102); die Perspektive<br />
des Betrachters i s t also die eines neutralen.Beobachters, nicht<br />
die des Dichters. Im "Abschied vom Wildkirchli" (IX,103f) i s t<br />
dieser Gegensatz <strong>von</strong> Höhe und Tiefe noch gesteigert durch die<br />
Betonung des Größenverhältnisses, das sich durch den Höhenunterschied<br />
ergibt:<br />
"Es i s t mir wenig hoch genug -<br />
Hier stand ich als ein Zwerg." (IX,103)<br />
Denn die Berge sind nicht nur hoch, sondern auch "unerschütterl<br />
i c h " und stehen "auf festem Grunde" (IX,104). "Türkenkrieg"<br />
und "Cholera" ordnen sich damit den Niederungen des verabscheuten<br />
Alltagslebens zu. Das lyrische Dichter-Ich "schleppte"<br />
sich auf die Alm hinauf, kann allerdings nicht oben bleiben,<br />
da es ja gleichzeitig die Tiefe, das Publikum, braucht. Zu
51<br />
Tal hingegen "fährt" der Dichter "jodelnd" (IX,104). Im Unterschied<br />
zur Dichterwerdung Ekkehards i s t hier die Gesundung des<br />
Bergsteigers gar nicht auf dem Umweg über das Dichten vollzogen;<br />
die Befreiung <strong>von</strong> "Sorg' und Qual" (IX,104) vollbringt einzig<br />
und a l l e i n der Höhenunterschied!<br />
Wiederum i s t dieser Befund nicht auf <strong>Scheffel</strong> zu beschränken.<br />
Im Dichtergedicht des 19. Jahrhunderts hat man einen zweischichtigen<br />
Aufbau der "Welt als ganzes" feststellen können^, die<br />
der hier aufgezeigten Dichotomie <strong>von</strong> oben und unten in etwa<br />
entspricht. Kennzeichnend für <strong>Scheffel</strong> i s t f r e i l i c h , wie durchgängig<br />
diese Struktur in sämtlichen Dichtungsgattungen aufzufinden<br />
i s t . Sogar als parodistisch gesteigerte Dichotomie <strong>von</strong><br />
Welt und Dichter wird dieser Höhenunterschied <strong>im</strong> Verhältnis<br />
des Katers Hiddigeigei zu seiner menschlichen Umwelt sichtbar.<br />
Die Türmerlied-Tradition verschmilzt dabei mit den zeittypischen<br />
Absatzbewegungen der Dichter. Speziell die Formulierung<br />
vom "Treiben der Parteien" (1,151) verrät ein bewußt parodistisches<br />
Zitieren des bekannten und umstrittenen Gedichtsverses<br />
<strong>von</strong> Freiligrath, der Dichter stehe auf einer höheren Warte als<br />
auf<br />
den Zinnen der Partei:<br />
"Von des Turmes höchster Spitze<br />
Schau' ich in die Welt hinein,<br />
Schaue auf erhabnem Sitze<br />
In das Treiben der Partein.<br />
Und die Katzenaugen sehen,<br />
Und die Katzenseele lacht,<br />
Wie das Völklein der Pygmäen<br />
Unten dumme Sachen macht.<br />
Doch was nützt's? ich kann den Haufen<br />
Nicht auf meinen Standpunkt ziehn,<br />
Und so laß ich ihn denn laufen,<br />
's i s t wahrhaft nicht schad' um ihn.<br />
Menschentun i s t ein Verkehrtes,<br />
Menschentun i s t Ach und Krach;<br />
Im Bewußtsein seines Wertes<br />
Sitzt der Kater auf dem Dach!-" (1,15*1)<br />
Herausgehoben aus dem Parteienstreit und dem sich darin verwickelnden<br />
Literaturbetrieb betrachtet der Dichter-Kater das<br />
"Menschentun". "Das Selbstbewußtsein seines Wertes" kommt dem<br />
Kater als Dichter auch hier a l l e i n durch seine Höhenlage. Das<br />
alltägliche Geschehen i s t deshalb schon ein "Verkehrtes", weil
52<br />
es aus der Höhe betrachtet wird. Freilich gleicht die Einsamkeit<br />
des Katers auf der Höhe einer Isolierung, die nicht ganz<br />
f r e i w i l l i g gewählt i s t . Seine klare Abgrenzung <strong>von</strong> den Niederungen<br />
l e i t e t der Dichter nicht zuletzt da<strong>von</strong> ab, daß ihm<br />
nichts anderes übrig bleibt.<br />
3. "Ach, ich bin ein ein Epigone": Vorbilder<br />
Die Versuchung liegt nahe, nach den bisherigen Befunden Scheff<br />
e l und seine Dichtung als epigonal zu bezeichnen und sie damit<br />
zugleich als erledigt zu betrachten. Die Begriffsgeschichte<br />
zur Epigonenfrage kann zur Klärung nur einen groben Rahmen ab-<br />
52<br />
stecken . Wie problematisch die Etikettierung <strong>Scheffel</strong>s als<br />
Epigone i s t , wird erst dann deutlich, wenn man eine solche Abstempelung<br />
an dem positiv entgegengesetzten Begriff der Originalität<br />
mißt. Bleibt es doch höchst fragwürdig, Postulate aus<br />
ganz begrenzten Epochen der Literaturgeschichte einfach zu<br />
übertragen.<br />
Schon die für das Epigonale als konstitutiv ange-<br />
5 3<br />
sehene Behauptung einer "Unbefangenheit des Epigonen" t r i f f t<br />
für <strong>Scheffel</strong> keinesfalls zu. Gerade das bewußte Erleben seines<br />
"Traurig Los der Epigonen" (1,20) spricht für ein reflektiertes<br />
und problematisch gewordenes Dichterbewußtsein. Wenn <strong>Scheffel</strong><br />
vorsätzlich und ganz gezielt eine traditionelle Dichterlaufbahn<br />
einschlägt, indem er mit Malversuchen und der obligaten Italienfahrt<br />
die Humanitätstradition aufn<strong>im</strong>mt, so spielt er zugleich<br />
mit einem Topos klassisch-romantischer Bildungsattitüde. Schon<br />
Jung-Werner <strong>im</strong> 7 /ionpe.ta./i verzweifelt an der epigonalen Konkurrenz<br />
mit Dante:<br />
"N<strong>im</strong>mer wag ich's, dir/ = Beatrice_7 zum Preise<br />
Einen neuen Sang zu singen.<br />
Ach, ich bin ein Epigone,<br />
Und vielhundert tapfre Männer<br />
Lebten schon vor Agamemnon,<br />
Und ich kenn den König Salom 1<br />
Und die schlechten deutschen Dichter." (1,4-0)<br />
Freilich enthält die Stelle neben den Spitzen gegen die zeitgenössische<br />
und erfolgreiche Literaturproduktion auch solche<br />
gegen das Publikum. Aus Angst vor der Erfolglosigkeit seines<br />
Versepos erwächst <strong>Scheffel</strong> eine Verachtung des Publikums, wie
53<br />
sie der Kater Hiddigeigei ironisch darstellt, wenn er mit dem<br />
endgültigen Verstummen seiner Dichterei droht:<br />
"Fruchtlos stets i s t die Geschichte;<br />
Mögen sehn sie, wie sie's treiben!<br />
- Hiddigeigeis Lehrgedichte<br />
Werden ungesungen bleiben." (1,157)<br />
In "späten Tagen" lebend (1,72) registriert <strong>Scheffel</strong> nicht nur<br />
sein persönliches Schicksal als epigonaler Dichter, der dem<br />
Publikum droht, weil er dem nachzueifernden Vorbild nichts anhaben<br />
kann. Epigonie wird ihm auf diese Weise eine allgemeine<br />
Zeittendenz, ein "müßig sitzen auf vererbten Truhen" (11,181),<br />
ein "Fäden zerren Eines wüstverschlungnen Knäuels" (1,20). Die<br />
Verstricktheit aller heutigen Menschen führt dazu, die eigene<br />
Nachgeborenheit<br />
anzuerkennen und das Epigonenschicksal als<br />
Grundlage eines zeitgenössischen Dichtertums zu akzeptieren. In<br />
seinem Reisebild £in Tag am Clue.lt <strong>von</strong> Vauctute (VIII, 11 8-1 50)<br />
<strong>von</strong> 1857 kann <strong>Scheffel</strong> das dichterische Vorbild Petrarca epigonal<br />
und originell rezipieren, weil er es gegen traditionelle,<br />
'epigonale' und als falsch eingestufte Petrarcabilder in Schutz<br />
n<strong>im</strong>mt. Durch das Nachreisen historischer Stätten kann der moderne<br />
Dichter, zugleich moderner Tourist, seine innere Verwandtschaft<br />
mit dem Vorbild ausleben. Daß <strong>Scheffel</strong> dabei den Wegspuren<br />
eines Vorläufers, der Reite, in die mittag ticken P/iovinzen<br />
<strong>von</strong> T/iank/ieick des Moritz August <strong>von</strong> Thümmel (1791ff) nachfolgt<br />
und sie zugleich k r i t i s i e r t , bricht den epigonalen Nachvollzug<br />
gleich doppelt. Die humoristische Beschreibung eines<br />
touristischen Ausflugs zu Petrarcas letztem Refugium i s t für<br />
<strong>Scheffel</strong> der Anlaß, verschiedene Petrarcabilder als falsch abzuwehren.<br />
Denn:<br />
"Der alte Poet i s t nicht nur geistig, sondern auch volkswirtschaftlich<br />
der Patron <strong>von</strong> Vaucluse geworden, man lebt<br />
und zehrt <strong>von</strong> seinem Andenken." (VIII,119)<br />
<strong>Scheffel</strong>s Literaturtourismus distanziert sich <strong>von</strong> seinen touristischen<br />
Vorläufern und deren Petrarcabild, das <strong>von</strong> "Touristen<br />
aus allen Weltgegenden" geschaffen worden i s t : "Uberall Petrarca,<br />
und nichts als Petrarca! Zu Vaucluse i s t kein Kraut wider<br />
ihn gewachsen" (VIII,122).<br />
<strong>Scheffel</strong>s Epigonenbewußtsein beschränkt sich also nicht auf die<br />
Einsicht in die eigene historische Verspätung, sondern denkt
54<br />
die Wirkungsgeschichte des großen Vorbilds mit. Das zeigen auch<br />
die weiteren falschen Petrarcabilder, die <strong>Scheffel</strong> dem Leser<br />
vorstellt. Es handelt sich um das Bild für die "große Menge",<br />
das Bild der "Konversationslexikonsüberlieferung" (VIII,126f).<br />
<strong>Scheffel</strong> k r i t i s i e r t es ausführlich, indem er seitenweise die<br />
einschlägigen Lexika z i t i e r t . Nach diesem "kommt wiederum ein<br />
ander Petrarcabild zum Vorschein" (VIII,128), nämlich das der<br />
<strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> so verachteten zünftigen Literaturwissenschaft.<br />
Auch dafür bieten Zitate aus einschlägigen Werken den Beweis,<br />
wie "die deutsche Literaturhistorie", "eine schreckliche Alte",<br />
"die seligen Dichterleichen seziert" (VIII,128). Die vierte<br />
Möglichkeit einer falschen, aber diesmal naiv-sympathischen<br />
Petrarcaverehrung i s t die der einfachen Landbewohner, die Petrarca<br />
"zum Zauberer umgewandelt" haben (VIII,133): "also<br />
wieder ein anderer Petrarca!" (VIII,134).<br />
Diese einfachen Leute erkennen in <strong>Scheffel</strong> jedoch den Auch-<br />
Dichter, den wahren Nachfolger Petrarcas: "j 'ai bien vu que<br />
vous §tes poete vous-meme" (VIII,134). Indem <strong>Scheffel</strong> dies<br />
fremdsprachlich verfremdet z i t i e r t , setzt er auch die nachfolgend<br />
geschilderte Lorbeerkrönung durch die Einhe<strong>im</strong>ischen mit<br />
bescheiden-überheblicher Ironie ins Licht: die Parallele zur<br />
Dichterkrönung Petrarcas in Rom i s t offensichtlich. Auf diese<br />
Weise begreift sich <strong>Scheffel</strong> als "einen epigonischen Mann"<br />
(VIII,121), f r e i l i c h in wahrer Legit<strong>im</strong>ation, der sich den Ort<br />
und damit auch das rechte Dichterverständnis erwandert: "so<br />
ist's auch für die Erkenntnis des Poeten unerläßlich, den Boden<br />
seiner Schöpfungen zu kennen" (VIII,123). <strong>Scheffel</strong>s Literaturaneignung<br />
als Erwanderung literarischer Stätten beschränkt sich<br />
nicht wie bei den Touristen auf das Leeren <strong>von</strong> Weinflaschen zu<br />
Ehren des Dichters; <strong>Scheffel</strong> erweist Petrarca "den schuldigen<br />
Tribut", indem er eine solche Flasche mit einem selbstverfaßten<br />
Gedicht "gleich einem jener Weihgeschenke" (VIII,122) in die<br />
Petrarcaquelle wirft! Der so auf die Ebene <strong>Scheffel</strong>s gezogene<br />
Klassiker hält nun den Vergleich mit dem Dichter <strong>Scheffel</strong> aus,<br />
wenn dieser beginnt, ein Gedicht Petrarcas "zur Kurzweil f r e i<br />
zu verdeutschen" (VIII,132). Die Anverwandlung dieses Gedichts<br />
als "Petrarcas Wanderlied" geschieht durch die Einordnung in<br />
die eigene LiteraturSituation. übrig bleibt ein Bedauern
55<br />
<strong>Scheffel</strong>s als Dichter ("unsereins"), als "eines Poetleins des<br />
neunzehnten Jahrhunderts" (VIII,134f), wenn er sich in die Zeiten<br />
Petrarcas zurückversetzt. Denn die direkte Ausmünzbarkeit<br />
<strong>von</strong> Dichtung (VIII,135: "wie wenig es sich ... rentiert") hat<br />
sich seit damals, meint <strong>Scheffel</strong>, noch verschlechtert. Damit<br />
aber sind schon alle "Merkwürdigkeiten" <strong>von</strong> Vaucluse "erschöpft"<br />
(VIII,135). Zum Schluß kann <strong>Scheffel</strong> den echten Petrarca,<br />
"den Mann selber und seine Art" (VIII,138), sprechen lassen.<br />
Die beiden mitgeteilten Textproben sind f r e i l i c h in ihrer Auswahl<br />
typischer für <strong>Scheffel</strong> als für Petrarca, wie <strong>Scheffel</strong>s<br />
Auswahlkriterium zeigt: "Und wie ein jeder sein eigen Ellenmaß<br />
für den Dichter der Vaucluse hat, so habe ich auch das meine"<br />
(VIII,137).<br />
Auf solche Weise entsteht <strong>Scheffel</strong>s dichterisches Selbstverständnis<br />
gerade <strong>im</strong> Akzeptieren der Epigonenrolle, in die er<br />
sich häuslich einrichtet. In fre<strong>im</strong>ütigem Selbstbezug hemmt das<br />
große Dichtervorbild nicht, sondern fördert die eigene Produktion,<br />
wenn <strong>Scheffel</strong> sich in ihm gleichsam vorweggenommen findet.<br />
Die "Möglichkeiten einer originalen Schöpfung"^ liegen also<br />
durchaus innerhalb der Epigonenhaltung. Die Angst, vor den<br />
großen Vorbildern nicht bestehen zu können, l e i t e t <strong>Scheffel</strong><br />
nicht aus dem Vergleich mit den Werken ab, sondern aus der Befürchtung,<br />
dem Lebenszuschnitt des klassischen Vorbilds nicht<br />
gerecht werden zu können. Das mag einer der Gründe sein, warum<br />
<strong>Scheffel</strong> <strong>im</strong>mer eine engere Bindung an den Großherzog <strong>von</strong><br />
Sachsen-We<strong>im</strong>ar-Eisenach zurückgewiesen hat: die epigonale<br />
Parallele zu Goethe war geographisch wie literaturgeschichtlich<br />
zu offenkundig. <strong>Scheffel</strong>s Mutter hatte in dieser Richtung vermutet<br />
:<br />
"Was <strong>Joseph</strong> vor We<strong>im</strong>ar so scheu macht, i s t der Gedanke an<br />
die großen Geister - Goethe, Schiller, Herder - in solche<br />
Fußstapfen treten zu sollen, erscheint seiner Bescheidenheit<br />
ein vermessenes Wagstück. Er fürchtet, ein zu schwachem<br />
Reis am alten großen Dichterbaum zu werden." (55)<br />
Die Teilhabe am Dichter, die sich auf dessen Ruhm beschränkt,<br />
bleibt nichts weiter als der Verzicht auf jede eigene Produktion.<br />
<strong>Scheffel</strong> w i l l nicht mit seinen Werken in Konkurrenz<br />
treten, sondern nur mit der Teilhabe am Dichterruhm:
56<br />
"Einen Dichterruhm wird sich heutigen Tages keiner mehr erwerben<br />
- 's i s t besser an gewissen Gräbern zu We<strong>im</strong>ar die<br />
großen Todten zu bedenken als selber noch ein Stück <strong>von</strong><br />
ihrem Heiligenschein zu beanspruchen." (56)<br />
<strong>Scheffel</strong>s Verehrung für Johann Peter Hebel als größten alemannischen<br />
Volksdichter macht einen weiteren Versuch, die eigene<br />
poetische Identität am anerkannten Dichterfuhm anderer auszurichten.<br />
Im Festgedicht zum 100. Geburtstag Hebels (1860)<br />
inszeniert <strong>Scheffel</strong> ein fiktives Gespräch <strong>von</strong> Dichter zu Dichter,<br />
das dem Zweck dient, den eigenen Auftritt als Dichter und<br />
Sänger zu legit<strong>im</strong>ieren. Indem er sich selbst und sein Werk in<br />
die ungebrochene Hebel-Nachfolge s t e l l t (IV,101: "So 'ne verfahrne<br />
Säckinger Trompeter"), sanktioniert <strong>Scheffel</strong> beides. Der<br />
<strong>im</strong>itierte, lächerlich wirkende alemannische Dialekts des<br />
<strong>Scheffel</strong>-Gedichts als Anspielung auf Hebels A te.ma.nn che Qedichte<br />
zeigt aber auch, daß diese Form der Dichtung jetzt so<br />
nicht mehr möglich i s t . <strong>Scheffel</strong> erkennt diesen Anachronismus<br />
zwar, empfindet ihn aber als ein persönliches Kunstmerkmal<br />
Hebels: "S'isch kein meh cho, der g'sunge het wie Du" (IV,107).<br />
Der neue Dichter muß darum den alten beneiden (IV,107: "0<br />
Dichtersma, wie möcht i Di drum nide!"), weil <strong>Scheffel</strong> zwar einsieht,<br />
daß die gewandelte Zeit neue Formen braucht, aber dennoch<br />
den traditionellen verhaftet bleibt. Das ironische, f i k <br />
tive Gespräch beider Dichter in den Wolken zwischen dem "Meister"<br />
Hebel und seinem Schüler <strong>Scheffel</strong> macht noch einmal deutlich,<br />
daß es der Nachruhm des Vorbilds i s t , auf den es ankommt. Deshalb<br />
auch führen - wie später bei <strong>Scheffel</strong> - die Figuren Hebels<br />
ein verselbständigtes, <strong>von</strong> der Dichtung abgelöstes Eigenleben<br />
<strong>im</strong><br />
Volksmund:<br />
"Im Zundelfrieder und <strong>im</strong> Zundelheiner<br />
Sin starki Chind und Chindeschind erwachse,<br />
Un sin wohluf f...J" (IV,108)<br />
Ebenfalls wie später auch <strong>Scheffel</strong> selbst wird nicht nur der<br />
Dichter Hebel, sondern auch seine he<strong>im</strong>atliche Landschaft in den<br />
Nachruhm<br />
einbezogen:<br />
"Der Meister Hebel hoch!<br />
Und hoch s i He<strong>im</strong>et, 's alemannisch Land!" (IV,109)<br />
Daß Heinrich Heine ebenso in die Reihe der Vorbilder <strong>Scheffel</strong>s<br />
gehört, mag auf den ersten Blick überraschen. Freilich bezieht
57<br />
sich <strong>Scheffel</strong> in seiner Heine-Nachfolge nur auf einen schmalen<br />
Aspekt des volkstümlichen oder ironischen Lyrikers und Prosaisten.<br />
Gerade diese Heine-Nachfolge i s t eine <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> sehr<br />
57<br />
direkt angestrebte und deutlich formulierte . Dabei versteht<br />
<strong>Scheffel</strong> sein Werk als "kritische Weiterführung des Heinec<br />
o<br />
sehen" . Die direkte Wiederspiegelung vor allem des frühen<br />
Heine bei <strong>Scheffel</strong> hat denn auch <strong>im</strong>mer wieder zu einem Vergleich<br />
beider Dichter herausgefordert, bei dem - wie könnte es<br />
anders sein - <strong>Scheffel</strong> schlecht wegkommt^. Die Heine-Übernahmen<br />
<strong>Scheffel</strong>s sind auf den ersten Blick tatsächlich Trivialisierungen<br />
und die Rationalisierung <strong>von</strong> spätromantisch Unsagbarem<br />
oder machen schmunzelnde Behäbigkeit aus vormals beißendem<br />
Spott. Bei Heine finden sich auch die Urformen der echt<br />
Scheffeischen Figuren - der ironisierte und sich selbst bespiegelnde<br />
Kater, der verliebte Dichter als Narr usw. Aber nicht<br />
nur in solchen Figuren oder in einzelnen Motiven i s t Heine das<br />
Vorbild, man denke nur an Heines Reisebilder, die <strong>Scheffel</strong> zu<br />
seinen eigenen Reisebildern und Episteln veranlaßt haben. Die<br />
Heine-Nachfolge i s t dabei zwar zuallererst eine s t i l i s t i s c h e ,<br />
doch reicht sie auch weiter bis zur Übernahme der kritischen<br />
Haltung. Der frühe Heine kann schließlich <strong>Scheffel</strong> sogar zur<br />
Parodie des verehrten Meisters verleiten, wie das Gedicht "Die<br />
moderne Loreley" <strong>von</strong> 1849 bezeugt:<br />
"Ein Steuermann sitzet am Ufer,<br />
Er seufzt und weiß wohl warum;<br />
Eine alte vers<strong>im</strong>pelte Leier<br />
Brummt ihm <strong>im</strong> Schädel herum.<br />
Das war eine schöne Donna,<br />
Des Schiffskapitän seine Braut,<br />
Der hat er mit allzuviel Wonna<br />
In die blauen Augen geschaut.<br />
Er steuert in schwerer Vers<strong>im</strong>plung,<br />
Das Schiff kracht mitten entzwei;<br />
Da ersoff bis auf den Schiffsjung<br />
Die ganze Kompanei.<br />
Auch der war' tot geblieben,<br />
Hätt f er nicht schw<strong>im</strong>men gekunnt.<br />
- - Da sieht man, wie falsches Lieben<br />
Die Menschen bringt auf den Hund." (IX,54)<br />
Nicht um einen <strong>Scheffel</strong> abwertenden Vergleich mit Heines berühmtem<br />
Gedicht kann es hier gehen, der Qualitätsunterschied
58<br />
i s t sowieso offenkundig. Deutlich werden kann hier jedoch ein<br />
für <strong>Scheffel</strong> und seine Arbeitsweise wichtiger Mechanismus. Die<br />
moderne Fassung <strong>Scheffel</strong>s liegt auf der vorausgesetzten Kenntnis<br />
der romantischen Märchenballade auf. Der burschikose Ton,<br />
den <strong>Scheffel</strong> in die Parodie seines Vorbilds einführt, erzeugt<br />
den als eigentümlich angesehenen Scheffeischen S t i l . Nur der<br />
ursprüngliche Balladentonfall wird übernommen;Intention und<br />
Handlung der Heineballade finden sich nur noch in geringen Resten.<br />
Zum Beweis: ohne den Titel wäre das Gedicht <strong>von</strong> seiner<br />
Handlung her kaum auf das Lorelei-Thema zu beziehen. Indem die<br />
Kenntnis der Heinefassung be<strong>im</strong> Leser vorausgesetzt wird, kann<br />
<strong>Scheffel</strong> die Parodie als originäre und zugleich originelle<br />
eigenständige Aussageform verstehen. Nur die Variation dieses<br />
Epigoniebezuges rechtfertigt ja die inhaltlich leere Parodie<br />
des Gedichts. Die Freude des Lesers am Wiedererkennen des Musters<br />
steigert <strong>Scheffel</strong> mit Detailrealismen, die zum Gedichtvorgang<br />
in keiner direkten Beziehung stehen ("Des Schiffskapitän seine<br />
Braut") - der romantische Ton Heines wird durch <strong>Scheffel</strong> 'real<br />
i s t i s c h 1 verändert. Der Vorgang in beiden Gedichten i s t jeweils<br />
ein ganz anderer geworden, nur die Schlußpointe bleibt annähernd<br />
die gleiche. Bei <strong>Scheffel</strong> aber wird sie zur deutlich ausgesprochenen<br />
Binsenweisheit, moralisierend und vermenschlicht zugleich.<br />
Dem jungen Heine als Lyriker des Biedermeiersalons entspricht<br />
als <strong>Scheffel</strong>s Zeitgenosse der ebenfalls berühmte Emanuel Geibel<br />
in manchen Bezügen, obwohl <strong>Scheffel</strong> ihn nie als direktes Vorbild,<br />
sondern ihn <strong>im</strong>mer nur als berühmteren Dichterkollegen bewundert<br />
hat^. Einer "mehr an Geibel anstreifenden Seite" seiner<br />
61<br />
Dichtung konnte der humorige <strong>Scheffel</strong> zwar eine starke Neigung<br />
entgegenbringen, aber kaum Gleichwertiges produktiv dagegensetzen.<br />
Dem dichterischen Selbstbewußtsein Geibels, seinem l i t e <br />
rarischen Erfolg und nicht zuletzt seiner Hofstellung als Dichterfürst<br />
g i l t f r e i l i c h <strong>Scheffel</strong>s uneingeschränkte Bewunderung.<br />
Das Gedicht "An Emanuel Geibel" <strong>von</strong> 1857 gibt da<strong>von</strong> Zeugnis. Es<br />
z i t i e r t und montiert das bekannte Vokabular des Geibelschen<br />
Dichterbildes (IX,123: "Dein eigen Sängerbild", "Dein Seherblick",<br />
"Alldeutschlands Nöten" usw) - man vergleiche damit<br />
Geibels berühmtes Gedicht vom "König Dichter"! Aber auch hier<br />
zeigt sich <strong>Scheffel</strong>s Eigenart, das ernste Pathos des Geibel-
59<br />
sehen Dichtungsinventars seinem burschikosen Tonfall anzuverwandeln:<br />
"Sind alt auch unsre Knochen,<br />
Die Kunst bleibt ewig neu,<br />
Noch raget ungebrochen<br />
Die Feste Poesey." (IX,123)<br />
In solchen Formulierungen i s t etwa auch an die Amateurpoetin<br />
62<br />
Friederike Kempner zu denken ;die Produktivkraft dieser montierten<br />
stehenden Dichterformeln scheint ein Gattungs- und<br />
Strukturzug der Gebrauchs- und Verbrauchslyrik dieser<br />
zu<br />
sein.<br />
Epoche<br />
Daß das Bewußtsein ihres Epigonentums für die Dichter dieser<br />
Zeit nicht den Regelfall ausmacht, i s t herausgearbeitet worden^.<br />
Hierin unterscheidet sich <strong>Scheffel</strong> deutlich <strong>von</strong> Geibel,<br />
der sich nicht als Epigone ausgegeben hat. Für <strong>Scheffel</strong> i s t die<br />
Trauer über das Erkennen seines geschichtlichen Orts eine der<br />
Grundlagen seines Epigonenbewußtseins. Epigonalität i s t für ihn<br />
eine der Zeittendenzen, wie er an Ludwig Uhland schreibt:<br />
"In unserer Epigonenzeit, wo in a±len Gebieten der Kunst so<br />
nah' ans Höchste schon gearbeitet i s t , s t e l l t man sich b i l l i g<br />
die Frage, ob nicht das Schweigen Gold, das andere nur S i l <br />
ber sei?" (65)<br />
Diese Erkenntnis, so allgemein sie gehalten i s t , i s t nun nichts<br />
weniger als neu, man denke an Karl Immermanns 1836 erschienenen<br />
Roman "Die Epigonen", der ja versucht, einen Zeitroman unter<br />
diesem Begriff zu subsummieren^. Daß <strong>Scheffel</strong> mit seiner Epigonalität<br />
aber "scherzt" und "dies Schicksal leichten Herzens<br />
67<br />
auf sich n<strong>im</strong>mt" , wird man nur bedingt behaupten können. Zuerst<br />
i s t bei <strong>Scheffel</strong> das eigene Epigonentum eine "Art historischer<br />
Astronomie, die jede Anwandlung zum Lachen in die gebührenden<br />
6 8<br />
Schranken zurückweist" . In einer Art Trotzhaltung kann daraus<br />
f r e i l i c h ein bewußtes Annehmen der Epigonalität resultieren,<br />
wenn es dem Dichter gelingt, zu eigenständigen Formen zu finden.<br />
Noch geschieht es <strong>Scheffel</strong> als einem der "zerfahrenen Epigonen",<br />
daß er sich und sein Dichten auf den "Satz: Alles schon dage-<br />
69<br />
wesen" reduziert: "Aber auch das i s t ein Gewinn" .<br />
An der Figur des Katers Hiddigeigei aus dem 7/iompe.te./i kann man<br />
ablesen, wie bald <strong>Scheffel</strong>, wiewohl parodistisch, zwischen
60<br />
"Senkt mich ein mit Schild und Lanze<br />
Als den letzten des Geschlechtes.<br />
Als den letzten, - o die Enkel,<br />
N<strong>im</strong>mer gleichen sie den Vätern,<br />
Kennen nicht des Geists Geplänkel,<br />
Ehrbar sind sie, steif und ledern.<br />
Ledern sind sie und langweilig,<br />
Kurz und dünn i s t ihr Gedächtnis;<br />
Nur sehr wen'ge halten heilig<br />
Ihrer Ahnherrn fromm Vermächtnis." (1,157)<br />
Sich als echter Epigone zu verstehen, kann bedeuten, die Angst<br />
vor literarischer Epigonalität auszulöschen zu versuchen. Nach<br />
der Reichsgründung <strong>von</strong> 1871 konnte sich für <strong>Scheffel</strong> in seinen<br />
Skizzen au* dem €l*aß (1872) die nationale Einheit in diesem<br />
Bewußtsein "in den Festjubelruf der Epigonen" fassen lassen:<br />
"Das ganze Deutschland vom Fels zum Meere hoch!" (VIII,181).<br />
Öfter aber bildet das Epigonenbewußtsein die Vorstufe einer<br />
70<br />
Fortschritts- und Zivilisationsfeindlichkeit . Die Literatur<br />
der Gegenwart wird dann zu einer epigonischen schlechthin, der<br />
<strong>Scheffel</strong> die 'Frische' gegenüberstellt:<br />
"ich würde mich freuen, einmal einem frischen Menschen mit<br />
frischen Melodien zu begegnen . . . ganz ohne den eigentümlichen<br />
epigonischen haut gout, der uns allen mit Schicksalsnothwendigkeit<br />
unmerklich/'!/ anhaftet." (71)<br />
Interessant i s t diese Äußerung auch deshalb, weil der Empfänger<br />
dieses Briefes, nämlich Paul Heyse, für <strong>Scheffel</strong> das Musterbeispiel<br />
eines epigonalen Dichters abgibt. Scheinbar verwendet<br />
<strong>Scheffel</strong> den Begriff des Epigonalen positiv, wenn er Paul Heyse<br />
in einer Empfehlung an den Großherzog <strong>von</strong> Sachsen-We<strong>im</strong>ar-Eisenach<br />
als einen Epigonen bezeichnet:<br />
"Paul Heyse als Dichter i s t die glänzende Verkörperung einer<br />
poetischen Epigonenzeit, mit allen Vorzügen und Fehlern einer<br />
solchen.- Durchbildung <strong>von</strong> Gefühl und Sprache, feine Auffassung<br />
der Motive, classisch sichere Handhabung der Form<br />
sind ihm in hohem Maße eigen; mit vornehmer Ruhe steht er<br />
a l l z e i t über dem behandelten Gegenstand und beherrscht ihn<br />
spielend. Daher wird er nie eine künstlerische Excentrizität,<br />
noch weniger einen auffallenden Fehler begehen, und<br />
seine Arbeiten werden <strong>im</strong>mer etwas Distinguirtes haben. Eine<br />
solche Auffassung und Behandlung der Poesie, die mitunter an<br />
Klopstocks Art erinnert, i s t f r e i l i c h mehr die Wirkung der<br />
Reflexion und durchdachten Innehabens der Kunstregeln, verschieden<br />
<strong>von</strong> jener instinctiven springquellartig hervorsprudelnden<br />
Offenbarung, die mit fremder dämonischer Macht
61<br />
über den Menschen kommen, ihn zwingen und seine Schritte<br />
leiten kann, ohne daß er weiß, wohin." (72)<br />
In der definitorischen Abgrenzung gegen Heyse wird allerdings<br />
deutlich, wie <strong>Scheffel</strong> seine eigene Position schon <strong>im</strong> Vokabular<br />
versteckt hat (springquellartiges Hervorsprudeln, dämonische<br />
Gewalt, Verachtung der Kunstregeln usw). In diesem Sinne i s t es<br />
sicher r i c h t i g , <strong>Scheffel</strong> als einen "Nachkömmling, der das Schwert<br />
73<br />
wider die eigene Mutter gerichtet hat", zu bezeichnen . Doch<br />
selbst dieses Epigonale i s t noch steigerungsfähig, wenn Schef-<br />
7L<br />
f e i glaubt, "in uns'rer spätepigonischen Zeit" zu leben !<br />
Das Dilemma, das es für <strong>Scheffel</strong> zu meistern g i l t , i s t so einfach<br />
formuliert wie es schwierig zu lösen i s t : Wie kann das<br />
Bewußtsein, in einer Spätzeit zu leben, auf originelle Weise<br />
in Dichtung umgesetzt werden? Im Gedicht "Bummelmeiers Klage"<br />
empfindet sich der Ich-Sprecher als politischer Epigone. Das<br />
Eingeständnis seiner politischen Unfähigkeit begründet er f r e i <br />
l i c h banal damit, er sei <strong>im</strong>mer " zu spät gekommen" (IX,45).<br />
Seine Person i s t deshalb <strong>im</strong> Grunde überflüssig, "ein höchst<br />
zweckwidrig Wesen" (IX,45). Die einzig verbliebene Möglichkeit<br />
i s t das Sich-lustig-machen über sich selbst. So wie Bummelmeier<br />
der Hofnarr des Kaisers wird, so verschiebt auch <strong>Scheffel</strong><br />
das Epigonale in einen humoristischen Zusammenhang: Humor,<br />
75<br />
sonst kein Kennzeichen <strong>von</strong> Epigonendichtung , wird für Scheff<br />
e l eine Möglichkeit zur Originalität.<br />
Eine andere Möglichkeit zur Uberwindung epigonaler Züge besteht<br />
für <strong>Scheffel</strong> darin, Originalität durch neue, echt poetische<br />
Redeformen zu gewinnen. Der Zweifel am Ausdruckswert der gültigen<br />
Sprache setzt über die verbale Kommunikation eine höhere<br />
Instanz an:<br />
"Die Sprache i s t ein edel Ding,<br />
Doch hat sie ihre Schranken;<br />
Ich glaub', noch <strong>im</strong>mer fehlt's am Wort<br />
Für die feinsten und tiefsten Gedanken.<br />
Schad't nichts, wenn auch ob Dem und Dem<br />
Die Reden a l l verstummen,<br />
Es hebt sich dann <strong>im</strong> Herzensgrund<br />
Ein wunderbares Summen." (1,145)<br />
Beispielhaft für <strong>Scheffel</strong>s Originalitätsstreben i s t auch die<br />
Wahl <strong>von</strong> solchen Stoffen und Motiven, die noch literarisch un-
62<br />
verbraucht und noch nicht t r i v i a l i s i e r t sind; die die Naturwissenschaft<br />
parodierenden Lieder oder die frühmittelalterliche<br />
Thematik des historischen Romans Lkkeka/id wären hier zu nennen.<br />
Wenn alles nichts nützt, den klassischen Vorbildern l i t e r a r i s c h<br />
gleichzukommen, dann gelingt es wenigstens <strong>im</strong> Nachvollziehen<br />
ihres Lebenswegs, <strong>im</strong> Einleben in ihr poetisches Leiden, den<br />
dichterischen Schöpfungsprozeß <strong>im</strong> Geist nachzuahmen. Diese<br />
Lebensepigonie <strong>Scheffel</strong>s findet man auf zahlreichen Stationen<br />
seiner Biographie. Schon der achtzehnjährige <strong>Scheffel</strong> hat sich<br />
nach klassich-romantischem Vorbild ganz der Kunst verschrieben.<br />
An den Vater schickt er folgendes Distichon:<br />
"Einzig der Kunst nur lebt' ich allhier. Von sonstiger<br />
Nahrung<br />
War außer Brot und Bier weiter die Rede nicht v i e l . " (76)<br />
Neben der zur Leerformel verkürzten Poesieaussage weist schon<br />
der zweite Vers auf die bereitliegenden Möglichkeiten o r i g i <br />
närer Dichtung hin: in seiner humorigen Saufpoesie wird Scheff<br />
e l bald einen eigenen Ton finden. Das hindert ihn nicht, nach<br />
bewährter Klassik-Ideologie nach Italien zu reisen und dort<br />
Erinnerungen und Briefe zu verfassen, die in Gegenstand, Sprachduktus<br />
und Selbstdarstellung den italienischen Reisenotizen<br />
Goethes nicht unähnlich sind. Wie Goethe hat auch <strong>Scheffel</strong> sein<br />
Italienerlebnis, wenn er ein neues Leben empfindet oder es doch<br />
77<br />
vorgibt: "Welschland hat den großen Reiz, daß man te.He.ri lernt"<br />
Auch auf diese Weise erzeugt das Bewußtsein der eigenen Epigo-<br />
78<br />
nalität oder das epigonaler Zeiten ein "Trotzdem" , einen<br />
inneren Widerstand gegen die Zeit, aus dem das Epigonale zum<br />
Rohmaterial einer neuen Poesie wird. <strong>Scheffel</strong> g i l t ja seinen<br />
zeitgenössischen Lesern gerade dann als o r i g i n e l l , wenn er über<br />
das Epigonale hinausgeht, indem er es benutzt.
63<br />
II. DICHTER UND GESCHICHTE<br />
1. Der historische Roman<br />
Der historische Roman, auch <strong>Scheffel</strong>s £kke.ha/id<br />
9<br />
hat schon <strong>im</strong>mer<br />
an der Diskrepanz zwischen der Wertschätzung eines breiten Lesepublikums<br />
und der Verachtung durch die normative Romantheorie<br />
gelitten . Schon Walter Scott, der Protagonist dieses Gattungstyps,<br />
hatte sich in den Vorworten zu seinen Romanen, vor allem<br />
in seinem Uaue/i£e.y, zum Verhältnis des historischen Romans zur<br />
Geschichtsschreibung grundlegend geäußert und damit best<strong>im</strong>mte<br />
2<br />
Gattungserwartungen vorgegeben . Zwei Generationen nach Scotts<br />
Romanen kompliziert sich die Gattungsproblematik für <strong>Scheffel</strong>s<br />
Lkkaka/id auf ganz eigene Weise. In den 50er Jahren des 19.<br />
Jahrhunderts hatte die Zahl der erschienenen historischen Romane<br />
erheblich zugenommen. Außerdem war <strong>Scheffel</strong>s Lkkatta/id in<br />
die De.u£*che. BL(L£io£he.k. Sammiung au/>e.i£e./>e.ne./i 0/iiginaiiomane.<br />
wie z. B. auch Hermann Kurz' Sonnantoi/ti (1854-) aufgenommen<br />
worden und konnte mit einer sehr v i e l höheren Startauflage als<br />
3<br />
der für Anfänger üblichen erscheinen . Dieser Glücksfall a l l e i n<br />
erklärt den Verkaufs- und Leseerfolg des £kke.haid noch nicht^.<br />
An der dahinter stehenden Frage, inwieweit dem £kke.ha/id der<br />
Ausgleich zwischen dem historisch beglaubigten Stoff und der<br />
literarischen Fiktion gelingt, hatte sich schon unter zeitgenössischen<br />
Lesern und Rezensenten eine heftige Diskussion entzündet.<br />
Schon die erste Rezension hatte den ELkkakaid gegen die<br />
Forderungen normativer Romanbetrachtung in Schutz genommen^.<br />
Uber die Kompositionsschwächen sieht der Rezensent großzügig<br />
hinweg, weil er <strong>im</strong> historischen Roman dieser Art v i e l Positives<br />
für den zeitgenössischen Leser erkennt: "Die Väter waren<br />
nicht v i e l anders, als die Söhne noch sind."^<br />
Eine andere Besprechung noch <strong>im</strong> Erscheinungsjahr hatte den<br />
Ekkaka/id kurz als "ein für die Geschichte des Romans epoche-<br />
7<br />
machendes Buch" bezeichnet . Auch dieser Kritiker lobt gerade<br />
die Aktualität des Historischen in diesem Roman:<br />
"so werden wir ja gerade in die Kluft zwischen diesen<br />
Quellen und ihrer Verarbeitung hineingestellt, wir sehen
64<br />
zu viel hinter die Coulissen und der unmittelbare Eindruck<br />
des poetischen Kunstwerks wird dadurch gestört. Wir merken<br />
bald, daß die Art <strong>von</strong> historischer Wahrheit, die wir hier<br />
haben, doch eine ganz andere i s t , als was die meisten Leute<br />
gewöhnlich meinen, wenn sie eine wahre Geschichte verlangen."<br />
(8)<br />
Weitere Angriffe werden schon <strong>im</strong> voraus abgeschmettert, indem<br />
man potentielle Kritiker in ihrer Leserfunktion einfach diskreditiert<br />
:<br />
"Für den Lesepöbel, der nur an dem Stofflichen seine Freude<br />
hat und weniger poetisch ergözt oder historisch belehrt als<br />
phantastisch beschäftigt seyn w i l l , wird es f r e i l i c h <strong>im</strong>merhin<br />
weniger ein Buch seyn. Auf solchen Pöbel, wenn er auch<br />
noch so sehr die Majorität bildet, darf aber keine Rücksicht<br />
genommen werden. Der Schriftsteller hat, was man auch <strong>von</strong><br />
Popularität sagen mag, <strong>im</strong>mer nur das, nicht zwar speciell<br />
und fachmäßig, aber allgemein gebildete Publikum in's Auge<br />
zu fassen, und für dieses wird es dem Ekkehard nicht an Anziehendem<br />
fehlen.f. . .J Die ganze Darstellung i s t so, daß<br />
sich ihrer jeder <strong>im</strong> weiteren Sinn Gebildete erfeuen kann;<br />
für den höher Gebildeten liegt überdieß in der historischen<br />
Dokumentirung noch ein besonderer Reiz." (9)<br />
Insofern i s t das eingangs zitierte Urteil Theodor Fontanes<br />
kein vereinzeltes, sondern t r i f f t genau den Nerv der poetologischen<br />
Diskussion nach der Mitte des Jahrhunderts. Fontane<br />
kommt ebenfalls auf die in den Rezensionen angeschnittenen<br />
Kernstücke der Diskussion, die Frage nach der historischen<br />
StoffWahrheit und das richtige Verhalten des Lesepublikums,<br />
zurück. Er macht das ihm zugetragene Urteil, alles Historische<br />
am Lkkekaid sei unwahr, zum Ausgangspunkt seiner Besprechung.<br />
Wenn Fontane dem Autor einen historischen Blick und "Verständ-<br />
1 0<br />
nis für das Historische" bescheinigt, so sieht er in ihm "ein<br />
11<br />
rückwärts gewandtes prophetisches Ahnungsvermögen" verkörpert.<br />
Geht man zudem <strong>von</strong> den grundsätzlichen Forderungen des<br />
programmatischen Realismus aus, dann erklärt sich Fontanes<br />
"ganz reiner Eindruck" - "rein" als konsequentes Durchhalten<br />
der einmal eingeschlagenen Erzählweise? - aus dem <strong>im</strong> Ckkeha/td<br />
wiedererkannten Verklärungsprinzip: "Natur" und "Kunst" sind<br />
1 3<br />
in der "künstlerischen Gestalt nahezu vollendet" ; die<br />
regionalgeschichtliche Thematik (Fontanes Uande/iungen\ ) des<br />
Ekkehard bleibt "Kostüm", das das "Le.ie.rt erschließt": "So<br />
waren die Leute vor tausend Jahren auch."^
65<br />
auf Äußerungen <strong>Scheffel</strong>s zurück, so findet man genau diese<br />
realistische Programmatik, die das Verklärungsprinzip ("Poesie")<br />
gegen das Romantische über den Geschichtsstoff zu erreichen<br />
sucht:<br />
"1. Die Geschichte durch die Poesie lebendig machen, 2. die<br />
Poesie, die mondscheindurchsichtig und wasserbleich geworden,<br />
durch geschichtliches Fleisch s t o f f l i c h und fett zu<br />
machen. Es liegt noch so v i e l Kernmark da und dort. Will<br />
einer diese zwei Zwecke, so entsteht der historische Roman"<br />
(15)<br />
Diese realistische Beziehung <strong>von</strong> Geschichte und Poesie zur Aussöhnung<br />
zu bringen, i s t <strong>im</strong> Vorwort zum Ckkehaid ausdrücklich<br />
thematisiert. Zwar äußert sich <strong>Scheffel</strong> dort sehr dezidiert zu<br />
Entstehung, Intention und Lesererwartung, doch darf bei einer<br />
Interpretation nicht übersehen werden, daß seit Scott "die<br />
Vorrede zum festen Formenbestand des historischen Romans" ge-<br />
1 6<br />
hört und damit auch festen typologischen Gesetzen unterworfen<br />
i s t , bei denen gewisse Rechtfertigungsfloskeln, der oft<br />
polemische Tonfall, ein pseudowissenschaftlicher Duktus usw.<br />
vorbest<strong>im</strong>mt sind. Solche Vorreden müssen deshalb auf dem Hintergrund<br />
der Gattungszwänge gelesen werden. Gustav Freytag,<br />
selbst Verfasser zahlreicher historischer Romane und mit Julian<br />
Schmidt in den Q/ienzHotan einer der Programmatiker des Realismus,<br />
hat erkannt, daß <strong>Scheffel</strong> zwar "in der Einleitung gegen<br />
gewisse Grenzbotenansichten polemisirt", aber der Roman selbst<br />
1 7<br />
den "wahren Hintergrund" eben dieser Ansichten bestätige<br />
"Dies Buch ward verfaßt in dem guten Glauben, daß es weder<br />
der Geschichtsschreibung noch der Poesie etwas schaden<br />
kann, wenn sie innige Freundschaft mit einander schließen<br />
und sich zu gemeinsamer Arbeit vereinen." (V,5)<br />
Dieser sentenzenhafte erste Satz der Vorrede des {Lkkekaid darf<br />
f r e i l i c h nicht darüber hinwegtäuschen, daß <strong>Scheffel</strong> nur eine<br />
"innige Freundschaft" <strong>von</strong> Geschichtsschreibung und Poesie, also<br />
keine Identität fordert und die Wirkungen dieser Zusammenarbeit<br />
nur negativ oder recht vage formuliert sind. Die h i s t o r i <br />
sche Quelle, das "Rohmaterial", muß "gereinigt, umgeschmolzen<br />
und verwertet" (V,5) werden. Ziel dieses Prozesses i s t für<br />
<strong>Scheffel</strong> die "Wiederbelebung der Vergangenheit" mittels einer<br />
"schöpferisch wiederherstellenden Phantasie" (V,6) zum Nutzen<br />
der Nation, also eine eminent restaurative und didaktische
66<br />
Verwertung. <strong>Scheffel</strong>s &kke.ha/id hat nämlich vor, "die Freude am<br />
geschichtlichen Verständnis auch in weitere Kreise zu tragen";<br />
der historische Roman erscheint ihm <strong>im</strong> Augenblick noch als<br />
ein Gegenstand, an dem "die Mehrzahl der Nation teilnahmslos<br />
vorübergeht" (V,6). Das s o l l durch den Ekkehard anders werden;<br />
dann nämlich i s t der historische Roman<br />
"ein Stück nationaler Geschichte in der Auffassung des<br />
Künstlers, der <strong>im</strong> gegebenen Räume Gestalten scharfgezeichnet<br />
und farbenhell vorüberführt, also daß <strong>im</strong> Leben und<br />
Ringen und Leiden des Einzelnen zugleich der Inhalt des<br />
Zeitraums sich wie zum Spiegelbild zusammenfaßt." (V,6f)<br />
Wird damit der historische Roman "als ebenbürtiger Bruder der<br />
Geschichte anerkannt" (V,7), so schließt sich der Kreis, Poesie<br />
und Geschichte seien verschwistert. Tatsächlich triumphiert<br />
der naive Zeichner über den Archäologen und den Geschichtsschreiber,<br />
weil es ihm gelingt, den Stoff mittels<br />
"einer schöpferisch wiederherstellenden Phantasie" (V,6) zu beseelen.<br />
Die Romangegenstände werden durch eine "<strong>von</strong> Poesie verklärter<br />
Anschauung der Dinge" (V,7) geheiligt, nehmen also das<br />
realistische Verklärungspostulat nochmals auf. Damit der histo-<br />
1 8<br />
rische Roman zur "eigenständigen Geschichtsbeschäftigung"<br />
werden kann, braucht er den Nachweis historischer Treue und<br />
Exaktheit, wie ihn die detaillierten Anmerkungen beschwören.<br />
Aber letzten Endes siegt die poetische Fiktion doch über jeg-<br />
1 9<br />
liehe historisch beweisbare Realität .<br />
Im Gefolge Scotts fordert die normative Poetik für den historischen<br />
Roman die fiktive Figur des mittleren Helden als Erzählvehikel.<br />
Scotts Uave./i(Le.u g i l t dafür als Idealtypus, a l l e r <br />
dings mit dem Vorzug, nicht nur mittlerer, sondern auch zwi-<br />
20<br />
sehen Gegenwart und Geschichte vermittelnder zu sein . Der<br />
Unterschied zwischen diesem Heldentypus und dem eigenständigen<br />
Geschichtsverständnis des Scheffeischen Romans liegt in der<br />
Umkehrung der Spannung <strong>von</strong> fiktivem Helden und historisch belegbarer<br />
Erzählhandlung. Im Lkkeka/id nämlich fehlt d i e bedeutende<br />
historische Persönlichkeit. Dagegen sind der Held und<br />
die Hauptfiguren realhistorische, d. h. zumindest quellenmäßig<br />
21<br />
belegbare Figuren . Demgegenüber i s t die Erzählhandlung<br />
größtenteils f i k t i v oder aus heterogenen und kaum nachprüfbaren<br />
Geschichtsversatzstücken zusammengefügt. Von diesem Blick-
67<br />
winkel aus lassen sich übrigens die Anachronismen <strong>im</strong> Lk.ke.ka/idL<br />
22<br />
erklären , die ganz einfach verklärte Geschichte, nicht historisch<br />
nachprüfbare Geschichte anbieten. Nicht die historische<br />
Persönlichkeit aus der Perspektive einer unbedeutenden mittleren<br />
Heldenfigur s o l l also dargestellt werden; Hauptgegenstand<br />
und Anliegen des Romans sind vielmehr die historischen Ereignisse<br />
selbst. Der Held <strong>im</strong> Lkke.ka/id dient zwar wie der Held der<br />
Scottschen Romane als Erzählvehikel, jedoch nicht mehr als mittlerer,<br />
sondern als idealer Held schlechthin. Ekkehards erstes<br />
Auftreten s t e l l t sich <strong>im</strong> Sinne eines pue/i 4ß/2ß*-Topos dar:<br />
"Sprechet, Bruder Ekkehard, rief der Abt ... Und das wogende<br />
Gemurmel verstummte; alle hörten den Ekkehard gern. Er war<br />
jung an Jahren, <strong>von</strong> schöner Gestalt, und fesselte jeden, der<br />
ihn anschaute, durch sittige Anmut, dabei weise und beredt,<br />
<strong>von</strong> klugverständigem Rat und ein scharfer Gelehrter ... Ein<br />
kaum sichtbares Lächeln war über seinen Lippen gelegen, dieweil<br />
die Alten sich stritten." (V,31)<br />
Das Identifikationsangebot, das auf diese Weise für den Leser<br />
vom Text ausgeht, verfällt damit der Tendenz zur Popularisierung<br />
des historischen Romans und unterliegt der Gefahr, "in<br />
2 3<br />
gefährliche Nähe zur Trivialität" zu geraten .<br />
2. Geschichte und Gegenwart<br />
Wie das Historische <strong>im</strong> Lkkeka/id angeeignet wird, s o l l ein Blick<br />
auf den Romananfang zeigen.<br />
"Es war vor beinahe tausend Jahren. Die Welt wußte weder <strong>von</strong><br />
Pulver noch <strong>von</strong> Buchdruckerkunst.<br />
Uber dem Hegau lag ein trüber bleischwerer H<strong>im</strong>mel, doch war<br />
<strong>von</strong> der Finsternis, die bekanntlich über dem ganzen Mittelalter<br />
lastete, <strong>im</strong> einzelnen nichts wahrzunehmen." (V,13)<br />
Der Erzähler setzt <strong>im</strong> Märchenton an, hält aber diesen Ton nicht<br />
durch. Das Geschichtliche wird nun nicht als genaues Datum oder<br />
Faktum präsentiert, sondern als bewußt ungenauer Eindruck des<br />
"beinahe". In gleichem Sinn n<strong>im</strong>mt der Erzähler das darauf f o l <br />
gende Zitat Uhlands "nicht allzu genau". Das Mittelalter wird<br />
durch Charakteristika, die mehr als pauschal sind, <strong>von</strong> der<br />
Neuzeit abgegrenzt, Pulver und Buchdruck weisen f r e i l i c h schon<br />
auf das weitere Romangeschehen voraus. Ebenso zielstrebig folgt<br />
der Leser der Perspektive des Erzählers in <strong>im</strong>mer kleiner wer-
68<br />
de*nde Weltausschnitte, bis Geschichte und Topographie ineinander<br />
übergehen: 1000 Jahre - Mittelalter - Hegau - Radolfszell -<br />
hoher Twiel - Burg darauf - Frau Hadwig auf dieser Burg (V,13f).<br />
Erst dann i s t der Punkt erreicht, "da unsere Geschichte anhebt"<br />
(V, 1 4-). Mittelalterliches wird nur in sprachlichen Vergangenheitsformen<br />
aufgerufen, indem dauernd auf die Historizität<br />
2 /<br />
der Zeitbegriffe verwiesen i s t . An dieser Stelle korrespon-<br />
2 5<br />
diert der Anfang des Romans auffällig mit dem Schluß . Die<br />
erste bzw. die letzte auftretende Figur i s t dabei jeweils die<br />
Herzogin. Der quellenmäßig verbürgte Nachtrag des Romanendes<br />
(VI,428ff) bezieht sich dann genau auf die geschichtlich-topographische<br />
Einleitung. Der* Hinweis auf "Staub und Asche", auf<br />
die Vergänglichkeit und Zeitlichkeit der Geschichte (VI,430),<br />
entspricht der Einleitungsformulierung: "Aber das i s t schon<br />
lange her" (V,13). Dieser Unausweichlichkeit des historischen<br />
2 6<br />
Wandels kontrastiert die Beständigkeit der Berge . In diesem<br />
Gegeneinander i s t auch der Gegensatz <strong>von</strong> einst und jetzt verborgen,<br />
wie er mit dem ersten Satz des Romans aufgerufen wird.<br />
Der v letzte Absatz des Erzählerauftritts (VI,430f) hat seine<br />
Entsprechung in der Vorrede (V,5ff); der präzise Bezug aufein-<br />
27<br />
ander<br />
i s t überdeutlich<br />
Was dieser Befund aussagt, i s t schnell zusammengefaßt: die Bausteine<br />
des historischen Stoffes beziehen jederzeit die Perspektive<br />
der Gegenwart mit ein. Gerade indem sie auf den großen<br />
Abstand zwischen damals und heute und gleichzeitig auf die<br />
innere Nähe der Empfindungen in beiden Epochen verweisen, dient<br />
das Geschichtliche l e t z t l i c h zur Darstellung der Gegenwart.<br />
Wie der Geschichtseinbau in das literarische Werk bewußt gegenwartsbezogen<br />
gelingen s o l l , hat <strong>Scheffel</strong> seit frühester Zeit<br />
auch theoretisch beschäftigt. Vorerst b e t r i f f t es nur die Maler<br />
e i , wenn der Zwanzigjährige seinem Vater das Problem des mangelnden<br />
Gegenwartsbezuges jeder historischen Kunst vorträgt.<br />
"Das Bewußtsein der Zeit in künstlerischer Form darzustellen"<br />
gipfelt als Forderung <strong>im</strong> Vorwurf an die Nazarener, Geschichtselemente<br />
unhistorisch, weil als zeitlos auszugeben; dadurch<br />
isoliere sich jede historische Kunst <strong>von</strong> der Gegenwart: "Es i s t<br />
eine Deportation der Kunst mitten aus ihrer vollen Wirksamkeit<br />
2 8
69<br />
ka/id sieht sich <strong>Scheffel</strong> dann selbst vor der Schwierigkeit, die<br />
29<br />
Geschichte "nicht außer Acht zu lassen" . Er hat zwar anfangs<br />
nach dem bewährten Muster des 7/iompe.te./i vor, "auch mit den Gestalten<br />
jener Zeit mein leichtsinniges Spiel zu treiben", aber<br />
allmählich entsteht ihm eine "historische Pietät" gegenüber der<br />
30<br />
Geschichte . Der humoristische S t i l , wie <strong>Scheffel</strong> ihn am Versepos<br />
ausgebildet hatte, muß an der Gattung des historischen<br />
Romans versagen:<br />
"Ich habe überhaupt bei ernster Beschäftigung mit der Geschichte<br />
gemerkt, daß auf Zeiten, die noch ursprünglich naiv,<br />
wie auf solche, die <strong>von</strong> tragischen Conflicten durchschüttert<br />
sind, sich die Ironie durchaus nicht anwenden läßt." (31)<br />
Man sieht, der epische Humor des poetischen Realismus i s t als<br />
Erzählmöglichkeit noch nicht in Sicht. <strong>Scheffel</strong> versucht dieses<br />
Problem deshalb so zu lösen, daß er sich auf seinen "Instinct,<br />
32<br />
oder bon sens" verläßt . Doch der Zwiespalt, "den Ernst und<br />
stofflichen Gehalt der historischen Wissenschaft mit den Ge-<br />
33<br />
setzen künstlerischer Schönheit zu verschmelzen" , bricht ihm<br />
<strong>im</strong>mer wieder auf:<br />
"In dieser Weise habe ich jetzt ein Werk unter der Feder,<br />
auf dessen Erfolg ich selbst gespannt bin; ich möchte es<br />
einen strengen historischen Roman nennen, der in spielender<br />
Weise das Kultur- und Geistesleben einer längst ver^klungenen<br />
Epoche enthält und der, wenn man ihn des psychologischen<br />
Rahmens der Geschichte entkleiden wollte, sich mit Leichtigkeit<br />
in eine Reihe gelehrter Abhandlungen auflösen ließe."<br />
(34)<br />
Schon <strong>im</strong> Vorwort des Lkkaka/id hatte <strong>Scheffel</strong> versucht, keinen<br />
Widerspruch zwischen der historischen Handlung und der Gegenwart<br />
aufkommen zu lassen. Der historische Roman wird dort mit<br />
dem Blick auf die Gegenwart legit<strong>im</strong>iert; <strong>Scheffel</strong> sieht "unsere<br />
Zeit in einem eigentümlichen Läuterungsprozeß begriffen" (V,7).<br />
Die Beschäftigung mit dem Historischen richtet sich am Zeitgeist<br />
aus, gegen den der historische Roman eine Alternative<br />
bieten s o l l . Die Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens<br />
seines Jahrhunderts verkürzt <strong>Scheffel</strong> populär auf Abstraktion<br />
und Phrase, Begrifflichkeit und Selbstbeschauung, Formelhaftigkeit<br />
und Kritik. Dem s t e l l t er Best<strong>im</strong>mungen gegenüber, die er<br />
schon für den 1 /lontpata/i gebraucht hatte: Farbe und Sinnlichkeit,<br />
Beziehung auf Leben und Gegenwart, naturgeschichtliche Analyse<br />
und schöpferische Produktion (V,7). Wenn <strong>Scheffel</strong> gegen die
70<br />
kritische Haltung der Gegenwart mit der "Rüstung zur Umkehr"<br />
auf das "Gebiet unserer deutschen Vergangenheit" wirbt (V,7),<br />
gibt sich die konservative, halbherzig realistische Position<br />
endgültig als reaktionäre.<br />
<strong>Scheffel</strong>s<br />
Vorlage, die St. Gallener Klostergeschichten, i s t ja<br />
schon als Quelle eine konservative Tendenzschrift, die gegen<br />
alle Neuerungen polemisiert und <strong>im</strong> 10. Jahrhundert die gute<br />
35<br />
alte Zeit schönfärberisch rühmt^ . <strong>Scheffel</strong> sucht darin Anmut<br />
und Fülle gemütreicher Zeiten (V,8), durch die die Verachtung<br />
der Gegenwart hindurchsch<strong>im</strong>mert. Wie sehr der mittelalterliche<br />
Stoff nur Mittel zum Zweck i s t , wird vollends offenkundig, wenn<br />
<strong>Scheffel</strong> <strong>im</strong> Mittelalter einer "<strong>bürgerlichen</strong> Gesellschaft" begegnet,<br />
deren "sozialer Verkehr" für die Gegenwart zur Mahnung<br />
dient (V,8). Die "politische Zerklüftung und Gleichgiltigkeit<br />
gegen das Reich" (V,8) s t e l l t noch deutlicher den direkten Bezug<br />
zur politischen Situation her. "Kein Wunder" (V,8) also,<br />
daß dem Erzähler wie dem Leser die Augen ob solcher Parallelen<br />
aufgehen. Trotzdem - und das zeigt die Position des historischen<br />
Romans der 50er Jahre - rechtfertigt <strong>Scheffel</strong> seinen Gegenstand<br />
zusätzlich nach zwei Richtungen. Mit den gelehrten Anmerkungen<br />
des Ckkuka/id bringt er den Beweis gegen "die Vermutung leichtsinnigen<br />
Spiels mit den Tatsachen" (V,11) bei, mit dem penetranten<br />
Gegenwartsbezug entkräftet er den Vorwurf, er verweile in<br />
"harmlosem Genießen" und "<strong>im</strong> fröhlichen Selbstgefühl eigenen<br />
Schaffens"<br />
(V,11).<br />
Der Vergleich mit dem Vorwort zur Novelle 3-un ipe/iu*, die 1866<br />
entstanden, aber erst 1871 erschienen i s t , zeigt, daß <strong>Scheffel</strong><br />
zu diesem Zeitpunkt keine historische Legit<strong>im</strong>ation mehr nötig<br />
hat. Sein Problem liegt jetzt vielmehr in dem Dilemma, seine<br />
offenkundige inhaltliche und s t i l i s t i s c h e Nachfolge <strong>von</strong> Roman-<br />
36<br />
t i k und Biedermeier abzustreiten . "Die Hohenstaufischen Kaiser<br />
mit großem Ansehen" (II,8) der Erzählung nehmen die Versailler<br />
Reichsgründung der Hohenzollern poetisch vorweg. Die Geschichte<br />
bietet zu offensichtliche Bezüge für die Zeitereignisse an,<br />
wenn <strong>Scheffel</strong> z. B. den Mainzer Hoftag Barbarossas "als h e r r l i <br />
ches Frühlingsfest deutscher Nationalkraft und deutschen Geistes"<br />
beschreibt (11,9). Die Korrelation <strong>von</strong> Gegenwartsereignissen<br />
und historischem Stoff läuft auf einer poetisch erhobenen Ebene
71<br />
ab. Auch deshalb versagen für <strong>Scheffel</strong> die reinen Geschichtsschreiber,<br />
weil sie nicht <strong>im</strong>stande oder willens sind, solche Bezüge<br />
wirksam werden zu lassen. <strong>Scheffel</strong> sucht dagegen seine Inspiration<br />
in der historischen Dichtkunst, die l e i s t e t , was die<br />
Wissenschaft verweigert: die fällige Synthese als "dichterische<br />
Selbstbeantwortung jener kulturhistorischen Fragen" (11,9). Die<br />
Zeiten des "Dampfrosses", "der Kriegsbedrängnis" und der "Bruderzwist"<br />
(11,10) <strong>von</strong> 1866 finden hier nicht bloß ihren Reflex; die<br />
zukünftige deutsche Einheit i s t gleichzeitig in der "Doppelarbeit<br />
des Dichters und des Malers" (11,10) als verwirklichte Hoffnung<br />
vorweggenommen.<br />
Im Vorwort zur T/tau Auant iu/ie. werden Gegenwart und Vergangenheit<br />
auf einer zusätzlichen Ebene miteinander in Beziehung gesetzt.<br />
Der Zusammenhang des spätmittelalterlichen Sängerwettstreits<br />
auf der Wartburg und des Gegenwartsbezugs des Scheffeischen Gedicht<br />
zykluses mit der Einweihung des Goethe-Schiller-Denkmals<br />
<strong>von</strong> 1857 in We<strong>im</strong>ar (III,8) i s t auf den ersten Blick nur sehr<br />
schwer nachzuvollziehen. Er wird aber hergestellt durch eine<br />
<strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> konstruierte "mehr als zufällige Fügung" (III,8)<br />
geschichtlicher Kontinuität: dem Literaturmäzenaten und Landgrafen<br />
Hermann <strong>von</strong> Thüringen aus dem 12. Jahrhundert schließt sich<br />
Goethes Herzog Karl August in We<strong>im</strong>ar an, dem endlich der gegenwärtige<br />
Großherzog Carl Alexander auf der Wartburg folgt! Im<br />
Mittelpunkt dieser topographischen und personalen Zufälligkeiten<br />
sammelt sich <strong>im</strong> Idealbild deutscher Klassik ein vermittelter<br />
Gegenwartsbezug. So wie alle drei Fürsten über die Zeiten hinweg<br />
in ihrer politischen und mäzenatischen Funktion verschmelzen<br />
können, so verkürzt sich auch die Perspektive auf die klassischen<br />
Vorbilder. Entsprechend solcher Verkürzungen werden Goethe<br />
und Schiller zum Allgemeingut mindestens des Bildungsbürgers erklärt<br />
und damit der geschichtliche Abstand eingeebnet. Die Allegorie<br />
der Frau Aventiure i s t wie Barbarossa <strong>im</strong> Kyffhäuser eingelagert<br />
und damit genauso vereinnahmt wie schon vorher die Klassik:<br />
"Hei, wer soviel erfahren dürfte und erführe, daß er mit den<br />
halbmythischen Schemen dieser mittelalterlichen Sänger, ihrem<br />
Leben, ihrer Epoche vertraut würde wie mit Goethes und Schillers<br />
klarer Zeit!" (III,8)<br />
Dieser Rückgriff auf zwei Geschichtsebenen, dieser doppelte<br />
Boden des historischen Dichtens i s t denn auch der Punkt, an dem
72<br />
Lob und Kritik der Scheffeischen Geschiichtsauffassung sich<br />
treffen. Aus <strong>Scheffel</strong>s eigener Sicht entsteht so jedoch eine<br />
"objektiv historische" Kunst, wie er sie für seine T/tau Aven-<br />
39<br />
tiuie. proklamiert hat . Ihr penetranter Gegenwartsbezug wird<br />
erst recht verständlich, wenn man <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>s Angst um sich<br />
und den Leser weiß, "daß die Pflege der mittelalterlichen und<br />
vorzeitlichen Studien etwas die Gegenwart Gefährdendes hat"^.<br />
So wie die Vergangenheit rückwärtsgewandte Erlösungsmodelle für<br />
die Gegenwart anbietet, so steckt in ihr zugleich die Gefahr,<br />
die Beschäftigung mit der Gegenwart ganz zu verdrängen. <strong>Scheffel</strong>s<br />
Bemühungen sind deshalb als ein dauernden Kampf zu lesen,<br />
Geschichte und Gegenwart zumindest sprachlich zusammenzubringen.<br />
Sinnigerweise in I/iene <strong>von</strong> Spit<strong>im</strong>ie/ig, <strong>Scheffel</strong>s geplantem<br />
großen historischen Roman, der vielleicht gerade aus diesem<br />
Grund Fragment geblieben i s t , lamentiert der Erzähler:<br />
"Denn nur in dieser Vergangenheit f r i s t e t sich noch mein<br />
Leben; auf Nichts Neues mehr steht mein Sinn und Alles, was<br />
noch vor mir liegt in der kurzen Spanne der Zeitlichkeit,<br />
heißt Erinnerung, Schmerz und Gebet." (4-1)<br />
Geschichte muß dergestalt zwangsläufig zu einem absolutem Wert<br />
werden. Im Grunde egalisiert das historische Denken, wenn die<br />
Geschichte einmal geschehen i s t , einfach alles; l e t z t l i c h wird<br />
die Gegenwart zur gegenwärtigen Geschichte und damit mit jener<br />
identisch:<br />
"und <strong>im</strong> Grunde, wer die Geschichte der Zeit, in der er lebt,<br />
kennt und versteht, der versteht auch die aller Vergangenheit,<br />
wenngleich er sie nie gelesen hat." (VIII,109)<br />
Dann aber i s t der Versuch des historischen Dichters, sich aus<br />
und in der Zeit durch die Geschichte zu retten, wieder an seinem<br />
Ausgangspunkt angelangt: "Was i s t in a l l dem bunten Schattenspiel<br />
<strong>von</strong> Welt und Geschichte das Bleibende?" (VIII,10)<br />
In dem "lyrischen Festspiel" die Linde am Ltte/i*de/ig zur Feier<br />
des 25jährigen Regierungsjubiläums des Großherzogs <strong>von</strong> Sachsen-<br />
We<strong>im</strong>ar-Eisenach (1878) läßt <strong>Scheffel</strong> die Geschichte als "stolze<br />
Frauengestalt in idealem Kostüm, etwa wie auf Kaulbachs Bild<br />
Geschichte and Sage, mit Gefolge" (11,182) und leibhaftig auftreten.<br />
Die Allegorie erklärt sich selbst, wobei sie "unsterbl<br />
i c h " durch die Reihen der Völker schreitet. An den Kriterien<br />
Echtheit, Recht, Schlichtheit und Menschenwürdigkeit (ll,182f)
73<br />
mißt sie "was heut noch Gegenwart, in strenger Prüfung", um dieses<br />
Urteil dann "mit ehrnen Griffeln" in die "Annalen der -<br />
Geschichte" niederzuschreiben (11,182). Das zur Person gewordene<br />
Geschichtsbild verdoppelt sich: unter der Leitung der Geschichte<br />
werden "geschichtliche Bilder" (II,182ff) gestellt.<br />
Selbst die Kunst hat in einem so geschichtsdominierten Raum kaum<br />
Platz. Zwar t r i t t die Poesie "begeistert" auf (11,192), doch<br />
bleibt ihr nur die Aufgabe, historische Erklärungen abzugeben.<br />
Die große Huldigung an sich selbst l e i t e t die Geschichte in<br />
eigener Person; auch der Abzug aller vollzieht sich "unter Vorantritt<br />
der Geschichte und der Künste" (11,194).<br />
Geschichte als Folie zur Gegenwart, Geschichte anstelle der<br />
Gegenwart, Geschichte schließlich als Kunst - in diesen Zusammenhängen<br />
wäre es nötig, gängige Thesen zur didaktischen Funktion<br />
/ 2<br />
der Geschichtsdichtung zu überprüfen . Auf jeden f a l l zeigen<br />
die Befunde Denkmodelle für die "populären Formen der Geschichtsaneignung<br />
<strong>im</strong> Zweiten Reich"^" .<br />
3. Geschichte als Wissenschaft<br />
Wissenschaft und Kunst waren für den jungen <strong>Scheffel</strong> nie Gegensätze,<br />
sondern galten ihm als identische Methoden, ein und dasselbe<br />
Ziel zu erreichen:<br />
"Beides i s t mir eigentlich gleich lieb und gleich nah am<br />
Herzen, denn Wissenschaft und Kunst sind in gewissem Sinn<br />
ein*, beide sind geistige. Tat, befriedigendes Leben, und ich<br />
würde dahin streben, entweder in der Wissenschaft künstlerisch<br />
oder in der Kunst wissenschaftlich, d. h. den ewigen<br />
Grundsätzen des Schönen zu wirken." (44)<br />
Eine so universal verstandene Geschichte bezieht Position innerhalb<br />
der Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts, man denke<br />
an <strong>Scheffel</strong>s Kritik dieser Wissenschaft aus dem Vorwort des<br />
&kke.ka/id. Wissenschaftskritik als Auseinandersetzung mit einer<br />
verengt-verängstigten Fachwissenschaft bildet auch den Hintergrund<br />
vieler Gaudeamus-Qte&ichte <strong>Scheffel</strong>s mit ihrer "spielerischen<br />
Ironisierung" der Naturwissenschaften^. Als ebenso<br />
spielerlische Ironisierung war <strong>Scheffel</strong>s ursprünglicher Zugriff<br />
auf die Geschichtswissenschaft gewesen. Der 7'/tompete/i <strong>von</strong><br />
Säkkinge.n 9 auch eine Geschichtsdichtung, i s t dafür ein Beispiel.
74<br />
Gleichfalls ein Spiel sind die gelehrten Anmerkungen zum tZkke.-<br />
ka/id. Anfangs sind sie kaum mehr als eine "Concession an die<br />
Nothwendigkeit<br />
der Verhältnisse, an die Majorität der ve/inün£tigen<br />
Leute", wie <strong>Scheffel</strong> an Paul Heyse schreibt^. Eindeutiger<br />
und rückhaltloser gesteht <strong>Scheffel</strong> in einem Brief an seinen<br />
Vater den wissenschaftlichen Wert der in den Rezensionen so<br />
vielgerühmten<br />
Anmerkungen:<br />
"Ein Beweis für mich aber, wie v i e l <strong>im</strong> Großen und Ganzen der<br />
Schein ausmacht, i s t , daß durch die dem Buch beigefügten<br />
Anmerkungen, die nur eine rohe Zusammenstapplung zusammengelesener<br />
Notizen und in den Augen eines wirklich gelehrten<br />
Mannes ganz ohne Werth sind, das Publicum sich verblüffen<br />
läßt, und i t z t vor der historischen Gründlichkeit des Verfassers<br />
mehr Respect hat, als ohne dieselben der Fall wäre."<br />
(47)<br />
Dient hier der Gelehrigkeitsausweis noch fast zufällig als Dekoration<br />
des poetischen Werks, so übern<strong>im</strong>mt <strong>Scheffel</strong> dieses<br />
Arbeitsprinzip wegen seines Erfolges für seine weiteren Werke.<br />
Zum 3.unipe/ius äußert er sich gegenüber seinem Illustrator<br />
Anton <strong>von</strong> Werner: "Während Sie die Bilder entwerfen, werde ich<br />
dann für eine anmutige Vorrede und für gelehrte Anmerkungen<br />
L 8<br />
sorgen" . Die Anmerkungen werden wie das Vorwort und die I l l u <br />
strationen zu einem überflüssigen, aber vom Publikum geforderten<br />
Ausstattungsattribut. In ihnen gerinnen die Ergebnisse der<br />
Geschichtswissenschaft zum Beweis der Autorgelehrsamkeit, enthalten<br />
doch diese Anmerkungen nicht nur Erklärungen schwerverständlicher<br />
Textstellen, sondern legen Zeugnis vom weitschweifigen<br />
Detailwissen des Verfassers ab. Zum zweiten dienen sie<br />
zur historischen Legit<strong>im</strong>ation für den gegenwärtigen Leser bei<br />
unwahrscheinlichen oder unglaublichen Geschehnissen; sie werden<br />
zum Beweismittel des argumentierenden Autors. Drittens schließl<br />
i c h können die Anmerkungen auch als Distanzierungsmittel des<br />
Erzählers fungieren, der in diesen Bemerkungen aus seiner<br />
Dichterrolle heraustreten kann. Betrachtet man nämlich die gelehrten<br />
Anmerkungen zum Ekkeha/id isoliert., also nicht als Zeilenkommentar<br />
des Romans, so geben sie ihre Funktion als Erzählmittel<br />
preis. In meist zeitkritischen Kommentaren äußert sich<br />
der Erzähler scheinbar abschweifend über die Sprache des 10.<br />
Jahrhunderts, die er mit der "kühleren, gefirnißten und abgeschliffenen<br />
Redeweise" <strong>von</strong> heute vergleicht (VI, 44-0, Anm. 75).
75<br />
Der Erzähler kann auch die Romanhandlung humoristisch begleiten;<br />
so vergleicht er z. B. den Sipplinger Wein <strong>von</strong> damals mit<br />
dem heutigen (VI,44-8, Anm. 114)• Er kann allgemeine Zeitkritik<br />
üben (VI,44-7, Anm. 142) oder die "verehrte Leserin" direkt befragen,<br />
ob es ihr nicht ebenso ergehe wie dem Romanhelden (VI,<br />
446, Anm. 133). Die bedeutsame Erzählfunktion des Anmerkungsapparats<br />
bei <strong>Scheffel</strong> kann man daran ablesen, in welchem Verhältnis<br />
Text und Anmerkungen <strong>im</strong> Lkkaka/id und <strong>im</strong> 2unipe./ius<br />
stehen. Symptomatisch für <strong>Scheffel</strong>s spätere Arbeitsweise am<br />
2uriipe./iuA i s t das Ubergewicht, das der geschichtswissenschaftliche<br />
Apparat <strong>im</strong> Verhältnis zur GeschichtserZählung erhält. Denn<br />
nun erläutern nicht mehr die Fußnoten die einzelnen Textstellen,<br />
sondern die Anmerkungen bilden einen verselbständigten, chronologisch<br />
und genealogisch gegliederten Anhang, der keinerlei<br />
Verbindung mehr zur Erzählung hat. Die Anmerkungen des J.unipe./iu4<br />
beweisen nur noch die Gelehrsamkeit des Autors, nicht mehr die<br />
Autentizität des Textes als GeschichtserZählung:<br />
l e t z t l i c h<br />
wird die Novelle zum Beispielfall innerhalb einer archivarischen<br />
Quellenpublikation.<br />
Konnte <strong>im</strong> &kke.ha/td die Geschichte noch "an sich selbst als<br />
49<br />
Poesie" erscheinen , so wird mit der zunehmenden Vertiefung<br />
und Verbreiterung der wissenschaftlichen Geschichtsstudien die<br />
Diskrepanz zwischen historischer und poetischer Arbeit <strong>im</strong>mer<br />
offenkundiger, aus der schließlich die Poesie vollständig verdrängt<br />
wird^. Der Versuch, <strong>im</strong> Geschichtsstudium "die uner-<br />
51<br />
quicklichen Zustände" nach 1848 zu vergessen , führt <strong>Scheffel</strong><br />
auch theoretisch zur Entgegensetzung <strong>von</strong> historischer Wissenschaft<br />
zu Kunst und Leben. Das Leben wird ihm "eine tiefere<br />
und lautere Quelle der Erkenntnis, als in allem zusammenge-<br />
52<br />
suchsten gelehrten Zeug" . Daß die politischen Zeitverhält-<br />
53<br />
nisse "trotz unserer profunden Geschichtsstudien" nur durch<br />
das Schwert gelöst werden können, wird deshalb <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> so<br />
pess<strong>im</strong>istisch formuliert, damit es nicht eintreten sollte. Für<br />
<strong>Scheffel</strong> selbst bleibt f r e i l i c h die große Tat in der Gegenwart<br />
anstelle trockener Geschichtsforschung nur eine Gebärde. Eine<br />
Aussöhnung dieses Gegensatzes findet deshalb nur personalisiert<br />
statt; als Verkörperung <strong>von</strong> Geschichtsdenken und -erwartungen
76<br />
dessen politischer Erfüllung historischer Erwartungen und <strong>im</strong><br />
Augenblick des offensichtlichen Erfolgs g i l t Bismarck für<br />
<strong>Scheffel</strong> als die Verkörperung der Geschichte als Tat. <strong>Scheffel</strong>s<br />
lebenslange Abneigung gegen Preußen widerspricht dem nicht,<br />
zeigt es doch die Durchsetzungskraft der personalisierten Geschichtserfahrung<br />
des Jahrhunderts. Das Lob Bismarcks für sein<br />
5 5<br />
QaudeamuA i s t <strong>Scheffel</strong> "eine stattliche Anerkennung" . Der<br />
<strong>Scheffel</strong>- und Bismarckfreund Anton <strong>von</strong> Werner hat, das wird<br />
aus dem Briefwechsel deutlich, schon früh eine Begegnung des<br />
56<br />
Dichters mit dem Reichskanzler vermittelt . <strong>Scheffel</strong> i s t stolz<br />
auf die Ehre, mit dem "Gewaltigen" speisen zu dürfen und be-<br />
57<br />
kennt: "Ich liebe ihn und die Seinigen in ihrer Eigenart" .<br />
Als zu <strong>Scheffel</strong>s 50. Geburtstag der eiserne Kanzler dem v i e l <br />
geehrten Dichter gratuliert, revanchiert sich <strong>Scheffel</strong> mit<br />
einem telegraphischen Gedicht, das in seinem holprigen Metrum<br />
mehr über <strong>Scheffel</strong> als über Bismarck aussagt, weil es die Geschichte,<br />
nun als politische Aktion, noch einmal und endgültig<br />
den eigenen Geschichtsdichtungen konfrontiert:<br />
"&in gutes Blatt Geschichte<br />
Ist mehr denn tausend Blätter Gedichte." (IX,195)
77<br />
III. DICHTER UND WIRKLICHKEIT<br />
1. Geschichte als Erzählung<br />
Wie die Geschichte als Historie schnell in Widerspruch zur Gegenwart<br />
gerät, so läuft auch <strong>Scheffel</strong>s Literaturverständnis<br />
quer zu konventionellen Gattungserwartungen. Am scheinbar bloß<br />
wortspielerisch gebrauchten Sinn <strong>von</strong> Geschichte als Historie<br />
und als Erzählung kann gezeigt werden, wie der unscharfe Gattungsbegriff<br />
Geschichte die <strong>Scheffel</strong>eigene Form des Dichtens<br />
sehr genau definiert. Die scheinbar unklare Best<strong>im</strong>mung l e i t e t<br />
sich aus einer 'offenen' Form vorrealistischen Erzählens ab; an<br />
Ludwig Tiecks unscharfe Novellendefinition wäre hierbei zu erinnern.<br />
Der poetologische Glaube nach 184-8, die Technik der<br />
Literatur lehren zu wollen und deshalb strukturell eindeutig<br />
definierte Fachbegriffe zu verlangen, g i l t für <strong>Scheffel</strong> noch<br />
nicht.<br />
Im Lkkeka/id meint die Herzogin Hadwig kurzweilige Unterhaltung<br />
durch die mündliche Darbietung deutscher Sagen, wenn sie <strong>von</strong><br />
Ekkehard eine Geschichte fordert (VI,320). Ihr Kämmerer Spazzo<br />
v e r t r i t t eine Gegenposition; ihm wäre es lieber, wenn statt des<br />
Erzählens "zwei Schwerter aufeinander klirren" (VI,322). Beide<br />
kommen in den <strong>von</strong> Ekkehard erzählten deutschen Heldensagen, etwa<br />
<strong>von</strong> Wieland dem Schmied oder König Rother, auf ihre Kosten. Ihre<br />
Kritik richtet sich zwar gegen den Wahrheitsgehalt dieser Geschichten<br />
(VI,336), kann aber deren erzählerischer Konsistenz<br />
nichts anhaben. Wirklichkeit oder die möglichst große Ubereinst<strong>im</strong>mung<br />
mit ihr i s t auf dieser Erzählebene noch kein Kriterium<br />
für Hörer und Erzähler.<br />
Erst die Aufforderung Hadwigs: "Ihr sollet erzählen!" (VI,337)<br />
durchbricht diese stillschweigende Ubereinkunft, weil Ekkehards<br />
Geschichte nun nicht mehr <strong>im</strong> Sinne der deutschen Heldenlieder,<br />
sondern als unhistorische, biographisch aufgefüllte Erzählung<br />
funktioniert. Ekkehard glaubt damit den Erwartungen der Herzogin<br />
zu entsprechen: "Ja wohl, - erzählen! Wer spielt mir die Laute<br />
dazu?" (VI,337). Sein Verlangen nach Musikbegleitung verweist<br />
seine Geschichte aber in eine ganz andere Gattung. Geschichte -
78<br />
das meint hier ein poetisch strukturiertes Empfinden und braucht<br />
nicht unbedingt den Regeln der Erzählprosa zu entsprechen. Ekkehards<br />
Erzählung steht denn auch in schärfstem Gegensatz zu den<br />
beiden vorausgegangenen Erzählbeiträgen <strong>von</strong> Spazzo und Praxedis.<br />
Es i s t eine "kurze Geschichte" (VI,337), eine in Märchenton und<br />
Struktur <strong>von</strong> der Hörererwartung völlig abgesetzte Parabel. Die<br />
Enttäuschung der Herzogin resultiert aus ihrem Unverständnis<br />
für Ekkehards Bruch mit der erzählerischen Konvention:<br />
"Frau Hadwig sprang unwillig auf. Ist das Eure ganze Geschichte?<br />
fragte sie. Meine ganze Geschichte! sprach er mit<br />
unveränderter St<strong>im</strong>me." (VI,337)<br />
Geschichte in diesem Sinn meint also den Kern poetisch-biographischen<br />
Erlebens ebenso wie seine Umsetzung in Erzählformen,<br />
die dann beliebig wählbar sind. Ähnlich i s t auch der Selbstvorwurf<br />
<strong>Scheffel</strong>s in seinem Gedicht "Poetennot" zu verstehen:<br />
"In deinem Leben n<strong>im</strong>mermehr versuch 1 dich am<br />
Geschichtlichen Roman, wenn die Geschichte fehlt<br />
Und zum Roman dein eigen Hirn nicht fähig i s t ! " (IX,102)<br />
Auch Ekkehards Gleichnis wird nicht akzeptiert, er muß also vorerst<br />
"noch eine Geschichte schuldig" bleiben (VI, 34-2). Ekkehards<br />
Erleben dreht sich <strong>im</strong>mer wieder um diese Mitte. "Eine Geschichte,<br />
rief er - o, eine Geschichte! Aber nicht erzählen ... kommt<br />
laßt sie uns tun, die Geschichte!" (VI,342) ruft er der Herzogin<br />
zu. Auf dem Punkt höchster Erregung schlägt die Geschichte<br />
in Wirklichkeit um und verfällt damit auf das andere Extrem.<br />
Erst durch die "alten Mären" Konrads (VI,370) kommt Ekkehard<br />
mit dem Waltharilied in Berührung, mit dem er schließlich seine<br />
eigenen Ansprüche und die Forderungen der Herzogin erfüllen<br />
kann: der Stoff entstammt der früheren Auflage der Herzogin<br />
entsprechend aus der Heldensage; gleichzeitig kann Ekkehard<br />
sein persönliches Erleben einbringen, f r e i l i c h nicht direkt,<br />
sondern in Form eines Gleichnisses:<br />
"Im Bild der Dichtung s o l l das arme Herz sich dessen freuen,<br />
was ihm das Leben n<strong>im</strong>mer bieten kann, an Reckenkampf und<br />
Minnelohn, - ich w i l l das Lied <strong>von</strong> Walthari <strong>von</strong> Aquitanien<br />
singen!" (VI,378)<br />
Eigenes Erleben und Geschichtsdichtung fließen ineinander (VI,<br />
381) und können, so hofft der Erzähler, zum "Denkmal deutschen<br />
Geistes" werden (VI,417). Dichtung zugleich als Ersatz für die
79<br />
Wirklichkeit und als ihr Gegenstück - beides erklärt, warum der<br />
Widerspruch: "die erste große Dichtung aus dem Kreis he<strong>im</strong>ischer<br />
Heldensage, die trotz verzehrendem Roste der Zeit unversehrt<br />
der Nachwelt erhalten war" (VI,4.17) für <strong>Scheffel</strong> nur ein scheinbarer<br />
i s t . Geschichte als Historie und Geschichte als Erzählung<br />
nehmen dieselbe zeitlos menschliche Thematik ,auf und geraten<br />
somit gar nicht in Konflikt.<br />
Ekkehards Geschichten sind deshalb dadurch charakterisiert, daß<br />
sie an der historischen Wahrheit nicht überprüfbar sind: "Es<br />
i s t unbekannt, ob dies derselbe Ekkehard war, <strong>von</strong> dem unsere<br />
Geschichte erzählte" (VI,4.28). Alle Versuche, die Erzählwelt in<br />
ihrem Realitätsgehalt zu bezweifeln, tragen deshalb nicht, weil<br />
sie deren Eigengesetzlichkeit unterschätzen: "Aber wer der Geschichte,<br />
die wir jetzt glücklich zu Ende geführt, aufmerksam<br />
folgte, weiß das besser" (VI, 4-28). Denn der Raum dieser Geschichte<br />
als Erzählung befand sich <strong>von</strong> Anfang an in "einem Lande der<br />
Fabel", genauso wie Praxedis in Griechenland diese Geschichte<br />
weitererzählen wird (VI,4-29). Als Geschichte aus der Geschichte<br />
ordnet sich diese Erzählung ein in einen unaufhörlichen Traditionsstrom<br />
<strong>von</strong> Geschichten, "und neue Geschichten haben die a l <br />
ten in Vergessenheit gebracht" (VI,4.30) - so wie alle Werke<br />
<strong>Scheffel</strong>s in irgend einer Weise Geschichten sind: t~k.ke.ha/id, <strong>im</strong><br />
Untertitel "Eine Geschichte aus dem 10. Jahrhundert"; Junipe/iut,<br />
die "Geschichte eines Kreuzfahrers"; tiugideo, "Eine alte Geschichte".<br />
Selbst der unvollendet gebliebene Wartburgroman<br />
sollte "Eine Geschichte aus der Zeit des Sängerkriegs auf der<br />
Wartburg" werden. Sogar die Zueignung des 7/iompete/i verweist<br />
auf die "Geschichte <strong>von</strong> dem jungen Spielmann Werner und der<br />
schönen Margareta" (1,4).<br />
2. Dichter und Realität<br />
Es verwundert nicht, daß jemand, der solche Geschichten erzählt,<br />
seine eigene Dichterrolle in ein grundsätzliches Verhältnis<br />
zur Umwelt setzt. An seine Mutter schreibt <strong>Scheffel</strong> 18 56:<br />
"Die Welt, die keine Vorstellung da<strong>von</strong> hat, daß die naturgemäße<br />
und einzig ersprießliche Stellung des Künstlers darin<br />
besteht, keine Steüung zu haben, das heißt: keinem äußeren<br />
die freie schaffende Arbeit des Geistes hemmenden Zwang
80<br />
unterworfen zu sein, verlangt <strong>von</strong> einem Mann, der an Gründung<br />
eines häuslichen Herdes denkt, eine sociale Position,<br />
T i t e l , Rang und Gott weiß was noch. Ich selber habe bis jetzt<br />
mit ängstlicher Vorsicht mir Alles vom Hals gehalten, was<br />
nach Derartigem aussah, und wußte wohl warum." (1)<br />
Wenn auch diese Äußerung durch die Enttäuschung über das Scheitern<br />
seiner Verlobungspläne ausgelöst i s t , so bleibt doch der<br />
Grundton für <strong>Scheffel</strong>s weiteres Leben erhalten. Immer sieht er<br />
sich "<strong>im</strong> doppelten Geschirr eines Geschäftsmannes und eines<br />
2<br />
Poeten" und dabei "in die doppelte Hetzjagd einer großen,<br />
schriftstellerischen Arbeit und höfisch geselligen Lebens" ge-<br />
3 '<br />
zwängt . Allerdings betrachtet <strong>Scheffel</strong> seine Dichterstellung<br />
als "contre Coeur" erworben^. Aus dieser Haltung heraus hat<br />
<strong>Scheffel</strong> es Zeit seines Lebens abgelehnt, auch nur "proforma<br />
5<br />
ein Amt" anzunehmen . Mit zunehmendem Alter verschärft sich<br />
dieser Gegensatz, so daß zwischen beiden Lebenshaltungen kein<br />
Ausgleich mehr möglich i s t :<br />
v"Es i s t ein großer Irrtum, wenn man glaubt, den Dichter oder<br />
Historiker durch Ankettung an ein Staatsamt zu fördern; man<br />
muß ihn f r e i forschen und arbeiten lassen, wie es der Gegenstand<br />
verlangt. Wenn ich ein wohlversorgter Bibliothekar oder<br />
Archivmann wäre, so wäre ich eben kein produktiver Schriftsteller<br />
mehr. Hier heißt es: entweder - oder." (6)<br />
<strong>Scheffel</strong>s Suche nach sozialer Freiheit in der Dichterrolle und<br />
sein Scheitern daran sind jedoch nicht einfach individualpsychologisch<br />
zu bedauern. Man hat die Genese des freien und damit<br />
aus den sozialen Bindungen gelösten Schriftstellers als den da-<br />
7<br />
zu gehörigen Hintergrund <strong>im</strong> Auge zu behalten .<br />
<strong>Scheffel</strong> löst dieses zeittypische Problem des freien Schriftg<br />
stellers auf dem bürgerllichen Markt auf sehr eigenständige,<br />
doppelte Weise. Zum ersten schlüpft <strong>Scheffel</strong> in die anachronistische<br />
Rolle des Sänger-Dichters "Magnus vom finstern Grunde"<br />
aus der T/tau Auentiune. (111,89-96). Die Stilisierung <strong>von</strong> Magnus<br />
' Dichterleiden zur Rolle des sozialen Außenseiters unter<br />
der Maske des Gehe<strong>im</strong>nisvollen (Beiname!) macht diesen zum<br />
Mahner und Zeitkritiker: "Verbuhlte Stadt, golddurstiger<br />
Menschenhaufen, / Es geht an euch!" (111,89). Die "heilige Einsamkeit"<br />
als seine natürliche Lebensform läßt den Dichter die<br />
Welt aus anderer Perspektive sehen: als Mann der unteren Sphären<br />
(Beiname!) sieht er die Welt gleichzeitig <strong>von</strong> unten wie
81<br />
<strong>von</strong> oben (111,90: "Ameisenhaufen"). Die Welt des Marktes und des<br />
<strong>bürgerlichen</strong> Handels findet in merkwürdig archaischen Wendungen<br />
Eingang (Kaufherr, Kaufweib, Kaufmannsdiener, Marktgeschäfte).<br />
Ihr kontrastiert sich die <strong>von</strong> Magnus auf den Schild gehobene<br />
"Ritterkunst" (111,93). Dieses Signal einer vor<strong>bürgerlichen</strong> Gesellschaftsordnung<br />
i s t indes der Gegenwart nicht mehr gewachsen.<br />
Die Wirklichkeit der Zeit fordert <strong>im</strong> Rollenlied das Verschwinden<br />
des Sängers. Der Nutzen der Dichtung als Kunst wird dabei<br />
als Gebrauchsgegenstand gemessen oder vielmehr "gewogen" und zu<br />
leicht<br />
befunden:<br />
"Zeuch ab, mein schlanker Magnus,<br />
Dein Mäntlein reicht nicht hin,<br />
Wir brauchen Samt und Scharlach,<br />
Verbrämt mit Hermelin.<br />
Zeuch ab, mein schlanker Magnus,<br />
Dein Wämslein i s t zu eng,<br />
Wir brauchen Gugelzipfen<br />
Mit Glöcklein und Gespräng.<br />
Zeuch ab, mein schlanker Magnus,<br />
Dein Täschlein i s t zu leer ..<br />
Wir brauchen's <strong>von</strong> Byzantern<br />
Und Lilientalern schwer.<br />
Zeuch ab, mein schlanker Magnus,<br />
Und schweig <strong>von</strong> deiner Kunst!<br />
Wir haben dich gewogen ...<br />
Was wiegt eine Handvoll Dunst?" (111,93)<br />
Die 'vermarktete' Welt mißt mit dem ihr eigenen Maß - sie wiegt.<br />
Sie wiegt den Sänger/Dichter und meint damit seine Kunst zu<br />
wiegen. Im Re<strong>im</strong>zusammenfall <strong>von</strong> "Kunst" und "Dunst" werden Werte<br />
kombiniert, mit deren Hilfe man das Schweigen des Dichters<br />
fordern kann. <strong>Scheffel</strong> selbst wird dieses Schweigen später als<br />
selbstgewählte Entscheidung ausgeben. Die Bedrohung des machtlosen<br />
Sänger-Dichters Magnus schlägt jedoch um in eine pathetische<br />
Geste, eine Vision, man könne die feindliche Welt "in<br />
Maulwurfsweise" (111,94-) unterlaufen. Der Tag der Abrechnung<br />
i s t für Magnus nicht mehr fern.<br />
"Wer mich nicht kannte, lernt mich heut noch kennen,<br />
.. Das Jagdwams fällt, in Stahl starrt Mann und Roß ..<br />
Ein Landgewalt'ger w i l l den Platz berennen,<br />
Ich bin sein Dienstmann und sein Kampfgenoß!" (111,94)<br />
Das Aushöhlen und Unterlaufen bürgerlicher Lebensstrukturen
82<br />
und Marktmechanismen durch die grandiose Drohung mit den Formeln<br />
vorstaatlicher Gewaltanwendung trägt indes nicht mehr.<br />
Die zweite Möglichkeit, den eigenen Dichteranspruch auf die<br />
Wirklichkeit zu beziehen, gewinnt <strong>Scheffel</strong> in Anlehnung an das<br />
Vorbild Schillers. Dieser Rückgriff gerade auf Schiller mutet<br />
auf den ersten Blick merkwürdig an, scheint er doch ein nicht<br />
mehr tragbares klassizistisches Dichtungsverständnis in die<br />
o<br />
Gegenwart zu transportieren . Doch <strong>Scheffel</strong>s persönlich formul<br />
i e r t e Erfahrung,<br />
"daß dieselbe Welt, die vor Schillerenthusiasmus fast<br />
närrisch war, noch <strong>im</strong>mer den Künstler nicht als einen sicher<br />
in ihr fußenden Mann betrachtet" (10),<br />
kommt der historische Zufall der so prächtig begangenen Jahrhundertfeier<br />
<strong>von</strong> Schillers Geburtstag 1859 zu Hilfe. An dieser<br />
Diskrepanz <strong>von</strong> pathetisch gefeierter Dichterhuldigung und dem<br />
Unverständnis gegenüber den Zeitgenossen reflektiert <strong>Scheffel</strong><br />
die<br />
eigene Literatenrolle:<br />
"Von Schillerfeiern weiß ich Nichts, da ich den Zweckessen,<br />
Dilettantenmusiken u. Vorträgen gelehrter Philister über<br />
das Undefinirbare einer Dichtersprache nicht Freund bin u.<br />
zu gut weiß, daß trotz alles ästhetischen Enthusiasmus die<br />
Nation heute noch wie ehedem ihre Künstler <strong>im</strong> Dreck stecken<br />
läßt, wenn sie nicht zufällig aus eigener Kraft sich durchgeschunden<br />
zur Geltung - oder - tod sind." (11)<br />
In dieser Mißachtung der sozialen Stellung des <strong>Dichterberuf</strong>s<br />
macht<br />
<strong>Scheffel</strong><br />
"die bittere Erfahrung, daß trotz allen Schillerfesten und<br />
SchillerStiftungen, trotz allem schönen Gerede und Schwärmen<br />
für die Kunst, der Künstler selber in Deutschland <strong>im</strong>mer noch<br />
zu den Leuten <strong>von</strong> verdächtiger sozialer Position geordnet<br />
wird." (12)<br />
Aus dieser verachteten sozialen Position kann der Dichter aber<br />
auch eine Stellung außerhalb realer Standesbeschränkungen ableiten.<br />
Diese 'freie' Stellung verschafft ihm dann Privilegien,<br />
die gesellschaftliche und poetische Folgen zugleich haben:<br />
"Der Poet hat a l l e r l e i Vorrechte, die sich andere Leute<br />
nicht herausnehmen dürfen: er redet Kaiser und Könige mit<br />
Du an, und man n<strong>im</strong>mt's ihm nicht übel." (13)<br />
Auch bei <strong>Scheffel</strong> liegt der Verdacht nahe, daß der Dichter seinen<br />
Beruf nicht nur um des Dichtens willen, sondern ganz be-
83<br />
wüßt auch als einen gesellschaftlichen Stand ann<strong>im</strong>mt. Dieser<br />
Beruf i s t dann allerdings keine Folge seiner poetischen Produktion<br />
mehr; er wird jetzt vielmehr die Voraussetzung für diese.<br />
Ein Dichter kann dann auch sein, wer nichts produziert als<br />
seine eigene Dichterpersönlichkeit:<br />
"Meine richtige Position bleibt vorerst die, durch eigene<br />
Arbeit künstlerisch an meiner eignen Vollendung thätig zu<br />
sein. Vielleicht kommt Etwas <strong>im</strong> Schlaf." (14-)<br />
Die eigene Person geht schließlich <strong>im</strong> Selbstbewußtsein des <strong>Dichterberuf</strong>s<br />
auf, weil (noch nicht vorhandene) dichterische Produktion<br />
und Poesieanspruch identisch werden. So fordert der<br />
29jährige(!) <strong>Scheffel</strong> in seinem Testament:<br />
"Auf den Ort, wo ich begraben werde, s o l l man, wenn's in<br />
welschen Landen i s t , einen einfachen Stein mit der Inschrift<br />
Josefus Victor <strong>Scheffel</strong>, poeta, setzen." (1$)<br />
Auf diese Weise sorgt der noch unbekannte Dichter schon für<br />
seinen eigenen poetischen Nachruhm vor. Noch der alte <strong>Scheffel</strong><br />
unterschreibt als längst berühmter Dichter 1884- einen zwar<br />
läppischen, aber eben gere<strong>im</strong>ten Geburtstagsspruch mit voller<br />
Berufsbezeichnung als "Gemeindepoet" (IX,237). Seinem Dichterkollegen<br />
Paul Heyse, auch er ja <strong>im</strong> Bewußtsein dichterischer<br />
Bedeutsamkeit, konnte <strong>Scheffel</strong> schon sehr früh offen gestehen,<br />
wie identisch ihm <strong>Dichterberuf</strong> und Selbstbewußtsein sind:<br />
"- denn <strong>im</strong> innersten Herzen s i t z t mir die Kunst u. nur die<br />
Kunst u. die wirft Bücher u. Folianten u. Gelehrsamkeit u.<br />
allen Plunder epigonischer Zeiten fröhlich zur Kammer hinaus<br />
u. ruft 'Hurrah, ich bin, weil ich bin!'" 16)<br />
Damit, so könnte man sagen, reagiert <strong>Scheffel</strong> auf eigene Weise<br />
auf das Cogito, e./igo tum des Descartes.<br />
Für den Verfasser des ersten Nachrufes 1886 war dann offens<br />
i c h t l i c h , daß der verstorbene Dichter <strong>im</strong> Gegensatz zu vielen<br />
anderen Schriftstellern der Zeit ein recht poetisches Verhältnis<br />
zur Wirklichkeit hatte:<br />
"Er war kein Honorarverdiener, kein Zeilenschreiber, ihm war<br />
die Muse keine Milchkuh, die ihn mit Butter versorgte, wie<br />
sie so manche unsrer jetzt lebenden Dichte./i auffassen, er<br />
sprach nur, wenn der Geist in ihm ihn reden trieb." (17)<br />
Einem so handfesten Umgang mit der Poesie als einer "Milchkuh"<br />
hatte sich nicht nur <strong>Scheffel</strong> verweigert. Auch Wilhelm Büschs
SA<br />
Balduin Bähiam (1887) i s t dabei als satirisch gegebene Hintergrundsfigur<br />
zu denken, dessen Dichtversuche nicht bloß an der<br />
Wirklichkeit leiden, sondern handgreiflich scheitern. <strong>Scheffel</strong><br />
selbst i s t , wie "nur wenig Auserwählten", "die Kunst wahres<br />
1 8<br />
Herzensbedürfnis" . Dieses "Herzensbedürfnis" i s t f r e i l i c h fest<br />
<strong>im</strong> Leben angesiedelt. Schon die Zueignung des 7/iompe.£e./i hatte<br />
die eigene Kunst gegen die der Zeitgenossen abgesetzt und dort<br />
das Lebensferne und Leblose dieser Dichtung k r i t i s i e r t , während<br />
sie für sich Best<strong>im</strong>mungen wie "rotwangig", "lerchenfröhlich und<br />
gesund" (1,6) in Anspruch nahm. Auch seine Arbeit am Lkkeka/id<br />
kann <strong>Scheffel</strong> auf die Telegrammformel bringen: "Ekkehard wird<br />
1 9<br />
gesund und kräftig mit ächter Alpenpoesie zu End geführt" .<br />
Solchen Vorstellungen <strong>von</strong> echter, kräftiger und lebensvoller<br />
Dichtung läuft natürlich die Ablehnung <strong>von</strong> Planung, Flegelhaftigkeit<br />
und Rationalität parallel. Schon für den 7/lompate/i proklamiert<br />
<strong>Scheffel</strong> das Wachsen des Gedichts statt des Baus auf Grund<br />
gelehrter Studien (1,4-). In diesem Sinn g i l t auch jede K r i t i k<br />
nur dann als ernstzunehmendes Urteil, wenn es dem eigenen Erleben<br />
entspricht:<br />
"Was an Lob und Tadel bemerkt wird, läßt mich sehr ruhig, da<br />
ich nichts Neues daraus erfahre und übel berathen wäre, wenn<br />
ich mich nach Einfällen anderer, die ebenso subjektiv sind<br />
wie meine eigenen, ängstlich richten wollte." (20)<br />
Aber bald gerät <strong>Scheffel</strong> in Widerspruch zu seinen subjektiven<br />
Behauptungen durch seine tatsächliche Arbeitsweise. Die früher<br />
abgelehnte 'objektive' Wissenschaft .als unpoetische Rationalität<br />
dient ihm jetzt zum Aufbau einer Synthese <strong>von</strong> Wissenschaft und<br />
Kunst:<br />
"denn Wissenschaft und Kunst sind in gewissem Sinn eint,<br />
beide sind geistige. Tat, befriedigendes Leben, und ich würde<br />
streben, entweder in der Wissenschaft künstlerisch oder in<br />
der Kunst wissenschaftlich, d. h. den ewigen Grundsätzen des<br />
Schönen zu wirken." (21)<br />
Wirklichkeit dringt dabei insofern in <strong>Scheffel</strong>s Dichtungen ein,<br />
als die Wissenschaft der Gegenwart selbst zum Gegenstand des<br />
Di cht f.- s werden kann. In seinen vor 1850 entstandenen und die<br />
Philosophie parodierenden Studentengedichten (IX,69-73) benutzt<br />
<strong>Scheffel</strong> diese Wissenschaft als zitierbares Material. Abstrahierte<br />
Begriffe aus der idealistischen Philosophie werden in
8$<br />
Allegorien gekleidet und in AlltagsVokabular einmontiert. Die<br />
dadurch erzeugten komischen Effekte relativieren nicht nur den<br />
zeitgenössischen Wissenschaftsjargon; <strong>im</strong> Gedicht "Elegie" (IX,71)<br />
bildet <strong>Scheffel</strong> mit dieser Mischung aus absolut gesetzten Begrifflichkeiten<br />
und der Umgangssprache eine eigene Sprachschicht.<br />
22<br />
Beide Ebenen verfremden sich gegenseitig . In gleicher Sprachmanier<br />
bietet sich aber auch die humorvolle Gegenposition an,<br />
der Versuch nämlich, der verkünstelten Rationalität eine pr<strong>im</strong>itive<br />
Aktivität in der Wirklichkeit entgegenzusetzen. Der Säufer<br />
s t e l l t seine Wirtshausbesuche als Mittel gegen die Schlechtigkeit<br />
der Zeiten hin. Durch die Mischung zweier Sprechebenen<br />
wird der banale Akt des Rausches überhöht:<br />
"Dies erwägend lenkt der Denker<br />
Seine Schritte stumm zur Schenke,<br />
Und ertrinkt <strong>im</strong> trüben Pathos<br />
Ob der Zeit chaot'schem W<strong>im</strong>meln.<br />
Und begrifflich säuft er weiter,<br />
Und wenn er <strong>im</strong> schiefen Gang dann<br />
Basislos und krumm herumwankt,<br />
Spiegelt sich in ihm das Weltall!" (IX,71)<br />
Saufpoesie - so verstanden - reagiert als Wirklichkeit auf übertriebene<br />
Sprachabstraktionen. Als Gegenbeispiel dieser Tendenz<br />
kann das Tischlied zur Philologen- und Schulmännerversammlung<br />
<strong>von</strong> 186$ in Heidelberg dienen. Unter gewaltigem Aufwand an angesammelten<br />
Sprachformeln berichtet ein sprechendes Faß über die<br />
Trinkgewohnheiten aller Zeiten als "Kultur- und Sprachgeschichte"<br />
(IV,60). Nutzlose Wissenschaftsbruchstücke werden hier <strong>von</strong><br />
<strong>Scheffel</strong> zur Legit<strong>im</strong>ation seines Wirklichkeitsanspruchs <strong>von</strong><br />
Poesie aufgewendet: das Faß "dekliniert sich selbst" in gotisch<br />
und althochdeutsch (IV,62)! Der Zweck des Gedichts rechtfertigt<br />
sich in der Selbstbestätigung des Dichters: "... Ich b i t t 1 nur<br />
um die Note gut / In Sp/iache und Geschichte." (IV,63).<br />
In beiden Möglichkeiten, die eigene Realität in das Gedicht<br />
einzulassen, liegt schon der Grenzbereich eingeschlossen, in<br />
dem die Realität als Dichtung erlebt, wie diese rezeipiert und<br />
sogar durch sie ersetzt werden kann. So wie <strong>Scheffel</strong> nach 184-8<br />
an seinen Jugendfreund Schwanitz schreibt, er habe den Glauben<br />
2 3<br />
an "die Poesie der Revolution verloren" , so i<br />
Romantik als Kunst- und Lebensprinzip zugleich<br />
n<br />
m<br />
auch die<br />
+<br />
* Man hat mit
86<br />
einigem Recht auf die "Fragwürdigkeit einer aufs Literarische<br />
schielenden Lebensbewältigung" hingewiesen, wenn die Poesie zum<br />
p r<br />
"Lebenssurrogat" verkomme . Uberträgt man nämlich diese poetische<br />
Betrachtungsweise auf die Beurteilung der Realität, so entsteht<br />
eine Pose realen Nachvollzugs poetischer Erfahrungen. Wie<br />
Goethe und die Romantiker hat auch <strong>Scheffel</strong> sein Italienerlebnis:<br />
"Welschland hat den großen Reiz, daß man ?.e.(Le.n lernt, [. . .J<br />
2 6<br />
- und daß man daß Denken dabei nicht vergißt." Freilich i s t<br />
diese angebliche Lebenserfahrung nur ein reproduziertes Kunsterlebnis.<br />
In der Folge sind Realitätserfahrung und Kunstverständnis<br />
überhaupt nicht mehr zu trennen.<br />
Bei seinen historischen Romanstudien versetzt sich <strong>Scheffel</strong><br />
nicht etwa in die Vergangenheit, sondern lebt in ihr: "Ich habe<br />
indeß wieder ganz in den Tiefen des Xten und sodann des X l l l t e n<br />
27<br />
Jahrhunderts gelebt" . Das Eintauchen ins Erlebnis der Quellen<br />
führt be<strong>im</strong> älteren <strong>Scheffel</strong> zwar zur inneren Ruhe, aber nicht<br />
mehr zum Dichten. So schreibt er 1866 dem Mitdichter Paul Heyse:<br />
"Bei mir i s t ziemlich s t i l l e . Ich habe die Poesie <strong>im</strong> Erlebnis<br />
2 8<br />
gesucht statt in der Production"<br />
Dahinter steckt die Durchschlagskraft einer Wirklichkeitserfahrung,<br />
der die poetische Rolle nicht mehr gewachsen i s t . <strong>Scheffel</strong>s<br />
lebenslanger Traum "<strong>von</strong> real einfachem Leben" (1,13) wäre<br />
nun höchstens biographisch interessant, wenn sich in seiner Verwirklichung<br />
nicht literarische Mechanismen abzeichneten. Die<br />
Erkenntnis,<br />
"daß Einsamkeit nur eine Schule fürs Leben i s t , nicht das<br />
Leben selbst, und daß wertlos verderben muß, wer in der<br />
gr<strong>im</strong>men Welt <strong>im</strong>merdar nur müßig in sich hineinschauen w i l l , "<br />
diese Erkenntnis g i l t für Ekkehard (VI, 4-24-) » aber nicht für<br />
<strong>Scheffel</strong>. So wie Ekkehards Dichtrruhm erst beginnt, als er<br />
schon längst zu dichten aufgehört hat (VI,4-26f), so ergeht es<br />
auch <strong>Scheffel</strong>. Daß sein eigentliches Lebensziel <strong>im</strong>mer schon ein<br />
anderes als das poetische gewesen i s t , gibt <strong>Scheffel</strong> in einem<br />
Brief an seinem Geburtstag(!) 1863 preis:<br />
"Wenn ich mein Leben f r e i gestalten könnte, würde ich ein<br />
abgeschiedenes Häuslein <strong>im</strong> Gebirge oder an einem See bewohnen,<br />
und die Städte nur ausnahmsweise betreten." (29)<br />
Dieses Ziel verwirklicht <strong>Scheffel</strong> in Radolfszell. "Hier in
87<br />
Radolfszell war er alles: Landwirt, Weinbergbesitzer, Jäger und<br />
30<br />
Fischer, nur nicht Dichter" . Der Besuch Herbert <strong>von</strong> Bismarcks,<br />
des Sohn des Reichskanzlers, g i l t dem Gutsbesitzer <strong>Scheffel</strong> und<br />
31<br />
setzt der Radolfszeller Einsiedelei noch 1877 Glanzlichter auf .<br />
Für die Dichtung bleibt <strong>Scheffel</strong> wenig Zeit; sie wird <strong>von</strong> anderen<br />
Dingen, so z. B. der Schaffung <strong>von</strong> materiellen Sicherheiten<br />
für seinen Sohn überlagert:<br />
"Meine Arbeit der letzten Jahre, dem freudig heranblühenden<br />
Sohn einen künftigen Besitz herzurichten, der wenigstens<br />
zeitweise dem Leben frische Luft zuführt, i s t darum der<br />
Kunst nicht zustatten gekommen, wenn sie auch guten Erfolg<br />
hatte." (32)<br />
Der Bauer <strong>Scheffel</strong> merkt allmählich, daß es mit seiner Dichtkunst<br />
nicht mehr weit her i s t :<br />
"Die Ehren der Welt haben keinen großen Eindruck gemacht, <strong>im</strong><br />
rauhen Getrieb des realen Lebens, das ich durch Ansiedelung<br />
am Untersee und ungesegneten Betrieb <strong>von</strong> Weinbau und Landwirtschaft<br />
bös kennen lernte, nehmen auch die Musen keine<br />
dauernde He<strong>im</strong>statt mehr und so merke ich allmälig, daß der<br />
Zenith lang schon überschritten i s t und v i e l Gutes kaum mehr<br />
nachfolgen wird." (33)<br />
Schon zwei Jahrzehnte früher hatte er erkannt: "Aber zu einem<br />
gesunden Leben scheint die Poesie keine tägliche Nothwendigkeit<br />
3Z.<br />
zu sein" . Das war nach dem Abschluß der T/tau Avantiu/ie. geschrieben<br />
und <strong>Scheffel</strong>s Musen haben sich daran gehalten. Die<br />
Poesie i s t nicht nur "keine tägliche Nothwendigkeit" mehr,<br />
sondern die Musen kehren überhaupt nicht mehr bei ihm ein.<br />
Die darin vorweggenommenen Einsiedelei-Gedanken, die <strong>Scheffel</strong><br />
als Gutsherr unter den Radolfszeller Bauern auslebt, kann man<br />
3 5<br />
natürlich als eine Form der Wirklichkeitsflucht deuten . Aber<br />
so einfach i s t das poetische Bewußtsein nicht zu verdrängen.<br />
<strong>Scheffel</strong>s Briefe, in denen sonst <strong>im</strong>mer über die Dichterstellung<br />
in der Welt reflektiert worden war, werden in dieser Zeit zu<br />
Küchenzetteln, in denen sich die Auseinandersetzung mit der<br />
Umwelt auf banalste Weise abspielt: "Es steht Alles gut u. aussichtsreich.<br />
Ich schikke nächstens 2 Sakk Kartoffeln."<br />
Doch als Dichter w i l l sich <strong>Scheffel</strong> noch <strong>im</strong>mer betrachtet wissen.<br />
Die Dingwelt habe nur, so behauptet er, "der dichterischen<br />
37<br />
St<strong>im</strong>mung zur Zeit/!/ ein Bein gestellt" . Dabei w i l l <strong>Scheffel</strong><br />
nicht wahrhaben, daß seine Poesie zunächst <strong>von</strong> Privatem über-
88<br />
lagert wird und damit ihren Öffentlichkeitscharakter vollständig<br />
verliert. Insofern i s t es kaum noch ironisch zu verstehen, was<br />
der Kater Hiddigeigei <strong>im</strong> 7/iompete/i eins prophezeiht hatte:<br />
"Seinen Hausbedarf an Liedern<br />
Schafft ein jeder selbst sich-heute." (1,150)<br />
Abgeleitet i s t diese Ansicht übrigens aus dem Vormärz-Liberalismus,<br />
wie <strong>Scheffel</strong> über seine eigenen dichterischen Versuche<br />
an seinen Studienfreund Eggers schon 1845 bekennt:<br />
"Die traurige Wahrheit, <strong>von</strong> der Gervin/=Gervinus_7 <strong>im</strong> letzten<br />
Semester sprach, daß es leider in unserer Zeit mit der Poesie<br />
so weit gekommen, daß jeder sich seinen riausieda/if daran<br />
selber schaffe, hat sich auch an mir erprobt." (38)<br />
Vor 1848 mag das noch wenig ernst gemeint sein. Sicherlich toternst<br />
meint es <strong>Scheffel</strong> in seinem Testament vom 24. März 1857,<br />
in dem er sich zu einer möglichen Veröffentlichung seines<br />
dichterischen Nachlasses äußert: "keine Gedichte; - es i s t ein<br />
3 grt<br />
Unsinn, solche zu machen - anders als zum Hausgebrauch" .<br />
Dichtung, so i s t zu schließen, hält der Wirklichkeit nicht<br />
stand, wenn sie sich mit dem ureigensten Poetischen begnügt.<br />
Erst wenn das Dichterische in die Nähe des Alltäglichen rückt,<br />
erhält es eine neue Qualität:<br />
"Nur ein würz'ger Bratenduft noch<br />
Schwebte l i e b l i c h durch die Stube,<br />
Gleich dem Liede, drin der tote<br />
Sänger bei der Nachwelt fortlebt." (I,16)<br />
Die Nähe des Poetischen zum Kulinarischen bleibt kein Einzelfall.Gültig<br />
i s t beides noch <strong>im</strong> Vergleich mit dem bewahrten<br />
Eigenwert des jeweils anderen. Zu einem seiner Gedankensprüche<br />
verkürzt s t e l l t <strong>Scheffel</strong> sogar die völlige Identität her, wenn<br />
er die Hausfrauen<br />
ermahnt:<br />
"Ein gut Gericht<br />
Ist auch ein Gedicht!" (IX,252)<br />
In dem Liedern des Vogt <strong>von</strong> Tenneberg (111,48-50) hat <strong>Scheffel</strong><br />
diese Tendenz zum Verbauern des Poesiebewußtseins ironisch dargestellt.<br />
Die sonderbare Kauzgestalt des Vogt <strong>von</strong> Tenneberg<br />
hat zwar alle offensichtlichen Attribute des Dichters abgelegt,<br />
bleibt aber mit der Dichterrolle des lyrischen Ichs verknüpft:
89<br />
"Ich bin der Vogt <strong>von</strong> Tenneberg,<br />
Den Minne nie befangen,<br />
Im Lindenwipfel streck ich mich<br />
Und laß die Beine hangen." (111,48)<br />
Die kompromißlose Weiberfeindschaft, die den Tenneberger mit<br />
<strong>Scheffel</strong> verbindet, wird jetzt ebenso wie die Ich-Rolle und<br />
das Präsens aufgegeben. Der Vogt hat sich mittlerweile in<br />
einer ganz anderen Form niedergelassen:<br />
"Das war der Vogt <strong>von</strong> Tenneberg,<br />
Den Liebe nie umfangen.<br />
Mit Weib und Kind selbsiebent kommt<br />
Vergnügt er jetzt gegangen." (111,49)<br />
Er muß jetzt seine Kinder hüten statt zu singen; wo einst seine<br />
baumelnden Beine hingen, hängen jetzt Windeln:<br />
"Im Lindengrün zum Trocknen jetzt<br />
Gewaschne Windeln hangen" (111,49).<br />
Von den Rückständen des Poetischen <strong>im</strong> Tenneberger i s t mittlerweile<br />
nichts mehr geblieben als ein Wiegenlied-Singen:<br />
"Und s t i l l e ward es, mäusleinstill<br />
Im Wipfel und am Stamme.<br />
Er singt nur, wenn der Dienst es w i l l<br />
Zur Ablösung der Amme:<br />
'Wigen wagen, gugen gagen,<br />
Ach mir tagen sanfte Plagen,<br />
Schreier, Schreier, kleiner Schreier, schweig,<br />
ich w i l l ja gern dich wagen! 1 " (111,50)<br />
Im 'Wagnis' des Kinderwiegens und Wiegenlied-Singens r e l a t i <br />
viert sich auch die heroische Haltung des poetischen Weiberfeinds.<br />
Aus dem ironisch gesehenen Unbehausten wird der behäbige<br />
Familienvater.<br />
Genauso, nur ernster ins Repräsentative und Endgültige s t i l i <br />
siert <strong>Scheffel</strong> sein eigenes Häuslichwerden:<br />
"Selbstverständlich kehren auch die Musen bei einem Mann,<br />
der um Markt- und Holzpreise Sorge zu tragen hat, nicht mehr<br />
v i e l ein; seit 3 Jahren ruht meine Dichtung und die Feder<br />
revidirt Rechnungen. Alles Schl<strong>im</strong>me trägt aber einen Ke<strong>im</strong><br />
des Guten in sich, und wie ich lächle, wenn <strong>im</strong> Garten die<br />
Rosen erfrieren und der Kohl gedeiht, so muthet es mich<br />
seltsam an, daß bei dieser poesielosen Wirthschaft die Verhältnisse<br />
vorwärts gehen und mir <strong>im</strong> vorigen Jahr gestattet<br />
haben ein kleines Grundstück am Bodensee zu erwerben, auf<br />
dem ich - zu stillem Studiren und Schaffen - ein bescheidenes<br />
Landhäuslein zu bauen gedenke. Da die Tage sich folgen
90<br />
aber sich nicht gleichen, hoffe ich dort in Ruhe und Weltabgeschiedenheit<br />
mich <strong>von</strong> den schweren Eindrücken dieser letzten<br />
3 Jahre an leichtem Spiel dichterischer Gedanken zu erholen.<br />
In die große Welt tauge ich nicht mehr. (39)<br />
In dieser zentralen Stelle werden die Versuche, zwischen dichterischer<br />
Rolle und der Durchschlagskraft der Dingwelt zu vermitteln,<br />
so recht deutlich. Im Bild vom Gedeihen des Kohls be<strong>im</strong><br />
Erfrieren der Rosen akzeptiert <strong>Scheffel</strong> seinen Rückzug aus der<br />
Poesie, allerdings nicht ohne Vorbehalt. Ist doch gerade der<br />
Rückzug in die Idylle dadurch motiviert, einen ungestörten Ort<br />
zum Dichten zu finden! Die Formulierung vom "Studiren und<br />
Schaffen" wird zur flugs als A l i b i eingestreuten Floskel (in<br />
Gedankenstrichen!). Doch verrät das Adjektiv ( " s t i l l " ) sich<br />
selbst als das, was es i s t : ein Nicht-Dichten. Die ehemaligen<br />
Dämonen der Poesie sind längst zum "leichten Spiel dichterischer<br />
Gedanken" geworden; sie haben mit dem ehemaligen Dichter leichtes<br />
Spiel. Insofern i s t der Widerspruch also erklärbar, wenn<br />
auch nicht auflösbar.<br />
Der alternde <strong>Scheffel</strong> gibt sich über den Wert seiner Festbeiträge<br />
und Huldigungsgedichte allerdings noch der Illusion hin,<br />
er könne sein Dichtertum dort wieder aufnehmen, wo er es liegengelassen<br />
habe. Um ein <strong>von</strong> ihm früher geprägtes Bild abzuwandeln:<br />
für <strong>Scheffel</strong> heißt es, den besoffenen Pegasus noch einmal zu<br />
satteln:<br />
"daß, nachdem ich so lange <strong>im</strong> Kampf mit widrigen Verhältnissen<br />
und der ökonomischen Wucht des Lebens als Dichter brach gelegen,<br />
jetzt f l o t t und f r e i das Roß Pegasus mit goldenen<br />
Schwingen wieder Einkehr hält be<strong>im</strong> alten Meister." (4-0)<br />
Daß das Verstummen der Poesie nicht auf die juristischen Schwierigkeiten<br />
<strong>Scheffel</strong>s mit seinen Nachbarn um die Fischereirechte<br />
oder auf die "ökonomische Wucht des Lebens" a l l e i n zurückgeht,<br />
sondern einen Teil seines Dichtens ausmacht, läßt sich schon<br />
an einem Brief des jungen <strong>Scheffel</strong> an seine Schwester belegen:<br />
"Mit Worten sing ich keine Lieder mehr. Wenn die Nachtigall<br />
blind wird, hat das Singen ein End; und wenn der Mensch mit<br />
Spitzbuben und schlechten Bauern stabhaltend das Dasein abwickelt<br />
und zwischen beiden Polen, Amtshaus und Wirtshaus,<br />
sich bewegt, so hat das Singen gleichfalls ein End." (4-1)<br />
Schon <strong>im</strong> 7/iompe.te/i hatte der Verfasser der Zueignung eine Neigung<br />
verspürt, "die Feder samt dem / Tintenfaß an die Wand zu
91<br />
werfen" (1,5). Doch damals bedurfte er der Poesie noch. Jetzt<br />
aber glaubt er zu erkennen, "daß Alles Irdische u. auch die<br />
Poesie, der schönste Sch<strong>im</strong>mer, nichtig i s t " ^ . Erst <strong>im</strong> Alter<br />
kann die Kunst wieder als Trösterin gegen die Drangsale der<br />
Wirklichkeit eingesetzt werden: "Vielleicht tröstet die Kunst!"^<br />
3. <strong>Scheffel</strong> - ein Realist?<br />
Ist <strong>Scheffel</strong> also ein Dichter des Realismus? Etliche Beobachtungen<br />
scheinen dafür zu sprechen. Im Lk.ke.ka/id beispielsweise<br />
hat der geschichtliche Stoff eine Funktion übernommen, wie sie<br />
der realistischen Programmatik entspricht:<br />
"In allen Gebieten schlägt die Erkenntnis durch, wie unsägl<br />
i c h unser Denken und Empfinden unter der Herrschaft der<br />
Abstraktion und der Phrase geschädigt worden; da und dort<br />
Rüstung zur Umkehr aus dem Abgezogenen, Blassen, B e g r i f f l i <br />
chen zum Konkreten, Farbigen, Sinnlichen, statt müßiger<br />
Selbstbeschauung des Geistes Beziehung auf Leben und Gegenwart,<br />
statt Formeln und Schablonen naturgeschichtliche Analyse,<br />
statt der Kritik schöpferische Produktion" (V,7).<br />
Einer der entschiedensten Programmatiker des Realismus, Gustav<br />
Freytag, hat dies erkannt^.<br />
Zum zweiten könnte man sich auf <strong>Scheffel</strong> selbst berufen, der sich<br />
für seinen Ekkeha/id ein scheinbar sehr handfestes realistisches<br />
Erzählprinzip<br />
zurechtgelegt hat:<br />
"ich gedenke aus jener rohen, werdenden, starken deutschen<br />
Zeit ein paar Bursche herauszufischen, die sich ganz natürl<br />
i c h und wohlconservirt ausnehmen sollen. Romantik wird<br />
jedenfalls nicht getrieben, dafür i s t mein gegenwärtiges<br />
Leben in der Atmosphäre des Kuhstalls Garantie." (45)<br />
Die Ablehnung der Romantik durch <strong>Scheffel</strong> entspricht ja sowohl<br />
den LiteraturvorStellungen der Jungdeutschen als auch denen des<br />
programmatischen Realismus. Umso erstaunlicher i s t es, daß<br />
gerade Theodor Fontane, dessen Programmschrift Unse/ie ly/iische<br />
und epische Poesie seit 7 84 8 ein Jahr vor dem zitierten <strong>Scheffel</strong>brief<br />
erschienen i s t , bei seinem Lob des Lkke.hu/id an <strong>Scheffel</strong><br />
eben dieses Romantische k r i t i s i e r t : "An einigen Stellen romant<br />
i s i e r t <strong>Scheffel</strong> mehr, als mir wünschenswert erscheint"^.<br />
An Begriff und Funktion des epischen Humors kann einleuchtend<br />
gezeigt werden, inwieweit <strong>Scheffel</strong>s literargeschichtliche Po-
92<br />
sition vom Realismus als einer Epochenbezeichnung abweicht,<br />
ohne sich auf Hilfsbegriffe - etwa /lomantische./i Realismus -<br />
zurückziehen zu müssen, die mehr verschleiern als erklären. Für<br />
den Poetischen Realismus i s t gezeigt worden, welch zentrale<br />
Funktion dem epischen Humor als einer Denk- und zugleich Erzähl-<br />
4.7<br />
kategorie zukommt^ . Auch <strong>Scheffel</strong> betrachtet ja einen spezifischen<br />
Humor als Gütezeichen seines Werkes und als eine der<br />
Wurzeln seines Schaffens. <strong>Scheffel</strong> hat den Urgrund seines Humors<br />
aus einer Melancholie abgeleitet, die aus seiner Reaktion auf<br />
die politischen Verhältnisse nach 184-8 herrühren s o l l :<br />
"Das Anschauen und Selbsterleben vieler schiefer und confuser<br />
Verhältnisse <strong>im</strong> öffentlichen und Privatleben, an denen seit<br />
184-8 unser Vaterland so reich i s t , gaben dieser Poesie eine<br />
ironische Be<strong>im</strong>ischung, und die Komik i s t eine umgekehrte<br />
Form innerer Melancholie." (4.8)<br />
Auffällig i s t zunächst, daß <strong>Scheffel</strong> zwischen Ironie und Komik<br />
genau unterscheidet (und-Beiordnung!) und gleichzeitig seine<br />
Komik als eine. Form der Melancholie ausgibt. Schon mit dieser<br />
Begriffsbest<strong>im</strong>mung i s t offensichtlich, wie wenig <strong>Scheffel</strong>s<br />
Humor - den Begriff selbst unterschlägt er an dieser Stelle<br />
nicht zufällig - mit dem Humor des Poetischen Realismus, etwa<br />
bei Gottfried Keller, zu tun hat. Als politisch ausgelöste<br />
Stilhaltung, nicht als realistisches Erzählprinzip dient der<br />
Humor <strong>Scheffel</strong>s vor allem dazu, geschichtliche Ereignisse mit<br />
der Gegenwart zu kontrastieren.<br />
Im Lkkeka/id z. B. unterlegt der Erzähler einem Vogel menschliche<br />
Empfindungen. Aber erst in der Parallelisierung dieses<br />
an sich unbedeutenden Details mit der Haupthandlung - ein<br />
'Realist' würde dergleichen nicht einführen - ergibt sich der<br />
humoristische<br />
Eindruck:<br />
"Der Star war aber tiefer gebildet. Er konnte außer dem gere<strong>im</strong>ten<br />
Klingklang auch das Vaterunser hersagen. Der Star<br />
war auch hartnäckig und konnte seine Grillen haben, so gut<br />
wie eine Herzogin in Schwaben." (V,17)<br />
Man hat auf die Doppelgesichtigkeit dieser Erzähltechnik und<br />
IQ<br />
"den dunklen Hintergrund" dieses Humors hingewiesen^" . Freilich<br />
genügt es nicht, die Verharmlosung dieses Humors in "ein<br />
schmunzelndes Behagen am Philistertum" zu konstatieren^. Der<br />
melancholische Hintergrund, auf dem die humorige Wirkung auf-
93<br />
s i t z t , macht diesen Mechanismus auch erzähltechnisch zwiespältig.<br />
So empfand <strong>Scheffel</strong> selbst einerseits "eine Art historische<br />
Pietät", wenn er versuchte, mit seinen Figuren sein "leicht-<br />
51<br />
fertiges Spiel zu treiben" . Der humoristische Zugriff scheitert<br />
also an der Seriosität des Stoffes. Andererseits bringt<br />
eben diese humoristische Stilhaltung zu seinem eigenen Erstaunen<br />
erst den humoristischen Dichter <strong>Scheffel</strong> hervor: "- es steckt<br />
noch ein ganz anderer Kerl in mir, ein Humorist, ein ganz mo-<br />
52<br />
derner unterhaltender Gesell" .<br />
Spürt man dem Urgrund dieses Humors nach, bei dem Ernsthaftigkeit<br />
der Themenwahl und humoristische Behandlung in Widerstreit<br />
liegen - anders als <strong>im</strong> Poetischen Realismus! -, dann t r i f f t man<br />
schon bald hinter einer biographisch begründeten "Anlage zur<br />
53<br />
Melancholie" auf ein Strukturprinzip <strong>im</strong> Werk <strong>Scheffel</strong>s. Die<br />
Melancholie bleibt bei ihrem totalen Anspruch als Lebensprinzip<br />
naturgemäß nicht auf eine menschliche Eigenschaft beschränkt.<br />
In seinen Reisebildern spricht <strong>Scheffel</strong> mehrfach <strong>von</strong> der "Melancholie<br />
der Gegend" (VII,60):<br />
"Der Fels starrt ihn an,/". . .] - er verfällt auch aufs Barokke<br />
und treibt Unsinn, steckt seinen Hut auf eine-Stange,<br />
läßt einen Teil seinem Sohn den Apfel vom Kopf schießen -<br />
f. ..] Man nenne das Menlancholie, man nenne es Katzenjammer<br />
- aber man spreche nicht <strong>von</strong> Despotismus oder Tyrannei."<br />
(VII,61)<br />
In der Figur des Landvogts Geßler aus Schillers UHkelm l a l l ,<br />
auf den hier angespielt i s t , bleibt die Melancholie noch <strong>im</strong><br />
Grenzbereich <strong>von</strong> P o l i t i k und Poesie. In einem nächsten Schritt<br />
kann dann die Melancholie sehr weit <strong>von</strong> politischen Ereignissen<br />
abgezogen und sogar auf die unbelebte Natur übertragen werden.<br />
Das zeigt, zwar in sich schon wieder ironisch, die Episode über<br />
einen Felsblock in einer wilden Schlucht:<br />
"Ich bin überzeugt, daß dieselben Ursachen, die den germanischen<br />
Menschen in seiner Teufelsnatur zu Geßlerschen Taten<br />
trieben, auch den Fels in die Tiefe stürzten. Die Melanchol<br />
i e wirkt sehr g e w a l t i g . .J Er seufzt schweigend, löst<br />
sich los <strong>von</strong> seinen Banden und stürzt sich - ein Opfer der<br />
Melancholie - talabwärts, und hat er etwa das Heidekraut<br />
erdrückt, oder sprudelt das Reußwasser nach wie vor höhnisch<br />
an ihm vorüber, so bricht das alte Herz und stirbt." (VII,62)<br />
An der Natur werden menschliche Verhaltensmechanismen ablesbar,<br />
die man nur auf eine erkenntnistheoretisch ernsthafte Ebene zu
94<br />
heben braucht, um sich an Stifters "sanftes Gesetz" in seiner<br />
Vorrede zu den Bunten Ste.ine.n <strong>von</strong> 1853 erinnert zu fühlen.<br />
Freilich liegen <strong>Scheffel</strong> so bewußte Ausdeutungen fern. Ironie<br />
und Selbstironie entsprechen eher der Stillage, in der sich<br />
sein Humor ausprägt. In der Zueignung zum 7nompe.te.n wundert<br />
sich der Wirt Don Pagano über seinen dichtenden Gast. Dieser<br />
kommt ihm als ein "sonderbarer / Kauz und sonderbar sein Handwerk"<br />
vor (1,3). Für den Wirt als poetisch Unverständigen f a l <br />
len Unvernünftigkeit und Nutzlosigkeit, Irrsinn und <strong>Dichterberuf</strong><br />
nicht nur syntaktisch zusammen. Der Erzähler läßt diese Ansicht<br />
nicht nur unwidersprochen, sondern scheint sie sogar<br />
zu<br />
akzeptieren:<br />
"Also sprach er.- Dieser Fremde<br />
War ich selber;" (1,3)<br />
Als Figur, an der sich Ironie und Selbstironie bis zur Parodie<br />
des Dichterstandes brechen, fungiert <strong>im</strong> 7 nompeten. der Kater<br />
Hiddigeigei. Er besitzt nicht nur dichterische Originalität und<br />
ein übersteigertes Selbstwertgefühl als eine "selbstbewußte,<br />
epische Charakterkatze" (1,5). Er dichtet auch als verkörperte<br />
Parodie selber Parodien, in denen die Kritik der zeitgenössischen<br />
Literaturproduktion zum Gegenstand des Dichtens werden<br />
kann. Für das Verständnis der Funktion dieses Katers kann ein<br />
Vergleich mit <strong>Scheffel</strong>s Vorbild und literarischen Parallelgestalten<br />
nützlich sein, man denke an Ludwig Tiecks Den gestiefe.1-<br />
te Katen. (1797), an E.T.A. Hoffmanns Lelensansiahten de.s Katens<br />
flunn (1819/21) und an Gottfried Kellers Spiegel, das Kätzche.n<br />
(1856). Während Hoffmanns Kater Murr mit seinem gescheiterten<br />
Bildungsgang gleichwertig neben den genialisch-romantischen<br />
Musiker Kreisler zu stehen kommt^, dient <strong>Scheffel</strong>s Kater Hiddigeigei<br />
nur als parodistische Kontrastfigur zur Rolle des Dichters<br />
selbst. Die Eigenständigkeit der Katzenfigur, man denke<br />
an Kellers Kätzchen Spiegel, wo die Geschichte ebenfalls um der<br />
Titelgestalt willen erzählt wird, i s t bei <strong>Scheffel</strong> aufgegeben.<br />
Dichter und Kater schleichen einsam auf dem Dach hin und her;<br />
der Kater wertet wie der Dichter die menschliche Dichtung als<br />
Katzenjammer. Hinter der ironischen Tiermaske steigert sich die<br />
Polemik gegen die Menschen insgesamt zu beißender Schärfe.<br />
Enthalten doch die Katerlieder des 7nompeten eine Parodie der
95<br />
menschlichen Welt, deren Eigenheiten nur locker in die Welt der<br />
Katzen transponiert worden s i n d ^ . Auch <strong>Scheffel</strong>s dichtender<br />
Kater schwärmt "für das Wahre und Gute und Schöne" und lernt<br />
"die Welt verachten" (1,1$2); die "Menschheit" g i l t ihm als<br />
ein "harmlos Volk" (1,1$3). Doch <strong>im</strong> Unterschied zum Kater Murr<br />
bleibt Hiddigeigeis Persönlichkeitsstruktur und seine Biographie<br />
außer Betracht. In der Verachtung des Mittelmäßigen und der<br />
Tendenz zum Verstummen i s t <strong>Scheffel</strong>s Position, wenn auch in parodistischer<br />
Verzerrung, aufgenommen (I,156f). In den Liedern<br />
Hiddigeigeis wird das Dichterische so ins Egozentrische gewendet,<br />
daß die Katerfigur hinter der Dichterrolle des Sänger-<br />
Ichs vollständig verschwindet:<br />
"Eigner Sang erfreut den Biedern,<br />
Denn die Kunst ging längst ins Breite,<br />
Seinen Hausbedarf an Liedern<br />
Schafft ein jeder selbst sich heute.<br />
Drum der Dichtung leichte Schwingen<br />
Strebt' auch ich mir anzueignen;<br />
Wer wagt's, den Beruf zum Singen<br />
Einem Kater abzuleugnen?<br />
Und es kommt mich minder teuer,<br />
Als zur Buchhandlung zu laufen<br />
Und der andern matt' Geleier<br />
Fein in Goldschnitt einzukaufen." (1,1$0<br />
Der "Beruf zum Singen" des Katers i s t nirgends ernst gemeint,<br />
wenn er Katzenmusik und Dichtung in einen Topf wirft. Die l y r i <br />
sche Produktion auf sich selbst zu beschränken, für "seinen<br />
Hausgebrauch" zu dichten, entspricht nicht schlecht der Gebrauchspoesie<br />
innerhalb der zeitgenössischen Lyrikproduktion.<br />
Wenn diese Lyrik "ins Breite" geht, so bezieht sie sich als<br />
veröffentlichte Literatur nur noch auf sich selbst: ein beliebig<br />
steigerbares Mengenwachstum t r i t t der Funktionsänderung<br />
der Lyrik als Verbrauchsgegenstand zur Seite. Hiddigeigeis<br />
Spott gegen das "matt' Geleier" und den "Goldschnitt" sucht<br />
eine zweite, wenn man so w i l l konstruktive Seite <strong>im</strong> Katerlied<br />
selbst als Beispiel für neues unverbrauchtes Dichten, das dann<br />
allerdings ein parodistisches und parodierendes sein muß.<br />
An diesem Punkt i s t die Differenz zur realistischen Erzählkunst<br />
ganz offensichtlich. Während etwa in Kellers Spiegel, das<br />
Kätzchen ein "Märchen" in mittlerer Stillage mit gedämpftem
96<br />
Humor um seiner selbst willen "erzählt" wird, t r i t t <strong>Scheffel</strong>s<br />
Kater als Randfigur, stellvertretend für die niedere Stilebene,<br />
aus dem Versepos heraus. Die Rollensprache Hiddigeigeis bleibt<br />
auf Dichterbetrachtungen außerhalb des Handlungsablaufs beschränkt.<br />
Die vorrealistische Stilmischung des 7/iompe.te/i hindert<br />
noch die epische Integration <strong>von</strong> Katerfigur und Dichterbewußtsein<br />
in die erzählte Fiktion.
97<br />
IV. DICHTER UND POLITIK<br />
1. Rhetorik und Mythos. <strong>Scheffel</strong>s politisches Selbstverständnis<br />
<strong>Scheffel</strong>s politische Haltung g i l t den Interpreten gern als eine<br />
für das Verständnis seines Werks nebensächliche Komponente.<br />
<strong>Scheffel</strong>s Beteiligung an der deutschen Revolution <strong>von</strong> 184-8 erscheint<br />
so als ein Mißgriff ohne weitere Folgen, sein verspätetes<br />
Bekenntnis zum Neuen Reich als Korrektur einer jugendlichen<br />
Verirrung. Ist <strong>Scheffel</strong> also ein unpolitischer, d. h. politisch<br />
uninteressierter und <strong>von</strong> den Zeitereignissen unbeeinflußter<br />
Dichter gewesen? Etliche uneindeutige politische Aussagen oder<br />
widersprüchliche Äußerungen mögen zu der Vermutung geführt<br />
haben, <strong>Scheffel</strong> habe die politischen Ereignisse nach 184.8<br />
1<br />
"kühler" als leidenschaftlichere Naturen" verkraftet . Andererseits<br />
hat man <strong>Scheffel</strong>s politisches Engagment mit ein paar Be-<br />
2<br />
griffen festzunageln versucht .<br />
Die politischen Anschauungen des Studenten <strong>Scheffel</strong> <strong>im</strong> Vormärz<br />
hat sein Biograph Proelß zusammengefaßt. Danach war <strong>Scheffel</strong><br />
"Anhänger jener liberalen Partei in Baden, welche damals ohne<br />
revolutionäre Gelüste und auf friedlichem Wege <strong>im</strong> Sinne vernunftgemäßer<br />
Freiheit ein geordnetes Verfassungsleben und<br />
die Wiederherstellung eines nach außen mächtigen deutschen<br />
Reiches" erstrebte." (3)<br />
Die beschönigende Tendenz dieser Deutung aus der Zeit des<br />
Kaiserreichs i s t deutlich. Sie wäre genauso einfach zu widerlegen<br />
durch einen Brief <strong>Scheffel</strong>s an seinen Studienfreund<br />
Friedrich Eggers in Berlin, in dem <strong>Scheffel</strong> einen Vormärzradikalen<br />
empfiehlt, dieser sei "ein durchaus tüchtiger Bursche<br />
und trotz seines Adels auf der äußersten Linken stehend"^".<br />
Geht man indes auf <strong>Scheffel</strong>s erste "journalistisch-politische<br />
Äußerung" in einem Flugblatt vom März 184-8 zurück^, so klärt<br />
sich das Bild etwas. Die Verfasser dieses Blattes wenden sich<br />
<strong>im</strong> Zusammenhang der Paulskirchendiskussion gegen den Plan, dem<br />
König <strong>von</strong> Preußen die Führungsrolle in Deutschland<br />
zuzugestehen.<br />
Vom Absolutismus, der Regierungsform <strong>von</strong> Gottes Gnaden,<br />
spricht <strong>Scheffel</strong> als "<strong>von</strong> einem romantischen Phantom" , bezieht<br />
also seine politische Kritik zurück auf seine Kunstkritik!
98<br />
"Die gerechten und wahrlich nicht unbescheiden vorgetragenen<br />
7<br />
Volkswünsche" scheinen ein demokratisches Prinzip auf den<br />
Schild zu heben, wenn dem preußischen König das Vetorecht gegen<br />
das Nationalparlament abgestritten wird. Die Trennung, die<br />
<strong>Scheffel</strong> zwischen preußischem König und preußischem Volk ("Kein<br />
Deutschland ohne Preußen") macht, weist auf die Struktur seiner<br />
politischen Zielvorstellungen hin: der "Kampf gegen den Absoluo<br />
tismus" bleibt <strong>im</strong> Grunde der 'Romantik' verhaftet, gegen deren<br />
partikularistische Relikte <strong>Scheffel</strong> sich wendet. Noch fallen -<br />
nicht nur in <strong>Scheffel</strong>s jugendlicher Begeisterung - in jenen<br />
Tagen die nationale Einheit und die freiheitlichen Verfassungsvorstellungen<br />
zusammen. Als <strong>Scheffel</strong> in die direkte Nähe des<br />
Geschehens gerät, entsteht bei ihm sofort eine gewisse Skepsis<br />
gegen das Frankfurter Honoratiorenparlament, dessen freiheitlicher<br />
Auftrag <strong>im</strong>mer mehr in ein legalistisches Fahrwasser gerät.<br />
Im seit März 184-8 tagenden Frankfurter Vorparlament hatte<br />
<strong>Scheffel</strong> sogar schon republikanische Forderungen verwirklicht<br />
gesehen, wie er an seinen Vater am 5. April 184-8 <strong>von</strong> Frankfurt<br />
aus<br />
schreibt:<br />
"Die Versammlung hat mich übrigens nicht ganz befriedigt;<br />
sie war ja ihrer ganzen Zusammensetzung nach eine entschieden<br />
revolutionäre, und doch hat sie so erschrecklich gesetzlich<br />
getan, [. . .J. So v i e l i s t mir hier klar geworden,<br />
daß die Re.pu(L£ik unsere Zukunft sein muß; die republikanische<br />
Partei wird wohl <strong>im</strong> Anfang auch noch einen konstitutionellen<br />
Kaisen herausdoktern und doktrinieren, allein alle, hier waren<br />
darin einig, daß <strong>von</strong> jetzt an der neue Staat nur auf demokratischer<br />
Basis aufgebaut werden könne, ob die Republik schon<br />
heute proklamiert werden solle oder abgewartet." (9)<br />
Dieser Verbalradikalismus mit seinem Traum einer "Republik als<br />
unserer Zukunft <strong>im</strong> Herzen"^ best<strong>im</strong>mt denn auch die Art, wie<br />
<strong>Scheffel</strong> Hecker einschätzt, als dieser noch nicht das Haupt der<br />
Frankfurter Demokraten, sondern oppositioneller Abgeordneter<br />
der<br />
zweiten badischen Kammer war:<br />
"Auf der äußersten Linken, eigentlich als selbständige Partei,<br />
steht ganz allein der Abgeordnete Hecker. Er i s t der Löwe<br />
der Opposition, aber zugleich schon über die sonstige Opposition<br />
hinausgeschritten. Er w i l l alle die Fragen, die das<br />
Programm unserer politischen und sozialen Zukunft bilden,<br />
ohne Rückhalt, ohne Scheu vor Hindernissen <strong>im</strong> gegenwärtigen<br />
Staatsleben r e a l i s i e r t wissen; - geht's nicht, so soll's<br />
brechen. /*. . . ] . Er i s t wie <strong>von</strong> der Umgestaltung der p o l i t i <br />
schen, so auch <strong>von</strong> der der sozialen Zustände lebendig
99<br />
durchdrungen; darum i s t er <strong>von</strong> der ganzen Kammer a l l e i n der<br />
Mann des ulenten Standes; Hecker i s t durch und durch<br />
Republikaner und sieht <strong>im</strong> konstitutionellen Staat nur den<br />
Ubergang zur reinen Demokratie, darum und wegen seiner sozialen<br />
Richtung steht er öfter, wenn's auch in der Kammer nicht<br />
gerade hervortritt, <strong>im</strong> Widerspruch mit dem mehr doktrinären<br />
Konstitutionalismus der übrigen Opposition und deren Organ<br />
den. Deutschen Zeltung (11).<br />
Diese republikanisch-demokratischen Anschauungen des frühen<br />
1 2<br />
<strong>Scheffel</strong> gelten allerdings mit gewissen Einschränkungen . Zwar<br />
heißt es bei <strong>Scheffel</strong>: "Das konstitutionelle Königtum i s t eine<br />
1 3<br />
Fiktion" , der Konstitutionalismus wird also in die Nähe der<br />
abgelehnten Romantik gestellt; doch die Republik an dessen<br />
Stelle bleibt ebenfalls eine romantische Fiktion, die mit der<br />
republikanischen Unreife des Volkes begründet wird:<br />
"Die Republik muß erst geistiges Eigentum des ganzen Volkes<br />
werden, ehe sie real und wirklich werden kann. /'. . .J. Vom<br />
Polizeistaat plumpt man nicht auf einmal in die Republik<br />
hinein." (U)<br />
So wie sich <strong>Scheffel</strong> <strong>im</strong> Literarischen gegen die Romantik abgrenzt,<br />
so auch in seinen politischen Vorstellungen: sowohl der<br />
politische als auch der poetische Realismus <strong>Scheffel</strong>s bleiben<br />
aber auf programmatische Äußerungen beschränkt.<br />
Daß sich <strong>Scheffel</strong> schon <strong>im</strong> Vorfeld der Frankfurter Verfassungsdiskussionen<br />
<strong>von</strong> der Position der Demokraten und Republikaner<br />
<strong>im</strong>mer mehr absetzt, hat er selbst mit dem Verhalten der 'Radikalen'<br />
begründet:<br />
"Meine Zuneigung zu einer demokratischen und freien Gestaltung<br />
unserer Zustände und mein Haß gegen alle Romantik in der<br />
Politik kommen nur der tiefen sittlichen Indignation gegen<br />
die Herren gleich, die sich auch als Apostel der Freiheit<br />
stempeln wollen, denen sie aber nicht <strong>im</strong> Herzen, sondern <strong>im</strong><br />
Magen s i t z t ! " (15)<br />
Tritt so der postulierte Realismus (des Magens) gegen den Idealismus<br />
(des Herzens) zurück, wenn es ernst wird, so bleibt doch<br />
genügend ideales Denken übrig, wenn es g i l t , die nationale Einheit<br />
zu propagieren:<br />
"An der Revolution in Baden habe ich keinen Anteil genommen,<br />
nicht weil ich keine Revolution wünschte, sondern weil ich<br />
eine ganz andere Organisation des deutschen Reichsverfassungskampfs<br />
anstrebte, und weil ich mit dem Neckarbundsgesindel,<br />
welches bei uns <strong>im</strong> Namen der deutschen Freiheit sein Schindluder<br />
trieb, nichts gemein haben wollte.
100<br />
Nach meiner Ansicht mußte eine irgend über den Horizont<br />
unserer kleinen Lumpenblätter hinausreichende P o l i t i k dahin<br />
zielen, die 28 verfassungstreuen Regierungen waffen- und<br />
kampfbereit zu machen; den inneren Hader ruhen zu lassen,<br />
als Ersatz/!/ dagegen <strong>von</strong> der Regierung die Rüstung der ungeheuren<br />
und frischen Volkskräfte zum Kampf gegen den Absolutismus<br />
verlangen. Und das war ziemlich <strong>im</strong> Zuge. Ich habe, eh'<br />
es bei uns losging, nicht in den Bierkneipen gewühlt, sondern<br />
in gebildeteren Kreisen; - alles betrachtete Preußen als unsern<br />
natürlichen Feind, - und <strong>im</strong> Bund mit Württemberg, Hessen<br />
p.p. hätten wir mit den Pickelhauben noch ein Wort reden<br />
können." (16)<br />
In der Rückschau nach dem Sieg der Reaktion unter preußischer<br />
Führung taucht die Komik als umgekehrte Form <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>s<br />
innerer Melancholie wieder auf, nicht ausdrücklich genannt, aber<br />
als rhetorisches Mittel verkleidet, das gegen die politische<br />
Enttäuschung gesetzt werden kann. Interessant bleibt, daß sich<br />
die politischen Anschauungen in die literarische Darstellungsform<br />
fast unmerklich umwandeln: der programmatisch-realistische<br />
Griff auf die "frischen Volkskräfte" gibt da<strong>von</strong> ebenso Zeugnis<br />
wie der burschikose Ton, mit dem über politische Ereignisse<br />
gesprochen wird ("Schindluder").<br />
Die Tätigkeit <strong>Scheffel</strong>s als Gesandtschaftssekretär des Staatsrechtlers<br />
Karl Theodor Welcker, des liberalen Abgeordneten in<br />
Baden und Mitherausgebers des berühmten Staats lexikons, des<br />
Bundestagsgesandten und Abgeordneten der Frankfurter Paulskirche,<br />
wollen wir nicht so stillschweigend übergehen wie vorgeschla-<br />
1 7<br />
gen . Gerade an der Parallele zu Welckers direkter politischer<br />
Einflußnahme lassen sich <strong>Scheffel</strong>s politisch-rhetorische Bekundungen<br />
verdeutlichen. Die Schwierigkeiten Welckers als Mitglied<br />
des 'revolutionären 1 Vorparlaments wie zugleich als Delegierter<br />
1 8<br />
am 'reaktionären' Bundestag sind dargestellt . In Welcker<br />
spiegelt sich vielleicht noch ausgeprägter als in anderen Liberalen<br />
das Dilemma des Konstitutionalismus. Als Vorkämpfer der<br />
badischen Opposition <strong>im</strong> Landtag und als Fürsprecher der Souveränitätsrechte<br />
des Volkes läßt sich Welcker <strong>im</strong> Jahre 184.8 <strong>von</strong><br />
der verstörten Regierung für den reaktionären Bundestag in Dienst<br />
nehmen. Man hat diesen und andere Gesinnungswechsel als die<br />
1 9<br />
"Biegsamkeit der Grundbegriffe" interpretieren wollen . Doch<br />
i s t Welckers Abrücken <strong>von</strong> revolutionär-demokratischen Vorstellungen<br />
stellvertretend für den Liberalismus zu sehen: die 'Radi
101<br />
Mächte. Außerdem g i l t ihm der wenn auch reaktionäre Bundestag<br />
als das einzige funktionierende gesamtdeutsche Organ. Sich unter<br />
diesem Vorbehalt für die antinationalen Zwecke des Partikularismus<br />
einspannen zu lassen, hat Welcker anscheinend in Kauf genommen.<br />
Von Seiten der schwankenden Regierungen wird er ganz<br />
bewußt für die Sache des Ancien Reg<strong>im</strong>e benutzt, um der Revolution<br />
die ant<strong>im</strong>onarchische Spitze zu nehmen und ihre Energien auf<br />
das nationale Einigungswerk abzulenken. Eine solche Integration<br />
des gemäßigten Gegners zur Abwehr der radikaleren, um die demokratische<br />
Bewegung zu spalten, propagiert der badische Außenminister<br />
:<br />
"Ein populärer Name g i l t jetzt alles. Darum erwähle man<br />
Männer, die sich Gehör in Deutschland verschaffen können, zu<br />
Bundestagsgesandten! Mögen sie früher geredet und geschrieben<br />
haben, was sie wollen, wenn sie nur <strong>von</strong> Grund der Seele<br />
deutsch sind, Kenntnisse haben und gut geartet sind. Sie werden<br />
andere Männer werden, sobald sie als Organe der Regierung<br />
mitzuwirken haben. Dann wird der Zauberschlag vollbracht sein,<br />
und das deutsche Volk sich wieder mit Vertrauen um die Bundeslade<br />
scharen.- Welcker i s t ein solcher populärer Mann. Er<br />
hängt mit Leib und Seele an Deutschland und i s t durch und<br />
durch bundesstaatlich gesinnt, ein Mann, der weiß, daß Recht<br />
und Gesetzlichkeit die Grundlage der Freiheit i s t . " (20)<br />
Es fällt daher ein eigentümliches Licht auch auf <strong>Scheffel</strong>, wenn<br />
er gerade jetzt "Gesandtschaftsattache" Welckers am Deutschen<br />
21<br />
Bundestag wird . Welckers Gesinnungswandlungen und die des<br />
Liberalismus sind aber noch nicht zu Ende. Als heftiger Gegner<br />
eines erblichen Kaisertums und als eifriger Verfechter einer<br />
großdeutschen Einigungslösung wendet sich Welcker, als Österreich<br />
sich eine Verfassung oktroyiert, <strong>von</strong> seinen Auffassungen<br />
urplötzlich ab. Noch "während der Nacht" ändert er seine Meinung<br />
und s t e l l t am nächsten Morgen in der Nationalversammlung persönl<br />
i c h den Antrag,<br />
"die ganze Verfassung, wie sie nach geendigter erster Lesung<br />
mit den Zusätzen der Regierung vorliegt, ein bloc anzunehmen<br />
und dem König Friedrich Wilhelm IV. <strong>von</strong> Preußen die Kaiserkrone<br />
anzubieten." (22)<br />
Spätestens an dieser Stelle beginnen die politischen Ansichten<br />
zwischen Welcker und <strong>Scheffel</strong> zu differieren. Trotz seiner Verehrung<br />
der Person Welckers bekundet <strong>Scheffel</strong> diese Divergenz<br />
eindeutig:
102<br />
"In Frankfurt hab ich manches <strong>von</strong> parlamentarischen Kämpfen<br />
miterlebt, und <strong>von</strong> dem wackern alten Welcker, wiewohl meine<br />
politische Ansicht nicht mit der seinigen Hand in Hand geht,<br />
v i e l gelernt." (23)<br />
Auf Betreiben Welckers, doch mit dem inneren Vorbehalt, "keinem<br />
2 /<br />
Menschen etwas da<strong>von</strong> mitzuteilen" , hatte <strong>Scheffel</strong> nach bestandenem<br />
Doktorexamen die Redaktion der nationalen und fortschrittlichen,<br />
aber antiradikalen Vatenländisehen Blatten, fän Baden<br />
übernommen. <strong>Scheffel</strong> wird dort Chefredakteur mit der Absicht,<br />
2 5<br />
"mein Scherflein zur politischen Verständigung beizutragen" .<br />
Es i s t festgestellt worden, daß <strong>Scheffel</strong> sich dabei stark dem<br />
Einfluß seines Freundes Ludwig Häusser, eines überzeugten An-<br />
26<br />
hängers der kleindeutschen Partei, angepaßt hat . <strong>Scheffel</strong>s<br />
politische Leitartikel in dieser Zeitung, die nach dem ersten<br />
Jahrgang eingegangen i s t , kreisen vor allem um die Frage nach<br />
dem Oberhaupt des neu zu gründenden deutschen Reiches, namentl<br />
i c h , ob der König <strong>von</strong> Preußen dazu geeignet i s t (X,7ff). Dieser<br />
wird ganz als konstitutioneller Monarch begriffen, der seine<br />
Wahl zum Reichsoberhaupt als Ausdruck der Volkssouveränität gar<br />
nicht ablehnen dürfe und könne. Trotz der Enttäuschung über die<br />
tatsächlich erfolgte Ablehnung bleibt die Drohung erhalten, die<br />
Revolution mit dem Endziel einer Republik können weitergehen.<br />
In der Verbindung <strong>von</strong> "Einheit und Freiheit der Nation" sieht<br />
<strong>Scheffel</strong><br />
den Kompromiß, bei dem die gemäßigte, d. h. die konservativ-konstitutionelle<br />
Partei gesiegt und ihren Teil der<br />
Forderungen durchgesetzt hat:<br />
"die Rechte hat bei der Erbauung der Spitze der Reichsverfassung<br />
den Sieg da<strong>von</strong> getragen und ihren erblichen Kaiser<br />
durchgesetzt; die Linke hat zu demokratischen Grundlagen der<br />
Verfassung manchen wichtigen Quaderstein herbeigeschafft."<br />
(X,22)<br />
Das höchste Ziel i s t jetzt für <strong>Scheffel</strong> die nationale Einheit;<br />
wo es um eine freiheitliche Verfassungsdiskussion geht, bleibt<br />
sie nebulös und rhetorisch ("manch wichtigen Quaderstein"). An<br />
dieser Stelle entsteht der politische Mythos, die nationale<br />
Einheit sei das einzige Ziel der Bewegung <strong>von</strong> 184-8 gewesen. Die<br />
Alternativen der Märzrevolution heißen für <strong>Scheffel</strong> nun nicht<br />
mehr " flonanchie oden Republik, sondern deutsches Panlament<br />
oder Republik." (X,34)- ? Der Zusammentritt der Nationalversammlung<br />
wird nachträglich <strong>im</strong> Sinn dieser politischen Mythosbildung aus-
103<br />
schließlich national interpretiert:<br />
"Darum ging auch aus dem einmütigen Willen des deutschen<br />
Volkes die Nationalversammlung hervor, die zu Frankfurt tagt,<br />
der Ausdruck der angestrebten Einheit, und das Volk gab ihr<br />
die Aufgabe, die Verfassung für das künftige Deutschland zu<br />
schaffen und uns f r e i und kräftig zu machen." (X,68)<br />
Der Einheitsbestrebung nach innen, der die freiheitliche Komponenten<br />
abhanden gekommen i s t , folgt der Nationalismus nach außen<br />
auf dem Fuß. Jetzt geht es nur mehr um Deutschlands Stellung in<br />
der Welt: "die Hauptsache i s t , daß wir nach außen unsere gebührende<br />
Stellung erringen, dann kommt das weitere <strong>von</strong> selbst" (X,<br />
69). Mit der erreichten nationalen Einheit sollen sich dann alle<br />
anderen Probleme <strong>von</strong> alleine lösen: "so i s t damit auch unvermerkt<br />
und ohne allen Lärm auf Rednertribünen oder Volksversammlungen<br />
ein Teil der sogenannten sozialen Fragen gelöst" (X,69).<br />
Solchermaßen i s t es nur konsequent, wenn sich <strong>Scheffel</strong> gegen<br />
weitergehende soziale Veränderungsversuche und gegen die d i l e t <br />
tantischen Urasturzpläne seines ehemaligen Verbindungsbruders<br />
Karl Blind zur Wehr setzt:<br />
"Das sind meistenteils Leute, die den ganzen Charakter der<br />
Märzrevolution verkehren, die <strong>von</strong> der nationalen Seite derselben<br />
nichts wissen oder nichts wissen wollen und meinen,<br />
mit dem einseitigen Geschrei nach Freiheit und abermals<br />
Freiheit und nach Abschaffung <strong>von</strong> allem, was abzuschaffen i s t<br />
und <strong>von</strong> einigem weiteren sei uns a l l e i n geholfen. (X,69)<br />
Folgerichtig steht <strong>Scheffel</strong> <strong>im</strong> Mai 184-9 be<strong>im</strong> Ausbruch dieser<br />
Umsturzversuche auf der Seite der Bürgerwehr, die an der Niederschlagung<br />
der Aufstände maßgeblichen Anteil hat:<br />
"in der Nacht vom 13. Mai war ich als Bürgerwehrmann <strong>im</strong> Zeughaus<br />
und habe etwas Pulver und Blei gegen die Mitbegründer<br />
der neuen Zustände verschossen. Wie aber der Landesausschuß<br />
einrückte und die neue Wirtschaft anfing, fühlte ich mich zu<br />
souverän, um mich <strong>von</strong> Blind, Steinmetz, Stay beherrschen zu<br />
lassen, oder für sie Soldat zu werden; packte daher meine<br />
Reisetasche und nahm meine Mappe und ging fort." (27)<br />
An den Mythos einer nationalen Erhebung, den die Reaktion abgewürgt<br />
hat, heftet sich sogleich die rhetorische Floskel des<br />
Rückzugs, der auch ein poetischer i s t . Weil <strong>Scheffel</strong> den Glauben<br />
2 8<br />
an die "Poesie der Revolution" verloren hat , zieht er sich<br />
zurück. Der Mythos aber bleibt erhalten. Verwandelt in Gestalt<br />
eines literarischen Kulturpess<strong>im</strong>ismus feiert er Auferstehung in
104<br />
<strong>Scheffel</strong>s kulturhistorischer Studie Aus de.m tiauensteine.i<br />
Schwa/izLoald <strong>von</strong> 1852. Die politische Unfähigkeit und der begrenzte<br />
Horizont der Schwarzwaldbauern werden zu erstrebenswerten<br />
Qualitäten:<br />
"der Mechanismus des konstitutionellen Systems, wo nicht<br />
seine f=des Bauern/ Interessen, sein Stand als solcher repräsentiert<br />
sind, i s t ihm fremd." (VII,170)<br />
Nicht nur, "daß der Hauensteiner zu den revolutionären Bewegungen<br />
in Baden sich durchaus negativ verhält"; der Verfasser<br />
<strong>Scheffel</strong> findet das sogar "erklärlich" (VII,171). Dem Leser<br />
bleibt dann nur noch übrig, "über das Verhältnis bäuerlicher<br />
Reaktion zur Revolution die geeigneten Glossen zu machen" (VII,<br />
171). Die bäuerlichen Revolutionen unterscheiden sich grundlegend<br />
<strong>von</strong> den <strong>bürgerlichen</strong>:<br />
"Der Bauer, wenn er störrisch wird, revolutioniert <strong>im</strong>mer nur<br />
nach rückwärts, d. h. er w i l l auf einen Zustand zurückgehen,<br />
der vor dem jetzigen, ihm unbequehmen vorhanden war, /..._/;<br />
er, w i l l die gute. alte. Ze.it, während er für moderne Prinzipien<br />
keine Hand rührt." (VII,185)<br />
Diese Bauernrevolutionen legit<strong>im</strong>ieren gleichzeitig <strong>Scheffel</strong>s<br />
Kulturkonservatismus und sind deshalb so interessant, weil sich<br />
an ihnen angeblich die allgemeine Geschichtsentwicklung ablesen<br />
läßt: "So geht die Bauernhistorie ihren eigenen Gang, unabhängig<br />
<strong>von</strong> der Weltgeschichte <strong>im</strong> großen" (VII,189). Freilich i s t dafür<br />
eine dialektische Umkehrung nötig: in der Monumentalisierung<br />
dieser Bauernmentalität lebt der politische Mythos <strong>Scheffel</strong>s<br />
kulturkritisch<br />
fort.<br />
In dieser Perspektive auf untere Schichten, die in solchen<br />
Äußerungen des Großbürgers <strong>Scheffel</strong> durchscheint, i s t ein beträchtliches<br />
Stück politischer Rhetorik enthalten. Diesen Antrieb,<br />
politische und soziale Fragestellungen rhetorisch anzugehen,<br />
hatte schon der jugendliche <strong>Scheffel</strong>. Der 20jährige<br />
schreibt an seine Mutter als Student aus Berlin:<br />
"Alles i s t <strong>im</strong> Festtagsschmuck, und die Sonne scheint darauf,<br />
als gab es gar kein Elend. Wenn man aber die Berichte über<br />
das Umsichgreifen <strong>von</strong> Armut, Verbrechen und Prostitution in<br />
Berlin l i e s t , wonach man ungefähr 100 000 Leute als vollständig<br />
bankerotten Teil der Berliner Gesellschaft bezeichnen<br />
kann, welcher lebt ohne zu wissen, wie er in der nächsten<br />
Woche seinen Unterhalt haben wird, da sieht sich die Sache<br />
mit andern Augen an." (29)
105<br />
Die heftige Sozialkritik und Großstadtfeindlichkeit bleibt nicht<br />
bloß sehr global und wirkt recht h i l f l o s . In ihr steckt auch<br />
eine sprachliche Stilisierung ins Dramatische. Tonfall und<br />
Rhetorik machen zwar deutlich, wie fern dem in materieller<br />
Sicherheit lebenden Bürgersohn <strong>Scheffel</strong> solche Probleme <strong>im</strong> Grunde<br />
stehen. Sein Anliegen i s t ihm dennoch ein soziales, wenn auch<br />
<strong>im</strong> Umkreis literarischer Erfahrungen - man denke an die zahllosen<br />
Verarbeitungen des schlesischen WeberaufStands <strong>von</strong> 1844<br />
oder an Bettina <strong>von</strong> Arn<strong>im</strong>s aufsehenerregende Schrift Dies Buch<br />
gehö'/it dem<br />
Hört ig!<br />
In gleicher Weise ruhen <strong>Scheffel</strong>s politische Wunschvorstellungen<br />
auf literarischen Vorgaben auf, in denen politische Rhetorik<br />
und Geschichtsmythos verknüpft sind. Als Beispiel hierfür kann<br />
das Gedicht "Frommer Wunsch" <strong>von</strong> 1846 dienen:<br />
"Hoch oben <strong>im</strong> Kyffhäuser ruht<br />
Der Kaiser festgebannt,<br />
Und mit ihm in der Tiefe schläft<br />
Noch schier das ganze Land.<br />
Noch fliegen, die einst hier gekrächzt,<br />
Die Raben überall<br />
Und müh'n sich als Nachtwächter ab<br />
Gen jeden Sonnenstrahl.<br />
Als ich des Berges Höh 1 erklomm,<br />
Da war's gar s t i l l rungsum,<br />
Und wie ich nach dem Kaiser r i e f ,<br />
Der Kaiser, der blieb stumm.<br />
Ach, hätt' ein Riesenhorn ich hier,<br />
Wie's nie ein Ochse trug,<br />
Dann blies ich unaufhörlich fort<br />
Mit vollem Atemzug.<br />
Ach, könnt' ich wie der Kriegsgott Mars<br />
Stark wie zehntausend schrei'n,<br />
Dann schrie' ich n<strong>im</strong>mermüden Munds<br />
Von hier ins Land hinein.<br />
Ein mancher Schläfer würde dann<br />
Vom Schlummer aufgeschreckt.<br />
Der alte Rotbart selber würd'<br />
Am End' noch aufgeweckt.<br />
Und wären sie versammelt a l l<br />
Die Schläfer ringsumher:<br />
Dann wollt' ich, daß ich Flügel hätt'<br />
Und eine Lerche war'!
106<br />
Dann flog* mit schmetterndem Gesang<br />
Dem Zuge ich voran<br />
Und kündete dem Vaterland<br />
Des Tags Erwachen an!" (lX,36f)<br />
Die Barbarossasage, wie sie spätestens seit den Befreiungskriegen<br />
in der politischen Lyrik zum nationalen Mythos geworden war,<br />
i s t offensichtlich ein weiteres Mal zur Vorlage politischen<br />
Wunschdenkens herangezogen worden. Friedrich Rückert, Ferdinand<br />
Freiligrath, Hoffmann <strong>von</strong> Fallersleben, Georg Herwegh, Ernst<br />
Moritz Arndt und Emanuel Geibel, um nur die bekanntesten zu<br />
nennen, sind <strong>Scheffel</strong> mit Gedichten zu diesem Stoff vorange-<br />
30<br />
gangen*' .<br />
<strong>Scheffel</strong>s Rekurs auf die Barbarossasage baut aus der politischen<br />
Vormärzlyrik eine Aura aus Versatzstücken auf. Die Initiative<br />
ergreift sogleich ein lyrisches Ich, das <strong>im</strong> Gegensatz zum schlafenden<br />
Kaiser vor Aktivität strotzt. Diese Initiative beschränkt<br />
sich jedoch auf einen einzigen Ton: "Ach, könnt' ich", dessen<br />
konjunktivische Aussagen auch inhaltlich i r r e a l bleiben. Diese<br />
Äußerungen überspielen schon mit der dritten Strophe die Symbolfunktion<br />
Barbarossas: als Aussagen sind sie nicht nur laut,<br />
31<br />
sondern auch pathetisch . Der Herold wird schließlich zum<br />
Kaiserrufer und zugleich zum Kriegsrufer ("Kriegsgott Mars").<br />
Erst die letzte Strophe kündigt das Ziel dieses Rufens an; sie<br />
verweist auf eine metaphorische Dichotomie <strong>von</strong> Tag und Nacht,<br />
deren Endpunkt der Sprecher setzt. Sein Wunsch "Des Tags Erwachen"<br />
zeigt, wie undeutlich dieses Sprechen i s t . Erst <strong>von</strong> da<br />
her entpuppt sich der Titel des Gedichts als vielsagend und sich<br />
selbstdeutend: der Wunsch bleibt metaphorisch ausgegeben und<br />
rhetorisch so stark an literarische Traditionen gebunden, daß<br />
die Aussage dahinter verschwindet.<br />
<strong>Scheffel</strong>s politische Gedichte der Vormärzzeit lassen in der<br />
Aufnahme des Mythos und seiner rhetorischen Präsentation<br />
wenigstens den politischen Hintergrund erahnen, der sich aber<br />
auf verhülltere Weise literarisch niederschlagen kann:<br />
"Ich bin oft so herzlich froh, daß hinter der Gedankenwelt<br />
<strong>von</strong> 184-8 auch noch eine andere l i e g t , in der es, bei der<br />
Erinnerung, die gar oft jetzt über mich kommt, hellauf tönt<br />
mit Sang und Klang und frischem Jugendleben." (32)<br />
Rechnet man mit einer solchermaßen vom Politischen gereinigten
107<br />
Lyrik, dann bleiben politische Inhalte nur noch mit Mühe aus<br />
historischen oder exotischen Motiven zu entschlüsseln. Anastasios<br />
der Byzantiner singt in der 7/iau Avantlu/ia einen "Trauergesang<br />
um die Eroberung Konstantinopels durch die lateinischen<br />
Kreuzfahrer i . J. 1204" (111,86-89): die <strong>im</strong> historischen Bereich<br />
angesiedelte Zeitkritik des 1859 entstandenen Gedichts<br />
("Neue Ära" in Preußen!) läßt den aktuellen politischen<br />
eigentlich nur noch durch die Zugehörigkeit zum Zyklus der<br />
Bezug<br />
7/iau Avantiu/ie. durchscheinen. Aber auch dann i s t jeder Zeitbezug<br />
noch extrem verborgen. Eine Kritik an der Reaktionsmentalität<br />
und der Zensur sind fast nicht mehr zu erkennen:<br />
"Kirchhofstill war's in den Landen,<br />
Der Erfolg galt für das Recht;<br />
Stummer Dienst war nur gelitten,<br />
Freien Sinn schlug Haft und Bann,<br />
Wer nicht Sklave, nicht verschnitten,<br />
Galt nicht für den rechten Mann." (111,88)<br />
2. Der ewige Student. Von der Burschenschaft zum Stammtisch<br />
Man könnte nun leicht auf den Gedanken kommen, an <strong>Scheffel</strong>s<br />
Burschenschafts- und Studentenliedern seine politischen<br />
Kommentare direkt abzulesen. Dies i s t aber nur in beschränktem<br />
Maß legit<strong>im</strong>. Man hat nämlich dabei <strong>im</strong> Auge zu behalten, daß<br />
gerade die aussagekräftigsten und politisch scheinbar aufschlußreichsten<br />
Lieder erst weit nach <strong>Scheffel</strong>s Studentenzeit<br />
und oft noch v i e l später aus der Erinnerung verfaßt worden<br />
3 3<br />
sind . Diese Endfassungen gehen allerdings meist auf Entwürfe,<br />
lose Blätter oder mündliche Vorformen der Studentenzeit zurück.<br />
Das Gedicht "Der Ichthyosaurus", das erst 1854 veröffentlicht<br />
wird, aber einer früheren Entstehungsepoche aus <strong>Scheffel</strong>s Studentenzeit<br />
entstammt, lebt aus der Inadäquanz <strong>von</strong> naturwissenschaftlichen<br />
Fachbegriffen und forschem Studentenjargon, oft<br />
in den Re<strong>im</strong>verbindungen:<br />
"Es rauscht in den Schachtelhalmen,<br />
Verdächtig leuchtet das Meer,<br />
Da schw<strong>im</strong>mt mit Tränen <strong>im</strong> Auge<br />
Ein Ichthyosaurus daher.
108<br />
Ihn jammert der Zeiten Verderbnis,<br />
Denn ein sehr bedenklicher Ton<br />
War neuerlich eingerissen<br />
In der Liasformation:<br />
'Der Plesiosaurus, der Alte,<br />
Er jubelt in Saus und Braus,<br />
Der Pterodactylus selber<br />
Flog neulich betrunken nach Haus.<br />
Der Jguanodon, der Lümmel,<br />
Wird frecher zu jeglicher Frist,<br />
Schon hat er am hellen Tage<br />
Die Ichthyosaura geküßt.<br />
Mir ahnt eine Weltkatastrophe,<br />
So kann es ja länger nicht gehn:<br />
Was s o l l aus dem Lias noch werden,<br />
Wenn solche Dinge geschehn?'<br />
So klagte der Ichthyosaurus,<br />
Da ward es ihm kreidig zumut;<br />
Sein letzter Seufzer verhallte<br />
Im Qualmen und Zischen der Flut.<br />
Es starb zu derselbigen Stunde<br />
Die ganze Saurierei,<br />
Sie kamen zu t i e f in die Kreise,<br />
Da war es natürlich vorbei.<br />
Und der uns hat gesungen<br />
Dies petrefaktische Lied,<br />
Der fand's als fossiles Albumblatt<br />
Auf einem Kropolith." (IV,10f)<br />
Die komische Wirkung fast schon als Sprachparodie entsteht<br />
durch die Verlagerung der Erzählperspektive in ein vermenschlichtes<br />
Tier der Vorzeit, das sich 'kritisch' mit seiner eigenen<br />
Urzeit-Gegenwart auseinandersetzt. Die naturwissenschaftliche<br />
Fortschrittsgläubigkeit des 19. Jahrhunderts wird <strong>im</strong><br />
Ichthyosaurus und seinem Kulturpess<strong>im</strong>ismus parodiert. Das faktische<br />
Aussterben der Saurier unterlegt dem sprechenden Vorzeitlebewesen<br />
ein ironisiertes Endzeitgerde. Da in ihm der<br />
ernsthafte Gegenstand der Naturgeschichte und die s t i l i s t i s c h<br />
unpassende Behandlung auseinanderdriften, entsteht ein studentisches<br />
Ulklied. Sein Gebrauchswert liegt in der Identifikationsmöglichkeit<br />
des Sängers/Lesers begründet. Denn der an und<br />
für sich sinnlose Inhalt des Sauriermonologs gewinnt erst in<br />
der Übertragung auf die Bedingungen des Studentenlebens einen<br />
Sinn. Studentische Sitten werden auf Urtiere übertragen (der
109<br />
betrunkene Pterodactylus; der Juguanodon, der "am hellen Tage"<br />
küßt), beziehen sich jedoch über das Lied auf die studentische<br />
Sangesgemeinschaft zurück. Erst dort wird die Identifikation<br />
möglich. Die Kulturkritik des alten Ichthyosaurus geht vom<br />
Gegenbild des Studenten, <strong>von</strong> der Lebensform des Philisters aus.<br />
Der Pess<strong>im</strong>ismus, der aus der Klage des philiströsen Urtiers<br />
spricht, findet sein Gegenstück in der studentischen Lebensform.<br />
Die lustige Ungeniertheit des parodierenden Liedes kann<br />
so zur positiven Antwort auf die pess<strong>im</strong>istisch gesehene Zeit<br />
werden.<br />
Die wohl bekanntesten Studentenverse <strong>Scheffel</strong>s <strong>von</strong> 1876(!), die<br />
<strong>Scheffel</strong>s Studentenideologie kompr<strong>im</strong>iert enthalten, zeigen f r e i <br />
l i c h unter ihrer gezwungenen Heiterkeit die Brüchigkeit dieses<br />
Studentenideals<br />
an:<br />
"Nicht rasten und nicht rosten,<br />
Weisheit und Schönheit kosten,<br />
Durst löschen, wenn er brennt,<br />
Die Sorgen versingen mit Scherzen:<br />
- Wer's kann, der bleibt <strong>im</strong> Herzen<br />
Zeitlebens ein Student!" (IX,195)<br />
Hier verbinden sich alle Versatzstücke der Scheffeischen Dichtungsideologie<br />
mit dem Studentenlied: das ewige Wandern als<br />
Angst vor dem Festsitzen; Weisheit und Schönheit als Ideale,<br />
die jedoch nur gekostet und nicht genossen werden; der Alkohol<br />
und die humorige Poesie als Ausdruck der "Sorgen" und zugleich<br />
als Therapie gegen sie. Diese Konstituenten des Studentenlebens<br />
werden nun als Versatz stücke und zugleich, auch als Regeln für<br />
das gesamte weitere Leben betrachtet ("zeitlebens"). Das Kennzeichen<br />
für ein echtes Studentsein i s t kein sozialer Status<br />
oder ein Abschnitt <strong>im</strong> Leben des Bürgers, sondern liegt <strong>im</strong> Herzen<br />
beschlossen - eine grundlegende, vom Lebensalter unabhängige<br />
Eigenschaft! Auch wenn der Bürger selber zum Philster geworden<br />
i s t , kann er sich innerlich weiterhin als Student fühlen. Die<br />
Einschränkung des Gedichts, daß es sich dabei um ein kaum erreichbares<br />
Ideal handelt, i s t verräterisch, weil es den Wunschtraum<br />
des Spießbürgers als nicht realisierbar enthüllt: "Wer's<br />
kann"! Deshalb auch bilden die miteinander re<strong>im</strong>enden Verse nicht<br />
bloß zufällige Kombinationen, sondern verknüpfen tiefere Schichten<br />
des Scheffeischen Studentenbildes. So wie Weisheit und
110<br />
Schönheit nur <strong>im</strong> "nicht rosten", also <strong>im</strong> Wandern begriffen werden<br />
können, genauso hängt die Sängerrolle am "Herzen" und<br />
"Scherzen", also am Humor. Die (kausale?) Verbindung <strong>von</strong> studentischem<br />
Leben und Trinkfreudigkeit liegt ebenso auf der Hand<br />
wie die Vermutung, daß sich das Studentsein "zeitlebens" nur in<br />
der Pflege eines studentischen Dursts manifestiert!<br />
<strong>Scheffel</strong>s politische Haltung dieser Zeit wäre dann nur an der<br />
engen Verknüpfung <strong>von</strong> studentischen und burschenschaftlichen<br />
Denkweisen mit der literarischen Formenwelt abzulesen. Es steht<br />
zu vermuten, daß die Verbindungen <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>s Dichtungen zu<br />
den politischen Ereignissen der Zeit über die studentische Rezeption,<br />
also ihren Gebrauchs- und Verbrauchszusammenhang laufen.<br />
<strong>Scheffel</strong>s frühe Lyrik i s t in ihrer Trinkfreude und Corpsverherrlichung<br />
auf spezifische Burschenschaftsgewohnheiten und<br />
Studentensitten ausgerichtet. Diese Rezeptionsbasis geht sicherl<br />
i c h , etwa in der Gaudeamus-Lyrik, in die Themen, die (mündliche)<br />
Vortragsform, den eigenartigen Humor und bis in die<br />
Sprachverwendung ein.<br />
Für <strong>Scheffel</strong> definiert sich <strong>im</strong> Studentenleben wie in seinen<br />
3L<br />
Verbindungsmitgliedschaften das Gegenbild zum Philister in<br />
zwei Richtungen: einmal hebt die hervorgekehrte Wissenschaftlichkeit<br />
den jungen Akademiker aus der Bürgermasse heraus, zum<br />
anderen führt er als Student einen bewußt dargebotenen unsoliden<br />
> 3 5<br />
Lebenswandel mit "Ulk, Nachtwandel, Unfug usw." Gerade dies<br />
letztere i s t dabei oft zum Hauptkennzeichen des Studentischen<br />
geworden. Es i s t also nur beschränkt ironisch gemeint, wenn<br />
<strong>Scheffel</strong> berichtet, einige Verbindungsbrüder betrachteten<br />
"als Mittelpunkt und Hauptzweck der Verbindung bloß die<br />
Kneipe und die durch den vielseitigen Umgang daselbst hervorgebrachte<br />
Charakterausbildung." (36)<br />
Der Kampf gegen den Typus des verhaßten Philisters bleibt jedoch<br />
das Kernstück des studentischen Verbindungslebens. <strong>Scheffel</strong> berichtet<br />
an Schwanitz über eine solche Zusammenkunft:<br />
"Einer trat ganz pompös auf, sprach <strong>von</strong> der Herrlichkeit des<br />
wahren Studentenlebens und brachte ein Pereat allen Philistern.<br />
Dann kam die Definition ungefähr so: Philister aber i s t jeder,<br />
der nicht weiß, was er w i l l . Jeder, der etwas w i l l ,<br />
muß auch etwas Höheres, über ihm Stehendes wollen, und dies<br />
Höhere kann nichts anderes sein, als der Gott, wie ^ i r ihn<br />
festhalten und glauben; - wer etwas anderes will,, als diesen,
111<br />
strebt nach etwas, das keinen Inhalt hat und unmöglich i s t , er<br />
weiß also in Wirklichkeit nicht, was er w i l l , ergo - - ! Dann<br />
wurde noch v i e l über deutsche Freiheit und Gemütlichkeit und<br />
Tapferkeit p.p. gepaukt." (37)<br />
Die antiphiliströse Attitüde darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen,<br />
daß allen Korpsstudenten später selbst einmal das<br />
Schicksal des verhaßten Philisters winkt. Der Versuch, den Geist<br />
des studentischen Lebens in das bürgerliche Leben des Philistertums<br />
hinüberzuretten, best<strong>im</strong>mt deshalb auch die Intention der<br />
3 8<br />
Studentenlieder <strong>Scheffel</strong>s . Für den zum Philister gewordenen<br />
Korpsstudenten gibt es dann die Möglichkeit, in den Studentenliedern<br />
<strong>Scheffel</strong>s auch <strong>im</strong> <strong>bürgerlichen</strong> Leben noch die Erinnerung<br />
zu bewahren und sich in ihrem Absingen weiterhin als Anti<br />
Philister zu fühlen. Diese Rezeptionsgruppe und in ihrem Sog<br />
eine spezifische Schicht des akademisch gebildeten Bürgertums<br />
i s t sicherlich für den Verkaufserfolg und die Gebrauchsfunktion<br />
39<br />
der <strong>Scheffel</strong>gedichte <strong>von</strong> tragender Bedeutung .<br />
Da <strong>Scheffel</strong>s Studentenlieder ja erst nachträglich aus dieser<br />
liebgewordenen Erinnerung entstehen, bildet sich fast automatisch<br />
ein Kreislauf erinnerungsseliger Bestätigung zwischen<br />
Autor, Text und Leser. Die 'Gattung' des Abschiedslieds umfaßt<br />
dann <strong>im</strong> Abschied <strong>von</strong> der geliebten Stadt Heidelberg ungesagt<br />
auch das Ende der studentischen Lebensform. In der lyrisierenden<br />
Umgebung des berühmten "Alt Heidelberg, die feine" - es steht <strong>im</strong><br />
7'/lompeta/i - wird dieser Zusammenhang deutlich:<br />
"Alt Heidelberg, du feine,<br />
Du Stadt an Ehren reich,<br />
Am Neckar und am Rheine<br />
Kein' andre kommt die gleich.<br />
Stadt fröhlicher Gesellen,<br />
An Weisheit schwer und Wein,<br />
Klar ziehn des Stromes Wellen,<br />
Blauäuglein blitzen drein.<br />
Und kommt aus lindem Süden<br />
Der Frühling übers Land,<br />
So webt er dir aus Blüten<br />
Ein sch<strong>im</strong>mernd Brautgewand.<br />
Auch mir stehst du geschrieben<br />
Ins Herz gleich einer Braut,<br />
Es klingt wie junges Lieben<br />
Dein Name mir so traut.
112<br />
Und stechen mich die Dornen,<br />
Und wird mir's drauß zu kahl,<br />
Geb' ich dem Roß die Spornen<br />
Und r e i t ' ins Neckartal." (1,18)<br />
Jung-Werner wird nämlich <strong>im</strong> Anschluß an dieses Lied dem Pfarrherrn<br />
<strong>von</strong> seinen juristischen Studien erzählen; zwei Seiten<br />
später folgt <strong>im</strong> gleichen Kontext die Geschichte vom trinkfreudigen<br />
Zwerg Perkeo; zum Vortrag seines Heidelberg-Lieds trinkt<br />
Werner zudem "Einen Schluck des roten Weines" (1,18). Die Beschreibung<br />
Heidelbergs stützt sich vorerst scheinbar auf rein<br />
topographische Tatsachen, als gelte es, einen gere<strong>im</strong>ten Fremdenführer<br />
zu erstellen. Erst der Ich-Bezug der vorletzten Strophe<br />
macht deutlich, wofür die Stadt Heidelberg steht: als Ersatz<br />
für eine "Braut" und ein "junges Lieben". Gegen die stechenden<br />
"Dornen" und die feindliche Umwelt wird die Stadt und mit ihr<br />
die ungenannte Studentenerinnerung zum Objekt eines fluchtartigen<br />
Rückzugs.<br />
In einem gattungstypologisch weniger eingebundenen Gedicht, dem<br />
"Abschiedslied des Unentwegten" <strong>von</strong> 184-5 (IX,20f), wird dieser<br />
Hintergrund noch deutlicher. Im Abschiedsgesang des Korpsstudenten<br />
werden typisch studentische Haltungen und Eigenschaften<br />
syntaktisch an das politisch Oppositionelle gebunden:<br />
"Ich ulk' nicht mehr in euch /=Straßen7 herum,<br />
St<strong>im</strong>m' nicht mehr die Marseillaise an<br />
[...]<br />
Was s o l l ich mit euch Kneipen allen?<br />
Vollendet sind ja schon die Wahlen,<br />
[...]<br />
Wo bei B i l l i a r d , Domino und Whist<br />
Die Opposition so tätig i s t . " (IX,20)<br />
Erst <strong>im</strong> Abschied vom Studentenleben macht das <strong>Scheffel</strong>gedicht<br />
die politischen Implikationen sichtbar. Erst dort, <strong>im</strong> Kreislauf<br />
vom Bürger zum Bürger, wird das Ende und Ziel des Studentenlebens<br />
zugegeben:<br />
"Bemoostes Sektionsmitglied zieh' ich aus,<br />
Behüt dich Gott, du Bürgerhaus,<br />
Vollendet i s t mein Gelehrtenlauf,<br />
Jetzt geht der Student in den Bürger auf!" (IX,20)<br />
Der &ngc/ic Ausschuß in Heidelberg i s t deshalb biographisch wie<br />
literarisch wichtig nicht nur als Anreger und Rezipient für<br />
<strong>Scheffel</strong>s Trink- und Qaudß.amus-Lieder ^; er verkörpert geradezu
113<br />
den Ubergang der Studentenkneiperei in das Stammtischwesen des<br />
gesetzten Bürgers. Dieser Enge/ie in jener Zeit war <strong>von</strong> seiner<br />
Zusammensetzung her nicht nur l i b e r a l - f r e i h e i t l i c h angehaucht,<br />
sondern hatte <strong>im</strong> Kern aus einer badischen 'Flüchtlingskolonie 1<br />
<strong>von</strong> Enttäuschten und Resignierten nach 184-8 bestanden . "Die<br />
Gemeinsamkeit des Geschicks" und die "Ferienst<strong>im</strong>mung, welche<br />
42<br />
bald über die Geister des Mißgeschicks die Oberhand gewann" ,<br />
umschreiben mit der St<strong>im</strong>mung des Kreises zugleich die beiden<br />
wichtigsten Best<strong>im</strong>mungen für <strong>Scheffel</strong>s lyrische Produktion jener<br />
Tage.<br />
In den Umkreis eines solchen Rezeptions- und Produktions Zirkels<br />
läßt sich <strong>Scheffel</strong>s Trinkphilosophie einordnen, allerdings nicht<br />
4 3<br />
<strong>im</strong> Sinne einer literaturgeschichtlichen Typologie , sondern in<br />
ihrem Bezug zur politischen Situation. Die Lieder vom Rodenstein<br />
<strong>im</strong> Qaude.am.iLS (IV,42-52) etwa deuten die Figur des Ritters um;<br />
das r i t t e r l i c h e Abenteuer wird ein <strong>im</strong>merwährendes Suchen nach<br />
neuen Trinkmöglichkeiten:<br />
"Das i s t der Herr <strong>von</strong> Rodenstein,<br />
Auf Rheinwein w i l l er pirschen." (IV,42)<br />
Für den Ritter, der seine Besitzungen nach und nach vertrunken<br />
hat, i s t das Trinken zum einzigen Lebensinhalt geworden. Das<br />
Trinken als Lebensbewältigung nach Enttäuschungen weitet sich<br />
zur Totalität; es kann <strong>im</strong> Singen <strong>von</strong> Trinkliedern zu einer unendlichen<br />
Kontinuität anwachsen, wie der "Und wieder"-Anschluß<br />
der Rodensteinlieder beweist. Ihre Nutzanwendung leiten diese<br />
Trinklieder daraus ab, daß der Rodensteiner sich zum nachahmenswerten<br />
Vorbild erhebt:<br />
"Und alles, was <strong>im</strong> Odenwald<br />
Sein' Durst noch nicht g e s t i l l t ,<br />
Das folgt ihm bald" (IV,49).<br />
Schließlich wird sogar die Zeit selbst eine durstige: "Schon<br />
naht die durstige Maiweinzeit" (IV,51). Diese Trinkfröhlichkeit<br />
und die Kraftpose gegen das antialkoholische Philistertum legen<br />
den Verdacht nahe, daß zum adäquaten Verständnis der Gedichte<br />
neben der Kenntnis der Melodien auch die Aufführungssituation<br />
in einer angeheiterten St<strong>im</strong>mung mitgedacht werden muß. Gleiches<br />
g i l t für die politischen Implikationen, die nur indirekt sichtbar<br />
werden, weil sie sich beispielsweise schon aus dem Selbst-
1U<br />
Verständnis der Produktions- und Rezeptionsgemeinschaft des<br />
£nge./izn ergeben. Der politische Anachronismus des Rodensteiners<br />
"0 römisch Reich, du bist nicht mehr,<br />
Doch r e i t 1 ich noch zu deiner Ehr!-<br />
- Der Rodenstein zieht um." (IX,4-1)<br />
bezieht noch am Rande die politische Diskussion um die Gestaltung<br />
des Reiches mit ein. Daß solches keinesfalls zu intensiv<br />
politisch interpretiert sein muß, belegt etwa der Nachweis, daß<br />
manches dieser Rodensteingedichte<br />
"den Protest des Schmezer 1 sehen Kreises [=£.nge./ie./i] gegen<br />
die frühe Polizeistunde des strengen Polizeireg<strong>im</strong>ents während<br />
jener reaktionären Epoche zu drastischem Ausdruck brachte."<br />
(U)<br />
<strong>Scheffel</strong> hat noch ausführlicher, dann allerdings ohne die politische<br />
Anspielung, diese Trinkfreudigkeit zu einem 'philosophischen<br />
1 System ausgeweitet. Im 1/lompata/i erzählt Jung-Werner<br />
dem Pfarrherrn, er habe sich längere Zeit in Heidelberg bei<br />
seinem alten Freund Perkeo, "des Kurfürsts Hofnarr" (1,21),<br />
aufgehalten:<br />
"Der hatt' aus des Lebens Stürmen<br />
Zu kontemplativer Trinkung<br />
Sich hieher zurückgezogen,<br />
Und der Keller war Asyl ihm." (1,21)<br />
Das Leben des Zwerges Perkeo dreht sich um das große Heidelberger<br />
Faß. Es i s t ihm ein "Wunder unsrer Tage", ein "Kunstwerk<br />
deutschen Denkens", es g i l t ihm geradezu als Liebesersatz (I,<br />
21: "'s war, als sei er ihm vermählt"). Perkeo, Jung-Werner -<br />
denn dieser deutet erzählend Perkeos Geschichte - und mit ihnen<br />
der Erzähler singen dem Faß ihr "Schlummerlied" (1,22). In bewußter<br />
Abgrenzung <strong>von</strong> der Welt dort "oben" führt das Trinken<br />
den Zwerg "Auf die Gründe aller Dinge; zur Wahrheit". Im Trunk<br />
findet er "Weltanschauung" und die wahre "Forschung": "Solchen<br />
Zweck erstrebend, trink' ich" (1,22). Die Welt wird ihm zu<br />
einem phantastischen Weinkeller, in dem die Fässer wie die<br />
Planeten um ihn kreisen. Damit i s t ihm sein Trinken nicht mehr<br />
nur "Kosmogonisch" (1,22), sondern sogar ein "schöpferisches<br />
Trinken" (1,23). Jung-Werner, der Held, schließt sich dem Zwerg<br />
an; eigentlich i s t er es, der dem Alkoholismus Perkeos durch<br />
seine Interrpetation erst die 'philosophische' D<strong>im</strong>ension gibt!
115<br />
Das Ziel und Ende dieses "philosoph 1 sehen Frühtrunks" (1,23)<br />
ist so einleuchtend wie banal - ein Vollrausch. Im Rausch verändert<br />
sich dann die Wirklichkeit, und zwar so, wie man sie<br />
gerne sehen würde und wie sie tatsächlich nicht ist:<br />
"Aber wie <strong>im</strong> Mittagsscheine<br />
Ich heraustrat, schien die Welt mir<br />
Etwas seltsam anzuschauen.<br />
Rosig sch<strong>im</strong>merten die Lüfte,<br />
Engel hört 1 ich musizieren." (1,23)<br />
Scheint die ironische Erzählung Jung-Werners die Hintergründe<br />
der politischen Enttäuschung <strong>Scheffel</strong>s durch humoristische<br />
Relativierung in Frage zu stellen - als <strong>Scheffel</strong> 184-9 das<br />
Perkeomotiv für ein Qaude.amus-Trinklied wieder aufn<strong>im</strong>mt, läßt<br />
er die Maske, die <strong>im</strong> Gattungsvorbehalt<br />
des 7/iompe.te./t noch<br />
steckt, fallen: die Perkeorolle wird zur Ichrolle. Die Eigenschaften<br />
"feuchtfröhlich und gescheut" (IV,59) werden nicht nur<br />
identische Eigenschaften; auch die <strong>Scheffel</strong>eigene Ubersetzung<br />
der antiken Sentenz in vino vaiita* zeigt in der Satzstellung,<br />
worauf es dem Dichter ankommt: "Die Wahrheit liegt <strong>im</strong> Weine"<br />
(IV,59). Dem Säufer "strahlte inneres Licht", sein Trinken wird<br />
ihm zur gigantischen Leistung und zur Heldentat (IV,60: "Also<br />
ich arm* Gezwerge den Riesen Durst bezwang").<br />
Welche Möglichkeiten in dieser Rolle des projizierten Ich-<br />
Bezuges stecken, zeigt ein bekanntes Traumgedicht <strong>Scheffel</strong>s:<br />
"Mir träumt', der H<strong>im</strong>mel samt der Erd'<br />
Sollt' eine Bowle sein;<br />
Dazwischen flöss' das weite Meer<br />
Und sei voll lauter Wein." (IX,34)<br />
Die Trinkersehnsucht nach freier Zeche und die Hoffnung, am<br />
nächsten Morgen kein Kopfweh zu verspüren, überdeckt nicht<br />
die Intention des Gedichts: der Weltbewältigung durch das Trinken.<br />
Der Träumer trinkt nicht gegen den Durst, sondern für sein<br />
"durstig Herz" (IX, 34-). Den direkten politischen Bezug gewinnt<br />
diese Trinkphilosophie wieder, wenn die alkoholische Lebensform<br />
exklusiv für das Bürgertum reserviert werden s o l l . Im<br />
Gedicht "Verschiedene Ansichten" <strong>von</strong> 184-8 wird den politisch<br />
trüben Ansichten des ersten und zweiten Standes das Trinken als<br />
'sozialer' Wert gegenübergestellt:
116<br />
"Es war ein Mann vom dritten Stand,<br />
Der Mann war nicht so arrogant,<br />
Er sprach: Die Welt i s t wunderschön,<br />
Ju, ja wunderschön,<br />
Dieweil Wirtshäuser drinnen stehn:<br />
Herr Wirt! Einen Schoppen!" (IX,46)<br />
In dem 184-9 entstandenen Gedicht "Der wahre deutsche Kaiser"<br />
löst <strong>Scheffel</strong> die aktuelle Frage nach dem Reichsoberhaupt für<br />
die Gesamtnation ganz einfach; ein wahrer deutscher Kaiser zeichnet<br />
sich durch Trinkfestigkeit aus:<br />
"Herr Wenzeslaus <strong>von</strong> Böhe<strong>im</strong>, der war ein wackrer Mann,<br />
Er saß be<strong>im</strong> Rheinweinfas«e vom frühsten Morgen an" (IX,61).<br />
Im Kaiser, der sich lieber als "Privatmann" um den Wein als um<br />
die Politik kümmert, i s t der persönliche Bezug der Ich-Rolle nur<br />
schwach übertüncht, wenn es ironisch einschränkend heißt: "- Und<br />
wenn ich Kaiser werde, so mach 1 ich's ebenso!" (IX,61).<br />
Unter der Maske <strong>von</strong> Rollen können so literarische Formen zur<br />
Literarisierung <strong>von</strong> Lebenswirklichkeit herhalten. Die Originalität<br />
* <strong>Scheffel</strong>s ergibt sich dann aus seiner Respektlosigkeit<br />
vor dem politischen Ereignis, das vom Leser/Hörer/Sänger zwar<br />
nicht zum Gebrauch als Trinklied, aber zum Verständnis als politisches<br />
Gedicht <strong>im</strong>mer mitrezipiert werden muß. Man braucht den<br />
L 5<br />
biographischen Bezug <strong>Scheffel</strong>s zum Trunk nicht übertreiben ,<br />
aber selbst eine Min<strong>im</strong>alinterpretation muß es bezeichnend finden,<br />
wie Politisches dadurch ironisiert und l i t e r a r i s i e r t wird, daß<br />
es in einen Kontext mit dem Trinken gebracht wird. Aus der Lebenslage<br />
des Trinkers aus Enttäuschung wird in der literarischen<br />
Situation fast zwangsläufig das politische Trinklied. Die<br />
schwärzeste Parodie dieser Art i s t das Gedicht "Es lebe die<br />
Bierrepublik!" <strong>von</strong> 1848:<br />
"Der Bierstaat, nur der Bierstaat sei es!<br />
In ihm liegt unser Heil a l l e i n :<br />
Und ganz Europa wird ein freies,<br />
Ein permanentes Lichtenhain!<br />
Man säuft als wie ein Kannibale,<br />
Im Katzenjammer kommt das Glück:<br />
Das i s t die neue soziale<br />
Die veilchenblaue Republik!" (IX,47f)<br />
Am weitesten i s t die Pervertierung des Politischen ins Alkoholische<br />
allerdings in dem Gedicht "Vom Kommissari und seinem Sekretär"<br />
getrieben, das sich auf <strong>Scheffel</strong>s Tätigkeit als Gesand-
117<br />
schaftssekretär Welckers bezieht:<br />
"War einst ein Koramissari,<br />
Der soff bei Tag und Nacht.<br />
Der hatt' ein' Sekretari,<br />
Der's ebenso gemacht.<br />
Depeschen, Brief und Akten<br />
Macht'n ihnen wenig Müh,<br />
Sie kneipten und tabakten<br />
Oft bis zum Morgen früh.<br />
Und soff der Kommissari<br />
'mal ein paar Glas zu v i e l ,<br />
So war dem Sekretari<br />
Ein Rausch ein Kinderspiel.<br />
Und lag der Kommissari<br />
Des Morgens noch <strong>im</strong> Tran,<br />
So fing der Sekretari<br />
Schon wieder zu frühstücken an.<br />
Wo war der Kommissari,<br />
Der so v i e l saufen kunnt ? ?<br />
Wo war der Sekretari?<br />
Sie war'n be<strong>im</strong> - Deutschen Bund!" (IX,4-6)<br />
Der realpolitische Anlaß der Gesandtschaft geht neben den humor<br />
i s t i s c h geschilderten Sauftouren der beiden Politiker fast<br />
völlig unter, so daß er nur noch als Pointe Verwendung findet:<br />
das Saufen re<strong>im</strong>t sich mit dem Deutschen Bund. Die politischen<br />
Bestrebungen, an denen <strong>Scheffel</strong> selbst einmal teilhatte, werden<br />
zugunsten eines Lachers <strong>im</strong> nachhinein diskreditiert.<br />
3. Vom Deutschen Bund zum Deutschen Reich<br />
<strong>Scheffel</strong>s Stellung innerhalb der politischen Situation der Zeit<br />
i s t , wie schon gezeigt wurde, kein bloß individuelles Schicksal.<br />
Mit Begriffen wie politisch-ästhetischer Masochismus^ i s t ebenso<br />
wenig anzufangen wie mit dem verfälschenden Urteil, <strong>Scheffel</strong><br />
habe sich in dieser Zeit <strong>im</strong>mer "auf Seiten der siegreichen Re-<br />
4.7<br />
aktion" befunden . Der Rückzug <strong>Scheffel</strong>s aus der Politik nach<br />
1848 i s t ein programmatischer. Insofern hat die Annahme der<br />
Assessorenstelle in Säckingen sinnbildhafte Funktion. Mit dem<br />
Rückzug in die äußerste Provinz verlegt sich <strong>Scheffel</strong> zugleich<br />
auf ein poetisches sich Erinnern best<strong>im</strong>mter Werte, die aus ihrem
118<br />
Gegensatz zur P o l i t i k ihre Qualität erhalten:<br />
"erinnerte mich, daß der Mensch auch noch andere Nahrung<br />
finden kann als P o l i t i k , erinnerte mich, daß es auch noch<br />
Kunst und Waldeinsamkeit gibt." (48)<br />
In Säckingen kann die Resignation nicht literarisch ausgedrückt,<br />
aber ausgelebt werden. An seine Mutter schreibt <strong>Scheffel</strong> 1850:<br />
"Hie und da komm ich mir schrecklich einsam vor. Mein Salon,<br />
Amtsstube und Wirtshaus sind die drei Punkte, um die sich<br />
mein Leben bewegt." (49)<br />
Solchermaßen empfand sich <strong>Scheffel</strong> in ganz und gar unetablierter<br />
Stellung, vom reaktionären Staat verfolgt und <strong>von</strong> seinen persönlichen<br />
Enttäuschungen erdrückt. Von da her ließen sich Vergleiche<br />
zum v i e l angepaßteren und kleindeutsch-preußischen Geibel ziehen<br />
sowie vor diesem Hintergrund Wertungen um Konventionalität und<br />
Konformität des politischen Standorts überprüfen^. Für <strong>Scheffel</strong><br />
verdichtet sich die Resignation nach 1848 zu einem grundsätzlichen<br />
Pess<strong>im</strong>ismus, der ihn zeitlebens hindern wird, als Vorreiter<br />
preußischer und nationaler Reichsbegeisterung aufzutreten. Er<br />
51<br />
"sieht mit einer gewissen Apathie der Zukunft entgegen" , wobei<br />
er seine eigene St<strong>im</strong>mung stellvertretend für die allgemein<br />
nationale n<strong>im</strong>mt: "Daher i s t die St<strong>im</strong>mung des Volkes die einer<br />
52<br />
dumpfen Resignation" .<br />
Charakteristisch für diese Jahre i s t der Versuch <strong>Scheffel</strong>s,<br />
sich <strong>von</strong> allem, was <strong>im</strong> weitesten Sinn an P o l i t i k erinnern könnte,<br />
zurückzuziehen. Das hindert <strong>Scheffel</strong> aber nicht, die politischen<br />
Ereignisse zeitkritisch zu kommentieren. Daß er sich die p o l i t i <br />
sche Situation Deutschlands <strong>im</strong> Jahre 1866 aus einem Versagen<br />
der Parteiungen <strong>von</strong> 1848 erklärt, mag <strong>im</strong>merhin überraschen:<br />
"1. Die radikal republikanische Putsch- und Krakehl-Partei.<br />
2. Die l i b e r a l parlamentarisch-gothaisch-preußisch-spitzliche.<br />
3. Die alten Metternichschen Diplomaten, die 1850 sich auf<br />
der Dresdner Konferenz umarmten, als der alte Bundestag<br />
wieder hergestellt war; so kommt an den Bankerott als Nummer:<br />
4. Die preußische Militärpartei mit der blutig eisernen Bruderhand<br />
und der Ladestock-Parlamentsfuchtel. [•••]<br />
Dieser Bankerott wird übrigens mit dem <strong>von</strong> Altdeutschland<br />
nahezu identisch sein.<br />
Einstweilen reguliert man sein Haus und behält keine<br />
fremden Depositen." (53)<br />
Daß gerade die Zeit der politischen Resignation die poetisch<br />
produktive Zeit <strong>Scheffel</strong>s gewesen i s t , legt einen psychologi-
119<br />
sehen Schluß nahe, ohne f r e i l i c h in eine plumpe Kausalität zu<br />
verf a l l e n ^ .<br />
Wie geht nun die Politik aus dieser Gegenhaltung <strong>Scheffel</strong>s in<br />
sein Werk ein? Während des französisch-österreichischen Krieges<br />
in Italien 1859 schreibt <strong>Scheffel</strong> an seinem unvollendet gebliebenen<br />
Wartburgroman das Kapitel der Thüringer vor Akkon, also<br />
die entscheidende Eroberungsschlacht der Kreuzzüge. Ähnliches<br />
g i l t für das Romanfragment 1/ie.ne. <strong>von</strong> Splt<strong>im</strong>.be.ng, das <strong>im</strong> oberitalienischen<br />
Raum spielen sollte. <strong>Scheffel</strong>s großdeutsche Haltung<br />
in der Zeit der kleindeutschen Lösungen - Preußen hält sioh ja<br />
aus taktischen Gründen aus dem Italienischen Krieg heraus -<br />
schlägt sich auch in der Ansiedelung seiner fragmentarischen<br />
'deutschen' historischen Romane und der Tn.au Aventiune in<br />
Österreich nieder. In die gleiche Richtung geht <strong>Scheffel</strong>s These,<br />
der Österreicher Heinrich <strong>von</strong> Ofterdingen sei der Verfasser des<br />
deutschen Nibelungenliedes. Die vermittelnde Funktion Heinrichs<br />
<strong>von</strong> Ofterdingen in der Tnau Aventiune zwischen den 'nationalen'<br />
Stammesunterschieden mit dem Ziel einer gesamtdeutschen Synthese<br />
in Mittelalter und Gegenwart i s t offenkundig:<br />
"Indem er dort /=Heinrich v. Ofterdingen auf der Wartburg/<br />
mit dem Nibelungenlied als höchster Leistung seinen Gegnern<br />
die Spitze bietet, einer Dichtung, welche einen nordischdeutschen<br />
Stoff mit den Elementen süddeutscher Geschichte versetzt<br />
und in süddeutsch frischer Weise behandelt zeigt, v o l l <br />
bringt er eine schöne Tat idealer Versöhnung des Gegensatzes<br />
<strong>von</strong> Nord und Süd <strong>im</strong> Deutschthum <strong>von</strong> damals, <strong>von</strong> der sich mit<br />
Fug der moderne Dichter eine verklärende Rückwirkung auf das<br />
Deutschland seiner eigenen Zeit hatte erträumen dürfen." (55)<br />
An die "freundlich gemeinte Doppelarbeit" am J.un ipenus mit Anton<br />
<strong>von</strong> Werner (11,10), bei der die nationale Spaltung in Nord und<br />
Süd durch das Werk gleichsam poetisch aufgehoben wird, sei erinnert<br />
.<br />
Trotzdem bleibt <strong>Scheffel</strong> politischer Pess<strong>im</strong>ist. Daraus l e i t e t<br />
er seinen Hang zu politischen Prophetien ab, wenn er z. B. 1850<br />
vermutet, "daß alles bis jetzt Aufgetauchte nur der Vorbote eines<br />
56<br />
großen europäischen Generalkrachs" sei . <strong>Scheffel</strong> sieht schon<br />
bald nach 1848 ein, daß sich die deutsche Einheit real nicht<br />
durch Verfassungsdiskussionen wie in der Frankfurter Paulskirche<br />
verwirklichen lassen wird. So hat er
120<br />
"die Gewißheit, daß unser Reichsadler dereinst noch mit Ehren<br />
über Altdeutschland flattern kann, aber erst, wenn wir Jungen<br />
auf den Schlachtfeldern mit unserm Herzblut das Vaterland gerettet<br />
haben." (57)<br />
Der Machtzuwachs Preußens seit den 50er Jahren und dessen M i l i <br />
tarismus i s t für <strong>Scheffel</strong> keine akzeptable Lösung der deutschen<br />
Frage; allerdings sieht er, daß er mit dieser Meinung in einer<br />
Minderheit i s t . Unter dem Eindruck des preußischen Sieges 1866<br />
muß <strong>Scheffel</strong> eingestehen, daß die St<strong>im</strong>mung in Deutschland zugunsten<br />
Preußens gewaltig wächst:<br />
"Wenn sich die Deutschen gefallen lassen, zu nichts zu taugen<br />
als zum ... prrräsentiert das Gewehr! so sind sie ihrer<br />
Zukunft wert." (58)<br />
Auch dem Ausbruch des Krieges mit Frankreich 1870 begegnet<br />
<strong>Scheffel</strong> <strong>im</strong> Gegensatz zur allgemeinen Kriegseuphorie der Zeit<br />
mit einem "eigenen, mit Mißtrauen und Vorsicht vermischten Mut";<br />
als einer der wenigen äußert er Zweifel am Sinn einer solchen<br />
Auseinandersetzung: "Ich bin Pess<strong>im</strong>ist und sehe aus dem ganzen<br />
Krieg lediglich Unheil für die zivilisatorischen Aufgaben Euro-<br />
59<br />
pas" . Bei diesem Krieg " i s t der Teufel über Nacht losgeworden"<br />
und "kein Enthusiasmus möglich", schreibt er in den Tagen des<br />
Kriegsausbruchs ausgerechnet an Anton <strong>von</strong> Werner, den Kriegs-<br />
60<br />
und Staatsmaler Preußens<br />
Solche kritischen Töne bleiben aber <strong>im</strong>mer zurückgebunden auf<br />
die Gegensätzlichkeit des Kriegshandwerks zur eigenen poetischen<br />
Betätigung. So verzeichnet <strong>Scheffel</strong><br />
"ein unhe<strong>im</strong>liches Bangen vor einem aus dem siegreichen Krieg<br />
herausgewachsenen Militärkoloß, der für Gedeihen und Selbständigkeit<br />
des deutschen Cultusitedens verhängnisvoll werden"<br />
müsse. Der Hinweis auf den Verfall des "Culturlebens" bezieht<br />
die politische Lage natürlich auf die eigene dichterische Situation.<br />
Hatte doch <strong>Scheffel</strong> gleich zu Kriegsbeginn festgestellt,<br />
(61)<br />
daß die Kriegs- und Soldatenlieder, die man aus seinem Munde<br />
erwartete, nicht seine Sphäre seien: "Kriegslieder ziemen nur<br />
einem, der selber die Zündnadel trägt, mir wenigstens liegt<br />
62<br />
nichts in der St<strong>im</strong>mung" . Der Umkehrung ± m ursprünglichen Verhältnis<br />
<strong>von</strong> Kriegsereignis und poetischer Produktion, die dahinter<br />
steckt, geht <strong>Scheffel</strong> nach dem für Deutschland siegreichen<br />
Ende des Krieges genauer nach. Das Versagen seiner Schaffens-
121<br />
kraft begründet er mit dem kompromißlosen Gegensatz dieser beiden<br />
Prinzipien, wobei sich die Poesie als der schwächere Teil erwiesen<br />
hat:<br />
"Seit dem Krieg 1870 u. dessen fortdauernden, in Süddeutschland<br />
nicht sehr freudig zu spürenden Wirkungen hat die Poesie<br />
keine Einkehr bei mir gehalten - wo die Kanonen sprechen i s t<br />
kein Ort für den Gesang." (63)<br />
Sein Verstummen als Dichter mit dem Krieg zu begründen i s t für<br />
<strong>Scheffel</strong> nicht neu. Schon ein Jahr zuvor hatte er sich ähnlich<br />
geäußert, allerdings eine kleine Hoffnung offen gelassen:<br />
"Ich habe ein zu scharfes Auge für die Leiden des Krieges,<br />
die auch den Siegern nicht vorenthalten bleiben, so daß mir<br />
eine ungetrübte Freude und der Ausdruck in poetischer Form<br />
nicht möglich wird. Vielleicht s t e l l t sich später aus a l l den<br />
Eindrücken etwas Anderes zusammen. Noch sind wir nicht am<br />
Ende ..." (64)<br />
Mit seiner Dichtung war <strong>Scheffel</strong> allerdings am Ende. Der Hoffnung<br />
auf das 'Zusammenstellen' <strong>von</strong> Poesie i s t er, f r e i l i c h in<br />
anderer Form, nämlich mit der Herausgabe seiner früher geschriebenen<br />
Gedichte und durch das Vorwort- und Widmungsschreiben zu<br />
allen möglichen Gelegenheiten gerecht geworden.<br />
Nur ganz allmählich wandelt sich <strong>Scheffel</strong>s Einstellung zum<br />
neuen Kaiserreich. Er erkennt, daß der Bismarckstaat die ersehnte<br />
Einheit, wenn auch auf andere Weise, verwirklicht hat.<br />
Die Aussöhnung <strong>Scheffel</strong>s mit dem Deutschen Reich i s t vor allem<br />
eine Aussöhnung mit den Spitzen des Reiches, mit Bismarck und<br />
dem deutschen Kaiser, weniger mit der preußischen Vorherrschaft<br />
in Deutschland und ihrer militärisch-wirtschaftlichen Unterdrückung<br />
der Bundesstaaten. Die späten Huldigungen an Kaiser<br />
und Reich (in dieser Reihenfolge!) würden <strong>Scheffel</strong> in die Nähe<br />
des Geibelschen Nationalpathos s t e l l e n ^ , betrachtete man sie<br />
i s o l i e r t und nicht als Endpunkt dieser Entwicklung. <strong>Scheffel</strong>s<br />
Verherrlichung des Reiches in dieser späten Lebensphase machen<br />
deshalb auch eher den Eindruck <strong>von</strong> mühsam abgerungenen Pflichtarbeiten.<br />
<strong>Scheffel</strong> gelingt eine poetische Rechtfertigung des<br />
nationalen Vormachtanspruchs nur dann, wenn er einen ganz konkreten<br />
Anlaß zugewiesen bekommt. Der 16. Versammlung deutscher<br />
Architekten und Ingenieure in Karlsruhe 1872 dichtet <strong>Scheffel</strong><br />
einen Festgruß (IX,179-181), in dem Spruchhaftes und Festlich-<br />
Repräsentatives mit dem nationalen Grundton zusammenfallen. In
122<br />
dieser Auftragsarbeit wird die "deutsche Technik" (IX,179) gefeiert,<br />
die allerdings für die Zwecke der nationalen Einheit beansprucht<br />
werden kann:<br />
"Dem Bau de/i Zukunft! - bis die Schranken fallen<br />
Leg' Süd wie Nord vorplanend Ehre ein:<br />
Zwei Preisaufgaben s t e l l f ich heut euch allen<br />
Und wer sie löst, mag Baudirektor sein:<br />
Architektur: des deutschen Reichstags Hallen,<br />
Ingenieurs: die Brücken übern Main!" (IX,181)<br />
So wie der nationale Ton den möglichst handfesten Anlaß eines<br />
Gelegenheitsgedichts braucht, genauso benötigt <strong>Scheffel</strong> den<br />
handfesten persönlichen Bezug auf die Zeitlage, wenn er repräsentativ<br />
Nationales dichten w i l l . "Dem deutschen Reichskanzler<br />
Fürsten Otto v. Bismarck" sendet er zu dessen Geburtstag am<br />
1. April 1885 ein Gedicht, in dem die Schlagworte des Kriegsund<br />
Soldatenjargons als humorig-gemütliches Gere<strong>im</strong>e und als<br />
Re<strong>im</strong>geklingel zu lesen sind:<br />
"Viel Feind, v i e l Ehr 1 ,<br />
Ein Held hat's schwer,<br />
Doch Sieg nach Krieg<br />
Und Dank nach Zank<br />
Und Ruhm, der blüht<br />
In Nord und Süd,<br />
Freut um so mehr!" (IX,239)<br />
Doch selbst hier spricht <strong>Scheffel</strong> <strong>im</strong> Gegensatz zu seiner sonstigen<br />
poetischen Gewohnheit die gefeierte Person <strong>im</strong> Gedicht nicht<br />
direkt an.<br />
Auch die studentische Flucht in Bieratmosphäre und Ulk existiert<br />
nicht mehr. "Zum 4-Ojährigen Stiftungsfest der Burschenschaft<br />
1euton La" in Jena, deren Mitglied er gewesen i s t , versucht<br />
<strong>Scheffel</strong> noch einmal, die studentische Erinnerung dichterisch<br />
aufleben zu lassen. Den Studenten des Zweiten Kaiserreichs kann<br />
er nun f r e i l i c h ein festes Ziel vor Augen stellen. Aus dem a l <br />
ten Studentenideal zwischen Bildungsanspruch und Trinkerei i s t<br />
jetzt eine nationale Inpflichtnahme durch'den Staat geworden:<br />
"Vereint am Reiche weiterbauen,<br />
Ist des heut'gen Hannes Pflicht!" (IX,241)<br />
"Deutsch <strong>im</strong> Herzen" (IX,249) haben diese Studenten zu sein, es<br />
genügt nicht mehr, das studentische "zeitlebens" mit sich <strong>im</strong><br />
Herzen zu tragen (IX,195)!
123<br />
Schließlich erkl<strong>im</strong>mt <strong>Scheffel</strong> doch noch den Gipfel nationaler<br />
und reichsbegeisterter Lyrik mit seinem Kaiserjubel; eingeholt<br />
sind die Floskeln militärisch-sakraler Hymnik:<br />
"Erweckt durch Blitz und Kampfgefahr<br />
Und treuer, deutscher Helden Tod,<br />
Sah sieghaft hier der Kaiser-Aar<br />
Des Reiches blutig Morgenrot." (IX,250)
125<br />
V. DICHTER UND BÜRGERLICHE GESELLSCHAFT<br />
1. Der Bürgerdichter<br />
Mit dem Bürgertum, aus dem er stammt und für das er gedichtet<br />
hat, lebt <strong>Scheffel</strong> auf gespanntem Fuß. Mit einem einfachen E t i <br />
kett bezeichnet erscheint <strong>Scheffel</strong> sicherlich als "Standesdichter<br />
des gebildeten Bürgertums" und als "Prophet des Philister-<br />
1 2<br />
tums" , ja sogar als "Ehrenbürger vom Dienst" . Aber selbst die<br />
Aussage, <strong>Scheffel</strong> sei der "Lieblingsdichter der wilhelminischen<br />
Zeit" gewesen, sagt, <strong>von</strong> den Auflagenhöhen seiner Bücher einmal<br />
abgesehen, nicht v i e l . Untersucht man das Bürgertum in seinen<br />
Beziehungen zu seinen dichtenden Bürgern^, so ergibt sich ein<br />
Zirkel <strong>von</strong> Produktion und Rezeption, in dem erfüllte Lesererwar-<br />
5<br />
tungen wieder neue Lesererwartungen produzieren . <strong>Scheffel</strong>s Bestreben,<br />
durch seine Literatur "weitere Kreise" (V,5), d. h.<br />
die "Mehrzahl der Nation" (V,6) zu erreichen, läßt sich allein<br />
mit den üblichen didaktischen Absichten der Geschichtsdichtung<br />
nicht rechtfertigen. Vielmehr i s t diese Intention <strong>Scheffel</strong>s in<br />
einer gemeinsamen Basis des Dichters mit dem gebildeten Bürger,<br />
einer gemeinsam aufgerufenen "Stabilität des <strong>bürgerlichen</strong> Bewußtseins"<br />
zu suchen^.<br />
Welche Rolle der Dichter innerhalb dieses Bürgertums zugewiesen<br />
erhält und wie er mit ihr zurechtkommt, erhellen schlaglichtartig<br />
die Schillerfeiern <strong>von</strong> 1859. Zu Schillers 100. Geburtstag<br />
feiert das deutsche Bildungsbürgertum den Klassiker als unverlierbaren<br />
Besitz und als Verklärung der enttäuschten politischen<br />
Hoffnungen. Die Gründung eines deutschen Nationalvereins und<br />
der italienisch-französische Krieg gegen Österreich <strong>im</strong> gleichen<br />
Jahr geben den Feierlichkeiten die nationale Note. Auch <strong>im</strong> Hause<br />
<strong>Scheffel</strong> n<strong>im</strong>mt man die Gelegenheit zur Schillerfeier wahr, wie<br />
die Mutter berichtet:<br />
"Im Wohnz<strong>im</strong>mer war eine schöne Schillerbüste nach Dannecker<br />
aufgestellt und Blattpflanzen überdachten dieselbe als grünendes<br />
Zelt <strong>von</strong> seltener Pracht und Schönheit. Im Besuchsz<strong>im</strong>mer<br />
lasen wir zuerst Schiller 1 sehe Gedichte verschiedener Art -<br />
und sie kamen allen wunderbar neu und schön vor. Als nun so<br />
die St<strong>im</strong>mung vorbereitet war, zündete Mathilde eine Menge<br />
Lämpchen um die Büste an. Das ganze Z<strong>im</strong>mer war mit Blumen,
126<br />
Licht und Grün erfüllt - so daß die überraschten und gerührten<br />
Gäste manche he<strong>im</strong>liche Thräne weinten. Graue Haare und süße<br />
Jugenderinnerung, das giebt ein wunderbares Gemisch <strong>von</strong><br />
St<strong>im</strong>mung. Fräulein Lufft trug schöne selbsterfundene Festworte<br />
vor und bekränzte dabei den lieben Dichter mit Lorbeer.<br />
Es war ein feierlicher schöner Anblick.- Sodann machte Schiller<br />
selbst die Tafelordnung. Ich hatte nämlich 18 schöne<br />
Sprüche aus seinen Werken ausgewählt, dieselben auf gleich<br />
große Zettel geschrieben und in der Mitte schief durchschnitten.<br />
Die eine Hälfte legte ich auf den Teller, die andere<br />
bot ich den Gästen zum Ziehen an. Dann mußten sie suchen, wo<br />
sich ihr Spruch ergänzte und das war ihr Platz. Es wurde bei<br />
diesem Fest-Abendessen beinah <strong>von</strong> der patriarchalischen Einfachheit<br />
unseres Hauses etwas abgewichen."<br />
Es gibt nämlich ein Festessen mit "Rheinlachs" und "prächtigen<br />
Krebsen". Nach einer o f f i z i e l l e n Tischrede des Kammerpräsidenten<br />
geht die Feier weiter:<br />
"Wir Anderen setzten die Schillerhuldigung in anmuthigerer<br />
Weise fort - theils in Improvisationen, theils in ungere<strong>im</strong>ter<br />
aber <strong>im</strong>mer herzlicher und für den großen Dichter warmfühlender<br />
Rede. Es war eine St<strong>im</strong>mung in der Gesellschaft, wie<br />
ich sie nie erlebt - bis lang nach Mitternacht wurde ununterbrochen<br />
gelesen, vorgetragen, aus dem Stegreif gedichtet,<br />
Toaste ausgebracht mit dem Puschglas und nie riß der Faden<br />
und nie sank das Gespräch in den Werkeltagston herab. Das war<br />
Schiller's Geist selber, der dies Wunder vollbrachte. Am f o l <br />
genden Abend sahen wir mit mehreren Gästen den Fackelzug und<br />
die Festfeiar auf dem Marktplatz, die großartig und würdig<br />
war. Ein mächtiges Gefühl durchschauerte mich, als die Polytechniker,<br />
die Männer der Zukunft - 800 an der Zahl - mit<br />
Fackeln anrückten, die große schwarzrothgoldene Fahne voran<br />
und dann die Banner aller Einzelstaaten; sie schwenkten diese<br />
Zeichen der Größe, der leider unterdrückten, aber erwachenden<br />
Größe unseres Vaterlandes vor dem nun gefundenen Zeichen der<br />
Einheit - vor Schiller. Dann warfen sie unter Reden und Gesang<br />
die Fackeln alle zu einer lodernden Flamme zusammen, auch die<br />
Bürger thaten dasselbe, so daß ein Brand <strong>von</strong> wenigstens<br />
2000 Fackeln vor der Büste aufglühte, die in unbeschreiblicher<br />
Verklärung in die Nacht hinaus sah." (7)<br />
Der Sohn, wie Schiller ein Dichter, empfindet f r e i l i c h anders.<br />
<strong>Scheffel</strong>s Identifkation mit Schiller unterscheidet sich grundlegend<br />
vom Enthusiasmus der nationalen Feiern durch die Betonung<br />
einer Gemeinsamkeit der beiden Dichter über die Zeiten hinaus.<br />
<strong>Scheffel</strong>s Verhältnis zum We<strong>im</strong>arer Hof i s t nämlich nicht nur <strong>von</strong><br />
einem epigonalen Abstand zum Klassiker Schiller geprägt. Für<br />
<strong>Scheffel</strong> wird Schillers Leben vielmehr zum Exempel für den<br />
Widerspruch innerhalb der <strong>bürgerlichen</strong> Gesellschaft, die Klassiker<br />
zu vergöttern, den lebenden Künstler aber gering zu schätzen.
127<br />
An seinen Gönner, den Großherzog Carl Alexander <strong>von</strong> Sachsen-<br />
We<strong>im</strong>ar-Eisenach, Schirmherr der neugegründeten Schillerstiftung<br />
zur Unterstützung notleidender zeitgenössischer Dichter, schreibt<br />
<strong>Scheffel</strong>:<br />
"Die Schillerfeste haben der ganzen Nation an den Geschicken<br />
ihres Poeten gezeigt, daß auch die Geister ersten Ranges <strong>im</strong><br />
Lauf ihrer Entwicklung in Bahnen gerathen können, wo es an<br />
einem Faden hängt, ob sie in Zwang und Verkümmerung elend<br />
einsumpfen oder aber - in neuer und reiner Atmosphäre die<br />
Flügel des Genius regen und entfalten sollen. /.../ Königliche<br />
Hoheit! Dieser Jammer wiederholt sich trotz aller<br />
Schillerstiftungen und Schillerfonds noch täglich, und daß<br />
er sich wiederholen kann, i s t ein schweigender aber begründeter<br />
Vorwurf für allen Festenthusiasmus, der da glaubt, Deutschland<br />
sei bereits das gelobte Land der Künste." (8)<br />
Der sozialen Ausgesetztheit, in der sich <strong>Scheffel</strong> gegenüber dem<br />
Bürgertum empfindet, widerspricht allerdings sein tatsächliches<br />
Ansehen und der Erfolg seiner Werke. Worin liegen die Ursachen<br />
bei diesem merkwürdigen Auseinanderklaffen <strong>von</strong> Selbst- und<br />
Fremdeinschätzung? Läßt sich der Erfolg eines Schriftstellers<br />
nicht bloß quantitativ am Buchabsatz messen, sondern auch als<br />
Befriedigung der "individuellen Teilnahme- und Selbstbestätigungso<br />
wünsche einer unbekannten Leserschaft" begreifen , so sucht man<br />
1 0<br />
Formen einer "nationalen Selbstvergewisserung" zu Lebzeiten<br />
<strong>Scheffel</strong>s vergebens. Im Unterschied etwa zur Propheten- und<br />
Heroldsrolle Geibels war <strong>Scheffel</strong>s Erfolg gerade auf seine<br />
provinziell-resignative Zurückgezogenheit (£kke.haid) , ein humoriges<br />
Behagen (Trinklieder) oder die sent<strong>im</strong>entale Idylle {7/iompe.te./i)<br />
gegründet. Nicht zufällig macht die <strong>im</strong> Jahre 1867 erschienene<br />
Ausgabe der v i e l früher gedichteten Qaude.amus-Lieder Schef-<br />
1 1<br />
f e i zum "volkstümlichsten Dichter Deutschlands" . Die Schizophrenie,<br />
gerade der resignative Rückzug des Dichters bestätige<br />
sein dauerndes Streben nach bürgerlicher Anerkennung, i s t nur<br />
dann zu erklären, wenn man den Rückzug <strong>Scheffel</strong>s aus der Poesie<br />
als Teil seiner Dichterrolle betrachtet, so wie sie auch <strong>von</strong><br />
seiner Leserschaft als seinem Werk zugehörig akzeptiert worden<br />
i s t . Der Rückzug des Dichters <strong>von</strong> der Poesie und sein Erfolg be<strong>im</strong><br />
Publikum verlaufen gleichsam umgekehrt proportional:<br />
"Deshalb spann er sich in eine ziemlich verdrossene Weltabgeschiedenheit<br />
ein und hielt nur noch s c h r i f t l i c h den Verkehr<br />
mit der Außenwelt aufrecht, während seine Werke Jahr für Jahr<br />
in vielen tausend Stücken seinen Namen in die Weite trugen."(12)
128<br />
<strong>Scheffel</strong> selbst formuliert anders. Für ihn steht den "unruhigen,<br />
glorreichen, aber windhetzenden Bahnen des dichterischen selbständigen<br />
Schaffens" das "Idyll und s t i l l e bürgerliche Ruheleben"<br />
1 3<br />
gegenüber . Das Bürgertum, das i s t zugleich das verhaßte Philistertum<br />
und eine gebildete Gesellschaftsschicht, die dem Dichter<br />
die begehrte soziale Reputation gewährt. Noch als junger<br />
Mann untern<strong>im</strong>mt <strong>Scheffel</strong> mit dem damals schon bekannten Kulturhistoriker<br />
W.H. Riehl eine Rheinwanderung, bei der man die<br />
potentiellen Leser in Augenschein n<strong>im</strong>mt, noch bevor ein Werk<br />
überhaupt geschrieben i s t :<br />
"<strong>Scheffel</strong> fragte verwundert, wen ich denn eigentlich besuchen<br />
wolle. Ich erwiderte, das wisse ich selbst nicht genau, ich<br />
kenne keinen Menschen in Boppard, nicht einmal dem Namen nach;<br />
es sei eben die ge.diide.te. Qese.ttschaft, es seien die Honoratioren<br />
<strong>von</strong> Boppard, denen unser Besuch gelte." (14)<br />
Im Schoß einer solchen Gesellschaft kann dann sehr v i e l später<br />
eine Literatur entstehen und gedeihen, die den Lesern wie auf<br />
den Leib geschrieben i s t .<br />
2. Der Dichterfürst<br />
Erscheint <strong>Scheffel</strong> auf diese Weise als der "Idealfall des bür-<br />
1 5<br />
gerlichen Unbürgers" , so deshalb, weil die Rolle des Bürgerdichters<br />
ihr Gegenstück schon in sich trägt. E. Lämmert hat in<br />
seinem Aufsatz über den Dichterfürsten diese "Stilisierung des<br />
Dichters zum Uberbürger" und damit zum "Unbürger" herausgearbeit<br />
e t ^ . Wird nämlich die fast "ideologische Einheit <strong>von</strong> Künstler<br />
1 7<br />
und Publikum" <strong>im</strong>mer weiter ins Extrem getrieben, so i s t bald<br />
der Punkt erreicht, an dem der Dichter aus der <strong>bürgerlichen</strong><br />
Lebens- und Rezeptionsgemeinschaft ausbricht. Innerhalb der<br />
Texte <strong>Scheffel</strong>s war dieser Tendenz schon längst Vorschub geleistet<br />
worden - man denke an <strong>Scheffel</strong>s Polarität <strong>von</strong> Höhe und<br />
Tiefe, die man nur auf den gesellschaftlichen Bereich zu übertragen<br />
braucht, um grundsätzliche Differenzen zwischen dem Dichter<br />
auf der Höhe und seinem <strong>bürgerlichen</strong> Publikum in der Tiefe<br />
zu haben. Wenn man w i l l , kann man in der Mittelalterthematik<br />
des Lkkehand stoffliche Ansätze für solche "Formen bürgerlicher<br />
1 8<br />
Dichter-Nobilitierung" erkennen. "Uberall naive, starke Zu
129<br />
die poetische Fiktion des Lkke.kan.d, sondern <strong>im</strong>pliziert ja auch<br />
die Stilisierung <strong>von</strong> Werk und Dichter ins Mittelalterliche und<br />
d. h. in Richtung auf aristokratische Lebensformen.<br />
Daß der mittelalterliche Stoff des Lkke.ka.id eine solche Betrachtungsweise<br />
zuläßt, beweist die Tatsache, daß <strong>Scheffel</strong> noch <strong>von</strong><br />
dem literarischen und dem Verkaufserfolg seines Romans auf ein<br />
aristokratisches Interesse an seinen Arbeiten und an seiner Person<br />
gestoßen i s t . <strong>Scheffel</strong>s Plan eines Wartburgromans als Auftragsarbeit<br />
für den Großherzog <strong>von</strong> Sachsen-We<strong>im</strong>ar-Eisenach z i e l t<br />
genau auf diesen Punkt, an*dem die Gemeinsamkeit zwischen Fürst<br />
und bürgerlichem Dichter ihren Ausgang n<strong>im</strong>mt. Zwar i s t <strong>Scheffel</strong><br />
1 9<br />
aus "seinem elementaren Unabhängigkeitstrieb" auf die Versuche<br />
des Großherzogs, ihn mit seinem Dichtungsauftrag in Pflicht zu<br />
nehmen, nur mit großer Zurückhaltung eingegangen. Eine feste<br />
Ehren- und Repräsentationsstellung, vergleichbar derjenigen des<br />
20<br />
Münchner Dichterkreises um König Max II. , lehnt <strong>Scheffel</strong> ab.<br />
Mit dem Hinweis auf die Unverträglichkeit <strong>von</strong> freiem <strong>Dichterberuf</strong><br />
und höfischer Stellung erläutert er dem Wartburgkommandanten<br />
Arnswald, dem Freund der Familie <strong>Scheffel</strong> und Vertrauten<br />
des Großherzogs, seine Position:<br />
"Ich bin als Poet in der sonderbaren Lage, dadurch am meisten<br />
gefördert zu sein, daß man mich jeden Dienstverhältnisses<br />
enthebt, f...] Ich würde meinen, für die Poesie angestellt<br />
zu sein, wenn ich eine dauernd bindende Position annähme,<br />
und das würde mir alle Freude am Schaffen beunruhigen." (21)<br />
Doch erklärt <strong>Scheffel</strong> sich bereit, unter dem Eindruck des soeben<br />
fertiggestellten Sängerkriegfreskos Moritz <strong>von</strong> Schwinds<br />
auf der Wartburg einen historischen Roman <strong>im</strong> S t i l seines Lkkekand<br />
als Auftragsarbeit anzufertigen. Dieser Wartburgroman wird<br />
nie vollendet werden; nur die ursprünglich als lyrische Einlagen<br />
geplanten Gedichte hat <strong>Scheffel</strong>, mit einem Vorwort und der Widmung<br />
an den Großherzog, gleichsam als Ersatz als Gedichtsammlung<br />
Tnau Aventlune veröffentlicht. Als Gegenleistung läßt ihm der<br />
Großherzog durch Arnswald den Professorentitel anbieten.<br />
Spätestens an dieser Stelle beginnt eine Gesinnungsgemeinschaft<br />
zwischen dem politischen Herrscher und dem <strong>bürgerlichen</strong> Dichter<br />
sich aufzubauen. Daß <strong>Scheffel</strong> diese Ehrung durch den Fürsten<br />
ablehnt, wird schon nicht mehr nur mit der Unvereinbarkeit <strong>von</strong><br />
Amt und <strong>Dichterberuf</strong> begründet, sondern mit der Frage nach der
130<br />
Reaktion der <strong>bürgerlichen</strong> Öffentlichkeit:<br />
"Die böse Welt hätte Grund zu boshaftem Gerede. Mir persönl<br />
i c h aber i s t , so lang ich mit schriftstellerischen Arbeiten<br />
beschäftigt bin, jede Beziehung zu einem öffentlichen Amte<br />
eine Quelle <strong>von</strong> Befangenheit, f...] Und einem Amte gebe ich<br />
mich mit ebenso ungetheilter Dienstbereitwilligkeit hin wie<br />
den Arbeiten der Musen. Vereinigen aber läßt sich Beides -<br />
wenn man Beides ernst n<strong>im</strong>mt - ebenso wenig, als man Schiffskapitän<br />
und Vorstand einer landwirthschaftlichen Anstalt zugleich<br />
sein kann. Dies i s t <strong>von</strong> mir keine vorgefaßte Meinung,<br />
sondern das Resultat meiner Lebenserfahrung." (22)<br />
Man sieht, wie die bisher strikte Ablehnung aller Ehrenbeweise<br />
sich aufzulösen beginnt.<br />
Nach seiner Verheiratung und damit <strong>im</strong> Stande bürgerlicher Gesetztheit<br />
wird sich <strong>Scheffel</strong> auch nicht mehr sträuben, den Hof-<br />
23<br />
r a t s t i t e l anzunehmen . Aber trotz dieser aus der <strong>bürgerlichen</strong><br />
Gesellschaft herausgehobenen Position bleibt ein Minderwertigkeitsgefühl<br />
bestehen, als Bürger am Fürstenhof in dauerndem<br />
2/<br />
Rechtfertigungszwang zu stehen .<br />
Mit dem historisch-literarischen Zufall, daß <strong>Scheffel</strong>s Fürstendienst<br />
ausgerechnet am We<strong>im</strong>arer Hof stattfindet, i s t zugleich<br />
der Fragenkomplex des Epigonentums angeschnitten. Goethes<br />
klassisches und Geibels zeitgenössisches Vorbild des Fürstendiensts<br />
lassen sich für <strong>Scheffel</strong> so direkt nicht nachvollziehen.<br />
Ob die Fürstengunst für <strong>Scheffel</strong>s Erfolg entscheidend oder sogar<br />
2 5<br />
hinderlich war , spielt dabei keine Rolle, höchstens der innere<br />
Widerstand <strong>Scheffel</strong>s, sich zu eng und ausschließlich an seinen<br />
Mäzen zu binden. Im Unterschied zum Opportunismus zeitgenössischer<br />
Dichterkollegen plagen <strong>Scheffel</strong> poetische Skrupel, als<br />
er eines dieser verlockenden Angebote ablehnt:<br />
"Alles mit sammt dem Gehalt i s t be<strong>im</strong> Teufel, und ich bin<br />
eigentlich ein sehr leichtsinniger, dummer Kerl, daß ich -<br />
den Seifenblasen der Poesie zu lieb, solche Opfer bringe,<br />
die mir Niemand dankt und die Mehrzahl noch dazu gänzlich<br />
verkennt." (26)<br />
Aber weniger der Fürstendienst i s t es, der <strong>Scheffel</strong> bedrückt,<br />
als die Angst, daß die bürgerliche Öffentlichkeit dies als<br />
Fürstendienerei auslegen könnte:<br />
"Sonntag war ich bei Großherzog und auf seinen Befehl be<strong>im</strong><br />
academischen Essen, als der Universität octroyirter Gast,<br />
der oben zum Hof gesetzt wurde. Dies hat mich genirt. [. .<br />
Ich finde es nicht recht, auf diese Weise ausgezeichnet zu
131<br />
werden, die alle Andern vor den Kopf stossen muß und mir -<br />
<strong>von</strong> vorneherein alle die Hofleute, mit Ausnahme Arnswalds,<br />
zu Feinden macht." (27)<br />
Vor allem wendet sich <strong>Scheffel</strong> gegen solche ungerechtfertigte<br />
Gunstbeweise seines Großherzogs, solange sie nur seine soziale<br />
und materielle Stellung betreffen. Sein dichterisches Selbstbewußtsein<br />
i s t dagegen ungebrochen, wenn sich die fürstliche Anerkennung<br />
darauf bezieht:<br />
"Nach We<strong>im</strong>ar und der Wartburg gehe ich dann auch nicht, weil<br />
ich nicht als ein Gnade und Protection Suchender dort fungiren<br />
w i l l , sondern als ein für Geschichte und Poesie des<br />
Landes Verdienter." (28)<br />
"Im Dienste der Herrschenden, ihr Herold und Verklärer" i s t<br />
<strong>Scheffel</strong> insoweit, als er sein dichterisches Formeninventar der<br />
Fürstenhuldigung anpaßt. "Das glückhafft Schiff", ein "Kaisergruß<br />
auf Mainau", gedruckt 1887, hat die Hochzeit der badensischen<br />
Prinzessin <strong>Viktor</strong>ia zum Anlaß und Gegenstand. Ein allegorisches<br />
Bodenseeschiff mit jubelnden Jungfrauen landet auf der<br />
Insel Mainau. Für Ort und Personal der Hochzeitsfeier i s t der<br />
berühmte Bodenseedichter <strong>Scheffel</strong> gerade der richtige Mann. Seine<br />
Dichtung als Schmuck <strong>von</strong> festlichen und repräsentativen Veranstaltungen<br />
verschönt den rauhen Alltag durch Poesie, so wie<br />
ausnahmsweise Blumensträuße "in der Geschütze Mund" gepflanzt<br />
worden sind (11,137). Großherzog und Großherzogin <strong>von</strong> Baden sind<br />
anwesend; Ihr Familienglück wird <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> identisch gesetzt<br />
mit der staatlich-politischen Wohlfahrt des Landes. Das Herrschaftsideal<br />
i s t <strong>im</strong> Festakt verwirklicht (11,14-0: "Das i s t verwirklicht<br />
jetzt und Gegenwart"). Den Höhepunkt der Feierlichkeit<br />
aber bildet die Anwesenheit des Kaisers, des höchsten Verwandten<br />
der Gefeierten, dessen Erwähnung als Steigerung bis zum<br />
Schluß aufgespart worden i s t . Nicht "mild" und "hell" wie be<strong>im</strong><br />
Landesfürstenpaar und ihrer Tochter vollzieht sich diese Huldigung:<br />
der Kaiser wird "in Ehrfurcht" begrüßt (II,HO). Statt<br />
"glückauf!" ruft man dem Kaiser zu: "Heil Kaiser Dir! Willkommen<br />
Majestät!" (11,141). Diese Differenzierung in der Huldigung<br />
zeigt die Intention des Scheffeischen Festgedichts an. Das<br />
Fürstenlob bleibt repräsentativer Schmuck der Familienfeier und<br />
i s t noch keine poetische Rechtfertigung der Fürstenherrschaft<br />
<strong>im</strong> Deutschen Reich, wie man es <strong>von</strong> der Gattung erwarten könnte.<br />
29
132<br />
Der "Prolog für die Festvorstellung <strong>im</strong> Stadttheater zu Mühlhausen<br />
i . E.Asaß!/ am 19. November 1884" (II,U3-152) s t e l l t in<br />
fünf lebenden Bildern Szenen aus der Reg<strong>im</strong>entskommandantur des<br />
Erbprinzen Wilhelm vor. "Ein ungewohnter Festglanz füllt die<br />
Räume" (11,14$)» denn das Militär hat für seine Festlichkeit<br />
einen poetischen Rahmen gewählt:<br />
"Soldaten sind's, die an des Friedens Künsten<br />
Sich heut erfreuen und am Bühnenspiel:<br />
Den Musen lauscht ein kriegrisch Publikum."(II,14$)<br />
Den Höhepunkt bildet allerdings erst das vierte Bild, das <strong>von</strong><br />
den Beziehungen und den Leistungen badischer Reg<strong>im</strong>enter <strong>im</strong> Krieg<br />
<strong>von</strong> 1870/71 handelt. "In f e i e r l i c h bewegtem Ton" (11,151), wie<br />
die Regieanweisung lautet, wird die nationalchauvinistische<br />
Selbstdarstellung auf die Ebene einer badischen Offiziersfeier<br />
heruntergeholt. Nur dadurch i s t das Nationale überhaupt erwähnenswert,<br />
als sich damit die Leistung des 112. Reg<strong>im</strong>ents <strong>im</strong> Krieg<br />
mit Frankreich beweisen läßt: "Die Hundertzwölfer waren auch dabei!"<br />
(11,151). Symptomatisch i s t , daß das "Hurra dem Kaiser und<br />
dem deutschen Reich!" (11,152) dem Kaiser als oberstem Kriegsherrn<br />
g i l t , aber nicht das Ende der Ehrung ausmacht: "die sieggekrönte<br />
Germania" reicht nicht ihm, sondern dem badischen Prinzen<br />
und Reg<strong>im</strong>entskommandeur Wilhelm "einen Lorbeerzweig" (11,152).<br />
So gesehen fungieren diese Huldigungsgedichte eher als Beweise<br />
für die persönliche Zuneigung <strong>Scheffel</strong>s zu seinen Gönnern, etwa<br />
der "Festgruß zur Vorfeier des Geburtstags des Fürsten Carl Egon<br />
<strong>von</strong> Fürstenberg" <strong>von</strong> 1858 (IX,125f), das "Festlied zum fünfzigsten<br />
Geburtstag des Großherzogs Friedrich <strong>von</strong> Baden" vom 9. September<br />
1876 (lX,199f) und der "Jubiläumsgruß" zu de ssen 25jährigem<br />
Regierungsjubiläum am 24. April 1877 (IX,2I5f). Kennzeichnend<br />
i s t jeweils, daß die poetische Form als dekorative Verkleidung<br />
<strong>von</strong> Feierlichkeiten verwendet wird. Uberhaupt scheint das Fest<br />
als Medium der SelbstdarStellung Themenstellung, Sprechebene und<br />
Huldigungsformeln so weit vorzugeben, daß die persönliche Handschrift<br />
des Dichters sich weitgehend verwischt.<br />
Aber auch in solch marginalen Auftragsarbeiten findet jene schon<br />
behandelte Polarität <strong>von</strong> Höhe und Tiefe Eingang, aus der die<br />
30<br />
"Verachtung der <strong>bürgerlichen</strong> Welt" spricht. Denn in der "zeit-<br />
31<br />
genössischen Angleichung <strong>von</strong> Fürst und Dichter" s t i l i s i e r t
133<br />
sich der Dichter auf realgesellschaftlich nicht erreichbare Höhen,<br />
<strong>von</strong> denen aus er in eine poetisch verklärte Gemeinschaft mit dem<br />
Fürstentum e i n t r i t t . Diese Gemeinschaft manifestiert sich für<br />
<strong>Scheffel</strong> in scheinbaren Äußerlichkeiten:<br />
"Der Poet hat a l l e r l e i Vorrechte, die sich andere Leute nicht<br />
herausnehmen dürfen; er redet Kaiser und Könige mit Du an,<br />
und man n<strong>im</strong>mt's ihm nicht übel." (32)<br />
So gesehen sind es nicht bloß Marotten, wenn sich <strong>Scheffel</strong> als<br />
Student und in seinen Briefen an den &nge./ie.n gern als Fle.l*te./i<br />
3-OAe.ph.u./> vom dil/i/ian A/>t bezeichnet und bezeichnen läßt; wenn er<br />
ernsthaft mit dem Gedanken spielt, sich die Burg Schwaneck in<br />
Pullach bei München zu kaufen. Von dieser letzteren anti<strong>bürgerlichen</strong><br />
Aktion kommt <strong>Scheffel</strong> allerdings bald ab, denn, so<br />
schreibt er an seine Mutter, "es würde meinem <strong>bürgerlichen</strong> Charakter<br />
eine sonderbare Färbung geben, wenn ich eine moderne Burg<br />
33<br />
bewohnen und besitzen wollte" . Die Verlockungen der feudalen<br />
Lebensform werden gerade noch durch den "<strong>bürgerlichen</strong> Charakter"<br />
aufgefangen!<br />
Die <strong>im</strong> Hintergrund stehende öffentliche Meinung, die <strong>Scheffel</strong>s<br />
Träume auf den Boden der <strong>bürgerlichen</strong> Tatsachen zurückholt, i s t<br />
trotzdem nicht gehindert, dem <strong>bürgerlichen</strong> Dichter einen dichterfürstlichen<br />
Anspruch zuzugestehen. Der <strong>Scheffel</strong>verehrung i s t<br />
es gelungen, <strong>Scheffel</strong>s Volkstümlichkeit zu propagieren und<br />
gleichzeitig seine Neigungen zum poetischen Feudalismus zu tolerieren.<br />
Sie pflegt noch <strong>im</strong> Jahre 1926 "<strong>Scheffel</strong>s Andenken in<br />
zweiundvierzig Denkmalstätten - Standbildern, Büsten, Plätzen,<br />
Straßen, ja Burgen selbst!" y * 9 also in Ehrungen, die <strong>im</strong> allgemeinen<br />
nur Füsten zuteil werden. Diese Anerkennung eines dichterfürstlichen<br />
Status wird dann gerade mit <strong>Scheffel</strong>s Volkstümlichkeit<br />
begründet!<br />
Die aristokratische Selbsterhöhung des Dichters meint als eine<br />
typische Zeiterscheinung der Gründerzeit ja auch einen realgesellschaftlichen<br />
Anspruch. Der Dichterfürst, getragen <strong>von</strong> der<br />
Verehrung eines geringgeschätzten Bürgertums, repräsentiert in<br />
seiner Person die gesellschaftliche Struktur der Kaiserzeit in<br />
den Nobilitierungsbestrebungen des Bürgertums zu einer <strong>bürgerlichen</strong><br />
Feudalgesellschaft. Dennoch muß <strong>Scheffel</strong> auch mit abweichenden<br />
Reaktionen seiner Leser rechnen. Auf die Verleihung
134<br />
des erblichen Adels zu seinem 50. Geburtstag erhält <strong>Scheffel</strong><br />
ein Gedicht aus Washington, unterzeichnet <strong>von</strong> einem Robert<br />
Reitzel, "Sprecher der freien Gemeinde", der in der Zitatparodie<br />
<strong>von</strong> frühen <strong>Scheffel</strong>gedichten den burschikosen Antiphilister<br />
<strong>Scheffel</strong> dem verächtlich gewordenen Fürstendiener gegenüberstellt<br />
<strong>Scheffel</strong> war, wie er bekennt, <strong>von</strong> dieser Art der Reaktion seiner<br />
Lesergemeinde schwer getroffen:<br />
"Der Pfarr' <strong>von</strong> Asmannshausen spricht:<br />
Die Welt i s t t i e f entartet,<br />
Doch daß der <strong>Joseph</strong>us sich adeln läßt,<br />
Das hätt' ich nicht erwartet.<br />
Ist das des fahrenden Schülers Art,<br />
Daß, wenn er alt geworden,<br />
Er sich das Kamisol besteckt<br />
Mit einem Fürstenorden?<br />
Ist das nicht schlichten Namens Hohn,<br />
Den Du mit Ruhm getragen,<br />
Daß sie Dir ihn mit einem <strong>von</strong><br />
Zuletzt zu schänden wagen?<br />
Welch Wälschland i s t ' s , das diesmal Dir<br />
Den freien Sinn verdorben,<br />
In welchem Kapua i s t Dir<br />
Alemann'scher Stolz erstorben?<br />
Steigt Dir das Blut nicht ins Gesicht,<br />
Wenn sie an Uhland mahnen?<br />
Hat freies Wort nicht mehr Gewicht,<br />
Als Lob <strong>von</strong> Untertanen?<br />
Wohl bringt man Dir den Willekum<br />
Vom Rhein- und Donaustrande,<br />
Doch überm Meer, da schütteln wir<br />
Das Haupt ob Deiner Schande.<br />
Der Meister <strong>Joseph</strong>us bleibt uns hold<br />
Im Engern wie <strong>im</strong> Weitern,<br />
Jedoch der Herr <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> wird<br />
An unsern Küsten scheitern." (35)<br />
Daß das Streben des Dichters in höhere poetische und soziale<br />
Sphären durch das deutsche Bürgertum (! Amerika-Auswanderer<br />
184-8) nicht abgebremst wird, liegt nicht zum mindesten in der<br />
Förderung, die der Dichter <strong>von</strong> seiten des Fürsten erhält. Anfangs<br />
i s t es noch der Dichter <strong>Scheffel</strong>, der dem Großherzog die<br />
Teilhabe an seiner Poesie untertänig anbietet:<br />
"und wenn es mir je einstmals gelingen sollte, ein fröhliches,<br />
farbenfrisches Wartburgbild aus den Zeiten, da Minnelied u.
135<br />
gewappneter Männer Schritt durch jene Hallen tönten, zu schaffen,<br />
so bin nicht ich der, der es zeichnet, sondern es i s t der<br />
künstlerische Sinn Euer Königl. Hoheit, der es in mir wachgerufen."<br />
(36)<br />
Doch bald schon erhebt die politische Macht einen realen Anspruch<br />
auf die Poesie und den Dichter: "Deshalb auch i s t es mir eine<br />
liebe Nothwendigkeit geworden, Sie als mir gehörend zu betrach-<br />
37<br />
ten", schreibt der Großherzog an <strong>Scheffel</strong> . Diese - <strong>von</strong> Seiten<br />
des Dichters - nicht mehr ganz f r e i w i l l i g e Gemeinsamkeit mit<br />
dem Fürsten w i l l den Mangel auf beiden Seiten kompensieren, den<br />
38<br />
politischen be<strong>im</strong> Dichter und den poetischen be<strong>im</strong> Fürsten . In<br />
dieser idealen Gemeinschaft <strong>von</strong> Fürst und Dichter setzt sich<br />
schon bald der materielle Besitzanspruch des Fürsten durch, der<br />
39<br />
<strong>Scheffel</strong> als "meinen gefeierten Dichter" beansprucht . Mehr<br />
noch: wenn der König <strong>von</strong> Württemberg sich zu <strong>Scheffel</strong> über dessen<br />
Lkkaka/id äußert: "Es i s t sehr schön <strong>von</strong> Ihnen, daß Sie mir<br />
meinen Hohentwiel besungen haben! "^, wird deutlich, daß der<br />
fürstliche Herrschaftsanspruch sich auch auf die Poesievorlage<br />
erstreckt. So i s t es nur konsequent, wenn aus den Anregungen<br />
des Fürsten für die Auftragsarbeiten in der Gattung des lyrischen<br />
Festspiels nach und nach dessen Mitarbeit wird:<br />
"Mein Sohn wird, so Gott w i l l , Mitte September mit seiner<br />
jungen Gattin seinen Einzug auf der Wartburg halten. Wir<br />
möchten diesen Einzug auf eine der Wartburg würdige Art<br />
feiern/ Ich rufe deshalb Ihre Muse und Ihr Herz an um Beistand.<br />
Ich denke mir dies folgender Maaßen: /". . .7" (4-1)<br />
So formuliert der Großherzog einen weiteren Huldigungsauftrag<br />
an seinen Dichter <strong>Scheffel</strong>; oder noch deutlicher:<br />
"So dachte, so denke ich mir den Plan und wie auch der einfachste<br />
Mensch den Dichter zum Dichten begeistern kann, indem<br />
er ihm irgend eine Blume in günstigem Augenblick hinreicht,<br />
so möchte ich beides gefunden haben: Zeitpunkt und Blume, denn<br />
den rechten Dichter, das weiß ich am besten, den habe ich gefunden."<br />
(42)<br />
Als <strong>Scheffel</strong> nach kaum mehr als einer Woche(!) das Festspiel<br />
übersendet, kann er die Vollendung <strong>von</strong> Text und Aufführung getrost<br />
dem Fürsten als seinem Mitdichter überlassen: "Die Anordnung<br />
und Ausführung des Schlußtableau stelle ich ganz den näher<br />
43<br />
eingehenden Anordnungen Ew. Kön. Hoheit anhe<strong>im</strong>."^<br />
Dichter, Thematik und Werk haben ihre "Unabhängigkeit" verloren,<br />
gerade wenn sie so heftig beschworen wird wie durch den Groß-
136<br />
herzog:<br />
"In Unabhängigkeit würden Sie mir abgehören, wenn auch durch<br />
Namen und hoffentlich That eng mir verbunden und gern würden<br />
unsere Geister in dem Namen/=Wartburg und Wartburgroman_7 einen<br />
Vereinigungspunkt finden, in welchem wir durch Vorliebe und<br />
gegenseitige Erkennung uns längst begegneten." (44)<br />
Seine Auftragsdichtung bis hin zur Enteignung seines poetischen<br />
Produkts durch den Fürsten schlägt bei <strong>Scheffel</strong> deshalb unversehens<br />
um in eine kritische Distanz, die den Dichter seine<br />
falsche sozial-poetische Integration gewahr werden läßt. Klarsichtig<br />
durchschaut <strong>Scheffel</strong> die politische Verschleierungsfunktion<br />
dieses Mäzenatentums seines Großherzogs:<br />
"Es wird mit der alten Gloria der Burg/=Wartburg7 einiger<br />
Humbug getrieben, damit die Leute die Misere der Gegenwart<br />
nicht betonen. /". . .] Baden und We<strong>im</strong>ar haben gegen die Frankfurter<br />
Anträge und Reformpläne gest<strong>im</strong>mt und sind damit demaskirt<br />
als das, was sie in Wahrheit sind: preußische Provinzen<br />
- Gegner Deutschlands. Das wäscht keine Kunst der<br />
Welt ab. Und wenn Preußen seinen längst beschlossenen und<br />
bald nicht mehr vermeidlichen Kampf mit den anderen Deutschen<br />
anhebt, werden die beiden kunstsinnigen Großherzöge mit ihren<br />
Truppen unter schwarzweißer Fahne gegen die anderen zu Felde<br />
ziehen." (45)<br />
3. Der Wanderdichter<br />
In der mentalen Struktur des Bürgers als Dichter i s t nicht nur<br />
die Tendenz zum Dichterfürsten angelegt, sondern auch eine andere<br />
Lebens- und Dichterrolle, nämlich die des Wanderers. Spez<br />
i e l l bei <strong>Scheffel</strong> i s t diese Dicht- und Lebensform des Wanderns<br />
schon <strong>im</strong>mer angelegt gewesen in der Rolle des ewigen Studenten<br />
und fahrenden Schülers, wobei das Vorbild mittelalterlicher Vaganten<br />
und Spielleute nachwirkt. Ins bürgerliche Leben i s t diese<br />
Rolle als die eines naturgenießenden Wanderers eingepaßt durch<br />
ihre antibürgerliche Stellung innerhalb der Bürgerwelt. Den verhaßten<br />
Philistern bleibt der fahrende Schüler "antibürgerlich<br />
<strong>im</strong> Rahmen des Bürgerlichen"^, weil er die Sehnsüchte und Wunschträume<br />
dieser Gesellschaft in sich trägt, obwohl er vorgibt,<br />
sich <strong>von</strong> ihr absetzen zu wollen. Das Befremden des Bürgers über<br />
47<br />
das <strong>Zeitalter</strong> der Eisenbahn^" n<strong>im</strong>mt die Beschleunigung a l l e r
137<br />
Lebensverhältnisse <strong>im</strong> Bild des Wanderers auf, der die Bewegung<br />
des <strong>Zeitalter</strong>s zwar mitmacht, sie aber auf ein vorindustrielles<br />
und individuumorientiertes Maß zurückschraubt.<br />
Schon die biographische Studie <strong>Joseph</strong> Stöckles <strong>von</strong> 1888 hatte<br />
<strong>Scheffel</strong> gleichsam als Verkörperung dieser Lebensform, als einen<br />
"Dichter des fröhlichen Wanderns und harmlosen Genießens" ge-<br />
L 8<br />
deutet 4 und <strong>im</strong> Wandermotiv ein Strukturmerkmal gesehen, das<br />
Gesamtwerk und Leben <strong>Scheffel</strong>s durchzieht. In gewisser Weise<br />
lassen sich <strong>Scheffel</strong>s Werk- und Lebensgeschichte tatsächlich als<br />
eine Geschichte <strong>von</strong> Wanderungen begreifen. Im "Lied fahrender<br />
Schüler" des Qau.de.amat (IV, 34) werden die Vagantenlieder aus den<br />
Cas<strong>im</strong>ina (Lu/iana nicht nur als Motto z i t i e r t , sondern prägen die<br />
Gedichtstruktur mit. Allerdings i s t die Vagantenfigur ihrer<br />
sozialen Funktion als Kulturträger und Mobilitätsmotor innerhalb<br />
der mittelalterlichen Gesellschaft enthoben und <strong>von</strong> Scheff<br />
e l in eine zeitlose und existentielle Lebensform gewendet:<br />
"Fahrende Schüler, unstete Kind,<br />
Sänger und Spieler, wirblige Wind." (IV,34)<br />
Zugleich spielt die Rolle wie so oft bei <strong>Scheffel</strong> ins Humoristische;<br />
die Tavernenpoesie der Ca/<strong>im</strong>ina Ha/iana i s t ja dem Wandermotiv<br />
schon inhärent. Auch <strong>Scheffel</strong>s fahrende Schüler sind <strong>im</strong><br />
Grunde auf den Weinkeller des Pfarrherrn aus, erwandern also nur<br />
den<br />
Wein.<br />
Auch <strong>im</strong> berühmtesten Lied <strong>Scheffel</strong>s, seinem Frankenlied (lV,35f),<br />
wird die Wandererfigur in eine vorindustrielle, metaphorisch<br />
'mittelalterliche' Szenerie eingebettet:<br />
"Wohlauf, die Luft geht frisch und rein,<br />
Wer lange s i t z t , muß rosten;<br />
Den allersonnigsten Sonnenschein<br />
Läßt uns der H<strong>im</strong>mel kosten.<br />
Jetzt reicht mir Stab und Ordenskleid<br />
Der fahrenden Scholaren,<br />
Ich w i l l zu guter Sommerzeit<br />
Ins Land der Franken fahren!" (IV,35<br />
Was man dabei leicht übersieht: noch weiter als be<strong>im</strong> vorigen<br />
Gedicht wird <strong>von</strong> der Bindung an ein historisch konkretes Vagantentum<br />
abstrahiert zugunsten einer traulich-naturhaften Volksliedatmosphäre.<br />
Trotzdem bleiben hinter der Wanderseligkeit die<br />
Rollenbest<strong>im</strong>mungen der 'mittelalterlichen' Lebensweise der<br />
"Scholaren" erhalten. Das hindert das lyrische Ich f r e i l i c h
138<br />
nicht, <strong>im</strong> Natureingang mit ähnlichem Konjunktivgebrauch wie bei<br />
Eichendorff zum romantischen Uber-Wanderer zu werden: "Ich<br />
wollt', mir wüchsen Flügel" (IV,35). Das Wandern, hier schon als<br />
Begründung gegen das "Rosten" der (<strong>bürgerlichen</strong>) Umwelt gewendet,<br />
i s t bedingt durch die St<strong>im</strong>ulanz einer ebenfalls wandernden<br />
Umgebung:<br />
"Wallfahrer ziehen durch das Tal<br />
Mit fliegenden Standarten." (IV,35)<br />
Der Wanderer paßt sich einer universalen Lebensform des Wanderns<br />
an.<br />
Noch weiter vom ursprünglichen historischen Bezug auf vorindus<br />
t r i e l l e Lebensverhältnisse i s t das Gedicht "Ausfahrt" (IV,64.)<br />
entfernt. Als Motto vor die Gedichtfolge AUA dem Ue.ite./ie.n ges<br />
t e l l t , paßt es in seiner Allgemeinheit auf alle diese Lieder<br />
und verkörpert so eine Art Grundprinzip des Wanderlieds:<br />
"Berggipfel erglühen,<br />
Waldwipfel erblühen<br />
Vom Lenzhauch geschwellt;<br />
Zugvogel mit Singen<br />
Erhebt seine Schwingen,<br />
Ich fahr' in die Welt.<br />
Mir i s t zum Geleite<br />
In lichtgoldnem Kleide<br />
Frau Sonne bestellt;<br />
Sie wirft meinen Schatten<br />
Auf blumige Matten,<br />
Ich fahr' in die Welt.<br />
Mein Hutschmuck die Rose,<br />
Mein Lager <strong>im</strong> Mose,<br />
Der H<strong>im</strong>mel mein Zelt:<br />
Mag lauern und trauern,<br />
Wer, w i l l , hinter Mauern,<br />
Ich fahr' in die Welt." (IV,64)<br />
Das Wandern i s t hier nicht allein als eine Beziehung <strong>von</strong> Ich und<br />
Naturausdruck best<strong>im</strong>mt. Der Refrain, in die Welt zu fahren,<br />
fordert zum Ausbruch au* der Stadt auf, der modernen Industriestadt<br />
des 19. Jahrhunderts, die noch in ihrer vor<strong>bürgerlichen</strong><br />
Erscheinungsform ("Mauern") Eingang findet. Dieser Natureingang<br />
als Aufbruch- und Ausbruchst<strong>im</strong>mung läßt sich bis in S t i l i s t i s c h e<br />
L 9<br />
hinein fassen . Die Natur kann geradezu be<strong>im</strong> Wandern mitgenommen<br />
werden, die Rose wird an den Hut gesteckt, das Moos wird<br />
zum Lager, der H<strong>im</strong>mel zum Zelt des Wanderers.
139<br />
Daß dem Bild dieser "Mauern" ein ganz best<strong>im</strong>mtes Gegenbild <strong>von</strong><br />
Freiheit entspricht, zeigt das 184-6 entstandene Lied "Abfahrt"<br />
aus dem Zyklus Lie.de.si einet fah/ienden Schü£e/it:<br />
"Nun s o l l es auf die Wand'rung geh'n,<br />
Studieren hab ? ich satt;<br />
Leb* wohl! Das Scheiden fällt nicht schwer,<br />
Du hochgelahrte Stadt!" (IX,25)<br />
Der Abschied vom studentischen Leben, dessen Funktion schon gezeigt<br />
wurde, t r i t t zum Ausbruch aus der Stadt. Dagegen setzt<br />
der Wanderer jetzt eine neue Form des Studierens:<br />
"Feldflasche du, voll würz'gen Weins,<br />
Du sei mein einzig Buch,<br />
In dem ich noch studieren w i l l<br />
Mit manchem tiefen Zug." (IX,26)<br />
Das Wandern wird l e t z t l i c h sogar zum "Glaubensbekenntnis", wie<br />
der Titel des folgenden Gedichts lautet (IX,26). Das Gedicht<br />
"Auf der Heerstraß'" (IX,27f) benennt konkret und humoristisch,<br />
welche Form <strong>von</strong> Freiheit gemeint i s t . Der Wanderer zieht auf<br />
"freier Heerstraß'" (I£,27); Natur und lustiges Wandervolk<br />
gliedern sich in die WanderSt<strong>im</strong>mung ein - nur eins,<br />
"Das passet nicht ins Frei'!<br />
- - Das i s t die hochwohlweise und<br />
Gestrenge Polizei." (50)<br />
<strong>Scheffel</strong> hat, als Dichter ein "Lebenswanderer mit der Muse <strong>im</strong><br />
51<br />
Gepäck" , die Bedeutung dieser Wanderideologie ausführlich<br />
kommentiert und in seinen Lebenszusammenhang eingebettet. Schon<br />
der 18jährige bemerkt: "das Reisen um zu /leiten hat wenig<br />
52<br />
Nutzen" . "Meine Wanderlust i s t noch nicht eingeschlafen",<br />
53<br />
raeint er; sie wird ihm "wieder neue Kraft und Luft geben" . Die<br />
erfrischende Wirkung des Wanderns gegen die Frustrationen der<br />
Normalität und des Alltags g i l t erst recht in den Zeiten p o l i t i <br />
scher Enttäuschung nach 1848. Dann wird das Wandern zur Flucht<br />
aus der Wirklichkeit:<br />
"und wie ich sah, mit welchen Mitteln bei uns restauriert<br />
ward, da wurde es mir so unendlich schwül und eng zu Mute,<br />
daß ich's in dieser Atmosphäre nicht mehr aushalten konnte.<br />
Da nahm ich abermals den Wanderstab." (54)<br />
Die Rolle des Wanderers wird bald zu seinem Markenzeichen, durch<br />
5 5<br />
das sich <strong>Scheffel</strong> definiert: "ein fahrender Schüler wie ich" .
UO<br />
Mit dem ,selbstinterpretierenden Etikett des Lebenswanderers paart<br />
sich fast zwangsläufig das Selbstmitleid, wie es in einem Brief<br />
<strong>Scheffel</strong>s<br />
<strong>von</strong> 1851 heißt:<br />
"Sind nun schon 6 Jahre, seit ich bei dir in Jena eingezogen,<br />
- und ich bin noch derselbe fahrende Schüler, ohne Ruhe, ohne<br />
Stellung, mit unbefriedigtem Drang ins Weite" (56).<br />
An Paul Heyse adressiert kostet <strong>Scheffel</strong>, sozusagen aus dem<br />
Zwang seiner Rolle heraus, seine Isoliertheit <strong>im</strong> eigenen poetischen<br />
Vokabular aus, wobei er sich ins Existentielle s t i l i s i e r t :<br />
"ich meinerseits habe nur die eine Entschuldigung, daß ich<br />
nach mancherlei gesellschaftlicher Position und Einkettung<br />
wieder ein fah/ie.nde./i geworden (-omnia f u i , n i h i l expedit) -<br />
ein streifender gyrovager Heerstraßenbeschreiter, der, die<br />
Reisetasche umgehängt, den dürren Ast in der Hand, hinauszieht,<br />
der Sonne u. guten Herbergen entgegen, aventiuregewärtig,<br />
nicht ohne Staub und Durst der Natur wärmende<br />
Lebenshauche ablauschend." (57)<br />
Trotzdem erkennt <strong>Scheffel</strong> den fundamentalen Unterschied zwischen<br />
seiner Rolle und dem Herumziehen der mittelalterlichen Vaganten.<br />
Den Großherzog erinnert er daran,<br />
"daß ich selber einst wie ein mittelalterlicher Sänger unbefangen<br />
auf Ihrer Burg aus und eingegangen bin, ohne zu erwägen,<br />
daß das neunzehnte Jahrhundert in seinen sozialen Verhältnissen<br />
und Ordnungen einen fahrenden Dichter mit andern<br />
Augen betrachtet als die Vorzeit." (58)<br />
Der Anachronismus des Fahrenden <strong>im</strong> 19. Jahrhundert hindert ihn<br />
f r e i l i c h nicht, das Wandern wenn schon nicht als tragfähige<br />
Lebensform, so doch als Medium dichterischer Inspiration zu verwenden:<br />
"Aber der Schreibtisch hat noch keine Anziehungskraft<br />
für mich und es drängt mich <strong>im</strong>mer wieder zum Laufen und Berg-<br />
59<br />
steigen" . Als Therapie kann das Wandern den seelisch belasteten<br />
Künstler sogar wieder zur Kunst zurückführen, wie <strong>Scheffel</strong><br />
behauptet:<br />
"Des Gemüthes Bekümmerniß zu verwinden, den Geist sich selbst,<br />
der Betrachtung der Herrlichkeit Gottes in der Welt, und<br />
damit der Kunst zurückzugeben, i s t kein besser Mittel, denn<br />
Wandern." (60)<br />
Daß das Wandern den Rückweg zur Kunst offenhalte, i s t aber oft<br />
nur ein Vorwand für den kaum mehr dichtenden <strong>Scheffel</strong>. Er wandert<br />
meistens aus medizinischen Gründen, denn, so schreibt er<br />
61<br />
dem Arzt Erismann, "sonst vertrocknet Leib und Seele" , oder
U1<br />
aus psychischen Gründen: "sobald das Geblüt träge werden w i l l ,<br />
62<br />
nehme ich Stock und Reisetasche und thue einen Marsch" . Sogar<br />
als körperliche und seelische Abmagerungskur kann das Wandern<br />
benutzt werden:<br />
"Ich habe während der ganzen Kriegszeit ausgehalten, meine<br />
Schuldigkeit getan, bin aber so gedankenarm u. corpulent und<br />
faul geworden, daß ich mir zur Erholung in diesem Sommer die<br />
Strapazen großer Wanderungen auferlegt u. auch glücklich die<br />
Taille wieder zu erträglichem Durchmesser herabgemindert<br />
habe." (63)<br />
Mit der medizinischen Heilkraft geht eine Funktion des Wanderns<br />
einher, bei der die Erholung nach der poetischen Produktion mit<br />
der Inspiration fü/i neue dichterische Versuche zusammenfällt.<br />
So schreibt <strong>Scheffel</strong> 1855 an Schwanitz, nachdem er sich am<br />
Lkkehand "auf den Hund gearbeitet" hat:<br />
"Krampf <strong>im</strong> Arm und Reizbarkeit <strong>im</strong> Kopf, daß ich manchmal zusammenschaudere<br />
und zittere wie ein Espenlaub <strong>im</strong> Wind. Aber<br />
ich weiß die Medizin - und sag wahrscheinlich bald einmal den<br />
Büchern und der Studierstube Valet und wandere hinaus in die<br />
weite Welt; <strong>im</strong> frischen Leben s i t z t zudem eine tiefere und<br />
lautere Quelle der Erkenntnis, als in allem zusammengesuchsten<br />
gelehrten Zeug." (64.)<br />
Der rein biographische Aspekt der Wanderrolle <strong>Scheffel</strong>s wäre nun<br />
nicht so wichtig, wenn er nicht direkt in den literarischen Produktionsprozeß<br />
eingegangen wäre. Als Ideal des Dichtungsvorgangs<br />
schwebt <strong>Scheffel</strong> eine Situation vor, in der Wandern und Dichten<br />
zusammenfallen; das Dichten s o l l sogar während des Wanderns vor<br />
sich<br />
gehen:<br />
"oft pack ich Morgens meine Tasche und ziehe hinaus .... ohne<br />
zu wissen, was ich den Tag über arbeiten w i l l . f. ..] Wie ein<br />
Jäger <strong>von</strong> der Jagd gehe ich Abends ungern he<strong>im</strong> ohne ein Lied<br />
als Beute <strong>im</strong> Sack zu haben ... und ich lerne mich selbst <strong>von</strong><br />
einer neuen, mehr an Geibel anstreifenden Seite kennen, die<br />
ich bisher nicht viel beachtet habe. In der Studierstube der<br />
Stadt oder mit Unterbrechungen geselligen Lebens wäre solch<br />
ein Arbeiten nicht möglich." (6$)<br />
Im Gedicht "Dem Improvisator Hermann" <strong>von</strong> 1869 (IX,173f) schafft<br />
es ein Wortspiel, daß der Aufbruch des Fahrenden und der Aufruf<br />
zum Dichten tatsächlich identisch werden:<br />
"Liebreich i s t sein Benehmen,<br />
Sein Vortrag ein Akkord,<br />
Doch w i l l er Abschied nehmen,<br />
Ruft alle Welt: Jahn.' loit!" (IX,173)
U2<br />
Die daraus fast zwangsläufig resultierende Vereinzelung des Wanderers<br />
als Dichter erhebt die Welterfassung durch das Wandern<br />
bald ins Metaphysische:<br />
"Wer Gott und Welt w i l l recht verstehn,<br />
Durchstreift Gebirg und Tal" (IX,223).<br />
Insofern i s t der Anklang an Eichendorffs bekanntes Wanderlied<br />
aus dem 7 augenichtt symptomatisch: die Wanderschaft des Fahrenden<br />
wird in eine Bewegung des Kosmos eingebettet, die so romantisch<br />
wie anachronistisch i s t . Das Wandern bleibt die einzige<br />
Möglichkeit, sich seiner Umgebung richtig einzufügen.<br />
"Wer warm in warmem Neste<br />
Mit Weib und Brut sich pflegt,<br />
Der wähnt, die Welt steh' feste,<br />
Weil er sich nicht bewegt.<br />
Und doch geht alles Leben<br />
Bergan, bergab in wildem Lauf,<br />
Und muß, wer stirbt, noch schweben<br />
Gruftabwärts erst, dann h<strong>im</strong>melauf." (IX,164-)<br />
Doch i s t auch hier mit der Aufnahme des romantischen Motivs -<br />
man denke an Eichendorffs Gedicht die beiden Qetetten, an dessen<br />
vorgestellte doppelte Lebensform hier angespielt sein könnte -<br />
dem Bewußtsein des fortgeschrittenen Jahrhunderts Rechnung getragen.<br />
Freilich i s t die Lösung <strong>Scheffel</strong>s, dem <strong>von</strong> Eichendorff<br />
dargestellten Spießerdasein zu entkommen, reichlich banal: dem<br />
beschleunigten durch eigene Bewegung (<strong>im</strong> Wandern) zu entkommen<br />
zu<br />
versuchen!<br />
Romantik t r i v i a l i s i e r t ? Schon <strong>im</strong> Lkkekaid hatte <strong>Scheffel</strong> die<br />
blaue Blume des Novalis, das Bild universaler poetischer Erkenntnis,<br />
den Ziegen zum Fressen angeboten (VI, 384-). Jetzt wird<br />
daraus eine handliche Metapher:<br />
"Der Mann vom Sängerorden,<br />
Des Fahrens niemals müd,<br />
Weiß, wo <strong>im</strong> kältsten Norden<br />
Die blaue Blume blüht:<br />
Er schaut <strong>von</strong> hohen Warten,<br />
Wo träges Blut zu Eis gerinnt,<br />
Die Welt als Gottes Garten<br />
Und sich als Gottes freies Kind." (IX 9 164.)<br />
Mit der Wanderrolle i n f i z i e r t , wie es naheliegt, <strong>Scheffel</strong> auch<br />
sein Epigonentum. Die Geistesverwandtschaft mit Petrarca festigt<br />
<strong>Scheffel</strong> dadurch, daß dieser als Wanderer gesehen wird:
U3<br />
"Und ich weiß nicht, ob viele Leser das <strong>von</strong> andern über den<br />
Mann <strong>von</strong> Vaucluse /^PetrarcaJ gefällte harte Urteil billigen,<br />
wenn sie ihn, den Alpenstock in der Rechten und die Bekenntnisse<br />
des heiligen Augustinus in der Reisetasche, den Mont<br />
Ventoux hinauf- und hinabsteigen sehen" (VIII, 14-3).<br />
Dieser zentrale Stellenwert der Wanderrolle in <strong>Scheffel</strong>s Werk<br />
hat massiv die Rezeption <strong>Scheffel</strong>s als eines Wanderdichters begünstigt^.<br />
Diese Wanderideologie wird nicht nur begeistert<br />
übernommen, sondern <strong>von</strong> den Interpreten als die angemessenste<br />
Form für die Textbetrachtung internalisiert . Im Grunde hatte<br />
dies schon der erste Rezensent der T/tau Avantlu/ie. festgestellt:<br />
"Auch Herr <strong>Scheffel</strong> gehört noch diesen poetischen Zugvögeln<br />
an, indem er eine ferne He<strong>im</strong>ath sucht und die Gegenwart verläßt."<br />
(68)<br />
Kritisch und gewollt komisch i s t <strong>Scheffel</strong>s Lebensentwicklung als<br />
Wandel seiner Wanderrolle beschrieben worden: vom fahrenden<br />
Schüler zum fahrenden Dichter, der ein fahriger geworden i s t .<br />
Der Psychiater Möbius hat 1906 auf das Abgründige der "Ruhelosigkeit<br />
und Wandersucht" <strong>Scheffel</strong>s hingewiesen:<br />
"<strong>Scheffel</strong> i s t fast <strong>im</strong>mer unterwegs, und hätte er kein Geld<br />
gehabt, so wäre er ein Vagabund geworden, wie so mancher<br />
seiner Leidensgenossen es wird." (70)<br />
Erweitert man diese individualpathologische Deutung auf die gesellschaftliche<br />
Situation, so läßt sich die personale Wanderrolle<br />
<strong>Scheffel</strong>s in der Tat als Versuch werten, die Mobilität<br />
der Studentenzeit und deren antiphiliströse Haltung in das bürgerliche<br />
Leben wenigstens für die Wanderzeiten hinüberzuretten.<br />
Insofern ist <strong>Scheffel</strong>s Wanderleidenschaft ein "Mittel der Selbsttherapie",<br />
ein Versuch, Leben und Dichtung "poetisch zu kompen-<br />
sieren"<br />
71<br />
Aber gehen wir noch einmal zurück auf die Funktion des Wanderns<br />
in <strong>Scheffel</strong>s Dichtungen. Das Wandermotiv kann, etwa in den<br />
Liebesliedern Jung-Werners <strong>im</strong> 7/iompata/i, stellvertretend für<br />
Liebesentsagung stehen. Sogar das berühmteste Lied des Versepos<br />
73<br />
arbeitet kaum versteckt mit dieser Metaphorik . Die Entsagung<br />
der Liebenden wird sprachlich in einen Aufbruch zur Wanderschaft<br />
umgesetzt:<br />
"Die Wolken fliehn, der Wind saust durch die Blätter,<br />
Ein Regenschauer zieht durch Wald und Feld,<br />
Zum Abschiednehmen just das rechte Wetter,<br />
69
1U<br />
Grau wie der H<strong>im</strong>mel steht vor mir die Welt.<br />
Doch wend' es sich zum Guten oder Bösen,<br />
Du schlanke Maid, in Treuen denk' ich dein!<br />
Behiiet dich Gott! es war' zu schön gewesen,<br />
Behüet dich Gott, es hat nicht sollen sein!" (1,150)<br />
Die Wortwahl a l l e i n belegt die Teilhabe der Natur an dieser<br />
Wanderschaft des Helden. Der konjunktivische Refrain schließlich<br />
deutet darauf hin, daß das Wandern eigentlich nie zum Stillstand<br />
gekommen war. Ruhe und Frieden sind i r r e a l , eine Fiktion gewesen.<br />
Ganz ähnlich, nur in die Kunstfigur Heinrichs <strong>von</strong> Ofterdingen<br />
eingekleidet, wird in dessen "Abschied <strong>von</strong> der Stiraburg" (III,<br />
96f) der Aufbruch dargestellt. Auch hier wandern Natur und Gott<br />
mit:<br />
"Ich fahr' auf neuen Straßen ...<br />
Der Strom und Wellen wandern ließ,<br />
Der wird mich nicht verlassen." (111,97)<br />
Seine Arbeitsmethode, Stoff und Inspiration erwandern zu können<br />
(oder zu müssen), hat <strong>Scheffel</strong> programmatisch formuliert <strong>im</strong> Vorwort<br />
zur Novelle Junipe/iut. Der Erzählraum der Novelle entwickelt<br />
sich aus einem Landschaftsbild, das erwandert worden i s t . Stofffindung<br />
und -bearbeitung sind das Ergebnis "bewegter Wanderjahre",<br />
in denen es <strong>Scheffel</strong> vergönnt war, diese Landschaft als "Paradies<br />
des Wanderers" kennenzulernen (11,7). Zur Legit<strong>im</strong>ation und<br />
historischen Verklärung seiner Arbeitsweise beruft er sich auf<br />
den Geschichtsschreiber Aventinus, der fordert, man solle Kulturgeschichte<br />
"durchfahren", "besuchen und besichtigen und überhaupt<br />
seine besseren Gedanken wandernd" schweifen lassen ( l l , 7 f ) .<br />
<strong>Scheffel</strong>, "die Reisetasche des Fahrenden umgehangen", hat sich<br />
natürlich an diesen Vorschlag gehalten und "manch eynen Winkel<br />
durchloffen und durchkrochen" (11,8). Als "rudernder Talwegfahrer"<br />
hat er "auf jenen Pfaden" einige "solcher Gänge" getan<br />
(11,8). "Auf seinen Wanderungen" trägt er natürlich die<br />
Ca/<strong>im</strong>lna duiana, "der fahrenden Schüler lateinisches Liederbuch",<br />
bei sich (11,9). Von diesem Rückgriff in die vorindus<br />
t r i e l l e Wanderschaft aus erklärt sich auch die häufige Kritik<br />
<strong>Scheffel</strong>s an "des Dampfrosses Schnauben" (11,10).<br />
Man mag nun glauben, daß der biographisch nachweisbare Aufwand<br />
an Reisen und V/ander fahr ten das Ergebnis, eine dünne Erzählung<br />
<strong>von</strong> mehreren Dutzend Seiten, nicht lohne. An dieser Stelle er-
U5<br />
hält das Wandern nämlich ein so starkes Eigengewicht, daß es<br />
seiner Motivation, als Inspirationsantrieb für die dichterische<br />
Produktion zu dienen, nicht mehr bedarf. Allmählich wird Scheff<br />
e l das Wandern zum Selbstzweck, aus dem keine Werke mehr entstehen;<br />
das Wandern kann das Dichten restlos ersetzen:<br />
"Wenn das Fußwandern nicht für sich genug Arbeit gäbe, so<br />
hätte ich reizender Motive zu dichterischer Arbeit viele<br />
gefunden." (74)<br />
Daß <strong>Scheffel</strong> die Gefahr einer solchen 'Entartung' des Wanderns<br />
für sich als Dichter deutlich gesehen hat, zeigt das Gedicht<br />
"Irregang" aus der T/tau Avantiu/ia (111,69-71). Die Figur des<br />
Dorfmusikanten und fahrenden Spielmanns "<strong>im</strong> Faschingsnarrenkleid<br />
/ Mit Schall durchs Land gezogen" (111,69) t r i t t diesmal in<br />
einer Er-Rolle auf. <strong>Scheffel</strong> vermeidet den direkten Bezug des<br />
lyrischen Ichs auf den Autor wie bei der Figur Heinrichs <strong>von</strong><br />
Ofterdingen. Das Weiterwandern des Sängers wird zum Erzählmotiv<br />
und zur Handlungskontinuität ("Und als"-Anschlüsse). Erst "auf<br />
den Höhen" findet Irregang seine Ruhe; hier i s t er "zur rechten<br />
Stelle" (111,71). Doch der Ruhepunkt beweist die Vergeblichkeit<br />
dieses Wanderns, denn es i s t "Irregangs letzter Irregang":<br />
"Ich glaube, den Wandrer <strong>im</strong> Narrenkleid<br />
Hat Schnee und Sturmnacht begraben;<br />
Verschneit, verweht ... verweht, verschneit!<br />
Er wollt's nicht anders haben.<br />
Du weidlicher Meister Irregang,<br />
Sag an, wo bist du geblieben?<br />
... Die Flocken fliegen in wirbelndem Drang,<br />
Stäuben zusamm ... und zerstieben ..." (111,71)<br />
Hier erst gibt sich der Ich-Erzähler als sarkastisch-fatalistischer<br />
Kommentator zu erkennen: "Er wollt's nicht anders haben".<br />
Negativen Einschlag bekommen die fahrenden Schüler auch in<br />
<strong>Scheffel</strong>s Wartburgromanfragment. Dort treten sie nur noch als<br />
7 5<br />
"fahrende Leute" , als Diebesgesindel und Wandervögel auf,<br />
ein Volk, das<br />
"hinauszieht in die Welt, mit Kunst, Gunst und Dunst sich<br />
durchschlagend, f...] Manch einem aber war auch bei sehnlichem<br />
Begehr der Rückkehr durch früheren Frevel die He<strong>im</strong>ath für<br />
<strong>im</strong>mer verschlossen und er mußte geächtet und f/iiadatotgatagt<br />
durch fremde Lande dahinfahren bis an sein selig End." (76)<br />
<strong>Scheffel</strong>s alter Freund Paul Heyse legt den Finger auf die Wunde,<br />
wenn er <strong>Scheffel</strong>s Wanderideologie mit seinem gutgemeinten Rat-
U6<br />
schlag auf die banale Häuslichkeitsideologie des gesetzten Bürgers<br />
zurückführt:<br />
"Daß ein Zug der Melancholie auf Deiner Stirn sich eingegraben,<br />
der fast nicht mehr schwinden w i l l , habe ich leider<br />
schmerzlich wahrgenommen. Dein fahrendes Leben trägt wohl die<br />
Hauptschuld. Es i s t ganz lustig, die Welt an sich vorübergehn<br />
zu lassen; aber man muß feststehn, wenn auch nicht<br />
s t i l l e . Deine Unstäte, wenn sie noch so bunt und ersprießlich<br />
Bilder und Menschen in Dir spiegelt, muß Dir doch zuletzt<br />
unhe<strong>im</strong>lich sein. Eine gute Frau thäte Dir noth." (77)<br />
Die Lebensform des Wanderdichters i s t aus Heyses Perspektive<br />
f r e i l i c h umgekehrt, wenn nicht mehr <strong>Scheffel</strong> wandert, sondern<br />
die Umwelt sich um ihn bewegt.<br />
Unbeeindruckt da<strong>von</strong> proklamiert der älter gewordene <strong>Scheffel</strong><br />
78<br />
zwar <strong>im</strong>mer noch seine "unzerstörbare Wanderlust" , jetzt aber<br />
79<br />
mit einem " I d y l l " als Ziel . Im Gedicht "Die Herberge am See"<br />
<strong>von</strong> 1860 kehrt der müde Fahrende he<strong>im</strong>, allerdings vorerst nur<br />
in eine "Taberne" (111,73). Hier i s t er "bekümmernisledig", es<br />
könnte "nicht wohliger sein"( 111,73). Hatte der Wanderer früher<br />
nur Hut und Stock, so besitzt er nun schon "eine bretterne Lade"<br />
und hat ein "Bänklein" zum Niedersetzen zur Verfügung. Seine<br />
Ideologie eines Fahrenden hat der zur Ruhe Gekommene aber nicht<br />
etwa aufgegeben, sondern zeigt sie gerade jetzt programmatisch<br />
vor:<br />
"Hoch weht ob den weißen Gestaden<br />
Der fahrenden Schüler Panier." (111,74)<br />
Ins Religiöse gewendet gipfelt die Wanderideologie in den Beigptatmcn<br />
<strong>im</strong> Gedicht "Ausfahrt"(!).So paradox es klingt, der Ich-<br />
Sprecher bricht hier zur Wanderung auf, um sich niederzulassen:<br />
"Landfahriges Herz, in Stürmen geprüft,<br />
Im Weltkampf erhärtet und oftmals noch<br />
Zerknittert <strong>von</strong> schämigem Kleinmut<br />
Aufjauchze in Dank<br />
Dem Herrn, der dich sicher geleitet!<br />
Du hast eine Ruhe, ein Obdach gefunden,<br />
Hier magst du gesunden,<br />
Hier magst du die ehrlich empfangenen Wunden<br />
Ausheilen in friedsamer S t i l l e . " (11,77)<br />
Dies sinnbildhafte Ende seiner Wanderschaft hatte <strong>Scheffel</strong><br />
f r e i l i c h schon in Italien vorausgesehen:<br />
"so weiß ich doch ganz gut, daß der fahrende Schüler auch<br />
einmal ans Ende der Fahrt kommen muß - an jenes Ende, wo die
U7<br />
Welt mit Brettern vernagelt i s t /"bretterne Lade!/, und der<br />
fahrende Schüler sich zum sitzenden Meister umzugestalten<br />
hat." (80)<br />
Denn das Ziel seines Wanderns war <strong>im</strong>mer die Ruhe, die "die v i e l -<br />
81<br />
gewanderte und vielgeprüfte Seele" zeitlebens gesucht hat<br />
Sinnbildlich ausgedrückt bedeutet dies, den Wanderstab in die<br />
Erde zu stoßen,<br />
"Daß er in neuem Blatt und Laub<br />
Ein Schattendach mir spende." (IV,77)<br />
In selbstquälerischer Trauer schlägt dieses vergebliche, absehbar<br />
ziellose Wandern <strong>im</strong> Gedicht "Dahe<strong>im</strong>" (111,111-113) um. Für<br />
Heinrich <strong>von</strong> Ofterdingen wie für seinen Dichger i s t die Wanderschaft<br />
längst eine Plage geworden. Der ehemals fröhliche Wanderer<br />
i s t hier der "Ritter Unstern" (111,111), die freudige Weltund<br />
Lebensgemächtigung i s t ins Gegenteil umgeschlagen: "Verfahrner<br />
Leute Fahrtgewinn heißt Leid!" (111,112). In allegorischer<br />
Gestalt treten die Begleiter der Wanderschaft auf: der<br />
"Nachbar Zeitversaum", "Jungfräulein Reue, sein geliebtes<br />
Kind", "Frau Langeweile mit dem Gähnemunde" und "Frau Schwermut<br />
mit dem aschenfahlen Haar". Ein wirkliches Ziel wäre es, "fahrtmüde<br />
Knochen" auszuruhn und Balsam in die Wunden zu gießen (III,<br />
112). Doch der gute Vorsatz (111,113: "So klang mein Lied") i s t<br />
nicht durchzuhalten. Frau Aventiure, die "Närrin" und doch die<br />
"alte Freundin", ruft den Sänger, so daß dieser nicht widerstehen<br />
kann. Der Dichter n<strong>im</strong>mt sein Leid bewußt in Kauf, obwohl<br />
er es als "Not" und als "Traumbild" durchschaut. Dieses Wandern<br />
als ein "irrfahrtwärts" Ziehen begrüßt der Dichter mit Hoffnung<br />
und Skepsis zugleich:<br />
"Auf und hinaus! bringt Roß und Schwert und Zither!<br />
Geliebtes Traumbild, Dank, daß du mich rufst!<br />
Nun folg' ich dir als treuster deiner Ritter,<br />
Vergessend aller Not, die du je schufst.<br />
Dürr sind des regelrechten Lebens Kränze,<br />
Die blaue Blume blüht nur <strong>im</strong> Gedörn;<br />
Auf und hinaus! ... <strong>im</strong> sturmdurchbrausten Lenze<br />
Fahr ich hinaus und suche meinen Stern." (111,113)<br />
Damit wird ganz deutlich, daß die Lebensform des Wanderns für<br />
<strong>Scheffel</strong> zum Bild der gesamten Menschheit geworden i s t : "Wir<br />
sind aber alle nur Pilger auf diesem Planeten und gehen schließ-<br />
8 2<br />
lieh denselben Weg" . Deshalb g i l t ihm der Tod als "die letzte
U8<br />
große Wanderung" . Diese Wanderung aber zu Fuß anzutreten<br />
sollte ihm schwer werden. Einen Monat vor seinem Tod schreibt<br />
<strong>Scheffel</strong> an Anton <strong>von</strong> Werner: "Seit October bin ich keinen<br />
8 L<br />
Schritt mehr gegangen, fahre aber täglich aus" .<br />
4
U9<br />
VI. DICHTER UND PUBLIKUM<br />
1. Schweigen als poetische Leistung<br />
<strong>Scheffel</strong>s produktive Phase als Dichter i s t mit der Herausgabe<br />
der Gedichtsammlung T/iau Ave.ntlun.e. <strong>im</strong> Jahre 1863 abgeschlossen.<br />
Der Wartburgroman, als dessen lyrische Beigaben diese Gedichte<br />
ursprünglich erscheinen sollten, blieb schon Fragment. Alles<br />
später Erschienene, wie die Gaudzamut-Lieder (1868) oder einige<br />
der Reisebilder, sind schon in den 4-Oer und 50er Jahren verfaßt<br />
worden. Von da an bringt es <strong>Scheffel</strong> nur noch zu gelegentlichen<br />
lyrischen Versuchen, einigen weisen "Sprüchen" sowie zu Festspielen<br />
für repräsentative Feiern. Allerdings macht man es sich<br />
zu leicht mit dem Urteil, <strong>Scheffel</strong>s Verstummen nach dem £kke.ha/id<br />
liege <strong>im</strong> biographisch-pathologischen Versagen seiner dichterischen<br />
Schaffenskraft begründet. Auch mit der Vermutung, dem<br />
Lyriker <strong>Scheffel</strong> habe die Gattung des Romans einfach nicht gelegen<br />
, kommt man nicht weiter. Erstaunlich i s t vielmehr die<br />
Tatsache, daß <strong>Scheffel</strong> noch dann, als er schon seit Jahren<br />
nichts mehr dichtete, <strong>im</strong> Bewußtsein der meisten zeitgenössischen<br />
Leser als produktiver Dichter g i l t . Zahllose Ehrungen und Huldigungen<br />
beziehen sich auf diese vermeintlich noch aktive Dichtungskraft<br />
<strong>Scheffel</strong>s. <strong>Scheffel</strong>s repräsentative Festgedichte, die<br />
<strong>im</strong>mer wieder erneuerten Vorworte zahlloser Neuauflagen, Zueignungen,<br />
Stammbucheintragungen und Widmungen überdeckten für die<br />
Öffentlichkeit das Versiegen der Neuproduktion. Zur rechten<br />
Zeit, bei großherzoglichen Jubiläen oder bei einer Universitätsfeier,<br />
produziert (sich) <strong>Scheffel</strong> wieder.<br />
Mit der Erklärung, <strong>Scheffel</strong>s "traurige Erfahrungen" <strong>im</strong> Verlegerstreit<br />
um den &kke.ha/id hätten zum Verstummen des Dichters geführt,<br />
übern<strong>im</strong>mt man eine Behauptung <strong>Scheffel</strong>s: sonst "würde ich<br />
noch mehrere solcher kulturhistorischen Romane aus der älteren<br />
2<br />
Geschichte verfaßt haben!" Erst sehr v i e l später i s t "der<br />
merkwürdige Umstand" aufgefallen, "daß dieses Schwinden der<br />
poetischen Leistungsfähigkeit mit der körperlichen Gesundung<br />
zusammenfällt" . Hier i s t jedoch darauf hinzuweisen, daß bei<br />
<strong>Scheffel</strong> solche Verstummenstendenzen nicht erst <strong>im</strong> Alter auf
150<br />
Grund besonderer Schicksalsschläge auftauchen, sondern als l a <br />
tenter Grundzug seines Wesens und seines Werkes <strong>im</strong>mer schon vorhanden<br />
sind, auch wenn <strong>Scheffel</strong> selbst seinen Verlegerstreit<br />
als Begründung heranzieht:<br />
"Solche und andere Erfahrungen werden dazu beitragen, mir,<br />
der ich keine hörnene Siegfriedshaus besitze, die Schrifts<br />
t e l l e r e i gründlichst zu verleiden; denn die Feder des Poeten<br />
fortwährend mit der des Advokaten vertauschen zu müssen<br />
und schließlich mit dem eigenen Herzblut andere Leute fett<br />
machen, i s t nicht sehr heiter." (4)<br />
Denn schon in seiner Jugend spielte <strong>Scheffel</strong> mit dem Gedanken,<br />
"in Gottes Namen seine Leier an den Nagel hängen" zu wollen^,<br />
während er gleichzeitig beschwichtigt: "Die Laute hängt noch<br />
nicht an der Wand"^. Die Drohung, das Dichten einzustellen,<br />
bleibt aber dauernd in der Luft. Nach dem schwächlichen Anfangserfolg<br />
seines Lk.ke.tia/id hatte <strong>Scheffel</strong> angekündigt:<br />
"Ich w i l l mich in Studien über die Geschichte des XVI. Jahrhunderts<br />
vergraben, und noch einmal Etwas Ernstes, Großes in<br />
Angriff nehmen; wenn ich damit auch nicht durchschlage, so<br />
häng ich die ganze Schriftstellerei an den Nagel und beruhige<br />
mich über die Mitgift an Geist, die der-Mensch mit auf die<br />
Welt bekommen, und ernähre mich mit irgend einer Handarbeit.<br />
Am End i s t doch Alles e i t e l . " (7)<br />
Prophetisch hatte schon Fontane <strong>Scheffel</strong>s Lkkeha/id als eine<br />
g<br />
"Einzelleistung" vermutet . <strong>Scheffel</strong> selbst hat sein Verstummen<br />
nicht als einen persönlichen Mangel, sondern als Ausdruck einer<br />
epigonischen Zeit verstanden. An Ludwig Uhland schreibt er 1854:<br />
"In unserer Epigonenzeit, wo in allen Gebieten der Kunst so<br />
nah' ans Höchste schon gearbeitet i s t , s t e l l t man sich b i l l i g<br />
die Frage, ob nicht das Schweigen Gold, das andere nur S i l <br />
ber sei?" (9)<br />
Ist <strong>Scheffel</strong>s Verstummen also ein Teil seines Dichterbewußtseins?<br />
Schon Richard M. Meyer hat, allerdings nur andeutungsweise,<br />
auf <strong>Scheffel</strong>s "Helden des Schweigens" und sein "Lob der<br />
1 0<br />
S t i l l e " hingewiesen . Diesen Zusammenhängen s o l l <strong>im</strong> folgenden<br />
11<br />
etwas nachgegangen werden. "II silenzio diverrebbe mortale" ,<br />
schreibt schon der junge <strong>Scheffel</strong> seiner Schwester aus Italien.<br />
Diese Behauptung verkürzt einen Gedankengang, der auch die<br />
Selbstdefinition des <strong>Dichterberuf</strong>s b e t r i f f t . Eine ähnliche Best<strong>im</strong>mung<br />
liegt nämlich auch dem letzten Lied Heinrichs <strong>von</strong><br />
Ofterdingen zugrunde, der seinem Dichten dadurch Mut zuspricht,
151<br />
daß er an seinen Zweifeln zu verzweifeln droht:<br />
"... Der Lieder größtes steht noch unbeendet ...<br />
Ich geh zugrunde - oder ich vollbring 1 s!" (111,119)<br />
Dieser scheinbare Gegensatz kann jedoch gleich vom Ofterdinger<br />
aufgelöst werden. Lieder brauchen nur noch gefunden, nicht mehr<br />
selbst erfunden zu werden:<br />
"Dort oder nie find' ich die großen Lieder,<br />
Hier schweigt mein Mund ... das Singen schafft ihm Weh."<br />
(111,119)<br />
In ähnlicher Weise i s t auch für den Kater Hiddigeigei <strong>im</strong> 7/iompe.te/i<br />
das poetische Schweigen nicht als Passivität, sondern als<br />
Willensakt zu werten. So wie für Heinrich <strong>von</strong> Ofterdingen i s t<br />
das Schweigen für den Kater eine poetische Aktion, wenn er der<br />
Menschheit seine dichterischen Werke verweigert:<br />
"Mögen sehn sie, wie sie f s treiben!<br />
- Hiddigeigeis Lehrgedichte<br />
Werden ungesungen bleiben." (1,157)<br />
In diesem Zusammenhang i s t die Rolle des Erdmanns <strong>im</strong> 7 /iompe.te./i<br />
(1,107-110) beachtenswert. <strong>Scheffel</strong> begreift hier das Verstummen<br />
und den Rückzug des s t i l l e n Mannes nicht als dessen Unfähigkeit<br />
zur Weltbewältung, sondern als rationalen Entschluß,<br />
nachdem dieser die Welt durchschaut habe. Allmählich versteinert<br />
der Schweiger in seiner Erdhöhle. "War ein stolzes Menschenkind<br />
einst", heißt es <strong>von</strong> ihm, und "höhnisch schier klang mir<br />
sein Lachen" (1,107). Für den s t i l l e n Mann i s t das menschliche<br />
Leben identisch mit Haß geworden (1,108: "Leben Menschen, Menschen<br />
hassen"). Anfangs singt er noch "schöne Lieder". Im Verstummen<br />
aber sieht er die Möglichkeit, seine Liedkunst noch zu<br />
steigern:<br />
"Erdmann, schöne Lieder weiß ich,<br />
Doch das schönste hab' ich noch nicht<br />
Dir verraten, das heißt Schweigen." (1,109)<br />
Nach diesem letzten Wort verwandelt sich der Schweigende in<br />
Stein und n<strong>im</strong>mt damit eine Zwischenstellen zwischen Lebenden<br />
und<br />
Toten ein:<br />
"Schweigend s i t z t er nun seit Jahren<br />
Dort am Fels, - i s t nicht gestorben,<br />
Lebt auch nicht, es wandelt langsam<br />
Sich der s t i l l e Mann in Stein um." (1,109)
152<br />
Auch wenn Jung-Werner, der Held des 7/iompe.te./i, noch an eine<br />
12<br />
Wiedererweckung des s t i l l e n Mannes glaubt - das extrem hermetische<br />
System dieser Isolation i s t nur <strong>von</strong> innen, also in der<br />
Selbstdarstellung zu durchbrechen. Diese Aufgabe versuchen die<br />
LLe.de./i de.* Stit£e.n flanne.4 (1,158-161) zu erfüllen, in denen<br />
Schweigsamkeit und Einsamkeit zusammenfallen. Hier g i l t das<br />
Schweigen als der Höhepunkt jeglichen Erkenntnisprozesses:<br />
"Und am Ende der Erkenntnis<br />
Steht ein ahnungsvolles Schweigen." (1,159)<br />
Das Schweigen i s t jedoch keine Negation oder Verweigerung einer<br />
Aussage. Wie die damit Hand in Hand gehende Versteinerung i s t<br />
auch das Verstummen des Mannes ein Willensakt. Alles geschieht<br />
"trotzig s t i l l " (IX,90). Daraus entsteht nämlich eine neue positive<br />
Konstruktivität, ein Gegenmodell zur äußeren Welt:<br />
"Altes Sein und Denken<br />
Auseinander fällt,<br />
Mußt dir selber schenken<br />
Eine neue Welt.<br />
Bau' sie dir tief innen,<br />
Bau f sie hell und weit -<br />
Strömen und verrinnen<br />
Laß die alte Zeit!" (IX,90)<br />
Jung-Werner hat bei seinem Besuch anscheinend vom s t i l l e n Mann<br />
gelernt. Denn auch in Werners Liedern spielt das Motiv des Verstummens<br />
eine zentrale Rolle. Allerdings i s t bei ihm der Anlaß,<br />
die Liebe zu Margareta, noch deutlich als Grund des Verstummens<br />
zu erkennen, während <strong>im</strong> VerachtungsSystem des s t i l l e n Mannes<br />
alle psychologisch erfaßbaren Gründe rationalisiert sind. Für<br />
Werner leistet die Musik Ersatz für die versagende Sprache:<br />
"Als ich zum erstenmal dich sah,<br />
Verstummten meine Worte,<br />
Es löste a l l mein Denken sich<br />
In schwellende Akkorde." (1,143)<br />
Die Grenzen der Sprache liegen <strong>im</strong> Ausdruck, also in ihrer<br />
Funktion als Kommunikationsmittel (1,143: "Kann dir nicht saeren,<br />
was ich w i l l " ) ; als postitcke. Aussage ("Summen") erfüllt sie<br />
jedoch weiterhin und in höherem Maße ihre Funktion:<br />
"Die Sprache i s t ein edel Ding,<br />
Doch hat sie ihre Schranken;
153<br />
Ich glaub', noch <strong>im</strong>mer fehlt's am Wort<br />
Für die feinsten und tiefsten Gedanken.<br />
Schad't nichts, wenn auch ob Dem und Dem<br />
Die Reden a l l verstummen,<br />
Es hebt sich dann <strong>im</strong> Herzensgrund<br />
Ein wunderbares Summen." (1,145)<br />
<strong>Scheffel</strong>s eigene Position modifiziert beide Verstummensmöglichkeiten<br />
und verbindet sie miteinander. Am deutlichsten zeigt sich<br />
diese<br />
Haltung in seinen Spruchweisheiten:<br />
"Die Welt treibt's arg,<br />
Sei s t i l l und stark!" (IX,256)<br />
Auffällig i s t hier die Kombination <strong>von</strong> Stille-Sein und S t i l l e -<br />
Halten. Geht es doch dabei nicht mehr bloß um das Dichten, sondern<br />
um ein Zusammenbinden zweier Lebenshaltungen, die <strong>im</strong> Wortsinn<br />
nichts miteinander zu tun haben müssen. Ein anderer Spruch<br />
zeigt dies noch deutlicher:<br />
"Ernsthaft streben,<br />
Heiter leben,<br />
Vieles schauen,<br />
Wenigen trauen -<br />
Deutsch <strong>im</strong> Herzen,<br />
Tapfer und s t i l l ,<br />
Dann mag kommen,<br />
Was da w i l l . " (IX, 249)<br />
Auch hier zeigt das Zusammenstehen des Stummseins mit anderen<br />
Lebenseigenschaften und Verhaltensweisen den besonderen Charakter<br />
dieser S t i l l e an. Es i s t keine passive Dulderhaltung, sondern<br />
die bewußte Annahme des Schweigens als ethische Haltung ("tapfer")<br />
In poetischerer und weniger didaktischer Form als der Spruchweisheit<br />
zeigt das 1860 entstandene Gedicht "Die Herberge am<br />
See", inwiefern das Schweigen des Dichters eine Leistung, ein<br />
poetischer Willensakt geworden i s t . Die Verse handeln vom sich<br />
Niederlassen und Ausruhen der Fahrenden; noch bleibt die Position<br />
des Dichter/Sängers aus dem Spiel. Daß aber in diesem Zyklus<br />
<strong>im</strong>mer vom Sänger die Rede i s t , zeigt auch das folgende Gedicht<br />
"Kahnfahrt": auch dort schon t r i t t der Wanderer mit seiner<br />
Zither in der Natur auf, die schweigt (111,75: " S t i l l beredter<br />
Pracht"). Für unser Gedicht (III,73f) kann dieses Oxymoron ein<br />
guter Hinweis sein; denn die letzte Strophe der "Herberge am<br />
See" läuft auf die bekannten und v i e l zitierten Verse hinaus,
154<br />
die - so verkürzt - einen ursprünglichen Widerspruch zusammenbinden<br />
:<br />
" S t i l l liegen und einsam sich sonnen,<br />
Ist auch eine tapfere Kunst." (111,74)<br />
Der Ich-Bezug des Gedichts i s t in den beiden letzten Versen ausgeschaltet,<br />
eine Bezug auf das lyrische Ich bleibt also ganz bewußt<br />
wie eine Frage offen. Dem Liegen und sich Sonnen sind mit<br />
" s t i l l " und "einsam" zwei Adverbien(I) zugeordnet, die darauf<br />
hinweisen, daß es sich <strong>im</strong> Grunde <strong>im</strong> Un-Tätigkeiten handelt. Insofern<br />
kann dann auch die Kunst eine "tapfere" sein. In der Vorstudie<br />
seines Tagebuchs vom 3. April 1860 hatte <strong>Scheffel</strong> diese<br />
1 3<br />
Verszeile noch als "feine Kunst" beschrieben . Die Umformung<br />
des Adjektivs in der endgültigen Fassung weist auf eine stärkere<br />
Tathaftigkeit der Kunst hin: <strong>Scheffel</strong>s Kunstbegriff erhebt den<br />
nicht mehr dichtenden Dichter erst recht zum Täter! Das verräterische<br />
"auch" aber gibt die letzte Erklärung. Denn nun s t e l l t<br />
sich weniger die Frage nach den anderen Künste, die es "auch"<br />
gibt, sondern umgekehrt: <strong>Scheffel</strong>s Kunst i s t jetzt einzig und<br />
a l l e i n das Stillhalten und Schweigen geworden, das sich aus der<br />
bewußten Aktion des Dichters legit<strong>im</strong>iert!<br />
In <strong>Scheffel</strong>s spätesten Gelegenheitsgedichten i s t diese Programmatik<br />
bis zur Unkenntlichkeit verkürzt. Sie i s t nur noch daran zu<br />
erkennen, daß man beobachtet, wo<strong>von</strong> in den Gedichten nicht die<br />
Rede i s t . Der Prozeß des Dichtens, der sonst fast <strong>im</strong>mer ein bevorzugter<br />
Gegenstand des Gedichts war, wird jetzt völlig ausgeklammert.<br />
<strong>Scheffel</strong>s Interesse für die einfache und t r i v i a l e<br />
Dingwelt kehrt seine früheren Anschauungen einer Verachtung der<br />
Normalität radikal um. Im Gedicht "Radolfszell" <strong>von</strong> 1873 beispielsweise<br />
s t e l l t die Entsagung innerhalb der Stadtmauern die<br />
Wanderseligkeit der frühen Jahre und die Flucht aus diesen<br />
Mauern geradezu auf den Kopf:<br />
"0 Rdadolfszell, due altes Nest<br />
Mit deinen Wackenmauern,<br />
Wie lernt man hier aufs allerbest<br />
Entsagen dem Brüten und Trauern!" (IX,182)<br />
Das Interesse des lyrischen Ichs beschränkt sich jetzt auf Weinbau,<br />
Seelandschaft und Angeln:
155<br />
"Vergnüglich s i t z t man am Strande fest<br />
Und vergißt den Koffer zu packen.<br />
0 Radolfszell, du altes Nest<br />
Mit deinen Mauerwacken!" (IX,183)<br />
Das bisher verhaßte Festsitzen g i l t <strong>Scheffel</strong> nun als "vergnügl<br />
i c h " , der Wanderschaftsaufbruch als Kofferpacken wird vergessen<br />
oder besser - verdrängt; das "alte Nest", vor 20 oder 30 Jahren<br />
<strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> noch als Sch<strong>im</strong>pfwort gebraucht, wird jetzt zum<br />
höchsten Lob!<br />
Wie sich also die Wanderideologie <strong>Scheffel</strong>s ins Gegenteil, zum<br />
Lob des Festsitzens verkehrt hat, genauso wendet sich die Lebensform<br />
des Dichters <strong>Scheffel</strong> vollständig um: der schweigende Dichter,<br />
an und für sich ein Widerspruch, wird nun zum Inbegriff<br />
der wahren poetischen Anschauung der Dinge. 'Philosophisch 1 abgesichert<br />
war diese Schweigeideologie <strong>Scheffel</strong>s schon durch das<br />
Reisebild £in Gang zu/i gnoßen Kan.taute in den Alpen den. Dauphine<br />
<strong>von</strong> 1857, in dem <strong>Scheffel</strong> sein Interesse an der Lebensweise der<br />
zu lebenslangem Schweigen verpflichteten Kartäusermönche s c h i l <br />
dert. Der direkte biographisch-pathologische Bezug i s t dabei zu<br />
vernachlässigen: bei einer<br />
seiner<br />
1<br />
Kopfkongestionen 1<br />
wurde der<br />
flüchtige <strong>Scheffel</strong> auf dem Weg dorthin aufgegriffen, wobei er<br />
angab, er wolle in den Orden eintreten! Das Reisebild setzt mit<br />
dem Bericht <strong>von</strong> einer Rhüneüberschwemmung ein; <strong>Scheffel</strong> hat deshalb<br />
"traurige Dinge" erleben müssen. Das Hochwasser wird zum<br />
Sinnbild einer "Zeit allgemeiner Katastrophe" auf dem Hintergrund<br />
einer desorientierten Welt (VIII,80). Zu diesen "trüben Bildern"<br />
stehen die Mönche der Kartause mit ihrem "unwandelbaren Schweigen"<br />
in scharfem Kontrast (VIII,83). Ihre Isolation durch das Schweigen<br />
wird <strong>Scheffel</strong> zum Symbol des Rückzuges aus einer schlechten<br />
Welt:<br />
"nichts mehr wissen <strong>von</strong> dem, was draußen die Gemüter bewegt,<br />
/. ..] nichts <strong>von</strong> der Organisation der Arbeit und der sozialen<br />
Frage, /". . ._7 und nichts <strong>von</strong> der neuen Gottheit des Tages,<br />
genannt cnedit mo&ilien." (VIII,91)<br />
Die Mönchseinsamkeit wird als Idylle gegen die Undurchschaubarkeit<br />
der ökonomischen und sozialen Ordnungen des 19. Jahrhunderts<br />
ausgespielt mit der Frage, "ob sie so unrecht haben?" Und Scheff<br />
e l erzählt am Morgen nach seiner Übernachtung <strong>im</strong> Kloster <strong>von</strong><br />
seinem Traum, in dem es ihm vorgekommen sei, "als wäre ich sei-
1 56<br />
ber bald reif für den weißen Kartäuserhabit" (VIII,92). So w i l l<br />
das Schweigen des Dichters neben den poetischen auch die sozialen<br />
Probleme der Gegenwart lösen.<br />
2. <strong>Scheffel</strong> und seine Leser<br />
Wie reagieren die Leser auf einen schweigenden Dichter? Die<br />
schon angedeutete Tatsache, daß <strong>Scheffel</strong>s Rückzug aus der l i t e <br />
rarischen Öffentlichkeit seinem Ansehen als volkstümlicher<br />
Schriftsteller keinen Abbruch tut, verweist auf ein merkwürdig<br />
intensives Verhältnis <strong>Scheffel</strong>s zu seinen Lesern, dem <strong>im</strong> folgenden<br />
nachgegangen werden s o l l . Schon eine der ersten Besprechungen<br />
des £kke.ha/id hatte nicht etwa auf die poetische Machart des<br />
Romans abgehoben, sondern war einem vermuteten Lesepublikum<br />
schon<br />
<strong>im</strong> voraus auf der Spur:<br />
"Für den Lesepöbel, der nur an dem Stofflichen seine Freude<br />
hat und weniger poetisch ergözt oder historisch belehrt als<br />
phantastisch beschäftigt seyn w i l l , wird es f r e i l i c h <strong>im</strong>merhin<br />
weniger ein Buch seyn. Auf solchen Pöbel, wenn er auch noch<br />
so sehr die Majorität bildet, darf aber keine Rücksicht genommen<br />
werden. Der Schriftsteller hat, was man auch <strong>von</strong> Popularität<br />
sagen mag, <strong>im</strong>mer nur das, nicht zwar speciell und<br />
fachmäßig, aber allgemein gebildete Publikum in 1 s Auge zu<br />
fassen, und für dieses wird es dem Ekkehard nicht an Anziehendem<br />
fehlen. /*. . .7 Die ganze Darstellung i s t so, daß sich<br />
ihrer jeder <strong>im</strong> weiteren Sinn Gebildete erfreuen kann; für<br />
den höher Gebildeten liegt überdieß in der historischen Dokumentirung<br />
noch ein besonderer Reiz." (14-)<br />
Hinter dem begrifflich vagen Differenzierungsversuch des sogenannten<br />
Bildungsbürgertums steckt schon die Erklärung, die den<br />
später ungeheuren Erfolg <strong>Scheffel</strong>s begründet. Das Identifikationsangebot,<br />
das demnach vom £kkeha/id ausgeht, bietet dem Leser<br />
mehr als s<strong>im</strong>plen Romangenuß. Gerade <strong>im</strong> Absetzen vom stofflichen<br />
Reiz, wie ihn der "Lesepöbel" sucht, gelingt es dem Leser, den<br />
Anspruch auf eine auch sozial höhere Position mitzumachen: die<br />
Ablehnung des £kke.ha/id würde ja das f r e i w i l l i g e Ausscheiden aus<br />
diesem Kreis der "höher Gebildeten" bedeuten.<br />
Man könnte sich an Gustav Freytag erinnert fühlen, der an seinen<br />
Verleger schreibt, der £kke.r\aid sei nicht "für's große Publikum",<br />
1 5<br />
"wohl aber für unsereinen" . Auch hier klingt der Versuch an,<br />
mit dem Dichter und dem Roman eine Art negative Identifikations-
157<br />
gemeinschaft aufzubauen, mit deren Hilfe man sich gegen ein anders<br />
orientiertes Publikum abschotten kann. Durch diese stark<br />
formende Gemeinschaft in Produktion und Rezeption i s t <strong>Scheffel</strong><br />
16<br />
"der geborene Erzähler für engere Kreise" . In diesem engeren<br />
Kreis, dem sich jeder beliebige Leser selbst zuordnen darf, wird<br />
zugleich ein Rezeptionsstandard geprägt, der nicht an soziale<br />
Bedingungen geknüpft i s t . Der Erfolg <strong>Scheffel</strong>s i s t auch dadurch<br />
best<strong>im</strong>mt, daß sich sein Publikum eben nicht ausschließlich nach<br />
soziologischen Stratifikationsmerkmalen, sondern genauso nach<br />
seinem funktionalen Verhalten zur Lektüre richtet. Schon dem<br />
ersten Rezensenten des Lkkeka/id i s t diese quasi sozial unabhängige<br />
Rezeptionsmöglichkeit aufgefallen:<br />
"Das vorliegende Werk dürfte unter anderen Lesern besonders<br />
auch solchen zu empfehlen seyn, die sich den Sommer über in<br />
den schönen Badeorten oder Landhäusern am Bodensee aufzuhalten<br />
pflegen. Diese können manche müßige Stunde auf sehr<br />
angenehme Weise mit der Leetüre eines Buches zubringen, das<br />
<strong>von</strong> der Vergangenheit der herrlichen Landschaft handelt, die<br />
sie <strong>von</strong> Säntis bis Hohentwiel hier täglich vor Augen haben."<br />
(17)<br />
Der Gebrauchszusammenhang, in den der Roman auf diese Weise gerät,bleibt<br />
nicht ohne Rückwirkung auf den Dichter. <strong>Scheffel</strong>s<br />
Verhältnis zur literarischen Kritik i s t gerade <strong>von</strong> dieser Spannung<br />
zwischen hohem Poesieanspruch und unterhaltendem Gebrauchswert<br />
seiner Produkte geprägt. Während <strong>Scheffel</strong> sich einerseits<br />
sarkastisch über die Literaturkritik als einer die Dichterleichen<br />
sezierenden Alten und über die Literaturgeschichte als einem<br />
"Zucht- und Arbeitshaus, das die deutsche Kritik statt eines<br />
Pantheons den Poeten zu erbauen pflegt" (VIII,129) äußert, definiert<br />
er andererseits sein intendiertes Publikum über den Gebrauchswert<br />
seiner Dichtungen. In verschiedenen Vorworten zum<br />
7/iompe.ie./i erläutert <strong>Scheffel</strong> genauer, wie er sich seine idealen<br />
Leser vorstellt. Zur zweiten Auflage (lX,135ff) nennt er<br />
"lust'ge Brüder bei weingoldnen Flaschen"; seinen 7/iompe.te.n.<br />
finde man "in alten Weidmannstaschen" und "bei des Landschaftsmalers<br />
Staffelei". Als weitere erwünschte Leser sind noch die<br />
"Pfarrherrn" und "eine Braut" genannt (IX,135). Die Rezipienten<br />
auch der Trinklieder und des 7/iompe.te./i sollen also mit dem Kreis<br />
identisch sein, aus dem sie hervorgehen. Der Jäger als Wanderer<br />
und der Landschaftsmaler als Künstler verweisen auf geistige
158<br />
Verwandte des Dichters - "unsereinen", wie schon Gustav Freytag<br />
bemerkt hatte. Der vereinzelte Pfarrherr i s t biographisch belegbar<br />
(Pfarrer Schmezer, das geistige Zentrum des £nge./ie.n) ; er<br />
fällt überdies als Leser des harmlosen 7/iompe.te./i funktional mit<br />
der Gruppe der Frauen zusammen. Diese Rezeptionsgruppe der<br />
Frauen t r i t t bei <strong>Scheffel</strong> erst <strong>im</strong> Vorwort zur 100. Auflage 1882<br />
ausführlicher in Erscheinung. Wichtig i s t wohl auch die Reihenfolge<br />
in der Anrede, wenn <strong>Scheffel</strong> seinen Dank ausspricht:<br />
"Nun dank' ich den Frauen und Jungfrauen a l l<br />
Und a l l den guten Gesellen,<br />
Die in der He<strong>im</strong>at jahraus jahrein<br />
Sich neu den Trompeter bestellen;" (IX,228)<br />
In der Hand der Frauen erhalten die <strong>Scheffel</strong>werke eine neue<br />
Qualität. Der wiederholte Kauf zum Verschenken oder Zerlesen<br />
deutet auf Rezeptionsformen hin, für die die Erklärungsversuche<br />
über das Lesepublikum a l l e i n nicht genügen. Der <strong>Scheffel</strong>text als<br />
Ware, als Geschenkartikel, als Bilderbuch oder als Hauszierrat -<br />
der literarische Erfolg scheint oft über Vermittlungswege zu<br />
laufen, denen man mit der reinen Text- und Datenanalyse nicht<br />
auf die Spur kommt (vgl. Kap. VII).<br />
Der Anerkennung durch die literarische Kritik hatte für den<br />
Erstling <strong>Scheffel</strong>s nur eine geringe Resonanz bei der Mehrzahl<br />
der Leser entsprochen. So konnte die Diskrepanz zwischen den<br />
positiven Rezensionen und dem schleppenden Verkauf des 7'/lompete/t<br />
<strong>Scheffel</strong> in Erstaunen versetzen: "Unbegreiflich i s t mir übrigens,<br />
wie bei diesen Zeichen der Anerkennung <strong>von</strong> allen Seiten erst<br />
1 8<br />
$00 Exemplare verkauft sind" . Die Anlaufzeit, die der Anfänger<br />
<strong>Scheffel</strong> benötigt, um sich einen Namen als Dichter zu machen,<br />
i s t vielleicht auch verantwortlich für die mangelnde Beachtung,<br />
die ihm die zeitgenössische Literaturgeschichtsschreibung entgegenbringt<br />
:<br />
"In der Literatur habe ich keine Illusionen mehr. Von einer<br />
Anerkennung kann ich, trotz einiger Symptome <strong>von</strong> Bekanntsein,<br />
noch nicht sprechen. Es i s t mir z.B. dieser Tage ein Werk<br />
<strong>von</strong> /"Robert/ Prutz, die deutsche Literatur <strong>von</strong> 184-8 - 1 860,<br />
zu Händen gekommen, wo viele neuere Schriftsteller, Heyse,<br />
Lingg, sogar J. Grosse, ausführlich besprochen sind. Meiner<br />
i s t dabei nicht mit einer Silbe Erwähnung gethan. Dies würde<br />
mich nicht befremden, da ich den Gegensatz süddeutschen Wesens<br />
zu der nordischen Frostigkeit recht gut kenne; was uns<br />
anzieht, stößt dort ab. Zu einer Kränkung wird die Sache aber<br />
dadurch, daß in einem Anhang alle Titel der 48 - 60 erschie-
159<br />
nenen, der Besprechung nicht für werth erachteten Werke, darunter<br />
auch die meinigen, angeführt sind." (19)<br />
Die literarische Geringschätzung, die mit der mangelnden Anerkennung<br />
auch gemeint i s t , dieser Unterschied zwischen Beachtung<br />
und Bekanntsein beschäftigt <strong>Scheffel</strong> <strong>im</strong>mer wieder. Erneut wird<br />
die Qualitätsfrage seiner Dichtungen aber auch dann an der voraussichtlichen<br />
Reaktion des Publikums festgemacht. So schreibt<br />
<strong>Scheffel</strong> über die wahrscheinliche Aufnahme der Tn.au. Aventiune.<br />
an seine Mutter:<br />
"Was das Buch Aventiure b e t r i f f t , so bin ich jetzt über<br />
dessen Schicksal <strong>im</strong> Klaren. Es wird bei einem kleinen - aus<br />
Künstlern, nicht zünftig beschränkten Gelehrten - und f r e i<br />
in das Leben schauenden Frauen bestehenden Kreise eine freundliche<br />
Beachtung finden, aber sehr langsam und geräuschlos<br />
weiter bekannt werden. Feuilletonkritik, vornehmer Pöbel,<br />
Wirtshauspolitiker u.s.w. werden es links liegen lassen ...<br />
leider auch viele redliche brave Leute, die den s.g. Mittelstand<br />
bilden und sonst gern etwas Schönes lesen. Diese aber<br />
haben vor allem Mittelalterlichen eine Gespensterfurcht und<br />
können sich meinen Standpunct, der die Alten so treu wie<br />
möglich in ihrer eigenen Denk- und Fühlweise zu schildern<br />
versucht, nicht klar machen. Für diese Sorte, die das große<br />
Publikum bildet, und die es als eine Art Beleidigung auffaßt,<br />
wenn man Etwas bringt, das sie nicht vollkommen verstehen,<br />
muß ich einmal Etwas in ganz anderer Tonart verfassen." (20)<br />
<strong>Scheffel</strong>s Anpassung an den Publikumsgeschmack und die Lesererwartung<br />
i s t die autorspezifische Kehrseite eines innigen Identifikationsverhältnisses.<br />
Auch der schließliche Erfolg des Tnompeizn<br />
i s t hauptsächlich einer außerliterarischen Initiative zu<br />
verdanken. So scheint <strong>Scheffel</strong> die weitreichenden sozialen Beziehungen<br />
seiner Familie be<strong>im</strong> Verteilen der Rezensionsexemplare<br />
geschickt ausgenutzt zu haben:<br />
"Dann aber vermittelte seine gesellschaftliche Stellung in<br />
Heidelberg, wo Häusser und Julius Braun und viele andere<br />
seiner persönlichen Freunde beträchtlichen Einfluß besaßen,<br />
seiner heiteren Dichtung den nicht zu unterschätzenden Vort<br />
h e i l , in der Professorengemeinde einer deutschen Universitätsstadt<br />
Aufsehen zu erregen. Die allgemein bestätigte<br />
persönliche Liebenswürdigkeit des jungendlichen <strong>Scheffel</strong> kam<br />
hierbei noch dem Dichter zu Gute." (21)<br />
So kann <strong>Scheffel</strong> auch seinen mit den üblichen Startschwierigkeiten<br />
kämpfenden Roman in ungebrochenem Selbstvertrauen an die<br />
Öffentlichkeit bringen. An seinen Freund und Verleger Adolf<br />
Bonz schreibt er über den £kkehand:
160<br />
"Diese Arbeit wird, wie ich je-tzt, nachdem sie ruhig vor mir<br />
liegt, gleich einem unparteiischen Dritten sagen kann, ein<br />
bedeutendes Aufsehen machen, v i e l angefochten werden (<strong>von</strong> den<br />
Fachmännern, die glauben, daß sie ein Monopol aufs germanistische<br />
Altertum hätten und <strong>von</strong> mannigfachen Philistern) aber<br />
noch mehr verteidigt und jedenfalls wird das Endresultat das<br />
sein, daß es in der Geschichte des deutschen historischen Romans<br />
eine Epoche bezeichnet." (22)<br />
Nachdem sich spätestens bis Mitte der 60er Jahre beide Hauptwerke<br />
<strong>Scheffel</strong>s durchgesetzt hatten, i s t der Verkaufserfolg der<br />
Gaude.amut-Lieder in ganz anderen Bahnen verlaufen. In Studentenund<br />
Stammtischkreisen konnten nach 184-8 die zum richtigen Zeitpunkt<br />
(1868) herausgegebenen Lieder auf eine gefeierte Aufnahme<br />
rechnen. Eine der ersten Besprechungen versteigt sich sogar zu<br />
der Vermutung, der wissenschaftliche Fortschritt des Jahrhunderts<br />
in allen Lebensbereichen spiegle sich exemplarisch in<br />
2 3<br />
<strong>Scheffel</strong>s studentischen Liedern ! <strong>Scheffel</strong> hat diesen populären<br />
Erfolg mit Freude zur Kenntnis genommen, gleichzeitig aber Sorge<br />
empfunden, daß diese Volkstümlichkeit mit der Mißachtung seiner<br />
ernsteren und mit höherem Anspruch gedichteten Werke erkauft<br />
werde. Das belegt eine Episode, die er Anton <strong>von</strong> Werner, dem<br />
Illustrator der Ausgabe, berichtet:<br />
"was wir aber hier Vergnügliches in Wort und Bild geschaffen,<br />
das wird volksthümlich werden; - wie ich neulich zu Basel <strong>im</strong><br />
Bären saß, wurde ich <strong>von</strong> einem jungen Mediziner erkannt und<br />
der Gesellschaft als der Verfasser des Pfahl&aumannt vorges<br />
t e l l t , der jüngst in den Fliegenden Blättern erschienen,<br />
worauf sofort wieder die bekannte Kneiperei losging, ohne<br />
daß nach meinen andern Werken und meinem fortgeschrittenen<br />
Schwabenalter gefragt wurde." (24.)<br />
Gegen diese Saufpoesie und die so handgreiflich gewordene Wirkungsgeschichte<br />
wendet sich Karl Gutzkow auf oberlehrerhafte<br />
Weise, weil er darin eine Schädigung der akademischen Jugend<br />
sieht. Darüber hinaus i s t Gutzkow einer der wenigen Zeitgenossen,<br />
die <strong>Scheffel</strong> grundsätzlich ablehnen:<br />
"Und in der akademischen und, wie die <strong>Scheffel</strong>feier zeigte,<br />
in der polytechnischen Sphäre i s t das 'deutsche Lied' so <strong>im</strong><br />
&nge./in wie <strong>im</strong> b)e.lte./in (sagen wir es offen heraus) geradezu<br />
zum grunzenden Schwein geworden, ob auch Universitäten und<br />
Großherzogthümer ihm huldigen! Die Verbindung hausbackener<br />
Stubengelehrsamkeit mit der Poesie der Flasche kann nur verderblich<br />
auf unsere akademische und Gymnasialjugend wirken."<br />
(25)<br />
Solche <strong>im</strong> Chor der Verehrer und Bewunderer der 70er Jahre
161<br />
übrig gebliebenen echten Kritiker werden, vor allem wenn sie<br />
das Richtige treffen, <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> auf die neue deutsche Art<br />
abgefertigt, wie er an Anton <strong>von</strong> Werner schreibt:<br />
"Die Kerls behaupten ich sei ein Hofschmeichler und Kriecher<br />
geworden und lügen und verläumden so kräftig, daß ich hie<br />
und da mit einem kräftigen Vorstoß Einen übers Maul haue.<br />
. . . der ganzen Bande aber eine so gründliche Verachtung erweise,<br />
daß sie noch lange fortstänkern werden.<br />
So i s t tüchtiger Leistung Schicksal: mit steigender Anerkennung<br />
bei den Braven auch steigende Anfechtung und Verlästerung<br />
bei der Unfähigkeit und der Bagage." (26)<br />
Bis zu seinem Lebensende wird sich <strong>Scheffel</strong> unverstanden fühlen,<br />
obwohl ihn mittlerweile die Wogen des literarischen und<br />
ökonomischen Bucherfolgs zum deutschen Klassiker erhoben haben.<br />
3. Der erklärbare Erfolg<br />
Die gewaltig steigenden Auflagen der <strong>Scheffel</strong>werke <strong>im</strong> letzten<br />
Viertel des 19. Jahrhunderts sind schon bald mit dem siegreichen<br />
Ende des Krieges <strong>von</strong> 1870/71 und der Reichsgründung in Verbin-<br />
27<br />
dung gebracht worden ; genauere Zusammenhänge konnten aber nur<br />
erahnt werden. Schon Proelß hatte vermutet,<br />
"daß das nach dem großen Krieg gegen Frankreich so bedeutend<br />
gesteigerte Nationalbewußtsein <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>s Dichtungen wie<br />
<strong>von</strong> denen keines anderen Dichters der Zeit sich angemuthet<br />
fühlte." (28)<br />
Man hat gemeint, nach 1871 hätten sich die verschiedensten<br />
Rezeptionsgruppierungen zu einem nationalen Rezeptionsvolk zu-<br />
29<br />
sammengeschlossen . Eggert hat für <strong>Scheffel</strong>s gestiegene Popularität<br />
dieser Zeit ein neues "Lebensgefühl" verantwortlich<br />
gemacht , das mit einer "Ubergangsphase" des historischen Ro-<br />
31<br />
mans zwischen 1870 und 1875 zusammenfalle .<br />
Jedenfalls i s t <strong>Scheffel</strong> schon zu seinen Lebzeiten ein deutscher<br />
Klassiker geworden, anders als Schiller oder Goethe aber ein<br />
Klassiker des breiten Lesepublikums. Bei <strong>Scheffel</strong>s Tod sollen<br />
der Lkke.ka/id 90, Qaudeamut $0 und der 7/lompete/t etwa 14-0 Auflagen<br />
gehabt haben. Die reinen Auflagenziffern besagen noch<br />
nicht v i e l , schon eher die Tatsache, daß für 1886 eine Gesamtauflage<br />
der Scheffeischen Werke <strong>von</strong> einer halben Million Exem-<br />
32<br />
plaren errechnet worden i s t . Für das Jahr 1902 sind durch
162<br />
die <strong>Scheffel</strong>-Jahrbücher genauere Angaben zur Hand:<br />
"Der 7 /iompete/i <strong>von</strong> Säkkingen hat in der Oktav-Ausgabe die<br />
254.» in der Großoktavausgabe die 4-.» und in der Quartausgabe,<br />
dem Prachtwerk Anton v. Werners, die 3. Auflage erlebt.-<br />
Lkketia/id hat in der Kleinoktavausgabe die 182., in<br />
der zweibändigen Großoktavausgabe die 8. Auflage erreicht.-<br />
Das ewig junge Qaudeamut steht in der Kleinoktavausgabe in<br />
der 64.., in der Großoktavausgabe und in der Quartausgabe in<br />
der 2. Auflage.- Der £unipe./iut hat es auf 8, T/iau Aventiu/ie<br />
auf 18, die Be/igptaImen haben es in der Kleinoktavausgabe<br />
auf 6, in der Quartausgabe auf 4-» Hugideo, der lange in der<br />
zweiten Auflage stecken geblieben war, hat es jetzt auf 9,<br />
die Ualde.intamke.it auf 5 Auflagen gebracht.- Von den Prosawerken<br />
stehen die Reitelilde/i und die Cpitteln in der 2.,<br />
das humorstrotzende Qedenkbuch. in der 3. Auflage, während<br />
die nachgelassenen Tün-f. Dicktungen die 2., die Qedichte aut<br />
dem Nachlaß die 4-.» und der Band Aut He<strong>im</strong>at und T/iemde noch<br />
die 1. Auflage aufweist.- Im Ganzen sind die Werke <strong>Scheffel</strong>s<br />
in nicht weniger als 580 Auflagen und 20 Ausgaben verbreitet."<br />
(33)<br />
Der Öffentlichkeitscharakter dieses Verkaufserfolgs läßt sich<br />
erst recht ermessen, wenn man ein vom Biographen Proelß mitgeteiltes<br />
Kuriosum betrachtet. Im Verlag Adolf Bonz<br />
"steht eine Schnellpresse <strong>von</strong> recht stattlichen D<strong>im</strong>ensionen,<br />
auf welcher <strong>von</strong> der Begründung des Geschäfts bis heute kein<br />
anderer Autor als <strong>Scheffel</strong> gedruckt worden i s t , ohne daß sie<br />
je einen Tag gerastet hätte." (34)<br />
Der Verfasser zieht auch gleich den zutreffenden Schluß vom<br />
Verkaufserfolg zum Dichterruhm <strong>Scheffel</strong>s:<br />
"Welch ungeheure Macht eines Dichtergeistes, welche weite,<br />
breite Wirkung auf das Volksgemüth s t e l l t uns diese Zahl vor<br />
Augen - und wenn Einer mit Engelszungen redete, er könnte<br />
uns den Einfluß <strong>Scheffel</strong>s und die Liebe seiner Nation für<br />
seine Werke nicht gewaltiger verkünden, als diese trockene<br />
Ziffer!" (35)<br />
Im Jahrbuch des <strong>Scheffel</strong>bundes <strong>von</strong> 1903 i s t eine andere, nicht<br />
weniger erstaunliche Relation errechnet worden. Die bisher verkauften<br />
Exemplare werden auf die Bevölkerung Deutschlands umgelegt,<br />
was dann bedeuten würde: "auf je 100 Köpfe kam ein Band<br />
<strong>Scheffel</strong>" 3 6 !<br />
Diese offensichtliche Volkstümlichkeit <strong>Scheffel</strong>s schlägt sich<br />
in scheinbar ganz abwegigen Rezeptionsmöglichkeiten nieder, <strong>von</strong><br />
denen eine stellvertretend vorgestellt werden s o l l , weil sie<br />
symptomatischen Charakter hat. In seinem 1898 in München erschienenen<br />
Buch
163<br />
"Der Angelsport. Das Wissenswerteste aus demselben nebst Anleitungen<br />
zum Gebrauch der Angelgeräte sowie Beschreibungen<br />
der verschiedensten Angelmethoden besonders der Flugangel,<br />
der Grundangel, der Spinnangel und der Schleppangel<br />
n<strong>im</strong>mt ein gewisser H. Stork senior <strong>Scheffel</strong> als Angler in Beschlag.<br />
Die Bekanntheit des Dichters wird benutzt, um das Interesse<br />
des Käufers für das eigene Buch anzufeuern und die<br />
doch prosaische Tätigkeit des Angelns durch poetischen Aufputz<br />
zu erhöhen. <strong>Scheffel</strong> wird für die Verbreitung des Angelsports<br />
und den Absatz des eigenen Buches eingespannt, aber so, daß der<br />
Dichter <strong>Scheffel</strong> nur noch als beiläufiges Attribut erscheint,<br />
das dem Angler <strong>Scheffel</strong> aufgesetzt wird:<br />
"Wie <strong>im</strong> Herzen des ganzen deutschen Volkes der Dichter, so<br />
wird der liebenswürdige Angler <strong>von</strong> der Seehalde fortleben<br />
auch in der Erinnerung der biederen Bewohner des Schmiechthales,<br />
welches ich nochmals zu sehen hoffe, um am Lieblingsplätzchen<br />
<strong>Scheffel</strong>s, am Mühlenschuss, unter schattigen Bäumen<br />
die Bilder der Vergangenheit an mir vorüberziehen zu<br />
lassen." (37)<br />
Eine andere Schicht der populären Rezeption wären die Parodien,<br />
Travestien und Nachempfindungen der <strong>Scheffel</strong>werke und des spezifischen<br />
<strong>Scheffel</strong>stils, entweder aus kritischer Verspottung<br />
oder aus dem Bedürfnis heraus, sich an den Sog der Beliebtheit<br />
<strong>Scheffel</strong>s anzuheften. Die S che. f feie, i fast als Epochenstil des<br />
späten 19. Jahrhunderts für die aufgewärmte Biedermeieridylle<br />
oder die antiquarische Quellenaufbereitung in Romanform wäre<br />
eine eigene Untersuchung wert, in der sich Mechanismen der<br />
Trivialisierung <strong>von</strong> Sprachformeln und Denkschemata aufzeigen<br />
ließen. Ähnliches g i l t für die zahllosen <strong>Scheffel</strong>standbilder<br />
und -denkmäler, Gedenktafeln und Erinnerungsstätten, die abgeo<br />
o<br />
sehen <strong>von</strong> Breitners Zusammenstellung <strong>von</strong> 1912 noch nicht<br />
systematisch erfaßt sind und einer ikonographischen Betrachtung<br />
wert<br />
wären.<br />
Kann dieser Erfolg <strong>Scheffel</strong>s erklärt werden? Im Unterschied zu<br />
3 9 LO<br />
Vermutungen und Ausflüchten oder eingängigen Spekulationen<br />
s o l l zusammenfassend versucht werden, die erstaunliche Wirkungsgeschichte<br />
<strong>Scheffel</strong>s unter besonderer Berücksichtigung des<br />
ikkehaid zu erhellen. <strong>Scheffel</strong> i s t an der Epochengrenze zwischen<br />
Biedermeier und Realismus auf eine merkwürdige Iiterargeschichtliche<br />
Situation gestoßen, in der seine Texte jeweils gleich.-
164<br />
zeitig unterschiedliche Lesarten anbieten konnten. Nach 184-8<br />
und während der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts i s t mit einem<br />
breiten Feld biedermeierlicher Lesererwartung unter der Oberfläche<br />
des realistischen Literaturbetriebs zu rechnen^. Für<br />
diese 'konservative' Leserschicht konnten <strong>Scheffel</strong>s ReiteHitde/i<br />
das Heine-Vorbild nahtlos <strong>im</strong>itieren, seine politischen Gedichte<br />
den Traditionen der Vormärz-Lyrik folgen, der 7/tompete/i sich<br />
der biedermeierlichen Versidylle problemlos einfügen. Speziell<br />
der Ekkeha/id paßt in die seit der Mitte der 50er Jahre stetig<br />
4.2<br />
ansteigende Produktion historischer Romane 4 . Auch die Tatsache,<br />
daß <strong>Scheffel</strong>s erster und einziger Roman gleich in der renommierten<br />
Meidinger-Reihe erscheinen konnte , mag den Bekanntheitsgrad<br />
des Autors gefördert haben.<br />
Wichtiger aber als Erklärung für den Erfolg des Ekkeha/id über<br />
die Jahrzehnte hinweg i s t das Angebot zur mehrfachen, epochenund<br />
schichtenspezifischen Rezeption, das <strong>von</strong> diesem Roman ausgeht.<br />
Dem programmatischen Realismus nach 184-8 konnte der tkkekaid,<br />
nicht nur wegen des realitätssüchtigen Vorworts, als<br />
Musterbeispiel dienen; zugleich erfüllte er die Vorstellungen<br />
der historischen Romane der Scott-Nachfolge, regionale Kultur<br />
und Geschichte als Formen der Wirklichkeit in sich aufzunehmen.<br />
An die Dorfgeschichte, an Berthold Auerbach, Willibald Alexis<br />
und Theodor Fontane wäre hierbei zu erinnern, die für ihr Werk<br />
einen vergleichbaren Zugang zur Wirklichkeitsdarstellung intendiert<br />
haben.<br />
Für die Zeitgenossen nach 1871 konnte der Lkkekaid gerade wegen<br />
seiner Zeitferne als allgemein gültiges Exempel der geschichtlichen<br />
Best<strong>im</strong>mung des Reiches gelesen werden. Hier t r i f f t der<br />
&kkeha/id auf die professoralen Geschichtsromane <strong>von</strong> Georg Ebers,<br />
Felix Dahn u. a., in denen die Geschichtswissenschaft sich gerade<br />
<strong>im</strong> Roman mehr oder weniger repräsentativ zur Schau s t e l l t<br />
(Anmerkungen!). Der Held des Ekkeha/id paßt zudem ins gründerzeitliche<br />
Bild des Individuums mit großen Gesten und pathetischen<br />
Redeformen; Geschichte wird als handgreifliches, personenzentriertes<br />
und raonumentalisiertes Menschheitsdrama (Karl May!)<br />
inszeniert. Der Ubergang zur He<strong>im</strong>atkunst, der sich aus der<br />
regionalgeschichtlichen Thematik des Romans fast <strong>von</strong> selbst anbietet,<br />
kann sich mühelos vollziehen. Mit seinem Kostümrealis-
165<br />
mus steht der Lk.ke.rta/id über die He<strong>im</strong>atkunstbewegung bis weit ins<br />
20. Jahrhundert hinein geradezu programmatisch für einen reaktionären<br />
Literaturbegriff, dessen Wucherungen bis in die Blut-und-<br />
Boden-Ideologie weit vor dem Dritten Reich vordringen 4 4 .<br />
Diese anti-modernistische, gegen die avantgardistische oder nur<br />
nicht-konservative Kunst gerichtete Komponente der Ekkeha/td-<br />
Rezeption i s t zum letztenmal deutlich an der Festschrift zum<br />
100. Geburtstag <strong>Scheffel</strong>s 1926 abzulesen. Die "Huldigung deutscher<br />
Dichter und Schriftsteller", als die sich die Sammlung<br />
<strong>von</strong> Antworten auf die Frage nach dem Schönen <strong>im</strong> Ekkeha/id versteht,<br />
reicht <strong>von</strong> Hermann Bahr, für den der Lkkeka/id einfach<br />
"unsterblich" und "ewige Kunst" i s t 4 ^ bis zu Hugo <strong>von</strong> Hofmannsthal,<br />
der <strong>im</strong> Lkkeka/id "sein Bescheidenes", aber zugleich auch das<br />
"Große der geistigen Zusammenhänge" erkennen w i l l ^ , oder Stefan<br />
Zweig, der darin "Heiterkeit aus klarem Gemüt und gleichzeitig<br />
LI<br />
ganz ernstem deutschen Sinn" abliest 4 . <strong>Scheffel</strong> g i l t sowohl als<br />
zeitlos und klassisch, als auch als der deutscheste Dichter.<br />
Diese v n Widerspruch als einen nur scheinbaren aufzulösen hat sich<br />
Börries <strong>von</strong> Münchhausen in dem eingangs zitierten neuen Jahrbuch<br />
des <strong>Scheffel</strong>bundes vorgenommen. Er versucht, <strong>Scheffel</strong>s<br />
Ewigkeitswert als Dichter durch eine selektive Rezeption des<br />
angeblich Uberdauernden und Erträglichen zu erhärten:<br />
"<strong>Scheffel</strong> lebt in Kopf und Herz der Nachwelt nicht als der<br />
Bierkartenpoet, nicht als der Trompetersänger, nicht als der<br />
Bratenbarde gelehrter Gesellschaften, sondern ausschließlich<br />
als der Dichter des Ekkehard und einer Handvoll ewiger Lieder."<br />
(LS)<br />
Dieser rein poetische Wert, der den Publikumserfolg scheinbar<br />
verschmäht und sich auf die elitäre Isolation individuellen<br />
Kunstgenusses zurückzieht, braucht aber dann doch die populäre<br />
und materielle Basis:<br />
"Und der Mann, der den stärksten Bucherfolg seiner Zeit hatte,<br />
der Mann, der ein Vierteljahrhundert lang der dichterische<br />
Geist Deutschlands war, der Mann war ein Deuttcke/i." (L9)<br />
Der nationale Wert <strong>im</strong> Schlepptau des ökonomischen Erfolgs i s t<br />
spätestens hier vollständig mit kulturkonservativer Bedeutung<br />
aufgeladen.<br />
Im gleichen Jahr wie diese beiden Huldigungsschriften erscheint<br />
eine Prachtausgabe <strong>von</strong> ein paar bedeutungslosen Briefen Schef-
166<br />
fels, bibliophil gedruckt, in rotes Leder gebunden und in l i m i <br />
tierter Auflage. Die Intention dieser Ausgabe, die das banalste<br />
Schriftstück durch repräsentative Gestaltung zum Dichterdenkmal<br />
erheben möchte, entspricht der der beiden anderen Schriften:<br />
gegen die zeitgenössische Literatur mit ihren "Modeströmungen,<br />
Schlagwörtern und sonstigen Vorurteilen" wird zu Felde gezogen<br />
und die gute alte Zeit und "eine nah bevorstehende <strong>Scheffel</strong>-<br />
Renaissance" beschworen^. Die <strong>Scheffel</strong>rezeption wird zum aggressiv-konservativen<br />
Vorwand, gegen die Literatur der eigenen<br />
Zeit ein Dichterbild zu setzen, das für sich ein ungetrübtes<br />
Einssein mit der Tradition proklamiert und behauptet, <strong>im</strong> Namen<br />
einer schweigenden Mehrheit zu sprechen: denn das "entspricht<br />
51<br />
heute wiederum einem verlangenden Sehnen weiter Kreise" .<br />
Schon wenige Jahre später wird die institutionalisierte <strong>Scheffel</strong>verehrung<br />
zum "Bewahrer und Erwecker volks- und stammesverbunde-<br />
52<br />
nen Geistes" und der <strong>Scheffel</strong>bund zum Volksbund umgetauft. Im<br />
<strong>Scheffel</strong>bund waren ja schon seit seiner Gründung vor der'Jahrhunderwende<br />
politisch konservativste Literaturtendenzen <strong>im</strong> Sinne<br />
5 3<br />
einer angeblich richtigen <strong>Scheffel</strong>-Nachfolge gepflegt worden .<br />
Jetzt aber wird aus dem volkstümlichen Dichter endgültig ein<br />
völkischer.<br />
Das schlechte Abschneiden <strong>Scheffel</strong>s nach dem Zweiten Weltkrieg<br />
scheint dem ehemaligen Publikumserfolg in umgekehrter Proportionalität<br />
zu entsprechen. <strong>Scheffel</strong>s Werk g i l t heute als "konsumchic",<br />
als "schön angepaßt und vollkommen ungefährlich"^4.
167<br />
VII. DER ILLUSTRIERTE DICHTER<br />
1. Die i l l u s t r i e r t e Prachtausgabe<br />
Auf welch verschlungenen Pfaden die.Textrezeption vor sich gehen<br />
kann, s o l l eine Analyse der Illustrationen zu den <strong>Scheffel</strong>werken<br />
zeigen. Damit wird zugleich ein Bereich angeschnitten, den die<br />
traditionelle Wirkungsgeschichte <strong>von</strong> geschriebener Literatur mit<br />
ihren Auflageziffern, Rezensionsauswertungen und Verbreitungsstatistiken<br />
nicht erfassen kann. Erst in jüngster Zeit werden<br />
die Beziehungen zwischen literarischem Text, seiner Bebilderung<br />
i<br />
und dieser Wirkung auf den Leser untersucht .<br />
Die hier i s o l i e r t dargebotenen Illustrationen verfälschen f r e i <br />
l i c h den Funktionszusammenhang der großformatigen, luxuriösrepräsentativen<br />
Prachtausgabe, in den sie gehören. Die sozialgeschichtlichen<br />
Bedingungen, unter denen die Prachtausgabe um<br />
2<br />
die Mitte des 19. Jahrhunderts entsteht, sind erkannt . Als typische<br />
Erscheinungen der Gründerzeit heben sich diese Prachtausgaben<br />
<strong>von</strong> den schon <strong>im</strong>mer üblichen Literaturillustrationen<br />
durch ihr spezifisches Formenarsenal und ihre besonderen Intentionen<br />
ab. Die "kolossale Entwicklung dieses Zweiges der<br />
Literatur" konnten schon die Zeitgenossen "nicht ohne Staunen<br />
3<br />
betrachten" . Speziell für die zweite Hälfte des Jahrhunderts<br />
kann der literargeschichtliche Zugriff auf Text und Historie<br />
unter der Perspektive der Literaturillustration geradezu grundsätzlich<br />
erfaßt werden 4 .<br />
Die wichtigste Funktion literarischer Prachtausgaben, nämlich<br />
die Erzeugung und Aufrechterhaltung eines sozial gestuften Lesepublikums<br />
<strong>im</strong> <strong>Zeitalter</strong> massenhaft verbreiteter Lesestoffe,<br />
hängt eng zusammen mit den neu entdeckten technischen Möglichkeiten<br />
der Bildreproduktion (Lichtdruck) und der sich gegen-<br />
5<br />
seitig beeinflußenden Realitätsmalerei und Fotografie . Der<br />
optischen Vermittlung auch <strong>von</strong> Literatur stehen mit neuen Medien<br />
und Bildtechniken Kanäle zur Verfügung, die mit der konventionellen<br />
Textanalyse nicht zu verstehen sind. Bis zu solchen Erfindungen<br />
und technischen Innovationen war das Lebende Bild des
168<br />
Literatur in handgreiflich erfaßbare, optische Darstellungsformen<br />
umzusetzen 6 . Auch für die <strong>Scheffel</strong>texte sind solche Lebenden<br />
Bilder überliefert, jetzt aber als Werbeträger für die I l l u s t r a <br />
tionen, wie <strong>Scheffel</strong> selber berichtet: "Samstag 6ten war colossale<br />
Reclame für die T/tau Avent Lüne, fünf lebende Szenen, <strong>von</strong><br />
7<br />
Dietz arrangirt, mit allem möglichen Pathos und Goldgrund."<br />
Die über die reine Verbildlichung der Texte hinausgehende gesellige<br />
Funktion der Lebenden Bilder zeigt sich daran, daß die<br />
Tableaux kein vorillustrativer Ersatz für Abbildungen sind,<br />
sondern diese selbst <strong>im</strong> gesellschaftlichen Kreis noch einmal<br />
nachspielen können:<br />
"In Stuttgart war ein Ball der Künstlergesellschaft Bergwerk,<br />
- die ganze Gesellschaft, gegen 200 Personen, waren<br />
Gestalten und Costüme aus dem 7/iompete/i, 6 große Bilder nach<br />
Deinen Compositionen wurden dargestellt, dann der Festzug<br />
<strong>von</strong> Allen, es fehlte Keiner, Fludribus, der Kutscher Anton,<br />
der ganze römische Klerus, Ritterdamen und Hauensteiner ...<br />
auch die Quadrillen waren vom Trompeter in der Mitte mit<br />
Margareta dominirt..." (8)<br />
Lesefunktion, Lesepublikum oder Käuferschichten der Scheffeischen<br />
Prachtausgaben genauer zu best<strong>im</strong>men, bereitet wegen der<br />
Breite der Genrestreuung {Qaude.am.ut für Studenten und Stammtische,<br />
£kkeha/id für historisch Interessierte, 7 /iompete/i für<br />
junge Mädchen usw.) einige Probleme. Die hohen Preise der Prachtausgaben<br />
(für <strong>Scheffel</strong>werke etwa das 25-fache der Normalausgabe)<br />
und die konkurrierenden billigeren Leseausgaben lassen nicht<br />
bloß vermuten, daß "solche Editionen kaum zu Lektürezwecken geo<br />
kauft" wurden . In den nachgehefteten Blättern der i l l u s t r i e r t e n<br />
2-un ipe/iut-Ausgabe <strong>von</strong> 1867 wird ausdrücklich für eine <strong>von</strong> den<br />
Texten abgelöste Verwendung der Illustrationen geworben:<br />
"Diese Bilder eignen sich überdieß wie kaum etwas Anderes<br />
zur Ausschmückung <strong>von</strong> Räumen, welche zur Pflege heiterer<br />
Geselligkeit best<strong>im</strong>mt sind." (10)<br />
Schon ernsthaftere Zeitgenossen haben diese unliterarische Verwendung<br />
<strong>von</strong> Literatur durch "sogenannte gebildete Damen" k r i t i <br />
siert, die diese Werke<br />
"nie gelesen haben, die sich aber einbilden, ein solches<br />
Werk zu kennen und geistig zu besitzen, wenn es verziert mit<br />
bunten Bildern als Staubfänger auf ihrem Sofatisch l i e g t . "<br />
(11)
169<br />
Aber nur scheinbar genügt es, wenn durch die prachtvolle Ausstattung<br />
<strong>von</strong> Texten "eine unbezwingliche Lust zum Besitzen er-<br />
12<br />
weckt" wird . Merkwürdigerweise sichert dieser nur materielle<br />
Besitz <strong>von</strong> Dichtung gleichzeitig den Anspruch auf den geistigen.<br />
Mit dem Erwerb der literarischen Prachtausgabe proklamiert der<br />
Käufer, an der Literatur als einer "der allerwichtigsten Factoren<br />
in der Erziehung und Bildung des Kunstgefühles" teilzuha-<br />
1 3<br />
ben . Generell erschließen sich <strong>von</strong> daher gesellschaftliche<br />
Verwendungszusammenhänge <strong>von</strong> Literatur, wenn die Prachtausgaben<br />
manchem als "Bilderbücher für große Kinder" gelten, die man<br />
"auf den Weihnachtstisch unter den Christbaum oder zum Durchblättern<br />
für 'Besuch* in das Salonz<strong>im</strong>mer" legt'' 4 .<br />
Implizit wird auf diese Weise auch über literaturgeschichtliche<br />
Wertungsfragen diskutiert, etwa welche Autoren sich zu i l l u <br />
strierten Ausgaben eignen und welche nicht, oder über die Frage<br />
der Stilhöhe, ob sich 'niedere' literarische Gattungen durch<br />
den hohen S t i l einer Illustration ins Repräsentative erheben<br />
lassen. Wie sehr diese Form <strong>von</strong> Buchpräsentation publikumsorientiert<br />
i s t und wie sehr scheinbare Geschmacksfragen politisch<br />
akzentuiert sind, zeigt die Diskussion um die geeignete Schriftform,<br />
wenn es heißt: "Seinen Schiller w i l l das deutsche Volk<br />
auch in deutscher Sprache lesen"'' ^!<br />
Die hier vorgestellten Illustrationen zu den Dichtungen <strong>Scheffel</strong>s<br />
beanspruchen in a l l diesen Aspekten exemplarische Geltung,<br />
weil ihr Produzent eine der repräsentativsten Gestalten der<br />
Epoche genannt werden darf. Anton <strong>von</strong> Werner (1843-1914) ragt<br />
aus der Masse geschäftsmäßiger Buchillustratoren auch insofern<br />
hervor, als seine Karriere bis zum Schlachtenmaler des neuen<br />
Reiches in den Illustrationen zu <strong>Scheffel</strong>s Werken seinen Ausgangspunkt<br />
hat. Werners Selbstdarstellung^ 6<br />
und sein Kunstanspruch<br />
(vgl. sein berühmtes Reichsgründungsgemälde) machen ihn<br />
geradezu zum Paradigma des reichsdeutschen Kunstbetriebs zwischen<br />
1871 und dem Ersten Weltkrieg. Daß Anton <strong>von</strong> Werner als<br />
1 7<br />
einer der Protagonisten der Panoramamalerei g i l t , s t e l l t auch<br />
seine <strong>Scheffel</strong>-Illustrationen in kunstgeschichtliche Zusammenhänge<br />
<strong>von</strong> nationaler Repräsentanz und autoritärer Herrschaftsordnung,<br />
denen hier nicht weiter nachgegangen werden kann, deren<br />
1 8
170<br />
2. Die Illustrationen Anton <strong>von</strong> Werners<br />
2-u.n<br />
ipeius<br />
<strong>Scheffel</strong>s J-un ipe/ius, Geschichte, eines K/ieuzfah/ieis i s t ebenso<br />
wie seine T/iau Avent iu/ie ein Teil des nach Erscheinen des Ekkehard<br />
1855 geplanten und nie vollendeten Wartburgromans. Die zu<br />
umfassende Anlage des Projekts und sein baldiges Verstummen veranlaßten<br />
<strong>Scheffel</strong> dazu, diesen Handlungsteil als selbständige<br />
Erzählung herauszugeben. Seit 1866 arbeitete Anton <strong>von</strong> Werner<br />
1 9<br />
an den Illustrationen zum Junipe/ius . Schon früher hatte Werner<br />
mehr oder weniger planvoll einzelne Gedichte der 7/iau Av&htiuie<br />
i l l u s t r i e r t . Erst durch <strong>Scheffel</strong>s Engagement für eine adäquate<br />
Bebilderung waren Werners Zeichnungen aus ihrer marginalen<br />
Bedeutung zur Gleichrangigkeit mit dem Text aufgewertet<br />
worden:<br />
"Der Erfolg und die Anerkennung wird zwar langsam aber sicher<br />
kommen .. ich empfehle als praktischer Mann dem Herausgeber<br />
dringend .. eine Mappe anfertigen zu lassen, worauf in<br />
passender Ornamentik und Ausstattung eine Frau Aventiure oder<br />
sonst etwas Bezeichnendes .. auch z. B. ein Minnesänger in<br />
der Weise, wie Ihr einstiger Entwurf zum Titelblatt des<br />
Buches - ersichtlich i s t . . . Die Welt kauft doppelt und dreifach,<br />
wenn man ihr Alles handgerecht und mundgerecht macht."<br />
(20)<br />
Die vorliegende Ausgabe in Quartformat <strong>von</strong> 1867 in violettem<br />
Leinen mit gepreßten ReliefOrnamenten und Titel in Goldprägung<br />
i s t das erste gemeinschaftliche Werk <strong>Scheffel</strong>s mit dem damals<br />
noch unbekannten Zeichner und Maler Anton <strong>von</strong> Werner, der damit<br />
zum bekannten <strong>Scheffel</strong>-Illustrator werden sollte. Trotz <strong>Scheffel</strong>s<br />
Kalkulationen mit dem Publikumsgeschmack i s t der Erfolg<br />
des Buches anfangs bescheiden: "Der Juniperus bricht sich, wie<br />
ich <strong>von</strong> vielen Seiten höre, Bahn mit 'Hochachtung', aber wenig<br />
'Verkauf'" 2 1 .<br />
Die gleichrangige Arbeitsgemeinschaft, die <strong>Scheffel</strong> seinem<br />
Illustrator indirekt angeboten hatte, n<strong>im</strong>mt dieser auf; sie<br />
findet <strong>im</strong> Titelblatt der i l l u s t r i e r t e n Ausgabe ihren ersten<br />
Niederschlag: "Juniperus. Geschichte eines Kreuzfahrers erzählt<br />
<strong>von</strong> J. V. <strong>Scheffel</strong>, i l l u s t r . v. A. v. Werner." In den nachgehefteten<br />
Reklameblättern der Oktavausgabe (Stuttgart 1871)
171<br />
werden andere i l l u s t r i e r t e Prachtausgaben und Fotografie-Mappen<br />
<strong>von</strong> Werner zu <strong>Scheffel</strong>s Werken angepriesen als "<strong>von</strong> denselben<br />
Verfassern"!<br />
Das Titelblatt des 2.unipe./ius (Abb. 1) i s t ganzfarbig (alle<br />
anderen Titelbilder Werners höchstens dreifarbig), was mit dem<br />
Kaufpreis (bis 25 Mark und mehr, einfache Oktavausgabe gebunden<br />
1 bis 2 Mark!) und der Repräsentationsfunktion dieser ersten<br />
Ausgabe zusammenhängt. Der T i t e l i s t leicht nach rechts verschoben;<br />
durch die Farbintensität und die ausgearbeitete Konturenzeichnung<br />
(Ornamentstab rechts nur noch schematisch!) liegt<br />
das kompositionelle Schwergewicht links <strong>von</strong> der Mitte. Es i s t<br />
gruppiert um die fast seitenhohe I n i t i a l e J, <strong>von</strong> der aus die<br />
Ornamentik ausgeht: oben in der Kapitalschrift des Titels, darunter<br />
die Rundinitiale des Untertitels, unten durch den Lianenschwung<br />
um das auslaufende J nach rechts, und an der rechten<br />
Seite durch den nur noch angedeuteten Ornamentstab. Dabei wird<br />
die zum Ornament gewordene I n i t i a l e zum Rahmen um Titel und<br />
Verfasser umgeformt. Der eigentliche T i t e l "Juniperus" als Name<br />
und individuelle Kennzeichnung des Helden löst sich zu einem<br />
Teil des Rahmens auf. Mit der neuen I n i t i a l e G wird die "Geschichte<br />
eine.* Kreuzfahrers" zum neuen T i t e l .<br />
Autor und Zeichner werden nicht nur grammatikalisch (Geschichte<br />
... erzählt <strong>von</strong> i l l u s t r . <strong>von</strong>...), sondern auch graphisch<br />
als eingerahmter Teil des Titels zusammengestellt. Die Verlagsbezeichnung<br />
bleibt kennzeichnenderweise außerhalb dieses Rahmens<br />
.<br />
Der bildliche, farbliche und figürliche Schwerpunkt des Blattes<br />
und damit der inhaltliche Bezug auf den Text liegt f r e i l i c h<br />
außerhalb des Rahmens links <strong>von</strong> der I n i t i a l e , allerdings eingebunden<br />
in die Ornamentstruktur des J. Spiegelbildlich zum Titel<br />
umfaßt das ausgeschmückte J durch geschweiften unteren Bogen<br />
und oberen Querstrich, beides in Form <strong>von</strong> Schlangen oder Drachenköpfen,<br />
die halbseitengroße Figur eines Kreuzritters. In<br />
Analogie zu mittelalterlichen, an den Sockel gebundenen Gewändeund<br />
Portalfiguren steht der Ritter mit Rüstung, Schild und<br />
Phantasiewappen mit beiden Beinen fest auf dem unteren Schlangenkopf,<br />
dabei eng ornamental gebunden an die 'Wand' des breiten<br />
J. Durch die Fahne, die eine Lanze i s t , tut sich allerdings
172<br />
noch eine zweite Analogie auf: die heroische Siegerpose der aufgestützten<br />
Lanze und des Fußes auf dem Kopf des Untiers i s t<br />
ikonographisch dem Hl. Georg zugeordnet. Die Bilddarstellung<br />
bestätigt also den Befund der ornamentalen Komposition. Durch<br />
'Unterdrückung' des individuellen Titels und Hervorhebung des<br />
allgemeineren Untertitels, der Geschichte irgendeines Kreuzfahrers,<br />
wird die semantische und ikonographische Beziehung <strong>von</strong><br />
"Kreuzfahrer" und "Kreuzritter" (Kreuz auf dem Gewand!) in der<br />
Georgspose hergestellt. Die Scheffeische Erzählung wird demnach<br />
in zwei Aspekten zurechtgerückt, einmal durch Proklamierung der<br />
Gleichrangigkeit und Gleichwertigkeit <strong>von</strong> Erzähler und Zeichner,<br />
als durch Verwischung der Entstehungschronologie <strong>von</strong> Text und<br />
Bild, zum anderen durch Verschiebung der Erzählintention und<br />
des Erwartungshorizonts des Betrachters: aus der persönlichen<br />
Abenteuergeschichte des in der He<strong>im</strong>at durch unerfüllte Liebe<br />
22<br />
enttäuschten Helden, der quasi zufällig "Kreuzfahrer" wird ,<br />
macht Werner durch die Analogie <strong>von</strong> Georgspose und Untertitel<br />
eine Erzählung aus dem christlichen und militant-religiösen<br />
Mittelalter! Verstärkt wird diese verschobene Bildwirkung durch<br />
die historisierende Ornamentzeichnung, die mittelalterliche<br />
Handschriftenmalerei <strong>im</strong>itiert. Als erstem und als einzigem farbigem<br />
Blatt kommt dem Titelblatt damit eine entscheidende, die<br />
Lesererwartung vorstrukturierende Funktion zu.<br />
Die erste Zeichnung nach diesem Titelblatt (Abb. 2) überrahmt<br />
auf einer halben Seite das Vorwort <strong>Scheffel</strong>s. Das Bild in der<br />
oberen Blatthälfte und der Text in der unteren werden <strong>von</strong> dünnen<br />
Holzstangen eingerahmt, die das Bild halbkreisförmig und den<br />
Rahmen als ganzen rechteckig schließen - ein Motiv, das aus der<br />
romantisierenden, 'altdeutschen' Dürer-Rezeption abgeleitet i s t<br />
und seine Verweisfunktion dadurch offenbart, daß es <strong>im</strong> Rahmen<br />
aller ganzseitigen Bilder leitmotivartig wieder auftaucht. Im<br />
Halbkreisbogen sitzen sich Autor und Illustrator nun leibhaftig<br />
und gleichrangig gegenüber. Beide evozieren die Vorwortsituation,<br />
den ersten textlichen Rahmen der Erzählung. Die gedoppelte<br />
Rahmenstruktur des J.unipe/iu* wird damit noch verschachtelter.<br />
Die Rahmenerzählung wird nochmals in den historisch-wissenschaftlichen<br />
Rahmen <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>s Vorwort und seinen Anmerkungen<br />
gespannt. Analog dazu arbeitet Anton <strong>von</strong> Werner. Auch bei ihm
173<br />
entspricht dem Rahmen um seine Zeichnung die Erzählsituation,<br />
die mit dem Titelblatt und <strong>Scheffel</strong>s Anmerkungen in eine zweite<br />
Rahmenstruktur eingebettet i s t . Werner treibt diese doppelten<br />
Rahmenformen aber noch weiter, indem er sie ornamental verdoppelt.<br />
Die rahmenden Teile wie Vorwort und Anmerkungen werden in<br />
ihrer bildlichen Darstellung nochmals gerahmt, ebenso alle ganzseitigen<br />
Bilder <strong>im</strong> Text. Gleiches g i l t auch für die Rahmenfunktion<br />
des Titelblattes. Typischerweise fehlt diese Rahmung an der<br />
Stelle, an der die Erzählsituation errichtet wird. Im Gegenteil:<br />
durch den fließenden Übergang <strong>von</strong> Bild in Initiale und Text wird<br />
gerade die <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> geschaffene Trennung aufgehoben.<br />
Die Bildgestaltung dieses 3-unLpe./iu.4-Vorworts i s t in sich dreischichtig<br />
aufgebaut. Im Vordergrund, an den Schnittpunkten <strong>von</strong><br />
Halbbogensegment und Rechteck, stehen sich die Attribute <strong>von</strong><br />
Dichter und Maler parallel gegenüber. Zwischen ihnen spannt sich<br />
das Spruchband mit der Aufschrift "Vorwort". Die Überschrift<br />
wird dadurch aus dem Text in die Zeichnung hineingezogen, beide<br />
damit enger verknüpft; als geschriebenes und zugleich gezeichnetes<br />
Wort vermittelt es zwischen den Attributen <strong>von</strong> Dichter und<br />
Maler. Ahnliches geschieht durch die Schrifttype, durch die der<br />
gesamte Text als Illustration ausgegeben wird - die Grenzen <strong>von</strong><br />
Bild und Geschriebenem sollen sich in der Anschauung verwischen.<br />
Im Mittelgrund, mit den Beinen in das Spruchband ragend, sitzen<br />
sich Dichter und Maler symmetrisch gegenüber, beide übrigens mit<br />
intendierter Portraitähnlichkeit. Beide werden jedoch in verschiedene<br />
Richtungen s t i l i s i e r t . <strong>Scheffel</strong> i s t als Dichter darges<br />
t e l l t , jedoch nicht dichtend, sondern vorlesend und mit der<br />
Rechten gestikulierend - eine Geste, die in Dichterdenkmälern<br />
auftaucht und die belegt, daß die Prachtausgabe ja ebenfalls als<br />
graphisches Dichterdenkmal gedacht i s t . überhaupt i s t <strong>Scheffel</strong>,<br />
und das st<strong>im</strong>mt mit seiner archivalischen Produktionsweise überein,<br />
den schweinsledernen Folianten zugeordnet. Dieser ' r e a l i s t i <br />
schen' und zugleich kostümhaften Darstellung entspricht auch<br />
seine Kleidung (Gelehrtentalar), Körperbau und Brillenform. Anton<br />
<strong>von</strong> Werner hingegen hat sich selber mit idealistischer Tendenz<br />
dargestellt. In Walther-<strong>von</strong>-der-Vogelweide-Haltung s i t z t<br />
er, sinnend auf den Dichter hörend, auf seinen Zeichenblock gestützt.<br />
In Gesichtsausdruck, Haartracht und Kleidung fehlt die
174<br />
realistische Komponente wie bei <strong>Scheffel</strong>; v i e l eher i s t an<br />
klassizistische Schillerbildnisse oder an eine vage romantizistische<br />
'altdeutsche' Kostümierung angeknüpft. Auf dem Zeichenblock<br />
(übrigens h e l l , <strong>Scheffel</strong>s Buch dunkel!) hat Werner signiert.<br />
An dieser Stelle i s t , verstärkt durch die Lichtführung,<br />
die Gleichwertigkeit <strong>von</strong> Dichter und Zeichner des Titelblatts<br />
sogar zugunsten des Malers verschoben, der sicherlich die schönere<br />
Gestalt sein s o l l . Unwillentlich aber bleibt doch das<br />
Ubergewicht <strong>Scheffel</strong>s deutlich. Nicht nur, daß es sich in der<br />
Illustration um ein auf das Sp/iuchband ge.4ch/i ie.ß.e.ne.4 Vortoo/tt<br />
handelt - der abgebildete Maler muß auch dem rezitierenden Dichter<br />
zuerst zuhören, während dieser agiert. Inwieweit die Vorwortsituation<br />
die beiden Verfasser in den Vordergrund rückt und<br />
die eigentliche Handlung in den Hintergrund drängt, zeigen die<br />
dunkel gehaltenen Figuren: alle drei sind nicht nur schlecht beleuchtet<br />
und weniger sorgfältig ausgeführt, sondern auch durch<br />
eine doppelte Schranke in den Hintergrund verwiesen. An ihren<br />
Kappen wird ein Motiv erkennbar, das in den Illustrationen des<br />
öfteren wiederkehrt und also stellvertretend für die zu erzählende<br />
Geschichte steht.<br />
Dominierend und antithetisch bleiben die beiden Hauptgestalten<br />
sich gegenüber, <strong>Scheffel</strong> mit bürgerlicher Kleidung, Gelehrtentalar<br />
und Folianten, dargestellt als historisch-archivalisch<br />
Arbeitender, Dichtung in der Deklamation repräsentierend; Anton<br />
<strong>von</strong> Werner als idealischer und genialischer, dem E i n f a l l frei<br />
nachschaffender Künstler. <strong>Scheffel</strong> i s t dabei realistisch, d. h.<br />
in Kleidung und Attributen 'richtig' dargestellt, denn <strong>im</strong> Vorwort<br />
zur Novelle geht es ihm selbst um die Lösung der "kulturhistorischen<br />
Fragen" (11,9). Werner, <strong>Scheffel</strong>s "kunstgeübter<br />
Freund", hatte dabei nur eine dienende Funktion erhalten:<br />
"diese Gestalten b i l d l i c h zu erfassen und, wie <strong>im</strong> Mittelalter<br />
einer geschriebenen Dichtung ein reicher Miniaturenschmuck<br />
zugekommen wäre" (11,10),<br />
den Erzählvorgang ornamental und dekorativ auszumalen.<br />
Daß endlich eine Gleichrangigkeit beider Produzenten unter Vernachlässigung<br />
des Gegenstandes herauskommt, i s t aber nicht nur<br />
dem persönlichen Geltungsbedürfnis Werners anzulasten. Sie i s t<br />
vielmehr bedingt durch "die <strong>von</strong> ernsten St<strong>im</strong>mungen bewegte
175<br />
Zeit", in der das Vorwort und die Illustrationen 1866 entstanden<br />
sind. So erhält die i l l u s t r a t i v e Gegenüberstellung <strong>von</strong> Wortund<br />
Bildproduzenten als zweier Kunstaspekte ein und derselben<br />
Sache politische Signalfunktion. "Die freundliche Doppelarbeit<br />
des Dichters und des Malers" (Reihenfolge!) überwindet poetisch<br />
und malerisch den deutschen Bruderzwist durch ein <strong>von</strong> beiden<br />
gleichwertig produziertes Kunstwerk als einen Beweis,<br />
"daß ehrliche deutsche Herzen Nichts wissen und Nichts wissen<br />
wollen <strong>von</strong> Haß, Trennung und Bruderzwist und daß hier ein<br />
Mann vom Oberrhein und ein Mann <strong>von</strong> der Oder in guter Kameradschaft<br />
zusammengearbeitet haben an einem Werke deutscher<br />
Kunst." (11,10)<br />
Der Beginn der eigentlichen Novellenhandlung setzt mit einer<br />
traditionellen Erzählsituation ein. Unter einem best<strong>im</strong>mten Vorwand,<br />
man denke an Boccaccios De.came./ione. oder Goethes U.nte./ika£iungen,<br />
treffen sich die deutschen Kreuzritter und erzählen; <strong>im</strong><br />
Augenblick i s t der Held Juniperus an der Reihe. Die I l l u s t r a <br />
tion, diagonal über das Blatt reichend und mehr als die Hälfte<br />
der Seite einnehmend, verbildlicht diesen Moment (Abb. 3). Erzähler<br />
und Zuhörer sitzen unter einer dreibogig geöffneten Halle<br />
und werden <strong>von</strong> draußen beleuchtet. Das Licht fällt auf den Erzähler,<br />
die Zuhörer ihm gegenüber sind <strong>im</strong> Schatten gehalten. Auffällig<br />
sind sogleich die Korrespondenzen sowohl zum Titelblatt<br />
als auch zur Vorwort-Illustration. Wie bei dieser s i t z t der<br />
Erzähler links, ebenfalls gestikulierend, aber erzählend, nicht<br />
deklamierend; die Zuhörer wie der Zeichner dort sinnend und<br />
lauschend, einer sogar in ähnlicher Kleidung und mit aufgestütztem<br />
Kopf. Allerdings sind jetzt die Verhältnisse innerhalb der<br />
Erzählung umgekehrt: diesmals erzählt ein idealer Jüngling<br />
(lange Haare), alte und bärtige Gestalten hören ihm zu. Der Erzähler<br />
i s t aus der Mitte nach links verschoben und Bedeutung<br />
signalisierenden Bildzeichen zugeordnet. Auffällig i s t , daß der<br />
Erzähler in zweifacher Relation zu seinen Zuhörern steht. Im<br />
Gegensatz zur Erwartung sitzt er nicht über den Zuhörern; v i e l <br />
mehr blicken die Zuhörer, einige stehen sogar, auf den Erzähler<br />
herab. Denn dieser i s t ja als erzähltes und zugleich erzählendes<br />
Ich nicht <strong>im</strong> Besitz der klassischen Erzählerüberschau und dessen<br />
Allwissenheit; so i s t er weder durch die Erzählerhöhe <strong>von</strong> seinen<br />
Zuhörern abgehoben noch durch die gleiche Ebene (Sitzhöhe,
176<br />
Alter, Lichteinfall!) an sie gebunden. Der Leser als Bildbetrachter<br />
blickt f r e i l i c h <strong>von</strong> unten auf den Erzähler und muß dessen<br />
erzählkompetentere, höhere Position anerkennen. Der Erzähler<br />
als Person i s t wiederum eng verschlungen mit der Pflanzenornamentik<br />
der I n i t i a l e unter ihm. Auf den Bogen des J der I n i t i a l e<br />
(vgl. Titelblatt!) setzt er seine Füße; das Wappenschild <strong>im</strong><br />
Pflanzenwerk entspricht dem Fahnenwappen des Kreuzritters auf<br />
dem Titelblatt. Verwoben in die ornamental auslaufenden Akanthusblätter<br />
sind noch ein Rüstungshelm und ein Taubenpaar, letzteres<br />
auf das Liebesmotiv der Handlung hinweisend.<br />
Der Gesamteindruck der Illustration läuft nun aber unserer Beschreibungsrichtung<br />
genau entgegen, bestätigt aber diese neue<br />
Erzähler/Betrachter-Relation. Aus der rein ornamentalen Pflanzenverschlingung<br />
erwächst, auch formal fest integriert, das doppelte<br />
Taubenmotiv als Liebeszeichen. Von diesem ausgehend und sich verbreiternd<br />
auf die doppelte Seitenbreite sind einerseits Schild<br />
und Helm als individuelles Signum des Helden bzw. als Zeichen<br />
des ritterlichen Kampfes (vgl. das trivial-romantische Mittelalterbild:<br />
Minne und Aventiure) eingebunden, andererseits entsteht<br />
daneben aus den gleichen Pflanzengewächs die I n i t i a l e .<br />
Daß diese z/uoächtt, läßt sich deutlich sehen: der rein pflanzliche<br />
Bogen des J f entpflanzlicht 1 sich nach oben <strong>im</strong>mer mehr!<br />
In ganzer Breite entwächst der Ornamentik nun der Erzähler, der<br />
mit den Hüften und Füßen noch <strong>im</strong> Pflanzenwerk steckt und <strong>von</strong><br />
der Initiale eingerahmt wird. Die Zuhörer sind nur noch Aufsatz,<br />
nicht mehr konstituierendes Element der Erzählsituation. Diese<br />
entsteht, so dürfen wir interpretieren, in der Tiefe aus vorbegrifflichen<br />
Anfängen über emblematische Bildzeichen bis zur<br />
eigentlichen Erzählung. Wie weit diese Deutung mit dem Dichtungsverständnis<br />
<strong>Scheffel</strong>s übereinst<strong>im</strong>mt, zeigt ein Blick in das<br />
£/c/ce.ha/id-\lorwort, wo der Erzähler seine Aufgabe <strong>im</strong> "Verdichten"<br />
solcher Gestalten sieht. In seinen Formulierungen steckt ebenf<br />
a l l s diese Bewegung <strong>von</strong> unten nach oben und zu <strong>im</strong>mer größerer<br />
Deutlichkeit: vom Erzähler heißt es da, es "wachsen ihm Gestalten<br />
empor, erst <strong>von</strong> wallendem Nebel umflossen, dann klar und<br />
durchsichtig" (V,9) .<br />
Die übrigen ganzseitigen Bilder der 3-unipe/iut-Ausgabe sind alle<br />
in gleichförmige Rahmen eingefügt (Abb. 4). Dieser rechteckige
177<br />
Rahmen mit Halbbogenausschnitt n<strong>im</strong>mt in der Ornamentierung sowohl<br />
das Initialenmotiv des Titelblattes als auch das Bogen-<br />
Motiv der Vorwort-Illustration wieder auf. Alle ganzseitigen gerahmten<br />
Bilder sind mit einer Titelunterschrift versehen, obwohl<br />
sie sich, wie eine Abdeckprobe ergibt, auch ohne diese Erklärung<br />
auf die Erzählung beziehen lassen. Sieht man <strong>von</strong> einem<br />
lockeren emblematischen pictura-subscriptio^-Bezug ab, so erhalten<br />
diese Untertitel durch Format und herauslösenden Rahmen die<br />
Funktion, die Bilder zu verselbständigen, die Eigenwertigkeit<br />
der Illustration zu betonen und die Zeichnungen vom Text abzulösen.<br />
Das Buch kann also auch, wie ein Versuch beweist, ohne<br />
Kenntnis der Novelle als Bilderbuch gelesen werden! Unter dieser<br />
Perspektive erscheinen nicht die Bilder, sondern der Text als zusätzliche<br />
und unter Umständen überflüssige Beigabe. Nicht umsonst<br />
sind als Illustrationen dramatische, d. h. handlungsreiche<br />
oder heroische Szenen gewählt. Insgesamt sechs dieser "Haupt-<br />
2 3<br />
Charakterbilder" sind übrigens <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> selber vorgegeben<br />
Allerdings setzt Anton <strong>von</strong> Werner die dramatische Szene in ein<br />
barockes Kompositionsprinzip um (doppelte Diagonale durch das<br />
Boot in Stromrichtung und zwischen den beiden Felsen!), indem<br />
er Dramatik personalisiert. In <strong>Scheffel</strong>s seitenlanger Naturschilderung<br />
(II,45ff) geht Juniperus funktional fast unter;<br />
bei Werner i s t er mit seinem Boot ins Zentrum gerückt: Diethelm,<br />
der ja gleichberechtigt das Gottesurteil mitmacht, i s t fast<br />
nicht zu erkennen (hinter dem rechten Felsen angedeutet!). Der<br />
sich ins Schicksal ergebende Held <strong>Scheffel</strong>s (Arme über der<br />
Brust verschränkt) i s t bei Werner in Erregung aufgelöst, 'manieristisch'<br />
beleuchtet (Kniesicht) und verdreht. Die I l l u s t r a <br />
tion folgt also einer eigenen Aussageintention, nicht dem Erzählprinzip<br />
der<br />
Novelle.<br />
Eine eigene Illustration Werners i s t den gelehrten Anmerkungen<br />
des Juni/?e./iu4 vorgesetzt (Abb. 5). Im Lkkeka/id waren solche Anmerkungen<br />
als Fußnoten noch in den Text integriert oder zumindest<br />
darauf bezogen. Im Jan ipz/iuA bilden sie eine getrennte Abteilung,<br />
eine eigene historische Abhandlung, die nur in lockerer<br />
Beziehung zum Text steht. Bestanden die
178<br />
Das Blatt n<strong>im</strong>mt die schon bekannten Bildmotive Werners in ihrer<br />
Verweisungsfunktion wieder auf, so das Rankenwerk und den Rundbogen<br />
<strong>im</strong> Rechteckrahmen. Auch das Spruchband mit der Aufschrift<br />
"Anmerkungen" i s t parallel zu dem des Vorworts gestaltet. Darunter<br />
s i t z t als Zeichen der Weisheit und Gelehrsamkeit eine<br />
Eule auf einem aufgeschlagenen Buch. Ansonsten aber i s t der<br />
Rahmen leer und nur flächig gefüllt, was ein bezeichnendes Licht<br />
auf die Bedeutung dieser Anmerkungen wirft. Eher könnte man<br />
da<strong>von</strong> ausgehen, daß das Rahmenmotiv durch die Leere in sich<br />
Portalfunktion erhält. Auch das Spruchband über dem Tor und die<br />
Eule als Türhüter sprechen dafür; das Raumfüllsel dahinter<br />
deutet Formen des Orientalismus an und erinnert nicht <strong>von</strong> ungefähr<br />
an eine eiserne Tür. Das Anmerkungsblatt wird damit für<br />
den Buchleser zum Portal zur Gelehrsamkeit, wodurch das nur Erfundene<br />
vom wirklich Gefundenen säuberlich getrennt werden.<br />
Gaude.amu.4<br />
<strong>Scheffel</strong>s Gaudeamu*-Gedichte wurden mit dem Untertitel "Lieder<br />
aus dem Engern und Weitern" in Buchform zuerst 1868 veröffentl<br />
i c h t . Zu bedenken i s t jedoch, daß es sich dabei fast ausnahmslos<br />
um Gedichte und Lieder handelt, die seit 184-8 entstanden<br />
und zum Teil in verschiedenen Blättern (anonym als 'Volkslieder'<br />
oder als Kommersgesänge) schon gedruckt waren. Unsere Prachtausgabe,<br />
die zweite, vermehrte Auflage <strong>von</strong> 1877 i s t "Mit 111/V<br />
Holzschnitt-Illustrationen u. Vignetten und einem Titelbild in<br />
Tondruck <strong>von</strong> Anton <strong>von</strong> Werner" ausgestattet, der daran seit<br />
1867 gearbeitet hat . Rotes Leinen i s t in Schwarz und Gold geprägt,<br />
der Titel selbst in Gold auf Schwarz auf rotem Leinendeckel,<br />
der Buchschnitt natürlich in Gold.<br />
Das ganzseitige T i t e l b i l d in drei Farben (schwarz, rot, blau)<br />
ruft die schon vom Hunipe./iu.A bekannten Bildmotive Werners neu<br />
auf (Abb. 6). Ein doppelter Rahmen in Holz<strong>im</strong>itation mit Rundbogenausschnitt<br />
umspannt das Bild einer fröhlichen Kahnpartie<br />
vor dem Heidelberger Schloß. Um den <strong>von</strong> Pflanzen umrankten Rahmen<br />
winden sich Spruchbänder mit T i t e l - und Verfasserangabe.<br />
Beide Bänder sowie der doppelte Rahmen geben dem Bild Tiefe,<br />
indem sie es vom Betrachter distanzieren. So entsteht der Eindruck<br />
nicht eines Bildes, sondern einer Guckkasten-Bühne, also
179<br />
eines freien Raumes hinter dem Rahmen. Diese Tendenz wird noch<br />
verstärkt durch die Schrägstellung des Bootes zu einer Art<br />
Schrankenwirkung, die die Breite des dahinter liegenden Flusses<br />
nochmals vom Hintergrund des Schlosses abgrenzt.<br />
<strong>Scheffel</strong>s eigene Vorstellungen für das Titelblatt waren anders<br />
orientiert<br />
gewesen:<br />
"Ersinnen Sie dazu den Genius der Lieder, als Knaben mit dem<br />
Wunderhorn, oder studentisch frisch, in Heidelberger Landschaft,<br />
mit den passenden Attributen, älteren und jüngeren<br />
Leuten Eins aufspielend ... Die charakteristische erste<br />
Illustration." (25)<br />
Werners Illustration indes erinnert statt der studentischen Romantik<br />
<strong>Scheffel</strong>s in einer Art Synkretismus die Vergangenheit<br />
pauschal. Nach dreißig Jahren werden die Freuden <strong>von</strong> Wein, Weib,<br />
Gesang, Kunst(-Geschichte) und Geselligkeit geballt zurückgerufen.<br />
Daß dabei einiges historisch verschoben wird, i s t bezeichnend<br />
(Anwesenheit singender Damen, girlandengeschmücktes<br />
Boot). Der gesellige Kreis der Revolutionszeit und nach 184-8<br />
wird <strong>von</strong> Anton <strong>von</strong> Werner auf ein idealisiertes <strong>Scheffel</strong>bild<br />
h i n s t i l i s i e r t . Das erhöht sitzende, mit Gitarre ausgestattete<br />
und mit deklamatorischer Geste auf <strong>Scheffel</strong> deutende Mädchen<br />
als dessen Muse hat mit dem Dichter Blickonktakt; <strong>Scheffel</strong><br />
steuert das Ganze zielbewußt. Alle anderen Bootsfahrer sehen nur<br />
begeistert (und <strong>von</strong> hinten) zur Muse auf, mit zwei Ausnahmen:<br />
der Pfeifenraucher vorn hat parallel dazu Blickkontakt mit seinem<br />
Hund, der <strong>im</strong> Hintergrund dunkel gehaltene Mann - übrigens<br />
als einziger mit Hut statt mit Studentenmütze - hält Blickkontakt<br />
mit dem Betrachter, zieht diesen also mit hinein ins Bild<br />
und distanziert ihn zugleich durch sein unbeteiligtes Lächeln.<br />
<strong>Scheffel</strong>, der Steuermann, der die Geschicke lenkt, orientiert<br />
sich bei seiner Fahrt an seiner Muse, nicht an der Örtlichkeit.<br />
Er hält sein Boot direkt auf Heidelberg zu. Durch die Beziehung<br />
<strong>von</strong> Burschenschaftsherrlichkeit und Altheidelberg (Schloß, nicht<br />
Stadt!) s t i l i s i e r t sich das Bild ins Nationale, jedoch Unbürgerliche.<br />
Die unbeschwerten Studenten (Mützen, Pfeife, Weinpokal,<br />
Girlanden) reihen sich um die germanisch blonde Muse vor der<br />
Kulisse des urdeutschen Heidelberg.<br />
Aber Werner inszeniert noch ein Weiteres. Zwischen Bild und<br />
unterem Rahmen spannt er ein Bildband mit dem schemenhaften,
180<br />
aber mehrfach wiederholten Reichsadler. Die Abbildung des volkstümlich<br />
Deutschen wird so <strong>im</strong> Rahmen des Reichsdeutschen gedeutet.<br />
Damit aber verschieben sich in dieser verfälschenden Aktualisierung<br />
die Zeitbezüge. Die frühe f demokratisch'-deutsche<br />
Geselligkeitspoesie des Qaudeamu* wird hineingezogen in die<br />
reichsdeutsch-nationalstaatliche Repräsentationspoesie der 70er<br />
Jahre. Beide Poesie- und Lebensformen verhalten sich so zueinander<br />
wie das anonyme Flugblatt mit Scheffeischen Trinkliedern<br />
zur Prachtausgabe des QaiLde.amu.4.<br />
Die Illustration zum Widmungsgedicht <strong>Scheffel</strong>s für die Sammlung<br />
(Abb. 7) folgt ebenfalls mit geringen Variationen dem<br />
schon bekannten Bildaufbau Werners. Hinter der Mauer mit der<br />
Aufschrift "Widmung", zugleich als Titel des Gedichts gedacht,<br />
s i t z t eine Runde mittlerer und älterer Herren in geselligem,<br />
feuchtfröhlichem Kreis. Das sie umrankende Pflanzenwerk hat<br />
seinen Ursprung links unten - in der Signierung Anton <strong>von</strong> Werners.<br />
In Wernerscher Manier sind dort <strong>von</strong> unten nach oben aufsteigend<br />
zwei Figuren eingebunden; einmal ein trommelnder Narr<br />
und über ihm aufsteigend die Allegorie des Frühlings, ein Knabe,<br />
der auf einem Tablett die Zeichen und Früchte des Frühlings<br />
hinaufreicht - wohl zu Pfarrer Schmezer, der in diesem Kreis<br />
der beste Maiwein-Brauer war und diese Ingredienzien gut gebrauchen<br />
konnte. Von diesem, verbunden durch die jeweils ausgestreckten<br />
Arme und das Weinglas, l e i t e t eine sitzende Figur<br />
zu <strong>Scheffel</strong> über. Diese Anordnungen beschreiben nicht schlecht<br />
die wichtigsten Aspekte der Scheffeischen Trinkpoesie in interpretationsrelevanter<br />
Reihenfolge. Auf Humor (Narr) und Frühlingsbegeisterung<br />
(Knabe) aufbauend vermittelt sich diese Poesie<br />
wenn nicht schon durch den Alkohol, so doch durch den dadurch<br />
erzeugten geselligen Kreis. Die Anordnung zeigt auch ungewollt,<br />
daß diese Art der Dichtung für <strong>Scheffel</strong> eine vermittelte sein<br />
muß (<strong>im</strong> Unterschied zum Erzähler des Jun Lpe/iut) ; sie i s t es<br />
auch historisch in ihrer Epigonalität. <strong>Scheffel</strong>s Figur a l l e i n<br />
t r i t t optisch aus dem geselligen Kreis heraus mit Ausnahme des<br />
Pfarrers, der aber durch die Bowle nach unten gebunden bleibt.<br />
<strong>Scheffel</strong> selbst wendet sich als einziger (wie der Unbekannte<br />
des Titelblatts!) durch Blick und Gestik an den Betrachter,<br />
bietet diesem aber die Untersicht an. Eine Handbewegung lädt in
181<br />
den Kreis ein oder s t e l l t ihn doch vor. Dabei s i t z t <strong>Scheffel</strong> auf<br />
der Mauer, wobei ihm einige Blätter aus der Hand auf die Seite<br />
des Betrachters fallen. Diese Uberwindung der optischen Distanzierung<br />
macht inhaltlich eines deutlich: <strong>Scheffel</strong> dichtet nicht<br />
mehr spontan, sondern er z i t i e r t Geschriebenes. Das Alter der<br />
Anwesenden und ihre rundlichen Figuren (vgl. <strong>Scheffel</strong> hier und<br />
auf dem Titelblatt!) dienen als Hinweis, wieweit die gesellige<br />
Situation der Jugendzeit nur noch gewaltsam geweckt, durch Aufgeschriebenes<br />
erinnert und durch Alkohol angestachelt werden<br />
muß. Aus der Studentenkneiperei i s t ein Altherrenstammtisch,<br />
aus der <strong>Scheffel</strong>muse, dem genial loci des Titelblattes, i s t als<br />
Inspiration die Waldmeisterbowle geworden!<br />
<strong>Scheffel</strong> hatte die Schwierigkeit, seine planlos zusammengekommenen<br />
studentischen Gelegenheitsgedichte systematisch zu ordnen,<br />
durch die Einteilung in fünf Abteilungen gelöst. Anton <strong>von</strong> Werner<br />
folgt dieser Einteilung, die an Systematische' Gliederungen<br />
zeitgenössischer Gedichtanthologien erinnert, mit seinen<br />
Vorsatzblättern für jede dieser Abteilungen. "Naturgeschichtl<br />
i c h " rankt Pflanzen und Fabeltiere als Schemen um die T i t e l <br />
schrift. In "Culturgeschichtlich" (Abb. 8) sammelt Werner die<br />
Bildungs- und Bildwerte der archäologischen 'Kulturgeschichte'.<br />
Ägyptische, assyrische und griechische Motivanklänge werden<br />
ornamental locker gebunden. Der malerische Eindruck, das St<strong>im</strong>mige<br />
der Motivformen täuschen jedoch über die Heterogenität der<br />
Einzelelemente nicht hinweg. Die Aussage der Blattes entspricht<br />
so in ihrer Allgemeinheit und Unverbindlichkeit genau dem Bildt<br />
i t e l .<br />
Freier und origineller arbeitet Werner bei den übrigen Abteilungen.<br />
Den Rodensteiner (Abb. 9) läßt er auf seinem Pferd<br />
lachend durch einen umrankten Reifen, der zugleich Rahmen i s t ,<br />
springen; das cholerische Temperament des Rodensteiners sprengt<br />
jeden Rahmen. Der T i t e l , gleichsam als Bauchbinde, umschließt<br />
als Spruchband den Kreis. Wieweit die reine Ornamentalisierung<br />
<strong>von</strong> Formen und Motiven allerdings führen kann, zeigt der darunter<br />
aufgehängte Davidstern mit Korkenzieher! Er wird funktionslos,<br />
rein ornamental gebraucht, nämlich als Pendant zur geschwungenen<br />
Peitschenschnur oben. Die vage 'altdeutsche' Verkleidung<br />
macht die Illustrierung endgültig zur angewandten
182<br />
Kostümkunde<br />
Werners.<br />
Die Illustrationen zu den naturwissenschaftlichen Gedichten sind<br />
als breit ausgeführte Initialen angelegt, die in einzelne B i l <br />
der auswuchern. Die Illustration zum Gedicht "Der Ichthyosaurus"<br />
(IV,10; Abb. 10) bildet auf den einzelnen Ästen eines<br />
Phantasiebaumes der Urzeit die Szenen ab, die in den Strophen<br />
jeweils beschrieben werden: etwa die beiden betrunkenen Saurier<br />
oder ganz unten ihre sich küssenden Artgenossen. Größer und nach<br />
rechts gerückt erscheint der Held des Gedichts, der sich über<br />
den Zeitverfall beklagende Ichthyosaurus. Die harmlos-komische<br />
Szenenreihung folgt der Scheffeischen Strophenfolge in genau<br />
stufigem<br />
Bildaufbau.<br />
<strong>Scheffel</strong>s Gedicht "Die Teutoburger Schlacht" <strong>von</strong> 1848 (IV,29)<br />
schildert den Kampf der Römer und Germanen als Raufhändel trunksüchtiger<br />
und urwüchsiger<br />
Gestalten:<br />
"Als die Waldschlacht war zu Ende,<br />
Rieb Fürst Hermann sich die Hände,<br />
Und um seinen Sieg zu weih'n,<br />
Lud er die Cherusker ein<br />
Zu 'nein großen Frühstück." (IV,31)<br />
Die letzte Strophe jedoch spricht schon 184-8 <strong>von</strong> dem damals<br />
aktuellen Plan, dem angeblichen Nationalhelden Arminius an der<br />
Stelle seines Triumpfes über die Römer ein Denkmal zu errichten.<br />
26<br />
<strong>Scheffel</strong>s Kommentar zu diesem Projekt weist zwar humoristisch,<br />
aber mit kritischem Blick auf die wahren Proportionen der Finanzierung<br />
hin:<br />
"Und zu Ehren der Geschichten<br />
Will ein Denkmal man errichten.<br />
Schon steht das Piedestal,<br />
Doch wer die Statue bezahl',<br />
Weiß nur Gott <strong>im</strong> H<strong>im</strong>mel." (IV,31)<br />
Anton <strong>von</strong> Werner benutzt diesen Denkmalsentwurf für eine der<br />
wenigen ganzseitigen Zeichnungen <strong>im</strong> QaudeamuA (Abb. 11). Das<br />
Denkmal i s t ja inzwischen (1875) fertiggestellt. Hermann in<br />
heroischer Siegerpose, hell vom Licht angestrahlt, wird <strong>von</strong><br />
schwarzen Vögeln (Adler?)umkreist. Hell sticht das Denkmal <strong>von</strong><br />
seiner dunklen Umgebung ab, aus der es hoch herausragt. Dräuende<br />
Wolken am Horizont wagen sich aber nicht bis zum Helden<br />
empor, auch der schwarze Vogel bleibt unter den Füßen des<br />
Standbilds. <strong>Scheffel</strong>s ironische Eingliederung der Gegenwart
183<br />
in einen quasi-historischen Bericht wird fast 30 Jahre später<br />
nicht bloß todernst genommen; er wird als repräsentative Form<br />
der geschichtlichen Deutung akzeptiert, seiner ironischen Distanzierung<br />
entkleidet und in die nationale Monumentalität erhoben<br />
.<br />
Ganz anders sind die Zeichnungen zu den fröhlichen Trink- und<br />
Wanderliedern, etwa zu dem berühmten "Wanderlied" (IV,35), aufgebaut<br />
(Abb. 12). Eine Gruppe <strong>von</strong> wandernden Scholaren i s t zur<br />
Einsiedelei gekommen. Derweil der Einsiedler rechts hinten mit<br />
einer Bäuerin schäkert, dringen die Wanderer in den ausschnittweise<br />
zu sehenden Weinkeller ein. Die Einsiedelei, <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong><br />
und Werner ihres religiösen Charakters entkleidet, wird zur<br />
idyllischen Sommerfrische. Der h l . Kilian, laut Wanderlied der<br />
Schirmherr der Winzer(!), hält die I n i t i a l e des Gedichts: Heiliger<br />
und Wein gehen zusammen.<br />
Das "Festlied zur Gründungsfeier der Universität Straßburg" <strong>von</strong><br />
1872 (IX,181) arbeitet mit dem Wortschatz und dem Bedeutungsinventar<br />
des neugegründeten Reiches. Das Gedicht i s t deshalb<br />
besonders interessant, weil seine Entstehung und die I l l u s t r a <br />
tion z e i t l i c h zusammenfallen. Die Gründung der deutschen Universität<br />
als politischer Akt <strong>im</strong> neueroberten Elsaß i s t für<br />
<strong>Scheffel</strong> der Anlaß zu einer heiteren Allegorese. Straßburg erscheint<br />
als Studentin, als "Der Hochschulen jungjüngste Schwester",<br />
die^ noch <strong>im</strong> ersten Semester steht. Nur knapp werden in<br />
der zweiten Strophe berühmte Straßburger als berühmte Deutsche<br />
erwähnt; schon bald geht <strong>Scheffel</strong> zum Elsässer Wein über, um<br />
be<strong>im</strong> Anstoßen und Trinken ausführlicher zu verweilen. Für ihn<br />
i s t die Gründungsfeier nur der Anlaß, einen Toast auszubringen.<br />
Aus Straßburg i s t "Neustraßburg" (IX,182) geworden, die Spuren<br />
nichtdeutscher Vergangenheit werden einfach weggetrunken:<br />
"Was sonst noch zu Argentoratum<br />
Einst Römer - und andre gemacht,<br />
Dem sei als entschwundenem Fatum<br />
Ein sühnend Glas Lethe gebracht!" (IX,181)<br />
Anton <strong>von</strong> Werner konstruiert anders (Abb. 13). Zwar verwendet<br />
er die <strong>im</strong> Gedicht genannten Figuren, erreicht aber a l l e i n durch<br />
die Anordnung einen anderen Eindruck. Zwei Personengruppen sind<br />
durch die Silhouette des Straßburger Münsters <strong>im</strong> Hintergrund<br />
und durch eine Lücke <strong>im</strong> Vordergrund getrennt, so daß beide zu-
184<br />
einander ausgerichtet sind. Links s i t z t Vater Rhein, auf einem<br />
Weinfaß lehnend und den anstürmenden Studenten und dem Münster<br />
mit dem Weinpokal zuprostend; neben ihm Erwin <strong>von</strong> Steinbach,<br />
auf den Grundriß seines Münsters gestützt und mit der anderen<br />
Hand auf dieses zeigend; schräg hinter ihm Gutenberg, mit der<br />
einen Hand auf seine Druckerpresse gestützt, mit der anderen<br />
<strong>im</strong> Bart sinnend auf die Studenten schauend; dahinter und darüber<br />
schließlich Tristan (stellvertretend für Gottfried <strong>von</strong> Straßburg)<br />
in weitem, gebauschtem Mantel, den Arm deutend auf die<br />
Studenten hin ausgestreckt. Von rechts stürmen unterdessen Studenten<br />
mit gezogenem Degen, altdeutschem Trinkhorn und der<br />
Reichsfahne begeistert auf diese Figuren zu. Wie hier studentisches<br />
und zugleich bürgerliches Bildungsgut mit der neuen<br />
Reichsidee verwoben sind, i s t deutlich. Reichsfahne mit Adler,<br />
der Reichsadler auf dem Wappen links unter der I n i t i a l e , die<br />
gezogenen<br />
Degen und der Hurra-Patriotismus der Herbeistürmenden<br />
signalisieren die aggressiv-nationale Tendenz. Zugleich aber<br />
wird der Umgang mit den abgebildeten Bildungsgütern, die mit<br />
dem Universitätsgedanken verbunden sind, augenfällig. In <strong>Scheffel</strong>s<br />
Gedicht kommen sie als sinnlos-stoffhubernde historische<br />
Details vor ('Geschichte' Straßburgs!). In Werners Illustration<br />
liegen Bücher und Schriften wirr durcheinander am Boden, eins<br />
da<strong>von</strong> i s t stellvertretend gekennzeichnet als SImpHzLAA<strong>im</strong>ut,<br />
wohl ein Hinweis auf die Deutschheit Gr<strong>im</strong>melshausens. Das B i l <br />
dungsgut liegt unbeachtet da, wichtiger i s t den Studenten das<br />
Trinkhorn und der Ritt auf dem Weinfaß oder das Schwenken des<br />
Reichsadlers. Der Student rechts mit B r i l l e , in Portaitähnlichkeit<br />
mit dem jungen <strong>Scheffel</strong>, reitet auf einem Krokodil, das<br />
vermutlich sinnbildlich für den Münchner Dichterkreis Da* K/io-<br />
27<br />
kodil steht , und ein bezeichnendes Licht auf den literarischen<br />
Geschmack der abgebildeten Studenten wirft.<br />
Eine andere Einstellung zeigt die Illustration Werners zum<br />
Festlied auf Hebels 100. Geburtstag (IV,101; Abb. U). Hier<br />
hängt sich <strong>Scheffel</strong> an den Ruhm seines Vorbilds an, indem er<br />
ihn bedichtet. <strong>Scheffel</strong> berichtet in alemannischer Mundart <strong>von</strong><br />
einem Besuch <strong>im</strong> H<strong>im</strong>mel, wo ihn Hebel beauftragt habe, seine Anhänger<br />
auf Erden zu grüßen. Dadurch s t i l i s i e r t sich <strong>Scheffel</strong><br />
zum Stellvertreter und Wortführer Hebels auf Erden. Werners<br />
Schlußillustration zu diesem Gedicht und zum ganzen Qaade.ama/>(\)
185<br />
hatte <strong>Scheffel</strong> selber vorgeschlagen:<br />
"der Hebel i s t notwendig, wegen der großen, sonst leerstehenden<br />
Textmasse, - wie Sie das Motiv fassen wollen, i s t<br />
natürlich Sache des malerischen Gefühls und wenn Ihnen die<br />
Luftfahrt des Mannes in der Joppe/*=<strong>Scheffel</strong>\J mit 2 Engeln<br />
behagt, so könnte dies als Schlußsituation Gedicht und Buch<br />
komisch abschließen" (28).<br />
Gemeint i s t die Szene, in der die Engel <strong>Scheffel</strong> auf die Erde<br />
zurückbringen:<br />
"Gli druf hen d f Engel mi am Chrage gno,<br />
Und chlip und chlap! se bini wo 'ni g'si b i . " (IV,109)<br />
Wie sieht es aber bei Werner aus? Zum Hochruf auf Hebel zeichnet<br />
er gerade umgekehrt, wie die Engel an <strong>Scheffel</strong> ziehen und<br />
zerren, als wollten sie ihn in die Höhe heben. Ein ungewollter<br />
Lapsus? Denn es sieht doch so aus, als handle es sich hier,<br />
humoristisch und stellvertretend natürlich, um die H<strong>im</strong>melfahrt<br />
des Dichters <strong>Scheffel</strong> noch zu Lebzeiten.<br />
Den 7 nompeten <strong>von</strong> Säkkingen<br />
Die i l l u s t r i e r t e Prachtausgabe des 7 nompeten i s t anscheinend<br />
zur rechten Zeit auf den Markt gebracht worden. Werner arbeitete<br />
seit 1873 an den Zeichnungen der erstmals 1853 erschienenen<br />
Dichtung, und <strong>Scheffel</strong> forderte schon Ostern 1869: "Es i s t<br />
Zeit, daß die i l l u s t r i r t e Ausgabe kommt, da schon die 9. gewöhn-<br />
29<br />
liehe ausgegeben wird" . Kurz nach dem Weihnachtsgeschäft kann<br />
<strong>Scheffel</strong> Werner dann 1874 melden: "Der i l l u s t r i r t e Trompeter<br />
30<br />
i s t überall ein gern gesehenes Prachtgeschenk" .<br />
Die zweite Auflage der Quartausgabe <strong>von</strong> 1879 i s t in rotes Preßleinen<br />
gebunden, mit goldenen Ornamenten verziert und natürlich<br />
mit Goldschnitt versehen. Kleinere Bilder und Vignetten sind <strong>im</strong><br />
Text mit Rahmenornamenten verziert, die seitengroßen Bilder<br />
sind jeweils mit einem Schutzblatt ausgestattet. Dieser Kunstanspruch<br />
dokumentiert sich auch darin, daß sich die Kleinbilder<br />
und<br />
Vignetten als Federzeichnungen, die Großbilder als separate<br />
graphische Kunstleistungen mit dem Anspruch <strong>von</strong> Radierungen<br />
präsentieren. Auch darin liegt eine Wertung, welche Szenen<br />
einer solchen großflächigen und 1 künstlerischen' Illustration<br />
für würdig gefunden werden.<br />
Das zweifarbige Titelblatt in rot und schwarz (Abb. 15) hat
186<br />
Portalfunktion. Es läßt keinen freien Zugang zur Geschichte,<br />
sondern behindert ihn, indem es ihn interpretiert. Nur mit diesem<br />
Beiwerk i s t der rechte Weg zum rechten Verständnis des<br />
Textes zu erlangen. Das Bild Säckingens, des Ortes der Handlung,<br />
seine Landschaft und Umgebung sind nur durch diesen Rahmen,<br />
nur durch seine Interpretation, teilweise sogar verdeckt,<br />
auf jeden F a l l weit <strong>im</strong> Hintergrund und ziemlich klein und nur<br />
skizzenhaft zu sehen. Der Hauptgegenstand wird in den Raum zurückgeschoben<br />
und kann nur <strong>von</strong> weitem unverbindlich (Postkarte!)<br />
betrachtet werden. Die Nebensache, das Beiwerk wird zur Hauptsache.<br />
Der Portaldurchgang wird deshalb fast ganz <strong>von</strong> den<br />
Spruchbändern mit der textlichen Information verstellt. Auch<br />
hier wieder waltet Werners Tendenz der ornamentalen Verschiebung<br />
der Schwergewichte. In der Größe der Schrifttypen und <strong>von</strong><br />
seiner Position überragt die Ortsbezeichnung "Säkkingen" die<br />
eigentliche Hauptgestalt des Trompeters. Außerdem hat der I l l u <br />
strator Werner durch die ornamentale Verteilung der Schriftzüge<br />
den Dichter in den Hintergrund, zumindest in die Ecke gedrängt<br />
("Ein Sang vom Oberrhein i l l u s t r i r t <strong>von</strong> A.v.Werner"!).<br />
Die an den Spruchbändern befestigten Gegenstände, Jung-Werners<br />
Trompete und die beiden Wappen (<strong>von</strong> Säckingen und vom Freiherrn)<br />
kehren leitmotivisch in vielen Zeichnungen wieder. Sie decken<br />
nicht nur die 'reale 1 Information, die Ansicht Säckingens, möglichst<br />
zu, sondern verweisen auf einen besseren, nämlich symbolisch-ikonographischen<br />
Zugang zum Text. In diesem Sinn i s t<br />
das ornamentalarchitektonische Br<strong>im</strong>borium des Bildes durchaus<br />
als Aussage mit spezifischer Funktion zu werten. Das Portal,<br />
mit ihm sein Inhalt und Gegenstand, gerinnt zur Würdeform, zur<br />
festlichen Inszenierung, deren direkter Zutritt dem Betrachter<br />
vorerst noch - bis zum Umblättern - verbaut i s t . Der Zuschauer<br />
wird Interpret, wenn er sich die Geschichte durch die Betrachtung<br />
des Rahmens deutet. Dazu trägt auch das Katermotiv bei,<br />
das auf den Kater Hiddigeigei als humoristische Figur verweist,<br />
hier aber in klassischer Würdeform gebraucht wird. Es findet<br />
sich wieder in den Statuen auf dem Fries auf den auslaufenden<br />
Blendsäulen, fast unkenntlich auf den Kapitellen dieser Säulen<br />
und dann nochmals als Katzenkopfmedaillon auf den unteren Säulenschäften.<br />
Gleichzeitig s t e l l t Werner damit die Katerepisoden
187<br />
<strong>im</strong> Versepos wie in seiner bildnerischen Darstellung an den Rand<br />
und betrachtet sie als Rahmenfigur der Haupthandlung.<br />
Der Sprenggiebel mit der ornamental ausgefüllten Kartusche s t e l l t<br />
die Würdeformen aus Neorenaissance und -barock als Leerformeln<br />
vor, genau wie das nur schmückende Relieffries und die Kandelaberarchitektur<br />
der Portalpfeiler. In solcher Scheinarchitektur<br />
werden die divergentesten Bauformen unhistorisch, aber 'organisch'<br />
ineinander verschlungen. Bedeutung erhalten sie durch<br />
Montage <strong>von</strong> Zusammenhängen, etwa die Anspielung auf Rokokoformen,<br />
die 'galante' Signale für die Liebesthematik des Versepos<br />
aussenden. Nicht zufällig blickt der Betrachter <strong>von</strong> unten auf<br />
das Portal, aber durch dieses <strong>von</strong> oben auf Säckingen: die harmlose<br />
Geschichte <strong>Scheffel</strong>s läßt sich leicht überschauen, ihre<br />
künstlerische, d. h. symbolische Deutung gelingt erst in der<br />
Umsetzung in säkularisierte Würdeformen. Nicht umsonst dominieren<br />
Bauformen und Architekturmotive solch repräsentativer Provenienz<br />
.<br />
Als Würdeform um die harmlose Erzählhandlung des 7/iompe.£e./i fungieren<br />
auch die übrigen Großbilder der Prachtausgabe. Das erste<br />
Bild zeigt Jung-Werner <strong>im</strong> verschneiten Wald auf seiner Trompete<br />
blasend (Abb. 16), scheinbar nur mit sich selbst und seiner<br />
Kunst beschäftigt, so wie er ja auch die Mitte des Blattes einn<strong>im</strong>mt.<br />
Der aus dem Hintergrund herantretende Pfarrherr führt<br />
mit seiner Person den erzählerischen Faden der Geschichte fort.<br />
Er weist auf die folgende Episode hin und verknüpft so Bild und<br />
Geschehen strukturell nach vorn. Hier wie in allen Freiluft-<br />
Bildern scheint die ornamentale Rahmenstruktur aufgegeben, doch<br />
i s t sie nachgeholt <strong>im</strong> Naturarrangement und gleichsam unmerklich<br />
dem Bild unterschoben. Werner steht nämlich dergestalt zwischen<br />
den Bäumen, daß der Raum um ihn herum frei i s t , rechts und links<br />
die Stämme ihn rahmen und die Baumkronen sich über ihm wölben.<br />
Das Naturportal übern<strong>im</strong>mt hier die Funktion des Architekturportals.<br />
Auch jetzt i s t die technisch geschickte Tiefenwirkung<br />
des Bildes zu beachten. Sowohl die Kronen der Bäume und die in<br />
den Hintergrund gestaffelten Stämme verweisen wie auch der den<br />
Fortgang der Geschichte best<strong>im</strong>mende Pfarrherr auf Tiefen des nur<br />
scheinbar vordergründigen Geschehens. Mag das Versepos auch<br />
flach sein, durch Werners Illustrationen wird es künstlerisch
188<br />
und erzählerisch vertieft.<br />
Das nächste Bild, Jung-Werner be<strong>im</strong> Pfarrherrn (Abb. 17), i s t <strong>im</strong><br />
Aufbau dem vorhergehenden sehr ähnlich. Die InterieurZeichnung<br />
löst die Schwierigkeit, eine Erzählsituation innerhalb des erzählten<br />
Geschehens abzubilden. Die dargestellte Szene reduziert<br />
das Bild auf Erzähler und Zuhörer. Interessant i s t , da-ß 'die<br />
Nebenepisoden, etwa die Eskapaden des Katers Hiddigeigei, die<br />
Geschichte des Zwerges Perkeo vor dem Faß oder das Erlebnis mit<br />
dem s t i l l e n Mann in der Erdmännleinhöhle nicht mit Großbildern<br />
bedacht werden. Diese zeichnerische Bewertung entspricht dem<br />
7/iompe.te./i <strong>Scheffel</strong>s, dem die Einschübe und Episoden ja ebenfalls<br />
als Füllsel gelten, vergleichbar dem "Büchlein der Lieder". Sie<br />
sind wichtig für die Erzählstruktur des Epos und als Motivation<br />
für das Verhalten Jung-Werners: seine Reise-, Wander- und Trinklust<br />
durch "Alt Heidelberg du feine" und Perkeo, seine Resignation<br />
und Melancholie durch den s t i l l e n Mann, Erzählerdistanzierung<br />
und -ironie durch den Kater Hiddigeigei. Für den Verlauf<br />
der Liebesgeschichte als Bildergeschichte haben sie keinen<br />
Funktionswert. Insofern hat das an sich inhaltsleere Bild be<strong>im</strong><br />
Pfarrherrn strukturelle Funktion zur Verknüpfung dieser nebensächlichen<br />
Episoden; gleichzeitig verweist es wie das vorige<br />
Bild schon weiter auf die nächste Illustration: das Mädchen<br />
links <strong>im</strong> Hintergrund i s t Signal wie der Pfarrherr <strong>im</strong> ersten<br />
Bild.<br />
Es erstaunt nicht, wenn das nächste Bild, das erste Zusammentreffen<br />
Jung-Werners mit Margareta (Abb. 18), die beiden Protagonisten<br />
wiederum einrahmt. Nicht <strong>von</strong> ungefähr bilden die Gebäude<br />
rechts und links sowie <strong>im</strong> Hintergrund (darüber!) eine Art<br />
architektonischen Rahmen, der sich um einen menschlichen fügt;<br />
beide Figuren sind <strong>von</strong> anderen eingerahmt, der Platz des Baldachins<br />
hinter und zwischen ihnen i s t nicht zufällig. Auch hier<br />
fällt wieder die Verweisfunktion des Bildes auf, die Möglichkeit,<br />
erzählerische Kontinuität in die Reihung <strong>von</strong> Szenen durch<br />
Vorausweisungen in das Bild einzubringen (Festzug). Der Umzug<br />
erhält so verbindende Funktion zwischen den beiden statischen<br />
Bildern vorher und nachher, die sich auch kompositionell entsprechen<br />
(Anordnung der Figuren, Lichteinfall): hier erzählt<br />
der Freiherr <strong>im</strong> Lehnstuhl und Margareta hört zu, dort erzählt
189<br />
Werner, der Pfarrherr <strong>im</strong> Lehnstuhl hört zu (Armhaltung der beiden<br />
<strong>im</strong> Lehnstuhl!).<br />
Das folgende Bild, die Vorstellung Werners be<strong>im</strong> Freiherrn, i s t<br />
gleichsam die Zusammenziehung der beiden vorigen Bilder in ikonographischer<br />
Hinsicht (Abb. 19). Dabei i s t ausgelassen, d. h.<br />
nur in Kleinzeichnungen und Vignetten eingegangen, daß Werner<br />
durch sein nächtliches Trompetenkunststück vor dem Schloß für<br />
Aufmerksamkeit gesorgt hat. Diese romantische St<strong>im</strong>mung i s t nun<br />
nicht, wie es ein Leichtes gewesen wäre, großformatig ausgeschlachtet;<br />
<strong>im</strong> Gegenteil i s t bewußt auf romantische St<strong>im</strong>mung<br />
verzichtet worden - ja wo sie auftaucht, wird sie zugunsten der<br />
würdevollen Liebesgeschichte unterdrückt. Bei diesem Bild i s t<br />
die Konstellation der beiden vorigen modifiziert wieder aufgenommen.<br />
Werner und Margareta stehen sich gegenüber, diesmal aber<br />
in.Beziehung aufeinander (Blickkontakt, Weinanbieten). Gleiches<br />
g i l t für den Freiherrn und seine Tochter (diese diesmal stehend,<br />
helle Beleuchtung). Auch hier i s t die Rahmenfunktion wieder<br />
deutlich erkennbar: Werner a l l e i n i s t eingerahmt vom Kamin, über<br />
dessen Rahmung er aber mit Kopf und Arm hinauswächst; um alle<br />
drei Figuren i s t ein weiterer Rahmen gespannt. Er reicht <strong>von</strong> der<br />
linken Kaminsäule und dem davor stehenden kandelaberartigen<br />
Ständer zur Pfeilerarchitektur am Möbel rechts hinter dem Freiherrn;<br />
überwölbt wird dies nicht nur durch die Decke, sondern<br />
zusätzlich durch das herabhängende Hirschgeweih (das keine andere<br />
Funktion hat: kein Leuchter, da Kerzen fehlen!)<br />
Das vorausdeutende Motiv i s t auch hier schnell gefunden. Es i s t<br />
das Weinglas, das Margareta anbietet bzw. das der Freiherr in<br />
der Hand hält. Auch <strong>im</strong> folgenden Bild, der Aufführung des Mailieds<br />
(Abb. 20), hält der Freiherr ein Weinglas in der Hand,<br />
während Margareta der Klosterschwester gerade eines anbietet.<br />
Die hier beschriebene Frühlings Situation i s t nach zwei Seiten<br />
hin beziehungsreich. Zum einen holt sie das Anfangsbild, Werners<br />
Trompetenspiel <strong>im</strong> verschneiten Wald, herein und korrigiert<br />
es <strong>im</strong> Sinne der fortgegangenen Handlung. Zum anderen verweist<br />
sie kompositionell und inhaltlich auf die folgende Illustration,<br />
die Aufführung des Festkonzerts (Abb. 21). Beide Bilder beschreiben<br />
eine festliche Situation, beide die Artikulierung <strong>von</strong><br />
Kunst, hier in freier Natur, in ungezwungener Haltung und zwangloser,<br />
auch ständisch freier Umgebung (vgl. anwesende Personen!);
190<br />
dort das feierlich-steife höfische Festkonzert in festlichem<br />
Rahmen (Pavillon) mit geladenen, sozial gefilterten Gästen; hier<br />
zwei Aufführende und viele Zuhörer, dort viele Aufführende und<br />
wenige Zuhörer.<br />
Beide Bilder lassen zugleich auch die Kunstauffassung Werners<br />
und <strong>Scheffel</strong>s durchscheinen. In beiden Bildern i s t der eigentliche<br />
Held, Jung-Werner, der wahre Künstler, in den Hintergrund<br />
gedrängt. In beiden Fällen drängen sich, humoristisch betrachtet<br />
und satirisch gezeichnet, Wichtigtuer und lächerliche Dilettanten<br />
vor: einmal der Lehrer, der sein Mailied in Heldentenorpose vorträgt,<br />
während Werner sich bescheiden <strong>im</strong> Hintergrund (=am rechten<br />
Rand) hält; zum zweiten der geniale Monumentalkünstler Fludribus,<br />
der sich komischerweise an den Pauken produziert. Dennoch<br />
dirigiert der richtige Künstler, Jung-Werner, in beiden Fällen.<br />
Zusätzlich sind beide Wichtigtuer in ironisch gemeinte Rahmen<br />
gefaßt: der sich produzierende Lehrer auf dem Steinsockel (Denkmal!)<br />
zwischen dünnen Stämmchen, Fludribus umrahmt <strong>von</strong> der k l e i <br />
nen Kaminarchtektur des Pavillons unter dem Wappen des Freiherrn<br />
(vgl. Kamin um Werner <strong>im</strong> vorigen Bild). Diese Rahmenformen als<br />
Xürdeformen wollen zu solchen Inhalten nicht recht passen. Dadurch<br />
interpretieren sie sich selbst und die dahinter stehende<br />
Kunstauffassung, wobei nur die zweite der Intention <strong>Scheffel</strong>s<br />
entspricht: die Mailied-Aufführung i s t bei <strong>Scheffel</strong> durchaus unkomisch<br />
gemeint.<br />
Bei Fludribus, der ja auch noch der eklektische Maler der a l l e <br />
gorischen Fresken des Pavillons i s t , setzt die Kritik Anton <strong>von</strong><br />
Werners als Maler an. Er verurteilt den Totalitätsanspruch des<br />
Künstlers Fludribus, der sein Malzeug zum Konzert mitgebracht<br />
hat. Seine sinnleere, aber pompöse Musik (Pauke) wirft ein bezeichnendes<br />
Licht auf seine heroisch-antikisierenden Fresken.<br />
Beides relativiert sich gegenseitig. Demgegenüber steht der bescheidene,<br />
ohne repräsentative Ansprüche auftretende Jung-Werner,<br />
der wahre Künstler, dessen Leistung für sich selber spricht und<br />
der doch die Fäden in der Hand hat (als Komponist und Dirigent<br />
beider Konzerte). Beide Wichtigtuer sind nur Dilettanten, denen<br />
es nicht um die Kunst, sondern um SelbstdarStellung geht. Dabei<br />
integriert sich der Lehrer, weil er seinen Beitrag als eingebundene<br />
Gesellschaftsunterhaltung versteht und ja auch nicht mehr
191<br />
w i l l als die Anerkennung dieser Gruppe. Fludribus setzt sich absolut<br />
durch den Verlust <strong>von</strong> Gesellschaft und durch den Totalitätsanspruch<br />
seiner Kunst und seiner selbst als Künstler.<br />
Das Trompetenmotiv in beiden Bildern gibt auch den Anknüpfungspunkt<br />
zur folgenden Abbildung (Abb. 22). Sie s t e l l t eine Szene<br />
dar, in der Jung-Werner Margareta mit seiner in der Laube l i e <br />
gengelassenen Trompete überrascht. Auffällig a l l e i n schon <strong>von</strong><br />
ihrer Größe i s t hier die Rahmenarchitektur. Die schweren Würdeformen<br />
wie Portalbogen, Kartusche mit Wappen, Sockel und Blendpfeilerarrangement<br />
werden nur durch die niederhängenden Pflanzengirlanden<br />
und die lebhaften Puttenpaare (Liebesmotiv Amor!)<br />
i d y l l i s i e r t und 'erleichtert'. Hier wird die Rahmenform selbst<br />
zum Liebesmotiv. Gleiches g i l t auch für den Kater (<strong>im</strong> Bild<br />
rechts vorn und als Reittier für die Putten vor den Blendpfeilern),<br />
der zusätzlich als Erzählerhinweis die Funktion poetischer,<br />
<strong>im</strong> idyllischen Epos humoristischer Distanz übern<strong>im</strong>mt.<br />
Uber das Katzenmotiv mit seiner doppelten Funktion läßt sich<br />
auch die Portalmotivik genauer best<strong>im</strong>men. Durch das Portal i s t<br />
dem Betrachter ein Blick in die dunkel gehaltene Laube (vgl.<br />
Architektur hell!) gewährt, in der Margereta (hell!) die Mitte<br />
einn<strong>im</strong>mt. Das an sich unbedeutende Trompetenblasen wird erst<br />
wichtig durch das Hinzukommen Werners. Dieser aber steht erst<br />
noch <strong>im</strong> Hintergrund außerhalb der Laube. Der Blick des Betrachters<br />
auf den erstaunten Helden i s t also ein zweifach vermittelter:<br />
einmal durch die Würde voraussetzende und gleichzeitig distanzierende<br />
Portalrahmung, zum anderen durch das Portal des<br />
Laubeneingangs. Das Trompetenblasen wird so zum zentralen Liebessinnbild;<br />
diese Trompete taucht als Vignette zum Kapitelende<br />
nochmals auf, wo sie <strong>von</strong> Englein getragen wird (Putten des Portalrahmens!)<br />
und einen humoristisch-'sakralen' Schlußpunkt<br />
setzt.<br />
Das 10. Stück des 7'/iompete./i, Jung-Werners Besuch be<strong>im</strong> s t i l l e n<br />
Mann in der Erdmännleinhöhle, wird vom Illustrator nicht durch<br />
ein großformatiges Bild gewürdigt. Als Nebenepisode wird es ins<br />
Vignettenhafte und Ornamentale herabgedrückt. Anton <strong>von</strong> Werner<br />
i d y l l i s i e r t die Zwergengestalten ins Kleinformatige, ohne die<br />
pathologischen Parallelen zwischen <strong>Scheffel</strong>, Jung-Werner und dem<br />
s t i l l e n Mann (Rückzugstendenz, Verstummen, Unverständnis der
192<br />
Welt) zu kennzeichnen, wie es der Text tut.<br />
Ausführlich hingegen wird in den beiden nächsten Bildern der Beginn<br />
des Volksaufstandes geschildert, wobei die zeitgeschichtlich-politische<br />
Realität nur dekorativ ins Geschehen einfließt.<br />
Das Bild <strong>von</strong> der Volksverhetzung (Abb. 23) kontrastiert zur<br />
Mailied-Aufführung und verzichtet dabei auf jede politische<br />
Stellungnahme, wie sie naheliegen könnte. Waren dort alle Stände<br />
zu friedlich-idyllischem Zweck zusammengekommen, so zeigt hier<br />
schon der Ausdruck der Gesichter und die Geräte (statt Weingläser<br />
und Musikinstrumenten) die gegenteiligen Absichten an.<br />
Der Anführer steht hervorgehoben auf einem Baumstumpf (vgl.<br />
Lehrer auf Steinsockel!), er deutet mit fast der gleichen Bewegung<br />
wie der Mailiedsänger, allerdings nicht wie dieser ziellos<br />
in die Luft, sondern konkret aufs Schloß.<br />
Auf dem Höhepunkt der äußeren Handlung i s t die Figur des Katers<br />
Hiddigeigei eingeschoben, allerdings nicht als Liebesmotiv,<br />
sondern als Zeichen der Allwissenheit und des episch-poetischen<br />
Überblicks. Aus seiner Höhenstellung warnt der Kater wie die<br />
Gänse des römischen Kapitols die Verteidiger des Schlosses vor<br />
dem Überfall. Die historisch belegte Szene wird damit bewußt<br />
humoristisch gebrochen und verhindert das Abkippen des komischen<br />
Epos in die ernste Erzählung. So i s t die Schlacht ja auch nur<br />
deshalb eingeführt, damit sich Jung-Werner in ihr bewähren kann<br />
und verwundet wird, so daß Margareta wiederum ihn pflegen kann.<br />
Das dazu gehörige Bild zeigt Margareta am Bett des verwundeten<br />
Geliebten (Abb. 24-). Wieder i s t der Zugang für den Betrachter<br />
und für Margareta zweifach vermittelt: einmal durch den diesmal<br />
malerisch gehaltenen Ornamentalrahmen, der nur in der Kartusche<br />
mit Wappen architektonische Formen ann<strong>im</strong>mt, andererseits<br />
durch Werners abgeschlossenes, durch die Vorhänge Portalfunktion<br />
annehmendes Bett. Margareta schiebt den Vorhang zur Seite, ein<br />
Motiv, daß <strong>im</strong> folgenden Bild die Figuren des architektonischen<br />
Rahmens übernehmen. Margareta i s t also gleichsam zu einer zweiten<br />
Rahmenfigur geworden. Zentrum des Bildes und des Betrachterinteresses<br />
i s t Werner, aber nur in Beziehung zu Margareta, seinem<br />
'Rahmen'. Mit der vorigen Illustration i s t das Bild zweifach<br />
verknüpft: einmal in der Umkehrung <strong>von</strong> Rahmen und Bildzentrum<br />
(Margareta mit der Trompete in der Laube!), zum anderen durch
193<br />
den Vorgang des interessierten Schauens, auch hier wieder in<br />
seiner Umkehrung. Dort i s t Margareta in sich versunken, hier i s t<br />
es Jung-Werner.<br />
Durch den zurückgeschobenen Bettvorhang wird wiederum auf das<br />
folgende Bild vorausgedeutet (Abb. 25). Die Darstellung der<br />
Liebe, das Zeigen der Zuneigung, spiegelt sich deutlich in der<br />
Rahmenarchitektur. Für die Szene zwischen Jung-Werner und Margareta<br />
in der Laube waren würdevolle, aber doch einfache Renaiscanceformen,<br />
für die ruhige Abbildung des schlafenden Werner<br />
sogar nur malerische Schmuckformen verwendet worden. Hier jedoch<br />
greift Anton <strong>von</strong> Werner auf das gesamte verfügbare Inventar<br />
barocker Würde- und Prachtformen zurück, etwa in den beiden faunartigen<br />
Pfeilergestalten oder dem gesprengten Segmentgiebel als<br />
Portalabschluß. Auch die Portalform i s t durch einen dreistufigen<br />
Zugang zum Bildgeschehen nochmals gesteigert.<br />
Die <strong>im</strong> Grunde einfache und harmlose Szene des sich küssenden<br />
Paares wird durch solche Prachtformen ins Würdige s t i l s i e r t ,<br />
ja beinahe sakralisiert. Der (<strong>im</strong> Bild gar nicht dargestellten)<br />
Leidenschaft der Liebe entspricht die Bewegung der traditionell<br />
unbeweglichen Pfeilerfiguren, der bewegten Bauformen (Sprenggiebel)<br />
und der turnenden Engel. Der drappierte Vorhang interpretiert<br />
sich aus dem Verweisungsmotiv des vorigen Blattes. Nicht<br />
etwa aus Prüderie sollen die Liebenden dem Blick verborgen werden.<br />
Vielmehr deuten ziehende Engel und schmunzelnde Faune<br />
darauf hin, daß der Blick f r e i gemacht werden s o l l für den Betrachter.<br />
Hiddigeigei als allwissender Erzählerfreund und Mitakteur<br />
hat hier Vorreiterfunktion für den Betrachter; er schaut<br />
schon gespannt auf die Szene.<br />
Er, die Engel und der scheinbar funktionslos daliegende Hut<br />
Jung-Werners verweisen wiederum auf das folgende Bild, die Werbung<br />
um Margareta (Abb. 26). Dort s i t z t der Kater <strong>im</strong> Hintergrund<br />
auf der Bank, Werner hält ostentativ seinen Hut in der<br />
Hand. Die Hutverweisung deutet strukturell das Bild vor, das<br />
trotz dieses Hinweises auf Höflichkeit oder Förmlichkeit nochmals<br />
durch einen Untertitel verdeutlicht werden muß. Die Szene<br />
bezieht sich außerdem auf Werners erste Vorstellung be<strong>im</strong> Freiherrn<br />
zurück. So wie Werner damals sich selbst angeboten hatte,<br />
so w i l l er jetzt etwas vom Freiherrn. Beide Figuren haben noch
194<br />
<strong>im</strong>mer dieselbe Haltung (Standpunkt), doch ihre Umgebung hat sich<br />
'umgekehrt 1 : der Ofen steht rechts statt links, der Schrank<br />
links statt rechts, das Licht fällt <strong>von</strong> links statt <strong>von</strong> rechts<br />
(Werner dunkel, Freiherr hell statt umgekehrt; Kater hinten statt<br />
vorne) .<br />
Die Titelbilder zum "Büchlein der Lieder", die hier eingeschoben<br />
sind, passen die tragenden Motive an die lyrische Form an. Während<br />
für dramatische und epische Szenen und Erzählhandlungen<br />
Portale und Torrahmenformen reserviert bleiben, werden die l y r i <br />
schen Einlagen innerhalb des Satzspiegels mit ornamentierten<br />
Bilderrahmen <strong>im</strong> Wortsinn umgeben (Abb. 27). Das Gedicht wird so<br />
zum Gedenkspruch, zum Poesiealbumvers, wird Ornament unter Ornamenten,<br />
die Information der Schrift gerinnt fast zur Schriftform<br />
als Schmuck des Rahmens. Die Abbildung zu Hiddigeigeis Katerliedern<br />
t r i v i a l i s i e r t (noch mehr) <strong>Scheffel</strong>s distanzierende<br />
Poeten- und Parodiefigur zur gitarrespielenden, vermenschlichten<br />
Katze. Die Selbstparodie des Dichters, die Zeitkritik als<br />
Poesiekritik, geht dabei verloren. Gleiches g i l t auch für die<br />
Figur des s t i l l e n Mannes, der zwischen Schneewittchenzwergen<br />
i d y l l i s i e r t angesiedelt wird (Abb. 28). Die schon oben angedeutete<br />
pathologische Tendenz wird zugunsten des märchenhaften und<br />
harmlosen Gesamteindrucks unterschlagen.<br />
Das letzte der großformatigen Bilder, Jung-Werner und Margareta<br />
be<strong>im</strong> Papst -(Abb. 29)> z i e l t auf Repräsentation des festlichen<br />
und würdevollen Schlusses. Die glückliche Lösung durch das Eingreifen<br />
des Papstes n<strong>im</strong>mt die an sich unwichtige private Liebesgeschichte<br />
in die politische Weltlage hinein; der Papst kümmert<br />
sich persönlich um die Liebenden. Die Würdeform der Renaissance,<br />
eine Art figu/ia pyiamidalz der Akteure, hebt die Szene als<br />
Schlußbild auf eine versöhnliche Ebene. Der Papst handelt als<br />
Mensch und Ehestifter, religiöse Tendenzen werden ganz bewußt<br />
vermieden.<br />
Dagegen fehlt es nicht an antiklerikalen Spitzen, so der fette<br />
schäkernde Prälat und die hexenhafte Nonne <strong>im</strong> Mittelgrund. Die<br />
traditionsreiche Dreieckszene bedarf keines Rahmens mehr, sie<br />
i s t hoheits- und würdevoll genug. Zugleich bleibt sie reduziert<br />
auf die Stiftung eines Ehe- und Liebesverhältnisses; die eigentliche<br />
Schwierigkeit, der Standesunterschied zwischen Jung-Werner
195<br />
und Margareta, wird so nebenher gelöst.<br />
Der Illustrator Anton <strong>von</strong> Werner indes verweist ganz bewußt<br />
darauf: das wohlbekannte Trompetenmotiv als Schlußvignette i s t<br />
<strong>von</strong> sinnbildlicher Qualität (Abb. 30). Die Trompete Jung-Werners<br />
steht nicht mehr f r e i <strong>im</strong> Raum; das Attribut des nun adeligen<br />
Musikanten wird nicht nur reich geschmückt durch die Fahne, sondern<br />
auch fest aufgehängt. Diese Bildtatsache kann nun zwei Bedeutungen<br />
haben: einmal wird die Trompete nicht mehr benutzt,<br />
sie hat ja, wie zu lesen, ihren Zweck, eine adelige Frau zu erringen,<br />
erfüllt; zum anderen i s t sie jetzt als Wandschmuck eingebunden<br />
in ein fest installiertes Ornament-Ensemble an der<br />
Wand. Sie i s t Teil eines Schmuckrahmens, nicht mehr <strong>von</strong> dieser<br />
Ornamentalbasis zu lösen. Vielleicht ungewollt spiegeln sich in<br />
dieser Schlußvignette auch <strong>Dichterberuf</strong> und Illustratorintention.<br />
Das Werk als solches wird gebunden an seine Verpackung; erst mit<br />
dieser i s t es adäquat rezipierbar. Das an sich sekundäre Element<br />
der Illustration hat sich auf eine gleichrangige Ebene mit dem<br />
eigentlichen Werk gehoben.<br />
Das Nachblatt (Abb. 31) interpretiert noch deutlicher, da es<br />
völlig unabhängig vom Erzählgang existiert. Der historische<br />
Grabstein Werner Kirchhofers, der für den Dichter der Anlaß für<br />
den 7/iompe.te./i war, wird auch für den Zeichner zum historischen<br />
Denkmal. Dabei übersieht Anton <strong>von</strong> Werner aber zweierlei. Einmal<br />
<strong>im</strong>itiert>er die historisierende Arbeitsweise <strong>Scheffel</strong>s, indem er<br />
dessen Technik nachahmt, zum anderen kehrt er sie in seiner Nachahmung<br />
um: für <strong>Scheffel</strong> war ja gerade der reale Grabstein der<br />
Ausgangspunkt seiner Fiktion gewesen, für Anton <strong>von</strong> Werner i s t<br />
er der Schlußpunkt. So i s t der Grabstein als Schlußstein nicht<br />
nur sent<strong>im</strong>entales Fle.me.nto moii für den Leser, sondern Realitätsinstanz<br />
zur Legit<strong>im</strong>ierung der historischen Wahrhaftigkeit des<br />
Werkes. Die Erfindung der Geschichte wird an die ehemals reale<br />
Existenz des Helden gebunden und damit der unverbindlichen f i k <br />
tiven Spielerei die 'wissenschaftliche' Existenzberechtigung<br />
verschafft.<br />
Auch hier wird übrigens deutlich, daß das Faktum, der Grabstein,<br />
nicht für sich a l l e i n sprechen kann. Er muß erklärend eingerahmt<br />
werden, allerdings nicht architektonisch. Vielmehr wird<br />
diesmal der steinerne Gegenstand lebendig eingerahmt, rechts<br />
durch Tier und Strauch, links durch Menschen. In solchem Bild
196<br />
i s t die historisch-lebendige Forschung a l s <strong>Scheffel</strong>-Wernersche<br />
Kunstanschauung auf den Begriff gebracht. Der Wanderer a la<br />
<strong>Scheffel</strong> läßt sich <strong>von</strong> einem Ortskundigen den Grabstein als<br />
Sehenswürdigkeit erklären und denkt sich seinen Teil dabei.<br />
Daraus kann ein 1 iompe.te.1 <strong>von</strong> Säkkingen entstehen.<br />
3. Bild statt Text. Bildbetrachtung als Literaturrezeption<br />
Die Neigung, den Illustrator <strong>von</strong> Literatur dem Dichter als Mitproduzenten<br />
gleichrangig an die Seite zu stellen, hatte angezeigt,<br />
welch grundlegende Bedeutung den Abbildungen für die Rezeption<br />
der <strong>Scheffel</strong>werke zukommt. Der Punkt, an dem die I l l u <br />
stration den Text nicht nur überwiegt, sondern sogar auf ihn<br />
verzichten kann, i s t dann bald in Sicht. <strong>Scheffel</strong>s Lk.ke.naid hat<br />
es nie zu einer i l l u s t r i e r t e n Prachtausgabe gebracht, obwohl<br />
31<br />
Anton <strong>von</strong> Werner seit 1875 Studien dazu trieb und die Vorarbeiten<br />
schon weit fortgeschritten waren. <strong>Scheffel</strong> lobt Werners<br />
Entwürfe ausdrücklich als sehr gelungen:<br />
"Deine Entwürfe zum i l l u s t r i r t e n Lkkekaid sind umsichtig und<br />
practisch und führen den Hauptinhalt übersichtlich vor. Gern<br />
hätte ich bezüglich des Formats eine Andeutung, welche <strong>von</strong><br />
den Motiven die großen Blätter bilden sollen." (32)<br />
Im Januar 1881 i s t Anton <strong>von</strong> Werner "mit den Skizzen schon am<br />
letzten Capitel angelangt" und <strong>Scheffel</strong> prophezeit ihm, die<br />
Ausgabe werde "ein dauernd <strong>im</strong> Bücherschatz der Deutschen b l e i -<br />
3 3<br />
bendes Werk" . Drei Jahre später i s t <strong>Scheffel</strong> skeptischer:<br />
"Sollte ich noch erleben, daß Dein Cyclus <strong>von</strong> Ekkehardcompositionen<br />
vollendet wird, so wird mir das ein freudiger Tag<br />
sein." (34)<br />
Daß mit <strong>Scheffel</strong>s Tod 1886 die so weit fortgeschrittenen Pläne<br />
nicht vollendet worden sind, zeigt, wie hoch die Beteiligung<br />
des Dichters selbst am Illustrationsvorgang eingeschätzt werden<br />
muß. Diese gleichsam authentischen <strong>Scheffel</strong>-Illustrationen,<br />
die noch durch Zust<strong>im</strong>mung oder sogar Mitarbeit des Dichters abgesegnet<br />
worden sind, lassen jedoch den Spielraum offen, Szenen<br />
aus <strong>Scheffel</strong>s Werk als Vorlage für eigene Bilder und Zeichnungen<br />
zu verwenden, ohne den Anspruch zu erheben, den gesamten Text<br />
i l l u s t r i e r e n zu wollen. So konnte der Münchner Bruckmann-Verlag
197<br />
(unter anderen!) schon 1879 eine Mappe mit 16 Kartons in Lichtdrucken<br />
nach Gemälden (!) zu <strong>Scheffel</strong>s tkkekaid herausbringen:<br />
"Ekkehard wird <strong>von</strong> Unberufenen i l l u s t r i r t , mit denen ich in<br />
keiner Beziehung stehe<br />
1) <strong>von</strong> Jenny in Hamburg. Lichtdruck <strong>von</strong> Jacoby in Neuendorf<br />
bei Coblenz,<br />
2) <strong>von</strong> den Pilotyschülern in München - große Formate, manier<br />
i r t e Effecte, keine historische Auffassung, Firma Flüggen<br />
u. Comp." (35)<br />
<strong>Scheffel</strong>s harsche Kritik an der gesamten Münchner Historienmalerei<br />
t r i f f t auch so renommierte Künstler wie den Münchner<br />
Mönchsmaler Eduard Grützner, für den das Klostermilieu des<br />
Lkkeka/id eigentlich doch die ideale Stoffvorlage hätte abgeben<br />
sollen. Da schäkert ein lustiger Grütznermönch, durch die Unterschrift<br />
gekennzeichnet als Kellermeister Rud<strong>im</strong>ann, mit der Magd<br />
Kerhildis <strong>im</strong> Weinkeller; Ekkehard kommt aus dem Hintergrund hinzu<br />
und stört die sent<strong>im</strong>entale Szene. Das Textgeschehen i s t zum<br />
Vorwand und zur Vorlage eines gemütvollen Genrebildes geworden.<br />
Diese selbständig erscheinenden Bildmappen als Bilderbücher mit<br />
nur bescheidenen Beschriftungen vereinzeln die Bildmotive endgültig.<br />
Sie sind die Konsequenz auch der Wernerschen I l l u s t r a -<br />
tions- und Repräsentationskunst. Der ursprünglich zugrunde<br />
liegende Text i s t nicht mehr nötig, wenn entscheidende Szenen,<br />
Höhepunkte und St<strong>im</strong>mungen optisch leichter zugänglich gemacht<br />
werden können. Der historische Roman Lkkeka/id verliert auf diese<br />
Weise nicht nur den <strong>von</strong> ihm erhobenen wissenschaftlichhistorischen<br />
Anspruch, sondern auch seinen erzählerischen Charakter.<br />
Die Textdeutung durch die Übertragung in das Bildmedium<br />
zerreißt die erzählerische Kontinuität. Die Bilder sind in der<br />
Reihenfolge vertauschbar und dann tatsächlich als Wandschmuck<br />
zu verwenden. Aus der auf Tischen ausliegenden Prachtausgabe,<br />
die <strong>im</strong>merhin noch ein Buch war, i s t der abgelöste und nur noch<br />
ästhetisierend ornamental auffaßbare Wandschmuck geworden.<br />
Daß diese Ablösung des Bildes vom Text, seine Verselbständigung<br />
und Ornamentalisierung <strong>von</strong> Seiten des Illustrators ausgeht, i s t<br />
allerdings nur die Hälfte der Wahrheit. <strong>Scheffel</strong> selbst hat<br />
diese Tendenz befördert. Seine letzte Dichtung, die Ualdeintamke.it<br />
<strong>von</strong> 1880, kehrt den üblichen Produktionsvorgang bei der<br />
i l l u s t r i e r t e n Ausgabe vollständig um. Zu zwölf landschaftlichen
198<br />
St<strong>im</strong>mungsbildern eines unbedeutenden Malers verfaßt <strong>Scheffel</strong><br />
nachträglich seine Dichtung. Der Dichter <strong>Scheffel</strong> i s t hier<br />
zweit-, ja nach dem Radierer sogar drittrangig geworden:<br />
"Waldeinsamkeit. Zwölf landschaftliche St<strong>im</strong>mungsbilder <strong>von</strong><br />
Julius Marak. Radiert <strong>von</strong> Eduard Willmann. Mit begleitender<br />
Dichtung <strong>von</strong> <strong>Joseph</strong> Victor <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>.<br />
So lautet der T i t e l . Die Poesie wird zu einer Art gere<strong>im</strong>ter<br />
Bildbeschreibung ohne jeglichen Inhalt.<br />
In einem letzten Projekt des schon seit einigen Jahren verstummten<br />
Dichters <strong>Scheffel</strong> und des Reichsmalers Anton <strong>von</strong> Werner,<br />
dem Festgedicht zum Jubiläum der Universität Heidelberg<br />
<strong>von</strong> 1886, arbeiten beide noch einmal zusammen. Doch findet<br />
<strong>Scheffel</strong>s erinnerungsdurstige Re<strong>im</strong>erei in seinem Todesjahr in<br />
der Illustration Werners (Abb. 32) keine Entsprechung mehr.<br />
Unter dem Motto des Psalms "Dies i s t der Tag, den der Herr gemacht<br />
hat" s t e l l t <strong>Scheffel</strong> sich vor und sein zur Feier des Tags<br />
"Vom heil'gen Geist" erleuchtetes "Altheidelberg" vor (IX,242).<br />
Das Lob der kurfürstlichen Tradition und ein ins Kostümhafte<br />
veräußerlichter Universitäts- und Bildungsgedanke bilden ein<br />
dichtes Konglomerat um den Festbegriff. Erst in der vorletzten<br />
der acht Strophen kommt <strong>Scheffel</strong> auf den Kern seiner Verse:<br />
"Der Geist i s t ' s , der das Rechte weist,<br />
Der Wahrheit schafft und Leben,<br />
Der starke, freie, deutsche Geist,<br />
Der uns das Reich gegeben!" (IX,243)<br />
"Ein brausend Hoch" bringt <strong>Scheffel</strong> aus auf "Altheidelberg, du<br />
Feine" (IX,243), er kehrt also vom Vaterlands-Hurra zurück zu<br />
den alten <strong>Scheffel</strong>motiven, die sein berühmtes Heidelberg-Lied<br />
aus dem 7/iompe.ie/i angesagt hatte.<br />
Anton <strong>von</strong> Werner hingegen zeichnet nur die nationale Dreieinigkeit<br />
<strong>von</strong> Kaiser, Militär und Wissenschaft. Das Arsenal des<br />
nationalen Pathos, der mittelalterliche Kaiser mit dem Lorbeerkranz<br />
als einem Heiligenschein, der Fahnenwald und die begeistert<br />
fackelschwingenden Studenten best<strong>im</strong>men die grell erleuchtete<br />
Szene. Das Hurra g i l t der Apotheose des Kaisers. Der künstlerische<br />
Anspruch, der den künstlerischen Wert rechtfertigte, i s t<br />
längst geschwunden. Der Gegenstand der Illustration i s t repräsentativer<br />
Fundus der Reichsverehrung; die Zeichnung wird
199<br />
Huldigung, die Universitätsfeier zum Vorwand. Der Zeichner und<br />
Maler hat den Dichter längst übertrumpft.
200<br />
ANMERKUNGEN<br />
Für genauere Angaben der abgekürzt zitierten Literatur wird<br />
auf das Literaturverzeichnis verwiesen. Alle Hervorhebungen in<br />
Zitaten sind, wenn nicht anders angegeben, original.<br />
EINLEITUNG<br />
1 Fontane, J.V.v.<strong>Scheffel</strong>: Ekkehard, in: Werke XXI/1, S. 250<br />
2 E. v. Sallwürck, Jos. <strong>Viktor</strong> v. <strong>Scheffel</strong>, S. 70<br />
3 Vgl. Lechner, J.V.v.<strong>Scheffel</strong> Werk und Publikum, bes. S. K6ff<br />
4 Ruhemann, <strong>Scheffel</strong>. Leben und Dichten, S. 14<br />
5 Man durchblättere die Jahrbücher des <strong>Scheffel</strong>bundes Nickt<br />
/tagten und nicht /tobten/ der Jahre 1891-1906<br />
6 B.V.Münchhausen, in: Jahrbuch des <strong>Scheffel</strong>bundes. Neue Folge.<br />
Band 1, S. 81<br />
7 H.R.Jauß, Literaturgeschichte als Provokation<br />
8 Münchhausen S. 80: "Lehre der fünf Stufen der Neuheit":<br />
1. Stufe: Verletzende Neuheit des Produzierten<br />
;<br />
2. Stufe: Reizvoll neu;<br />
3. Stufe: Nullpunkt zwischen alt und neu,<br />
eine Art Zeit- und S t i l l o s i g -<br />
keit;<br />
4. Stufe: Unmodern;<br />
5. Stufe: Das Historischwerden des Phänomens<br />
9 Münchhausen S. 8<br />
10 Münchhausen S. 10<br />
11 Münchhausen S. 12<br />
12 Vgl. Der Deutsche <strong>Scheffel</strong>bund. Bewahrer und Erwecker volksund<br />
stammesverbundenen Geistes, ein Wegbereiter junger<br />
deutscher Dichtung<br />
13 Lobe, <strong>Scheffel</strong>, eine fränkische Fehlanzeige, S. 236.- Lobe<br />
fragt z. B. danach, "was <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> heute geblieben i s t "<br />
(S. 236). Sein Aufsatz führt ihn auf die Suche nach Texten,<br />
die "noch heute mit Vergnügen zu lesen" sind (S. 245). Das<br />
Ergebnis muß erwartungsgemäß niederschmetternd sein.<br />
U Lobe S. 253<br />
15 Lobe S. 243<br />
16 Lobe S. 235.- Einige dieser Kriterien sind zudem zu pauschal,<br />
als daß sie greifen könnten. Lobes Kriterien sind: "einfallslose<br />
Direktheit", "undifferenziertes Problemlösungsverhalten"<br />
(S. 241), monotones Versgeklingel, abgegriffenes Vokabular,<br />
Betulichkeit, anbiedernd, ungehemmte Epigonie (S. 255f);
201<br />
<strong>Scheffel</strong> habe heute(!) den Zeitgeist nicht mehr auf seiner<br />
Seite (S. 257); er mache das Historische mundgerecht (S.<br />
260).<br />
17 Lobe S. 256<br />
18 Sengle, Biedermeierzeit I I , S. 703<br />
19 Alberti, Der Lieblingsdichter des neuen Deutschland, S. 270<br />
20 Lechner S. 152<br />
21 Lechner S. 74<br />
22 Eggert, Studien zur Wirkungsgeschichte des deutschen historischen<br />
Romans 1850 - 1875, S. 16<br />
23 Eggert S. 12<br />
24. Martini, Deutsche Literatur <strong>im</strong> <strong>bürgerlichen</strong> Realismus 184-8 -<br />
1898, S. 5U<br />
25 Martini S. 5U<br />
26 Sengle I I , S. 704<br />
27 Proelß, <strong>Scheffel</strong>s Leben und Dichten, S. 50<br />
28 Proelß S. 21<br />
.29 Proelß S. 21<br />
30*Brief an Eggers vom 17. Oktober 1847, Eggers-Briefe S. 55<br />
31 Brief <strong>Scheffel</strong>s, z i t . nach Proelß S. 30<br />
32 Brief vom 23. Januar 1844, Elternhaus-Briefe S. 37<br />
33 Brief vom 22. Februar 1844» ebd. S. 51<br />
34 Brief vom 11. April 1848, ebd. S. 181<br />
35 Brief an Eggers vom 17. Oktober 1847, Eggers-Briefe S. 57f<br />
36 Brief vom 29. J u l i 1846, Elternhaus-Briefe S. 167<br />
37 Ebd. S. 168<br />
38 Wilhelm Zentner <strong>im</strong> Vorwort der Elternhaus-Briefe S. XXVII<br />
39 Brief an Eggers vom 26. Januar 1845, Eggers-Briefe S. 18<br />
40 Proelß S. 55<br />
41 Proelß S. 42<br />
42 Alle Zitate <strong>im</strong> Text beziehen sich auf die zugrunde gelegte<br />
beste Ausgabe <strong>von</strong> Franke (s. Literaturverzeichnis). Die<br />
römischen Ziffern bezeichnen den Band, die arabischen die<br />
Seitenzahl.- Ohne hier textkritische Fragen erörtern zu<br />
wollen, muß doch die Benutzung der Franke-Ausgabe gerechtfertigt<br />
werden; sie wird aus zwei Gründen bevorzugt. Einmal<br />
beansprucht Franke selbst für seine Ausgabe "authentische<br />
Geltung" (S.3), wobei er auf Erstdrucke bzw. auf die eigene<br />
Sichtung des Nachlasses zurückgreift. Zum zweiten sind die<br />
leichter zugänglichen Ausgaben (z. B. <strong>von</strong> Proelß) nicht<br />
vollständig und auch nicht ganz zuverlässig. Franke kann<br />
z. B. der Proelß-Ausgabe "hunderte <strong>von</strong> Fehlern und Druckversehen"<br />
nachweisen (S. 3)\
202<br />
43 Brief an Schwanitz vom 27. Februar 1848, Schwanitz-Briefe<br />
S. 104<br />
44 Brief an Schwanitz vom 29. Februar 1848, ebd. S. 105<br />
45 Ebd. S. 106<br />
46 Ebd. S. 110<br />
3J7 Ebd. S. 107<br />
48 Brief an den Vater vom 8. Juni 1848, Elternhaus-Briefe S. 188<br />
49 Trotz etlicher Differenzen: "In Frankfurt hab ich manches <strong>von</strong><br />
parlamentarischen Kämpfen miterlebt, zbd <strong>von</strong> den wackern<br />
alten Welcker, wiewohl meine politische Ansicht nicht mit<br />
der seinigen Hand in Hand geht, v i e l gelernt" (Brief an<br />
Eggers vom 27. Januar 1849, Eggers-Briefe S. 70). In einem<br />
Brief an seinen Vater vom 18. Juni 1848 wird <strong>Scheffel</strong> deutlicher:<br />
"Er steht nur etwas zuviel auf der rechten Seite,<br />
was mir besonders darum leid i s t , weil er fatale A l l i i e r t e<br />
hat, z. B. den preußischen Adel, Herrn <strong>von</strong> Radowitz und<br />
Herrn <strong>von</strong> Vincke" (Elternhaus-Briefe S. 187).<br />
50 "An der Revolution in Baden haben ich keinen Anteil genommen",<br />
schreibt <strong>Scheffel</strong> an Schwanitz (vom 28. J u l i 1848,<br />
Schwanitz-Briefe S. 129)<br />
51 Brief an Schwanitz vom 26. Oktober 1849, ebd. S. 133 *<br />
52 Ebd. S. 133f<br />
53 Brief an Eggers vom 17. Oktober 1849, Eggers-Briefe S. 74<br />
54 "Hie und da komm ich mir schrecklich einsam vor. Mein Salon,<br />
Amtsstube und Wirtshaus sind die drei Punkte, um die sich<br />
mein Leben bewegt." (Säckingen-Briefe S. 100)<br />
55 Brief an Schwanitz vom 11. Januar 1849, Schwanitz-Briefe<br />
S. 126<br />
56 Brief <strong>Scheffel</strong>s, z i t . nach dem Vorwort der Italien-Briefe<br />
S. X.- Bei Paul Heyse und den Dichtern des Münchner Dichterkreises<br />
finden sich bemerkenswerte Parallelen zur künstlerischen<br />
Inspirationsfunktion <strong>von</strong> Italienfahrten, vgl.<br />
Krausnik, Paul Heyse und der Münchener Dichterkreis<br />
57 "<strong>Joseph</strong>'s Feder werden Sie an seinem Humor erkennen", schreibt<br />
die Mutter <strong>Scheffel</strong>s an Schwanitz, um <strong>Scheffel</strong>s Beiträge <strong>von</strong><br />
denen des Mitautors Häusser zu unterscheiden ( z i t . nach<br />
Proelß S. 197)<br />
58 Vgl. 11,9: "Es war damals, wie der Geschichtsschreiber<br />
Stalin sagt, nach Beilegung so manchen Streites in Deutschland<br />
ein heiteres Ritterleben in Hof- und Reichsfesten, als<br />
die Nachricht <strong>von</strong> der Einnahme Jerusalems durch Saladin 1187<br />
alles aufschreckte und den Kaiser, der in seiner Jugend<br />
schon eine Kreuzfahrt gemacht hatte, antrieb, durch Wiedereroberung<br />
der heiligen Stadt das Werk seines Lebens zu krönen<br />
. "<br />
59 Auf die Namensähnlichkeit Carl Alexanders mit Goethes Karl<br />
August wird ausdrücklich angespielt (III,8)!<br />
60 Brief an die Mutter vom 24. November 1863, Wandern/Weilen-<br />
Briefe S. 70
203<br />
61 Brief an Anton <strong>von</strong> Werner vom 19. -Juli 1870, Werner-Briefe<br />
S. 111<br />
62 Brief an den Verleger Adolf Bonz vom August 1870, z i t , nach<br />
Proelß S. 6^1<br />
63 Ebd. S. 641<br />
64 <strong>Scheffel</strong> scheint der Friedensschluß wichtiger zu sein als<br />
die Kaiserproklamation: "wurde die Kaiserproklamation sehr<br />
kühl aufgenommen ... Das Glockengeläut und Schießen veranlaßte<br />
zur Annahme, Paris sei genommen, als man hörte, nein,<br />
aber der Kaiser verkündet, war etwas wie Enttäuschung auf den<br />
Gesichtern. Um so aufrichtiger war der allgemeine Jubel bei<br />
der Capitulation <strong>von</strong> Paris, ein wahres Illuminirfieber bei<br />
gesetzten Leuten ... man begrüßte den nahen Frieden ..."<br />
(Brief an Werner vom 16. Februar 1871, Werner-Briefe S. 116)<br />
65 "Fürst Bismarck war mir mehr als freundlich, ich war zwe<strong>im</strong>al<br />
bei dem Gewaltigen zu Tisch und liebe ihn und die Seinigen<br />
in ihrer Eigenart." (Brief an Werner vom 22. Juni<br />
1877, ebd. S. 166)<br />
66 Brief an Werner vom 16. Februar 1871, ebd. S. 144<br />
I. DICHTER UND DICHTUNG<br />
1 Vgl. Eggert S. 177, der herausarbeitet, daß "die meisten<br />
historischen Romane jener Jahre aus der Perspektive des objektiven<br />
Erzählers geschrieben sind". Der Erzähler trete<br />
hinter den erzählten Gegenstand zurück, was für den Lkkeka/id<br />
nur in sehr beschränktem Maße z u t r i f f t .<br />
2 Vgl.: "Wer f s /*.../ nicht allzu genau n<strong>im</strong>mt"; "unserer alten<br />
Mutter Erde" (V,13); "unsere Geschichte" (V,U); "Es gibt<br />
Tage, wo der Mensch/".../" (V,15)<br />
3 Lechner S. 4-3<br />
4. So Karl Gutzkow über den 7/iompe.te./i (Unterhaltungen am häusl.<br />
Herd S. 1U).<br />
5 Brief an die Mutter vom 4. April 1853, Italien-Briefe S. 87<br />
6 Trompeter/Ekkehard-Briefe S. 45, Anmerkung 76<br />
7 "Wer aber <strong>von</strong> solchen Erscheinungen he<strong>im</strong>gesucht wird, dem<br />
bleibt nichts übrig, als sie zu beschwören und zu bannen."<br />
(V,10)<br />
8 Brief an Eggers vom 29. Februar 1856, z i t . nach Kremser,<br />
Studien über <strong>Scheffel</strong> S. 21<br />
9 Brief an den Großherzog <strong>von</strong> Sachsen-We<strong>im</strong>ar-Eisenach vom<br />
5. Dezember 1859, Großherzog-Briefe S. 39<br />
10 Brief an Müller vom 20. April 1854, Müller-Briefe S. 522<br />
11 Brief vom 23. J u l i 1863, Briefe an Schweizer Freunde S. 75<br />
12 Brief der Mutter an Arnswald vom April 1856, Schwanitz-<br />
Briefe S. 211<br />
13 Brief an Eisenhart 1859, z i t . nach Kobell, <strong>Scheffel</strong> und<br />
seine Familie S. 35
204<br />
14 Brief an Eggers vom 29. Februar 18 56, z i t . nach Kremser S. 21<br />
15 Vgl. Sengle II, S. 257ff zur Best<strong>im</strong>mung des Biedermeier<br />
16 Brief an Salomon Hirzel vom 28. J u l i 1857, in: Gustav Freytag<br />
an Salomon Hirzel und die Seinen, S. 52<br />
17 "Jenes süße, schöpfungsalte<br />
Lied der ersten jungen Liebe.<br />
Zwar ein Lied noch ohne Worte;<br />
Doch sie ahnten seinen Inhalt" (I,98f)<br />
18 Lechner S. 20<br />
19 IX,120.- Hervorhebung <strong>von</strong> mir<br />
20 Brief an Werner vom 6. August 1885, Werner-Briefe S. 209<br />
21 IX,135: "Zunftbereich des Kalten und Verständ 1 gen";<br />
"Wo Zahl und Formel herrscht"<br />
22 Brief vom 28. August 1855, Trompeter/Ekkehard-Briefe S. 50<br />
23 Brief an Heyse vom 16. Dezember 1854, Heyse-Briefe S. 16<br />
24 Pflicht/Neigung-Briefe S. 76<br />
25 Für den uninformierten, d. h. nicht literarisch eingeweihten<br />
Kellermeister Rud<strong>im</strong>ann beginnt die "neue Ära" erst mit der<br />
Verhaftung Ekkehards: "Die Heidenwirtschaft mit dem Virgilius<br />
hat ein Ende" (VI,347).<br />
26 "wenn ihm/=Ekkehard/ auch innerlich die Kunst für ewig versagt<br />
i s t " (VI,271), behauptet Gunzo und weist damit für den<br />
Leser auf Ekkehards echtes Dichtertum voraus.<br />
27 Lechner S. 173f bringt dafür zahlreiche Belegstellen bei<br />
28 Brief an die Mutter vom 16. Dezember 1845, Elternhaus-Briefe<br />
S. 124<br />
29 Vgl. VI,376: "Im Bild der Dichtung s o l l das arme Herz sich<br />
dessen freuen"; "denn mein Herz i s t wohlgemutex<br />
zu singen in der Einsamkeit"<br />
30 Wie Hinck, Epigonendichtung und Nationalidee S. 274 für<br />
Geibel f e s t s t e l l t<br />
31 Brief an den Vater vom 28. August 1855, Trompeter/Ekkehard-<br />
Briefe S. 50<br />
32 Rüge, <strong>Scheffel</strong>s Frau Aventiure S. 14<br />
33 Brief vom 27. Mai 1861, z i t . nach Proelß S. 568<br />
34 6. Epistel vom 24. März 1850, Säckingen-Briefe S. 63<br />
35 <strong>Scheffel</strong> <strong>im</strong> Lichte seines hundertsten Geburtstags S. 54<br />
36 Ebd. S. 31<br />
37 Gutzkow, Trompeter, in: Unterhaltungen am häuslichen Herd,<br />
S. 144<br />
38 Vgl. Sengle, Biedermeierzeit I und II<br />
39 J.B., in: Frankfurter Museum, 2. Jahrgang, 1856, S. 181<br />
40 Brief an Adolf Freiherr <strong>von</strong> Leutrum-Ertingen nach dem<br />
29. September 1855, Trompeter/Ekkehard-Briefe S. 82
205<br />
41 Brief an Hirzel vom 28. J u l i 1857, Hirzel-Briefe S. 52<br />
42 Vgl. Mulert, <strong>Scheffel</strong>s Ekkehard als historischer Roman, S. 90;<br />
lobend: Bus, die Geschichte <strong>im</strong> Erzählwerk <strong>Scheffel</strong>s, S. 48<br />
43 Lechner S. 59<br />
44 Windfuhr, der Epigone, S. 192<br />
45 Iser/Schalk (Hg), Dargestellte Geschichte, S. 72f und S. 25<br />
46 Ebd. S. 74<br />
47 Brief an Landpfarrer Faber vom 14. August 1855, Trompeter/<br />
Ekkehard-Briefe S. 79<br />
48 Brief an Adolf Freiherr <strong>von</strong> Leutrum-Ertingen nach dem<br />
29. September 1855, ebd. S. 82<br />
49 Vgl. Proelß S. 313; Boerschel, <strong>Scheffel</strong> und Emma He<strong>im</strong>,<br />
S. 124; Bus S. 47f; Lechner S. 100<br />
50 Vgl. VI,363: "Aber den Sennen war's recht, und den Bergen<br />
auch, und niemand tat Einsprache."<br />
51 Schlaffer, Dichtergedicht <strong>im</strong> 19. Jahrhundert, S. 307<br />
52 Windfuhr S. 189-195<br />
53 Lechner S. 25<br />
54 Lechner S. 1<br />
55 Brief der Mutter <strong>Scheffel</strong>s, z i t . nach Proelß S. 507<br />
56 Brief an die Mutter vom 15. Januar 1854, Trompeter/Ekkehard-<br />
Briefe S. 3<br />
57 Vgl. <strong>Scheffel</strong>jahrbuch 1903, S. 106-114; Proelß S. 267<br />
58 Lechner S. 19<br />
59 Zuletzt Lechner S. 18-21<br />
60 Lechner S. 12<br />
61 Brief an die Mutter vom 7. August 1859, Pflicht/Neigung-<br />
Briefe S. 80<br />
62 Mostar (Hg), Friederike Kempner, der schlesische Schwan<br />
63 Lämmert, Dichterfürst, S. 44-0<br />
64 Windfuhr S. 197<br />
65 Zit. <strong>im</strong> <strong>Scheffel</strong>jahrbuch 1904, S. 66: Brief an Uhland vom<br />
8. Januar 1854<br />
66 Zu den Cpigonzn vgl. Selbmann, Theater <strong>im</strong> Roman S. 159ff<br />
67 Sengle II, S. 631<br />
68 Brief an die Mutter vom St. Stephanstag 1852, Italien-<br />
Briefe S. 64<br />
69 Brief an die Mutter vom 11. und 12. Juni 1852, ebd. S. 17<br />
70 Vgl. Eggert S. 202<br />
71 Brief an Heyse vom 29. April 1861, Heyse-Briefe S. 60<br />
72 Brief an den Großherzog vom 14. September 1858, Großherzog-<br />
Briefe S. I6f.- Zu Paul Heyse jetzt: Ausstellungskatalog
206<br />
München 1981: Paul Heyse, Münchner Dichterfürst <strong>im</strong> <strong>bürgerlichen</strong><br />
<strong>Zeitalter</strong><br />
73 Meyer, deutsche Literatur <strong>im</strong> 19. Jahrhundert, S. 302<br />
74- Zit. aus dem Nachlaß nach Kremser S. 29<br />
75 Vgl. Schlaffer S. 330<br />
76 Brief an den Vater vom 17. September 1844, Elternhaus-Briefe<br />
S. 83<br />
77 Brief an Häusser, z i t . nach Proelß S. 254<br />
78 Lechner S. 29<br />
II. DICHTER UND GESCHICHTE<br />
1 Es kann natürlich nicht angehen, <strong>Scheffel</strong>s Roman daran zu<br />
messen, "inwieweit der Lkketta/id den Anforderungen entspricht,<br />
die an einen historischen Roman zu stellen sind" (Mulert S.1),<br />
Die Schlußfolgerung, "<strong>Scheffel</strong> i s t in Widerspruch mit den<br />
Gesetzen der Einheit, der Wahrscheinlichkeit, der Notwendigkeit<br />
und damit den Gesetzen der Wahrheit und Schönheit geraten"<br />
(ebd. S. 66), läßt sich mit der gleichen Berechtigung<br />
ins Positive wenden. Man s t e l l t dann die "Einordnung der geschichtlichen<br />
Fakta in den Subjektivismus" lobend heraus und<br />
folgert: "Der ELkketiaid erfüllt die Grundforderungen, die an<br />
einen historischen Roman gestellt werden, in hohem Maße"<br />
(Bus S. 73).<br />
2 Vgl. dazu Iser/Schalk; jetzt: Steinecke, Romantheorie und<br />
Romankritik in Deutschland I<br />
3 Eggert S. 30f<br />
4 Auflagenzahlen z. B. ebd. S. 27<br />
5 Wolfgang Menzels Literaturblatt 1855, S. 283: "Ganz abgesehen<br />
"da<strong>von</strong>, ob das vorliegende Werk allen Forderungen, die<br />
man an ein solches machen könnte, ganz genügt, muß die<br />
Manier in Schutz genommen werden."<br />
6 Ebd. S. 281<br />
7 Morgenblatt für gebildete Leser Nr. 45 vom 4. November 1855,<br />
S. 1073<br />
8 Ebd. S. 1075<br />
9 Ebd. S. 1075<br />
10 Fontane, Ekkehard, S. 251<br />
11 Ebd. S. 250<br />
13 Ebd. S. 250<br />
14 Ebd. S. 251<br />
15 Zit. nach Kremser S. 10<br />
16 Eggert S. 55<br />
17 Gustav Freytag an Hirzel vom 28. J u l i 1857, Hirzel-Briefe<br />
S. 52
207<br />
18 Leitner, Angewandte Geschichte, S. 16<br />
19 Vgl. VI, 4-28: "Ande/ie haben behauptet, es seien mehrere des<br />
Namens Ekkehard <strong>im</strong> Kloster Sankt Gallen gewesen, und der<br />
den Walthari dichtete, sei nicht der nämliche, der die Herzogin<br />
Hadwig des Lateins unterwies. Aber wer der Qe^ckickte,<br />
die wir jetzt glücklich zu Ende geführt, aufmerksam folgte,<br />
weiß die* (Lette/t." (Hervorhebung <strong>von</strong> mir)<br />
20 Iser/Schalk S. 22<br />
21 Vgl. Mulert S. 40<br />
22 Das Schmücken des Weihnachtsbaums <strong>im</strong> Mittelalter; Essen mit<br />
Messer und Gabel; die Herzogin mit der Küchenschürze in der<br />
Küche be<strong>im</strong> Plätzchenbacken usw.<br />
23 Iser/Schalk S. 32<br />
24 Z. B. V,13 2 "Denksteine stürmischer Vorgeschichte unsrer<br />
alten Mutter Erde"; "mag's ein denkwürdiger<br />
Tag gewesen sein"; "das i s t schon lange her";<br />
"es i s t Graß gewachsen über /".../";<br />
V,14: "Gedächtnis an die fröhliche Jugendzeit"<br />
25 Vgl. V,14: "Zur Zeit, da unsere Geschichte anhebt" und VI,<br />
428: "Hier endet unsere Geschichte"<br />
26 Anfangs V,14* "nur die Berge stehen noch <strong>im</strong>mer" und am<br />
Schluß VI,430: "Der hohe Twiel hat noch vieles erleben<br />
müssen f...J Jetzo ist's s t i l l auf jenem Gipfel"<br />
27 V,5: "Buch" - VI,431: "BÜchkein";<br />
V,9* "wachsen ihm Gestalten empor" mit der direkten Aufforderung<br />
zum Dichten - VI,431: "standen die Gestalten" ebenf<br />
a l l s mit dieser Aufforderung;<br />
beide Male enthält die Leseranrede eine captat io (Lenevo tentiae,<br />
nämlich V,11: Hroswitha-Zitat - VI,431: "Gehab' dich<br />
wohl und bleib ihm fürder gewogen!"<br />
28 Brief an den Vater vom 29. J u l i 1846, Elternhaus-Briefe<br />
S. N 1 67<br />
29 Brief an die Mutter vom 24. April 1854, Trompeter/Ekkehard-<br />
Briefe S. 11<br />
30 Brief an Landpfarrer Faber nach dem 14. August 1855, ebd.<br />
S. 79<br />
31 Ebd. S. 79<br />
32 Brief an den Vater vom 28. August 1855, ebd. S. 50<br />
33 Brief an Wilhelm Meyer-Ott vom 30. November 1854, Briefe an<br />
Schweizer Freunde S. 45<br />
34 Ebd. S. 45<br />
35 Vgl. Proelß S. 327<br />
36 Vgl. 11,8: "Auch/*!/ der erklärte Widersacher bläßlicher Romantik<br />
und unfreier Rückwärtsgelüste vermag kaum ein t i e f <br />
ernstes Gefühl abzuweisen."<br />
37 <strong>Scheffel</strong> <strong>im</strong> Lichte seines 100. Geburtstags S. 13 und S. 22<br />
38 Vgl. Leitner S. 12
208<br />
39 Brief an Eduard Dössekel vom 29. Dezember 1863, Briefe an<br />
Schweizer Freunde S. 82<br />
40 Brief an E.L.Rochholz vom 18. Januar 1868, ebd. S. 173<br />
4.1 1/ie.ne. <strong>von</strong> Spii<strong>im</strong>&e/ig (unvollendet) S. 2<br />
42 Vgl. Eggert S. 54<br />
43 Lämmert S. 44-3<br />
44 Brief an die Mutter vom 9. Januar 1853, Italien-Briefe S. 70f<br />
45 Meyer S. 311<br />
46 Brief an Heyse vom 17. Januar 1856, Heyse-Briefe S. 21<br />
47 Brief an den Vater vom 28. August 1855, Trompeter/Ekkehard-<br />
Briefe S. 50<br />
48 Brief an Werner vom 28. Februar 1866, Werner-Briefe S. 28<br />
49 Martini S. 445<br />
50 Vgl. den Brief an den Großherzog vom 24. Januar 1860, Großherzog-Briefe<br />
S. 59<br />
51 Proelß S. 136<br />
52 Brief an Schwanitz vom 24. Februar 1855, Schwanitz-Briefe<br />
S. 205<br />
53 Brief an Schwanitz vom 26. Januar 1850, ebd. S. 137<br />
54 Auch dies i s t nicht untypisch für die Zeit, man vgl. das<br />
Bismarckbild Fontanes, das dessen Romane wie ein gehe<strong>im</strong>es<br />
Muster durchzieht! (zuletzt: Müller-Seidel, Fontane S. 42ff)<br />
55 Brief an Werner vom 1. Januar 1877, Werner-Briefe S. 159<br />
56 Vgl. Poschinger, Bismarck und <strong>Scheffel</strong>, S. 204<br />
57 Brief an Werner vom 22. Juni 1877, Werner-Briefe S. 166.-<br />
Ein gewisser Vorbehalt in der Formulierung i s t allerdings<br />
unüberhörbar.<br />
III. DICHTER UND WIRKLICHKEIT<br />
1 Brief an die Mutter vom 26. Oktober 1856, Mein-Glück-Briefe<br />
S. 24<br />
2 Brief an Eisenhart <strong>von</strong> 1859, z i t . nach Kobell S. 35<br />
3 Brief an Louise <strong>von</strong> Kobell, ebd. S. 38<br />
4 Brief an die Mutter vom 22. Oktober 1858, Pflicht/Neigung-<br />
Briefe S. 55<br />
5 Brief an August Corrodi vom 23. Mai 1856, z i t . nach <strong>Scheffel</strong>jahrbuch<br />
1903, S. 12<br />
6 Brief an Schwanitz vom 17. J u l i 1863, Schwanitz-Briefe S. 231<br />
7 Lämmert S. 447<br />
8 Haferkorn, Entstehung der bürgerlich-literarischen I n t e l l i <br />
genz und des Schriftstellers, bes. S. 195ff
209<br />
9 Der Versuch 'kapitalistische 1 Widersprüche um die Mitte des<br />
19. Jahrhunderts über das Vorbild Schillers zu lösen, findet<br />
seine Parallele <strong>im</strong> Arbeitsbegriff Gottfried Kellers in dessen<br />
Q/iünen rie.in/iich, vgl. Selbmann S. 187<br />
10 Brief an die Mutter vom 6. April 1860, Wandern/Weilen-<br />
Briefe S. 17<br />
11 Brief an Emma He<strong>im</strong> vom 22. November 1859, z i t . nach Boerschel<br />
S. 217<br />
12 Brief an den Großherzog, <strong>im</strong>merhin der Schirmherr der<br />
Schillerstiftung, vom 7. Oktober 1860, z i t . nach Rüge S. 111<br />
13 Brief an Frau Engerth vom 17. Dezember 1853, z i t . nach<br />
Boerschel S. 139<br />
14 Brief an die Mutter vom 18. November 1856, Mein-Glück-Briefe<br />
S. 34<br />
15 Abgedruckt in: Trompeter/Ekkehard-Briefe S. 56<br />
16 Brief an Heyse vom 17. Januar 1856, Heyse-Briefe S. 21f<br />
17 Alberti, der Lieblingsdichter des neuen Deutschland, S. 271<br />
18 Brief an den Großherzog vom 9. J u l i 1859, Großherzog-Briefe<br />
S. 34<br />
19 Telegramm an die Eltern vom 2. September 1854, Trompeter/<br />
Ekkehard-Briefe S. 25<br />
20 Brief an den Vater vom 28. August 1855, ebd. S. 50<br />
21 Brief an die Mutter vom 9. Januar 1853, Italien-Briefe S. 70f<br />
22 IX,22: "Nur des Nichts Sumpfblüten blühen"; "Balsam der<br />
Vermittlung"; "Erz des Begriffes" usw.<br />
23 Brief an Schwanitz vom 11. Januar 1849, Schwanitz-Briefe<br />
S. 126<br />
24 Brief an Eggers vom 17. Oktober 1847, Eggers-Briefe S. 57f<br />
25 Hinck S. 275, allerdings auf Geibel gemünzt<br />
26 Brief an Ludwig Häusser, z i t . nach Proelß S. 254<br />
27 Brief an Müller vom 11. August-;1861 , Müller-Briefe S. 540<br />
28 Brief an Heyse vom 29. Januar 1866, Heyse-Briefe S. 72<br />
29 Brief vom 16. Februar 1863, z i t . nach Proelß S. 585<br />
30 Ruhemann S. 324<br />
31 Vgl. Poschinger S. 205<br />
32 Brief an den Großherzog vom 31. Dezember 1883, Großherzog-<br />
Briefe S. 128<br />
33 Brief an Dössekel vom 4. Dezember 1882, Briefe an Schweizer<br />
Freunde S. 216<br />
34 Brief an die Mutter vom 4- September 1863, Wandern/Weilen-<br />
Briefe S. 65<br />
35 Lechner S. 131ff und S. 142ff<br />
36 Brief an Emma He<strong>im</strong> vom 26. August 1881, z i t . nach Boerschel<br />
S. 357
210<br />
37 Brief an Werner vom 23. Juni 1867, Werner-Briefe S. 52<br />
38 Brief an Eggers vom 16. Mai 184-5, Eggers-Briefe S. 36<br />
38a Mein-Glück-Briefe S. 41<br />
39 Brief an den Großherzog vom 6. Januar 1872, Großherzog-<br />
Briefe S. 1l6f<br />
40 Brief an Eisenhart vom 29. Dezember 1873, als dieser Scheff<br />
e l <strong>im</strong> Auftrag des bayerischen Königs Ludwig II. den Max<strong>im</strong>iliansorden<br />
übersendet; z i t . nach Kobell S. 83<br />
41 Brief an die Schwester vom 2. Februar 1851, Säckingen-Briefe<br />
S. 103<br />
42 Brief, z i t . nach Boerschel S. 161<br />
43 Brief an Werner vom 6. August 1885, Werner-Briefe S. 209<br />
44 Wenn Freytag an seinen Verleger Hirzel schreibt, daß Scheff<br />
e l "in der Einleitung gegen gewisse Grenzbotenansichten<br />
polemisirt", aber durch den Roman selbst den "wahren Hintergrund"<br />
dieser Ansichten glänzend bestätige - Brief Freytags<br />
an Hirzel vom 28. J u l i 1857, Hirzel-Briefe S. 52.- <strong>Scheffel</strong><br />
w i l l ja ganz <strong>im</strong> Sinne der realistischen Theorie durch den<br />
historischen Roman zur "<strong>von</strong> poesie verklärter Anschauung<br />
der Dinge" (V,5) kommen!<br />
45 Brief an Müller vom 20. April 1854, Müller-Briefe S. 522<br />
46 Fontane, Ekkehard S. 252<br />
47 Immer noch grundlegend: Preisendanz, Humor als dichterische<br />
Einbildungskraft<br />
48 Trompeter/Säckingen-Briefe, Anmerkung 76<br />
49 Lechner S. 9<br />
50 Martini S. 318<br />
51 Bezüglich des Lkke.tia.idi Brief an Landpfarrer Faber nach dem<br />
14. August 1855, Trompeter/Ekkehard-Briefe S. 79<br />
52 Brief an Heyse vom 17. Januar 1856, Heyse-Briefe S. 22<br />
53 Meyer S. 303<br />
54 Vgl. Selbmann S. 108ff<br />
55 "Katerschlachtlied" (1,150); "Katerheldengreis" (1,151);<br />
"Katzenjammer", "Katzenschmerz" (1,152); "Katertraum" (I,<br />
152); "Dach der Dächer" (1,154) usw.<br />
IV. DICHTER UND POLITIK<br />
1 Meyer S. 308<br />
2 Martini S. 315: "Politisch neigte er zum süddeutsch-republikanischen<br />
Demokratismus idealistisch-romantischer Prägung.<br />
Erst die Reichsgründung versöhnte ihn mit Preußen."<br />
3 Proelß S. 349<br />
4 Brief an Eggers vom 18. Oktober 1847, Eggers-Briefe S. 64
211<br />
5 Abgedruckt bei: Franke, Vorwort der <strong>Scheffel</strong>-Ausgabe 1,20<br />
6 Ebd. S. 21<br />
7 Ebd. S. 21<br />
8 Brief an Schwanitz vom 28. J u l i 1849, Schwanitz-Briefe S. 129<br />
9 Elternhaus-Briefe S. 176f<br />
10 Brief an Schwanitz vom 24. Mai 1848, Schwanitz-Briefe S. 116<br />
11 Brief an Schwanitz vom 27. Februar 1848, ebd. S. 102f<br />
12 Wie Bürkle anhand bisher unveröffentlichen Materials herausgearbeitet<br />
hat, so z. B. in dem nicht datierten Faszikel<br />
"Die politische Entwicklung in Parallele mit der religiösen.<br />
Die Staatsform der Zukunft" (Bürkle S. 124)<br />
13 Bürkle S. 124<br />
14 Bürkle S. 125<br />
15 Brief an Schwanitz vom 29. Februar 1848, Schwanitz-Briefe<br />
S. 108<br />
16 Brief an Schwanitz vom 28. J u l i 1849, ebd. S. 129<br />
17 Proelß S. 95<br />
18 Vgl. Wild, Karl Theodor Welcker<br />
19 Wild S. 250<br />
20 Zit. nach Wild S. 228<br />
21 Wild S. 263<br />
22 Wild S. 309<br />
23 Brief an Eggers vom 27. Januar 1849, Eggers-Briefe S. 70<br />
24 Brief an die Mutter vom 11. April 1848, Elternhaus-Briefe<br />
S. 179<br />
25 Brief an die Mutter vom 26. Mai 1848, ebd. S. 184<br />
26 Proelß S. 119<br />
27 Brief an Schwanitz vom 28. J u l i 1849, Schwanitz-Briefe<br />
S. 131.- Vgl. auch Proelß S. 105<br />
28 Brief an Schwanitz vom 11. Januar 1849, Schwanitz-Briefe<br />
S. 126<br />
29 Brief an die Mutter vom 29. Mai 1846, Elternhaus-Briefe<br />
S. 152<br />
30 Zur Nachwirkung Barbarossas jetzt: Schreiner, Die Staufer<br />
in Sage, Legende und Prophetie, in: Die Zeit der Staufer<br />
I I I , S. 249 ff<br />
31 IX,36f: "Mit vollem Atemzug"; "wie ich nach dem Kaiser<br />
r i e f " ; "Riesenhorn"; "stark wie zehntausend<br />
schrei f n"; "n<strong>im</strong>mermüden Munds"; "mit schmetterndem<br />
Gesang" usw.<br />
32 Brief an Schwanitz vom 26. Januar 1850, Schwanitz-Briefe<br />
S. 138<br />
33 Vgl. Proelß S. 36
212<br />
34 <strong>Scheffel</strong>s Verhältnis zu den Burschenschaften: mittlerweile<br />
i s t geklärt, daß <strong>Scheffel</strong> aktiver Burschenschaftler, oftmals<br />
sogar die treibende Kraft und Gründungsmitglied bei Burschenschaftsneugründungen<br />
und -trennungen gewesen i s t , so z.B.<br />
bei der Alemania" und "Palatina" <strong>im</strong> Sommer 184-5, und bei der<br />
Umbildung zur "Frankonia" ein Jahr später. Gerade für Scheff<br />
e l i s t die Nähe zu demokratisch und republikanisch gesinnten<br />
Gruppierungen nachweisbar. Der radikalere Neckarbund,<br />
unter seinen Mitgliedern <strong>Scheffel</strong>s Kommilitone und späterer<br />
Revolutionsführer Carl Blind, i s t beispielsweise durch Abspaltung<br />
aus der "Alemania" hervorgegangen.(vgl. Proelß<br />
S. 54).<br />
35 Brief an Schwanitz vom 13. J u l i 1845, Schwanitz-Briefe S. 18<br />
36 Ebd. S. 18<br />
37 Brief an Schwanitz vom 15. Januar 1846, ebd. S. 43<br />
38 Vgl. Lechner S. 106<br />
39 Vgl. Lechner S. 153-156<br />
40 Vgl. Falck, die Gesellschaft des Heidelberger "Engeren"<br />
41 Vgl. Proelß S. 128<br />
42 Proelß S. 115<br />
43 Proelß S. 59: "einerseits die <strong>von</strong> der Romantik zu sent<strong>im</strong>entalen<br />
Bläßlingen abgeschwächten Gestalten des seinem Wesen<br />
nach so urkräftigen und derben Mittelalters und der altersgrauen<br />
Vorzeit, nach dem Muster des (Je intchioetgen, realparodistisch<br />
umzugestalten, und andererseits: die niedrigsten<br />
und urwüchsigsten Gebilde der organischen Welt <strong>im</strong> Sinne<br />
des Zechhumors mit menschlichen Gelüsten und Empfindungen zu<br />
begaben."<br />
44 Proelß S. 303<br />
45 Etwa durch Vermutungen über einen Zusammenhang einer Geisteskrankheit<br />
<strong>Scheffel</strong>s mit dem Alkoholismus (vgl. Möbius, Uber<br />
<strong>Scheffel</strong>s Krankheit, S. 20).<br />
46 So Lobe S239: "<strong>Scheffel</strong> delektierte sich noch <strong>im</strong> eigenen<br />
Scheitern genüßlerisch resignierend am ihm Unfaßbaren."<br />
47 Eggert S. 67<br />
48 Brief an Eggers vom 17. Oktober 1849, Eggers-Briefe S. 75<br />
49 Brief an die Mutter vom 17. Dezember 1850, Säckingen-Briefe<br />
S. 100<br />
50 Vgl. unausgesprochen Hinck S. 279<br />
51 Brief an Rudolf Häusler vom 10. Oktober 1866, Briefe an<br />
Schweizer Freunde S. 149<br />
52 Brief an Häusler vom J u l i 1867, ebd. S. 165<br />
53 Brief an Erismann vom Juni 1866, Erismann-Briefe S. 27f<br />
54 So Zentner in der Einleitung zu den Elternhaus-Briefen (S.<br />
XXXXVII): <strong>Scheffel</strong> sei gerade deshalb Dichter geworden,<br />
ioei£ er sich aus der P o l i t i k zurückgezogen habe
213<br />
55 Proelß S. 486<br />
56 Brief an Schwanitz vom 26. Januar 1850, Schwanitz-Briefe<br />
S. 137 und weiter: "Der deutsche Napoleon i s t wenigstens<br />
noch nicht dagewesen."<br />
57 Brief an Schwanitz vom 11. Januar 1849, ebd. S. 126<br />
58 Brief an Erismann vom 28. November 1866, Erismann-Briefe<br />
S. 29<br />
59 Brief an Erismann vom 28. J u l i 1870, ebd. S. 41<br />
60 Brief an Werner vom 19. J u l i 1870, Werner-Briefe S. 111<br />
61 Zit. nach Proelß S. 641<br />
62 Ebd. S. 641<br />
63 Brief an Emma He<strong>im</strong> vom 19. November 1871, z i t . nach Boerschel<br />
s. 324<br />
64 Brief an Louise <strong>von</strong> Kobell vom 30. Oktober 1870, z i t . nach<br />
Kobell S. 77<br />
65 Vgl. Hinck S. 272<br />
V. DICHTER UND BÜRGERLICHE GESELLSCHAFT<br />
1 Lobe S. 257<br />
2 Lobe S. 241<br />
3 Eggert S. 172<br />
4 Den Begriff des Bürgertums, so problematisch er sein mag,<br />
differenziere ich ausdrücklich hier nicht. Vgl. in diesem<br />
Zusammenhang: Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit<br />
5 Eggert S. 93<br />
6 Vgl. Lechner S. 49<br />
7 Brief der Mutter, z i t . bei Proelß S. 504ff<br />
8 Brief an den Großherzog vom 5. Dezember 1859, Großherzog-<br />
Briefe S. 39f<br />
9 Lämmert S. 44-7 in Fortführung der Jaußschen These <strong>von</strong> der<br />
Ablesbarkeit des Horizontwandels an der Publikumsreaktion<br />
(vgl. Jauß S. 177)<br />
10 Lämmert S. 451<br />
11 Sallwürck S. 78<br />
12 Sallwürck S. 88<br />
13 Brief an die Mutter vom 24. August 1858, Pflicht/Neigung-<br />
Briefe S. 50<br />
14 Riehl, Eine Rheinfahrt mit <strong>Scheffel</strong>, S. 226<br />
15 Lechner S. 8<br />
16 Lämmert S. 453<br />
17 Schlaffer S. 326
214<br />
18 Lämmert S. 453<br />
19 Proelß S. 423<br />
20 Vgl. Krausnik<br />
21 Brief an Answald, z i t . nach Proelß S. 498f.- Daß <strong>Scheffel</strong><br />
nur beunruhigt i s t , den Widerspruch zwischen dem Anspruch<br />
des freien Schriftstellers und den Entfremdungsbedingungen<br />
des Marktes auf Grund seiner wirtschaftlich gesicherten<br />
Stellung also nicht mitreflektiert, i s t offensichtlich.<br />
22 Brief an Answald, z i t . nach Proelß S. 584f<br />
23 Proelß S. 617<br />
24 Proelß berichtet, unter <strong>Scheffel</strong>s Papieren habe sich ein<br />
Konzept gefunden, "in welchem er sich gegen den Vorwurf<br />
rechtfertigte, daß er sich in die Sphäre des We<strong>im</strong>arschen<br />
Hofes gedrängt habe, in die er als Bürgerlicher nicht gehöre."<br />
(Proelß S. 555)<br />
25 Vgl. Lechner S. 149<br />
26 Brief an Eisenhart vom 27. Dezember 1856, z i t . nach Kobell<br />
S. 41<br />
27 Brief an die Mutter vom 21. August 1858, Pflicht/Neigung-<br />
Briefe S. 50<br />
28 Brief an die Mutter vom 17. Oktober 1858, ebd. S. 52 '<br />
29 So Lobe S. 253<br />
30 Schlaffer S. 302<br />
31 Lämmert S. 441<br />
32 Brief an Frau Engerth vom 17. Dezember 1853, z i t . nach<br />
Ruhemann S. 139<br />
33 Brief an die Mutter vom 4. September 1863, Wandern/Weilen-<br />
Briefe S. 66<br />
34 <strong>Scheffel</strong> <strong>im</strong> Lichte seines 100. Geburtstags S. 5<br />
35 Von <strong>Scheffel</strong> mitgeteilt in einem Brief an Schwanitz vom<br />
9. April 1976, Schwanitz-Briefe S. 248f<br />
36 Brief an den Großherzog vom 18. November 1857, Großherzogbriefe<br />
S. 6, zur Auftragsarbeit des Wartburgromans<br />
37 Brief des Großherzogs an <strong>Scheffel</strong> vom 6. März 1859, Großherzog-Briefe<br />
S. 33<br />
38 Brief des Großherzogs an <strong>Scheffel</strong> vom 11. Januar 1859,<br />
Großherzog-Briefe S. 30: "Dichten kann ich nicht, aber<br />
fühlen kann ich die Kunst"<br />
39 Brief des Großherzogs an <strong>Scheffel</strong> vom 18. März 1873, Großherzog-Briefe<br />
S. 26<br />
40 Zit. nach: Oberbreyer, <strong>Scheffel</strong>'s Adel und Orden, in:<br />
<strong>Scheffel</strong>jahrbuch 1891, S. 93<br />
41 Brief des Großherzogs an <strong>Scheffel</strong> vom 10. Juni 1872, Großherzog-Briefe<br />
S. 119<br />
42 Brief des Großherzogs an <strong>Scheffel</strong> vom 15. Juni 1872, ebd.<br />
S. 121
215<br />
43 Brief an den Großherzog vom 23. Juni 1872, ebd.- S. 123<br />
44 Brief des Großherzogs an <strong>Scheffel</strong> vom 6, Februar 1858, ebd.<br />
S. 11<br />
45 Brief an die Mutter vom 14. September 1863, Wandern/Weilen-<br />
Briefe S. 65<br />
46 Lechner S. 53<br />
47 Vgl. zu diesem Komplex: Schivelbusch, Eisenbahnreise<br />
48 Stöckle, Ich fahr ? in die Welt, <strong>im</strong> Untertitel seines Buches<br />
49 Vgl.: Ä/iblühen, £iglühen, Zugvogel erhebt seine Schwingen,<br />
Sonne zum Qe.te.ite. bestellt usw.<br />
50 IX,28, bei <strong>Scheffel</strong> gesperrt gedruckt. Dabei i s t zu beachten,<br />
daß der Begriff der Polizei noch die gesamte staatliche<br />
Gewalt umfaßt, z. B. auch <strong>Scheffel</strong>s Beruf als Verwaltungsjurist<br />
eingeschlossen i s t , l e t z t l i c h also die Gesamtheit<br />
des Philistertums innerhalb der <strong>bürgerlichen</strong> Gesellschaft<br />
gemeint i s t !<br />
51 Hinck S. 274<br />
52 Brief an den Vater vom 22. Februar 1844» Elternhaus-Briefe<br />
S. 50<br />
53 Brief an die Eltern vom 3. September 1844» ebd. S. 80<br />
54 Brief an Eggers vom 17. Oktober 1849, Eggers-Briefe S. 76<br />
55 Brief an die Mutter vom 19. August 1851, Säckingen-Briefe<br />
S. 129<br />
56 Brief an Schwanitz vom 17. Oktober 1851, Schwanitz-Briefe<br />
S. 179<br />
57 Brief an Heyse vom 26. Oktober 1860, Heyse-Briefe S. 51<br />
58 Brief an den Großherzog vom 27. Juni 1863, Großherzog-Briefe<br />
S. 95<br />
59 Brief an die Mutter vom 30. Oktober 1861, Wandern/Weilen-<br />
Briefe S. 37<br />
60 Brief an den Großherzog vom 15. Juni 1860, Großherzog-<br />
Briefe S. 66<br />
61 Brief an Erismann vom 22. Mai 1863, Erismann-Briefe S. 17<br />
62 Brief an Erismann vom 25. Januar 1866, ebd. S. 25<br />
63 Brief an Emma He<strong>im</strong> vom 6. September 1871, z i t . nach Boerschel<br />
S. 322<br />
64 Brief an Schwanitz vom 24. Februar 1855, Schwanitz-Briefe<br />
S. 205<br />
65 Brief an die Mutter vom 7. August 1859» Pflicht/Neigung-<br />
Briefe S. 80<br />
66 Zusammengestellt bei Lechner S. I68f<br />
67 Vgl. Leitner S. 26f<br />
68 Wolfgang Menzels Literaturblatt 1864» S. 341<br />
69 Stöckle S. 58
216<br />
70 Möbius S. 16<br />
71 Lobe S. 252<br />
73 I,U9f: bei den RosenJ'stehn" die Dornen; "Zum Schluße<br />
kommt das Voneinander^/i/i" ; ein stumrgepriif ter müder Uandß/i^mann";<br />
"da führte mich der U&g zu die hinan" usw. (Hervorhebung<br />
<strong>von</strong> mir)<br />
74 Brief an Werner vom 20. Mai 1868, Werner-Briefe S. 84<br />
75 Wartburgroman S. 51<br />
76 Ebd. S. 54<br />
77 Heyse-Briefe S. 49<br />
78 Brief an den Großherzog vom 6. Januar 1872, Großherzog-<br />
Briefe S. 1l6f<br />
79 Brief an Dössekel vom 5. September 1867, Briefe an Schweizer<br />
Freunde S. 168<br />
80 Brief an die Mutter vom 9. Januar 1853, Italien-Briefe S. 69<br />
81 Brief an E. Rothpietz vom 18. Mai 1873, Briefe an Schweizer<br />
Freunde S. 196<br />
82 Brief an Schwanitz vom 8. J u l i 1884, Schwanitz-Briefe S. 257<br />
83 Brief an Emma He<strong>im</strong> vom 15. Dezember 1857, z i t . nach Boerschel<br />
S. 160<br />
84 Brief an Werner vom 1. März 1886, Werner-Briefe S. 216<br />
VI. DICHTER UND PUBLIKUM<br />
1 Proelß S. 530<br />
2 Zernin, Erinnerungen an <strong>Scheffel</strong>, S. 13.- <strong>Scheffel</strong> fühlte<br />
um seinen Anteil am Gewinn betrogen, als der Berliner Verleger<br />
Otto Janke den pleitegagangenen Meidinger-Verlag und<br />
mit ihm die Rechte am Lkkeka/id erwarb und nicht bereit war,<br />
<strong>Scheffel</strong> an neuen Auflagen - und Gewinnen - angemessen zu<br />
beteiligen.<br />
3 Franke, Vorwort S. 50<br />
4 Brief an Müller vom 24. August 1861, Müller-Briefe S. 542<br />
5 Brief an die Mutter vom 26. Oktober 1856, Mein-Glück-Briefe<br />
S. 26<br />
6 Brief an Heyse vom 25. Februar 1860, Heyse-Briefe S. 49<br />
7 Brief an die Mutter vom 29. September 1855, Trompeter/Ekkehard-Briefe<br />
S. 64<br />
8 Fontane, Ekkehard S. 250: "Was Scott voraus hat, i s t die<br />
schöpferische Fülle; eine Erzählung, wie <strong>Scheffel</strong> sie einmal<br />
geschrieben, schrieb Scott in seiner glänzendsten Zeit<br />
in drei Monaten."<br />
9 Brief an Uhland vom 8. Januar 1854, z i t . nach: <strong>Scheffel</strong>jahrbuch<br />
1904, S. 66
217<br />
10 Meyer S. 305<br />
11 = Schweigen wäre todbringend: Brief an die Schwester vom<br />
10. Oktober 1856, Mein-Glück-Briefe S. 24<br />
12<br />
, f<br />
Bis die Fülle der<br />
Erkenntnis<br />
Und die Lieb' den Steinbann sprengt." (1,110)<br />
13 Zit. nach Rüge S. 90<br />
14 Morgenblatt für gebildete Leser S. 1075<br />
15 Freytag an Hirzel vom 28. J u l i 1857, Briefe an Hirzel S. 52<br />
16 Meyer S. 307<br />
17 Menzels Literaturblatt 1855, S. 283<br />
18 Brief an die Mutter vom 12. August 1855, Trompeter/Ekkehard-<br />
Briefe S. 45<br />
19 Brief an die Mutter vom 4- November 1862, Wandern/Weilen-<br />
Briefe S. 52<br />
20 Brief an die Mutter vom 29. September 1863, ebd. S. 68<br />
21 Proelß S. 298f<br />
22 Zit. nach Kremser S. 10<br />
23 Braun, Literaturbilder der Gegenwart 1869, S. 1225<br />
24 Brief an Werner vom 27. Mai 1867, Werner-Briefe S. 50<br />
25 Gutzkow, Zur Gymnasialreform 1878, S. 140<br />
26 Brief an Werner vom 25. April 1879, Werner-Briefe S. 185<br />
27 Vgl. Boerschel S. 283f<br />
28 Proelß S. 650<br />
29 Lechner S. 154<br />
30 Eggert S. 171<br />
31 Eggert S. 204<br />
32 Vgl. Meyer S. 305f<br />
33 <strong>Scheffel</strong>jahrbuch 1902, S. 57f<br />
34 Proelß S. 658<br />
35 Proelß S. 658<br />
36 <strong>Scheffel</strong>jahrbuch 1903, S.119.- Genauere Zahlen finden sich<br />
bei Lechner S. 146-148:<br />
7/iompe.tei: 1. Aufl. = 1854; 2. Aufl = 1859; 11. Aufl. =<br />
1870; 25. AufL = 1873; 100. Aufl. = 1882;<br />
200. Aufl. = 1892; 322. Aufl. = 1921.<br />
Bis 1907 sind das 369300 Exemplare<br />
£kke.hasid: 1. Aufl. = 1 855; 2. Aufl. = 1862; 3. Aufl. = 1865;<br />
16. Aufl. = 1876; 90. Aufl. = 1890; 200. Aufl.<br />
= 1903/4.<br />
Bis 1907 ergeben sich ca. 329400 Exemplare<br />
Qaude.amu*: 1. Aufl. = 1868; 2. Aufl. = 1869; 10. Aufl. =<br />
1872; 20. Aufl. = 1875; 50. Aufl. = 1887;<br />
60. Aufl. = 1897.
218<br />
Bis 1907 ca. 90200 Exemplare. Dazu kommen noch<br />
Flugblattdrucke u. ä. sowie die nicht nachweisbare<br />
mündliche Verbreitung.<br />
Für das Jahr 1906 kommt Lechner auf eine Gesamtauflage der<br />
Werke <strong>Scheffel</strong>s <strong>von</strong> 911200 Exemplaren.<br />
37 Stork, Angelsport S. 285<br />
38 Breitner S. 13-17 sowie 139ff, dessen anregend kommentierende<br />
Bibliographie in ihrer Machart bis heute unübertroffen i s t !<br />
39 Lechner S. H6: "Die Gründe dafür/"=der Erfolg des Lkke.ka/id]<br />
zu erörtern, maße ich mir nicht an."<br />
4.0 Vgl. Fetzer, der verzögerte Erfolg<br />
41 Vgl. Sengle I, S. 257ff<br />
42 Eggert S. 26<br />
4-3 Eggert S. 31.- Be<strong>im</strong> Lkkcka/id i s t deshalb zu bedenken, daß<br />
die Erstauflage für das Debütwerk <strong>Scheffel</strong>s nicht wie üblich<br />
etwa 1000 Exemplare betrug, sondern wegen des zu erwartenden<br />
Reihenabsatzes gleich 10000 Stück. Der angeblich so<br />
schleppende Absatz des Lkke-ka/id (Fetzer S. 28) darf also<br />
nicht an der Zeitspanne bis zur 2. Auflage gemessen werden!<br />
Dazu kommen noch die Streitigkeiten um und mit dem Roman,<br />
der unter die Konkursmasse des <strong>von</strong> Otto Janke übernommenen<br />
Meidingerverlags f i e l und auch <strong>von</strong> da her an einem 'normalen'<br />
Absatz gehindert war (vgl. Eggert S. 4-0).<br />
4-4- Vgl. Müller-Seidel, Literatur und Ideologie<br />
4.5 <strong>Scheffel</strong> <strong>im</strong> Lichte seines 100. Geburtstags S. 21<br />
46 Ebd. S. 31<br />
LI Ebd. S. 119<br />
LS <strong>Scheffel</strong>jahrbuch 1926, S. 6<br />
L9 Ebd. S. SL<br />
50 Köhler-Briefe S. I<br />
51 Ebd. S. I<br />
52 <strong>Scheffel</strong>bund, Bewahrer und Erwecker volks- und stammesverbundenen<br />
Geistes<br />
53 Material dazu: Breitner S. 179ff<br />
5L So Lobe S. 235<br />
VII. DER ILLUSTRIERTE DICHTER<br />
1 Für einen anderen Bereich: vgl. Ott/Walliczek, Bildprogramm<br />
und Textextstruktur; auch: Hess, Allegorie und Historismus<br />
2 Vgl. Realismus und Gründerzeit S. 182ff<br />
3 Börsenblatt des dt. Buchhandels 1883 Nr. L3, S. 801<br />
L Vgl. Hess, Bildersaal des Mittelalters<br />
5 Vgl. Katalog: Photographie <strong>im</strong> 19. Jahrhundert
219<br />
6 Vgl. Selbmann S. 1l6ff<br />
7 Brief an Werner vom 11. März 1869, Werner-Briefe S. 103<br />
8 Brief an Werner vom 16. Februar 1880, ebd. S. 189f<br />
9 Realismus und Gründerzeit S. 183<br />
10 Nachblätter zur J-unipe.n.u.A-Ausgabe, ohne Seitenzählung<br />
11 Börsenblatt 1881 Nr. 270, S. 5311<br />
12 Grenzboten 35. Jahrgang, Nr. 1 (1876), S. 330<br />
13 Börsenblatt 1883 Nr. 259, S. 5028<br />
14 Deutsche Buchhändler-Akademie, 1. Band, 1884, S. 636<br />
15 Ebd. S. 640<br />
16 Vgl. seine Memoiren <strong>von</strong> 1913 mit dem T i t e l "Erlebnisse und<br />
Eindrücke"<br />
17 Jetzt: Oettermann, Panorama S. 204-210<br />
18 Vgl. Hess, Panorama und Denkmal<br />
19 Werner-Briefe S. VII<br />
20 Brief an Werner vom 3. Januar 1865, Werner-Briefe S. 25f<br />
21 Brief an Werner vom 24. Juni 1868, ebd. S. 89<br />
22 <strong>Scheffel</strong> erwähnt nur einmal <strong>im</strong> Rahmenteil seiner Novelle,<br />
daß der Held mit einem "Hilf Sankt Georg!" in die Schlacht<br />
geht (11,11)<br />
23 Brief an Werner vom 28. Februar 1866, Werner-Briefe S. 28<br />
24 Ebd. S. VIII<br />
25 Brief an Werner vom 27. April 1867, ebd. S. 43<br />
26 Vgl. Ein Jahrhundert Hermannsdenkmal 1875 -1975<br />
27 An dessen Sitzungen hat <strong>Scheffel</strong> wohl mehrfach teilgenommen.<br />
Vgl. auch <strong>Scheffel</strong>s Freundschaft mit Paul Heyse und <strong>Scheffel</strong>n<br />
"Krokodil"-Zitat <strong>im</strong> Widmungsgedicht IX,214f<br />
28 Brief an Werner vom 29. August 1867, Werner-Briefe S. 56f<br />
29 Brief an Werner <strong>von</strong> Ostern 1869, ebd. S. 107<br />
30 Brief an Werner vom 9. Januar 1874, ebd. S.138.- Die I.Aufl.<br />
der Be./igp^a<strong>im</strong>zn wird also wohl zum Jahresende 1873 erschienen<br />
sein<br />
31 Vgl. Anton <strong>von</strong> Werner, Erlebnisse und Eindrücke, S. 144<br />
32 Brief an Werner vom 12. Januar 1875, Werner-Briefe S. 141<br />
33 Brief an Werner vom Januar 1881, ebd. S. 192<br />
34 Brief an Werner vom 12. Februar 1884, ebd. S. 206<br />
35 Brief an Werner vom 6. Januar 1874, ebd. S. 138
221<br />
ZEITTAFEL<br />
16. Februar 1826 <strong>Joseph</strong> <strong>Viktor</strong> <strong>Scheffel</strong> als Sohn des Ingenieurs<br />
und Majors Philipp Jakob <strong>Scheffel</strong> und dessen<br />
Ehefrau <strong>Joseph</strong>ine geb. Krederer in Karlsruhe<br />
geboren.<br />
1843<br />
1843/44<br />
1 844/45<br />
1845/46<br />
1846/47<br />
März 1848<br />
1849<br />
Ende 1849<br />
Dezember 1851<br />
Man 18 52<br />
Mai 18 53<br />
Abschluß des Karlsruher Gymnasiums als Pr<strong>im</strong>us.<br />
Zwei Semester Studium der Rechte in München.<br />
Teilnahme am kulturellen und politischen Leben<br />
der Stadt. Erste Alpenwanderungen.<br />
Zwei Semester Studium in Heidelberg. Intensives<br />
Burschenschafts- und Verbindungsleben.<br />
Dazwischen Wanderungen in die Umgebung.<br />
Studium in Berlin. Wanderungen in Thüringen.<br />
Auseinandersetzung mit Philosophie und b i l <br />
dender Kunst. Erste Lieden einet ^ahnenden<br />
Qete l len .<br />
Letzte Studiensemester in Heidelberg. Examensvorbereitungen.<br />
Burschenschaftsleben.<br />
Beteiligung an der liberal-demokratisehen Bewegung.<br />
Zeitweilig Sekretär des Bundestagsgesandten<br />
und Abgeordneten Karl Theodor<br />
Welcker. Mit Welcker Teilnahme am Frankfurter<br />
Vorparlament und an der Nationalversammlung.<br />
Reisen mit Welcker nach Lauenburg und Wien,<br />
die jedoch erfolglos enden. Staatsexamen in<br />
Karlsruhe. Enttäuschung über das Scheitern<br />
der Nationalversammlung.<br />
Promotion. Praktikum am Heidelberger Oberamt.<br />
Beteiligung als Bürgerwehrmann be<strong>im</strong> Ausbruch<br />
der Revolution. Wanderungen nach Oberitalien<br />
und in den Schwarzwald.<br />
Assessorenstelle"am Bezirksamt in"Säckingen.<br />
Säckingen. E p ittetn und der Aufsatz Aua dem<br />
HauenaI e in ei Sckwanzwa Id . Wanderungen nach<br />
Graubünden und Tirol.<br />
Sekretär be<strong>im</strong> Hofgericht in Bruchsal.<br />
Urlaub. Reise nach Italien zur Ausbildung als<br />
Maler. Florenz, Pisa. Längerer Aufenthalt in<br />
Rom. Mal- und Zeichenunterricht. Mit der<br />
deutschen Künstlerkolonie in den Albaner<br />
Bergen. Reise über Rom, Neapel, Capri, Sorrent.<br />
Zweifel am Malerberuf. Dort Beginn der l i t e <br />
rarischen Tätigkeit, den Inompeten <strong>von</strong> Säkkingen.<br />
Einige Lieder, die später in den Gaudeamus<br />
aufgenommen wurden.<br />
He<strong>im</strong>kehr. Gescheiterte LiebesbeZiehungen. Vergebliche<br />
Werbung um seine Kusine Emma He<strong>im</strong>.<br />
Entschluß, Privatdozent werden zu wollen.
222<br />
Weihnachten 1853 Veröffentlichung des 7/iompete/i. Beginn mit<br />
Quellen- und Archivstudien zur mittelalterlichen<br />
Geschichte.<br />
März 1854<br />
Frühjahr 1855<br />
Mai 1855<br />
Winter 1855/56<br />
1857<br />
Oktober 1856<br />
Oktober 1857<br />
März 1859<br />
Mai 1860<br />
März 1861<br />
J u l i 1863<br />
Beginn des Ekkehard. Studienaufenthalt in<br />
St. Gallen, <strong>im</strong> Hegau und auf dem Hohentwiel.<br />
Bewerbung um die Professur für Deutsche Literatur<br />
am Eidgenössischen Polytechnikum in<br />
Zürich. Vergeblich, die Stelle erhält F.T.<br />
Vischer.<br />
Veröffentlichung des Ekkehard. Plan für einen<br />
historischen Roman Irene <strong>von</strong> Spit<strong>im</strong>berg, angeregt<br />
durch die Freundschaft mit dem Maler<br />
Anselm Feuerbach.<br />
Mit Feuerbach Venedigreise und Bibliotheksstudien.<br />
Fluchtartige Reise wegen Choleraausbruch<br />
ins Kastell Toblino in Südtirol.<br />
Kränkelnd - und depressiv in Karlsruhe. Veröffentlichung<br />
des Reisetagebuchs als Qedenkbuch<br />
üben, stattgehabte Einlagerung auf Kasteit<br />
Jobtino. Kopf- und Augenleiden. Reise nach<br />
Südfrankreich.<br />
Veröffentlichung der Reiseeindrücke als Reisebild<br />
Ein lag am Quett de/i Vaucluse. Fieberanfall.<br />
Kur in Bad Rippoldsau. Kontakte zum<br />
Münchner Dichterkreis. Aussicht auf eine<br />
Stelle in München.<br />
Umzug nach München. Die nachgereiste Schwester<br />
Marie stirbt kurz nach ihrer Ankunft an Typhus.<br />
Depressionen und Selbstvorwürfe. Reise nach<br />
Paris und in die Normandie.<br />
Bibliothekar an der fürstlichen Hofbibliothek<br />
<strong>von</strong> Fürstenberg in Donaueschingen. Katalogisierung<br />
der Bestände. Druck des Katalogs.<br />
Beginn der Novelle Juniperus.<br />
Ausscheiden aus dem Bibliotheksdienst. Studienwanderfahrten.<br />
Auftrag des Großherzogs <strong>von</strong><br />
Sachsen-We<strong>im</strong>ar-Eisenach, einen Wartburgroman<br />
zu schreiben. Besuch und Aufenthalt auf der<br />
Wartburg. Aufenthalt <strong>im</strong> Chiemgau und auf<br />
Frauenchiemsee. Zahlreiche Gedichte entstehen.<br />
Reise ins Salzkammergut und durch die Alpen.<br />
Vollendung des Wartburgromans erweist sich als<br />
unmöglich. Gehirnentzündung. Aufenthalt in<br />
der Schweizer Heilanstalt Brestenberg. Gedichte<br />
für die Sammlung 7 tau Avent iure.<br />
Genesung. Reisen an den Niederrhein und in<br />
die Schweiz. Depressive St<strong>im</strong>mung.<br />
Vollendung der 7/tau Aventiure . Aufenthalt<br />
in Pienzenau <strong>im</strong> Mangfalltal (Oberbayern). Von<br />
dort aus Oberland- und Alpenwanderungen mit<br />
Ludwig Steub.
223<br />
Winter 1863/64<br />
August 1864<br />
Februar 1865<br />
Sommer 1866<br />
Mai 1867<br />
Januar 1 869<br />
1872<br />
1876<br />
1878<br />
seit 1881<br />
1886<br />
Werbung um die bayerische<br />
Caroline <strong>von</strong> Malsen.<br />
Diplomatentochter<br />
Heirat. Hochzeitsreise nach Oberitalien.<br />
Aufenthalt in Seon.<br />
Tod der Mutter. Wanderungen.<br />
Scheitern der Ehe, Trennung.<br />
Sohn Victor geboren. Veröffentlichung der<br />
Liedersammlung Qau.de.amu.4.<br />
Tod des Vaters. Entführung des eigenen Sohnes<br />
<strong>von</strong> München nach Karlsruhe. Beginn der Zusammenarbeit<br />
und Freundschaft mit Anton <strong>von</strong><br />
Werner. Veröffentlichung der Novelle J.un Lpe/tu*,<br />
9. April 1886 Tod in Karlsruhe<br />
Ankauf eines Grundstücks in Radolfzell für<br />
den Bau des Landsitzes "Seehalde"<br />
Ankauf der Halbinsel Mettnau und des Mettnauschlößchens.<br />
Zahlreiche Ehrungen zum 50. Geburtstag.<br />
Persönlicher und erblicher Adel.<br />
Veröffentlichung der Waldeinsamkeit,<br />
Weitergehender Rückzug aus dem öffentlichen<br />
Leben. Landwirt und Gutsbesitzer.<br />
Feier des 60. Geburtstags in Heidelberg. Versöhnung<br />
mit der Gattin.
225<br />
LITERATURVERZEICHNIS<br />
1. Zur Problemstellung<br />
Hartmut"Eggert: Studien zur Wirkungsgeschichte des deutschen<br />
historischen Romans 1850 - 1875. Frankfurt 1971. (=Studien<br />
zur Philosophie und Literatur des neunzehnten Jahrhunderts<br />
Band 14).<br />
Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen<br />
zu einer Kategorie der <strong>bürgerlichen</strong> Gesellschaft.<br />
5. Aufl. Neuwied 1971 .<br />
Hans J. Haferkorn: Zur Entstehung der bürgerlich-literarischen<br />
Intelligenz und des Schriftstellers <strong>im</strong> Deutschland zwischen<br />
1750 und 1800, in: Literaturwissenschaft und Sozialwissenschaften<br />
3: Deutsches Bürgertum und literarische Intelligenz<br />
1750 - 1800. Stuttgart 1974. S. 113-275.<br />
Günter Hess: Allegorie und Historismus. Zum 1 Bildgedächtnis'<br />
des späten 19. Jahrhunderts, in: Verbum et Signum. 1. Band.<br />
Beiträge zur mediävistischen Bedeutungsforschung, Hrsg. <strong>von</strong><br />
Hans Fromm, Wolfgang Harms, Uwe Ruberg. München 1975. S. 555-<br />
591 .<br />
Ders.: Panorama und Denkmal. Erinnerung als Denkform zwischen<br />
Vormärz und Gründerzeit, in: Literatur in der sozialen Bewegung.<br />
Aufsätze und Forschungsberichte zum 19. Jahrhundert.<br />
Hrsg. <strong>von</strong> Alberto Martino. Tübingen 1977. S. 130-206.<br />
Ders.: Bildersaal des Mittelalters. Zur Typologie i l l u s t r i e r t e r<br />
Literaturgeschichte <strong>im</strong> 19. Jahrhundert, in: Deutsche Literatur<br />
<strong>im</strong> Mittelalter. Kontakte und Perspektiven. Hugo Kuhn zum<br />
Gedächtnis. Hrsg. <strong>von</strong> Christoph Cormeau. Stuttgart 1979.<br />
S. 500-546.<br />
Paul Heyse. Münchner Dichterfürst <strong>im</strong> <strong>bürgerlichen</strong> <strong>Zeitalter</strong>.<br />
Katalog der Ausstellung der Bayer. Staatsbibliothek 1981.<br />
München 1981.<br />
V/alter Hinck: Epigonendichtung und National idee. Zur Lyrik<br />
Emanuel Geibels, in: ZfdPh 85 (1966). S.267-284.<br />
Wolfgang Iser/Fritz Schalk (Hrsg.): Dargestellte Geschichte in<br />
der europäischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Frankfurt<br />
1971. (=Studien zur Philosophie und Literatur des neunzehnten<br />
Jahrhunderts Band 7).<br />
Ein Jahrhundert Hermannsdenkmal 1875 -1975. Hrsg. <strong>von</strong> Günther<br />
Engelbert. Detmold 1975. i=Sonderveröffentlichungen des naturwissenschaftlichen<br />
und historischen Vereins für das Land Lippe<br />
Band 23).<br />
Hans Robert Jauß: Literaturgeschichte als Provokation. 2.Aufl.<br />
Frankfurt 1970.<br />
Michael Krausnik: Paul Heyse und der Münchener Dichterkreis.<br />
Bonn 1974. (-Abhandlungen zur Kunst-, Musik- und Literaturwissenschaft<br />
Band 165).
226<br />
Eberhard Lämmert: Der Dichterfürst, in: Dichtung, Sprache,<br />
Gesellschaft. Akten des IV. Internationalen Germanistenkongresses<br />
1970 in Princeton. Hrsg. <strong>von</strong> Victor Lange und Hanns-<br />
Gert Roloff. Frankfurt 1971. (=Beihefte zum Jahrbuch für<br />
Int. Germanistik 1). S. 439-455.<br />
Fritz Martini: Deutsche Literatur <strong>im</strong> <strong>bürgerlichen</strong> Realismus<br />
1848 - 1898. 2., durchges. Aufl. Stuttgart 1964.<br />
Richard M. Meyer: Die deutsche Literatur des Neunzehnten Jahrhunderts.<br />
Berlin 1912.<br />
Walter Müller-Seidel: Theodor Fontane. Soziale Romankunst in<br />
Deutschland. Stuttgart 1975.<br />
Ders.: Literatur und Ideologie. Zur Situation des deutschen<br />
Romans um 1900, in: Dichtung, Sprache, Gesellschaft (s. unter<br />
Lämmert). S. 593-601.<br />
Stephan Oettermann: Das Panorama. Die Geschichte eines Massenmediums.<br />
Frankfurt 1980.<br />
Norbert H. Ott/Wolfgang Walliczek: Bildprogramm und Textstruktur.<br />
Anmerkungen zu den 1 Iwein ? -Zyklen auf Rodeneck und in<br />
Schmalkalden, in: Deutsche Literatur <strong>im</strong> Mittelalter (s. unter<br />
Hess). S. 473-500.<br />
"In unnabhahmlicher Treue". Photographie <strong>im</strong> 19. Jahrhundert -<br />
ihre Geschichte in den deutschsprachigen Ländern. Ausstellungskatalog<br />
Köln 1979.<br />
Wolfgang Preisendanz: Humor als dichterische Einbildungskraft.<br />
Studien zur Erzählunst des poetischen Realismus. München 1963.<br />
(=Theorie und Geschichte der Literatur und der schönen Künste<br />
Band 1).<br />
Realismus und Gründerzeit. Hrsg. <strong>von</strong> Max Bucher u. a. Band 1.<br />
Stuttgart 1976.<br />
Wolfgang Schivelbusch: Geschichte der Eisenbahnreise. Zur<br />
Industrialisierung <strong>von</strong> Raum und Zeit <strong>im</strong> 19. Jahrhundert. Frankfurt,<br />
Berlin, Wien 1979 (=Ullstein-Materialien Anthropologie).<br />
Heinz Schlaffer: Das Dichtergedicht <strong>im</strong> 19. Jahrhundert. Topos<br />
und Ideologie, in: Jahrbuch d. dt. Schiller-Gesellschaft 10<br />
(1966). S. 297-335.<br />
Klaus Schreiner: Die Staufer in Sage, Legende und Prophetie, in":<br />
Die Zeit der Staufer III. Ausstellungskatalog Stuttgart 1977.<br />
S. 249-262.<br />
Rolf Selbmann: Theater <strong>im</strong> Roman. Studien zum Strukturwandel des<br />
deutschen Bildungsromans. München 1981. ( = Münchner Universitätssehriften<br />
23).<br />
Friedrich Sengle: Biedermeierzeit. Deutsche Literatur <strong>im</strong><br />
Spannungsfeld zwischen Restauration und Revolution 1815 - 1848.<br />
Band I bis III. Stuttgart 1971-1980.<br />
Hartmut Steinecke: Romantheorie und Romankritik in Deutschland.<br />
Die Entwicklung des Gattungsverständnisses <strong>von</strong> der Scott-<br />
Rezeption bis zum programmatischen Realismus. Band 1. Stuttgart<br />
1975.<br />
Karl Wild: Karl Theodor Welcker, ein Vorkämpfer des älteren<br />
Liberalismus. Heidelberg 1913.
227<br />
Manfred Windfuhr: Der Epigone. Begriff, Phänomen und Bewußtsein,<br />
in: Archiv f. Begriffsgeschichte 4 (1959). S. 182-209.<br />
2. Ausgaben und Briefe<br />
<strong>Joseph</strong> Victor <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>s Werke. Hrsg. <strong>von</strong> Johannes Franke.<br />
10 Bände. Leipzig (1917).<br />
Irene <strong>von</strong> Spil<strong>im</strong>berg. Unvollendeter Roman <strong>von</strong> Josef <strong>Viktor</strong> <strong>von</strong><br />
<strong>Scheffel</strong>. Für den Deutschen <strong>Scheffel</strong>bund aus dem Nachlaß des<br />
Dichters hrsg. und eingel. <strong>von</strong> Friedrich Panzer. Karlsruhe 1930.<br />
<strong>Scheffel</strong>s Wartburgroman. I.Teil: Wartburggeschichten. Für den<br />
Deutschen <strong>Scheffel</strong>bund aus dem Nachlaß des Dichters hrsg. <strong>von</strong><br />
Friedrich Panzer. Karlsruhe 1937.<br />
Juniperus. Geschichte eines Kreuzfahrers erzählt <strong>von</strong> J.V.<br />
<strong>Scheffel</strong>, i l l u s t r . v. A. v. Werner. Stuttgart 1867.<br />
Gaudeamus! Lieder aus dem Engern und Weitern <strong>von</strong> <strong>Joseph</strong> Victor<br />
<strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>. Mitt 111 Holzschnitt-Illustrationen u. Vignetten<br />
und einem Titelbild in Tondruck <strong>von</strong> Anton <strong>von</strong> Werner. 2., verm<br />
Aufl. Stuttgart 1877.<br />
Der Trompeter <strong>von</strong> Säkkingen. Ein Sang vom Oberrhein <strong>von</strong> <strong>Joseph</strong><br />
Victor <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>. I l l u s t r i r t <strong>von</strong> Anton <strong>von</strong> Werner. 2. Aufl.<br />
Stuttgart 1879.<br />
Bilder zu <strong>Scheffel</strong>'s Ekkehard <strong>von</strong> J.Benczur u. a. München o.<br />
J. (1879).<br />
Festschrift zum Jubiläum der Universität Heidelberg <strong>von</strong> <strong>Joseph</strong><br />
Victor <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>. Mit einer Illustration <strong>von</strong> Anton <strong>von</strong><br />
Werner. Stuttgart 1886.<br />
Elternhaus-Briefe: <strong>Joseph</strong> Victor <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>. Briefe ins<br />
Elternhaus 1843 - 1849/ Im Auftr. d. Dt. <strong>Scheffel</strong>bundes eingel.<br />
u. hrsg. v. Wilhelm Zentner. Karlsruhe 1926.<br />
Säckin.^en-Briefe: <strong>Scheffel</strong> in Säckingen. Briefe ins Elternhaus<br />
1850 - 1851. Im Auftr. d. Dt. <strong>Scheffel</strong>bundes eingel. u.<br />
hrsg. v. Wilhelm Zentner. Karlsruhe 1927.<br />
Italien-Briefe: <strong>Scheffel</strong> in Italien. Briefe ins Elternhaus<br />
1852 -1853. Im Auftr. d. Dt. <strong>Scheffel</strong>bundes eingel. u. hrsg.<br />
v. Wilhelm Zentner. Karlsruhe 1929.<br />
Trompeter/Ekkehard-Briefe: Vom Trompeter zum Ekkehard. <strong>Scheffel</strong>s^<br />
Briefe ins Elternhaus 1853/55. Im Auftr. d. Dt. <strong>Scheffel</strong>bundes<br />
eingel. u. hrsg. v. Wilhelm Zentner. Karlsruhe 1934.<br />
Mein-Glück-Briefe: "Mein Glück w i l l mir nicht glücken". <strong>Scheffel</strong>s<br />
Briefe ins Elternhaus 1856/57. Für d. Dt. <strong>Scheffel</strong>bund <strong>im</strong><br />
Reichswerk Buch und Volk eingel. u. hrsg. v. Wilhelm Zentner.<br />
Karlsruhe 1939.<br />
Pflicht/Neigung-Briefe: Zwischen Pflicht und Neigung. <strong>Scheffel</strong><br />
in Donaueschingen. Briefe ins Elternhaus 1857/59. Für den<br />
Volksbund f. Dichtung vorm. <strong>Scheffel</strong>bund eingel. u. hrsg. v.<br />
Wilhelm Zentner. Karlsruhe 1946.
228<br />
Wandern/Weilen-Briefe: Wandern und Weilen. <strong>Scheffel</strong>s Briefe ins<br />
Elternhaus 1860 - 1864-. Hrsg. u. e r l . v. Wilhelm Zentner. Karlsruhe<br />
1951.<br />
Köhler-Briefe: Vom jungen <strong>Scheffel</strong>. Briefe an seinen Studienfreund<br />
Rudolf Köhler. Mit einer Einführung v. Theodor Hampe.<br />
We<strong>im</strong>ar 1926.<br />
Eggers-Briefe: Eine Studienfreundschaft. <strong>Scheffel</strong>s Briefe an<br />
Friedrich Eggers 1844/1849. Im Auftr. d. Dt. <strong>Scheffel</strong>bundes<br />
eingel. u. hrsg. v. Dr. Gerda Rüge. Karlsruhe 1936.<br />
Erismann-Briefe: Briefe J. V. v. <strong>Scheffel</strong>s an Dr. A. Erismann<br />
in Brestenberg. Mit 4 Bildern hrsg. v. R. Bosch. Aarau 1926.<br />
Schwanitz-Briefe: Josef Victor v. <strong>Scheffel</strong>s Briefe an Karl<br />
Schwanitz. (Nebst Briefen der Mutter <strong>Scheffel</strong>s.) (1845 - 1886).<br />
Leipzig 1906.<br />
Briefe J. V. v. <strong>Scheffel</strong>s an Schweizer Freunde. Mit Porträt<br />
<strong>Scheffel</strong>s <strong>im</strong> Lichtdruck hrsg. v. Adolf Frey. Zürich 1898.<br />
Großherzog-Briefe: Briefwechsel zwischen <strong>Joseph</strong> <strong>Viktor</strong> <strong>von</strong><br />
<strong>Scheffel</strong> und Carl Alexander, Großherzog <strong>von</strong> Sachsen-We<strong>im</strong>ar-<br />
Eisenach. Im Auftr. d. Dt. <strong>Scheffel</strong>bundes hrsg. v. Conrad<br />
Höfer. Karlsruhe 1928.<br />
Heyse-Briefe: Briefwechsel zwischen <strong>Joseph</strong> <strong>Viktor</strong> <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong><br />
und Paul Heyse. Für d. Dt. <strong>Scheffel</strong>bund hrsg. v. Conrad Höfer.<br />
Karlsruhe 1932.<br />
Müller-Briefe: Otto Müller: <strong>Joseph</strong> <strong>Viktor</strong> v. <strong>Scheffel</strong> und Otto<br />
Müller 1854 - 1861, in: PMLA 53 Nr. 2 (1938). S. 519-544.<br />
Werner-Briefe: Briefe <strong>von</strong> Josef Victor <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> an Anton<br />
<strong>von</strong> Werner 1863 - 1886. Mit Anmerkungen vers. u. hrsg. v. d.<br />
Empfänger. Stuttgart 1915.<br />
3. Ausgewählte Rezensionen<br />
(Julius Braun:) Literaturbilder der Gegenwart X: <strong>Joseph</strong> Victor<br />
<strong>Scheffel</strong>, in: Münchener Propyläen, I. Jahrgang Nr. 52 (1869).<br />
S. 1225-1228.<br />
Theodor Fontane: <strong>Joseph</strong> <strong>Viktor</strong> <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>: Ekkehard, in:<br />
Literarische Essays und Studien. 1. Teil. München o. J.<br />
(-sämtliche Werke Band XXI/1). S. 250-252.<br />
J. B...s, in: Frankfurter Museum Nr. 23, II. Jahrgang vom<br />
7. Juni 1856. S. 180-182.<br />
Gustav Freytag an Salomon Hirzel und die Seinen. Mit einer<br />
Einleitung <strong>von</strong> Alfred Dove. Als Handschrift für Freunde gedruckt.<br />
0. 0. 0. J. S. 52f.<br />
Karl Gutzkow: Der Trompeter <strong>von</strong> Säckingen, in: Unterhaltunger.<br />
am häuslichen Herd. Dritter Band Nr. 9(1855). S. 144.<br />
Ders.: Zur Gymnasialreform, in: Deutsche Revue, Jahrgang II,<br />
Heft 4 (Januar 1 878 ). S. 134-140.<br />
Wolfgang Menzels Literaturblatt Nr. 30 vom 15. Aoril 1854.<br />
S. 117f.
229<br />
Dass. Nr. 71 vom 5. September 1855. S. 281-283.<br />
Dass. Nr. 86 vom 26. Oktober 1864. • S. 341-343.<br />
Morgenblatt für gebildete Leser Nr. 45 vom 4. November 1855.<br />
S. 1073-1076.<br />
Konrad Alberti: Der Lieblingsdichter des neuen Deutschland, in:<br />
Schorers Familienblatt, 7. Band (1886). S. 269-271.<br />
4. Bibliographien<br />
Anton Breitner: <strong>Joseph</strong> <strong>Viktor</strong> <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> und seine Literatur.<br />
Prodromos einer <strong>Scheffel</strong>-Bibliographie. Bayreuth 1912.<br />
Ernst Carlebach: <strong>Joseph</strong> Victor v. <strong>Scheffel</strong>. Erstausgaben -<br />
<strong>Scheffel</strong>literatur. Zu seinem 100. Geburtstag am 16. Februar<br />
1926. Antiquarisches Verzeichnis Nr. 341. Heidelberg 1926.<br />
5. Erinnerungen und andere Quellen<br />
Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel 1881, Nr. 270. S. 5311<br />
Dass. 1883, Nr. 43. S. 801<br />
Dass. 1883, Nr. 259. S. 5028<br />
Rosalie Braun-Artaria: Von berühmten Zeitgenossen. Lebenserinnerungen<br />
einer Siebzigerin. 3., unv. Aufl. München 1918.<br />
Deutsche Buchhändler-Akademie, 1. Band. We<strong>im</strong>ar 1884. S. 636<br />
R. Falck: Die Gesellschaft des Heidelberger "Engeren". Nach<br />
Privatmitteilungen <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> und seinen Freunden. Berlin<br />
1 880.<br />
Die Grenzboten, 35. Jahrgang, Nr. 1 (1876). S. 330.<br />
Louise <strong>von</strong> Kobell: Josef Victor <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> und seine Familie.<br />
Nach Briefen und mündlichen Mittheilungen. Schwetzingen-Heidelberg<br />
und Wien 1901.<br />
Gerhart Herrmann Mostar: Friederike Kempner, der schlesische<br />
Schwan. Das Genie der unfreiwilligen Komik. 5. Aufl. München<br />
1972. (=dtv 292).<br />
W.H.Riehl: Eine Rheinfahrt mit <strong>Viktor</strong> <strong>Scheffel</strong>, in: ders.:<br />
Kulturgeschichtliche Charakterköpfe. Aus der Erinnerung gezeichnet.<br />
2. Aufl. Stuttgart 1892. S. 207-236.<br />
H. Stork senior: Der Angelsport. Das Wissenswerteste aus demselben<br />
nebst Anleitungen zum Gebrauch der Angelgeräte sowie<br />
Beschreibungen der verschiedensten Angelmethoden besonders<br />
der Flugangel, der Grundangel, der Spinnangel und der Schleppangel.<br />
Als Anhang: Angler-Fahrten. Dr. Victor <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> als<br />
Angler. Im Selbstverlage des Verfassers. München 1898.<br />
Anton <strong>von</strong> Werner: Erlebnisse und Eindrücke 1870 - 1890. Berl<br />
i n 1913.<br />
Gebhard Zernin: Erinnerungen an Dr. Josef Victor <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>.<br />
Erlebtes und Erfahrenes. 2. verb. Aufl. Darmstadt/Leipzig 1887.
230<br />
6. <strong>Scheffel</strong>-Literatur<br />
Ernst Boerschel: Josef <strong>Viktor</strong> <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> und Emma He<strong>im</strong>. Eine<br />
Dichterliebe. Mit Briefen u. Erinnerungen. Berlin 1906.<br />
Hermann Bürkle: <strong>Joseph</strong> Victor <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> als Politiker (1826-<br />
1886). Diss. Frankfurt 1925.<br />
Lotte Bus: Die Geschichte <strong>im</strong> Erzählwerk <strong>Joseph</strong> <strong>Viktor</strong> <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>s.<br />
Diss. masch. München 1944.<br />
Günther Fetzer: Der verzögerte Erfolg. <strong>Joseph</strong> Victor <strong>von</strong> Scheff<br />
e l und sein Publikum, in: Badische He<strong>im</strong>at 1976, Heft 1. S. 27-<br />
35.<br />
Werner Kremser: Studien über <strong>Joseph</strong> <strong>Viktor</strong> <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>. Aus<br />
dem bisher unerschlossenen Nachlaß des Dichters. Salzburg 1913.<br />
Manfred Lechner: <strong>Joseph</strong> Victor <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>. Eine Analyse seines<br />
Werks und seines Publikums. Diss. München 1962.<br />
Ingrid Leitner: Angewandte Geschichte. Untersuchung zu <strong>Scheffel</strong>s<br />
Archaismen. Mag.-Arb. (ungedr.) München 1973.<br />
Jochen Lobe: <strong>Viktor</strong> <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>, eine fränkische Fehlanzeige,<br />
in: Poetisches Franken hrsg. v. Wolfgang Buhl. Würzburg 1971.<br />
S. 235-260.<br />
P.J.Möbius: Uber <strong>Scheffel</strong>s Krankheit. Halle 1907.<br />
S.G.Mulert: <strong>Scheffel</strong>s Ekkehard als historischer Roman. Ästhetisch-kritische<br />
Studie. Münster 1909.<br />
Friedrich Panzer: <strong>Scheffel</strong>s Romanentwurf "Irene <strong>von</strong> Spil<strong>im</strong>berg",<br />
in: Sitzungsberichte d. Heidelberger Akademie d. Wiss. phil.-<br />
hist. Kl., Jahrgang 1930/31. 6. Abhandlung.<br />
Heinrich <strong>von</strong> Poschinger: Fürst Bismarck und <strong>Viktor</strong> v. <strong>Scheffel</strong>,<br />
in: Deutsche Revue XXVI (2), Mai 1901. S. 202-205.<br />
Johannes Proelß: <strong>Scheffel</strong>s Leben und Dichten. Berlin S. 1887.<br />
Gerda Rüge: <strong>Scheffel</strong>s Frau Aventiure, in: Neue Heidelberger<br />
Jahrbücher 1935. S. 6-126.<br />
Alfred Ruhemann: <strong>Joseph</strong> <strong>Viktor</strong> <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong>. Sein Leben und<br />
Dichten. Stuttgart 1887.<br />
Edmund <strong>von</strong> Sallwürck: Jos. <strong>Viktor</strong> v. <strong>Scheffel</strong>. (Leipzig 1920).<br />
<strong>Joseph</strong> Stöckle: Ich fahr' in die Welt. <strong>Joseph</strong> Victor <strong>von</strong> Scheff<br />
e l , der Dibhter des fröhlichen Wanderns und harmlosen Genießens.<br />
Paderborn 1888.<br />
7. Sonstige Schriften<br />
Nicht rasten und nicht rosten! Jahrbücher des <strong>Scheffel</strong>bundes.<br />
1891, 1892/93, 1894, 1895, 1896, 1898, 1899, 1900, 1902, 1903,<br />
1904, 1906.<br />
<strong>Scheffel</strong>. Jahrbuch des Deutschen <strong>Scheffel</strong>bundes. Der Jahrbücher<br />
des <strong>Scheffel</strong>bundes neue Folge. Band 1. Hrsg. v. Börries Frhr.<br />
v. Münchhausen. Karlsruhe 1926.
231<br />
<strong>Joseph</strong> Victor <strong>von</strong> <strong>Scheffel</strong> <strong>im</strong> Lichte seines hundertsten Geburtstages.<br />
Eine Huldigung deutscher Dichter und Schriftsteller.<br />
Hrsg. vom <strong>Scheffel</strong>-Museum in Mattsee-Salzburg. 1. u. 2. Aufl.<br />
Stuttgart 1926.<br />
Der Deutsche <strong>Scheffel</strong>bund. Bewahrer und Erwecker volks- und<br />
stammesverbundenen Geistes, ein Wegbereiter junger deutscher<br />
Dichtung. 0. 0. 1932.
233<br />
ABBILDUNGEN<br />
Abb. Nr. zu Seite:<br />
1 Titelblatt zu Junipe/ius 171<br />
2 Vorwort 172<br />
3 Erzählbeg i nn 175<br />
4 Das Strom - Ordal 176<br />
5 Anmerkung en 177<br />
6 Titelblatt zu Qaudeamus 178<br />
7 Widmung 180<br />
8 Culturgeschichtlich 181<br />
9 Die Lieder vom Rodenstein 181<br />
10 Der Ichthyosaurus 182<br />
11 Hermannsdenkmal 182<br />
12 Wanderlied 183<br />
13 Festlied zur Gründungsfeier der<br />
Universität Straßburg 183<br />
U Festlied auf Hebels 100. Geburtstag 184<br />
15 Titelblatt zu Den. 7 n.ompe.te./i <strong>von</strong> Säkkingen 185<br />
16 1 . B ild: Jung-Werner <strong>im</strong> Wald 187<br />
17 2. Bild: Jung-Werner be<strong>im</strong> Pfarrherrn 188<br />
18 3. Bild: Jung-Werner und Margareta 188<br />
19 5. Bild: Jung-Werner be<strong>im</strong> Freiherrn 189<br />
20 6. Bild: Mailied 189<br />
21 7. Bild: Festkonzert 189<br />
22 8. Bild: Jung-Werner und Margareta in<br />
der Laube 191<br />
23 9. Bild: Volksaufstand 192<br />
24 11 . Bild: Jung-Werner verwundet 192<br />
25 12. Bild: Liebesszene 193<br />
26 13. Bild: Die Werbung 193<br />
27 Büchlein der Lieder 194<br />
28 Lieder des s t i l l e n Mannes 194<br />
29 16. Bild: Jung-Werner und Margareta be<strong>im</strong> Papst 194<br />
30 Schlußvignette: Jung-Werners Trompete 195<br />
31 Grabstein Werner Kirchhofers 195<br />
32 Jubiläum der Universität Heidelberg 198
Abbildung 1 235
236 Abbildung 2<br />
ivn mit lii111>?l<strong>im</strong>f11iit>cr 3i1)öiil)i*il roid) i\cfoi^nctcii 'KV<br />
IUVUMI ^v••:• »ui, in tvtkit biiit^'iu^tiiMitcn ^afnlt<br />
{\\V\ku Mo (ilkiiicn /"N-inuMjmvKl^r tvr iKliuiihtjcu Vllpon<br />
liaiilHiidiiii<strong>im</strong>oiii,<br />
-Wichum, wo ^cl Ijoljo 'Kantvit<br />
iiitu-ii-tl)liil)c Awiitnuivu ii^di £t1)iiiff)din\ii Ij<strong>im</strong>üMoiilt, uwo<br />
ivi iiluii U'n ilioltHhuo r, ivmi fouittoidK •WtKl'ciicn<br />
ciitft ivu ^olvii iiiio-> w\i ( N 'niipl)iHii liiiD Vliiinioiiitcii<br />
I>I11 iin111clICH llnium-:- hilivkn, JUMUIKU IHM tmuini<br />
inuüiiniiti'u «*ltiII• vin De-:* r dmmy\nu\ 1 tV'-> I111r» i>cit<br />
iiui!ui>\UiitKi! .^olivii^iu^'ii CUT nu*if;cn x\ural»criK, in<br />
Den ^ tiiMiiiV'lüi'U'ii ivr jiniivuihiiicIlcuiVii To ihm, tvv<br />
n'iihii utr.it) üito (Saiiilunl) niiD tv-> au-> tvn
Abbildung 3 237<br />
u füljler Wartenueranba be* ÄÜo--<br />
ftcrv auf ^era, Marmel fafjeu<br />
<strong>im</strong> >l)re be* Wrn eilf()uubert<br />
uub ueuu^ia, etlidje beutfdje<br />
AUou^faljvov vittevlidjeit 3tan--<br />
bes an* bom .s>eere, bas ^aubcuaf<br />
^nbroia, bcv ^lilbc Don<br />
£i)üviiia,eii bom iirofjeu fdnuerfällia,<br />
-uub eiu()er}iel)enben ^ilßevijeer feine*<br />
C he<strong>im</strong>s be* Ataifer jyriebrid) «Notl)bart N norauseileub,<br />
wn ^ruubufium über 'Dieer uor|>tolemais s flefüfyrt<br />
hatte. W bem legten grofjen 9)iauerftuvin vevunmbet<br />
waren fie }u pflege uub JOeiluua, au* bem Vager uad)<br />
be* Marmel n>o()lbefeftia,ter litftfvifdjev (vinfamfeit iun--<br />
bvadjt roovben. (viu Jeber trug feilt Seiitjcidjen<br />
<strong>von</strong> fauleniid)em (tteroaffen ober ^aubaefdjofj aned)ifd)eu<br />
ivener* am Körper. Ivolj ungeheurer ?tnftrenauna,<br />
irar jener 2türm am 8onuabeub uad) bem<br />
jyefte CUjrifti Jöunmelfafjrt ein fieglofer geblieben.<br />
Unter beu tljüringifdje«, rl;eiulänbifd)en unb<br />
i
238 Abbildung 4
Abbildung 5
240 Abbildung 6
Abbildung 7<br />
•
242<br />
Abbildung 8
Abbildung 9
244 Abbildung 10
Abbildung 11 245
248 Abbildung 14<br />
..?ht \>iiniHtfl luoiit mit* ficdjt bc 'J.Korgciiovn<br />
..^\u ftdvdnciu ( S >1 an^ uub idticr u<strong>im</strong>ieiljia, juntlc:<br />
,/3o ijdjv c 8d)i. er diiuuit au n-> 'ro Öciindb . .<br />
i)M) nii Taiil! . . Ter A.vbel feignet eud)! . ."<br />
. . 8o ijd) mi<br />
v<br />
Md)t, iljv liebi \.Vvc i'-sduH'k.<br />
t'tfnb* ovbli<br />
d)nallo!<br />
v<br />
|MJ[ uub paff uub puff!<br />
Uub iio'nciuol! . . UHMUIO Wliivli an ucviuiiiuit,<br />
(*« jdjaM uiit:<br />
Tor<br />
N<br />
AK eilt er v» c b c l Ijod)!<br />
Uub ()od) fi vwinietl), > allemauund) VanM
Abbildung 15
Abbildung 19<br />
2 5 3
256<br />
Abbildung 22
Abbildung 27 261
Abbildung 28<br />
•Aus K'r^r^nvuuilctu-Aylilc<br />
infam iruinMe oeiue Bahnen,<br />
Stillos l^cvy uiio iiiiperyiat!<br />
Piel erfeunen, Mieles ahnen<br />
!l>ir)t Ou, IPUS Dir Keiner üiat.<br />
!Po in ftiirmifdiem
Abbildung 29
264 Abbildung 30<br />
^ V ^ .... • .v .v. ^ ^ -V .\» ^ •<br />