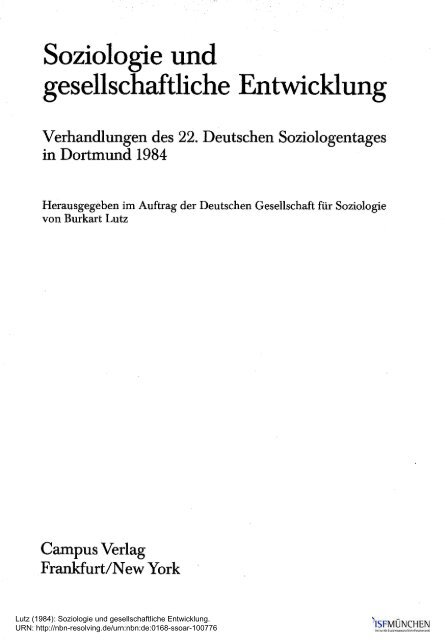soziologie und gesellschaftliche entwicklung (35 mb) - ISF München
soziologie und gesellschaftliche entwicklung (35 mb) - ISF München
soziologie und gesellschaftliche entwicklung (35 mb) - ISF München
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Soziologie <strong>und</strong><br />
<strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung<br />
Verhandlungen des 22. Deutschen Soziologentages<br />
in Dortm<strong>und</strong> 1984<br />
Herausgegeben im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Soziologie<br />
von Burkart Lutz<br />
Campus Verlag<br />
Frankfurt/New York<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung<br />
!<br />
1<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek<br />
Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung :<br />
Verhandlungen d. 22. Dt. Soziologentages in<br />
Dortm<strong>und</strong> 1984 / hrsg. im Auftr. d. Dt. Ges. für<br />
Soziologie von Burkart Lutz. - Frankfurt/Main ;<br />
New York : Campus Verlag, 1985.<br />
ISBN 3-593-32829-1<br />
NE: Lutz, Burkart [Hrsg.]; Deutscher Soziologentag<br />
<br />
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung <strong>und</strong> Verbreitung sowie<br />
der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form<br />
(durch Photokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche<br />
Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer<br />
Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.<br />
Copyright © 1985 Campus Verlag G<strong>mb</strong>H, Frankfurt/Main<br />
Umschlaggestaltung: Atelier Warminski, Büdingen<br />
Satz: Heinz Breynk, Kirchweiler<br />
Druck <strong>und</strong> Bindung: Beltz Offsetdruck, Hemsbach<br />
Printed in Germany<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
INHALT<br />
Vorwort 11<br />
Burkart Lutz<br />
PLENARVORTRÄGE<br />
Zur <strong>gesellschaftliche</strong>n Entwicklung der Soziologie:<br />
Überlegungen zu zukünftigen Chancen <strong>und</strong> Problemlagen 17<br />
Burkart Lutz<br />
Die <strong>gesellschaftliche</strong> Dynamik als theoretische Herausforderung 27<br />
Renate Mayntz<br />
Die unbekannte Zukunft <strong>und</strong> die Kunst der Prognose 45<br />
Reinhart Koselleck<br />
The Social Fo<strong>und</strong>ations of Monetarism and "Bastard"<br />
Keynesianism: the Shrivelling of Neo-Conservatism 60<br />
Paolo Leon<br />
Gesellschaftliche Entwicklung oder Entwicklung des<br />
Weltsystems? 76<br />
Immanuel Wallerstein<br />
Die heutigen <strong>gesellschaftliche</strong>n Syndrome der osteuropäischen<br />
Gesellschaften <strong>und</strong> Entwicklungsalternativen 91<br />
Andras Hegedüs<br />
THEMENBEREICH I:<br />
GESELLSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG<br />
VON LEBENSZUSAMMENHÄNGEN<br />
Einleitung 103<br />
Eckart Pankoke<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Moderne familiale Lebensformen als Herausforderung<br />
der Soziologie 110<br />
Kurt Lüscher<br />
Unentgeltliche Arbeit im Lebenszusammenhang von Frauen<br />
<strong>und</strong> deren Reflexion in den Sozialwissenschaften 128<br />
Ursula Beer<br />
Zur Entwicklung lokaler Lebenszusammenhänge als<br />
Gegenstand stadtsoziologischer Forschung 145<br />
Ulfert Herlyn<br />
Zur Dynamik <strong>und</strong> Potentialität städtischer Lebensformen 152<br />
Karl-Dieter Keim<br />
Die <strong>gesellschaftliche</strong> Organisation von Arbeit als Problem<br />
der Sozialpolitik 160<br />
Fritz Böhle<br />
Marginalisierung als sozialpolitische Alternative? 169<br />
Barbara Riedmüller<br />
Diskussionsbeiträge zu den Referaten von<br />
Lüscher, Herlyn, Keim <strong>und</strong> Böhle<br />
Rosemarie Nave-Herz, Adalbert Evers, Thomas Krämer-<br />
Badoni, Marianne Weg, Helgard Ulshoefer, Georg Vobruba,<br />
Rolf Rosenbrock 177<br />
THEMENBEREICH II: PROGNOSEN IM BILDUNGSBEREICH<br />
Einleitung 207<br />
Ansgar Weymann<br />
Prognosen über Bildung <strong>und</strong> Arbeit — eine Bilanz aus<br />
soziologischer Sicht 209<br />
Ulrich Teichler<br />
Bildung <strong>und</strong> Wertwandel 224<br />
Helmut Klages<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Bildungsprognosen: Scheitern ohne Ende oder<br />
„Aufbruch zu neuen Ufern"? 242<br />
Ansgar Weymann<br />
Politikberatung durch Bildungsforschung?<br />
Einleitung 250<br />
Friedhelm Gehrmann<br />
Politikberatung durch Berufsbildungsforschung 252<br />
Laszlo Alex<br />
Ergebnisse der Forschung über Hochschulen als Gr<strong>und</strong>lage<br />
hochschulpolitischer Entscheidungen — Erfahrungen<br />
von HIS 262<br />
Heinz Griesbach<br />
Zur Politikberatung durch Bildungsforschung im Bereich<br />
der Weiterbildung 271<br />
Wolfgang Schulenberg<br />
Weiterbildung <strong>und</strong> Politikberatung 278<br />
Wolfgang Zapf<br />
Bildung <strong>und</strong> Wertwandel: Am Beispiel von „Leistung"<br />
in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland zwischen 1950<br />
<strong>und</strong> 1980 282<br />
Heiner Meulemann<br />
Daten, Erklärungen, Prognosen — Wege der Annäherung<br />
Einleitung 292<br />
Manfred Küchler<br />
Experimental-Pläne in sozialwissenschaftlicher Forschung 295<br />
Martin Irle<br />
Fragen der Erklärung <strong>und</strong> Prognose in qualitativen Untersuchungen.<br />
Dargestellt am Beispiel der „Arbeitslosen von<br />
Marienthal" 303<br />
Christel Hopf<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
THEMENBEREICH III: TERRORISMUS IN DER BUNDES<br />
REPUBLIK DEUTSCHLAND<br />
Einleitung 319<br />
Günter Albrecht<br />
Große Wirkungen kleiner Reize — sy<strong>mb</strong>olisch vermittelt.<br />
Zur Soziologie des Terrorismus 322<br />
Friedhelm Neidhardt<br />
Zur Soziologie des Terrorismus 334<br />
Fritz Sack<br />
THEMENBEREICH IV: GESELLSCHAFTLICHE VORAUS<br />
SETZUNGEN VON TECHNIK<br />
ENTWICKLUNG<br />
Einleitung <strong>35</strong>3<br />
Hartmut Neuendorff, Gert Schmidt<br />
Technologie<strong>entwicklung</strong> zwischen Eigendynamik <strong>und</strong> öffentlichem<br />
Diskurs. Kernenergie, Mikroelektronik <strong>und</strong> Gentechnologie<br />
in vergleichender Perspektive <strong>35</strong>5<br />
Bernward Joerges, Gotthard Bechmann, Rainer Hohlfeld<br />
Kommentare zum Beitrag von Joerges/Bechmann/Hohlfeld<br />
Hartmut Neuendorff, Walther Ch. Zimmerli 375<br />
Industriearbeit im U<strong>mb</strong>ruch — Versuch einer Voraussage 382<br />
Horst Kern, Michael Schumann<br />
Kommentare zum Beitrag von Kern/Schumann<br />
Klaus Düll, Rudi Schmidt 398<br />
Technologie<strong>entwicklung</strong>: Autonomer Prozeß <strong>und</strong><br />
industrielle Strategie 411<br />
Wolfgang Krohn, Werner Rammert<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Gewerkschaftliche Technologiepolitik zwischen Statussicherung<br />
<strong>und</strong> Arbeitsgestaltung<br />
Eckart Hildebrandt, Rüdiger Seltz<br />
THEMENBEREICH V:<br />
THEORIEN DER GESELLSCHAFTLICHEN<br />
ENTWICKLUNG DER MODERNE<br />
Einleitung 451<br />
Bernhard Giesen<br />
Wege der Moderne. Zwischen Tradition <strong>und</strong> Modernität, Partikularismus<br />
<strong>und</strong> Universalismus, Routine <strong>und</strong> Revolution, Konformität<br />
<strong>und</strong> Entfremdung 453<br />
Richard Münch<br />
Versozialwissenschaftlichung der Identitätsformation <strong>und</strong><br />
Verweigerung von Lebenspraxis: Eine aktuelle Variante der<br />
Dialektik der Aufklärung 463<br />
Ulrich Oevermann<br />
Bemerkungen zu Gesellschaftsstruktur, Bewußtseinsformen<br />
<strong>und</strong> Religion in der modernen Gesellschaft 475<br />
Thomas Luckmann<br />
Der Kapitalismus — ein unvollendbares Projekt? 485<br />
Johannes Berger<br />
Mobilisierung der Laien - Deprofessionalisierung der Hilfen.<br />
Ein Verlust an <strong>gesellschaftliche</strong>r Rationalität? 497<br />
Christian von Ferber<br />
Märkte, Käuflichkeit <strong>und</strong> Moralökonomie 509<br />
Georg Elwert<br />
Theorien der <strong>gesellschaftliche</strong>n Entwicklung zur Moderne<br />
Einleitung 520<br />
Klaus Eder<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Formale Rationalität als Kern der Weberschen<br />
Modernisierungstheorie 523<br />
Rainer Döbert<br />
Rationalisierung <strong>und</strong> Enthierarchisierung. Zur Kritik der<br />
Weberschen Ägyptisierungsthese 530<br />
Hans Haferkamp<br />
Die Modernisierung der Zeit <strong>und</strong> die Zeit nach der Moderne 537<br />
Hanns-Georg Brose<br />
Die zögernde Begrüßung der Moderne. Zu Georg Simmeis<br />
Diagnose moderner Lebensstile 543<br />
Georg Lohmann<br />
Wissen — Orientierung — Handlung<br />
Subjektives Erlebnis <strong>und</strong> das Institut der Konversion 549<br />
Walter M. Sprondel<br />
Soziale <strong>und</strong> biographische Konstitution chronischer<br />
Krankheit 559<br />
Wolfram Fischer<br />
Entwicklung <strong>und</strong> Diskontinuität<br />
Einleitung 570<br />
Georg Elwert<br />
Volkszählung <strong>und</strong> bürokratische Herrschaft in Bauernstaaten 572<br />
Gerd Spittler<br />
Strategische Gruppen, Klassenbildung <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Entwicklungen 576<br />
Hans-Dieter Evers, Tilman Schiel<br />
Entwicklung, Hegemoniekrise <strong>und</strong> Friedensfähigkeit in<br />
der Gegenwart 580<br />
Dieter Senghaas<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
VORWORT<br />
Burkart Lutz<br />
Vor einigen Jahren hat sich mit der Entscheidung der DGS, Soziologentage<br />
in zweijährigem Turnus zu veranstalten, das Prinzip eingespielt, daß Soziologentage<br />
jeweils abwechselnd eindeutig themenzentriert vom Vorstand ausgerichtet<br />
<strong>und</strong> mit wesentlich offenerer Thematik maßgeblich von den Sektionen<br />
gestaltet werden sollen. Nach den themenzentrierten Soziologentagen<br />
von 1979 in Berlin <strong>und</strong> von 1982 in Ba<strong>mb</strong>erg lag es nahe, 1984, wie<br />
vier Jahre zuvor in Bremen, den Sektionen die Hauptverantwortung für die<br />
Organisation des Soziologentags zu übertragen.<br />
Einer nahezu beliebig offenen Themenwahl stand freilich entgegen, daß<br />
die Jahreszahl 1984 mit Konnotationen beladen ist (war), die von der Soziologie<br />
nicht einfach übersehen werden kann.<br />
Angesichts dessen entschloß sich der Vorstand für eine Struktur des<br />
22. Deutschen Soziologentags, die sich an drei Absichten orientierte:<br />
Die eine Absicht bestand darin, die Herausforderung des Orwell-Jahres<br />
aufgreifend, aber sie bewußt in soziologisch bearbeitbare Kategorien übersetzend,<br />
zu fragen, inwieweit Soziologie gegenwärtig in der Lage ist, wichtige<br />
<strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklungen genau <strong>und</strong> zuverlässig zu beobachten,<br />
die sie bestimmenden Tendenzen herauszuarbeiten <strong>und</strong> neue Perspektiven<br />
<strong>und</strong> Problemlagen so frühzeitig zu identifizieren, daß sich die <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Praxis rechtzeitig auf sie einstellen kann. Hierbei war — sofern angebracht:<br />
durchaus selbstkritisch — zu prüfen, wo angesichts dieser Aufgabe<br />
die Stärken <strong>und</strong> Schwächen des Faches liegen <strong>und</strong> welche Felder <strong>und</strong> Fragen<br />
es in Zukunft vordringlich zu bearbeiten bzw. zu entwickeln gelte.<br />
Die zweite Absicht war, die Sektionen in den Mittelpunkt der Veranstaltungen<br />
zu stellen <strong>und</strong> ihnen Gelegenheit zu geben, sich mit charakteristischen<br />
Leistungen vor der Öffentlichkeit der Soziologie zu präsentieren.<br />
Deshalb hatte der Vorstand schon im Sommer 1983 alle Sektionen aufgefordert,<br />
für sich allein oder in Zusammenarbeit mit anderen Sektionen je<br />
eine Plenarveranstaltung mit anschließenden Arbeitssitzungen zu planen,<br />
in denen gezeigt werden sollte, was aus den spezialisierten Forschungs<strong>und</strong><br />
Diskussionszusammenhängen, die in erster Linie in den Sektionen zu<br />
Hause sind, zum übergreifenden Thema — der Bestimmung von Grenzen<br />
<strong>und</strong> Möglichkeiten retrospektiver <strong>und</strong> prognostischer Erfassung <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Entwicklung — beigetragen werden kann.<br />
Mit dieser Aufforderung verband der Vorstand eine dritte Absicht: Die<br />
Entwicklung der Soziologie ist gegenwärtig durch eine starke Tendenz zur<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Herausbildung spezialisierter Forschungsrichtungen geprägt, die sich in den<br />
Sektionen mehr oder minder genau abbilden. Zwar ist diese Tendenz sicherlich<br />
eine unvermeidliche Folge von Entwicklungen, die, für sich genommen,<br />
jeweils sehr positiv zu werten sind, wie z.B. verstärkte empirische Professionalisierung<br />
(die notwendig feld- <strong>und</strong>/oder methodenzentriert ist) oder engerer<br />
Kontakt mit gleichfalls jeweils spezifischer <strong>gesellschaftliche</strong>r Praxis.<br />
Doch hatte <strong>und</strong> hat Spezialisierung auch Nebenwirkungen, die ein erhebliches<br />
Risiko für die Einheit des Faches bedeuten <strong>und</strong> nicht zuletzt in der<br />
Entstehung spezieller soziologischer Subkulturen bestehen, die einander<br />
kaum mehr wahrnehmen, geschweige denn, daß sie noch miteinander kommunizierten.<br />
Nun ist jedoch die Einheit des Faches offenk<strong>und</strong>ig eine unverzichtbare<br />
Voraussetzung dafür, die Unabhängigkeit der Wissenschaft gegenüber<br />
rasch wechselnden Modeströmungen oder Bestrebungen zu ihrer kurzschlüssigen<br />
Instrumentalisierung zu wahren; auch sind viele der heute oder<br />
in Zukunft notwendigen thematischen, konzeptuellen <strong>und</strong> methodischen<br />
Innovationen nur im größeren Zusammenhang des Faches als Ganzem zu<br />
leisten. Indem er den Sektionen Gelegenheit zu Auftritten in der soziologischen<br />
Öffentlichkeit gab <strong>und</strong> eine Reihe von Sektionen veranlaßte, gemeinsame<br />
Plenarveranstaltungen zu organisieren, hoffte der Vorstand auch,<br />
die innere Einheit des Faches wieder etwas stärker ins Blickfeld zu rücken.<br />
Wieweit diese Absichten eingelöst oder verfehlt, die mit ihnen verknüpften<br />
Hoffnungen begründet oder illusorisch waren, läßt sich auch ex<br />
post nicht eindeutig bestimmen.<br />
Die Zusammenfassung" von Vorträgen aus verschiedenen Sektionen zu<br />
einer gemeinsamen Veranstaltung ist in einzelnen Fällen wider Erwarten<br />
gut gelungen, da die Beteiligten viel Mühe in die vorherige Abstimmung<br />
<strong>und</strong> Planung investiert hatten. Vielleicht wurden hier über den konkreten<br />
Anlaß hinausreichende Beziehungen zwischen Spezial<strong>soziologie</strong>n angeknüpft,<br />
die bisher kaum Kontakt miteinander hatten. In anderen Fällen<br />
konnten auch Sektionen, die benachbarte Sachgebiete bearbeiten <strong>und</strong> über<br />
Doppelmitgliedschaften miteinander verb<strong>und</strong>en sind, nichts anderes zustande<br />
bringen, als ihre Referate ohne wechselseitigen Bezug <strong>und</strong> ernsthafte Absprache<br />
im gleichen Raum abzuwickeln.<br />
Sicher ist, daß Organisation <strong>und</strong> Ablauf des Dortm<strong>und</strong>er Soziologentags<br />
viel Kritik fanden. Ein Teil der Kritik mag Ausdruck der allgemeinen<br />
Verdrossenheit gegenüber dem eigenen Fach sein, die gegenwärtig unter<br />
Soziologen — <strong>und</strong> wohl vor allem unter den ehemaligen „68ern" — weitverbreitet<br />
ist. Andere Kritikpunkte sind jedoch sehr ernst zu nehmen. Sie<br />
richten sich vor allem darauf, daß:<br />
• auf den Veranstaltungen zu viele <strong>und</strong> zu lange Referate gehalten wurden;<br />
• mit ganz wenigen Ausnahmen (die dann auch — so die Scheuch-Tenbruck-Debatte<br />
— sehr großen Zulauf fanden) keine Diskussionen zustande<br />
kamen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Daß entgegen den ursprünglichen Intentionen beides zutraf, ist nicht zu<br />
leugnen. Die Gründe hierfür sind vielfältig <strong>und</strong> liegen sicher nicht nur in der<br />
mangelnden Fähigkeit vieler Soziologen, das Verhältnis zwischen Seitenzahl<br />
<strong>und</strong> Zeitbedarf ihrer Referate richtig einzuschätzen, eine wissenschaftliche<br />
Argumentation schnell auf den Punkt zu bringen <strong>und</strong> in einem Vortrag zwei<br />
oder drei gutdurchdachte Thesen eingängig darzustellen. Ganz offensichtlich<br />
sehen sich sehr viele Kollegen der jüngeren Generation starkem Druck<br />
ausgesetzt, auf Soziologentagen mit einem Referat präsent zu sein (wobei<br />
die Sorge um die berufliche Zukunft sich mit der weitverbreiteten Praxis<br />
deutscher Universitätsverwaltungen ko<strong>mb</strong>iniert, Reisekostenzuschüsse zum<br />
Besuch wissenschaftlicher Tagungen nur dem zu gewähren, der ein Referat<br />
hält). Und die Sektionen <strong>und</strong> ihre Sprecher sind ebenso offensichtlich aufgr<strong>und</strong><br />
der typischen Sozialstrukturen, in denen sich die Sektionsarbeit vollzieht,<br />
kaum in der Lage, rationierend <strong>und</strong> selektierend in das Angebot an<br />
Referaten einzugreifen. Was dann an Tagungszeit überhaupt noch für Diskussion<br />
zur Verfügung gestanden hätte, wurde überdies oft schon deshalb<br />
nicht zu wirklichen Debatten genutzt, weil offenbar viele Soziologen glauben,<br />
daß in dem offen soziologenfeindlichen Klima, das heute vielfach<br />
herrscht, ernsthafte Kritik an Kollegen gänzlich inopportun sei.<br />
Allerdings ist die Hoffnung nicht ganz unberechtigt, daß diese Schwächen<br />
in der jetzt vorgelegten schriftlichen Fassung der Dortm<strong>und</strong>er Verhandlungen<br />
weitgehend in den Hintergr<strong>und</strong> treten. So sehr brillante Kontroversen<br />
die Stimmung eines Kongresses erhellen <strong>und</strong> seinen Ablauf beleben,<br />
so groß ist doch die Gefahr, daß sie bei der anschließenden Drucklegung<br />
einen Gutteil ihrer Spannung verlieren. Deshalb leidet auch der Tagungsband<br />
weniger darunter, daß es sie nicht gab. Und manche der Referate,<br />
die in Dortm<strong>und</strong> unter hohem Zeitdruck vom Blatt gelesen wurden,<br />
präsentieren sich nunmehr dem aufmerksamen Leser als sehr aufschlußreiche,<br />
interessante <strong>und</strong> gut verständliche Texte.<br />
Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Soziologie möchte all den<br />
Sprechern <strong>und</strong> Mitgliedern seiner Sektionen, die aktiv an den oftmals aufwendigen<br />
<strong>und</strong> mühevollen Vorbereitungen dieses Soziologentags beteiligt<br />
waren, sehr herzlich danken. Sein Dank gilt vor allem aber auch den Gastgebern,<br />
der Stadt <strong>und</strong> der Universität Dortm<strong>und</strong>. Dortm<strong>und</strong> hat ja in der<br />
Entwicklung der deutschen Soziologie nach dem Zweiten Weltkrieg eine<br />
bedeutende Rolle gespielt. Zahlreiche angesehene Soziologen haben hier<br />
wenigstens einige Jahre — an der Sozialforschungsstelle oder anderswo —<br />
gearbeitet. Viele wichtige Untersuchungen fanden in Dortm<strong>und</strong> <strong>und</strong> in seinem<br />
Umland statt. Es war seit langem an der Zeit, einen Soziologentag in<br />
Dortm<strong>und</strong> zu veranstalten. Daß dies nunmehr möglich wurde, ist nicht zuletzt<br />
der Gesellschaft zur Förderung der Sozialforschung in Dortm<strong>und</strong> zu<br />
verdanken, der die Hauptlast der organisatorischen Vorbereitung zugefallen<br />
war.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Plenarvorträge<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ZUR GESELLSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG DER SOZIOLOGIE:<br />
ÜBERLEGUNGEN ZU ZUKÜNFTIGEN CHANCEN UND<br />
PROBLEMLAGEN<br />
Burkart Lutz<br />
Es habe sich eingebürgert, so sagte Joachim Matthes vor zwei Jahren in<br />
Ba<strong>mb</strong>erg, daß der amtierende Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für<br />
Soziologie zur Eröffnung eines Soziologentags einen professionspolitischen<br />
Vortrag halte. Zwar war ich, als ich dies hörte, zunächst etwas verw<strong>und</strong>ert,<br />
daß ausgerechnet die Soziologen, die ja bislang nachgerade ihre Identität<br />
auf Traditionskritik gegründet hatten, Wert darauf legen sollten, in so kurzer<br />
Zeit, im Rhythmus weniger Soziologentage, eine eigene Tradition gestiftet<br />
zu haben. Aber bei näherem Nachdenken leuchtete mir die Sache<br />
doch zunehmend ein. Der Vorsitzende einer, wie man früher so schön sagte,<br />
gelehrten Gesellschaft, die auf das Prinzip der Ehrenamtlichkeit gestellt<br />
ist <strong>und</strong> keine Ressourcen zu verteilen hat, verfügt ja nur über sehr wenig<br />
institutionelle Möglichkeiten, auf die Entwicklung des Faches Einfluß zu<br />
nehmen. Um so ernster muß er die Deutungsmacht nehmen, die ihm anläßlich<br />
einer solchen Gelegenheit wie der Eröffnungsveranstaltung eines Soziologentags<br />
zufallen könnte, <strong>und</strong> um so überlegter muß er mit ihr umgehen.<br />
In diesem Sinne möchte ich mit einer These beginnen:<br />
I<br />
Der Soziologie geht es gegenwärtig erheblich besser, als man dies angesichts<br />
der allgemeinen Befindlichkeit <strong>und</strong> Stimmungslage der Soziologen,<br />
der seit einigen Jahren in Mode gekommenen Unken-, ja Kassandrarufe<br />
prominenter Kollegen <strong>und</strong> des mitleidsvollen oder böswilligen Tenors mancher<br />
Pressekommentare glauben könnte.<br />
Hier einige Belege für diese These:<br />
1. Im Zuge des allgemeinen Ausbaus der Hochschulen hat sich die Zahl der<br />
Hochschullehrerstellen für Soziologie von 1960 bis zur Mitte der 70er Jahre<br />
etwa verzwanzigfacht. Die Personalausstattung der Soziologie ist heute besser<br />
als die wesentlich älterer Fächer prinzipiell ähnlicher Natur, wie z.B. die<br />
Psychologie. Wenngleich es natürlich in jüngster Zeit immer wieder zu versuchten<br />
oder vollzogenen Stelleneinziehungen kommt, trifft dies doch zumeist<br />
die Soziologie nicht stärker als andere vergleichbare Fächer; <strong>und</strong> mei-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
nes Wissens wird hierdurch nirgendwo die Substanz des Personalbestands<br />
wirklich ernsthaft bedroht.<br />
2. Die Forschungsstruktur <strong>und</strong> -infrastruktur der deutschen Soziologie ist<br />
zwar, wie mit Recht immer wieder beklagt wird, institutionell ganz unzureichend<br />
konsolidiert. Aber sie existiert, produziert viel Ordentliches <strong>und</strong><br />
gelegentlich sogar einiges Außerordentliche. Und entgegen einer weitverbreiteten<br />
Befürchtung hatten weder die Haushaltskürzungen noch die politische<br />
Tendenzwende der letzten Jahre bisher wirklich lebensbedrohende<br />
Konsequenzen für sie, obwohl der Stellenbestand in der Forschung weitaus<br />
verletzlicher ist als an den Hochschulen.<br />
3. Das soziologische Veröffentlichungswesen funktioniert auf eine Art <strong>und</strong><br />
Weise, die noch vor zehn Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre. Trotz gelegentlicher<br />
Klagen über mangelndes Angebot an guten Manuskripten nimmt<br />
der Umfang der für Soziologen wichtigen Zeitschriften, rechnet man die<br />
zum Teil vorzüglichen Sonderbände mit, eher zu als ab. Daß ein sehr angesehener<br />
deutscher Verlag seine farblich fein abgestimmte Taschenbuchreihe<br />
nicht mehr so großzügig wie bisher für soziologische Manuskripte öffnet,<br />
hat bisher in Quantität <strong>und</strong> Qualität der soziologischen Buchproduktion<br />
keine dramatischen Spuren hinterlassen. Auch das eher karge tägliche Brot<br />
soziologischer Forschung läßt sich, wie das Beispiel des Campus Verlags<br />
zeigt, vermarkten. Und neuerdings scheint sogar das Interesse größerer<br />
Verlage an soziologischen Veröffentlichungen wieder zuzunehmen.<br />
4. Die großen politisch-theoretischen Konflikte <strong>und</strong> Kontroversen, die untrennbar<br />
mit der Entwicklung der Soziologie in den letzten 20 Jahren verb<strong>und</strong>en<br />
sind, haben trotz gegenteiliger Befürchtungen, zu denen es viele Anlässe<br />
gab, das Fach nicht auseinanderbrechen lassen. Wenngleich viele der<br />
großen Auseinandersetzungen nicht wirklich ausgetragen, d.h. bis zu dem<br />
Punkt getrieben worden wären, an dem sich die in ihnen angesammelte<br />
Spannung wissenschaftlich produktiv entladen könnte, hat doch die Soziologie<br />
die für die späten 60er <strong>und</strong> frühen 70er Jahre so charakteristischen<br />
Überlagerungen von innerwissenschaftlichen <strong>und</strong> politisch-ideologischen<br />
Frontstellungen alles in allem weitaus besser verarbeitet, als zu erwarten<br />
war. Zwar kann ich mir immer noch nicht vorstellen, daß, sagen wir einmal,<br />
Offe <strong>und</strong> Tenbruck gemeinsam einen Sammelband herausgeben. Aber<br />
wenn essentielle Interessen des Faches auf dem Spiele stünden, wäre ich mir<br />
ganz sicher, daß Habermas <strong>und</strong> Scheuch ohne Berührungsängste zusammen<br />
aufzutreten bereit wären.<br />
5. Endlich hat sich, auch nachdem die Planungseuphorie vergangen <strong>und</strong> die<br />
kritisch-emanzipatorische Stimmungslage in Politik <strong>und</strong> Verwaltung gänzlich<br />
verschw<strong>und</strong>en ist, sozialwissenschaftliches Wissen in den verschiedensten<br />
Formen als wichtiges Instrument <strong>gesellschaftliche</strong>r Praxis erwiesen.<br />
Sicher sind die Zeiten vorbei, in denen man ein fachfremdes Publikum bereits<br />
durch geschickte Handhabung soziologischer Gr<strong>und</strong>begriffe beein-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
drucken konnte. Doch hat sich die Nutzung sozialwissenschaftlicher Forschungsergebnisse<br />
<strong>und</strong> typisch sozialwissenschaftlicher Argumentationsweisen<br />
inzwischen in vielen Bereichen <strong>gesellschaftliche</strong>r Praxis ganz selbstverständlich<br />
eingebürgert, wenngleich es uns vielfach nicht gelungen ist, dafür<br />
Sorge zu tragen, daß dies dann auch tatsächlich der Soziologie gutgeschrieben<br />
wird.<br />
Vielleicht müßten wir die deutsche Soziologie <strong>und</strong> ihre Lage öfter von<br />
außen betrachten. Vielfach wird ja erst mit fremden Augen als Indikator<br />
kräftiger <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>er Konstitution sichtbar, was einem selbst ganz banal<br />
<strong>und</strong> nicht des Aufhebens wert erscheint: ein recht kontinuierlicher Strom<br />
soziologischer Wissensproduktion, der jenseits der unvermeidlichen Red<strong>und</strong>anz<br />
auf einer ganzen Reihe von Teilgebieten Wichtiges <strong>und</strong> Neues zustande<br />
gebracht hat, das trotz der Sprachbarriere zunehmend auch im Ausland<br />
mit großem Interesse zur Kenntnis genommen wird; gute Ansätze zu fachlicher<br />
Professionalisierung, wobei der Verlust an emphatischer Begeisterung,<br />
der wohl einmal den Aufbruch in die Soziologie begleitet hatte, als unverzichtbarer<br />
Preis der Konsolidierung akzeptiert werden muß; eine breite<br />
Ausstrahlung auf benachbarte Fächer, wobei man fälschlicherweise meist<br />
nur die oberflächliche Soziologisierung, die sich in deren Begrifflichkeit<br />
vollzog, im Auge hat, obwohl doch der wirklich wichtige Einfluß der Soziologie<br />
darin bestand oder besteht, bisher primär normativ oder klassifikatorisch<br />
orientierten Wissenschaften zu helfen, sich eine systematische<br />
empirische F<strong>und</strong>ierung zu geben.<br />
II<br />
An sich müßte Soziologie also sehr gut dafür gerüstet sein, die Herausforderungen<br />
aufzunehmen, die mit einiger Wahrscheinlichkeit in Zukunft auf sie<br />
zukommen werden.<br />
Wenn meine eigenen, kürzlich veröffentlichten <strong>und</strong> in vieler Hinsicht<br />
noch durchaus vorläufigen <strong>und</strong> unscharfen Überlegungen zur Entwicklung<br />
industriell-marktwirtschaftlicher Gesellschaften vom Typ der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
in den kommenden zwei oder drei Jahrzehnten auch nur einigermaßen<br />
zutreffend sind, dann werden diese Gesellschaften zunehmend mit<br />
Problemlagen konfrontiert sein, deren Bewältigung einen massiv wachsenden<br />
Bedarf an typisch sozialwissenschaftlichen Leistungen impliziert. Gesellschaften<br />
dieser Art sind meiner Meinung nach in der Tat seit etwa einem<br />
Jahrzehnt in ein Entwicklungsstadium eingetreten, in dem sie einem<br />
wachsenden, vielleicht sogar kumulativen Risiko systemischer Destabilisierung<br />
ausgesetzt sind, dem Risiko von Gleichgewichtsstörungen, die mit<br />
mehr oder minder langen, oftmals sehr langen Zeitverzögerungen von einem<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>n Teilbereich auf andere übergreifen oder überspringen. Die<br />
heute noch ganz überwiegend bereichsspezifischen Instrumente politischer<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Intervention <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong>r Steuerung sind angesichts solcher systemischer<br />
Destabilisierungsprozesse machtlos; ja, sie tragen durch die ihnen<br />
immanenten Praktiken der Problemverlagerung <strong>und</strong> portionierten Problemverarbeitung<br />
vielfach noch dazu bei, sie zu verstärken.<br />
Die steuernde oder präventive Beherrschung solcher systemischer Gleichgewichtsstörungen<br />
wird zweifellos nicht möglich sein, wenn die zentralen<br />
Politikinstanzen nicht auf eine hochentwickelte Kompetenz für die Analyse<br />
komplexer <strong>gesellschaftliche</strong>r Zusammenhänge, Strukturen <strong>und</strong> Prozesse<br />
zurückgreifen können. Dies muß keineswegs bedeuten, daß es zu einer in<br />
vieler Hinsicht höchst fatalen Vermengung von politischer Steuerungs- <strong>und</strong><br />
Gestaltungsverantwortung <strong>und</strong> Wissenschaft kommen müßte. Doch wird<br />
vermutlich gerade ein selbstbewußtes <strong>und</strong> effizientes politisch-administratives<br />
System einen Bedarf an unabhängiger <strong>und</strong> kritischer wissenschaftlicher<br />
Analyse <strong>und</strong> Diagnose haben, der nach Quantität <strong>und</strong> Qualität weit über das<br />
jetzt Bekannte hinausgeht. Zwar ist sicherlich Soziologie nicht das einzige<br />
Fach, das sich zur Deckung dieses Bedarfs anbieten wird. Doch wenn sich<br />
unser Fach auch nur einigermaßen im wissenschaftlichen Wettbewerb zu behaupten<br />
weiß, sollte sich hiermit genuin soziologischer Arbeit ein Betätigungsfeld<br />
eröffnen, das ein auch gegenüber dem heutigen Stand substantiell<br />
angewachsenes Personal tragen könnte.<br />
III<br />
Allerdings gibt es gute Gründe für die Befürchtung, daß die Soziologie diese<br />
Herausforderung nicht adäquat aufzunehmen <strong>und</strong> die von ihr implizierte<br />
Chance höchstens sehr beschränkt zu nutzen verstehen wird.<br />
Diese Befürchtung resultiert in erster Linie aus dem, was man die Sozialstruktur<br />
der Soziologie nennen könnte, <strong>und</strong> aus den in ihr angelegten Problemen,<br />
deren Lösung vermutlich die Zukunft der Soziologie wie der Soziologen<br />
stark bestimmen wird. Da sich dieser Zusammenhang sehr wohl mit<br />
spezifisch soziologischen Kategorien analysieren läßt, bedarf es auch nicht<br />
des Rekurses auf psychologische oder moralische Begriffe, die allzu häufig<br />
in Reflexionen von Soziologen über die eigene Wissenschaft dominieren.<br />
Lassen Sie mich wenigstens in rohen Strichen skizzieren, wie eine solche<br />
soziologische Analyse der Sozialstruktur der Soziologie <strong>und</strong> der in ihr<br />
angelegten Entwicklungsengpässe <strong>und</strong> Probleme aussehen <strong>und</strong> zu welchen<br />
Ergebnissen sie — auf einer empirischen Gr<strong>und</strong>lage, die im Detail überwiegend<br />
noch zu schaffen wäre — führen könnte:<br />
1. Zunächst einmal weist die Soziologie gegenwärtig eine demographische<br />
Struktur auf, die mutatis mutandis mit der Altersstruktur eines extrem armen<br />
Entwicklungslandes vergleichbar ist: einigen Dutzend Geronten, die<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
zumeist vor nicht allzu langer Zeit ihren 50sten Geburtstag gefeiert hatten,<br />
stehen einige h<strong>und</strong>ert 40jährige <strong>und</strong> einige tausend 30jährige gegenüber.<br />
Und in den Universitäten drängen sich gegenwärtig, gewissermaßen als Kinder<br />
in wissenschaftlich noch unmündigem Alter, weit über 20.000 Hauptfachstudenten.<br />
Ich glaube nicht, daß es noch eine andere Disziplin mit so extremen<br />
Generationsrelationen gibt, aufgr<strong>und</strong> derer in der Soziologie gegenwärtig<br />
etwa vier- bis fünfmal soviel Studierende wie aktiv Berufstätige gezählt werden<br />
<strong>und</strong> in den nächsten Jahren, kommt es nicht zu einer dramatischen Abkehr<br />
vom Soziologiestudium, auf jeden Pensionierungs- oder Emeritierungsfall<br />
mehrere h<strong>und</strong>ert Studienanfänger treffen werden.<br />
2. Diese Soziologengenerationen befinden sich gegenwärtig in ganz unterschiedlichen<br />
beruflichen Situationen:<br />
Die 50jährigen haben wohl alle auf die eine oder andere Weise reüssiert.<br />
Sie haben die prestigereichsten Lehrstühle des Faches inne <strong>und</strong> konnten<br />
sich noch die meisten Fußnotenprivilegien <strong>und</strong> sonstigen fringe benefits<br />
der alten Ordinarienuniversität sichern.<br />
Die 40jährigen halten ihrerseits den Kernbestand der Positionen besetzt,<br />
auf denen institutionelle Stabilität <strong>und</strong> Kontinuität einer Wissenschaftsdisziplin<br />
beruhen: als Lebenszeitprofessoren an den Hochschulen<br />
oder mit vergleichbaren Stellungen in der Forschung bzw. in den wissenschaftsbezogenen<br />
Teilen der <strong>gesellschaftliche</strong>n Praxis. Ihre berufliche Lage<br />
ist vielleicht nicht immer so günstig wie die der 50jährigen, aber doch, vor<br />
allem als Folge der massiven Expansion soziologischer Lehre zwischen den<br />
späten 60er <strong>und</strong> den späten 70er Jahren, alles in allem sehr komfortabel.<br />
Ganz anders sieht die Lage bei der großen Mehrzahl der 30jährigen aus.<br />
Wenngleich mir hierfür keine umfassenden <strong>und</strong> zuverlässigen Daten vorliegen,<br />
scheint mir doch außer Frage zu stehen, daß allenfalls eine Minderheit<br />
von ihnen eine auskömmliche Beschäftigung mit dauerhafter Perspektive<br />
gef<strong>und</strong>en hat. Befristete Arbeitsverträge, nicht selten mit explizitem Ausschluß<br />
von Weiterbeschäftigung beim gleichen Arbeitgeber, intermittierende<br />
Arbeitslosigkeit <strong>und</strong> vielfältige Formen von Selbstausbeutung sind die<br />
typischen Merkmale der aktuellen beruflichen Situation dieser Generation.<br />
3. Diese Differenzen sind nicht einfach Ausdruck unterschiedlicher biographischer<br />
Stationen, die von allen Generationen nacheinander durchlaufen<br />
werden müssen. Sie lassen sich auch nicht bloß als eine Extremform<br />
von intergenerationeller Chancenungleichheit interpretieren, die es als solche<br />
immer wieder gegeben hat. In diesen Differenzen schlagen sich vielmehr<br />
auch tiefgreifende Brüche in Karrieremuster <strong>und</strong> Karriereperspektiven<br />
von Soziologen nieder:<br />
Für die Mehrzahl der 50jährigen war die Entscheidung für Soziologie<br />
als Beruf sicherlich keine bequeme <strong>und</strong> selbstverständliche Entscheidung.<br />
Für viele bedeutete sie, Existenzbedingungen zu akzeptieren, wie sie traditionell<br />
mit den Begriffen des Privatgelehrten oder Privatdozenten assoziiert<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
werden, wenngleich ihnen fast ausnahmslos das an sich hierzu vorausgesetzte<br />
eigene Vermögen fehlte. Ihr Weg in die Soziologie führte also im Regelfall<br />
über lange Jahre eher niedrigen Einkommens <strong>und</strong> unsicherer Zukunft,<br />
über Zwang zu unvorhersehbarem Ortswechsel <strong>und</strong> oft auch über die Notwendigkeit,<br />
sich mit schwer erträglicher Abhängigkeit von den Launen eines<br />
Patrons zu arrangieren. Und nur am Rande sei, mit Blick auf die Jüngeren,<br />
gesagt, daß sich auf diesem Hintergr<strong>und</strong> ganz gut verstehen läßt, warum<br />
manche der 50jährigen, die ja Ende der 60er Jahre erst kurz zuvor damit<br />
hatten beginnen können, sich auf ihrem ersten Lehrstuhl etwas bequemer<br />
einzurichten, mit solcher Heftigkeit <strong>und</strong> Erbitterung auf die ganz naive Kritik<br />
der damals Jungen, heute 40jährigen, an der Ordinarien-Universität <strong>und</strong><br />
ihren Privilegien reagiert haben.<br />
Ganz anders sieht das typische Karrieremuster der 40jährigen aus. Ihnen<br />
boten sich, sobald sie ihr Studium abgeschlossen hatten, weitreichende<br />
Möglichkeiten wissenschaftlicher oder wissenschaftsbezogener Tätigkeiten.<br />
Insbesondere ko<strong>mb</strong>inierten sich für sie generelle Hochschulexpansion <strong>und</strong><br />
spezieller Aufschwung der Soziologie in einer Weise, die für ein knappes<br />
Jahrzehnt durchaus den Eindruck entstehen lassen konnte, daß schon der<br />
halbwegs erfolgreiche Abschluß eines Soziologie-Studiums nahezu selbstverständlich<br />
auch den Zugang zu herausgehobenen Lebenszeitpositionen im<br />
akademischen Bereich sicherte.<br />
Die 30jährigen mußten hingegen in den letzten Jahren die bittere Erfahrung<br />
machen, daß dieses Karrieremuster, das für die meisten von ihnen<br />
fast evidenter Hintergr<strong>und</strong> ihrer Studien- <strong>und</strong> Berufswahlentscheidung war,<br />
für sie nicht mehr gilt. Dies bedeutet, wie sich nunmehr mit zunehmender<br />
Deutlichkeit herausstellt, nicht einfach eine graduelle Verschlechterung der<br />
Chancen in dem Sinn, daß sich nun wieder die Muster wissenschaftlicher<br />
Biographie durchsetzen würden, denen sich die 50jährigen ja auch hatten<br />
unterwerfen müssen. Von den 30jährigen wissen wir sicher, daß nur wenige<br />
von ihnen überhaupt die Chance haben, irgendwann einmal auf eine Stelle<br />
als C 3- oder C 4-Professor zu gelangen. Möglicherweise wird es für die Mehrheit<br />
von ihnen sogar unmöglich sein, auf Dauer ihren Lebensunterhalt in den<br />
Berufsfeldern zu verdienen, in denen die Mehrzahl der Älteren heute tätig ist.<br />
Und welche beruflichen Karriereperspektiven mit welchen Chancen <strong>und</strong><br />
Risiken sich den heutigen Hauptfachstudierenden der Soziologie einmal bieten<br />
werden, wenn sie — aus gutem Gr<strong>und</strong> immer später <strong>und</strong> immer zögernder<br />
— die Universität verlassen werden, ist im günstigsten Fall ungewiß.<br />
4. Berufliche Lage <strong>und</strong> Karriereperspektiven begründen ihrerseits Interessenorientierungen<br />
von Soziologen, die, so fürchte ich, zunehmend heterogen,<br />
divergent, vielleicht sogar zwischen jeweils größeren Gruppen offen widersprüchlich<br />
werden. Ich möchte dies an einem sehr evidenten <strong>und</strong> für die<br />
nächsten Jahre vermutlich zunehmend aktueller werdenden Sachverhalt illustrieren,<br />
nämlich der Entwicklung der soziologischen Lehre im Hauptfachstudium:<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Das soziologische Establishment der 40- <strong>und</strong> 50jährigen Professoren<br />
muß ein vorrangiges Interesse daran haben, den Lehrbetrieb so zu organisieren,<br />
daß er möglichst störungsfrei funktioniert. Hiervon hängt nicht nur<br />
ab, wie erträglich ihre persönliche Arbeitssituaton ist; nur wenn es ihnen<br />
gelingt, auch in einer Zeit scharfer Mittelrestriktionen <strong>und</strong> tendenziell noch<br />
weiter wachsender Studentenzahlen mit ihren Vorlesungs- <strong>und</strong> Prüfungsverpflichtungen<br />
einigermaßen gut über die R<strong>und</strong>en zu kommen, haben sie<br />
überhaupt noch eine Chance, forschend <strong>und</strong> publizierend einen ernsthaften<br />
Beitrag zur Wissenschaft zu leisten.<br />
Dem steht nun gegenüber, daß die 30jährigen, wenngleich sie vielerorts<br />
als Assistenten oder wissenschaftliche Mitarbeiter die Hauptlast des<br />
Lehrbetriebs zu tragen haben, ihre beruflichen Chancen nicht mehr in der<br />
Lehre <strong>und</strong> den hierbei erworbenen Qualifikationen, sondern ganz anderswo<br />
suchen müssen. Auch wenn viele der 30jährigen individuell noch darauf<br />
setzen mögen, irgendwann noch eine Lebenszeitstellung an einer Hochschule<br />
zu ergattern, hat sich doch ihr kollektives Interesse, das sich meinem Eindruck<br />
nach zunehmend im Berufsverband zu artikulieren versucht, vorrangig<br />
darauf zu richten, die Verwendbarkeit der Soziologenqualifikation außerhalb<br />
der Universität <strong>und</strong> in möglichst vielen Feldern <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Praxis nachhaltig zu erhöhen.<br />
Die sich aus diesem Interesse folgerichtig ergebende Forderung nach<br />
einem Studiengang, der für ein breites Spektrum von Aufgaben in der <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Praxis möglichst berufsfertig qualifiziert, ist, wenn überhaupt,<br />
woran ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt meine Zweifel habe, nur<br />
dann erfüllbar, wenn es zu tiefgreifenden Veränderungen im Lehrbetrieb<br />
der meisten deutschen Hochschulen kommt. Und es ist ganz offenk<strong>und</strong>ig, daß<br />
solche Veränderungen, zu deren Bewältigung jetzt <strong>und</strong> in absehbarer Zeit<br />
kaum zusätzliche Ressourcen verfügbar sein werden, schwerlich mit den Interessen<br />
an einem funktionierenden Lehrbetrieb auf einen Nenner gebracht<br />
werden können.<br />
IV<br />
Es ist evident, daß eine solche Sozialstruktur, wie ich sie eben zu skizzieren<br />
versucht habe, die weitere Entwicklung des Faches mit dem hohen Risiko<br />
schwerer Probleme belastet <strong>und</strong> insoweit seine Fähigkeit stark beeinträchtigen<br />
kann, neue Chancen zu nutzen. Drei solche denkbare Probleme möchte<br />
ich hier wenigstens nennen:<br />
1. Zunächst einmal ist zu befürchten, daß sich aus den stark divergierenden<br />
Interessen der jüngeren <strong>und</strong> älteren Soziologen ein offener intergenerationeller<br />
Konflikt entwickelt, der einen Gutteil der Kräfte <strong>und</strong> Ressourcen absorbiert<br />
oder blockiert, die eigentlich dringend für die weitere Entwicklung<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
des Faches <strong>und</strong> dafür benötigt würden, die neu auf das Fach zukommenden<br />
Herausforderungen aufzunehmen. Mir scheint die Gefahr dafür, daß sich<br />
Soziologen in den nächsten Jahren mit möglicherweise großem Engagement<br />
in fachinternen Auseinandersetzungen verzetteln <strong>und</strong> damit die im<br />
Interesse der Soziologie <strong>und</strong> der Soziologen eigentlich erstrangigen Aufgaben<br />
vernachlässigen, um so größer, als ja manche der Konfliktgegenstände<br />
<strong>und</strong> Konfliktfronten, die sich heute bereits abzuzeichnen beginnen,<br />
scheinbar durchaus solche langfristigen Entwicklungsperspektiven<br />
berühren, wenn es sich etwa um Fragen der Reform des Soziologiestudiums<br />
oder um Beschäftigungsflexibilisierung im Hochschulbereich handelt.<br />
2. Weiterhin dürften wir — jenseits der unbestreitbaren <strong>und</strong> sehr ernst zu<br />
nehmenden beruflichen Schwierigkeiten, denen sich die 30jährigen heute<br />
<strong>und</strong> in absehbarer Zukunft gegenübersehen — das Problem der langfristigen<br />
personellen Reproduktion des Faches nicht aus den Augen verlieren, die<br />
von der extremen Instabilität der Karrieremuster <strong>und</strong> Karriereperspektiven<br />
von <strong>und</strong> für Soziologen stark bedroht ist.<br />
Wie gut die Produktion eines Studiengangs <strong>und</strong> wie hoch damit auch<br />
die Qualität des Nachwuchses ist, auf den das Fach rechnen kann, hängt,<br />
nach allem, was wir wissen, keineswegs nur von der Qualität des Lehrangebots<br />
ab, sondern auch von den komplizierten Selektions- <strong>und</strong> Motivationsprozessen,<br />
die sich mit Studien- <strong>und</strong> Berufswahlentscheidungen<br />
verbinden. Berufswahl- <strong>und</strong> Arbeitsmarktverhalten ihrerseits werden jedoch<br />
ganz offenbar stark durch die Berufschancen <strong>und</strong> Karrieremuster<br />
gesteuert, die etwa zeitgleich an älteren Berufsangehörigen zu beobachten<br />
sind. Und ein Fach, bei dem kaum Gewißheit darüber besteht, welche<br />
Berufsperspektiven mit dem Studienabschluß verb<strong>und</strong>en sind, läuft immer<br />
Gefahr, bei der Konkurrenz um den wissenschaftlichen Nachwuchs gegenüber<br />
anderen Fächern ins Hintertreffen zu geraten.<br />
Dabei geht es keineswegs allein, ja vielleicht nicht einmal in erster<br />
Linie darum, ob von einem Studiengang besonders gute <strong>und</strong>/oder gesicherte<br />
Arbeitsmarktchancen eröffnet werden; im Grenzfall kann ein Fach vielleicht<br />
sogar gerade deshalb besonders wertvolle, leistungsfähige <strong>und</strong> engagierte<br />
Studenten anziehen, weil seine Wahl stark risikobehaftet ist.<br />
Die eigentliche Gefahr scheint mir vielmehr eine Studentenpopulation<br />
der Soziologie zu sein, die ganz unterschiedliche <strong>und</strong> möglicherweise sogar<br />
noch kurzfristig stark variierende Erwartungen intrinsischer oder<br />
instrumenteller Art an ihr jeweiliges Studium stellt. Eine solche Studentenschaft<br />
wäre gewiß kein besonders günstiges Milieu für die Heranbildung<br />
eines hochqualifizierten <strong>und</strong> motivierten Soziologennachwuchses, wie<br />
immer das Verhältnis zwischen Studentenzahl <strong>und</strong> Reproduktionsbedarf<br />
des Faches im engeren Sinne (<strong>und</strong> die damit vorgegebene Selektionsquote),<br />
aussehen mag.<br />
3. Das weitaus gravierendste Risiko scheint mir allerdings darin zu liegen,<br />
daß unter dem Druck von Problemen der eben skizzierten Art kontinuier-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
liehe <strong>und</strong> systematische Forschung kaum mehr zustande kommt. Soziologie<br />
hat sich ja in der Phase ihrer rapiden Expansion an den Hochschulen vor<br />
allem als ein Lehrfach <strong>und</strong> kaum als ein Forschungsfach etabliert. So<br />
wäre es nicht verw<strong>und</strong>erlich, wenn sich in dem eben genannten Konflikt<br />
zwischen den beiden für sich jeweils hochlegitimen Interessen an einem<br />
funktionierenden Lehrbetrieb einerseits, an einer effizienten Ausbildung<br />
für Praxis außerhalb der Hochschule andererseits, im Alltag der Hochschulinstitute<br />
ein pragmatischer Kompromiß durchsetzt, dem von allen Beteiligen<br />
fast unbemerkt die letzten noch verfügbaren Ressourcen für Forschung<br />
zum Opfer fallen. Die Entwicklung der Psychologie in den letzten<br />
zwei Jahrzehnten, wo unter dem Druck beschäftigungsbezogener Interessen<br />
der jüngeren Psychologen <strong>und</strong> der Studenten an vielen Hochschulen<br />
die Vermittlung praktisch verwertbarer — „klinischer" — Fähigkeiten so<br />
sehr die Oberhand gewann, daß für Forschung kaum mehr Raum noch<br />
Interesse verblieb, sollte von den Soziologen sehr ernst genommen werden,<br />
zumal sie sich unter prinzipiell für Forschung sehr viel günstigeren Bedingungen<br />
vollzog.<br />
Im Unterschied zur Psychologie würde allerdings ein solcher Kompromiß<br />
auf Kosten der Forschung nicht nur die langfristige Zukunft des<br />
Faches <strong>und</strong> seine Fähigkeit in Frage stellen, neue Herausforderungen aufzunehmen;<br />
er würde — vermutlich schon viel früher — auch die beruflichen<br />
Chancen von Soziologen fast überall außerhalb von Hochschule <strong>und</strong> Forschung<br />
massiv verschlechtern. Auch wer der Meinung ist, daß ich die neuen<br />
Problemlagen, mit denen ich die Zukunftsaufgaben der Soziologie wie<br />
ihre zukünftigen Wirkungsmöglichkeiten begründe, stark überzeichnet<br />
habe, wird doch zugestehen müssen, daß der gegenwärtige Wissensbestand<br />
der Soziologie auf sehr vielen Gebieten nicht ausreicht, um eine sozialwissenschaftliche<br />
Praxeologie zu begründen, die im Zuge einer durchstrukturierten<br />
Lehre in professionelle Handlungskompetenz mit effektiven<br />
Arbeitsmarktchancen umgesetzt werden könnte.<br />
V<br />
Zwar wäre vermutlich auch ein wesentlich stärkeres Fach mit der Aufgabe<br />
überfordert, Probleme der eben genannten Art aus eigener Kraft wirklich<br />
befriedigend zu lösen, würde dies doch Ressourcen materieller <strong>und</strong> organisatorischer<br />
Art voraussetzen, die nicht auf der Ebene von einzelnen Fächern,<br />
sondern allenfalls auf der Ebene von Großinstitutionen verfügbar oder<br />
mobilisierbar sind. Andererseits ist die gegenwärtige Lage der Soziologie<br />
gewiß nicht so schlecht, daß sie die heute in Kollegenkreisen weithin um<br />
sich greifende, gelegentlich sogar heroisch stilisierte resignative Untätigkeit<br />
rechtfertigen würde. Ob das Fach — in erster Linie auf der Gr<strong>und</strong>lage<br />
von Forschungsleistungen tendenziell sehr innovativer Art — eine<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Zukunft hat oder sich am Ende des Jahrh<strong>und</strong>erts in der Abseitsposition<br />
eines eher feuilletonistischen Nebenfachs für Lehramtsbewerber <strong>und</strong><br />
Sozialarbeiter wiederfinden wird, ob sich Soziologie gegen die Konkurrenz<br />
anderer Disziplinen mit klarerem Bewußtsein der Interessen ihres Faches<br />
<strong>und</strong> ihrer Absolventen <strong>und</strong> mit größeren Fähigkeiten zu ihrer Durchsetzung<br />
wird behaupten können oder nicht — dies wird zumindest im Sinne einer<br />
notwendigen (wenngleich nicht hinreichenden) Bedingung von den Soziologen<br />
selbst abhängen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
DIE GESELLSCHAFTLICHE DYNAMIK ALS THEORETISCHE<br />
HERAUSFORDERUNG<br />
Renate Mayntz<br />
Auf dem letzten Soziologentag war viel von der Krise der modernen Gegenwartsgesellschaft<br />
die Rede, wobei am Ende offenblieb, ob die empf<strong>und</strong>ene<br />
Krise wirklich eine ist. Unbestreitbar ist aber wohl die Existenz einer verbreiteten<br />
Furcht vor krisenhaften Entwicklungen, die möglich scheinen, ob<br />
1<br />
wohl niemand sie will. Man braucht auch nicht erst die bekannten Schreckgespenste<br />
der ausufernden Massenarbeitslosigkeit, der irreversiblen Umwelt<br />
2<br />
schädigung, des Zusammenbruchs der Weltwirtschaft oder des Atomkriegs<br />
heraufzubeschwören. Die letzte Dekade hat uns eine Vielzahl weniger apokalyptischer<br />
Entwicklungen beschert, die unerwünscht <strong>und</strong> meist auch unerwartet<br />
waren <strong>und</strong> dazu führten, daß die Planungseuphorie der späten<br />
60er <strong>und</strong> 70er Jahre von einem f<strong>und</strong>amentalen Mißtrauen in unsere Fähigkeit<br />
abgelöst wurde, die Dynamik sozialer, technischer <strong>und</strong> ökonomischer<br />
Entwicklungen zu beherrschen. Die Konjunktur des Themas der Regierbarkeit<br />
bzw. Unregierbarkeit ist ein Indikator für dieses Ohnmachtsgefühl, das<br />
sich paradoxerweise in einer Epoche ausbreitet, in der weltweit in einem nie<br />
vorher dagewesenen Maß versucht wird, die genannten Entwicklungen<br />
steuernd in den Griff zu bekommen.<br />
Als Sozialwissenschaftler betrifft uns dies alles nicht nur vital, sondern<br />
auch im Kern unseres professionellen Selbstverständnisses. Der Politiker wie<br />
jeder, der Entwicklungen handelnd zu beeinflussen sucht, kann sich am Ende<br />
immer damit entschuldigen, daß ihm Macht <strong>und</strong> Mittel fehlten, um eine<br />
bestimmte Wirkung hervorzubringen oder etwas Gefürchtetes zu verhindern.<br />
Vom Sozialwissenschaftler aber wird erwartet, bzw. wir erwarten von<br />
uns selbst, daß wir die <strong>gesellschaftliche</strong> Dynamik, die zu Wertewandel <strong>und</strong><br />
neuen sozialen Bewegungen, zur kontraintuitiven Wirkung mancher staatlichen<br />
Intervention oder auch zu gefürchteten künftigen Ereignissen führt,<br />
wenigstens verstehen. Hier erzeugt jedoch ein summarischer Blick über das,<br />
was unsere Disziplin leistet, ein mindestens a<strong>mb</strong>ivalentes Gefühl. Einerseits<br />
scheint es, daß wir ein außerordentlich hohes Reflexionsniveau erreicht haben.<br />
Die Sozialwissenschaften registrieren viele <strong>gesellschaftliche</strong> Vorgänge<br />
<strong>und</strong> Veränderungen recht sensibel <strong>und</strong> machen sie sofort nach ihrem Auftreten<br />
zum Gegenstand intensiver Analysen; man braucht sich nur einmal<br />
zu vergegenwärtigen, wieviel in den vergangenen Jahren über neue soziale<br />
Bewegungen, Wertewandel, die Auswirkungen moderner Technologien, unkonventionelle<br />
Formen politischer Partizipation <strong>und</strong> andere aktuelle Themen<br />
mehr geschrieben worden ist. Andererseits muß die Tatsache irritieren,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
daß viele Entwicklungen <strong>und</strong> Ereignisse, die wir post factum zumindest zu<br />
unserer eigenen Zufriedenheit erklären können, uns in ihrem Auftreten fast<br />
immer überraschen.<br />
Vordergründig kann man derartige Überraschungserlebnisse mit dem<br />
Hinweis auf prinzipielle Grenzen der Prognostizierbarkeit spezifischer Ereignisse<br />
abtun. Die Geschichte ist, in den Worten von Michel Serres, der<br />
„Ort der zureichenden Ursachen ohne Wirkung, der gewaltigen Wirkungen<br />
aus unbedeutenden Gründen, der starken Folgen aus schwachen Ursachen,<br />
der strikten Effekte aus zufälligen Gründen". Spezifische Entwicklungspfade<br />
erscheinen oft nur retrospektiv als notwendiges Ergebnis der jeweili<br />
3<br />
gen Umstände. Aber auch, wenn wir im einzelnen nicht vorhersagen können,<br />
sollten wir — sofern es überhaupt sinnvoll ist, nach einer Gesellschafts<br />
4<br />
theorie (im Unterschied zu einer Theorie sozialen Verhaltens) zu suchen —<br />
doch wenigstens in der Lage sein, die uns überraschenden Entwicklungen als<br />
individuelle Erscheinungsformen eines generelleren Musters zu erkennen.<br />
Auch in dynamischen <strong>und</strong> nicht voll determinierten Systemen sollte in anderen<br />
Worten möglich sein, was von Hajek als pattern prediction bezeichnet<br />
hat. Tatsächlich aber scheinen unsere Analysen nicht nur den realen Entwicklungen<br />
hinterherzuhinken; wir haben aus ihnen auch erstaunlich wenig<br />
5<br />
für ein prinzipielles Verständnis der besonderen Dynamik hochkomplexer<br />
sozialer Systeme gelernt. Dadurch aber erhalten auch zunächst befriedigende<br />
Ad-hoc-Erklärungen überraschender Entwicklungen einen beunruhigenden<br />
Grad an Beliebigkeit: so wie sie sind, leuchten sie ein, aber man fragt<br />
sich, ob es sich wirklich um mehr als prinzipiell austauschbare Deutungen<br />
handelt. Das Eingeständnis jedoch, kein Wissen, sondern nur wechselnde<br />
Situationsdefinitionen zu produzieren, muß zwangsläufig das Vertrauen in<br />
die Erklärungskraft unserer theoretischen Paradigmen zerstören.<br />
Ein derart skeptisches Urteil kann allerdings höchstens die Makro<strong>soziologie</strong><br />
betreffen, <strong>und</strong> auch sie ganz speziell hinsichtlich des Anspruchs, Prozesse<br />
<strong>und</strong> Entwicklungen erklären zu können, die als Ergebnis der Verflechtung<br />
zahlreicher Einzelhandlungen ungeplant auftreten. In der Mikro<strong>soziologie</strong><br />
<strong>und</strong> in den Bindestrich<strong>soziologie</strong>n findet dagegen zweifellos nicht nur<br />
ein Wechsel von theoretischen Ansätzen, sondern auch ein Wachstum empirisch<br />
zunehmend gesicherter Theorien mittlerer Reichweite statt. 6 Aus unserem<br />
Verständnis der Vorgänge in Familie <strong>und</strong> Betrieb, von kommunalen<br />
Machtstrukturen <strong>und</strong> bei politischen Wahlen folgt jedoch nicht ohne weiteres<br />
die Einsicht in die spezifische Dynamik des <strong>gesellschaftliche</strong>n Makrosystems.<br />
Ähnliches gilt für strukturelle Forschungsansätze, die mit aggregierten<br />
Individualdaten arbeiten, wie z.B. die Schichtungsforschung, die<br />
eher ein bestimmtes Resultat <strong>gesellschaftliche</strong>r Entwicklung nachzeichnet<br />
als unser Verständnis der Systemdynamik zu erhöhen.<br />
Das Fehlen einer erklärungskräftigen Theorie <strong>gesellschaftliche</strong>r Dynamik<br />
ist nun allerdings kaum die Folge einer leicht vermeidbaren, sozusagen<br />
schuldhaften Ignoranz. Die Leichtigkeit, mit der wir in abstrakten Begriffen<br />
über Gesellschaften, ja über die Weltgesellschaft sprechen können, täuscht<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
über die kognitiven Probleme hinweg, die sich uns angesichts eines Gegenstands<br />
stellen, der unsere Möglichkeiten direkter Erfahrung so weit übersteigt,<br />
wie es das Ganze einer modernen Gesellschaft tut. Vielleicht haben<br />
einige von Ihnen den Science-Fiction-Film gesehen, in dem ein mutiger Abwehrspezialist<br />
sich soweit miniaturisieren läßt, daß er mit einer Injektionsnadel<br />
in die Blutbahn eines genialen Wissenschaftlers gebracht werden kann,<br />
der durch eine Thro<strong>mb</strong>ose akut gefährdet ist. Was den Film faszinierend<br />
macht, sind die langen Passagen mit Aufnahmen aus dem Inneren des<br />
menschlichen Körpers, vor allem von Blutgefäßen verschiedenen Durchmessers,<br />
die dem miniaturisierten Agenten wie ein verwirrendes System von Kanälen,<br />
Schleusen <strong>und</strong> Strudeln erscheinen, in dem er sich nur deshalb einigermaßen<br />
orientieren kann, weil er als ausgewachsener Mensch den Bauplan<br />
des Körpers kannte. Wir aber sind, wenn Sie mir diese organizistische Metapher<br />
nachsehen, in der Lage einer ganz normalen Zelle, von der man verlangt,<br />
sich aus dem, was aus ihrer Mikroperspektive an Erfahrung möglich<br />
ist, ein zutreffendes Bild des Körpers als einem funktionierenden Ganzen zu<br />
machen. Gegenstände wie die Familie, Organisationen oder auch das Funktionieren<br />
des Wahlsystems können wir noch direkt erfahren; die Gesellschaft<br />
der B<strong>und</strong>esrepublik oder der USA können wir uns aber beim besten<br />
Willen nicht mehr konkret vorstellen.<br />
Der Gr<strong>und</strong> für diese kognitiven Schwierigkeiten liegt nicht schon in der<br />
Größe des Gegenstands, sondern im wesentlichen in der enormen Komplexität<br />
seines Aufbaus <strong>und</strong> der damit zusammenhängenden spezifischen Dynamik.<br />
Die modernen Gegenwartsgesellschaften sind gleichzeitig segmentär<br />
differenziert, in mehrfacher Hinsicht geschichtet <strong>und</strong> hochgradig arbeitsteilig,<br />
so daß sie sich als ein System komplex ineinander geschachtelter, einander<br />
überlagernder <strong>und</strong> miteinander verwobener Handlungssysteme präsentieren.<br />
Dabei war es ganz wesentlich die technische Entwicklung, die einerseits<br />
die Arbeitsteilung beschleunigt <strong>und</strong> die Organisationsbildung gefördert<br />
hat, darüber hinaus aber auch unmittelbar neue Verflechtungszusammenhänge<br />
in Gestalt jener extensiven sozio-technischen Systeme erzeugt hat,<br />
die sich auf der Gr<strong>und</strong>lage der modernen Energie-, Verkehrs- <strong>und</strong> Kommunikationstechniken<br />
gebildet haben. Diese Art des strukturellen Aufbaus hat<br />
wichtige Folgen für die interne Dynamik derartiger Gesellschaften. Wie<br />
schon Herbert Spencer wußte, wächst mit dem Maß der funktionellen Differenzierung<br />
die Interdependenz zwischen den Teilen eines Ganzen, ein Prozeß,<br />
bei dem auch die erhöhte Kommunikationsdichte in modernen Gesellschaften<br />
eine wichtige Rolle spielt. Allerdings sind die verschiedenen Teilsysteme<br />
zwar interdependent, gleichzeitig aber oft nur lose miteinander ge<br />
7<br />
koppelt. In derartigen Systemen haben Einzelereignisse typischerweise vielfache<br />
Folgen <strong>und</strong> vor allem schwer vorhersehbare Fernwirkungen. Die charakteristische<br />
Binnenstruktur der modernen Gesellschaften bedeutet zugleich,<br />
daß es eine große Vielzahl von Akteuren oder Handlungszentren<br />
gibt, von denen viele in erheblichem Maße über Ressourcen <strong>und</strong> technische<br />
Instrumente zur Verfolgung ihrer Ziele verfügen. Was daraus an Wechsel-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Wirkungen entsteht, ist weder spontan abgestimmt noch 'gesetzmäßig' determiniert.<br />
Die Existenz von Handlungsspielräumen für eine große Zahl von<br />
Akteuren erhöht vielmehr trotz aller Abstimmungsbemühungen die Wahrscheinlichkeit,<br />
daß z.B. aus dem Zusammentreffen von absichtsvoller politischer<br />
Intervention mit dem an eigenen Zielen orientierten Handeln von<br />
Organisationen <strong>und</strong> Einzelpersonen etwas resultiert, was von keinem der<br />
Beteiligten beabsichtigt <strong>und</strong> i.d.R. auch nicht vorhergesehen wurde. Die<br />
8<br />
uns oft überraschende <strong>und</strong> politische Steuerungsbemühungen frustrierende<br />
Dynamik moderner Gegenwartsgesellschaften, die anscheinende Indeterminiertheit<br />
mancher <strong>gesellschaftliche</strong>n Vorgänge ist insofern das Ergebnis<br />
ganz bestimmter historischer Entwicklungen — kein Merkmal alles Sozialen<br />
schlechthin, sondern das Spezifikum eines bestimmten Gesellschaftstyps.<br />
Hält man trotz dieser Eigenart unseres Erkenntnisgegenstandes am Ziel<br />
einer empirisch f<strong>und</strong>ierten, erklärungskräftigen Gesellschaftstheorie fest,<br />
die nicht nur etwas über Beschaffenheit <strong>und</strong> Bildung sozialer Ordnungen<br />
oder auch Konfliktstrukturen zu sagen weiß, sondern auch zum Verständnis<br />
dynamischer Vorgänge in komplexen sozialen Systemen führt, dann<br />
muß man fragen, warum die heute vorherrschenden theoretischen Paradigmen<br />
diesem Erkenntnisinteresse offensichtlich nicht genügen.<br />
Angesichts der besonderen Fragestellung, um die es hier geht, könnte<br />
man versucht sein, den zentralen Mangel in einer Vernachlässigung von Prozeßtheorien<br />
im Bereich der heutigen Makro<strong>soziologie</strong> zu suchen. Dagegen<br />
9<br />
spricht allerdings die Konjunktur von Modernisierungstheorien in den 60er<br />
Jahren ebenso wie die neuere Renaissance evolutionstheoretischer Ansätze,<br />
ganz zu schweigen von dem lebhaften Interesse für besondere Veränderungsprozesse<br />
wie den technischen Wandel, die Rationalisierung oder die Entwicklung<br />
einer postindustriellen Gesellschaft. Das Defizit liegt also nicht im<br />
Verkennen von Wandlungsvorgängen, sondern eher in einer unzureichenden<br />
Analyse der Prozeßmechanismen sowie in dem vorherrschenden Interesse<br />
für längerfristige, mehr oder weniger lineare Trends in der Veränderung einzelner<br />
Systemmerkmale. Es ist diese Betrachtungsweise, die uns manche<br />
der eingangs angesprochenen Überraschungen beschert hat. Wie unerwartet<br />
schnell ist z.B. die skeptische Generation abgetreten, hat sich das Ende der<br />
Ideologie in sein Gegenteil verkehrt, sind im Schoß der auf Wissen <strong>und</strong> Information<br />
basierenden postindustriellen Gesellschaft neue Irrationalismen<br />
entstanden. Die Fixierung auf lineare Trends hat dazu geführt, daß uns<br />
Entwicklungen wie die Ausbreitung der informellen Ökonomie, die Entdifferenzierungsphänomene<br />
z.B. im medizinischen Bereich oder auch die<br />
10<br />
Renaissance des Regionalismus in ihrem scheinbar plötzlichen Auftreten<br />
überrascht haben. Nicht, daß es keine Trends z.B. einer wachsenden Differenzierung,<br />
Bürokratisierung oder Verwissenschaftlichung gäbe. Sie sind<br />
aber, wie Norbert Elias am Beispiel der politischen Zentralisierung so schön<br />
gezeigt hat , oft bloß das Ergebnis der zeitweiligen Dominanz einer Tendenz<br />
im Widerspiel gegenläufiger Kräfte <strong>und</strong> neigen schon deshalb zu Brü<br />
11<br />
chen <strong>und</strong> Umkehrungen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Die Konzentration auf langfristige Veränderungen führt außerdem zur<br />
Vernachlässigung dessen, was man den prozessualen Mikrobereich nennen<br />
könnte, d.h. die Vielzahl kurzfristiger, sich häufig konterkarierender Abläufe<br />
<strong>und</strong> das, was ihnen an Wirkungsmechanismen zugr<strong>und</strong>eliegt. Gewiß wird<br />
bei der Betrachtung längerfristiger <strong>gesellschaftliche</strong>r Veränderungen oft<br />
nach den zentralen Antriebskräften des Prozesses gefragt, ob man diese nun<br />
im Klassenantagonismus, den evolutionären Prinzipien von Anpassung <strong>und</strong><br />
Auslese oder der immanenten Logik einer kognitiven oder moralisch-praktischen<br />
Entwicklung sieht. Zur Erklärung kurzfristiger dynamischer Vorgänge,<br />
die aus der Summierung <strong>und</strong> Verflechtung zahlreicher Handlungen unter<br />
bestimmten strukturellen Bedingungen hervorgehen, reicht der Hinweis<br />
auf einen zentralen Antriebsfaktor jedoch nicht aus. Sowohl die Fragestellungen<br />
wie die analytische Perspektive vieler Wandlungstheorien sind insofern<br />
wenig geeignet, unser Verständnis für die Systemdynamik der Gegenwartsgesellschaften<br />
entscheidend zu erweitern.<br />
Raymond Boudon, der sich vor einigen Jahren ebenfalls einmal mit dem<br />
Problem der mangelhaften Erklärungskraft der Soziologie beschäftigt hat,<br />
riet damals, es den von ihm für wesentlich erfolgreicher gehaltenen Bevölkerungs-<br />
<strong>und</strong> Wirtschaftswissenschaften nachzutun, die ihren Gegenstand präzise<br />
abgrenzen, sich auf die Erfassung weniger Variablen beschränken <strong>und</strong> die<br />
empirische Forschung auf der Basis einer kleinen Anzahl logischer Paradigmen<br />
organisieren. 12 Die amerikanische Makro<strong>soziologie</strong> geht heute teilweise<br />
diesen Weg, was nicht zufällig mit der Wiederauferstehung des Homo Oeconomicus<br />
etwa in der Public-choice-Theorie oder auch in tauschtheoretischen Ansätzen<br />
verb<strong>und</strong>en ist. 13 Meiner Ansicht nach ist diese Rezeptur jedoch verfehlt<br />
<strong>und</strong> man braucht, um das zu sehen, nicht einmal auf die offensichtliche<br />
Erklärungsschwäche der gängigen ökonomischen Theorien zu verweisen. Niemand<br />
wird bestreiten, daß wir mit unseren beschränkten kognitiven Fähigkeiten<br />
gar nicht anders können, als zu vereinfachen. Dadurch werden aber Reduktion<br />
<strong>und</strong> Selektivität nicht schon zum Königsweg der Erkenntnis. Der<br />
Satz von der notwendigen Eigenkomplexität gilt auch für theoretische Systeme,<br />
mit denen man eine in struktureller <strong>und</strong> dynamischer Hinsicht komplexe<br />
<strong>und</strong> komplizierte Wirklichkeit erfassen will. Angesichts der Eigenart hochentwickelter<br />
Gegenwartsgesellschaften erscheint so jedes reduktionistische Forschungsprogramm,<br />
erscheinen alle Versuche der Beschränkung auf einige wenige<br />
Wirkungsprinzipien oder Strukturaspekte von vornherein als Irrwege. Die<br />
theoretische Herausforderung liegt ganz im Gegenteil darin, die Überlagerung<br />
verschiedener Strukturen <strong>und</strong> die Vielfalt von Abhängigkeitsbeziehungen zu<br />
erfassen <strong>und</strong> die vielen, manchmal isoliert voneinander ablaufenden, dann<br />
wieder sich gegenseitig beeinflussenden Prozesse gleichzeitig zu sehen. Gemessen<br />
an dieser Forderung ist gerade die theoretisch anspruchsvolle Makro<strong>soziologie</strong><br />
zu abstrakt <strong>und</strong> zu selektiv, was ich hier am Beispiel der Systemtheorie<br />
erläutern will — womit nicht gesagt ist, daß makrosoziologische Ansätze<br />
politökonomischer <strong>und</strong> kommunikationstheoretischer Provenienz in<br />
dieser Hinsicht weniger problematisch wären.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Die Vereinfachung findet zum einen auf der Abbildungsdimension statt.<br />
Niemand wird bestreiten, daß selbst ein vierfach ineinandergeschachteltes<br />
AGIL-Schema noch eine grobe Vereinfachung der Wirklichkeit ist. Nun ist<br />
Abstraktion, d.h. das Denken in Kategorien ohne unmittelbaren Bezug zur<br />
Alltagserfahrung, sicher unabweislich. Ebenso unabweislich für eine erklärungskräftige<br />
Theorie ist aber der Brückenschlag zurück zur Erfahrungsebene.<br />
Das AGIL-Schema, um bei diesem Beispiel zu bleiben, bezieht sich zwar<br />
auf Wirklichkeit, beansprucht aber keine deskriptive Gültigkeit, sondern<br />
dient eher als analytisches Ordnungsschema. Das ist in sich keineswegs zu<br />
kritisieren. Der Erkenntnisprozeß beginnt mit der kategorialen Ordnung<br />
der Welt; begriffliche Ordnungsschemata sind deshalb eigenständige wissenschaftliche<br />
Leistungen von hohem Wert. Das gilt auch für die Identifikation<br />
genereller Prinzipien, ob diese nun Interpenetration, Komplexitätsreduktion,<br />
Differenzierung oder Grenzziehung heißen. Aber wenn nicht einmal<br />
versucht wird, die Ordnungsschemata mit Empirie auszufüllen <strong>und</strong> die behaupteten<br />
Mechanismen <strong>und</strong> Entwicklungstendenzen an der Wirklichkeit<br />
zu überprüfen, dann bleibt die Theoriebildung auf halbem Wege stecken.<br />
Gleichzeitig vermitteln die umfassenden Abstraktionen leicht den falschen<br />
Eindruck, wir hätten die Struktur <strong>und</strong> Dynamik unserer Gesellschaften<br />
schon begriffen. Jeder, der in der bekannten systemtheoretischen Sprache<br />
argumentiert, meint wohl im Zweifelsfall, daß er über Wirklichkeit redet.<br />
Trotzdem können wir auf dieser Abstraktionsebene oft nicht mehr sicher<br />
sein, ob wir nicht nur in den Ästen semantischer Bäume herumturnen <strong>und</strong><br />
als eine Art Scholastiker des 20. Jhdts. die Glöckchen eines begrifflichen<br />
Glasperlenspiels klingen lassen. So kann es kommen, daß wir vielleicht nicht<br />
einmal merken, wie wenig wir z.B. die konkrete Binnenstruktur verschiedener<br />
funktioneller Teilsysteme — vielleicht mit Ausnahme des politischen —<br />
<strong>und</strong> ihre derzeitigen Veränderungstendenzen kennen. Ähnliches gilt für<br />
Prozesse wie die behauptete Verselbständigung von Teilsystemen, die Entwicklung<br />
spezifischer Teilrationalitäten oder auch die gegenläufige Tendenz<br />
der Interpenetration.<br />
Systemtheoretische Ansätze sind aber nicht nur durch das Maß ihrer<br />
Abstraktion von der Wirklichkeit, sondern auch durch eine in inhaltlicher<br />
Hinsicht selektive Perspektive gekennzeichnet. Parsons selbst, der hier eher<br />
in der Nachfolge Durkheims als Webers steht, war bekanntlich vom Problem<br />
sozialer Ordnung fasziniert. Seinem Ansatz ist immer schon kritisch entgegengehalten<br />
worden, daß er es kaum erlaube, Wandlungsprozesse, zumal<br />
solche, die mit Konflikten zu tun haben, adäquat zu behandeln. Daß Gleichgewichtsmodelle<br />
für die Analyse sozialer Prozesse durchaus fruchtbar sein<br />
können, hat Neil Smelser gezeigt. Was dagegen bei Parsons' Ansatz den<br />
15<br />
Zugang zur <strong>gesellschaftliche</strong>n Dynamik verstellt, ist die selektive Berücksichtigung<br />
normativer Strukturen. Dieser Strukturbegriff betont in erster<br />
Linie den Aspekt des relativ Stabilen statt der Besonderheit von Anordnungsmustern,<br />
<strong>und</strong> was die Beziehungen zwischen den Elementen des Ganzen<br />
betrifft, geraten vor allem normativ geregelte Interaktionen in den Blick.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Für das Verständnis dynamischer Vorgänge sind jedoch gerade nicht normativ<br />
geregelte Beziehungen <strong>und</strong> vor allem die weit verästelten <strong>und</strong> nicht mit<br />
stabilen Interaktionsbeziehungen zusammenfallenden funktionellen Abhängigkeiten<br />
von ganz besonderer Bedeutung. Eine weitere Folge des auf dem<br />
Wege über die Rollentheorie für einen großen Teil der heutigen Soziologie<br />
bestimmend gewordenen normativen Paradigmas ist die Vernachlässigung<br />
reaktiver Verhaltensprägungen, die ebenfalls für die soziale Dynamik von<br />
ganz besonderer Bedeutung sind.<br />
Die neuere deutsche Systemtheorie folgt Parsons zwar nicht in seiner<br />
selektiven Betonung normativer Strukturen, aber indem sie ihren Kernbegriff<br />
des Handlungssystems als Zusammenhang sinnhaft miteinander verb<strong>und</strong>ener<br />
Handlungen versteht, vernachlässigt auch sie zwangsläufig jene<br />
wichtigen indirekten Abhängigkeitsbeziehungen, die z.B. dazu führen können,<br />
daß als Folge der amerikanischen Gesetzgebung zur Lebensmittelkennzeichnung<br />
über mehrere Schritte hinweg am Ende die Zahl der Badetouristen<br />
in Hawaii zurückgeht. 15 Die Dynamik komplexer sozialer Systeme wird zu<br />
einem guten Teil von aggregativen <strong>und</strong> kumulativen Effekten, von Neben<strong>und</strong><br />
Fernwirkungen menschlichen Handelns bestimmt, die typischerweise<br />
jenseits des individuellen Sinnhorizonts liegen. Ein selektives Interesse für<br />
Sinnzusammenhänge geht an diesen Phänomenen leicht vorbei.<br />
Eine weitere folgenschwere Selektivität des Begriffs des Handlungssystems<br />
liegt darin, daß er von konkreten Personen abstrahiert, die der Systemumwelt<br />
zugerechnet werden (was ähnlich für Parsons' Begriff des "social<br />
System" gilt). Obwohl gerade die soziologische Systemtheorie in all ihren<br />
Varianten immer wieder Anstrengungen gemacht hat, die mikrosoziologische<br />
Analyse sozialen Handelns mit der makrosoziologischen Analyse <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Prozesse zu verbinden, sind diese Versuche weithin bei bloßen<br />
begrifflichen Lösungen stehengeblieben. Handlungstheorie <strong>und</strong> Systemtheorie<br />
können aber nicht schon deshalb als miteinander integriert gelten,<br />
weil auf beiden Ebenen dieselben analytischen Kategorien benutzt werden.<br />
Ebensowenig kann eine Gesellschaftstheorie, in der zwar Handlungen vorkommen,<br />
aber in der nicht zu erklären versucht wird, warum bestimmte<br />
Akteure unter gegebenen Umständen auf eine bestimmte Weise handeln,<br />
jemals die Frage beantworten, warum ganz spezifische Selektionen <strong>und</strong> damit<br />
auch Strukturbildungen stattfinden. So gilt auch für diese Ansätze, was<br />
Karl Martin Bolte kürzlich im Zusammenhang mit einem Plädoyer für eine<br />
stärker subjektorientierte Soziologie gesagt hat: „Obwohl jeder theoretische<br />
Ansatz der Soziologie letztlich irgendwie die Tatsache im Blick hat, daß Gesellschaft<br />
von Menschen 'gemacht' wird <strong>und</strong> daß Menschen in ihrem Denken<br />
<strong>und</strong> Handeln zu einem nicht unerheblichen Teil Produkte von Gesellschaft<br />
sind, lenken bestimmte Theorieansätze ... den Blick des Forschers<br />
aber geradezu von dieser Tatsache fort <strong>und</strong> lassen sie über die Betonung anderer<br />
Aspekte fast in Vergessenheit geraten." 16 Die Integration von Handlungs-<br />
<strong>und</strong> Gesellschaftstheorie ist dabei speziell im Hinblick auf die Erklärung<br />
von Makrophänomenen prekär. Die Wirkung des jeweiligen sozialen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Kontextes für das Handeln von Individuen, aber auch für Struktur <strong>und</strong> Verhalten<br />
von Organisationen wird viel eher systematisch berücksichtigt als die<br />
umgekehrte Richtung, das Entstehen von Makrophänomenen aus der Verflechtung<br />
<strong>und</strong> Summierung motivierten Handelns.<br />
Das Unbehagen über die mangelnde Erklärungskraft von dominanten<br />
theoretischen Paradigmen speziell für bestimmte dynamische Phänomene<br />
manifestiert sich in jüngster Zeit u.a. in einer Renaissance des Interesses am<br />
Phänomen unbeabsichtigter Handlungsfolgen. Nun sind derartige unbeabsichtigte<br />
Handlungsfolgen sowohl „ein trivialer Alltagstatbestand" als<br />
18<br />
17<br />
auch ein in den Sozialwissenschaften von Anfang an thematisiertes Phänomen,<br />
das, von Popper 1961 zum zentralen Thema sozialwissenschaftlicher<br />
Forschung erhoben, schon von den schottischen Moralphilosophen angesprochen<br />
wurde. Die Renaissance des Themas hat gewiß etwas mit dem<br />
19<br />
Erlebnis mißlungener ökonomischer <strong>und</strong> gesellschaftspolitischer Steuerung<br />
in jüngerer Zeit zu tun. Unbeabsichtigte Handlungsfolgen sind für individuelle<br />
<strong>und</strong> kollektive, private <strong>und</strong> staatliche Akteure in dem Maße ein prak<br />
20<br />
tisches Problem, wie sie zielorientiert handeln, was heißt, daß dieses praktische<br />
Problem auf <strong>gesellschaftliche</strong>r Ebene mit dem Maß unseres Steuerungsanspruchs<br />
wächst. Daß dies nicht nur ein spezifisch politischer Steuerungsanspruch<br />
sein muß, zeigt symptomatisch das in den USA viel beachtete<br />
Buch des Journalisten Richard Louv, in dem er argumentiert, daß die Amerikaner<br />
als Volk dabei sind, eine Art von Gesellschaft zu schaffen, die sie so<br />
überhaupt nicht wollen. Es ist gerade die hier zum Ausdruck kommende<br />
21<br />
Spannung zwischen kollektiver Verursachung oder <strong>gesellschaftliche</strong>r Eigendynamik<br />
einerseits <strong>und</strong> Steuerungsansprüchen andererseits, die dem Thema<br />
der unbeabsichtigten Handlungsfolgen seine dauerhafte Faszinationskraft<br />
verleiht. Trotzdem ist van den Daele zuzustimmen, wenn er die diesem<br />
22<br />
Thema gewidmeten Beiträge des 20. Soziologentags dahingehend zusammenfaßt,<br />
daß die theoretische Bedeutung des Konzepts unbeabsichtigter<br />
Handlungsfolgen für die Soziologie marginal sei, da die Tatsache des Unbeabsichtigtseins<br />
für das, was da geschieht, von eher nebensächlicher Bedeutung<br />
ist. Die Diskussion unbeabsichtigter Handlungsfolgen ist theoretisch<br />
allerdings insofern durchaus von Interesse, als sie die Aufmerksamkeit auf<br />
das Problem der Transformation individueller Handlungen in kollektive<br />
Phänomene lenkt. Die relevanten Aggregateffekte usw. können jedoch genausogut<br />
auftreten, wenn zweckrational handelnde Individuen ihre Ziele<br />
23<br />
erreichen bzw. wenn überhaupt kein intentionales Handeln stattfindet, sondern<br />
Routineverhalten, Regelbefolgung oder affektive Reaktionen.<br />
Das Konzept der unbeabsichtigten Handlungsfolgen greift als Erklärungsansatz<br />
auch deshalb zu kurz, weil nicht systematisch danach gefragt<br />
wird, aufgr<strong>und</strong> welcher motivationalen <strong>und</strong> strukturellen Bedingungen bestimmte<br />
Arten kollektiver Phänomene entstehen. Hier führen die theoretischen<br />
Ansätze von Norbert Elias, Raymond Boudon <strong>und</strong> Crozier <strong>und</strong> Friedberg<br />
weiter 24 , die unabhängig voneinander entwickelt wurden, aber alle<br />
gleicherweise von der Beobachtung kontraintuitiver oder paradoxer Effekte<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
zw. unbeabsichtigter kollektiver Folgen individuellen Handelns angeregt<br />
wurden. Alle genannten Autoren setzen sich ausdrücklich vom normativen<br />
Paradigma ab <strong>und</strong> wollen mit einer gewissen Emphase den menschlichen<br />
Aktor wieder in die soziologische Theorie zurückholen. Gemeinsam ist ihnen<br />
schließlich vor allem, daß sie sich für strukturelle Konfigurationen interessieren,<br />
die sowohl das Handeln selbst wie auch das — typischerweise<br />
unbeabsichtigte — Produkt dieses Handelns prägen.<br />
Am umfassendsten <strong>und</strong> vermutlich auch bekanntesten ist der Ansatz<br />
von Norbert Elias, der einerseits in seiner Zivilisationstheorie zeigt, wie<br />
strukturelle Bedingungen die menschlichen Handlungsorientierungen beeinflussen,<br />
in seiner Schrift „Was ist Soziologie" aber zugleich versucht, systematisch<br />
eine Morphologie von Verflechtungszusammenhängen zu begründen,<br />
die neben einer strukturellen auch eine historisch-dynamische Komponente<br />
haben. Die Art des Verflechtungszusammenhangs prägt dabei nicht<br />
nur das Handeln, sondern wirkt sich zugleich auf das kollektive Handlungsergebnis<br />
aus. Eine der von ihm hierzu formulierten Regeln besagt z.B., daß<br />
je zahlreicher die beteiligten Handelnden <strong>und</strong> je geringer die Machtunterschiede<br />
zwischen ihnen sind, das Ergebnis ihrer Interaktion um so weniger<br />
zur Realisierung der Ziele irgendeines der Handelnden führen wird. 25 Diese<br />
<strong>und</strong> ähnliche Regeln mögen relativ leer erscheinen; Elias' Analyse des Königsmechanismus,<br />
der wesentlich an der Entstehung absolutistischer Territorialstaaten<br />
beteiligt war, zeigt aber, welches Erklärungspotential seinem<br />
Ansatz im Prinzip innewohnt. 26<br />
Ähnliches gelingt Boudon am Beispiel der paradoxen Auswirkungen verbesserter<br />
Bildungschancen auf die soziale Ungleichheit. Boudon unterscheidet<br />
im übrigen systematisch zwischen normativ regulierten <strong>und</strong> durch<br />
27<br />
faktische Abhängigkeit gekennzeichneten Interdependenzsystemen <strong>und</strong><br />
konzentriert sich sodann auf die letzteren. Das ist insofern wichtig, als<br />
28<br />
es sehr häufig Abhängigkeitsbeziehungen genau dieser Art sind, die zu den<br />
uns überraschenden Ergebnissen <strong>gesellschaftliche</strong>r Eigendynamik führen.<br />
Typischerweise spielen dabei — oft vielgliedrige — Handlungsketten eine<br />
Rolle, in denen zwischen den Handlungsergebnissen von A <strong>und</strong> den Handlungsmöglichkeiten<br />
von B Abhängigkeiten bestehen, die als solche gar nicht<br />
beabsichtigt <strong>und</strong> auch nicht sozial normiert sind; derartige Abhängigkeitsbeziehungen<br />
können am Ende als Verstärkung, Bumerangeffekt oder Selffulfilling<br />
prophecy gleichsam zu ihrem Anfangspunkt zurückkehren oder<br />
sich auch, wie Wellenkreise im Wasser, immer weiter davon entfernen.<br />
Während Boudon sich zunächst vor allem für unerwartete Aggregateffekte<br />
<strong>und</strong> weniger für den Einfluß struktureller Konfigurationen auf das Handeln<br />
des Einzelnen interessierte , ist die Akzentuierung bei Crozier <strong>und</strong><br />
29<br />
Friedberg fast umgekehrt. Für sie ist die Handlungssituation sowohl für die<br />
Wahl unmittelbarer Handlungszwecke wie auch für die Wahl von Strategien<br />
entscheidend; sie bietet dem Aktor sozusagen einerseits mögliche Ziele für<br />
sein Handeln an <strong>und</strong> legt ihm andererseits nahe, welche Mittel er einsetzen<br />
kann. Diese handlungstheoretische Perspektive ist deshalb so wichtig, weil<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
zur Erklärung kollektiver Phänomene nicht nur Einsicht in Handlungsverflechtungen<br />
<strong>und</strong> -summierungen, sondern auch in die Genese von spezifischen<br />
Handlungsweisen nötig ist. Tatsächlich werden wir nicht nur durch<br />
unerwartete Ergebnisse kollektiven Handelns, sondern oft auch durch dieses<br />
Handeln selbst überrascht, ob es dabei um das Investitionsverhalten von<br />
Firmen, den plötzlichen Vandalismus von Jugendlichen oder den Umschwung<br />
in der Einstellung zur modernen Technik geht. Verführt vom normativen<br />
Paradigma auf der einen <strong>und</strong> der Survey-Forschung auf der anderen<br />
Seite, die Meinungen <strong>und</strong> Handlungsweisen gern mit demographischen <strong>und</strong><br />
sozio-ökonomischen Merkmalen von Individuen korreliert, verstehen wir<br />
oft zu wenig, wie Menschen in einem bestimmten biographischen Kontext<br />
auf spezifische Situationen reagieren bzw. in ihnen agieren. Dabei hat sich<br />
ein auf die Beschaffenheit der Handlungssituation abstellender Erklärungsansatz<br />
hier <strong>und</strong> da schon hervorragend bewährt, so z.B. bei der Erforschung<br />
abweichenden Verhaltens , sozialer Bewegungen oder auch der Informationsnutzung.<br />
Ein adäquates Verständnis sozialer Dynamik verlangt also<br />
32<br />
30 31<br />
nicht nur eine Struktur-<strong>und</strong>-Prozeß-Theorie auf der Makroebene, sondern<br />
auch die systematische Integration der Lebensweltperspektive, allerdings<br />
nicht, wie das Randall Collins will , um Makrophänomene mikrosoziologisch<br />
aufzulösen, sondern ganz im Gegenteil, um sie als ihren Bestimmungs-<br />
3 3<br />
gr<strong>und</strong> zu sehen. Eine solche Forderung mag alte Berührungsängste der Soziologie<br />
gegenüber der Psychologie wachrufen. Wir sollten uns dadurch aber<br />
nicht zur Blindheit gegenüber der Tatsache verleiten lassen, daß es nicht selten<br />
unsere grob vereinfachten anthropologischen Prämissen gewesen sind,<br />
die zu Fehlprognosen <strong>und</strong> Fehlinterpretationen kollektiver Phänomene geführt<br />
haben. Unser Verständnis von Vorgängen wie z.B. dem in der Implementationsforschung<br />
oft beobachteten Auftreten von massiertem Wi<br />
34<br />
derstand <strong>und</strong> Verweigerung, wo infolge regulierender Interventionen wachsende<br />
Konformität erwartet wurde, wäre etwa bei Berücksichtigung der<br />
psychologischen Reactance-Theorie von vornherein besser gewesen; dasselbe<br />
gilt für die soziologische Erforschung komplexer Entscheidungsprozes-<br />
<strong>35</strong><br />
se <strong>und</strong> die neuere kognitive Psychologie. 36<br />
Ko<strong>mb</strong>iniert man die theoretischen Ansätze von Elias, Boudon <strong>und</strong><br />
Crozier, dann zeichnen sich die Konturen eines analytischen Paradigmas<br />
ab, das sich speziell für die Erklärung dynamischer Vorgänge in hochkomplexen<br />
sozialen Systemen eignet. Dabei geht es im Kern darum, Systemprozesse<br />
nicht nur in ihrer strukturverändernden Wirkung, sondern auch<br />
als Folge bestimmter struktureller Konfigurationen <strong>und</strong> der in ihnen beschlossenen<br />
Abhängigkeitsbeziehungen zu begreifen. Der strukturelle Kontext<br />
beeinflußt dabei einerseits das konkrete Handeln von Individuen, bestimmt<br />
aber gleichzeitig die Aggregateffekte, Nebenwirkungen usw. dieses<br />
Handelns. Es geht also darum, gleichzeitig <strong>und</strong> gleichgewichtig Struktur<br />
<strong>und</strong> Dynamik, Handeln <strong>und</strong> System miteinander zu verknüpfen, <strong>und</strong><br />
37<br />
zwar dergestalt, daß die dynamischen Konsequenzen von Strukturen<br />
über das Handeln von Individuen, die Rückwirkung dynamischer Vor-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
gänge auf Strukturen über die Systemeffekte individuellen Handelns erfolgen:<br />
System<br />
Um den skizzierten Ansatz gesellschaftstheoretisch fruchtbar zu machen,<br />
ist es notwendig, ihn sowohl in systematischer Hinsicht weiterzuentwickeln,<br />
wie auch zugleich bezogen auf moderne Gegenwartsgesellschaften zu konkretisieren.<br />
Es gibt auch bereits eine ganze Reihe von Einzelarbeiten <strong>und</strong><br />
38<br />
Forschungsrichtungen, die als Bausteine einer empirisch f<strong>und</strong>ierten Theorie<br />
sozialer Dynamik dienen können. Am ehesten überzeugen dabei vermutlich<br />
historisch gesättigte Monographien, die — im Gegensatz zu den meisten eher<br />
formalen analytischen Ansätzen — jenes Maß an Komplexität erreichen, das<br />
nötig ist, um den Eindruck von Wirklichkeitsnähe zu vermitteln. Ein gutes<br />
Beispiel solcher Monographien ist die neueste Arbeit von Burkart Lutz,<br />
der die Ursachen verschiedener ökonomischer Wachstumsschübe in den<br />
westlichen Industriegesellschaften untersucht hat. Gute empirische Beispiele<br />
speziell für das Wechselspiel zwischen Steuerungsversuchen <strong>und</strong> Ei<br />
39<br />
gendynamik liefert die Implementationsforschung, wenn sie die Reaktivität<br />
politischer Handlungsfelder aufzeigt, die durch die Veränderung der Handlungssituation<br />
von Gesetzesadressaten <strong>und</strong> Vollzugsträgern entsteht. Reiches<br />
Material bieten auch Untersuchungen über die „Entwicklungsdilem<br />
40<br />
mas" des Wohlfahrtsstaates sowie die Analysen von komplexen Entscheidungsprozessen,<br />
in denen zwischen dem auslösenden Entscheidungsproblem<br />
41<br />
<strong>und</strong> dem schließlichen Entscheidungsergebnis nur noch eine lockere Beziehung<br />
besteht. Gerade derartigen empirischen Studien fehlt jedoch<br />
42<br />
leicht das generalisierende Element, so daß sie mehr zu unserem Verständnis<br />
einzelner konkreter Abläufe als zur Entwicklung einer über sie hinausgehenden<br />
Theorie beitragen. Was deshalb notwendig erscheint, ist der bewußte<br />
Versuch eines Brückenschlags zwischen historisch gesättigten empirischen<br />
Studien einerseits <strong>und</strong> einer systematischen Weiter<strong>entwicklung</strong> des skizzierten<br />
Paradigmas andererseits. Auch hierzu gibt es bei näherem Zusehen eine<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ganze Reihe von Anknüpfungspunkten in den analytischen Kategorien <strong>und</strong><br />
Fragestellungen bestimmter neuerer Forschungsrichtungen.<br />
Zur Fortführung von Elias' Versuch einer systematischen Analyse der<br />
Struktur von Verflechtungszusammenhängen läßt sich etwa auf den organisationssoziologischen<br />
Ansatz interorganisatorischer Netzwerke (ION) wie<br />
auch auf andere Formen der Netzwerkanalyse sowie auf die mit durchaus<br />
ähnlichen Konzepten operierenden Arbeiten zur Politikverflechtung <strong>und</strong><br />
zum Neokorporatismus zurückgreifen. So unterschiedlich das anstoßgebende<br />
Erkenntnisinteresse der genannten Forschungsrichtungen ursprünglich<br />
auch gewesen sein mag, so bewußt ist man sich inzwischen der über das<br />
Netzwerkkonzept vermittelten Berührungspunkte geworden. Den Arbeiten<br />
in den genannten Gebieten ist gemeinsam, daß sie sowohl empirisch wie<br />
43<br />
auch auf Generalisierung bedacht sind. Sie beschränken sich auch nicht etwa<br />
auf morphologische Überlegungen, sondern interessieren sich speziell<br />
für die dynamischen Konsequenzen bestimmter struktureller Konfigurationen.<br />
So wird z.B. zu zeigen versucht, wie neokorporatistische Entscheidungsstrukturen<br />
sich auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken oder<br />
44<br />
wie der Netzwerkcharakter der am Vollzug eines Gesetzes beteiligten Implementationsinstanzen<br />
den Ablauf <strong>und</strong> Erfolg von Koordinations- <strong>und</strong><br />
Steuerungsversuchen, aber auch von kooperativen Handlungsergebnissen<br />
beeinflußt. Wichtig ist, daß in derartigen Untersuchungen nicht nur gefragt<br />
wird, wie bestimmte strukturelle Konfigurationen kollektive Hand<br />
45<br />
lungsergebnisse beeinflussen, sondern auch, wie die Netzwerkposition der<br />
einzelnen Akteure (zu der natürlich ihre Abhängigkeit von anderen Akteuren<br />
gehört) ihre Handlungsstrategien prägt. Vom Ansatz her werden diese<br />
Forschungsrichtungen damit der zuvor skizzierten doppelten Fragestellung<br />
gerecht.<br />
Allerdings sind nicht nur die einschlägigen Forschungsergebnisse noch<br />
lückenhaft. Auch die Ansätze selbst greifen bei der Analyse von realen Verflechtungszusammenhängen<br />
insofern noch zu kurz, als es sich bei den untersuchten<br />
Netzwerkbeziehungen i.d.R. um — vorgeschriebene oder faktische<br />
— Interaktionsbeziehungen oder über Personalunion vermittelte Verknüpfungen<br />
handelt; die so wichtigen indirekten Abhängigkeitsbeziehungen<br />
bleiben dabei meist ausgespart. Genau diese Abhängigkeitsbeziehungen<br />
müssen jedoch einbezogen werden, wenn wir verstehen wollen, wie sich in<br />
den modernen Gegenwartsgesellschaften die Abhängigkeitsmuster verändert<br />
haben — man denke in diesem Zusammenhang nur einmal an die schon<br />
erwähnten, umfassenden sozio-technischen Systeme, die teilweise zu einer<br />
Zentralisierung der Abhängigkeitsbeziehungen bei gleichzeitigem Verlust<br />
eingebauter Pufferzonen oder Red<strong>und</strong>anzen <strong>und</strong> damit zu einer ganz bestimmten<br />
Art von Verw<strong>und</strong>barkeit bestimmter Funktionsbereiche geführt<br />
haben, die u.a. für das Auftreten gewisser Arten von Katastrophen entscheidend<br />
sind. 46<br />
Auch in anderer Hinsicht ist der Ansatz interorganisatorischer Netzwerke<br />
erweiterungsbedürftig. So werden die untersuchten Netze gewöhnlich<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
um einen zentralen Prozeß oder Zweck herum konstruiert, der als Abgrenzungskriterium<br />
dient. Es wäre aber wichtig, Verflechtungszusammenhänge<br />
als Netzwerk aus Netzwerken zu sehen, als Ergebnis der Überlagerung verschiedener<br />
Handlungssysteme. Schließlich bestehen die analysierten Netzwerke<br />
i.d.R. auch nur aus formalen Organisationen, während die nicht or<br />
47<br />
ganisierten Bestandteile realer Verflechtungszusammenhänge, die Wechselbeziehungen<br />
der Organisationen mit dem je eigenen Publikum aus Haushalten<br />
<strong>und</strong> Einzelpersonen fehlen.<br />
Wenn der Netzwerkansatz entsprechend erweitert würde, ließe er sich<br />
auch für die vergleichende empirische Analyse der Binnenstruktur verschiedener<br />
funktioneller Teilsysteme <strong>und</strong> ihres Wandels verwenden. Da die in sozialen<br />
Netzwerken ablaufenden Interaktionen die ganz konkreten Wechselwirkungsprozesse<br />
nicht nur innerhalb, sondern auch zwischen verschiedenen<br />
funktionellen Teilsystemen der Gesellschaft darstellen, ist der Ansatz<br />
schließlich auch geeignet, das systemtheoretische Gesellschaftsmodell empirisch<br />
zu konkretisieren. Die Analyse der Struktur einzelner Politiksektoren<br />
(policy sectors) ist ein Schritt auf diesem Wege. Dabei läßt sich dann<br />
48<br />
auch die Rolle von Vermittlungsinstanzen berücksichtigen, die an der Grenze<br />
zwischen mehreren Teilsystemen angesiedelt sind <strong>und</strong> die in jüngster Zeit<br />
auch außerhalb des Kreises der Neokorporatismusforscher Aufmerksamkeit<br />
gef<strong>und</strong>en haben. 49<br />
•Die Analyse verzweigter <strong>und</strong> mehrgliedriger Abhängigkeitsbeziehungen,<br />
die zu nicht ohne weiteres vorhersehbaren Neben- <strong>und</strong> Fernwirkungen einzelner<br />
Ereignisse führen, haben sich andere Forschungsrichtungen zum Thema<br />
gewählt, für die hier die Technologiefolgenabschätzung (TA) stehen<br />
kann. Wenn auch in vielen der auf praktische Politikberatung abzielenden<br />
TA-Studien die Bewertung <strong>und</strong> gegenseitige Aufrechnung positiver <strong>und</strong> negativer<br />
Technikfolgen im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, geht es doch<br />
prinzipiell um Versuche der Rekonstruktion oder auch Antizipation jener<br />
Kausalketten, die die Ausbreitung <strong>und</strong> die Folgen der Nutzung einer neuen<br />
Technik bestimmen. Das zuvor skizzierte Paradigma paßt auf diese Prozesse<br />
insofern besonders gut, als die interessierenden Technikfolgen Aggre<br />
50<br />
gateffekte <strong>und</strong> mittelbare Wirkungen des motivierten Handelns von Produzenten<br />
<strong>und</strong> Anwendern sind, die mit ihrem Tun auf die Gegebenheiten der<br />
eigenen Handlungssituation reagieren. Die <strong>gesellschaftliche</strong>n Folgewirkungen<br />
ihres Handelns sind von diesen Motiven entkoppelt <strong>und</strong> werden weitgehend<br />
von anderen, den Nutzungsmodus prägenden Kontextfaktoren bestimmt.<br />
Allerdings schenken die meisten TA-Studien dem strukturellen<br />
Substrat <strong>und</strong> dem Prozeßcharakter der von ihnen untersuchten Auswirkungen<br />
keine besondere Aufmerksamkeit. Die Prozesse hängen, sozialwissenschaftlich<br />
gesprochen, in der Luft, wodurch Abschätzungen des Auftretens<br />
oder Ausbleibens bestimmter, bereits vorher als abhängige Variable definierter<br />
Folgewirkungen dem Leser auch leicht als unzureichend begründet, ja<br />
als Resultat der Methode „II x Daumen" erscheinen. Es käme also darauf<br />
an, das Nachzeichnen vielgliedriger Wirkungsketten systematisch mit einer<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Analyse der sozialen Strukturen, der Netzwerke aus organisierten <strong>und</strong><br />
nicht-organisierten Akteuren zu verbinden, deren Handeln dabei eine Rolle<br />
spielt. Entsprechende Brückenschläge werden neuerdings bereits versucht,<br />
so etwa in LaPortes Konzept von Technik als sozialer Organisation. 51<br />
Was in sozialen Systemen geschieht, ist natürlich nicht nur eine komplexe<br />
Aufsummierung bloßer Anpassungsreaktionen, wie sie bei TA-Studien im<br />
Vordergr<strong>und</strong> stehen. Erlebte Abhängigkeiten, erduldete Schädigungen<br />
durch das Tun von Akteuren, mit denen man noch nicht einmal in direkter<br />
Beziehung steht, lösen Gegenwehr aus <strong>und</strong> Versuche, die betreffenden Abhängigkeitsbeziehungen<br />
umzugestalten. Staatliche Steuerungsbemühungen,<br />
aber auch das Entstehen formaler Organisationen <strong>und</strong> ihre Verknüpfung<br />
zu interorganisatorischen Netzwerken mit geregelten Interaktionsbeziehungen<br />
oder die Entwicklung neokorporatistischer Entscheidungsstrukturen<br />
sind allesamt das Ergebnis derartiger Handlungsstrategien. Es erübrigt sich<br />
52<br />
fast zu betonen, daß die neu geschaffenen Strukturen die Handlungssituation<br />
der Akteure in einer oft kaum vorausgesehenen Art verändern <strong>und</strong> so<br />
am Ende z.B. neben oder sogar anstatt der erstrebten Handlungskoordination<br />
eine gegenseitige Blockierung bewirken.<br />
Negative Externalitäten oder Fernwirkungen als Folge indirekter Abhängigkeitsbeziehungen<br />
wie auch Aggregateffekte, die durch die schlichte<br />
Aufsummierung paralleler Einzelhandlungen entstehen, sind nur zwei —<br />
<strong>und</strong> zudem eher simple — Varianten, dynamischer Effekte. Theoretisch<br />
interessanter sind die von ThQmas Schelling so genannten interaktiven Effekte,<br />
die durch unbeabsichtigte wechselseitige Beeinflussung Zustandekommen<br />
bzw. die von Boudon analysierten Kompositionseffekte. Diesem<br />
53<br />
zentralen Teil des skizzierten Paradigmas ist bisher in den Sozialwissenschaften<br />
noch relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden, was wesentlich<br />
mit der Konzentration auf Interaktionsbeziehungen zusammenhängt.<br />
Selbst Boudon hat nicht versucht, die verschiedenen Typen der<br />
54<br />
von ihm analysierten Kompositionseffekte systematisch mit der Struktur<br />
von Verflechtungszusammenhängen zu verknüpfen <strong>und</strong> die Prozeßmechanismen<br />
zu identifizieren, die dabei eine Rolle spielen. Dabei gibt es viele<br />
vorzügliche, vor allem auch empirische Analysen sozialer Prozesse, in denen<br />
derartige Mechanismen dargestellt werden. In der Literatur über soziale Bewegungen<br />
findet sich z.B. reichhaltiges Material über Eskalationsmechanismen<br />
im Rahmen von Konfliktprozessen, die aus antagonistischen Strukturen<br />
erwachsen. Von anderer Art sind die Mechanismen <strong>und</strong> strukturellen<br />
55<br />
Ausgangsbedingungen kumulativer Prozesse, bei denen bestimmte Sättigungseffekte<br />
oder das Überschreiten von Schwellenwerten eine Rolle spielen.<br />
Den eher im Mikrobereich liegenden Beispielen, die Schelling hier zur<br />
Illustration benutzt — Veränderung räumlicher Verteilungsmuster <strong>und</strong><br />
56<br />
Besuchsfrequenzen von Veranstaltungen — könnte man auf <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Ebene die von Offe analysierten Mechanismen an die Seite stellen, die<br />
dazu führen, daß Recht <strong>und</strong> Geld als Steuerungsmittel infolge kumulierender<br />
negativer Nebenwirkungen an Wirksamkeit verlieren. Von großer Be-<br />
57<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
deutung sind auch strukturelle Spannungen, die sich aus der Gleichzeitigkeit<br />
von Bedürfnissen oder Handlungszielen ergeben, deren Maximierung<br />
sich gegenseitig ausschließt, so wie das bei Zentralisierung <strong>und</strong> Dezentralisierung,<br />
Koordination <strong>und</strong> Autonomie oder Flexibilität <strong>und</strong> Dauerhaftigkeit<br />
ist. Derartige strukturelle A<strong>mb</strong>ivalenzen können entweder zu einem<br />
Nebeneinander von Trend <strong>und</strong> Gegenbewegung oder auch zu Oszillationen<br />
führen; Norbert Elias' bereits erwähnte Analyse des Wechselspiels von Zentralisierung<br />
<strong>und</strong> Dezentralisierung im Prozeß der Staatenbildung ist eines<br />
von vielen möglichen Beispielen. Analytisch besonders anspruchsvoll sind<br />
schließlich bestimmte Arten von Ko<strong>mb</strong>inationseffekten, die sich entweder<br />
aus dem zufälligen (d.h. möglichen, aber nicht notwendigen, keiner Regel<br />
folgenden) Zusammentreffen verschiedener Umstände in einer Situation<br />
oder aus der wechselseitigen Beeinflussung mehrerer gleichzeitiger, aber im<br />
wesentlichen getrennt nebeneinanderlaufender Prozesse ergeben. Für den<br />
ersten Typ können Katastrophen 58 , für den zweiten der von Max Weber<br />
analysierte abendländische Rationalisierungsprozeß, aber auch die von<br />
Burkart Lutz untersuchten Wachstumsschübe, die jeweils auf ganz besonderen<br />
Faktorenkonstellationen beruhen, als Beispiele dienen. 59<br />
Gerade die zuletzt genannten Ko<strong>mb</strong>inationseffekte erinnern nachdrücklich<br />
an den kontingenten Charakter eigendynamischer, also nicht geplanter<br />
sozialer Abläufe. Unfälle <strong>und</strong> Katastrophen, aber auch Entdeckungen <strong>und</strong><br />
Erfindungen, Revolutionen <strong>und</strong> Kriege werden durch die jeweiligen Umstände<br />
ermöglicht, vielleicht sogar nahegelegt, aber wann, ja sogar ob sie<br />
stattfinden, ist nicht determiniert. Je eher dabei -ein bestimmtes Ereignis<br />
erwartbar ist <strong>und</strong> je deutlicher es entweder wiederholte, nicht darauf abzielende<br />
Handlungen oder einzelne, das Ereignis bewußt anstrebende Handlungen<br />
voraussetzt, um so eher läßt sich ihr Eintreten verhindern. Erkennbar<br />
zu irreversiblen Umweltschädigungen führendes Verhalten läßt sich, wenn<br />
diese Folge nicht zu plötzlich auftritt, unterbinden, revolutionäre Situationen<br />
können entschärft <strong>und</strong> Eskalationen gestoppt werden. Gesellschaftliche<br />
Entwicklung ist das Resultat des ständigen Wechselspiels von Eigendynamik<br />
<strong>und</strong> Steuerungsversuchen. Ob wir diese Entwicklung besser zu beherrschen<br />
lernen, hängt nicht nur von guten Absichten, sondern auch von<br />
rechtzeitigen Einsichten ab. Die Theorie sozialer Dynamik, die dieses leisten<br />
könnte, liegt noch nicht ausformuliert vor, aber es gibt einen Weg, der<br />
dahin führt, <strong>und</strong> viele von uns sind auf ihm bereits unterwegs. Die Soziologie<br />
hat die theoretische Herausforderung erkannt <strong>und</strong> aufgenommen.<br />
ANMERKUNGEN<br />
1 Peter Berger, „Die Krise, sofern es sie gibt Soziale Welt, Jg. 34/1983, S. 228-251.<br />
2 Hans Jonas bringt diese Gr<strong>und</strong>stimmung gut zum Ausdruck, wenn er von einer<br />
„apokalyptischen Situation" spricht; vgl. seinen Aufsatz "Responsibility Today.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
The Ethics of an Endangered Future", Social Research, 43/1976, S. 77-97, insbes.<br />
S. 82.<br />
3 Michel Serres, Der Parasit, Frankfurt/M. 1984 (1981), S. 38.<br />
4 Vgl. Baruch Fischhoff, "For those condemned to study the past: Heuristics and<br />
biases in hindsight", in: D. Kahnemann, P. Slovic, A. Tversky, Judgment <strong>und</strong>er<br />
uncertainty: Heuristics and biases, Ca<strong>mb</strong>ridge Mass. 1982, S. 341-349.<br />
5 F. v. Hajek, Die Theorie komplexer Phänomene, Tübingen 1972.<br />
6 Vgl. speziell hierzu auch die Beispiele des Theoriewachstums bei David G. Wagner<br />
<strong>und</strong> Joseph Berger, Do Sociological Theories Grow?, Bericht des Laboratory for<br />
Social Research, Stanford University, Septe<strong>mb</strong>er 1983.<br />
7 Henry Mintzberg zitiert in diesem Zusammenhang ausführlich Anthony Jay, der die<br />
Tatsache, daß das Römische Reich so groß werden konnte <strong>und</strong> so lange überlebte,<br />
unmittelbar mit den damaligen — wenig entwickelten — Verkehrs- <strong>und</strong> Kommunikationsmöglichkeiten<br />
in Zusammenhang bringt, die eine größere Selbständigkeit der<br />
einzelnen Reichsgebiete erlaubten <strong>und</strong> erforderten; vgl. H. Mintzberg, The Structuring<br />
of Organizations, Englewood Cliffs N.J. 1979, S. 420.<br />
8 Vgl. hierzu auch Norbert Elias, Was ist Soziologie?, <strong>München</strong> 1981, S. 74: „Die zunehmende<br />
Undurchschaubarkeit, die wachsende Komplexität der Verflechtungen,<br />
die offensichtlich verringerte Möglichkeit irgendeines einzelnen, selbst des nominell<br />
mächtigsten Menschen, für sich allein <strong>und</strong> unabhängig von anderen Entscheidungen<br />
zu treffen, das ständige Hervorgehen von Entscheidungen im Zuge von mehr<br />
oder weniger regulierten Machtproben <strong>und</strong> Machtkämpfen vieler Menschen <strong>und</strong><br />
Gruppen, alle diese Erfahrungen bringen es Menschen stärker zum Bewußtsein, daß<br />
es anderer, unpersönlicherer Denkmittel bedarf, um diese wenig transparenten <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Zusammenhänge zu begreifen oder gar zu kontrollieren."<br />
9 Das meint etwa Martin Broicher: Zu den Begriffen „Sozialer Prozeß" <strong>und</strong> „Eigendynamik"<br />
in: Birgitta Nedelmann (Hg), Eigendynamische soziale Prozesse, vervielfältigtes<br />
Manuskript, Freiburg 1982, S. 74-92.<br />
10 Heinrich Bollinger, Joachim Hohl, „Auf dem Weg von der Profession zum Beruf.<br />
Zur Deprofessionalisierung des Ärzte-Standes", in: Soziale Welt 4/1981, S. 440-<br />
464.<br />
11 Norbert Elias, Über den Prozeß der Zivilisation, Bd. 2, Wandlungen der Gesellschaft,<br />
Frankfurt/M., 1976.<br />
12 Raymond Boudon, Widersprüche sozialen Handelns, Darmstadt/Neuwied 1979,<br />
S. 31.<br />
13 Stellvertretend für viele können hier das Buch von Mancur Olson, The Rise and<br />
Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities, New<br />
Haven Conn. 1982, <strong>und</strong> die Studie von John Chubb, Enterest Arups and Ahe<br />
Bureaucracy. The Kolitis Bf Energy, Stanford CA 1982, stehen.<br />
14 Neil J. Smelser, "Toward a General Theory of Social Change", in: ders., Essays<br />
in Sociological Explanation, Englewood Cliffs N.J. 1968.<br />
15 Dieses Beispiel findet sich bei Maurice N. Richter, Technology and Social Complexity,<br />
Albany 1982, S. 91.<br />
16 Karl-Martin Bolte, Erhard Treutner (Hg), Subjektorientierte Arbeits- <strong>und</strong> Berufs<strong>soziologie</strong>,<br />
Frankfurt/M. 1980, S. 15.<br />
17 Vgl. die Beiträge in: Lebenswelt <strong>und</strong> soziale Probleme. Verhandlungen des 20.<br />
Deutschen Soziologentags zu Bremen 1980, hg. von J. Matthes, Frankfurt/M.<br />
1981.<br />
18 Wolfgang van den Daele, „'Unbeabsichtigte Folgen' sozialen Handelns — Anmerkungen<br />
zur Karriere des Themas", in: Matthes 1981 [Anm. 17], S. 237.<br />
19 Reinhard Wippler, „Erklärungen unbeabsichtigter Handlungsfolgen: Ziel oder Meilenstein<br />
soziologischer Theoriebildung", in: Matthes 1981 [Anm. 17], S. 246-261.<br />
20 So auch Wolfgang Zapf, „Zur Theorie u. Messung von 'side effects'", in: Matthes<br />
1981 [Anm. 17], S. 275.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
21 Richard Louv, America II, J.P. Tarcher Verlag Los Angeles 1983.<br />
22 Wolfgang van den Daele, [Anm. 18], S. 238.<br />
23 So argumentiert auch Reinhard Wippler in seinem Beitrag, [Anm. 19], S. 246-261.<br />
24 Norbert Elias, Was ist Soziologie?, [Anm. 8]; ders., Über den Prozeß der Zivilisation,<br />
[Anm. 11]; Raymond Boudon, La Logique du Social, Paris 1979; Michel<br />
Crozier, E. Friedberg, L'Acteur et le Systeme, Paris 1977.<br />
25 In der Formulierung von Reinhard Wippler, „Nicht-intendierte soziale Folgen individueller<br />
Handlungen", Soziale Welt, Jg. 29/1978, S. 160.<br />
26 Norbert Elias, Uber den Prozeß der Zivilisation, [Anm. Ii].<br />
27 Raymond Boudon, [Anm. 12], Kap. 5, S. 108-143.<br />
28 Ähnliche Unterscheidungen findet man auch sonst gelegentlich in der Literatur; vgl.<br />
den abschließenden Beitrag von Fritz W. Scharpf in dem von Kenneth Hanf <strong>und</strong><br />
ihm herausgegebenen Band Inter-Organizational Policy-Making. Limits to Coordination<br />
and Central Control, London/Beverly Hills 1978, vor allem S. <strong>35</strong>1, oder<br />
auch Jeffrey Pfeffer, Gerald R. Salancik, The External Control of Organizations,<br />
New York usw. 1978, S. 41, die zwischen Outcome interdependence and Behaviour<br />
interdependence unterscheiden.<br />
29 Das gilt nicht mehr für Raymond Boudons neuestes Buch: La place du de'sordre,<br />
Paris 1984, das hier nicht mehr berücksichtigt werden konnte.<br />
30 Abweichendes Verhalten wird hierbei als von situativen Gelegenheiten mitbestimmt<br />
gesehen; vgl. Richard A. Cloward, „Illegitime Mittel, Anomie <strong>und</strong> abweichendes<br />
Verhalten", in: Fritz Sack, Rene König (Hg.), Kriminal<strong>soziologie</strong>, Frankfurt/M., S.<br />
314-338.<br />
31 Sehr deutlich wird diese Perspektive bei Frances F. Piven <strong>und</strong> Richard A. Cloward,<br />
Poor People's Movements, New York 1979.<br />
32 Brenda Dervin, "Communication Gaps and Inequities. Moving Toward a Reconceptualization",<br />
in: dies, <strong>und</strong> Melvin J. Voigt (Hg), Progress in Communication<br />
Sciences, Bd. 2, Norwood N.J. 1980, Kap. 3.<br />
33 Randall Collins, "On the Microfo<strong>und</strong>ations of Macrosociology", AJS 86/1981, S.<br />
984-1014.<br />
34 In der Mikro<strong>soziologie</strong>, speziell in der Sozialisationsforschung, werden die psychologischen<br />
Voraussetzungen sozialer Vorgänge verständlicherweise sehr viel eher systematisch<br />
berücksichtigt.<br />
<strong>35</strong> Vgl. D. Dickenberger, G. Gniech, "The Theory of Psychological Reactance", in:<br />
Martin Irle (ed), Studies in Decision Making, Berlin/New York 1982, S. 311-341.<br />
36 Diese Forschungsrichtung wird etwa repräsentiert durch den Band von John S.<br />
Carroll, John W. Payne, Cognition and Social Behaviour, New York usw. 1976 <strong>und</strong><br />
durch neuere Arbeiten über die "judgmental heuristics", die in dem Sammelband<br />
von D. Kahnemann u.a., [Anm. 4] dargestellt werden.<br />
37 In seinem neuesten Buch faßt Raymond Boudon sein sehr ähnliches Paradigma in<br />
die Formel M = M { m ES (M')3) , in Worten: Das makrosoziologische Phänomen<br />
M „est une fonction des actions m, lesquelles dependent de la Situation S de l'acteur,<br />
cette Situation etant elle-meme affectee par des donnees macrosociales M\"; La<br />
place du de'sordre, [Anm. 29], S. 40.<br />
38 Boudon, Crozier <strong>und</strong> Friedberg konzentrieren sich auf die Erläuterung <strong>und</strong> beispielhafte<br />
Verdeutlichung eines generellen Ansatzes, wobei vor allem die letzteren<br />
durchweg unterhalb der <strong>gesellschaftliche</strong>n Makroebene bleiben. Elias argumentiert<br />
zwar systematisch, gesamtgesellschaftlich <strong>und</strong> historisch, verknüpft diese Aspekte<br />
jedoch nur teilweise <strong>und</strong> wendet seinen Ansatz auch nicht auf heutige Gesellschaften<br />
an.<br />
39 Burkart Lutz, Der kurze Traum immerwährender Prosperität. Eine Neuinterpretation<br />
der industriell-kapitalistischen Entwicklung, Frankfurt/M. 1984.<br />
40 Siehe etwa Eugene Bardach, Robert A. Kagan, Going by the Book. The Problem<br />
of Regulatory Unreasonableness, Philadelphia 1982, vor allem Kap. 4.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
41 Wolfgang Zapf, „Entwicklungsdilemmas <strong>und</strong> Innovationspotentiale in modernen<br />
Gesellschaften", in: Krise der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des 21. Deutschen<br />
Soziologentags in Ba<strong>mb</strong>erg 1982, hg. v. J. Matthes, Frankfurt/M. 1983, S.<br />
293-308.<br />
42 Das sind die sog. garbage can decision processes; vgl. das allgemeine Modell <strong>und</strong> die<br />
empirischen Beispiele bei James G. March <strong>und</strong> Johan P. Olsen, A<strong>mb</strong>iguity and<br />
Choice in Organizations, Bergen 1976.<br />
43 Vgl. K. Hanf <strong>und</strong> F.W. Scharpf (Hg), Inter-Organizational Policy-Making, [Anm.<br />
28]; Gerhard Leh<strong>mb</strong>ruch, "Concertation and the Structure of Corporatist Networks",<br />
in: J. Goldthorpe (ed), Order and Conflict in Contemporary Capitalism<br />
Studies in the Political Economy of West European Nations, Oxford (im Druck).<br />
44 David R. Cameron, Social Democracy, Corporatism, and Labor Quiescence in Advanced<br />
Capitalistic Societies, paper prepared for the SSRC Conference on Order<br />
and Conflict in Western Capitalism, Buchenbach b. Freiburg 1983.<br />
45 Dieter Grunow, „Interorganisationsbeziehungen im Implementationsfeld <strong>und</strong> ihre<br />
Auswirkungen auf die Umsetzung <strong>und</strong> die Zielerreichung politischer Programme",<br />
in: R. Mayntz (Hg), Implementation politischer Programme II, Ansätze zur Theoriebildung,<br />
Opladen 1983, S. 142-167.<br />
46 Hierzu Patrick Lagadec, Le risque technologique majeur, Paris usw. 1981.<br />
47 Grunow, [Anm. 45], verweist bereits auf die daraus resultierenden „sek<strong>und</strong>ären<br />
Verpflichtungen".<br />
48 Siehe z.B. David Knoke <strong>und</strong> Edward Laumann, "The Social Organization of National<br />
Policy Domains", in: P.V. Marsden <strong>und</strong> N. mLin (Hg), Social Structure and Network<br />
Analysis, Beverly Hills 1982, S. 255-270; W. Richard Scott <strong>und</strong> John W.<br />
Meyer, The Organization of Institutional Sectors, Project Report Nr. 82-A14,<br />
Stanford University, July 1982.<br />
49 Theoretisch etwa bei Helmut Willke, Entzauberung des Staates. Überlegungen zu<br />
einer Sozietäten Steuerungstheorie, Königstein/Ts. 1983; empirisch bei Ulla Foemer,<br />
Zum Problem der Integration komplexer Sozialsysteme am Beispiel des Wissenschaftsrats,<br />
Berlin 1981.<br />
50 Zwei Beispiele sind: Ithiel de Sola Pool (ed), The Social Impact of the Telephone,<br />
Ca<strong>mb</strong>ridge/London 1977; BMFT (Hg), Technologie, Wirtschaftswachstum <strong>und</strong> Beschäftigung,<br />
Bonn 1983.<br />
51 Todd LaPorte, Technology as Social Organization, ISG Studies in Public Organization<br />
WorkingPapers No. 84-1, Berkeley, CA 1984.<br />
52 Die spontan weniger naheliegende Anwendung dieser Perspektive auf Organisationen<br />
findet sich besonders deutlich bei Pfeffer <strong>und</strong> Salancik, [Anm. 28J, die verschiedene<br />
Strategien behandeln, wie Organisationen ihre Abhängigkeitsbeziehungen<br />
umgestalten können.<br />
53 Thomas C. Schelling,Micromotives andMacrobehaviour, New York/London 1978.<br />
54 Eine wichtige Ausnahme stellt die — charakteristischerweise nicht publizierte — Arbeit<br />
von Birgitta Nedelmann dar, die unter Mitwirkung von Martin Broicher <strong>und</strong><br />
Karl-Heinz Korn eine vorzügliche Textsammlung zusammengestellt <strong>und</strong> eingeleitet<br />
hat: Eigendynamik <strong>und</strong> soziale Prozesse, als Manuskript vervielfältigt, Köln 1982.<br />
55 Ein gutes Beispiel für ein anspruchsvolles theoretisches Konzept zur Analyse sozialer<br />
Bewegungen, das in vieler Hinsicht dem hier skizzierten analytischen Paradigma<br />
entspricht, ist die Arbeit von Charles Tilly, From Mobilization to Revolution,<br />
Reading, Mass. 1978.<br />
56 Thomas C. Schelling, [Anm. 53].<br />
57 Claus Offe, Berufsbildungsreform. Eine Fallstudie über Reformpolitik, Frankfurt/<br />
M. 1975, Kapitel 3.<br />
58 Barry A. Turner, Man-Made Disasters, London 1978.<br />
59 Burkart Lutz, [Anm. 39].<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
DIE UNBEKANNTE ZUKUNFT UND DIE KUNST DER PROGNOSE<br />
Reinhart<br />
Koselleck<br />
„Kann man das Vergangene erkennen, wenn man das Gegenwärtige nicht<br />
einmal versteht? Und wer will vom Gegenwärtigen richtige Begriffe nehmen,<br />
ohne das Zukünftige zu wissen? Das Zukünftige bestimmt das Gegenwärtige<br />
<strong>und</strong> dieses das Vergangene". Diese Worte stammen von Johann<br />
Georg Hamann. Für jeden Leser, der die Zeit metaphorisch als Linie deutet,<br />
die aus der Vergangenheit durch den fiktiven Punkt der Gegenwart in die<br />
offene Zukunft führt, ist diese Feststellung Hamanns unsinnig. Für den Geisteshistoriker<br />
ist es schnell ersichtlich, daß Hamanns Worte von der heilsgeschichtlichen<br />
Erwartung zehren, die durch die Offenbarung zugänglich, ein<br />
Wissen von der Zukunft bereitstellt, die jeden persönlich, aber auch die<br />
Weltgeschichte im ganzen betrifft. Für den politischen oder den Sozialhistoriker,<br />
der sich professionell mit Vergangenem beschäftigt, der etwa das<br />
Vergangene nach Kausalketten befragt, die in die Gegenwart führen, bleibt<br />
die Zukunft methodisch ausgespart. Allenthalben wird er erkenntnistheoretisch<br />
oder psychologisch einräumen, daß eigene Erwartungshaltungen seine<br />
Fragestellungen beeinflussen mögen, die ihm das sogenannte Erkenntnisinteresse<br />
stimulieren. Ein wenig Zukunft wird er dulden, ohne seine Berufsqualität<br />
geschmälert zu finden. Mehr gefordert sind heute die ausdifferenzierten<br />
Wissenschaftsfelder der Politologie, der Ökonomie <strong>und</strong> der Soziologie,<br />
sofern sie nicht Einzelfälle, sondern Strukturen hochrechnen, um Zukunftstrends<br />
aus ihnen abzuleiten.<br />
Es gehört nun zum Bef<strong>und</strong> historisch überlieferter Quellen, daß Zukunftsvoraussagen<br />
jedweder Art unzählbar sind. Wir brauchen nicht im Jahre<br />
1984 zu leben, um an die Legion der Zeitutopien zu denken, mehr negativer<br />
als positiver Art, die Gegenwärtiges hochgerechnet haben, oder, mit<br />
Hamann zu reden, aus der Zukunft heraus Gegenwart diagnostizieren. Aber<br />
der Reigen führt weiter, etwa zu den Wahlprognosen, die die tatsächlichen<br />
Wahlen beeinflussen, sei es durch Zustimmung oder durch Widerspruch, den<br />
sie hervorrufen; oder unser Reigen führt zu den Planungsziffern einer Produktionsserie,<br />
die von den Marktanalysen künftig zu erschließender Möglichkeiten<br />
abhängen; oder zu den computergespeicherten Alternativen aller<br />
denkbaren Entscheidungen im geplanten Atomkrieg; oder zu den Voraussagen<br />
des Club of Rome, inzwischen verstärkt durch die umweltbewußten<br />
Grünen, die ihre Furcht in politische Zukunftsrationalität zu transponieren<br />
trachten; oder zu dem üblichen Geschäft jeder Diplomatie, die ohne Kalkül<br />
künftiger Handlungen gar nicht existieren würde; bis hin zum Alltag, in dem<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
die finanziellen Folgen einer Kindsgeburt bedacht werden, <strong>und</strong> das um so<br />
mehr, als Arbeitslosigkeit oder Einkommenskürzung Zukunftsdaten enthalten,<br />
mit denen gerechnet werden muß. Schließlich sei nicht zu vergessen der<br />
Traum, dem schon in der Kanonisierung durch Artemidor eine weissagende<br />
Kraft zugemessen wird, die auch in die Diagnosen heutiger Analysen eingeht,<br />
indem sie therapeutisch, also auch prognostisch genutzt wird. Die Beispielreihe<br />
läßt sich beliebig verlängern. Sie reicht also vom Alltag der Individuen<br />
bis zur großen Politik <strong>und</strong> greift darüber hinaus in den Zeitraum<br />
nicht-steuerbarer Prozesse, auch wenn deren Randbedingungen änderbar<br />
sind. Ich erinnere an die Hochrechnung der Energiereserven korreliert mit<br />
der demographischen Kurve der Erdbevölkerung, die beide langfristige Daten<br />
bereitstellen, die ihrerseits zunehmend auf die mittel- <strong>und</strong> kurzfristigen<br />
Planungsdaten in Politik <strong>und</strong> Wirtschaft zurückwirken. Hamanns Worte,<br />
daß das Zukünftige auf das Gegenwärtige einwirke, kann in dieser Allgemeinheit<br />
also kaum bestritten werden.<br />
Der Status des Zukünftigen entspricht nun nicht r<strong>und</strong>um dem Status<br />
des Vergangenen. Vergangenes ist in unserer Erfahrung enthalten <strong>und</strong> empirisch<br />
verifizierbar. Zukünftiges entzieht sich gr<strong>und</strong>sätzlich unserer Erfahrung<br />
<strong>und</strong> ist demnach empirisch nicht verifizierbar. Gleichwohl gibt es<br />
Voraussagen, die mit größerer oder minderer Plausibilität aus der Erfahrung<br />
in die Erwartung transponiert werden können. Hierbei handelt es sich, um<br />
einen scharfen Kontrahenten von Hamann zu bemühen, um das Vorhersehungsvermögen,<br />
um die Praevisio. „Dieses Vermögen zu besitzen", sagt<br />
Kant, „interessiert mehr als jedes andere: weil es die Bedingung aller möglichen<br />
Praxis <strong>und</strong> der Zwecke ist, worauf der Mensch den Gebrauch seiner<br />
Kräfte bezieht. Alles Begehren enthält ein (zweifelhaftes oder gewisses)<br />
Voraussehen dessen, was durch diese möglich ist. Das Zurücksehen aufs<br />
Vergangene (Erinnern) geschieht nur in der Absicht, um das Voraussehen<br />
des Künftigen dadurch möglich zu machen: indem wir im Standpunkte der<br />
Gegenwart überhaupt um uns sehen, um etwas zu beschließen oder worauf<br />
gefaßt zu sein". 1<br />
Kant führt die geschichtlichen Zeitdimensionen auf ihren anthropologischen<br />
Kern zurück. Die Konzentration auf den handelnden Menschen, anders<br />
als in Augustins Reduktion der Zeitdimension auf den inneren Menschen,<br />
ähnlich dagegen schon in Chladenius' Historischer Hermeneutik,<br />
stellt uns anthropologische <strong>und</strong> insofern metahistoische Kategorien zur Verfügung,<br />
die die Bedingungen möglicher Geschichte definieren. Kant spricht<br />
innerhalb der drei Zeitdimensionen der Zukunft <strong>und</strong> dem ihr zugeordneten<br />
Vorhersehungsvermögen eindeutig das größere Gewicht zu.<br />
Der Bef<strong>und</strong> ist klar. Begehren, wie Kant sagt, aber auch Ängste <strong>und</strong><br />
Hoffnungen, Wünsche <strong>und</strong> Befürchtungen sowie rationale Planungen, Berechnungen<br />
<strong>und</strong> eben Voraussagungen — alle diese Weisen der Erwartung<br />
gehören zu unserer Erfahrung, oder besser gesagt, korrespondieren mit unserer<br />
Erfahrung. Der Mensch als weltoffenes Wesen, genötigt, sein Leben zu<br />
führen, bleibt auf Zukunftssicht verwiesen, um existieren zu können. Die<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
empirische Unerfahrbarkeit seiner Zukunft muß er, um handeln zu können,<br />
einplanen. Er muß sie, ob zutreffend oder nicht, voraussehen. Mit diesem<br />
Paradox sind wir im Zentrum unserer Fragestellung.<br />
Was sieht der Mensch voraus, was kann er voraussehen? Die kommende<br />
Wirklichkeit — oder nur Möglichkeiten? Eine Möglichkeit, mehrere oder<br />
viele? Ist die Voraussicht geleitet von Furcht oder von Vernunft oder, mit<br />
Hobbes zu sprechen, von beiden zugleich? Ist sie geführt vom Glauben an<br />
eine Prophetie oder abgesichert durch den Rückgriff auf eine geschichtsphilosophisch<br />
begründete Notwendigkeit oder gespeist aus Kritik oder<br />
Skepsis? Ist sie an Vorzeichen mantischer oder magischer Art geb<strong>und</strong>en<br />
oder an ein Zeichensystem geschichtlicher Deutungen oder an die Versuche<br />
wissenschaftlicher Analysen?<br />
Die historischen Antworten lassen sich nun eingrenzen, wenn man die<br />
Voraussagen auf einige Gr<strong>und</strong>typen zurückführt, die sich im Laufe der Geschichte,<br />
einander überholend, aber auch überlappend, aufweisen lassen.<br />
Außerdem lassen sich die Antworten reduzieren, wenn nur nach den Voraussetzungen<br />
gefragt wird, wann <strong>und</strong> warum welche Prognosen eingetroffen<br />
sind oder nicht. Mit dieser letzten Frage werde ich mich im folgenden<br />
beschäftigen <strong>und</strong> dabei einer groben Typologie nicht entraten können.<br />
Bei der Fülle eingetroffener <strong>und</strong> bei der ebenso großen, vielleicht größeren<br />
Fülle nicht eingetroffener <strong>und</strong> deshalb vergessener Prognosen, läßt<br />
sich eine Alternative denken. Entweder handelte es sich um ein reines<br />
Glücks- oder Zufallsspiel, warum eine Prognose sich bewahrheitet hat <strong>und</strong> eine<br />
andere nicht. Oder es lassen sich Kriterien finden; warum die eine Prognose<br />
eher eingetroffen ist als die andere, warum die eine sich hat verifizieren<br />
lassen, die andere nicht. Ich werde versuchen, einige Kriterien aus Beispielen<br />
politischer Prognosen zu entwickeln.<br />
Sieht man von jeder historischen Erfahrung ab, so läßt sich sagen, entweder<br />
ist die Zukunft völlig unbekannt — dann ist jede Prognose ein Würfelspiel<br />
des Zufalls. Oder es gibt, <strong>und</strong> dafür spricht die historische Erfahrung,<br />
Grade der größeren oder geringeren Wahrscheinlichkeit, mit der die kommende<br />
Wirklichkeit vorausgesehen werden kann. Es gibt Bündel von Möglichkeiten,<br />
die einzeln oder zusammengenommen verschiedene Chancen<br />
ihrer Verwirklichung indizieren: Dann muß es auch eine Kunst der Prognose<br />
geben, die wenigstens minimale Regeln ihres Gelingens enthält.<br />
Rein formal läßt sich folgende Regel aufstellen: Die Skala der Zukunftsaussagen<br />
reicht von absolut sicheren Prognosen zu solchen höchst unwahrscheinlichen<br />
Inhalts. So muß es als absolut sicher gelten, daß unser Globus<br />
die Katastrophe überdauert, die ein Atomkrieg für die ganze Menschheit<br />
herbeiführen kann. Andererseits ist es völlig unsicher, ob eine atomare Katastrophe<br />
durch Zufall, durch Versehen oder durch Absicht herbeigeführt<br />
wird, oder ob sie gar verhindert werden kann. D.h., je weiter wir uns von<br />
langfristigen Daten naturaler Vorgegebenheiten entfernen <strong>und</strong> unsere Voraussagen<br />
auf politische Entscheidungssituationen konzentrieren, desto<br />
schwieriger wird die Kunst der Prognose. Der tastende Lichtstrahl suchen-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
der Prognostik oszilliert zwischen sicheren <strong>und</strong> gewissen Rahmenbedingungen<br />
<strong>und</strong> solchen, die sich prozessual verändern, um im Feld politischer Aktionen<br />
vergleichsweise unsicher zu sein. Aber allemal zieht Prognostik ihre<br />
Evidenz aus der bisherigen Erfahrung, die wissenschaftlich verarbeitet wird<br />
<strong>und</strong> die hochzurechnen eine Kunst der Ko<strong>mb</strong>ination vielfältiger Erfahrungsdaten<br />
darstellt.<br />
Als Historiker sind wir in der Lage, eingetroffene Prognosen daraufhin<br />
zu befragen, warum sie sich erfüllt haben. Als Historiker wissen wir aber<br />
auch, daß in der Geschichte immer mehr geschieht oder weniger als in den<br />
Vorgegebenheiten enthalten ist. Insofern ist die Geschichte immer neu <strong>und</strong><br />
überraschungsschwanger. Wenn es gleichwohl eintreffende Voraussagen<br />
gibt, so folgt daraus, daß die Geschichte nie völlig neu ist, daß es offensichtlich<br />
längerfristige Bedingungen oder gar dauerhafte Bedingungen gibt, in<br />
deren Spielraum sich das jeweils Neue einzustellen pflegt. Jede einzelne Geschichte,<br />
in die wir verstrickt sind, erfahren wir als einmalig, aber die Umstände,<br />
unter denen sich die Einmaligkeit einstellt, sind selber keineswegs<br />
neu. Es gibt Strukturen, die sich durchhalten <strong>und</strong> es gibt Prozesse, die anwähren:<br />
Beide bedingen <strong>und</strong> überdauern die jeweiligen Einzelereignisse, in<br />
denen sich Geschichte vollzieht. Anders gewendet, es gibt verschiedene<br />
Geschwindigkeiten des Wandels.<br />
Geographische Bedingungen wandeln sich gar nicht oder nur kraft der<br />
technischen Beherrschung eben dieser geographischen Voraussetzungen<br />
menschlichen Tuns. Rechtliche <strong>und</strong> institutionelle Bedingungen wandeln<br />
sich ebenfalls langsamer als die politischen Aktionen, die sich dieser rechtlichen<br />
<strong>und</strong> institutionellen Bedingungen bedienen. Verhaltensweisen <strong>und</strong><br />
Mentalitäten wandeln sich ebenfalls langsamer als die Kunst, sie ideologisch<br />
oder propagandistisch zu verändern. Politische Machtkonstellationen wandeln<br />
sich ebenfalls langfristiger als ihre tatsächliche Veränderung in Kriegen<br />
oder Revolutionen auf beschleunigte Weise sichtbar macht.<br />
Auch wenn die konkrete Geschichte jeweils einmalig bleibt, gibt es verschiedene<br />
Schichten der Veränderungsgeschwindigkeit, die wir theoretisch<br />
auseinanderhalten müssen, um Einmaligkeit <strong>und</strong> Überdauern aneinander<br />
messen zu können. Wenn wir aber davon sprechen, daß sich geographische,<br />
institutionelle, rechtliche oder mentalitätsgeb<strong>und</strong>ene Bedingungen durchhalten,<br />
so sind wir genötigt, ihnen im konkreten Vollzug der diachronen<br />
Zeitverläufe den Charakter der Wiederholung zuzumessen. Der Brief, den<br />
ich morgens um 9.00 Uhr empfange, mag eine freudige oder traurige Nachricht<br />
enthalten, die unüberholbar oder unüberbietbar ist. Aber die Postauslieferung<br />
morgens um 9.00 Uhr vollzieht sich von Tag zu Tag, dahinter steht<br />
eine Organisation, deren Stabilität in der Wiederholung ihrer eingespielten Regeln<br />
enthalten ist, deren finanzielles Polster durch die wiederholte Fortschreibung<br />
der budgetmäßig erfaßten postalen Einnahmen ermöglicht wird. Dieses<br />
Beispiel läßt sich auf alle Bereiche des menschlichen Lebens ausdehnen.<br />
Um meine These zu präzisieren: Prognosen sind nur möglich, weil es<br />
formale Strukturen in der Geschichte gibt, die sich wiederholen, auch wenn<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ihr konkreter Inhalt jeweils einmalig <strong>und</strong> überraschend für die Betroffenen<br />
bleibt. Ohne Konstanten verschiedener Dauerhaftigkeit im Faktorenbündel<br />
kommender Ereignisse wäre es unmöglich, überhaupt etwas vorauszusagen.<br />
Lassen Sich mich eine Beispielreihe aus dem Umfeld neuzeitlicher Revolutionen<br />
bringen.<br />
1. Der Begriff der Revolution ist ein geschichtstheoretisch geradezu exemplarisch<br />
zu nennender Begriff, der uns das Wechselspiel zwischen Einmaligkeit<br />
<strong>und</strong> Wiederholung erläutert. Gewiß, jede Revolution, die stattfindet,<br />
ist für die Betroffenen einzigartig, verheerend oder ein erhofftes Glück stiftend.<br />
Aber im Begriff der Revolution ist auch die Wiederholung enthalten,<br />
die Rückkehr oder gar der Kreislauf. Diese Bedeutung ist nun keineswegs<br />
ein zufälliger Rest des dem Lateinischen entlehnten Wortes revolutio. Der<br />
Begriff enthält vielmehr eine Strukturaussage über Revolutionen schlechthin,<br />
wie wir sie in zahlreichen Varianten auf diesem Globus immer wieder<br />
kennenlernen. Die Wiederkehrlehre, die theoretisch im Revolutionsbegriff<br />
enthalten ist, impliziert sowohl diachrone Verlaufszwänge, die sich analog<br />
wiederholen wie auch parallelisierbare Akte bestimmter Handlungen. So<br />
ist in dem Begriff enthalten die Gewaltausübung jenseits der Legalität, bei<br />
ihrem Gelingen ein Wechsel der Herrschaftsweisen oder der Verfassungsformen;<br />
ein Austausch, meist nur partieller Art, der Eliten; ein Besitzwechsel<br />
durch Aufruhr, Enteignung <strong>und</strong> Umverteilung der Gewinne. Ferner enthält<br />
der Begriff altbekannte Verhaltensweisen: der Feigheit, des Mutes, der<br />
Furcht, der Hoffnung, des Terrors aus Angst oder aus Übermut, der Parteibildung<br />
<strong>und</strong> der Parteispaltung, der Rivalität der Führer, der Akklamationsfähigkeit<br />
der Massen <strong>und</strong> ihrer Akklamationsbedürftigkeit. Kurzum, in jeder<br />
Revolution sind sowohl Faktoren synchroner Art, die sich analog wiederholen,<br />
wie auch Wirkungsketten diachroner Art enthalten, die im Einzelfall<br />
einmalig sind, deren formale Struktur aber immer wiederkehrende Elemente<br />
aufweisen. Anders ausgedrückt: Die Geschichte verläuft nicht nur einmalig<br />
in diachroner Reihe, sie enthält immer auch Wiederholungen, metaphorisch<br />
gesagt eben Revolutionen, die einmaligen Wandel <strong>und</strong> Wiederkehr des<br />
analogisch Gleichen oder Ähnlichen, jedenfalls des Vergleichbaren enthalten.<br />
Der Verlauf der Französischen Revolution von 1787 bis 1815 gleicht in<br />
vieler Hinsicht, nicht nur im Prozeß gegen den König, der zu seiner Hinrichtung<br />
führte, dem Ablauf der Englischen Revolution von 1640 bis 1660/88.<br />
Und so kann es nicht verw<strong>und</strong>ern, daß die Voraussagen der Französischen<br />
Revolution immer wieder auf das Beispiel der Englischen zurückgriffen <strong>und</strong><br />
daß die Diagnosen im Verlauf der Französischen Revolution immer wieder<br />
von Analogieschlüssen aus der englischen Parallele zehrten, um glaubwürdig<br />
zu sein. Cromwell war die diktatorische Figur, die Robespierre zu werden<br />
vermeiden wollte, die dann aber von Napoleon überboten wurde.<br />
2. Für die Schlüsse aus der Vergangenheit in die Zukunft, die auf einer<br />
strukturellen Wiederholbarkeit beruhen, seien drei Beispiele genannt,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
die mit zunehmender Konkretion die Diktatur Napoleons voraussagten.<br />
D'Argenson sagte als einer der ersten die kommenden Ereignisse glänzend<br />
voraus, als er die Ko<strong>mb</strong>ination von Monarchie <strong>und</strong> Demokratie als<br />
wahrscheinlich <strong>und</strong> als zukunftsträchtig definierte. 2 In der aristotelischen<br />
Topologie war ihm die Aristokratie das eigentliche Hindernis kommenden<br />
Ausgleichs, der über kurz oder lang zu einer Verfassungsänderung führen<br />
müsse. Eine sozialgeschichtliche <strong>und</strong> prozessuale Auslegung der aristotelischen<br />
Herrschaftskategorien ermöglichte es d'Argenson, die Zusammenarbeit<br />
des Monarchen mit den aufsteigenden bürgerlichen Schichten vorauszusagen,<br />
um im Falle ihrer Verhinderung die Revolution zu prognostizieren.<br />
Die Destruktion der Nobilität <strong>und</strong> die democratie royale entsprachen<br />
einander. Die Prognose beruhte auf einer neuen, verzeitlichten Ko<strong>mb</strong>ination<br />
überkommender Begriffe <strong>und</strong> Einsichten.<br />
Die Ergiebigkeit der geschichtlichen Voraussage hing von den verschiedenen<br />
geschichtlichen Schichten ab, von den zeitlichen Tiefenstaffelungen,<br />
die aus der historischen Erfahrung in die Zukunftsaussage transponiert wurden.<br />
Die räumliche Metaphorik, die in unserem Wort 'Geschichte' enthalten<br />
ist, mag hier hilfreich sein, um zu fragen, welche Schicht der Erfahrung<br />
jeweils abgerufen wird. Das wird sehr viel deutlicher bei der zweiten Prognose<br />
aus dem Jahre 1780. Sie stammt von Diderot. Und sie lautet: „Unter<br />
dem Despotismus wird das über seine lange Leidenszeit erbitterte Volk keine<br />
Gelegenheit versäumen, seine Rechte wieder an sich zu nehmen. Aber da<br />
es weder ein Ziel noch einen Plan hat, gerät es von einem Augenblick zum<br />
andern aus der Sklaverei in die Anarchie. Inmitten dieses allgemeinen Durcheinanders<br />
ertönt ein einziger Schrei — Freiheit. Aber wie sich des kostbaren<br />
Gutes versichern? Man weiß es nicht. Und schon ist das Volk in die verschiedensten<br />
Parteien aufgespalten, aufgeputscht von sich widersprechenden<br />
Interessen ... Nach kurzer Zeit gibt es nur noch zwei Parteien im Staat;<br />
sie unterscheiden sich durch zwei Namen, die, wer sich auch immer dahinter<br />
verbergen mag, nur noch lauten können 'Royalisten' <strong>und</strong> 'Antiroyalisten'.<br />
Das ist der Augenblick der großen Erschütterungen, der Augenblick der<br />
Komplotte <strong>und</strong> Verschwörungen ... Der Royalismus dient dabei ebenso als<br />
Vorwand wie der Antiroyalismus. Beides sind Masken für Ehrgeiz <strong>und</strong> Habgier.<br />
Die Nation ist jetzt nur noch eine von einem Haufen von Verbrechern<br />
<strong>und</strong> Bestochenen abhängige Masse. In dieser Lage bedarf es nur noch einen<br />
Mannes <strong>und</strong> eines geeigneten Augenblicks, um ein völlig unerwartetes Ergebnis<br />
eintreten zu lassen. Kommt dieser Augenblick, erhebt sich auch<br />
schon der große Mann ... Er spricht zu den Menschen, die gerade noch alles<br />
zu sein glaubten: Ihr seid nichts. Und sie sprechen: Wir sind nichts.<br />
Und er spricht zu ihnen: Ich bin der Herr. Und sie sprechen wie aus einem<br />
M<strong>und</strong>e: Ihr seid der Herr. Und er spricht zu ihnen: Hier sind die Bedingungen,<br />
unter denen ich euch zu unterwerfen bereit bin. Und sie sprechen:<br />
Wir nehmen sie an ... Wie wird die Revolution weitergehen? Man weiß es<br />
nicht". 3<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Diderots Prognose war der Aufklärungstaktik entsprechend anonym<br />
in das Werk von Raynal über die koloniale Expansion Europas eingeschmuggelt<br />
worden. Sie gehört zu den erstaunlichsten Voraussagen über<br />
den mittelfristigen Verlauf der kommenden Revolution, die sich in groben<br />
Zügen vollständig bewahrheitet hat. Sie ist weit konkreter als eine ähnlich<br />
scharfsinnige Prognose Friedrich des Großen. Dieser hatte den kommenden<br />
Bürgerkrieg in Frankreich als Ergebnis der Aufklärung vorausgesagt,<br />
4<br />
aber Diderot ging als Aufklärer der Aufklärung noch einen Schritt weiter<br />
<strong>und</strong> konnte die Dialektik von Herr <strong>und</strong> Knecht in eine politische Strukturaussage<br />
ummünzen, die eine freiwillig akzeptierte Diktatur zum Ergebnis<br />
hatte.<br />
In die Voraussage Diderots gingen nun zahlreiche Schichten geschichtlicher<br />
Erfahrung ein. Zeitgenössisch bot ihm die schwedische Revolution<br />
Gustav III. von 1772 den Einstieg in die Analyse mit dem Ergebnis einer<br />
überparlamentarischen Monarchie, das er für die französische Zukunft<br />
als mögliche Parallele hochrechnete.<br />
Aber historisch liegen tiefere Schichten seiner Voraussage zugr<strong>und</strong>e,<br />
es gingen mehrere strukturell wiederholbare Elemente in sie ein. Es handelt<br />
sich um Argumentationsfiguren, die Diderot aus der römischen Geschichte<br />
ableitete, speziell aus Tacitus <strong>und</strong> seiner Analyse des Bürgerkriegs im<br />
Dreikaiserjahr. Wie die Parole, ja der Wunsch nach Freiheit in die Sehnsucht<br />
nach freiwilliger Unterwerfung umschlagen könne, das war aus den<br />
aufgeklärten Prämissen, die Diderot teilte, nicht ableitbar. Dahinter standen<br />
Erfahrungen, die auf die römischen Bürgerkriege zurückführten <strong>und</strong> auf<br />
die Bürgerkriege in der Kaiserzeit. Außerdem stand noch Polybios' Kreislaufmodell<br />
Pate, das seinerseits in der sophistischen Tradition, von Herodot<br />
überliefert , den Weg in eine Monarchie als zwangsläufig deutbar machte.<br />
5<br />
Die Treffsicherheit von Diderots Prognose beruhte also auf einer geschichtlichen<br />
Tiefenstaffelung, in die einmal ausformulierte historische Erfahrungen<br />
<strong>und</strong> ihre theoretischen Verarbeitungen eingegangen waren. Obwohl<br />
Diderot einräumte, nicht zu wissen, wie die Revolution weitergehe,<br />
bezog sich die Scharfsichtigkeit seiner Analyse auf die Wiederholbarkeit<br />
historischer Erfahrungssätze.<br />
Das gleiche gilt nun für eine Voraussage Wielands. Er prognostizierte,<br />
nunmehr in den konkreten kurzfristigen Ereigniszusammenhang der Französischen<br />
Revolution eingeb<strong>und</strong>en, daß Napoleon Bonaparte die Diktatur<br />
in Frankreich ergreifen werde. Eineinhalb Jahre vor dem Staatsstreich<br />
sagte er diesen voraus <strong>und</strong> fügte hinzu, daß er die beste Lösung sein werde,<br />
die der französische Bürgerkrieg finden könne. Wieland geriet deshalb in<br />
nicht geringe Schwierigkeiten, weil er in Weimar als Jakobiner <strong>und</strong> Bonapartist,<br />
wenn es das Wort schon gegeben hätte, verschrieen wurde.<br />
Die Sicherheit seiner eingetroffenen Prognose beruht nun nicht nur<br />
auf politischem Instinkt oder Zufallsspiel, sondern zunächst auf der großen<br />
Parallele, die er zur Englischen Revolution immer wieder zog, <strong>und</strong> darüber<br />
hinaus auf seiner antiken Bildung, die ihn disponierte, den Verfassungs-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
wandel im Schema der polybianischen Kreislauflehre zu sehen sowie auf<br />
der Kenntnis des römischen Bürgerkrieges, der schließlich in die Diktatur<br />
Cäsars einmündete. Das, was Wielands konkrete Prognose auszeichnet,<br />
beruht also auf der theoretischen Prämisse, daß sich im Verlauf einer<br />
Revolution bestim<strong>mb</strong>are Verläufe wiederholen können, so daß es möglich<br />
wurde, auch einen Einzelfall, nämlich die Diktatur von Napoleon<br />
persönlich daraus abzuleiten. 6<br />
Wir sind nun in der glücklichen Lage, eine andere Prognose Wielands<br />
zitieren zu können, die nicht eingetroffen ist. Nach der Einberufung der<br />
Notablen-Versammlung 1787 sagte er voraus, daß sich die kommende<br />
Revolution in Frankreich milde, wohltätig <strong>und</strong> vernunftgeleitet, friedlich<br />
<strong>und</strong> glücksspendend vollziehen werde. Wörtlich: „Auch in diesen wichtigen<br />
<strong>und</strong> zum Glück der Völker so wesentlichen Stücken scheint sich<br />
(wenn uns unser Vertrauen nicht betrügt) der gegenwärtige Zustand von<br />
Europa einer wohltätigen Revolution zu nähern; einer Revolution, die<br />
nicht durch wilde Empörungen <strong>und</strong> Bürgerkriege, sondern durch ruhige,<br />
unerschütterliche standhafte Beharrlichkeit bei einem pflichtmäßigen<br />
Widerstand — nicht durch das verderbliche Ringen der Leidenschaften<br />
mit Leidenschaften, der Gewalt mit Gewalt, sondern durch die sanfte,<br />
überzeugende <strong>und</strong> zuletzt unwiderstehliche Übermacht der Vernunft,<br />
bewirkt werden wird: kurz, eine Revolution, die, ohne Europa mit Menschenblut<br />
zu überschwemmen <strong>und</strong> in Feuer <strong>und</strong> Flammen zu setzen,<br />
das bloße wohltätige Werk der Belehrung der Menschen über ihr wahres<br />
Interesse, über ihre Rechte <strong>und</strong> Pflichten, über den Zweck ihres Daseins<br />
<strong>und</strong> die einzigen Mittel, wodurch derselbe sicher <strong>und</strong> unfehlbar erreicht<br />
werden kann, sein wird." 7<br />
Für unsere Fragestellung wird eines sofort deutlich: Die sanfte <strong>und</strong> vertrauensvolle<br />
Voraussage beruhte darauf, daß Wieland alle bisherige Erfahrung<br />
durch die selbstgewisse Vorm<strong>und</strong>schaft der Aufklärung außer<br />
Kraft zu setzen sich fähig glaubte. Beflügelt durch die optimierende Aufklärungshoffnung<br />
sagte Wieland eine Revolution voraus, die sich von allen<br />
bisherigen Revolutionen dadurch unterscheiden werde, daß sie ohne Bürgerkrieg<br />
vollzogen werden könnte. Zugunsten der Einmaligkeit geschichtlicher<br />
Progression verzichtete Wieland, seinem eigenen Vertrauen trauend, auf jeden<br />
Analogieschluß, den er aus der früheren Geschichte hätte ziehen können<br />
<strong>und</strong> den er zehn Jahre später gezogen hat. Es war gerade die geschichtliche<br />
Einmaligkeit <strong>und</strong> die lineare Hochrechnung des aufgeklärten Optimismus,<br />
die ihn eine Voraussage formulieren ließ, die binnen kurzem von den<br />
politischen Ereignissen desavouiert wurde.<br />
Das erste Kriterium, das wir damit erprobt haben, liegt also in der<br />
Testfrage enthalten, ob eine Prognose auf Möglichkeiten geschichtlicher<br />
Wiederholung rekurriert oder ob sie eine absolute Einmaligkeit des geschichtlichen<br />
Verlaufes unterstellt. Dort wo Wieland Analogieschlüsse<br />
aus der Erfahrung zog, hat er recht behalten, dort wo er die Geschichte<br />
als unvergleichbar neu definierte, blieb er im Unrecht.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Halten wir als erstes Zwischenergebnis fest: Je mehr zeitliche Schichten<br />
möglicher Wiederholung in die Prognose eingegangen sind, desto zutreffender<br />
war die Voraussage. Je mehr sich die Voraussage auf die Unvergleichbarkeit<br />
<strong>und</strong> Einmaligkeit der kommenden Revolution bezog, desto<br />
weniger hat sie sich erfüllt. Es gibt kaum eine Revolution, die so oft <strong>und</strong><br />
so zutreffend in ihrem tatsächlichen Kommen vorausgesagt wurde wie<br />
die Französische. Aber ebenso häufig sind die illusionären Auskünfte über<br />
ihren kommenden Verlauf gewesen. Ich erinnere an die belle revolution,<br />
die herbeizuwünschen <strong>und</strong> anzupreisen Voltaire nie müde wurde. Er erblickte<br />
in der herbeigewünschten Umwälzung nichts anderes als die Vollstreckung<br />
einer moralischen Gerechtigkeit, die als Philosoph er polemisch<br />
einzufordern niemals aufgab. Gelegentlich sind die Voraussagen so exakt<br />
<strong>und</strong> präzise formuliert worden wie von Friedrich, Diderot oder Rousseau,<br />
die den linearen Fortschritt in die Einmaligkeit hinein relativiert hatten.<br />
So ist der Anteil geschichtlicher Erfahrung jeweils verschieden dosiert<br />
in die Prognosen eingegangen. Dort wo die Chancen geschichtlicher Wiederholung<br />
negiert wurden, gerieten die Voraussagen in das Umfeld großer<br />
Wünschbarkeit, während dort, wo die Wiederholbarkeit geschichtlicher<br />
Möglichkeiten ernstgenommen wurde, die Prognosen eine größere Chance<br />
hatten einzutreffen. Um die Erfolgsträchtigkeit von Voraussagen beurteilen<br />
zu können, kommt es also darauf an, die zeitliche Mehrschichtigkeit<br />
geschichtlicher Erfahrung herauszuarbeiten, aus denen sich Voraussagen<br />
zusammensetzen.<br />
Zur Erläuterung sei eine andere Beispielreihe vorgeführt, die unserer<br />
eigenen Vergangenheit angehört <strong>und</strong> auf den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges<br />
hinweist. Dabei werde ich drei Typen vorführen, die unsere These<br />
von der geschichtlichen Tiefenstaffelung als Voraussetzung erfolgreicher<br />
Prognosen erläutert. Am 16. Nove<strong>mb</strong>er 1937 schrieb Benesch, damals<br />
Präsident der Tschechoslowakei: „Ich weiß, daß die Lage ernst ist, bin<br />
aber dennoch Optimist. Ich glaube unentwegt, daß wir den Frieden erhalten<br />
werden. Ich glaube nicht, daß in absehbarer Zeit ein europäischer<br />
Krieg möglich ist. Ich bin vielmehr der Hoffnung, daß er nicht kommen<br />
wird." Man müsse sich nur auf die Verteidigung vorbereiten. „Für die<br />
Tschecholowakei fürchte ich nichts". Ein Jahr später befand sich Benesch<br />
8<br />
im Exil zu London.<br />
Es handelt sich hier um eine Wunschprognose, gespeist zugegebenerweise<br />
aus Optimismus, um eine Meinungsäußerung, die über einen Politiker<br />
in dieser Position zu dieser Zeit nur Erstaunen auslösen kann. Nun gehört<br />
es freilich zu jeder Voraussage, daß die eigene Einstellung zur Zukunft<br />
als Faktor in die Prognose eingeht. Aber die Chancen der Erfüllung steigen<br />
erst mit der Macht, die groß genug ist, um die Erfüllung einer sich selbst<br />
gestellten Prognose herbeizuführen.<br />
In dieser Lage befand sich damals Hitler. Sieben Tage nach der optimistischen<br />
Äußerung von Benesch rief Hitler vor der Ortsgruppe der NSDAP<br />
in Augsburg aus: „Es ist doch etwas W<strong>und</strong>erbares, wenn das Schicksal<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Menschen ausersehen hat, für ihr Volk sich einsetzen zu dürfen. Heute<br />
stehen uns neue Aufgaben bevor. Denn der Lebensraum unseres Volkes<br />
ist zu eng. Die Welt wird eines Tages unsere Forderungen berücksichtigen<br />
müssen. Ich zweifle keine Sek<strong>und</strong>e daran, daß wir genauso, wie es uns<br />
möglich war, die Nation im Innern emporzuführen, auch die äußeren gleichen<br />
Lebensrechte wie die anderen Völker uns verschaffen werden." 9<br />
Kaum verschleiert kündigt Hitler sein Expansionsprogramm an, ohne den<br />
möglichen Krieg beim Namen zu nennen. Insofern handelt es sich auch<br />
hier um eine Wunschprognose. Aber die Elemente, aus denen sich seine<br />
Zukunftsvoraussage zusammensetzt, sind vielschichtiger als bei Benesch.<br />
Hitler beschwor, wie er es immer tat, den innenpolitischen Aufstieg<br />
als Unterpfand für den künftigen Erfolg auch auf dem Feld der Außenpolitik.<br />
Es handelt sich um den typischen Fall einer linearen Hochrechnung<br />
mittelfristiger Art aus der Vergangenheit in die Zukunft wie wir<br />
sie auch bei Wieland kennengelernt haben, ohne neu hinzukommende<br />
Faktoren der Weltpolitik in Europa zu benennen, selbst wenn Hitler sie<br />
als Politiker bedacht haben mochte. Hier liegt die Stoßkraft der anfänglichen<br />
Erfolge Hitlers, aber zugleich die tiefsitzende Fehlerquelle verborgen,<br />
die seinen Untergang <strong>und</strong> mit ihm den des alten Deutschland herbeiführen<br />
half. Die lineare Hochrechnung war einschichtig. Hinzu kommt die<br />
Berufung auf das Schicksal, ein Ideologiestreifen, der in die deutsche<br />
Geistesgeschichte zurückreicht, jenes Schicksal, an dem Hitler keine Sek<strong>und</strong>e<br />
zweifelte, wie er autosuggestiv versicherte. Die Struktur dieser Prognose<br />
enthüllt sich damit als eine ultimative Zwangsprognose. Hitler hat sie sich<br />
immer wieder selbst gestellt. Sie korrespondiert jener linearen Hochrechnung,<br />
die keine Alternativen zuläßt, vielmehr ausschließt. In der Ausschließlichkeit<br />
lag ihre Zwanghaftigkeit beschlossen, die Hitler durch das Bewußtsein<br />
seiner Auserwähltheit autosuggestiv absicherte. Seine Prognose nähert<br />
sich der Struktur prophetischer Weissagungen.<br />
Konfrontieren wir die Wunschprognose von Benesch <strong>und</strong> die ultimative<br />
Zwangsprognose von Hitler mit einem dritten Typus. Am 27. Nove<strong>mb</strong>er<br />
1932 erklärte Churchill im House of Commons: „Es wäre sicherer, die<br />
Danziger Frage <strong>und</strong> des polnischen Korridors, heikel <strong>und</strong> schwierig wie<br />
sie ist, neu aufzurollen, mit kaltem Blut <strong>und</strong> in ruhiger Atmosphäre <strong>und</strong><br />
solange die Siegermächte noch ihre breite Überlegenheit innehätten, anstatt<br />
zu warten <strong>und</strong> dahinzutreiben, Schritt für Schritt <strong>und</strong> Stufe um Stufe,<br />
bis noch einmal eine große Konfrontation zustande kommt, in der wir<br />
in gleicher Weise kämpfend einander gegenüberstehen." 10<br />
Selbstredend gehen auch in diese Prognose Wünsche ein, <strong>und</strong> auch ein<br />
ultimativer Handlungszwang liegt in ihr beschlossen, aber mit dem Ziel,<br />
einen zweiten Weltkrieg zu verhindern. Es handelt sich um eine alternative<br />
Bedingungsprognose, die Handlungsanweisungen enthält. Was diese Prognose<br />
auszeichnet, ist die klare Formulierung zweier Möglichkeiten, deren<br />
eine auf die dauerhafte Erfahrung des Ersten Weltkrieges zurückgreift,<br />
deren andere aber die Einmaligkeit der sich ändernden Nachkriegssituation<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
in Rechnung stellt. Ihre Struktur ist mehrschichtig. Die Diagnose beruht auf<br />
der anhaltenden Erfahrung der Katastrophe von 1914, um für den schwindenden<br />
Handlungsspielraum 1932 eine Alternative zu formulieren. Die Warnung<br />
vor der Wiederkehr des Weltkrieges evoziert eine Anweisung, ihn zu<br />
verhüten.<br />
Nun mag man die schlichte Alternative auf die Suggestionskraft von<br />
Churchills Rhetorik zurückführen, — er wird auch weitere Möglichkeiten<br />
im Hinterkopf gehabt haben. Die Katastrophe, die zu vermeiden Churchill<br />
politisch vorschlug, ist gemäß seiner Voraussage eingetroffen. Die Erfahrung<br />
des Kriegsausbruches von 1914 mit dem daraus abgeleiteten Analogieschluß<br />
hat ihn nicht getrogen. Aber bei Churchill handelt es sich nicht<br />
um eine lineare Hochrechnung unentrinnbarer Zukunft, sondern diese Hochrechnung<br />
setzte eine Bedingung möglicher Wiederholung, um in actu dagegen<br />
anzukämpfen. Die Richtigkeit der Prognose gründet also in der handlungsanleitenden<br />
Verwendung mehrerer geschichtlicher Tiefendimensionen,<br />
deren Ko<strong>mb</strong>ination die Treffsicherheit hervorgebracht hat.<br />
Unsere Fragestellung nach den geschichtlichen Zeitschichten ermöglicht<br />
es uns, die Prognostik aus dem Bezugsrahmen der reinen Anthropologie<br />
oder gar der Psychologie der jeweiligen Agenten herauszuführen. Nicht<br />
der rührende Optimismus eines Benesch, nicht die Autosuggestion von<br />
Hitler <strong>und</strong> auch nicht die phantasievolle Nüchternheit von Churchill liefern,<br />
uns den Schlüssel für die Richtigkeit oder Falschheit ihrer Voraussagen.<br />
Die objektivierbaren Kriterien liegen in der zeitlichen Tiefenstaffelung, die<br />
argumentativ für die Prognose herangezogen wurde.<br />
Es ist nicht nur die formale Wiederholbarkeit möglicher Geschichte,<br />
die ein Minimum an prognostischer Sicherheit garantiert, sondern es kommt<br />
ebenso darauf an, die Mehrschichtigkeit historischer Zeitverläufe einzukalkulieren.<br />
Deshalb möchte ich in einem zweiten Durchgang unsere Frage nach den<br />
verschiedenen Zeitschichten präzisieren. Theoretisch lassen sich drei Zeitebenen<br />
unterscheiden, die verschieden abrufbar sind, um Prognosen zu ermöglichen.<br />
Erstens gibt es die kurzfristige Sukzession des Vorher <strong>und</strong> Nachher, die<br />
unsere alltäglichen Handlungszwänge kennzeichnet. Immer situationsbezogen<br />
ändern sich die Voraussetzungen für die beteiligten Agenten in früher<br />
oder später erfahrbaren Fristen, in Jahren, Monaten, Wochen, St<strong>und</strong>en, ja<br />
sogar von Minute zu Minute. In diesem Zusammenhang ist es besonders<br />
schwierig, exakte Prognosen zu stellen, nicht zuletzt deshalb, weil niemals<br />
alle Reaktionen <strong>und</strong> Aktionen zugleich überblickt oder gar erkannt werden<br />
können. Es ist wie beim Schachspiel, wo erst nach einer bestimmten Summe<br />
von Zügen die Lage so weit geklärt ist, daß Prognosen mit großer, schließlich<br />
absoluter Treffsicherheit gestellt werden können.<br />
Zweitens gibt es die Ebene mittelfristiger Trends, von Geschehensabläufen,<br />
in die eine Fülle von Faktoren eingehen, die sich der Verfügung der jeweils<br />
Handelnden entziehen. Hier wirken die zahlreichen transpersonalen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Bedingungen in das Geschehen ein, die sich selber nur mit einer langsameren<br />
Geschwindigkeit ändern als die Aktionen der Handelnden selbst. In diesen<br />
Bereich gehören z.B. ökonomische Krisen oder Abläufe eines Krieges<br />
oder eines Bürgerkrieges oder die längerfristigen Wandlungen, die durch<br />
die Einführung neuer Produktionstechniken hervorgerufen werden oder<br />
jene Vorgänge, die von den Betroffenen als Verfall der Sitten oder als Dekadenz<br />
einer politischen Handlungsgemeinschaft begriffen werden. Immer<br />
handelt es sich um Verlaufsfiguren, die von den transpersonalen Rahmenbedingungen<br />
beeinflußt werden, die aber schließlich so weit reichen können,<br />
auch die Rahmenbedingungen selbst zu verändern. Es handelt sich um<br />
prozessuale Verläufe, die aller Innovation zum Trotz so viel Analogieschlüsse<br />
zulassen, wie die Beispielreihe unserer Revolutionsprognosen gezeigt hat.<br />
Drittens gibt es eine Ebene von gleichsam metahistorischer Dauer, die<br />
deshalb noch nicht zeitlos ist. Man kann auf dieser Ebene hypothetisch solche<br />
anthropologische Konstanten ansiedeln, die sich mehr als alle anderen<br />
Faktoren dem geschichtlichen Wandlungsdruck entziehen. Aus diesem Bereich<br />
stammt eine Fülle von Erfahrungssätzen, die sich gr<strong>und</strong>sätzlich wiederholen<br />
lassen, die immer <strong>und</strong> immer wieder applikabel sind. Es handelt<br />
sich dann um Erfahrungssätze, denen eo ipso eine prognostische Wahrheit<br />
innewohnt.<br />
Hierhin gehört die einfache Form des Sprichwortes, die oft mit gegenläufigen<br />
Nutzanweisungen versehen wird, aber immer anwendungsfähig<br />
bleibt. Übermut kommt vor den Fall. Viele H<strong>und</strong>e sind des Hasen Tod.<br />
Viele Köche verderben den Brei. Freilich hängt die Anwendbarkeit davon<br />
ab, ob man sich auf Seiten der H<strong>und</strong>e, der Köche, der Hasen oder im Brei<br />
befindet. Aber der Rang solch scheinbar banaler Lebensweisheiten kann<br />
nicht unterschätzt werden. Sie tauchen auch in höher aggregierten Aussagen<br />
auf. Selbst wenn man einräumt, daß der Verlauf der Geschichte sich<br />
nicht nach unseren moralischen Urteilen <strong>und</strong> Sprichwortweisheiten richtet,<br />
bleibt der Übermut doch eine berechenbare, gelegentlich zäh<strong>mb</strong>are<br />
Größe im Spiel der Kräfte. Schließlich gibt es Kurzformeln, deren prognostische<br />
Wahrheit unwiderlegbar bleibt. So warnte Seneca Nero vergeblich:<br />
Er könne alle totschlagen, nur nicht seinen Nachfolger. Hier handelt<br />
es sich um eine formale Zukunftsaussage, die sich jederzeit inhaltlich ausfüllen<br />
läßt. Scheinbar zeitlos sind sie situativ applikabel. Stalin ahnte es,<br />
als er Trockij ermorden ließ. Nicht verhindern konnte er die Entstalinisierung<br />
durch seine Nachfolger.<br />
In einem höher aggregierten Zustand handelt es sich um metahistorischen<br />
Sätze, in denen die Bedingungen möglicher Geschichten, also auch<br />
möglicher Zukunft, reflektiert werden. Ich verweise hier auf die Reden<br />
des Thukydides oder auf die Thematik des Tacitus, der weniger die Tatsächlichkeit<br />
der Ereignisse beschreibt, als die Art, wie sie widersprüchlich<br />
erfahren wurden. Die Bürgerkriegsanalysen beider Autoren, die die Verläufe<br />
nicht nur schildern, sondern zugleich semantisch reflektieren <strong>und</strong> auf ihren<br />
Erfahrungsgehalt abfragen, führen zu Lehren der Geschichte, die nicht<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
nur rhetorisch wiederholt werden können. Sie sind auch tatsächlich anwendbar.<br />
Die Überwindung der konfessionellen Bürgerkriege in der frühen<br />
Neuzeit mag auch ohne antike Autoren gelungen sein, tatsächlich aber stellten<br />
sie Lehren bereit, die unmittelbar handlungsanleitend waren. Sie enthielten<br />
ein prognostisches Potential, das die neuen Erfahrungen um ihren<br />
Überraschungseffekt brachte. Religiöse Intoleranz wurde kalkulierbar, politisch<br />
berechenbar <strong>und</strong> deshalb zäh<strong>mb</strong>ar.<br />
Wir können bis zur Gegenwart gehen <strong>und</strong> eine Vermutung anstellen.<br />
Wir wissen nicht, welche Argumente Dubczek 1968 im Kreml zu hören bekam,<br />
bevor er sich den sowjetischen Bedingungen unterwarf. Aber die<br />
Gr<strong>und</strong>struktur der Argumente findet sich bei Thukydides in seinem berühmten<br />
Dialog zwischen den Athenern <strong>und</strong> den Bürgern von Melos. Der<br />
11<br />
Melier-Dialog besteht in einer auf zwei Rollen verteilten Argumentation,<br />
die modern formuliert auf eine alternative Bedingungsprognose hinausläuft,<br />
um handlungsanleitend zu wirken. Thukydides definierte die Einstellung<br />
der Melier in einem Satz als Wunschprognose: Sie nehmen die verhüllte<br />
Zukunft aus lauter Wunsch schon für Gegenwart <strong>und</strong> irrten deshalb. Die<br />
Athener dagegen beriefen sich auf das Gesetz der Macht, das sie nicht erf<strong>und</strong>en,<br />
sondern nur übernommen hätten, um es anzuwenden. Nach dem<br />
Austausch der Argumente, in denen sich Hoffnung <strong>und</strong> Erfahrung gegenüberstanden,<br />
inhaltlich gesprochen das Rechtsbewußtsein der Melier <strong>und</strong><br />
der gewollte Machtmißbrauch der Athener, berichtet Thukydides nurmehr<br />
in drei Zeilen, wie die Melier nach ihrer Unterwerfung hingerichtet, ihre<br />
Frauen <strong>und</strong> Kinder versklavt wurden. Das analoge Geschick blieb Prag erspart.<br />
Die Tschechen haben sich gebeugt.<br />
Es wäre unsinnig, hier eine lineare Wirkungsgeschichte des Thukydides<br />
konstruieren zu wollen. Es gibt vielmehr geschichtliche Erfahrungsstrukturen,<br />
die einmal ausformuliert nicht verlorengehen, die sich auch unter<br />
völlig veränderten Bedingungen moderner Machtausübung oder neuer<br />
Rechtsauffassungen durchhalten: Ihnen wohnt eine prognostische Kraft<br />
inne, die von metahistorischer Dauer ist <strong>und</strong> die jederzeit für politische<br />
Hochrechnungen genutzt werden kann.<br />
Ich komme zum Schluß. Die theoretische Unterscheidung zwischen<br />
unseren drei Zeitverläufen, der kurzfristigen Aktionen, der mittelfristigen<br />
Ablaufzwänge sowie der langfristigen bzw. dauerhaft wiederholbaren Möglichkeiten<br />
zeigt uns, daß sich ihr Verhältnis im Laufe der neueren Geschichte<br />
gr<strong>und</strong>legend verändert.<br />
Kurzfristige Prognosen sind heute deshalb schwerer zu stellen, weil die<br />
Faktoren, die in sie eingehen müssen, selber vervielfältigt worden sind. Gewiß<br />
gehen Elemente metahistorischer Dauer in sie ein, aber die Vielfalt<br />
der universalen Rahmenbedingungen aller einzelnen Handlungen hat sich<br />
erhöht, ihre Komplexität ist schwerer beherrschbar.. Kurzfristige Prognosen<br />
waren einfacher, solange in der frühen Neuzeit die Zahl der agierenden<br />
Handlungsträger überschaubar blieb, solange die Lebensdauer der<br />
Fürsten als Menschen in ihrer endlichen Begrenztheit politisch kalkulierbar<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
lieb. Die Berechnung der Erbfallkonstellationen für den nächsten Krieg<br />
gehörte zur Dauerbeschäftigung frühneuzeitlicher Prognostik. Je mehr wir<br />
uns der eigenen Zeit nähern, desto schwieriger wird die Kunst kurzfristiger<br />
Prognosen, weil auch die längerwährenden Rahmenbedingungen der<br />
kurzfristigen Handlungsspielräume sich vervielfacht <strong>und</strong> verändert haben.<br />
Aber auch die transpersonalen Konstanten, die als Bedingungen die<br />
mittelfristigen Verläufe determiniert haben, haben sich seit r<strong>und</strong> 200 Jahren<br />
mit steigender Geschwindigkeit geändert. Technik <strong>und</strong> Industrie haben<br />
die Erfahrungsspannen verkürzt, die sich nur unter gleichbleibenden Voraussetzungen<br />
stabilisieren konnten. Die Voraussetzungen unserer Lebensverläufe<br />
ändern sich schneller als früher, selbst die Strukturen werden zum<br />
Ereignis, weil sie sich schneller wandeln. Der gute alte Satz, daß wir nicht<br />
für die Schule, sondern für das Leben lernen, hat seine Kraft verloren. Wir<br />
lernen nur noch, wie wir umlernen können. Und selbst das haben wir noch<br />
nicht gelernt. Im Hinblick auf unser Modell dreier Zeitschichten läßt sich<br />
sagen, daß ehedem langwährende Konstanten, die den Bedingungsrahmen<br />
mittelfristiger Verläufe <strong>und</strong> kurzfristiger Handlungszusammenhänge stabil<br />
hielten, selber unter erhöhten Wandlungsdruck geraten sind. Es gibt immer<br />
mehr Variablen, die hochzurechnen <strong>und</strong> aufeinander zu beziehen immer<br />
schwieriger wird. Deshalb hat sich, wissenschaftsgeschichtlich gesprochen,<br />
aus der Zunft der Historiker die der Soziologen herausdifferenziert. Die<br />
Frage danach, wie sich kurze, mittlere <strong>und</strong> lange Fristen zueinander verhalten,<br />
zwingt die Soziologen zur Prognose, ob sie wollen oder nicht. In<br />
historischer Perspektive sei mir deshalb noch ein Nachwort gestattet: Die<br />
prognostische Sicherheit müßte wieder steigen, wenn es gelingt, mehr Verzögerungseffekte<br />
in die Zukunft einzubauen, Verzögerungseffekte, die berechenbarer<br />
werden, sobald die ökonomischen <strong>und</strong> institutionellen Rahmenbedingungen<br />
unseres Handelns stetiger werden. Aber das ist vermutlich<br />
nur eine Utopie, die aus der bisherigen Geschichte nicht ableitbar ist.<br />
ANMERKUNGEN<br />
1 Kant, Anthropologie in pragmatischer Absicht, Teil 1, § 32, in Werke, hg. Weischedel,<br />
Darmstadt 1964, Bd. VI, S. 490.<br />
2 d'Argenson, Conside'rations sur le gouvernement ancien et pre'sent de la France,<br />
Yverdon 1764, S. 138 ff.<br />
3 Diderot, in: Raynal, Histoire Philosophique et Politique et du commerce des<br />
Europe'ens dans les deux Indes, Genf 1780, IV, S. 488 ff.<br />
4 Friedrich der Große, Werke, dt. hg. von G.B. Volz, Berlin 1912, Bd. 7, S. 267 f.<br />
(Kritik des 'Systems der Natur' von Holbach, 1770).<br />
5 Herodot, Hist. III, 79 ff.<br />
6 Wieland, Der Neue Teutsche Merkur, 2. Stük, März 1798, in: Sämtl. Werke, Leipzig<br />
1857, Bd. 32, S. 53 ff.<br />
7 Wieland, Das Geheimnis des Kosmopolitenordens (1788), Sämtl. Werke, Bd. 30, S.<br />
422.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
8 Brief an Emil Ludwig, zit. nach Helmut Kreuzer, „Europas Prominenz <strong>und</strong> ein<br />
Schriftsteller", in: Süddt. Zeitung, 17/18.11.1962.<br />
9 Max Domarus, Hitler, Reden <strong>und</strong> Proklamationen, <strong>München</strong> 1965, Bd. 1/2, S. 760.<br />
10 Churchill, Rede im House of Commons am 27. Nov. 1932, in: Pari. Acts, 5. Ser.<br />
vol. 272.<br />
11 Thukydides, Gesch. des peloponnesischen Krieges, dt. von G.P. Landmann, Zürich<br />
<strong>und</strong> Stuttgart 1960, S. 431 ff. (V 85-115).<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
THE SOCIAL FOUNDATIONS OF MONETARISM AND "BASTARD"<br />
KEYNESIANISM: THE SHRIVELLING OF NEO CONSERVATISM<br />
Paolo Leon<br />
0. Introduction<br />
The concept of social (or societal) development is foreign to recent economic<br />
thinking. Even if economics are a science for which social realities are relevant<br />
only insofar as they determine a change in the basic postulates of economic<br />
theory — different in this from sociology, where social facts are the motivations<br />
for theorizing — during the last two decades the major schools of<br />
economic thought seem to have reverted to primitive social postulates,<br />
entirely static in conception. In what follows I shall describe the social<br />
tenets of today economics and I shall conclude with an attempt at explaining<br />
why economics has taken this particular route in the last few years. In<br />
order to <strong>und</strong>erstand the effective social postulates of economics, I shall<br />
describe the behaviour of economic agents according to two main schools<br />
of thought: the neo-keynesian (what Joan Robinson called "bastard"<br />
keynesianism) and the monetarist (taking due account of the rational expectations<br />
variant). There are, of course, other schools and many individual<br />
economists who cannot be assimilated to either of the two schools (disequilibrium,<br />
postkeynesian, neoricardian or marxian theories, just to reme<strong>mb</strong>er<br />
the most conspicuous) and, in fact, many of these have singularly<br />
rieh social postulates in the back of their thinking; and there are the eclectic<br />
ones (Malinvaud is an example) that slice reality so that it fits either pne or<br />
the other of the main theories; the point I want to make, however, concerns<br />
that part of economics which is predominant today in the definition of economic<br />
policies, or that which influences mostly conventional wisdom and culture.<br />
As will be seen, a few social coneepts — used inter alia by many sociologists<br />
— are not an original derivation from social theory applied to social facts,<br />
büt are a translation, often unconscious, of those economic theories.<br />
1. Macro- and microeconomics<br />
a) The monetarists<br />
For the most recent breed of monetarists, economic agents consider that<br />
prices are flexible, both in the short and in the long run, so that the market<br />
form is better described as tending to pure and perfect competition.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
This 1 implies that the "mean expectation of firms with respect to some<br />
phenomenon — say price — is equal to the prediction that would be made<br />
by the relevant... economic theory or model" (Buiter, 1980) (Muth, 1961);<br />
"if Information is scarce and costly, the economic System cannot waste it;<br />
it is therefore natural that expectations are defined as exploiting at least all<br />
the Information linked to the variables that characterize the relevant model"<br />
(De Feiice — Pelloni, 1982). Slightly more formally, the rational expectation<br />
hypothesis (REH) is defined by the condition that "the subjective<br />
probability distribution of future economic variables held at time t, coincides<br />
with the actual, objective conditional distribution based on the Information<br />
assümed to be available at time t" (Lucas and Prescott, 1974).<br />
Behind this hypothesis there is, of course, a world of literature linked<br />
specifically to economic policies and in particular to monetary policies.<br />
The problem that the REH wants to solve is a real one: when the public<br />
decision makers establish a policy, then private economic agents will not<br />
be surprised by such policies; they will <strong>und</strong>erstand their effects and behave<br />
taking them into account so as to maximize profits. Since all economic<br />
agents maximize their (present and rationally expected) profits, public<br />
policies will be accepted if they are coherent with this behaviour; in other<br />
words, public policies cannot force what the market would not accept.<br />
Individuais can make mistakes, but there is no reason to suppose that<br />
mistakes are not distributed normally, so that all agents, as well as the<br />
economy at large, barring a stochastic error, will in fact maximize profits.<br />
The typical application of the REH is in monetary policies: when the<br />
Government increases money supply for the purpose of furthering economic<br />
activity, aiming for example at reducing unemployment, agents will<br />
react to the subsequent inflation initially believing that the price rise is<br />
relative to their Output rather than to the general price level; sooner or<br />
later, however, they will include in the available Information set the delusion<br />
deriving from such mistake, and will make correct price expectations; more<br />
importantly, if they are rational, they will operate on the basis of a model<br />
that teils them that those policies are inflationary. As the agents' model is<br />
a market Clearing one — and it will be, if they maximize their profits, as<br />
prices are considered flexible — there will never be any "money illusion"<br />
and all agents will be capable of calculating (correctly) expected values in<br />
real terms/As a result, monetary policies of an inflationary or of deflationary<br />
character will generally be ineffective (Sargent — Wallace, 1975).<br />
It has been objected that such behaviour is not applicable to fiscal<br />
policy: a tax is a tax, and cannot be double-guessed by agents (barring<br />
evasion). To counter this objection, monetarists have devised the following<br />
way out: a tax increase (decrease) will influence money suppley, decreasing<br />
(increasing) it, thereby influencing price level expectations. Public spending<br />
was a more difficult nut to crack: but monetarists think that private agents<br />
facing an increase in public spending will react expecting a future tax increase<br />
or a future growth in money supply. Intuitively, enterprises and<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
workers are dissimilar and may not be taken together <strong>und</strong>er the same expectation<br />
hypothesis. However, monetarists (Lucas and Rapping, 1969)<br />
consider that, for workers, leisure time provides Utility just as consumer<br />
goods do, so that consumption at any moment is composed of consumer<br />
goods and leisure time. Work time is the opposite of leisure time, and can<br />
be considered as "non consumption" of leisure time. Thus, anything which<br />
will stimulate an increase in consumption at the present time, will also<br />
stimulate to work less. Thus, labour supply will be a function of the interest<br />
rate, as this can be considered the price of leisure time at present in terms<br />
of future leisure time. Now, workers have the same rational expectations<br />
behaviour as enterprises and consider the wage rate no less flexible than any<br />
other price and a market Clearing price; thus any unemployment that the<br />
reality shows is voluntary: it derives from a conscious choice between leisure<br />
and work that, rationally, workers are making — both in the short and in<br />
the long run. Unemployment compensation, therefore, only makes for<br />
higher unemployment, as it reduces the "cost" of leisure time or, if we<br />
want, it reduces the interest rate applicable to workers.<br />
The social tenets of this school are clear and una<strong>mb</strong>iguous: a pure and<br />
perfect competition world of individual enterprises and individual suppliers<br />
of labor is in permanent (i.e. both short and long term) equilibrium due to<br />
the fact that these individuals have rational expectations, and consider all<br />
prices as flexible. They are always capable of redressing any external<br />
shock because they follow the profit maximization rule. Involuntary unemployment<br />
is impossible, not only because unemployment implies leisure<br />
time, but also because by lowering the demanded (real) wage workers can<br />
always find employment (the reduction may logically push wages to zero!).<br />
Marginal Utility of work is negative; so is — logically — the marginal Utility<br />
of employment; unemployed are those whose marginal Utility of consumption<br />
is higher than the marginal disutility of employment. Unused capacity<br />
is also impossible, as by lowering their prices (the reduction may imply<br />
negative prices, but this is excluded by postulate!) entrepreneurs can always<br />
seil the amount needed to maximize profits. Individual efficiency produces<br />
collective effectiveness, and supply determines demand. In this set-up,<br />
agents will find an equilibrium position at what monetarists call the "natural<br />
rate of unemployment", and this rate is resilient to whatever effort the<br />
Government will make with monetary policies (or fiscal or spending policies,<br />
as we have seen). Actually, a whole host of concepts acquires, in this way,<br />
a "natural" character; the "natural" rate of growth or of development, the<br />
"natural" distribution of income, the "natural" international division of<br />
labor, the "natural" rate of exchange, and, of course, the "natural rate of<br />
societal development", are all concepts that can be logically derived from<br />
this school of thought.<br />
Enterprises are price takers, just as workers, and no aggregate degree of<br />
monopoly is postulated. Equilibrium is considered a permanent Situation,<br />
and together with the assumptions of rational expectations of price flexi-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ility and of profit maximization, it makes the macro and micro levels<br />
coincidental. There is no reason to deal with aggregates, in this set-up, while<br />
reasoning on the basis of representative (profit-maximizing) agents provides<br />
an immediate picture of society as a whole. There is actually no need for<br />
the State, in this vision, as the perfect foresight (or rational expectations)<br />
of agents constitutes the only rational government. The State can exist, but<br />
it will create disequilibrium or, at best, will be useless.<br />
There is <strong>und</strong>oubtedly great elegance in this construction. As will be<br />
seen in discussing the neo-keynesian view, it does away with a great nu<strong>mb</strong>er<br />
of theoretical difficulties.<br />
There is no necessity in the monetarist world — only choice. Better,<br />
there is only one, all pervading, and slightly lunatic necessity: that of<br />
choosing. For this reason, this school has called itself the "New Classical<br />
Economics" 2 .<br />
Unfortunately, this vision is devoided of any rationality. The starting<br />
point is the market Clearing bias that would characterize agents' expectations.<br />
Why agents should so expect is unexplained. The only explanation<br />
for this hypothesis is that it would be desirable to agents (and to the economists<br />
observing them) if price flexibility could be considered rational.<br />
Thus, the assumption of perfect competition is not a simplifying hypothesis,<br />
it is rather "positive" in nature — and this destroys most of the<br />
monetarists claim to science. The problem is not that perfect competition<br />
is unrealistic: this is well known and accepted. Rather, perfect competition<br />
is viewed as a desired State of nature because it is a rational State. Since the<br />
monetarists' model derives from this assumption, it acquires the character<br />
of utopia.<br />
This explains well why the social thinking of monetarists is so static:<br />
social and economic development, even institutional change, are concepts<br />
that cannot be analysed with this theory. The profit maximization rule is<br />
also very naive. Economic agents are viewed as individuals, rather than as<br />
enterprises (otherwise there could not be any symmetry between enterprises<br />
and workers), and expectations are truly subjective: monetarists<br />
consider the enterprise as coincidental with the entrepreneur, not a social<br />
agent but an individual concern.<br />
There must, thus, be a "natural" enterprise (not simply a representative<br />
enterprise), as only this will Square with all the other "natural" concepts.<br />
Again, this is a "desired" enterprise, and its conception is therefore non<br />
scientific 3 .<br />
Next, the rational expectation hypothesis. This is nothing but a tautology.<br />
The agents' relevant model is the monetarists' model, and this is so —<br />
it is said — because they are rational; but this, at most, implies that rational<br />
is the theory not the behaviour. As rational is opposed to irrational, few<br />
economists have had the courage to criticize the tautology; none — to my<br />
knowledge — has pointed out that rational behaviour (in the sense defined<br />
above) is opposed to constrained behaviour: seen in this light, the tautology<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
is clearer. Actually, also rational expectations are "natural": once the<br />
market is defined as the monetarists do, these expectations have to be<br />
rational, otherwise the market would not be natural. Moreover, the relevant<br />
model needs "an additional sociological condition which entails perceived<br />
and actual unanimity of beliefs across all agents in the model" (Frydman<br />
and Phelps, 1983). In fact, testing statistically the REH has been fo<strong>und</strong><br />
a prohibitive task: "the assumption of optimal use of the available Information<br />
cannot be tested independently of an assumption about the available<br />
Information" (Buiter, 1980). In the end, the result of all this is entirely<br />
paradoxical. Crises, Stagnation, social misery do not really exist. If they<br />
are present, it can only be the result of State interference with what would<br />
otherwise be a natural Optimum equilibrium. But why isn't the State as<br />
"natural" as other agents? Why shouldn't there be "natural" institutions? 4<br />
Only by removing the social aspects of reality, monetarists can build their<br />
own specific "natural"-neutral world.<br />
b) The neo-keynesians<br />
Much of this thinking is a reaction to the neo-keynesian school that had<br />
developed an Interpretation of economic phenomena which, utilising some<br />
of Keynes' ideas, focused the attention on the labor market, represented<br />
by the well-known Phillips curve (Phillips 1958, Lipsey 1960, Samuelson<br />
and Solow 1960) . This is a relationship which makes money wages dependent<br />
inversely on unemployment; as money wages are considered the<br />
main source of inflation (cost-push inflation), that relationship was used<br />
to explain it: when unemployment decreases, money wages increase, and<br />
prices with them. Public policy, therefore, consists in determining the<br />
acceptable level of the couple inflation — unemployment. This construction<br />
was destroyed by the long period of Stagflation following the break between<br />
the dollar and gold (1968-71) and the oil crises (1973 to 1980) -<br />
as is well known, high unemployment went hand in hand with high inflation.<br />
Monetarists have objected to this hypothesis, because it is built on the<br />
basis of money-illusion: as workers are not fools (and bear rational expectations),<br />
they will reckon their wages in real terms; if increases in money<br />
wages bring about inflation, and no increase in real wages, they will either<br />
settle for wage indexation or stop contracting for higher money wages.<br />
Thus, the Phillips curve does not exist, there is no trade-off between<br />
unemployment and inflation, and the latter is never due to private economic<br />
agents, but to public policy, which increases money supply in order<br />
to fight unemployment (which, as we have seen, according to monetarists<br />
does not really exist).<br />
There is little doubt that the social vision of neo-keynesians was (and<br />
is) füll of deficiencies. Thus, to suppose that public policies do not engender<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
a reaction on the part of some economic agent is nonsensical. To suppose<br />
that, by and large, prices are determined by enterprises on the basis of a<br />
cost-plus formula is surely naive. The vision of an enterprise, busy in<br />
transferring almost freely cost increases onto price increases, makes all<br />
other enterprise objectives irrelevant: why bother with the application<br />
of technical progress, the pursuit of productivity increases, even the policies<br />
aiming at restricting competition (and which make a cost-plus pricing<br />
formula possible), if costs changes can be transferred onto prices? The<br />
entrepreneur's task becomes similar to that of a rentier, and the enterprise<br />
is reduced to a rent-producing function (in the thirties, when these models<br />
were built, profits were in fact called "quasi-rents"). Although this vision<br />
has been, in the past, important in dismantling the pure and perfect competition<br />
fable in economics, its shallowness preserves the same static<br />
nature of the competitive assumption. The role of the Trade Unions is<br />
similar to that of the enterprise: Trade Unions are monopolistic Operators<br />
no less than firms. However, while enterprises pass cost increases onto<br />
prices, the reasons for raising money wages on the part of Trade Unions<br />
are muddled up in neo-keynesians. Wages rise not because the cost (of<br />
subsistence) increases: in this, workers (organized or not) are not symmetrical<br />
to enterprises. Money wages rise because unemployment decreases<br />
or, if we want, because labor becomes a scarce factor of production. Thus,<br />
it is not the (original) monopolistic nature of Trade Unions that counts,<br />
but the emergence of a natural monopoly due to scarcity, and given to<br />
workers, not to their Organization. True, TU can create scarcity artificially<br />
(e.g. reduction of working hours) in order to increase wages . But this<br />
6<br />
cannot be considered the reason for a permanent phenomenon as the<br />
unemployment — inflation trade-off. Implicity, therefore, the neo-keynesians<br />
adopt a "wage f<strong>und</strong>" theory, or a theory in which income distribution<br />
is dominated by enterprise behaviour. There is a contradiction here,<br />
internal to the neokeynesian model: if money wages create inflation,<br />
so that — brought to the limit — all wage increases are purely nominal,<br />
then there is no reason for workers' organizations and TU loose legitimacy;<br />
inflation would therefore be attributable to a tragic mis<strong>und</strong>erstanding<br />
on the part of workers (who can forget, at this point, Citizen Weston?).<br />
The neo-keynesian theory can be considered an adhockery. In general,<br />
it is fo<strong>und</strong>ed on a weak autonomy of the enterprise role (simple transmission<br />
of general price level increases), and a strong autonomy of the<br />
workers' role (the demand of wage increases is independent from any<br />
causal factor); but in the end it turns the story aro<strong>und</strong>, Stripping workers<br />
of any power in real wage bargaining .<br />
7<br />
More generally, this theory does not establish any link with the growth<br />
of the economy. The stylized facts just mentioned can take place at any<br />
level of the rate of growth; thus, the growth of the economy (of its sectors,<br />
of productivity, of investment and consumption) is irrelevant. On the<br />
contrary, supposing that the maximum rate of growth is associated with<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
füll employment (a common hypothesis in economics), then maximum<br />
Output growth would generally be associated with maximum growth in<br />
prices. Füll employment and maximum growth are thus impossible —<br />
irrespective of any growth of productivity, of population, of markets,<br />
etc. and economics is brought back to its marginalist (i.e. non-keynesian)<br />
origin, by which scarcity is the determinant of price (and value). Neokeynesians<br />
do not originally accept this tenet — if it were so, Say's law<br />
would dominate, supply would create its own demand, and crisis, stagnations<br />
and cycles would not exist. For neo-keynesians, the only relevant<br />
scarcity lies in the labor force (an opinion common to Marxians, Sraffians<br />
and post-keynesians); but if the labor force became scarce only at (and<br />
not before) füll employment, economics would not be the science that<br />
studies the relationship between aims and scarce resources, and neo-keynesians<br />
would be forced to research further into what economics really<br />
is, risking some unpleasant findings related to the capitalist System. Much<br />
simplier is to suppose that the labor-force is "increasingly scarce" as unemployment<br />
decreases (a plausible way to reintroduce from the window<br />
what was pushed out of the door): since the labor force is scarce even<br />
before full-employment, its price will rise the nearer the market is to füll<br />
employment; and as wages determine prices, all prices will rise — thus,<br />
scarcity determines prices (and values), and Say's law is valid again. In<br />
this framework, neo-keynesians have no difficulty in considering labor<br />
less homogeneous than depicted tili now. The more numerous are the<br />
labor markets, the less substitutable is the labor force, the easier it is to<br />
sustain that labor scarcity appears much before the füll employment<br />
level. Trade Unions, in this case, can indeed be represented as monopolists,<br />
and money wages can be made to rise as the rate of growth of the economy<br />
increases. The favor with which the segmentation hypothesis has been<br />
accepted by many a sociologist (Doeringer/Piore, 1971) is perhaps areflection<br />
of the necessity of segmentation to salvage the Phillips curve, incomes<br />
policies and, in general, the role of Government as mediator between labor<br />
and capital (on which more, below). Incorporating the segmentation idea into<br />
the neokeynesian model justifies labor policies on education and training<br />
which, increasing the "specialization" of labor (reducing its homogeneity),<br />
make it scarcer and, also, reduce the (political) risk of mass unemployment.<br />
With this Interpretation, unemployment is as segmented (as specialized) as<br />
employment; more importently, it may be involuntary, but becomes voluntary<br />
(politically) if the Government provides training for increased mobility<br />
(specialization, segmentation): a social, mass phenomenon, can thus be<br />
(politically) reduced to a question of individual choice. It will be apparent<br />
that, in this way, neokeynesians can reduce considerably the gap separating<br />
their theory from the monetarists' — as both favor labor policies of a<br />
"structural" character or, in other words, destined to lower the natural rate<br />
of unemployment .<br />
8<br />
Neokeynesians have another difficulty to face, again, of a very general<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
nature. The Phillips curve aggregates workers' and firms' behaviours; thus<br />
the cost plus pricing formula is an average of the behaviour of different<br />
economic agents. The assumption is not incorrect: it refers to Kalecki's<br />
aggregate degree of monopoly, and may be considered a description of the<br />
macroeconomic supply equation. Unfortunately, it is gravely incomplete.<br />
Since it is not possible to sum up the differing behaviour of economic<br />
agents (the degree of monopoly varies greatly from sector to sector, place<br />
to place, commodity to commodity), aggregate quantities are interpreted<br />
a-posteriori (there is another tautology here) as showing an average, socialwide<br />
degree of monopoly; if the estimated equation fits well the Statistical<br />
data of those aggregate quantities, then the degree of monopoly will be<br />
that which has been econometrically estimated. The trouble is that if the<br />
estimate does not fit the data (as during the 1974 — onwards period),<br />
the theory has no gro<strong>und</strong> on which to rest: as there can be n (for n -> )<br />
00<br />
nu<strong>mb</strong>er of theories fitting the actual data just as well, the neo-keynesians<br />
have constructed for themselves an impossible task, because they multiply<br />
their opponents. Part of the trouble lies in the neo-keynesians' oblivion<br />
of the effective demand problem — Keynes' central point. If demand is not<br />
always assured (in the amount needed to utilize fully productive capacity,<br />
including labor), then it will never be possible to sum up the behaviour<br />
of individual agents to obtain the economy as a whole. In other words,<br />
when unemployment (involuntary) is present and capital is <strong>und</strong>erutilized,<br />
society is not the sum of its components. Both Sraffa (1925) and Keynes<br />
(and Rosa Luxe<strong>mb</strong>urg) show this well, when they argue that production<br />
costs (average and marginal) decrease when demand increases, or that<br />
returns (to scale, to investment or to the increased application of one<br />
factor of production) are normally constant or increasing .<br />
9<br />
In these conditions, each enterprise does not know that its unit costs<br />
depend on aggregate demand, and cannot act to increase it; it lacks role,<br />
objectives and means to make an increase in aggregate demand part of its<br />
own decision making process and this has not changed with the advent<br />
10<br />
of the Weifare or Interventionist State.<br />
Industrial sociologists would be surprised in knowing that economics<br />
admits only the term "efficiency", not that of "effectiveness". Subsumed<br />
is the concept that if all enterprises are efficient, the economy will also<br />
be effective. This is not true, since Sraffa and Keynes, for whom social<br />
effectiveness is not assured by individual efficiency. If society is not made<br />
up by the sum of its components, then it is not possible to extract social<br />
rules or laws by observing (and adding) economic agents, and macroeconomics<br />
(or society) is autonomous and original vis-a-vis microeconomics<br />
or its social components. This applies, of course, to social development<br />
as well as to social structures. But this is an extremely difficult stricture<br />
for any economist: the proof is in the development of keynesian thinking,<br />
since the beginning forced to adhere to principles unfamiliar to its originator,<br />
or in the forgetfulness to which the first Sraffa was condemned.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
To sum up. The neokeynesians believe that individuals, added up, make<br />
society as a whole; individual enterprises enjoy a degree of monopoly sufficient<br />
to pass increases onto prices; workers are permanently eager to<br />
increase money-wages, even though their own costs are not increasing.<br />
Society, therefore, does not develop. The State is needed, as a new economic<br />
agent, to mediate between workers and entrepreneurs by choosing<br />
the "consensus" trade-off between inflation and unemployment. If the<br />
latter increases in spite of this mediation, then for neokeynesians it will be<br />
structural in character and will require "ad hoc" policies — technical training<br />
and education, new technology, microcomputers, the tertiary sector, and<br />
a whole host of "ersatz" concepts. It will be noticed that for neokeynesians<br />
the only real social role is that of the State as a mediator; enterprises and<br />
workers are social Operators justifying each other, and their difficulties in<br />
reaching long term agreements (a difficulty which has no social fo<strong>und</strong>ation<br />
in neokeynesians' thinking) in turn justifies the State — whose existence,<br />
however, is again not expressly based on any social fo<strong>und</strong>ation.<br />
This is neither a world of necessity nor a world of choice: necessity<br />
apparently lies in the mutual roles of enterprises and workers, but both<br />
these subjects are viewed microeconomically. Although neokeynesians<br />
attribute a macroeconomic role to the conflict between those two agents,<br />
the transition from micro to macro does not take place anywhere explicity<br />
(this is also a problem for those sociologists who Substitute the State role<br />
with a postulate — complexity — whose necessity is not theoretically fo<strong>und</strong>ed).<br />
Society is thus not given a role of its own, and even the State — being<br />
a mediator — is seen as just another economic agent. In this case, the monetarists<br />
gain momentum: a natural—rational State is a neutral State, an<br />
economic agent like any other.<br />
2. Money & society<br />
The centerpiece of the economic debate — it is now quite evident — is money.<br />
True, the relationship between aggregate demand, supply curves, prices and<br />
income distribution is also central. But as the microeconomics of these<br />
relationship has not been researched into, this set of relationships has not<br />
been really debated. Money, instead, is a topic that was studied starting at<br />
the micro level. Keynes' revolution, in the '30s, was built on a new vision<br />
of money in the economic process: different from the classics, keynesian<br />
thinking viewed money not only as a means of exchange, but also as object<br />
of speculation. Money is a störe of value, because only money can transfer<br />
purchasing power from the present into the future; other assets (financial<br />
or real) cannot be made available directly, they have to be exchanged with<br />
money in order to free the purchasing power they represent. As money is<br />
always perfectly liquid (i.e. immediately realizable in assets or in commodities),<br />
it is the best means to störe wealth, also because it is riskless — in<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
the sense that the future price of assets other than money is uncertain.<br />
True, in periods of inflation, uncertain will also be the value of money; but<br />
this uncertainty is common to money and to all other assets; the latter will<br />
show, thus, a double uncertainty: that which derives from their illiquidity,<br />
and that which derives from inflation. It is known why money — its nature<br />
of störe of value — represented such an important part in Keynes' interpretation:<br />
demand and supply of money determine the interest rate (if<br />
people save, keeping their savings in the mattress, nobody pays them an<br />
interest rate), this determines investment, and investment determines effective<br />
demand and national income. If money did not exist, supply and<br />
demand of commodities will always balance by definition: barter can only<br />
take place between existing commodities. Thus, supply determines demand,<br />
in a barter world. With money, aggregate demand could stagnate at less<br />
than füll employment, because the public might prefer liquidity, such that<br />
the interest rate would be too high to ensure füll employment. In other<br />
words, liquidity preference is not in any way linked — through some equilibrating<br />
mechanism — to the maximum level of Output or of employment.<br />
Also, savings are not brought to equality with investment through the<br />
interest rate, which is only the price of money in terms of other assets; as<br />
a result, there can be, at any time, ex ante discrepancies between (planned)<br />
savings and investment, creating conditions of insufficient (or excessive)<br />
investment. In fact, one of Keynes' main novelties is in the recognition that<br />
it is the level of income (output) that brings to equality savings and investment;<br />
or, in different terms, that savings are determined by income (output),<br />
rather than the other — and more orthodox — way ro<strong>und</strong> 11 .<br />
Keynes was indeed skeptical as to the relationship between the interest<br />
rate and investment — in the sense that in his mind there was no assurance<br />
that a lower (higher) interest rate would stimulate (depress) investment and<br />
employment. His consideration of uncertainty, and of the behaviour of enterprises,<br />
led him to prefer fiscal and public expenditure means (all the way to<br />
the "socialization" of investment) to monetary means.<br />
However, it was mainly on money that the discussion centered. To many<br />
neokeynesians, money as a störe of value, different from others assets, represented<br />
the true obstacle to remove from the theory, if the traditional<br />
consideration of the economy as a self-equilibrating mechanism was to be<br />
reconstructed. If a central feature of society, such as the demand for money,<br />
could be held responsible for crises and Stagnation and if savings are a residual,<br />
rather than the cause, of investment, then the economy would be<br />
prone to public policy, State Intervention, politics — and economics would<br />
became more a practical, or moral activity than the object of truly scientific<br />
Observation. A rieh literature developed which brought neokeynesians to<br />
place money alongside other financial assets, each characterized by differing<br />
degrees of liquidity, risk (rather than uncertainty) and interest premia so<br />
that economic agents could optimize the distribution of wealth among different<br />
assets. In this manner, economic agents would manage their port-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
folios — including money — and no central speculative role could be attributed<br />
to money. In addition, savings were considered the stuff which creates<br />
portfolios — by definition including all financial assets. Therefore, the interest<br />
rate is not the price of money, but of all assets (in terms of commodities) and<br />
of savings; moving the interest rate would move the volume of savings: in this<br />
way, the interest rate becomes the price of savings in terms of consumer goods,<br />
or the old premium for abstinence, and abstinence the cause of development.<br />
Monetarists went a step further, and included in the realm of each<br />
agent's choice all assets, financial as well as real, completing the neokeynesians<br />
job: in this manner, no special motivation for keeping money as a<br />
störe of value is recognized, and all wealth is substitutable with money.<br />
There may be different uncertainties attached to different forms of wealth<br />
— but as agents have rational expectations based on the relevant model,<br />
and if (because) the model is that which does not recognize to money any<br />
other function than that of means of exchange, Keynes' intuition was<br />
destroyed. Money is neutral, and does not interfere with the real forces<br />
that determine (and automatically restore) equilibrium 12 .<br />
This discussion seems far removed from social reality and from social<br />
development. It is only an appearance. It will be evident by now that the<br />
focus of Keynes' research was the justification of State Intervention — as a<br />
social, macroeconomic necessity. He tried to break the strictures of orthodoxy<br />
working on macroeconomic quantities and building a model to show<br />
that no natural mechanism exists to produce füll employment, nor coincidence<br />
between macro and micro levels. Neo-keynesians and monetarists,<br />
although through different paths, work to show exactly the contrary.<br />
3. Conclusion<br />
The problem is to <strong>und</strong>erstand why the return to orthodoxy in recent times<br />
or what has pushed so many economists to overturn Keynes' research program.<br />
Of course, Keynes never ceased to face harsh opponents: this can<br />
simply be attributed to ideological and political biases and does not explain<br />
the recent popularity of antikeynesianism.<br />
In fact, however, economic reality has changed. While Keynes was<br />
viewing the socialization of investment as the stabilizing force in the economic<br />
and social System, his followers have rationalized a different type<br />
of State Intervention — the Weifare State — the essence of which was less<br />
in providing effective demand for füll employment than in mediating the<br />
conflict between enterprises and workers. There is considerable difference<br />
between these avenues for State Intervention — and political scientists as<br />
well as sociologists have delved on it at length.<br />
From an economic point of view, the difference lies in the effects of<br />
the two alternative programs. Socializing investment implies stabilizing<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
effective demand as determinant of Output, employment and income.<br />
Spending on welfare affects the Standard of living and, therefore consumption,<br />
which is, however, a function of employment and income. While<br />
socializing investment creates profit and savings, and Substitutes market<br />
forces, welfare sustains consumption and provides room for market forces.<br />
The preference afforded to welfare spending, in turn, was the result of postwar<br />
development strategies, based on expanding international free trade,<br />
rather than socializing national investment, which created the need for<br />
balance of payments policies and therefore for State policies of mediation<br />
(to control competitiveness). Unfortunately, when the bases of international<br />
development collapsed (the break of the Bretton Woods agreement<br />
on international liquidity and trade), State mediation became aimless<br />
(zero-sum game), and the role of the State lost legitimacy.<br />
This has not prevented the continued presence of the Welfare State —<br />
although its essence has changed. With low and fluctuating international<br />
demand, the rate of growth of each economy has been low and fluctuating<br />
— and welfare expenditure has not been able to either increase or stabilize<br />
the rate of growth. Actually, the negative economic results cannot be<br />
imputed to welfare: this Supplements household consumption, but total<br />
household consumption is determined by household income; thus, other<br />
income sources, rather than welfare, will determine the propensity to consume,<br />
the multiplier and the effects on the economy. When the economy<br />
does not grow and fluctuates, labor demand will not grow and fluctuate.<br />
Now, welfare can be seen as a means to provide greater contractual power<br />
to the unemployed, when labor demand is present; but when labor demand<br />
is absent, welfare becomes similar to charity (there is no social exchange<br />
justifying it) and this — contrary to what Job search economists think —<br />
reduces, rather than increases, the contractual power of the unemployed;<br />
the nature of the mediation effected by the State changes substantially,<br />
and the role of the State is diminished.<br />
Furthermore, welfare expenditure gives rise to welfare institutions.<br />
These are built, from the beginning, with two objectives: one — common<br />
to all institutions — is to provide effective demand to the economic System<br />
(effectiveness); the other, constitutive the Institution, to spend government<br />
f<strong>und</strong>s (efficiently — in the sense of making the public institutions viable;<br />
not in the market sense). When public policy is of a mediating character,<br />
the "effectiveness" objective becomes less relevant than the "efficiency"<br />
objective: there will be a progressive tendency of institutions to prefer<br />
"efficiency" to effectiveness — or, in other words, to reinforce their specific<br />
vis-a-vis of their general role. This, in turn, will exercise pressures on Government<br />
budgets, favoring financial transfers to welfare institutions vs. expenditure<br />
on goods and Services, so that — in the end — Government<br />
deficits may paradoxically grow due to greater "efficiency" (i.e. autonomy)<br />
of welfare institutions. It is as if a "public market" is created, where institutions<br />
behave as private enterprises enjoying a degree of monopoly in the<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
sense that they can influence demand (welfare transfers), and a degree of<br />
monopsony in the sense that they can influence supply (government welfare<br />
financing). The result of all this is that füll employment will not be<br />
assured, as — again following Keynes — there is no reason to suppose that<br />
market forces (or autonomous social behaviour) produce necessarily füll<br />
employment (or effectiveness). Two outcomes are then logically possible:<br />
the first is that Government will find it ever more difficult to obtain fuller<br />
employment by increasing welfare expenditure, if the market does not<br />
produce füll employment by itself; the second is that the egalitarian motivations<br />
behind welfare gradually change to charity motivations.<br />
Society will soon find that welfare is economically and socially useless,<br />
while the market is the real force that determines (less than füll) employment.<br />
Neokeynesians sensed this, and thought that a policy to minimize<br />
wages, compensated by welfare, could stimulate private investment — a<br />
mediation which however lacks the power to oblige enterprises to accumulate,<br />
and leaves to market forces the determination of investment and<br />
employment. Monetarists, more radically, throw away welfare and recognize<br />
the powers of the market ("natural" social behaviour; or the "natural"<br />
development thereof). They negate any strength to the multiplier — not<br />
only of welfare expenditures, but of all autonomous expenditures — thus<br />
freeing the market from any links with public policy.<br />
The Welfare State, so modified or reduced, opens up new vistas, not<br />
particularly optimistic, for societal change. As it tends to become charity<br />
on the one hand, and to reinforce the "efficiency" of public institutions<br />
on the other, while leaving market forces free to operate and to create<br />
stable long-term unemployment, somewhere in the social System a new<br />
class division may appear. What we thought in the past were signs of social<br />
progress — the development of mass movements based on voluntary aggregation<br />
and formed outside the institutional set-up — may yet be interpreted<br />
as a spontaneous adaptation of society to the liberation of market<br />
forces, the disgregation of the welfare State, the reproduction of a divided<br />
society, based on mass unemployment, crises and slow economic growth.<br />
Economists, as intellectuals, have simply sensed this societal change —<br />
and have used their tools to justify it. If saddened by our role, it is nevertheless<br />
fascinating to see the mechanisms at work: wehave,infact, witnessed<br />
the social creation of ideology. As an economist, I would welcome sociologists<br />
interested in examining — in corpore — the sociology of ideology.<br />
ANMERKUNGEN<br />
1 Not all monetarists adhere to the rational expectation hypothesis (Frydman-Phelps,<br />
1983); they fear that such hypothesis is "closer in spirit to a planned economy than<br />
to a decentralized market, due to the relevant model" (q.v.).<br />
2 Some reference to Smith, Ricardo, Malthus or Marx, due to the "natural" concepts;<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ut mostly the reference is to the liberal economic school that Keynes, with a misnomer,<br />
called "the Classics". This school is essentially anti-keynesian, and has<br />
decided to dress the colors of Keynes' enemies. Although extremist, this school is<br />
academically well accepted. And because it is extremist, it appeals to extreme<br />
liberals — including those that feel the urge to "change the System". It is not uncommon<br />
today to find similar extremists in the "left wing": they generally don't<br />
know the cultural roots of their own extremism.<br />
3 Although less appealing than the perfect competition utopia. The "natural" enterprise<br />
is totally autocratic, does not distinguish between the owners of the enterprise<br />
and its managers, and all its components can be measured in price terms and<br />
disaggregated at will.<br />
4 This, by the way, is a problem for those politicians in Government that profess neomonetarist<br />
principles: they would have to be continuously self-effacing; but in<br />
order to make their ideas believed they have to exercise force, much beyond what<br />
would be natural. Thus, we have liberalism by "diktat" in Great Britain, and a<br />
Shacht-type keynesianism in the U.S.<br />
5 I shall not quote the immense literature on the Phillips curve. Suffice it to say that<br />
all neo-keynesians have subscribed it (Samuelson, Solow, Modigliani, Tobin) as well<br />
as some post-keynesians (Kahn) and even young marxists (Rawthorne) — the latter<br />
taking the inflation-unemployment trade-off as a sign of class struggle.<br />
6 If so, and contrary to monetarist opinion, real wages will increase, due to the quasirent<br />
accruing to a labor monopoly.<br />
7 Keynes, in fact, recognized that workers can only determine money wages, while<br />
real wages are determined by enterprises — that control prices. This did not mean,<br />
however, that real wages are considered as given: Keynes' point was intended to<br />
show that effective demand could not be systematically sustained by an increase<br />
in money wages.<br />
8 It is interesting to note that the term "structural" has completely changed meaning<br />
over the last two decades: it was originally associated, with reference to unemployment,<br />
to <strong>und</strong>erdeveloped areas, where the problem was recognized as being rather<br />
that of accumulation than of a lack of effective demand; this justified aid policies<br />
in favor of such areas — a "progressive" idea. Today, the term "structural" is<br />
applied to well developed economies, in order to justify the recent, large unemployment<br />
rates; if unemployment is structural only faster accumulation can remedy it,<br />
and this will take place only if the rate of profit is sufficiently high. In this manner,<br />
a redistribution of income against wages and in favor of profits becomes the best<br />
means to reduce "structural" unemployment. Monetarists are slightly less naive,<br />
as they leave to enterprises' decisions to determine what is the natural rate of unemployment;<br />
but there is no doubt that if the "natural investment rate" rises, then<br />
also the natural employment rate will rise. As an aside, let us remind ourselves that<br />
if both developed and <strong>und</strong>erdeveloped areas have structural or natural unemployment,<br />
the case for an aid policy in favor of the latter becomes very weak — both<br />
areas will be considered as differing due to "natural" causes.<br />
9 This implies that the (cost) supply curve of each enterprise is not increasing (Jossa,<br />
1981) and that the demand curve for each product does not contribute to determining<br />
prices, which therefore reflect production costs. In the economic System,<br />
then, effective aggregate demand determines aggregate supply, but individual supply<br />
curves determine prices. If aggregate (not the specific commodity's) demand could<br />
be shown to influence all individual supply curves — in the sense that unit cost<br />
curves will decline (rise) more the greater is the increase (decrease) in aggregate<br />
demand (Leon, 1981) — then the change in aggregate demand, through individual<br />
firms' cost curves, would have an influence on prices and, therefore, on income<br />
distribution. Sraffa (1960) showed that income distribution is determined outside<br />
the economic System ( he thought that the interest rate, via the keynesian liquidity<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
preference, might play a role) — but his System is static (or post-hoc). Since his<br />
f<strong>und</strong>amental contributions, anti-keynesians and anti-monetarists are groping in the<br />
research of an alternative description of the System.<br />
10 Fordism, as Gramsci indicated, is not a proof to the contrary; Ford thought that an<br />
increase in wages, if generalised to all employers, would have increased demand and<br />
aggregate output; but he did not increase the wages of his workers hoping to obtain<br />
that result.<br />
11 The manner in which Keynes made savings dependent on income, rather than determining<br />
it, was through a consumption function, in turn dependent on income.<br />
Both neokeynesians and monetarists have tried to improve on the consumption<br />
(and saving) function, building it as the sum of individual preferences which take<br />
into account household wealth and optimizing consumer behaviour. Neokeynesians<br />
(Modigliani — Brunberg, 1954 and Modigliani — Ando, 1963) have introduced<br />
financial wealth, the present value of future expected wage income and, therefore,<br />
an interest rate — in this way, the interest rate is again the price of savings (abstinence)<br />
and the traditional mechanism to reinstate (full-employment) equilibrium.<br />
Monetarists (Friedman, 1957) make individual consumption (and savings) a function<br />
of the present value of present and future income introducing again the interest<br />
rate as an explanatory variable, reaching results similar to the neo-keynesians.<br />
It is paradoxical that, econometrically, Keynes' traditional function Stands very<br />
well to tests; however "it does not Square well with the diffuse opinion (sie) according<br />
to which the share of savings should be independent of income" (Frasca<br />
et. al. 1979).<br />
12 It is interesting to note that in this voyage toward orthodoxy a new coneept appears:<br />
wealth. This a rather mysterious coneept, in economics, shrouded in partial<br />
definitions, and given more to intuition than to logic. Wealth is not capital — it is<br />
more a financial than an economic term. As it represents the sum of assets and<br />
liabilities, in the absence of the State wealth should be zero for the society at<br />
large — debts equalling credits. It may not be zero if the State issues debt which<br />
will not be redeemed — but since many orthodox theories are framed in a stateless<br />
environment, there is little sense in speaking of wealth for society. As a financial<br />
coneept, wealth can acquire different forms, and the history of financial markets<br />
has created, and is creating, ever new forms of assets representing wealth. In this,<br />
there is certainly a type of social development. But the (social) necessity for the<br />
innovation in wealth has not been discussed in economics. A few keynesians (Minsky<br />
1977) think that money is also endogenous (agents are capable of producing<br />
money-type assets even in the absence of the State issuing legal tender), and the<br />
new forms of wealth are simply the result of the market trying to overcome monetary<br />
restrictions of Governments and banks. This creates havoc for monetarists,<br />
and many neo-keynesians, because while it shows that money is wealth, it also<br />
shows that money is a peculiar form of wealth.<br />
BIBLIOGRAPHY<br />
W.H. Buiter: "The macroeconomics of Dr. Pangloss: a critical survey of the New Classical<br />
Macroeconomics", Economic Journal, March 1980.<br />
F. Caffe': "Intervento Pubblico e Realta economica", Rassegna-Economia, maggiogiugno<br />
1984.<br />
M. de Felice and G. Pelloni: "Aspettative razionali, teoria economica e politiche di<br />
stabilizzazione", ISEDI, Milan 1982.<br />
P. Doeringer and M. Piore: Internal Labor Market and Manpower Analysis, Lexing-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ton, 1971.<br />
F. Frasca, N. Rossi, E. Tarantelli, C. Tresoldi, I. Visco: La funzione del consumo in<br />
Italia, Banca d'Italia, Modelle- Econometrico dell'Economia Italiana, 1979.<br />
M. Friedman: Price Theory, Aldine, Chicago 1962.<br />
M. Friedman: "A Theory of the Consumption Function", NBER, Princeton University<br />
Press, New York, 1957.<br />
M. Frydman and E.S. Phelps: "Individual expectations and aggregate outcomes", in<br />
Individual forecasting and aggregate outcomes: rational expectations examined,<br />
Ca<strong>mb</strong>ridge University Press, 1983.<br />
B. Jossa: "Critica della legge della domanda e dell'offerta", in: Allocazione delle risorse<br />
e politica economica, Societa Italiana degli Economisti, 1981.<br />
R.G. Lipsey: "The relation between unemployment and the rate of change of money<br />
wage rates in the United Kingdom 1862-1957: a further analysis", Economica,<br />
February 1960.<br />
P. Leon: L'economia della domanda effettiva, Feltrinelli, Milan 1981.<br />
R.E. Lucas and E.G. Prescott: "Investment <strong>und</strong>er uncertainty", Econometrica, Septe<strong>mb</strong>er<br />
1979.<br />
R.E. Lucas and L.A. Rapping: "Real Wages, employment and inflation", Journal of<br />
Political Economy, October 1969.<br />
F. Modigliani and A. Ando: "The life-cycle hypothesis of saving: aggregate implications<br />
and tests", American Economic Review, March 1963.<br />
F. Modigliani and R. Brunberg: Utility analysis and the aggregate consumption function,<br />
unpublished, 1954.<br />
J.F. Muth: "Rational expectations and the theory of price movements", Econometrica,<br />
July 1961.<br />
A.W. Phillips: "The relationship between unemployment and the rate of change of<br />
money wage rates in the United Kingdom, 1861-1957", Economica, Nove<strong>mb</strong>er<br />
1958.<br />
P.A. Samuelson and R.M. Solow: "Analytical aspects of anti-inflation policy", American<br />
Economic Review, May 1960.<br />
TJ. Sargent and N. Wallace: "Rational expectations, the optimal monetary instruments<br />
and the optimal money supply rule",/oMrna/ of Political Economy, April 1975.<br />
P. Sraffa: Production of commodities by means of commodities, Ca<strong>mb</strong>ridge and Turin,<br />
1960.<br />
P. Sraffa: "Sülle relazioni tra costo e quantitaprodotta" (1925), now in: Contributi per<br />
un'analisi economica dell'impresa, ed. G. Zanetti, Liguori, Naples, 1980.<br />
M.H. Willes: "Rational expectations as a counter revolution", in: D. Bell — I. Kristol,<br />
The Crisis in Economic Theory, Basic Book, New York, 1981.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
GESELLSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG ODER ENTWICKLUNG DES<br />
WELTSYSTEMS?*<br />
Immanuel<br />
Wallerstein<br />
Das Thema dieses Deutschen Soziologentags ist „Soziologie <strong>und</strong> Gesellschaftliche<br />
Entwicklung". Dieser Titel enthält zwei der allgemeinsten, der<br />
zweideutigsten <strong>und</strong> trügerischsten Worte im soziologischen Wortschatz:<br />
Gesellschaft <strong>und</strong> Entwicklung. Deshalb habe ich den Titel meines Vortrags<br />
in Form einer Frage gestellt: Gesellschaftliche Entwicklung oder Entwicklung<br />
des Weltsystems?<br />
Gesellschaft ist natürlich ein alter Begriff. Das Oxford English Dictionary<br />
gibt dafür zwölf verschiedene Hauptbedeutungen, von denen nur zwei für<br />
unsere Diskussion am wichtigsten erscheinen. Eine ist "the aggregate of<br />
persons living together in a more or less ordered Community". Die zweite,<br />
nicht sehr unterschiedliche, ist "a collection of individuals comprising a<br />
Community or living <strong>und</strong>er the same Organization of government". Das<br />
Oxford English Dictionary hat den Vorzug eines historischen Wörterbuchs<br />
<strong>und</strong> gibt folglich auch die erste nachgewiesene Verwendung an. Die ersten<br />
Belege in diesem Sinne finden sich 1639 bzw. 1577, also zu Beginn des modernen<br />
Zeitalters.<br />
Beim Nachschlagen deutscher Wörterbücher finde ich, daß der Große<br />
Duden (1977) folgende relevante Definition anbietet: „Gesamtheit der<br />
Menschen, die unter bestimmten politischen, wirtschaftlichen <strong>und</strong> sozialen<br />
Verhältnissen zusammen leben", unmittelbar ergänzt durch folgende<br />
Beispiele: „die bürgerliche, sozialistische, klassenlose Gesellschaft". Das<br />
Wörterbuch der Deutschen Gegenwartssprache (1967), in der DDR veröffentlicht,<br />
enthält eine ziemlich ähnliche Definition: „Gesamtheit der unter<br />
gleichartigen sozialen <strong>und</strong> ökonomischen sowie auch politischen Verhältnissen<br />
lebenden Menschen", gefolgt von mehreren Beispielen, einschließlich:<br />
„die Entwicklung der (menschlichen) Gesellschaft...; die neue sozialistische,<br />
kommunistische Gesellschaft; die klassenlose Gesellschaft...; die<br />
bürgerliche, kapitalistische Gesellschaft". Dieser Definition ist die Anmerkung<br />
„ohne Plural" vorangestellt.<br />
Wenn man nun diese Definitionen näher betrachtet, die sicherlich typisch<br />
für das sind, was man in den meisten Wörterbüchern der meisten Spra-<br />
Für die sehr hilfreichen Kommentare zu einem früheren Entwurf dieser Arbeit, die<br />
zur Klarstellung meiner Argumentation wesentlich beigetragen haben, möchte ich<br />
an dieser Stelle Terence K. Hopkins meinen aufrichtigen Dank aussprechen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
chen finden würde, dann bemerkt man eine merkwürdige Anomalie. Jede<br />
dieser Definitionen bezieht sich auf eine politische Komponente; dies<br />
anscheinend impliziert, daß jede Gesellschaft innerhalb eines spezifischen<br />
Sets politischer Grenzen existiert, obwohl die Beispiele gleichfalls andeuten,<br />
daß eine Gesellschaft durch weniger spezifische <strong>und</strong> mehr abstrakte Phänomena<br />
definiert eine Art von Staat ist; wobei das zuletzt erwähnte Wörterbuch<br />
ausdrücklich „ohne Plural" hinzufügt. In diesen Beispielen wird<br />
„Gesellschaft" durch ein Adjektiv modifiziert, <strong>und</strong> diese Verbindung von<br />
Substantiv <strong>und</strong> Adjektiv beschreibt eine Art von Struktur, die eine „Gesellschaft"<br />
im anderen Sinne, dem der politisch begrenzten Entität, habe.<br />
Dieser leztere Gebrauch des Wortes Gesellschaft kann dann einen Plural<br />
haben, während der erstere dies nicht duldet.<br />
Vielleicht sehen Sie hierin keine Anomalie. Ich möchte jedoch damit<br />
beginnen, die Eingangsbemerkung eines der ersten ernsthaften Versuche,<br />
dieses Thema in der modernen Sozialwissenschaft zu behandeln, zu unterstreichen.<br />
Es ist ein deutscher Versuch — Lorenz von Stein's längst vergessenes<br />
Werk „Der Begriff der Gesellschaft <strong>und</strong> die soziale Geschichte<br />
der Französischen Revolution bis zum Jahre 1830". Stein schreibt in der<br />
Einleitung: „Der Begriff der Gesellschaft gehört ... zu den schwierigsten<br />
in der ganzen Staatswissenschaft..." (1959,1, 12).<br />
Warum spricht Stein von Gesellschaft als von einem Begriff der Staatswissenschaft?<br />
Sicher ist eine Antwort darauf, daß der damals in Deutschland<br />
übliche Fachausdruck Staatswissenschaft, den Bereich der heute in<br />
Deutschland so genannten Sozialwissenschaften mit einbezog, obgleich<br />
die Grenzen beider nicht identisch sind. Der Gebrauch des Wortes Staatswissenschaften<br />
im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert in Deutschland, nicht jedoch in England<br />
oder Frankreich, ist selbst ein bedeutsames Phänomen, das ein Verständnis<br />
der Sozialwissenschaften vom Standpunkt der Überlegenheit eines, wie<br />
ich es nennen würde, semiperipheren Staates außerhalb des Kulturkreises<br />
der Hegemonialmacht widerspiegelt. Dies ist jedoch nicht die vollständige<br />
Antwort. Gesellschaft ist ein Begriff der Staatswissenschaft, <strong>und</strong> „der<br />
schwierigste", weil, wie aus Steins Werk selbst hervorgeht, der Begriff<br />
„Gesellschaft" seine Bedeutung für uns primär (sogar ausschließlich)<br />
in der klassischen Antinomie Gesellschaft/Staat hat. Und diese Antinomie<br />
hat ihrerseits ihren Ursprung im Versuch der modernen Welt, die ideologischen<br />
Implikationen der Französischen Revolution in den Griff zu bekommen.<br />
Schon vor 1792 waren Könige abgesetzt <strong>und</strong>/oder durch Rebellionen<br />
zur Änderung der verfassungsmäßigen Struktur ihres Regimes gezwungen<br />
worden. Die Legitimation solcher Veränderungen war jedoch vorher in der<br />
Existenz einer oder mehrerer unrechtmäßiger Handlungen des Monarchen<br />
gesucht worden. Die Französische Revolution jedoch war auf dieser Basis<br />
nicht gerechtfertigt oder wurde zumindest nicht so gerechtfertigt. Statt<br />
dessen proklamierten die Revolutionäre nachdrücklich als neue Moral oder<br />
strukturelle Gr<strong>und</strong>lage der Legitimität den Begriff des 'Volkswillens'. Wie<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
wir wissen, überrollte dieses theoretische Konstrukt die Welt in den folgenden<br />
zwei Jahrh<strong>und</strong>erten nach der Französischen Revolution, <strong>und</strong> es gibt<br />
heute wenige, die dies bestreiten, trotz all der Versuche der konservativen<br />
Theoretiker von Burke <strong>und</strong> de Maistre an, diese Doktrin herabzusetzen,<br />
<strong>und</strong> trotz der zahlreichen Fälle, in denen die Volkssouveränität de facto<br />
ignoriert wurde.<br />
Die Theorie, daß die Souveränität beim Volke liegt, wirft zwei Probleme<br />
auf. Erstens müssen wir wissen, wer <strong>und</strong> wo das Volk ist, d.h., wer<br />
die „Bürger" eines „Staates" sind <strong>und</strong> sein sollten. Ich erinnere Sie daran,<br />
daß das Kernwort der ehrfürchtigen Anrede auf dem Höhepunkt der<br />
Französischen Revolution das Wort „Citoyen" war. Der „Staat" jedoch<br />
trifft die Entscheidung, wer die „Bürger" sind, <strong>und</strong> vor allem entscheidet<br />
er, wer die vollwertigen Mitglieder des Gemeinwesens sind. Selbst heute<br />
ist nicht jeder in einem Staat lebende Mensch ein Bürger dieses Staates<br />
oder ein Wähler in diesem Staat. Die zweite Frage ist, wie man den Willen<br />
des Volkes erkennt. Dies ist sogar noch schwieriger als das erste Problem.<br />
Es ist wohl nicht sehr übertrieben, wenn ich behaupte, daß sich ein sehr<br />
großer Teil des historisch <strong>und</strong> sozialwissenschaftlichen Unternehmens im<br />
19. <strong>und</strong> 20. Jahrh<strong>und</strong>ert mit der Lösung dieser zwei Fragen beschäftigte,<br />
<strong>und</strong> daß das wichtigste dafür benutzte begriffliche Werkzeug die Idee ist,<br />
daß da eine Sache genannt „Gesellschaft" existiert, die durch ein verwickeltes<br />
— teils sy<strong>mb</strong>iotisches, teils antagonistisches — Verhältnis mit etwas, das<br />
„Staat" genannt wird, verknüpft ist. Wenn Sie dennoch wie ich das Gefühl<br />
haben, daß wir diese zwei Fragen nach ungefähr 150 Jahren nicht sehr<br />
gut gelöst haben, so liegt die Ursache vielleicht darin, daß wir uns nicht<br />
sehr adäquate begriffliche Werkzeuge geschaffen haben. Wenn dies der<br />
Fall ist, dann sollte man analysieren, warum dies geschehen ist: hierzu<br />
will ich kommen.<br />
Lassen Sie uns einen kurzen Blick auf das andere Wort des Titels,<br />
auf das Wort „Entwicklung", werfen. Auch Entwicklung hat sehr viele<br />
Bedeutungen. Die ihrem Gebrauch nach bei uns wichtigste im Oxford<br />
English Dictionary lautet wie folgt: „the growth or unfolding of what<br />
is in the germ: (b) of races of plants and animals." Das Oxford Englisch<br />
Dictionary verfolgt diesen Gebrauch nur bis 1871 zurück, bis zu einem<br />
sozialwissenschaftlichen Werk, Tylors Primitive Culture, Vol. I. Tylor<br />
wird wie folgt zitiert: „Its various grades may be regarded as stages of<br />
development or evolution, each the outcome of previous history" „Entwicklung",<br />
fügt das OED noch hinzu, ist „the same as Evolution".<br />
In deutschen Wörterbüchern finden wir etwas Ähnliches. Der Große<br />
Duden scheint fast jeden Gebrauch in unserem Sinne zu vermeiden, bis<br />
er zur Zusammensetzung „Entwicklungsgesetz" kommt, welche — wie<br />
er sagt — sich auf „Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft" bezieht. Das DDR Wörterbuch<br />
behandelt die Sache ebenfalls indirekt, mittels eines Beispiels,<br />
„die kulturelle, <strong>gesellschaftliche</strong>, geschichtliche, politische, ökonomische,<br />
soziale Entwicklung unseres Volkes."<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Die englischen Definitionen erklären vollauf, wie eng dieser Gebrauch<br />
in der Sozialwissenschaft mit der Doktrin der biologischen Evolution verknüpft<br />
ist, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts entstand. Dies<br />
gilt selbstverständlich auch für die deutschen Definitionen. Das Duden<br />
Fremdwörterbuch definiert die „Evolutionstheorie", eine direkte Anleihe<br />
aus dem Englischen, wie folgt: „Theorie von der Entwicklung aller Lebewesen<br />
aus niedrigen, primitiven Organismen."<br />
Wenn wir nun die beiden Worte verbinden, wie bei der Benennung dieses<br />
Kongresses (auf keinen Fall unüblich), <strong>und</strong> wir von „Gesellschaftlicher<br />
Entwicklung" sprechen, dann beschäftigen wir uns offensichtlich damit,<br />
wie sich eine Entität (eine Entität, die nicht der Staat ist, die jedoch nicht<br />
vom Staat getrennt ist <strong>und</strong> gewöhnlich mehr oder weniger die gleichen<br />
Grenzen mit ihm teilt) im Laufe der Zeit von einem niedrigen in einen höheren<br />
oder „komplexeren" Zustand entwickelt hat.<br />
Wo ist also der „Keim", von dem man diese Evolution ableiten kann,<br />
<strong>und</strong> wie weit muß man zurückgehen? Ich möchte kurz zwei mögliche Beispiele<br />
einer „Gesellschaft" erwähnen <strong>und</strong> einige naive Fragen dazu stellen.<br />
Ein Beispiel ist die deutsche Gesellschaft. Das zweite Beispiel ist die Gesellschaft<br />
Puerto Ricos. Es ist nicht meine Absicht, die reichhaltige Literatur gelehrter,<br />
öffentlicher Debatten zu diesen beiden Beispielen nochmals durchzugehen.<br />
Dies wäre eine monumentale Aufgabe im Falle des deutschen Beispiels,<br />
<strong>und</strong> auch im Falle Puerto Ricos wäre sie nicht gerade klein. Ich möchte lediglich<br />
aufzeigen, daß einige elementare Probleme im Gebrauch des Begriffs<br />
„Gesellschaft" in beiden Beispielen bestehen. Mir sind die Eigenheiten dieser<br />
beiden Fälle bekannt, <strong>und</strong> einige werden sicher sagen, daß sie in bestimmter<br />
Weise nicht „typisch" oder „repräsentativ" seien. Aber eine der geschichtlichen<br />
Realitäten ist, daß jedes Beispiel der Geschichte spezifisch <strong>und</strong> individuell<br />
ist, <strong>und</strong> ich bin, offen gesagt, skeptisch, ob es irgendwo repräsentative<br />
„Fälle" gibt. So fiel meine Wahl also auf diese beiden, weil Ihnen der deutsche<br />
Fall bekannt ist, <strong>und</strong> Sie vielleicht auf den Fall Puerto Rico gespannt<br />
sind, den die meisten von Ihnen wahrscheinlich nicht kennen.<br />
Erlauben Sie mir die einfache Frage: Wo ist die deutsche Gesellschaft?<br />
Befindet sie sich innerhalb der jetzigen Grenzen der B<strong>und</strong>esrepublik? Die<br />
offizielle Antwort scheint zu sein: Heute gibt es „zwei deutsche Staaten",<br />
jedoch nur „ein Volk". Diese eine „Nation" oder dieses eine „Volk" wird<br />
also offensichtlich so definiert, zumindest von einigen, daß sie/es die Menschen<br />
sowohl der B<strong>und</strong>esrepublik als auch der DDR mit einschließt.<br />
Wie steht es nun aber mit Österreich? Gehören die Österreicher zur<br />
deutschen „Gesellschaft", zum deutschen „Volk"? Österreich gehörte formell<br />
nur kurze Zeit, von 1938 bis 1945, zum deutschen Staat. Trotzdem<br />
wurde — wie Sie wissen — in der Mitte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts Österreichs<br />
Vereinigung mit einem damals nur potentiellen deutschen Staat als eine<br />
besondere Möglichkeit ausführlich diskutiert. Anscheinend gibt es unter anderem<br />
eine alte nationalistische Tradition, nach der Österreich als Teil der<br />
deutschen Gesellschaft definiert werden könnte.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Trotzdem scheint die heutige Antwort auf meine Frage, ob Österreich<br />
ein Teil der deutschen Gesellschaft sei, nein zu sein — jedoch nur heute. Der<br />
Gr<strong>und</strong> dafür liegt in den Anstrengungen der heutigen B<strong>und</strong>esrepublik, sich<br />
moralisch vom Dritten Reich, das mit Anschluß verb<strong>und</strong>en wird, abzusetzen;<br />
jeder Andeutung, daß Österreich kein getrennter Staat sei oder nicht<br />
immer sein wird (folglich Nation?, folglich „Gesellschaft"?), wird sowohl<br />
in der B<strong>und</strong>esrepublik als auch in Österreich mit Stirnrunzeln begegnet.<br />
Wenn eine „Gesellschaft" jedoch etwas ist, das sich aus einem „Keim"<br />
„entwickelt", wie ist es möglich, daß ein rein politisches Ereignis, das Ergebnis<br />
des Zweiten Weltkrieges, oder noch etwas weiter zurück, das Ergebnis<br />
des Österreich-Preußischen Krieges 1866, die Bestimmung des sozialen<br />
Raums der deutschen Gesellschaft beeinflussen könnte? Sollte man<br />
nicht schließlich annehmen, daß eine Gesellschaft verschieden vom Staate<br />
ist, eine Art zugr<strong>und</strong>eliegende <strong>und</strong> sich entwickelnde Realität, die zumindest<br />
teilweise gegen den Staat <strong>und</strong> trotz des Staates existiert? Wenn wir jedoch<br />
bei jeder Veränderung der Staatsgrenzen auch die Grenzen der „Gesellschaft"<br />
ändern, wie können wir dann begründen, daß sich die Legitimität<br />
einer von der „Gesellschaft" geschaffenen Regierung von der Legitimität<br />
einer vom Staate geschaffenen Regierung unterscheide? Der Begriff<br />
der „Gesellschaft" sollte uns etwas Solides, auf dem gebaut werden kann,<br />
schaffen. Wenn der Begriff aber zu einer Knet-Masse wird, die wir nach Belieben<br />
umformen können, wird er uns herzlich wenig helfen — weder im<br />
analytischen, im politischen noch im moralischen Sinne.<br />
Während der deutsche Fall zwei oder vielleicht sogar drei souveräne<br />
„deutsche Staaten" umfaßt, scheint der Fall Puerto Rico genau das Gegenteil<br />
zu sein. Gegenüber einer Gesellschaft mit mehreren Staaten steht hier<br />
wahrscheinlich eine Gesellschaft ohne jeglichen Staat. Schon seit dem 16.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert hat ein Puerto Rico genannter Verwaltungsapparat existiert,<br />
aber zu keinem Zeitpunkt gab es je einen souveränen Staat, ein vollanerkanntes<br />
oder vollwertiges Mitglied des interstaatlichen Systems. Sicher,<br />
die Vereinten Nationen debattieren von Zeit zu Zeit darüber, ob da jemals<br />
in Zukunft einer bestehen wird, <strong>und</strong> selbstverständlich tun dies auch die<br />
Einwohner von Puerto Rico.<br />
Wenn hier also überhaupt kein Staat existiert, wie bestimmen wir dann<br />
die „Gesellschaft"? Wo ist sie lokalisiert? Wer sind ihre Glieder? Wie entstand<br />
sie? Diese Fragen sind, wie Sie wohl gleich erahnen, politischer Natur,<br />
<strong>und</strong> der Ursprung leidenschaftlicher Kontroversen. Vor kurzem wurde dieser<br />
intellektuelle Streit auf ungewöhnliche Art durch Jose Luis Gonzalez<br />
neu entfacht, der 1980 das Buch „El pais de cuatro pisos" veröffentlichte.<br />
Gonzalez ist ein Gelehrter, der sich selbst als puertoricanischen Nationalisten<br />
betrachtet. Das Buch ist jedoch eine Polemik gegen bestimmte puertoricanische<br />
„Independistas", insbesondere gegen Pedro Albizu Campos,<br />
nicht weil sie für die Unabhängigkeit waren, sondern weil sie ihre Forderungen<br />
auf eine völlig falsche Analyse der puertoricanischen „Gesellschaft"<br />
stützten.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Gonzalez beginnt, in der besten Tradition Max Webers, mit der Beobachtung<br />
einer Anomalie. Puerto Rico hat als einzige aller spanischen Kolonien<br />
der westlichen Hemisphäre nie einen Unabhängigkeitsstatus erlangt.<br />
Wie kam es dazu? Seine Antwort geht aus seiner Überzeugung hervor, daß<br />
die Entwicklung der „Gesellschaft" Puerto Ricos gerade nicht auf einen<br />
„Keim" zurückzuführen sei. Er schlägt eine alternative Analogie vor: Die<br />
„Gesellschaft" Puerto Ricos ist ein vierstöckiges Gebäude <strong>und</strong> jedes Stockwerk<br />
wurde in spezifischen historischen Momenten hinzugefügt. Das erste<br />
Stockwerk entstand vom 16. bis zum 18. Jahrh<strong>und</strong>ert durch die Vermischung<br />
drei historischer „Rassen": die Taina (oder karibischen Indianer),<br />
die Afrikaner (als Sklaven herübergeholt) <strong>und</strong> die spanischen Siedler. Da<br />
die Taina großenteils vernichtet wurden <strong>und</strong> die Spanier eine zahlenmäßig<br />
kleine Gruppe darstellten, die auch häufig zeitlich nur begrenzt dort lebten,<br />
bekamen die Afrikaner das Übergewicht. „Deshalb bin ich überzeugt, <strong>und</strong><br />
habe es auch häufig geäußert, auch wenn es einige Leute beunruhigt <strong>und</strong><br />
stört, daß die ersten Puertoricaner in Wirklichkeit schwarze Puertoricaner<br />
waren" (Gonzalez, 1980, 20).<br />
Erst 1815 änderte sich diese ethnische Mischung in Puerto Rico. 1815<br />
wurde die Insel durch die Real Cedula de Gracias für Flüchtlinge aus den<br />
anderen lateinamerikanischen Kolonien, die sich mitten in den Unabhängigkeitskriegen<br />
befanden, geöffnet — dies nicht nur für die dem König<br />
loyalen Spanier, sondern auch für Engländer, Franzosen, Holländer <strong>und</strong><br />
Iren. Achten Sie bitte auf das Datum: 1815. Es ist nämlich auch das Jahr,<br />
in dem Napoleon endgültig ins Exil ging, das Gründungsjahr der Heiligen<br />
Allianz <strong>und</strong> das Jahr der Konsolidierung der britischen Hegemonie im<br />
Weltsystem. Im Laufe des späten 19. Jahrh<strong>und</strong>erts war Puerto Rico außerdem<br />
ein Aufnahmeland für weitere Einwanderungswellen, besonders aus<br />
Korsika, Mallorca <strong>und</strong> Katalonien. Gegen Ende des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts, sagt<br />
Gonzalez, war folglich ein zweites Stockwerk durch diese weißen Siedler<br />
des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts erbaut worden, die in Puerto Rico eine „privilegierte<br />
Minderheit" bildeten (S. 24). Also, setzt Gonzalez fort, sei es nicht wahr,<br />
wie Albizu Campos <strong>und</strong> andere behaupten, daß Puerto Rico zu Beginn der<br />
amerikanischen Kolonisation 1898 eine homogene „nationale Kultur" besessen<br />
habe. Genau das Gegenteil sei der Fall gewesen, es war ein „geteiltes<br />
Volk".<br />
Gonzalez benutzt diese Tatsache, um die unterschiedliche Antwort von<br />
Puertoricanern auf die U.S.-Kolonisation zu erklären, durch die das dritte<br />
Stockwerk entstand. Vereinfacht dargestellt, behauptet er, daß die Hacendados<br />
die Amerikaner anfangs begrüßt hätten, in der Meinung, daß sie<br />
durch dieses Verhalten letztendlich als Teil der amerikanischen Bourgeoisie<br />
aufgenommen würden. Als ihnen nach zehn Jahren klar wurde, daß dies<br />
nicht geschehen würde, habe sich die „privilegierte Minderheit" dem Nationalismus<br />
zugewandt. Die puertoricanische Arbeiterklasse dagegen habe<br />
der U.S.-Invasion anfänglich auch wohlwollend gegenübergestanden, jedoch<br />
aus entgegengesetzten Gründen. Sie habe diese als eine Möglichkeit<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
angesehen, ihre „Rechnungen [mit der Klasse der Gr<strong>und</strong>eigentümer] zu begleichen"<br />
(S. 33), die „von den puertoricanischen Massen als das empf<strong>und</strong>en<br />
wurden, was sie tatsächlich waren: Ausländer <strong>und</strong> Ausbeuter" (S. <strong>35</strong>).<br />
Dann ist da noch das vierte Stockwerk, dessen Entstehung nicht als ein<br />
Ergebnis der kulturellen „Nordamerikanisierung", sondern eher als das Ergebnis<br />
der wirtschaftlichen Veränderungen ab 1940 zu betrachten ist. Am<br />
Anfang führte dies zu einer „Modernisierung innerhalb der Abhängigkeit"<br />
(S. 41) der puertorikanischen Gesellschaft, später jedoch, in den 70er Jahren,<br />
zum „spektakulären <strong>und</strong> nicht wieder gutzumachenden Zusammenbruch"<br />
(S. 40) des vierten Stockwerkes. Die weitere Komplikation, daß die<br />
Puertoricaner seit den 1940er Jahren massiv in die kontinentalen Vereinigten<br />
Staaten migrieren, <strong>und</strong> daß ein Großteil aller Puertoricaner außerhalb<br />
von Puerto Rico geboren wurde <strong>und</strong> lebt, wird von Gonzalez nicht direkt<br />
untersucht. Gehören auch diese Menschen noch zur puertoricanischen Gesellschaft,<br />
<strong>und</strong> wenn dies so ist, für wie lange noch?<br />
Ich zitiere Gonzalez weder um die Zukunft Puerto Ricos zu erörtern,<br />
noch um uns die tiefgründigen sozialen Spaltungen in unseren sogenannten<br />
Gesellschaften vor Augen zu führen; diese Spaltungen sind ganz sicher Klassenspaltungen;<br />
häufig (oder sogar meistens) jedoch sind sie von ethnischen<br />
Spaltungen überlagert <strong>und</strong> mit ihnen verb<strong>und</strong>en. Ich zitierte den Fall Puerto<br />
Rico, wie vorher den Fall Deutschland, eher um den Wechsel <strong>und</strong> die anfechtbaren<br />
Definitionen der Grenzen einer „Gesellschaft" <strong>und</strong> den engen<br />
Zusammenhang solcher wechselnden Definitionen mit den historischen Ereignissen,<br />
die nicht primär ein Ergebnis einer der „Gesellschaft" intrinsischen<br />
Entwicklung sind, hervorzuheben.<br />
Das gr<strong>und</strong>legende Falsche am Begriff „Gesellschaft" ist die Konkretisierung<br />
<strong>und</strong> somit die Kristallisierung sozialer Phänomena, deren wirkliche Bedeutung<br />
nicht in ihrer Solidarität, sondern gerade in ihrer Fluidität <strong>und</strong> ihrer<br />
Geschmeidigkeit liegen. Der Begriff „Gesellschaft" impliziert, daß wir zur<br />
Analyse eine greifbare, <strong>und</strong> dennoch sicher auch eine sich „entwickelnde"<br />
Wirklichkeit vor uns haben. Tatsächlich haben wir in erster Linie ein rhetorisches<br />
Konstrukt, <strong>und</strong> deshalb, wie Lorenz von Stein sagt, einen „schwierigen<br />
Begriff" der Staatswissenschaft (in diesem Fall der politischen Philosophie)<br />
vor uns. Wir haben jedoch kein analytisches Werkzeug für die Summierung<br />
oder Zerlegung unserer sozialen Prozesse.<br />
Eines der Welt-Sozialwissenschaft zugr<strong>und</strong>eliegenden Elemente war in<br />
den letzten Jahren eine spezifische Lektüre der modernen europäischen Geschichte.<br />
Diese Lektüre der Geschichte ist nicht nur auf professionelle Geschichts-<br />
<strong>und</strong> Sozialwissenschaftler begrenzt. Sie beinhaltet eine tiefliegende<br />
Gr<strong>und</strong>lage für unsere gemeinsame Kultur, die allen in der Sek<strong>und</strong>arstufe<br />
unseres Schulsystems vermittelt wird, <strong>und</strong> ist eine gr<strong>und</strong>legende Voraussetzung<br />
für das Verständnis der sozialen Welt. Sie war nicht Gegenstand<br />
größerer Kontroversen; sie war eher das Gemeingut der beiden wichtigsten<br />
Weltanschauungen des letzten Jahrh<strong>und</strong>erts, des Liberalismus <strong>und</strong> Marxismus,<br />
die andererseits in starkem Gegensatz zueinander standen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Dieses Lesen der Geschichte nimmt die Form eines historischen Mythos<br />
an, der zwei Hauptaussagen enthält. Die erste Behauptung ist, daß aus der<br />
europäischen mittelalterlichen Feudalwelt, in der Herren über Bauern herrschten,<br />
eine neue soziale Schicht, die städtische Bourgeoisie, hervorging<br />
(hervortrat, geschaffen wurde), die zuerst das alte System (das „ancien<br />
regime") wirtschaftlich unterminierte, <strong>und</strong> es dann politisch vernichtete.<br />
Das Ergebnis war eine marktbeherrschte kapitalistische Wirtschaft in Ko<strong>mb</strong>ination<br />
mit einem auf persönlichen Rechten basierenden politischen Repräsentativsystem.<br />
Die europäische Geschichte wurde sowohl von den Liberalen<br />
als auch von den Marxisten auf diese Weise beschrieben; <strong>und</strong> beide<br />
applaudierten diesem historischen Prozeß als „progressiv".<br />
Die zweite Behauptung in diesem historischen Mythos wird sehr klar in<br />
Karl Büchers Buch, Die Entstehung der Volkswirtschaft, festgehalten; hier<br />
unterscheidet Bücher drei aufeinander folgende Stufen der europäischen<br />
Wirtschaftsgeschichte — geschlossene Hauswirtschaft, Stadtwirtschaft <strong>und</strong><br />
Volkswirtschaft. Das Schlüsselelement, in dem Bücher die liberal-marxistische<br />
Übereinstimmung darstellt, ist die Wahrnehmung der modernen Geschichte<br />
als eine Geschichte der sich ausdehnenden wirtschaftlichen Kreise,<br />
in welchen der größte Sprung der der „lokalen" Wirtschaft zur „nationalen"<br />
Wirtschaft — selbstverständlich in einem Nationalstaat lokalisiert —<br />
war. Bücher hebt diesen Zusammenhang hervor, indem er betont, daß „die<br />
Volkswirtschaft das Produkt einer jahrtausendelangen historischen Entwicklung<br />
ist, das nicht älter ist als der moderne Staat" (1913, 90). Beachten<br />
Sie bitte am Rande wieder den Begriff „Entwicklung". Bücher hebt<br />
ausdrücklich die räumliche Verflechtung hervor, die implizit in den generischen,<br />
deskriptiven Kategorien der Werke vieler anderer bedeutender Sozialwissenschaftler<br />
des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts zu finden sind: bei Comte <strong>und</strong><br />
Dürkheim, Maine <strong>und</strong> Spencer, Tönnies <strong>und</strong> Weber.<br />
Meines Erachtens sind diese beiden in dem vorherrschenden historischen<br />
Mythos der modernen europäischen Geschichte enthaltenen Behauptungen<br />
große Verzerrungen der wirklichen Geschehnisse. Ich möchte hier<br />
nicht ausführen, warum ich zu der Überzeugung gelangt bin, daß der Aufstieg<br />
einer Bourgeoisie, die auf irgendeine Weise eine Aristokratie vernichtete,<br />
mehr oder weniger das Gegenteil von dem ist, was wirklich geschah<br />
(nämlich die Verwandlung der Aristokratie in eine Bourgeoisie zur Rettung<br />
ihrer kollektiven Privilegien; diesen Fall habe ich an anderer Stelle erörtert<br />
(Wallerstein 1982). Ich ziehe es vor, meine Aufmerksamkeit auf den zweiten<br />
Mythos, den von den sich ausbreitenden Kreisen zu konzentrieren.<br />
Wenn die wesentliche Bewegung der modernen europäischen Geschichte<br />
die Entwicklung von der Stadtwirtschaft zur Volkswirtschaft, von lokalen<br />
Stätten zum Nationalstaat war, wo ist dann die „Welt" in dieser Vorstellung<br />
unterzubringen? Die Antwort lautet: im wesentlichen als eine Begleiterscheinung.<br />
Nationalstaaten werden als diejenigen politischen Einheiten betrachtet,<br />
die einen Teil ihrer Zeit <strong>und</strong> Energie (meist einen relativ kleinen<br />
Teil) für inter-nationale Aktivitäten: internationalen Handel, internationale<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Diplomatie verwenden. Diese sogenannten internationalen Beziehungen<br />
sind für diesen Staat, diese Nation, diese „Gesellschaft" irgendwie „äußerlich".<br />
Einige mögen bestenfalls einräumen, daß sich diese Situation in Richtung<br />
auf die „Internationalisierung" der Wirtschaft <strong>und</strong> der politischen <strong>und</strong><br />
kulturellen Schauplätze entwickelt hat, <strong>und</strong> zwar erst in jüngster Zeit (von<br />
1945 oder sogar erst von den siebziger Jahren an). Infolgedessen, so wird<br />
uns gesagt, gibt es jetzt vielleicht „zum allererstenmal" etwas, das wir Weltproduktion<br />
oder Weltkultur nennen können.<br />
Diese Vorstellungen, die mir offen gestanden immer bizarrer vorkommen,<br />
je mehr ich die wirkliche Welt untersuche, sind der Kern der operationalen<br />
Bedeutung des Begriffs „Gesellschafts<strong>entwicklung</strong>". Ich möchte<br />
hier eine andere Auffassung, einen anderen Weg, die <strong>gesellschaftliche</strong> Realität<br />
zusammenfassen, einen alternativen begrifflichen Rahmen vorlegen, von<br />
dem, wie ich hoffe, gesagt werden kann, daß er umfassender <strong>und</strong> zweckdienlicher<br />
die reale <strong>gesellschaftliche</strong> Welt, in der wir leben, erfaßt.<br />
Der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus brachte vor allem<br />
anderen (sowohl logisch als auch zeitlich) die Schaffung der Weltwirtschaft<br />
mit sich. Das bedeutet, eine <strong>gesellschaftliche</strong> Arbeitsteilung wurde durch<br />
die Umwandlung des Fernhandels hervorgerufen, <strong>und</strong> zwar aus einem<br />
Handel mit „Luxusgütern" in einen Handel mit „lebenswichtigen Gütern"<br />
oder „Massengütern". Auf diese Weise wurden weit auseinanderliegende<br />
Prozesse in lange Warenketten zusammengefaßt. Diese bestanden<br />
aus einzelnen miteinander verketteten Produktionsprozessen, deren<br />
Verknüpfung die Akkumulation von bedeutenden Mehrwerterträgen<br />
<strong>und</strong> ihre entsprechende Konzentration in wenigen Händen möglich machte.<br />
Solche Warenketten gab es schon im 16. Jahrh<strong>und</strong>ert, sie gingen allem,<br />
was man sinnvollerweise als „Nationalökonomie" bezeichnen könnte, voraus.<br />
Diese Ketten aber konnten nur durch die Bildung eines zwischenstaatlichen<br />
Systems, nämlich der kapitalistischen Weltwirtschaft, gesichert werden,<br />
das mit den Grenzen der realen <strong>gesellschaftliche</strong>n Arbeitsteilung in<br />
Einklang stand. Wie die kapitalistische Weltwirtschaft ursprünglich von Europa<br />
ihren Ausgang nahm, um die ganze Erde zu erfassen, so expandierten<br />
auch die Grenzen des zwischenstaatlichen Systems. Die souveränen Staaten<br />
waren Institutionen, die dann innerhalb dieses (sich ausdehnenden) zwischenstaatlichen<br />
Systems geschaffen <strong>und</strong> von ihm definiert wurden <strong>und</strong> ihre Legitimität<br />
aus der Verbindung von juristischer Selbstbehauptung <strong>und</strong> der Anerkennung<br />
durch andere ableiteten. Dies ist das Wesentliche an der „Souveränität",<br />
wie wir sie verstehen. Daß es nicht genug ist, Souveränität zu<br />
proklamieren, um sie dann auszuüben, wird an den aktuellen Beispielen der<br />
„unabhängigen" Bantustans in Südafrika <strong>und</strong> dem türkischen Staat in Nordzypern<br />
klar. Diese Gebilde sind keine souveränen Staaten, weil die anderen<br />
Mitglieder des Clubs souveräner Staaten sie nicht als solche anerkennen (in<br />
beiden Fällen zwar mit einer einzigen Ausnahme, die aber nicht ausreicht).<br />
Wie viele <strong>und</strong> welche Staaten eine solche Forderung nach Souveränität anerkennen<br />
müssen, um sie zu legitimieren, ist unklar. Daß da irgendwo eine<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
kritische Schwelle ist, wird offensichtlich, wenn wir sehen, wie fest Marokko<br />
dem Wunsch der Mehrheit der Mitglieder (<strong>und</strong> zwar einer klaren Mehrheit)<br />
der Organisation für afrikanische Einheit (OAU), der Arabischen Demokratischen<br />
Republik Sahara einen vollen Status in dieser regionalen zwischenstaatlichen<br />
Struktur zu gewähren, entgegentritt. Selbstverständlich<br />
weiß Marokko, daß eine Anerkennung durch die Organisation für afrikanische<br />
Einheit Druck auf die Großmächte hervorrufen würde, <strong>und</strong> die Forderung<br />
nach Anerkennung auf diese Weise die kritische Schwelle überschreiten<br />
würde.<br />
Es waren also das Weltsystem <strong>und</strong> nicht die einzelnen „Gesellschaften",<br />
die sich „entwickelt" haben. Das heißt, nachdem sie einmal ins Leben gerufen<br />
worden war, wurde die kapitalistische Weltwirtschaft zunächst einmal<br />
konsolidiert, <strong>und</strong> dann nach <strong>und</strong> nach der Einfluß ihrer Gr<strong>und</strong>strukturen<br />
auf die <strong>gesellschaftliche</strong>n Prozesse innerhalb ihrer Grenzen vertieft <strong>und</strong><br />
erweitert. Die ganzen Vorstellungen des Wachstumsprozesses von der Eichel<br />
zur Eiche, vom Keim zu seiner Entfaltung, gibt, wenn überhaupt, nur einen<br />
Sinn, wenn sie auf die einzigartige kapitalistische Weltwirtschaft als ein historisches<br />
System angewendet werden.<br />
Erst in diesem Entwicklungsrahmen entstanden viele der Institutionen,<br />
die wir oft ziemlich irrtümlich als „ursprünglich" beschreiben. Die Souveränität<br />
der Gerichtsbarkeit im zwischenstaatlichen System wurde geschaffen<br />
<strong>und</strong> die „Staatlichkeit" dieser Gerichtsbarkeit wurde immer mehr institutionalisiert,<br />
<strong>und</strong> zwar in dem Maße, wie sich eine Art von <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Bindung zu den Körperschaften entwickelte, die von der Gerichtsbarkeit<br />
festgelegt wurden. So breitete sich langsam <strong>und</strong> mehr oder weniger in<br />
Einklang mit den sich entwickelnden Grenzen jedes Staates ein entsprechendes<br />
Nationalgefühl aus. Das moderne Weltsystem hat sich aus einem<br />
System, in dem diese „Nationalgefühle" schwach oder nicht vorhanden waren,<br />
zu einem System entwickelt, in dem sie auffallen, sich ausbreiten <strong>und</strong><br />
festsetzen.<br />
Die Nationen waren jedoch nicht die einzigen neuen <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Gruppierungen. Die <strong>gesellschaftliche</strong>n Klassen, wie wir sie kennengelernt<br />
haben, wurden ebenfalls im Laufe dieser Entwicklung geschaffen, sowohl<br />
objektiv als auch subjektiv. Die Wege der Proletarisierung <strong>und</strong> der Bourgeoisierung<br />
waren lang <strong>und</strong> verschlungen, aber sie waren vor allem die Folge<br />
von Prozessen im Weltmaßstab. Selbst unsere gegenwärtigen Haushaltstrukturen<br />
— ja, sogar sie — sind erzeugte Gebilde, die gleichzeitig die zweifache<br />
Erfordernis einer Struktur erfüllen, die einerseits die Arbeitskraft<br />
sozialisiert <strong>und</strong> sie andererseits teilweise gegen die harten Auswirkungen<br />
des Arbeitssystems schützt.<br />
In dieser ganzen Beschreibung ist das Bild, das ich benutze, nicht das<br />
eines kleinen Kerns, an den ich weitere Außenschichten anfüge, sondern<br />
das eines dünnen äußeren Rahmens, der stufenweise mit einem dichten inneren<br />
Geflecht aufgefüllt wird. Gemeinschaft <strong>und</strong> Gesellschaft in der konventionellen<br />
Weise gegenüberzustellen, wie es nicht nur in der deutschen,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
sondern in der gesamten Soziologie geschieht, muß die Pointe verfehlen. Es<br />
ist das moderne Weltsystem, das heißt die kapitalistische Weltwirtschaft,<br />
deren politischer Rahmen das aus souveränen Staaten bestehende zwischenstaatliche<br />
System ist, das die Gesellschaft ausmacht, in der unsere vertraglichen<br />
Verpflichtungen angesiedelt sind. Um ihre Strukturen zu rechtfertigen,<br />
hat diese Gesellschaft nicht nur die vielfältigen Gemeinschaften,<br />
die in der Geschichte vorkamen (was der Punkt ist, der normalerweise betont<br />
wird), zerstört, sondern ein Geflecht von neuen Gemeinschaften geschaffen<br />
(<strong>und</strong> vor allen Dingen die Nationen, das heißt die sogenannten<br />
Gesellschaften). Unsere Sprache kehrt also das Oberste zuunterst.<br />
Ich bin versucht zu sagen, daß wir uns tatsächlich nicht auf dem Weg<br />
von der Gemeinschaft zur Gesellschaft befinden, sondern umgekehrt von<br />
der Gesellschaft zur Gemeinschaft, aber das ist auch nicht ganz richtig. Es<br />
ist eher so, daß unsere einzige Gesellschaft, die kapitalistische Weltwirtschaft<br />
(auch wenn sie eine nur teilweise vertraglich festgelegte Struktur ist),<br />
unsere vielfältigen bedeutungsvollen Gemeinschaften geschaffen hat. Vom<br />
Aussterben weit entfernt, sind Gemeinschaften niemals stärker, komplexer,<br />
übergreifender <strong>und</strong> konkurrierender gewesen <strong>und</strong> waren niemals bestimmender<br />
für unser Leben. Und doch sind sie niemals weniger legitimiert gewesen.<br />
Sie waren auch niemals irrationaler, so im materialen irrational,<br />
<strong>und</strong> zwar gerade deswegen, weil sie aus einem <strong>gesellschaftliche</strong>n Prozeß hervorgegangen<br />
sind. Wenn man so will, sind unsere Gemeinschaften unsere<br />
Lieblinge, die es nicht wagen, ihre Namen zu nennen.<br />
Natürlich ist das eine unmögliche Situation, <strong>und</strong> wir sehen uns inmitten<br />
einer weltweiten kulturellen Rebellion gegen diesen Druck, der um uns<br />
ist. Dieser Druck kommt in den unterschiedlichsten Formen zum Ausdruck:<br />
in den religiösen F<strong>und</strong>amentalismen, den Hedonismen des Auf-sich-<br />
Zurückziehens <strong>und</strong> der totalen Selbstbezogenheit, den vielfältigen „Gegenkulturen",<br />
den „grünen" Bewegungen, <strong>und</strong> nicht zuletzt im Aufruhr von<br />
wirklich ernsthaften <strong>und</strong> mächtigen anti-rassistischen <strong>und</strong> anti-sexistischen<br />
Bewegungen. Ich meine damit keineswegs, daß diese verschiedenen Gruppen<br />
alle gleich sind: überhaupt nicht. Aber sie sind die gemeinsame Folge<br />
der unbarmherzigen Ausbreitung des historischen <strong>gesellschaftliche</strong>n Systems,<br />
das formal zwar immer rationaler, aber material immer irrationaler<br />
wird, <strong>und</strong> in dem wir uns alle gemeinsam gefangen sehen. Diese<br />
Gruppen bedeuten Schmerzensschreie gegen die Irrationalität, die im Namen<br />
einer universellen rationalisierenden Logik tyrannisiert. Wenn wir<br />
uns wirklich von der Gemeinschaft zur Gesellschaft bewegt hätten, würde<br />
all dies nicht passieren. Wir würden statt dessen in den Gewässern der Vernunft<br />
einer Welt der Aufklärung baden.<br />
Einerseits ist da viel Hoffnung. Unser historisches System ist wie alle<br />
historischen Systeme voller Widersprüche, voller Prozesse, die uns dazu<br />
zwingen, in eine Richtung zu gehen, um unsere kurzfristigen Interessen zu<br />
verfolgen, <strong>und</strong> in eine andere, um unseren mittelfristigen Interessen nachzugehen.<br />
Diese Widersprüche sind in die wirtschaftlichen <strong>und</strong> politischen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Strukturen unseres Systems eingebaut <strong>und</strong> spielen sich aus. Ich möchte<br />
noch einmal betonen, daß ich hier keine Untersuchungen wiederholen<br />
will, die ich an anderer Stelle über das gemacht habe, was ich die „Übergangskrise"<br />
(Wallerstein 1985) nenne. Das ist ein langer Prozeß, der vielleicht<br />
150 Jahre in Anspruch nimmt, <strong>und</strong> der bereits begonnen hat. Er<br />
wird mit der Ablösung unseres gegenwärtigen Systems <strong>und</strong> seiner Ersetzung<br />
durch irgendein anderes System enden, ohne daß es jedoch irgendeine Garantie<br />
dafür gibt, daß dieses andere tatsächlich besser sein wird. Es gibt keine<br />
Garantie, aber eine bedeutungsvolle Möglichkeit. Das heißt, wir stehen<br />
vor einer historischen, kollektiven Wahl, etwas, was selten geschieht, <strong>und</strong><br />
was nicht das Los jeder Menschheitsgeneration ist.<br />
Ich möchte hier lieber die Frage der möglichen Rolle der historischen<br />
Gesellschaftswissenschaften bei dieser kollektiven Wahl, die natürlich eine<br />
moralische <strong>und</strong> folglich eine politische Wahl ist, aufwerfen. Das Gr<strong>und</strong>konzept<br />
von „Gesellschaft" <strong>und</strong> die gr<strong>und</strong>legenden historischen Mythen dessen,<br />
was ich den liberal-marxistischen Konsens des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts genannt habe,<br />
ergänzen sich <strong>und</strong> bilden das Gerüst der Sozialwissenschaften, die der<br />
wichtigste ideologische Ausdruck des Weltsystems sind. Ich habe behauptet,<br />
daß diese beiden Elemente im wesentlichen ohne Basis sind. Natürlich war<br />
das kein Zufall. Der Begriff der Gesellschaft <strong>und</strong> die historischen Mythen<br />
waren Teil der Maschinerie, die das moderne Weltsystem in seiner Blütezeit<br />
so gut funktionieren ließ. In der Zeit eines relativen systemischen Gleichgewichts<br />
ist das Bewußtsein der Intellektuellen vielleicht die genaueste Widerspiegelung<br />
der zugr<strong>und</strong>eliegenden materiellen Prozesse.<br />
Wir befinden uns jedoch nicht mehr in einer Zeit relativen systemischen<br />
Gleichgewichts. Es ist nicht so, daß der Apparat schlecht gearbeitet hat,<br />
sondern er hat das eher zu gut gemacht. Die kapitalistische Weltwirtschaft<br />
hat sich über 400 Jahre lang bei der Lösung von kurz- <strong>und</strong> mittelfristigen<br />
Problemen w<strong>und</strong>erbar geschickt gezeigt. Überdies sprechen alle Anzeichen<br />
dafür, daß sie jetzt <strong>und</strong> in naher Zukunft fähig ist, weiter in dieser Richtung<br />
erfolgreich zu sein. Die Lösungen selbst haben jedoch Veränderungen<br />
bei der zugr<strong>und</strong>eliegenden Struktur hervorgerufen, die mit der Zeit diese<br />
große Fähigkeit, die stets notwendigen Anpassungen vorzunehmen, aufheben.<br />
Das System ist dabei, seine Freiheitsgrade zu beseitigen. Ich kann diese<br />
Sache hier nicht beweisen. Ich behaupte sie einfach <strong>und</strong> benutze sie dazu,<br />
die Tatsache zu erklären, daß wir mitten unter den Lobeshymnen auf die<br />
Effizienz der kapitalistischen Zivilisation überall Anzeichen von Unbehagen<br />
<strong>und</strong> kulturellem Pessimismus finden. Der Konsens beginnt also zusammenzubrechen.<br />
Das zeigt sich in der Unzahl von antisystemischen Bewegungen,<br />
die zunehmend stärker <strong>und</strong> unkontrollierbarer werden.<br />
Bei den Intellektuellen schlägt sich dieses Unbehagen in einer zunehmenden<br />
Hinterfragung von gr<strong>und</strong>sätzlichen Voraussetzungen nieder. Heute<br />
gibt es Physiker, die die ganze philosophische Beschreibung der Wissenschaft,<br />
die „Entzauberung der Welt", die von Bacon über Newton zu Einstein<br />
reicht, anzweifeln <strong>und</strong> uns beschwören einzusehen, daß Wissenschaft<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
eher die „Wiederverzauberung der Welt" bedeute (Prigogine <strong>und</strong> Stengers,<br />
1979). Ich möchte hier zum Ausdruck bringen, was viele immer mehr fühlen,<br />
daß es nämlich sinnlos ist, die Prozesse der <strong>gesellschaftliche</strong>n Entwicklung<br />
unserer vielfältigen (nationalen) „Gesellschaften" so zu analysieren als<br />
ob sie autonom wären <strong>und</strong> intern Strukturen entwickelten. Vielmehr sind<br />
sie <strong>und</strong> waren sie in erster Linie Strukturen, die von weltweiten Prozessen<br />
hervorgerufen wurden <strong>und</strong> eine entsprechende Form haben. Diese weltweite<br />
Struktur <strong>und</strong> die Prozesse ihrer Entwicklungen sind der eigentliche Gegenstand<br />
unserer kollektiven Untersuchung.<br />
Wenn ich nicht falsch liege, hat das erhebliche Konsequenzen für uns. Es<br />
bedeutet natürlich, daß wir gemeinsam unsere Voraussetzungen <strong>und</strong> folglich<br />
unsere Theorien überdenken müssen. Aber es hat noch eine schmerzlichere<br />
Seite. Das heißt, daß wir die Bedeutung unseres gesamten Bestandes langsam<br />
akkumulierter „empirischer Daten" reinterpretieren müssen. Die konstante<br />
Zunahme dieses Bestandes bewirkt das Anwachsen der Bibliotheken<br />
<strong>und</strong> Archive <strong>und</strong> ist die historisch entstandene <strong>und</strong> verdrehte Gr<strong>und</strong>lage<br />
fast unserer gesamten laufenden Arbeit.<br />
Aber warum sollen wir das tun? In wessen Namen <strong>und</strong> in wessen Interesse?<br />
Die eine Antwort, die jetzt schon mindestens 75 Jahre lang gegolten<br />
hat, war die „im Namen der Bewegung, der Partei oder des Volkes". Ich<br />
verwerfe diese Antwort nicht wegen irgendeines Glaubens an die Trennung<br />
von Wissenschaft <strong>und</strong> Werten. Aber die Antwort ist keine Antwort, <strong>und</strong> zwar<br />
aus zwei Gründen: Erstens gibt es nicht nur eine Bewegung. Vielleicht konnte<br />
die Gruppe der antisystemischen Bewegungen irgendwann einmal den Anschein<br />
der Einheitlichkeit behaupten, jetzt aber sicher nicht mehr. Auf der<br />
Ebene weltweiter Prozesse gibt es nicht nur eine Vielfalt von Bewegungen,<br />
sondern sogar viele Typen von Bewegungen. Zweitens machen die Bewegungen<br />
insgesamt in bezug. auf die Effizienz der Veränderungsstrategie, die<br />
aus den Debatten des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts hervorging, eine kollektive Krise<br />
durch. Ich beziehe mich auf die Strategie, die Veränderungen durch die<br />
Übernahme der Staatsmacht anstrebt. Tatsache aber ist, daß die antisystemischen<br />
Bewegungen selbst das Ergebnis des kapitalistischen Weltsystems<br />
sind. Eine Folge davon ist, daß sie durch ihre Aktionen nicht nur das Weltsystem<br />
unterminiert haben (ihr angebliches Ziel, das sie teilweise erreicht<br />
haben), sondern daß sie dieses System auch aufrechterhalten haben, <strong>und</strong><br />
zwar besonders durch die Übernahme von Staatsmacht <strong>und</strong> ihr Operieren<br />
in einem zwischenstaatlichen System, das der politische Überbau der kapitalistischen<br />
Weltwirtschaft ist. Das hat interne Grenzen hinsichtlich der<br />
Fähigkeit dieser Bewegungen, in Zukunft effektiv zu mobilisieren, hervorgerufen.<br />
Wie man es auch nimmt, wenn das Weltsystem in Krise ist, dann<br />
sind es auch die antisystemischen Bewegungen, <strong>und</strong> ich möchte hinzufügen,<br />
auch die selbst-reflektiven Strukturen dieses Systems, nämlich die Wissenschaften.<br />
Die Krise der Bewegungen liegt in ihrer insgesamt zunehmenden Unfähigkeit,<br />
ihre wachsende politische Stärke in Prozesse umzuformen, die das<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
estehende Weltsystem effektiv verändern könnten. Gegenwärtig besteht<br />
eine der Beschränkungen, wenngleich sicher nicht die einzige, darin, daß sie<br />
in ihren eigenen Analysen große Segmente der Ideologie des bestehenden<br />
Weltsystems integriert haben. Was die historischen Sozialwissenschaften in<br />
dieser Übergangskrise leisten können, ist deshalb ein Engagement, das gleichzeitig<br />
mit den Bewegungen sympathisiert <strong>und</strong> sich von ihnen absetzt. Wenn<br />
auch die Wissenschaft keine Praxis anbieten kann, so kann sie doch Einsichten<br />
vermitteln, die aus der Distanz entstehen, vorausgesetzt, daß die Wissenschaft<br />
nicht neutral ist. Wissenschaftler sind aber niemals neutral, <strong>und</strong> folglich<br />
ist auch die von ihnen produzierte Wissenschaft nicht neutral. Das<br />
Engagement, von dem ich spreche, ist selbstverständlich das Engagement<br />
für materiale Rationalität. Es ist eine Verpflichtung angesichts einer Lage,<br />
in der durch den Niedergang des historischen <strong>gesellschaftliche</strong>n Systems,<br />
in dem wir leben, eine kollektive Wahl möglich gemacht worden ist, die jedoch<br />
durch das Fehlen einer klar umrissenen alternativen <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Kraft erschwert wird.<br />
Rein intellektuell ausgedrückt bedeutet das in dieser Lage, daß wir unseren<br />
Begriffsapparat überdenken <strong>und</strong> von der ideologischen Patina des 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts befreien müssen. Während wir versuchen, neue heuristische<br />
Gr<strong>und</strong>lagen zu schaffen, die vom Fehlen <strong>und</strong> nicht vom Vorhandensein<br />
materialer Rationalität ausgehen, werden wir in unserer empirischen <strong>und</strong><br />
theoretischen Arbeit radikal agnostisch sein müssen.<br />
Sie werden mir verzeihen, daß ich vor einem Kongreß deutscher Soziologen<br />
Max Weber zitierte. Wir kennen alle seine leidenschaftliche Rede an<br />
die Studenten von 1919 „Politik als Beruf". Aus dieser Rede klingt ein tiefer<br />
Pessimismus:<br />
Nicht das Blühen des Sommers liegt vor uns, sondern zunächst eine Polarnacht von eisiger<br />
Finsternis <strong>und</strong> Härte, mag äußerlich jetzt siegen welche Gruppe auch immer. Denn:<br />
wo nichts ist, da hat nicht nur der Kaiser, sondern auch der Proletarier sein Recht verloren.<br />
Wenn diese Nacht langsam weichen wird, wer wird dann von denen noch leben,<br />
deren Lenz jetzt scheinbar so üppig geblüht hat? (1958, 547-48).<br />
Wir müssen uns fragen, ob die Polarnacht, die tatsächlich kam, wie Weber<br />
vorausgesagt hatte, schon hinter uns liegt oder noch Schlimmeres kommen<br />
wird. In beiden Fällen ist die einzig mögliche Schlußfolgerung, die wir ziehen<br />
sollten, diejenige, die Weber gezogen hat:<br />
Die Politik bedeutet ein starkes langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft<br />
<strong>und</strong> Augenmaß zugleich. Es ist durchaus richtig, <strong>und</strong> alle geschichtliche Erfahrung bestätigt<br />
es, daß man das Mögliche nicht erreichte, wenn nicht immer wieder in der Welt<br />
nach dem Unmöglichen gegriffen worden wäre (1958, 548).<br />
Ich sagte, daß unsere Konzeptionen auf die intellektuellen Rätsel, die durch<br />
die Französische Revolution hervorgerufen worden waren, zurückgeführt<br />
werden können. Auch unsere Wunschvorstellungen <strong>und</strong> Lösungen stammen<br />
daher. Die berühmte Dreiheit von „liberte, egalite, fraternite" ist keine Beschreibung<br />
der Realität; sie hat die Strukturen der kapitalistischen Weltwirt-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
schaft weder in Frankreich noch anderswo durchdrungen. Dieser Leitsatz<br />
war tatsächlich nicht wirklich der Slogan der sogenannten bürgerlichen Revolution,<br />
sondern eher der ideologische Ausdruck der ersten ernsthaften<br />
antisystemischen Bewegung in der Geschichte der modernen Welt, die fähig<br />
war, ihre Nachfolger zu formen <strong>und</strong> zu inspirieren. „Freiheit, Gleichheit,<br />
Brüderlichkeit" ist ein Slogan, der nicht gegen den Feudalismus, sondern<br />
gegen den Kapitalismus gerichtet ist. Sie sind die Vorstellungsbilder einer<br />
sozialen Ordnung, die anders als unsere ist, einer Ordnung, die eines Tages<br />
geschaffen werden möge. Dafür brauchen wir Leidenschaft <strong>und</strong> Augenmaß<br />
Das wird nicht leicht sein <strong>und</strong> kann ohne ein gr<strong>und</strong>legendes Überdenken<br />
der Strategie seitens der antisystemischen Bewegungen nicht erreicht werden<br />
— ein weiteres Thema, das ich hier nicht besprechen konnte. (Siehe jedoch<br />
Wallerstein 1984b, Teil II). Aber wir werden diese Ordnung ebenfalls<br />
nicht verwirklichen, solange jene, die behaupten, daß sie sich darum bemühen,<br />
die soziale Realität zu verstehen, also wir historischen Sozialwissenschaftler,<br />
nicht bereit sind, in der Wissenschaft <strong>und</strong> in der Politik Webers<br />
Schluß-Appell zu wiederholen „Dennoch".<br />
BIBLIOGRAPHY<br />
Bücher, Karl ( 1913), Die Entstehung der Volkswirtschaft, Tübingen.<br />
9<br />
Gonzales, Jose' Luis (1980), El paisde cuatro pisos. Rio Piedras, P. R.: Ed. Huraca'n.<br />
Prigogine, Ilya & Stengers, Isabelle (1979), La nouvelle alliance. Paris: Gallimard.<br />
Stein, Lorenz von (1959), Der Begriff der Gesellschaft <strong>und</strong> die soziale Geschichte der<br />
Französischen Revolution bis zum Jahre 1830, drei Bände. Hildesheim: Georg<br />
Olms Verlagsbuchhandlung.<br />
Wallerstein, Immanuel (1982), "Economic Theories and Historical Disparities of Development",<br />
in: Eighth International Economic History Congress, Budapest 1982,<br />
J. Kocka & G. Ranki, eds., B. 1: Economic Theory and History. Budapest, Akade'miai<br />
Kiado', 17-26.<br />
Wallerstein, Immanuel (1984), The Politics of the World-Economy. Ca<strong>mb</strong>ridge: Ca<strong>mb</strong>ridge<br />
Univ. Press.<br />
Wallerstein, Immanuel (1985). „Krise als Ubergang", in: S. Amin, G. Arrighi, A.G.<br />
Frank & I. Wallerstein, eds., Die Dynamik der globalen Krise. Wiesbaden: Westdeutscher<br />
Verlag.<br />
Weber, Max (1958). Gesammelte politische Schriften. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul<br />
Siebeck).<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
DIE HEUTIGEN GESELLSCHAFTLICHEN SYNDROME<br />
DER OSTEUROPÄISCHEN GESELLSCHAFTEN UND<br />
ENTWICKLUNGSALTERNATIVEN<br />
András Hegedüs<br />
Die Möglichkeit sowohl der retrospektiven als auch der voraussehenden,<br />
prognostischen Analyse hängt mit den konkreten Beziehungen der Gesellschaft,<br />
in der der Soziologe lebt <strong>und</strong> tätig ist, zusammen. So muß man,<br />
wenn man die heutige Lage der osteuropäischen Soziologie verstehen will,<br />
von den osteuropäischen Verhältnissen ausgehen.<br />
Bis Stalins Tod dominierte ein rigid monolithisches System mit offiziellen<br />
Thesen über die <strong>gesellschaftliche</strong>n Beziehungen, welche in keiner Weise<br />
mit der konkreten Wirklichkeit übereinstimmten. In der stalinistischen Periode<br />
wurde dadurch in allen osteuropäischen Ländern eine scharfe Feindseligkeit<br />
gegen die Soziologie begründet. Schon am Anfang der Entfaltung<br />
dieser Systeme gab es überall Konflikte zwischen Machthabern <strong>und</strong> Soziologen.<br />
Ein typisches Beispiel dafür war der Konflikt zwischen Lenin <strong>und</strong><br />
Sorokin, dem beruhtem Soziologen von St. Petersburg. Diese Konflikte<br />
hatten dann überall eine totale Repression gegenüber der Soziologie als einer<br />
sogenannten bürgerlichen Gesellschaftswissenschaft zur Folge.<br />
In den Reformen der ersten Jahre des 60er Jahrzehnts begann die<br />
Renaissance der Soziologie. Allmählich gewann die sogenannte marxistische<br />
Soziologie an Raum, obwohl sie anfangs nur einen äußerst geringen Spielraum<br />
hatte. Offiziell wurde sie als ein spezifischer Bereich der marxistischen<br />
Gesellschaftswissenschaften behandelt, der der marxistischen Philosophie<br />
unterworfen ist. Die meisten Soziologen nahmen anfangs diese Enge an Bewegung<br />
prinzipiell an, da sie von ihnen als eine notwendige Voraussetzung<br />
für eine Wiederbelebung ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit betrachtet wurde.<br />
Aber die praktische soziologische Analyse erwies immer öfter die Fragwürdigkeit<br />
der offiziellen Thesen über die bestehenden <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Verhältnisse; durch die kritischen soziologischen Untersuchungen wurden<br />
mehr <strong>und</strong> mehr offizielle Thesen nicht verifiziert, sondern falsifiziert. Durch<br />
diese Situation kam es zu verschiedenen Konflikten zwischen den Machthabern<br />
<strong>und</strong> einem Teil der Soziologen. In diesem Konflikt bildeten sich, als<br />
spezifische Antworten der Soziologie auf diesen Konflikt, die verschiedenen<br />
Richtungen der Soziologie aus.<br />
Man kann drei Hauptrichtungen unterscheiden:<br />
Die stärkste Richtung mit einer bedeutenden staatlichen Unterstützung<br />
ist die apologetische marxistische Soziologie. Sie durchbricht den erwähnten<br />
engen Rahmen nicht, obwohl sie ihn natürlich auszuweiten bestrebt ist.<br />
Diese Soziologie pflegt besonders gute Beziehungen mit der westlichen So-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ziologie. Sie ist nicht ohne Wirkung <strong>und</strong> ohne Ergebnis. Obwohl diese Richtung<br />
eine apologetische Funktion erfüllt, ist ihre Rolle in der Modernisierung<br />
der offiziellen Ideologie nicht unwichtig. Obwohl sie von mir kritisiert<br />
wird, möchte ich ihre positive Funktion in der Modernisierung betonen. In<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>n Veränderungen, wie sie zu diesem Begriff der Modernisierung<br />
gehören, besteht ein sehr enger Zusammenhang zwischen einer reformistisch-politischen<br />
Linie <strong>und</strong> der staatlichen Unterstützung der Soziologie.<br />
Und die Tatsache, daß von der dominierenden ungarischen Reformpolitik<br />
die apologetische, Richtung der Soziologie, gemessen an den Verhältnissen<br />
in den westlichen Staaten, eine erhebliche Unterstützung bekommt, wird<br />
von den unser Land besuchenden ausländischen Soziologen mit Bew<strong>und</strong>erung<br />
anerkannt.<br />
Die zweite große Richtung bedeutet schon einen Ausbruch aus diesen<br />
engen Rahmen <strong>und</strong> nimmt das Falsifizieren der nicht mehr haltbaren Thesen<br />
über dieses Gesellschaftssystem in Osteuropa auf sich. Das führte zuerst<br />
zu Kritik der Praxis <strong>und</strong> nicht der offiziellen Ideologie. Charakteristisch<br />
hierfür ist die von dem jugoslawischen sogenannten Praxiskreis geübte Kritik,<br />
dessen Mitglieder sich für die Ideologie der Selbstverwaltung engagieren<br />
<strong>und</strong> auf ihrer Gr<strong>und</strong>lage die Praxis kritisieren. Das kritische Verhalten<br />
führt jedoch notwendigerweise zur Kritik der Ideologie.<br />
Diese Richtung steht mit den Vertretern der offiziellen Ideologie <strong>und</strong><br />
der politischen Führung in einem unvermeidbaren Konflikt, allerdings hängen<br />
die Natur <strong>und</strong> die Schärfe dieses Konflikts davon ab, was für ein politischer<br />
Kurs in den einzelnen osteuropäischen Ländern dominiert. In Ungarn<br />
z.B. gab es zwischen 1972-1976, als die Periode der Reformfeindlichkeit<br />
bestand, vielfach Berufsverbote für kritische Soziologen. In dieser Periode<br />
wurden sehr viele begabte Kollegen in die Emigration gezwungen. Im<br />
Jahre 1978 hat eine neue Reformperiode begonnen <strong>und</strong> damit ist die Toleranz<br />
der Macht gegenüber den kritischen Soziologen gewachsen. Immer öfter<br />
erscheinen in den verschiedenen offiziellen Zeitschriften kritische soziologische<br />
Analysen <strong>und</strong> die kritischen Schriften, die in der zweiten Kultur,<br />
in dem sogenannten Samisdat, veröffentlicht werden, werden gewissermaßen<br />
von der Macht toleriert.<br />
Wenn ich vorher sagte, daß die positive Funktion der marxistischen Soziologie<br />
darin besteht, bei der Modernisierung dieser Gesellschaften behilflich<br />
zu sein, dann muß ich jetzt sagen, daß die kritische Soziologie eine<br />
sehr wichtige Rolle in der Vorbereitung der strukturellen Veränderungen,<br />
das heißt, der strukturellen Reformen spielt.<br />
Die dritte Antwort auf die Konflikte zwischen Macht <strong>und</strong> Soziologie<br />
ist die typische empirische Analyse einer empirischen Richtung, wo bei der<br />
Themenwahl solche Probleme vermieden werden, in denen es zu einem<br />
Konflikt zwischen überholten offiziellen Thesen <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Wirklichkeit kommen könnte. Ein typisches Beispiel hierfür ist die internationale<br />
Freizeitforschung, an der sich viele osteuropäische <strong>und</strong> westliche<br />
Staaten beteiligten. Lange Jahre hindurch wurden dabei Dutzende von So-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ziologen in osteuropäischen Ländern beschäftigt, ohne daß dadurch irgendein<br />
Konflikt zwischen Machthabern <strong>und</strong> Soziologen ausgelöst wurde.<br />
Darüber hinaus ist dem Reformkurs zu verdanken, daß empirische Soziologen<br />
mehr <strong>und</strong> mehr Unterstützung bekommen, <strong>und</strong> zwar von Betrieben,<br />
Genossenschaften, Gewerkschaften <strong>und</strong> Gemeindeverwaltungen. In<br />
den letzten Jahrzehnten wurde empirische Soziologie zur Mode. Damit<br />
will ich nicht sagen, daß sie ohne konkreten Nutzen wäre, um verschiedene<br />
lokale Konflikte zu lösen <strong>und</strong> die Ziele der Führung zu erreichen. In dieser<br />
Hinsicht spielt die Industrie- bzw. Arbeits<strong>soziologie</strong> eine hervorragende Rolle,<br />
obwohl solche Untersuchungen in großem Maße der Management-Ideologie<br />
unterworfen sind, was selbstverständlich ist, weil ihr Auftraggeber in<br />
den meisten Fällen das Management der Betriebe ist.<br />
So erfüllt die empirische Richtung im Rahmen der verschiedenen Institutionen<br />
eine wesentliche soziotechnische Funktion. Dabei werden ihre Ergebnisse<br />
sowohl von der apologetischen als auch von der kritischen Richtung<br />
genutzt. Besondere Wichtigkeit hat sie für letztere, da Soziologen, die<br />
kritische Zielsetzungen haben, weniger <strong>und</strong> weniger Möglichkeiten für eigene<br />
empirische Forschung besitzen <strong>und</strong> deshalb keine Primär-, sondern Sek<strong>und</strong>äranalysen<br />
durchführen müssen.<br />
Retrospektive Analysen wurden in diesen drei Richtungen unterschiedlich<br />
verwirklicht. Ich möchte diesen Unterschied am Hauptsyndrom dieser<br />
Gesellschaften dokumentieren, nämlich am bürokratischen Syndrom.<br />
Nach der marxistischen Theorie wird mit der Vergesellschaftung der<br />
Produktionsmittel die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beendet<br />
<strong>und</strong> damit die persönliche Abhängigkeit der Menschen von Menschen<br />
aufgelöst. In den osteuropäischen Ländern entfalteten sich jedoch gewaltige<br />
Machtinstitutionen in allen Bereichen der Gesellschaften <strong>und</strong> herrscht<br />
eine strenge hierarchistische Abhängigkeit.<br />
Dieses System der Machtinstitutionen ist monolithisch <strong>und</strong> widersetzt<br />
sich bisher allen pluralistischen Tendenzen. Ich möchte allerdings betonen,<br />
daß nur die Machtstruktur monopolistisch ist, nicht die gesamte Gesellschaft.<br />
In der Gesellschaft sind pluralistische Erscheinungen erhalten geblieben,<br />
z.B. verschiedene ideologische Richtungen, Interessengruppen, Kirchen<br />
usw. Diese Tendenzen werden durch den ständig zunehmenden Drang der<br />
Menschen nach privater <strong>und</strong> institutioneller Autonomie besonders in Mitteleuropa<br />
gestärkt. Ohne Übertreibung kann man feststellen, daß in den osteuropäischen<br />
Ländern eine bürgerliche Gesellschaft in statu nascendi ist. Das<br />
gilt besonders für Polen <strong>und</strong> Ungarn.<br />
Diese Situation, wo die einzelnen Individuen im allgemeinen über eine<br />
sehr kleine Unabhängigkeit verfügen, verursacht ganze Serien von <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Krankheiten: der <strong>gesellschaftliche</strong> Dynamismus vermindert<br />
sich, die demokratische Entwicklung hat eine geringe Basis, die Macht bietet<br />
ohne <strong>gesellschaftliche</strong> Kontrolle eine Möglichkeit für Willkür.<br />
Alle drei Richtungen der Soziologie beschäftigen sich mit dem bürokratischen<br />
Syndrom, weil es unvermeidbar eines der zentralen Objekte der so-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ziologischen Forschung ist. In der Art <strong>und</strong> Weise, wie sie sich mit ihm auseinandersetzen,<br />
unterschieden sie sich jedoch sehr scharf voneinander.<br />
Die apologetische Richtung erkennt nicht an, daß in diesen Gesellschaften<br />
die Machtapparate als Bürokratie fungieren <strong>und</strong> daß das Prinzip nicht<br />
gilt, demzufolge die Machtapparate im Dienst der Gesellschaft stehen <strong>und</strong><br />
prinzipiell keine eigenen Interessen <strong>und</strong> Ziele besitzen. Die Soziologen, die<br />
dieser Richtung angehören, nehmen natürlich die verschiedenen Kennzeichen<br />
des bürokratischen Syndroms wahr, doch führen sie diese nicht auf<br />
strukturelle Ursachen zurück, sondern auf subjektive Fehler verschiedener<br />
Natur. So wird aus dem Problem der Bürokratie der „Bürokratismus", die<br />
Summe der von den Beamten begangenen Fehler, die ohne strukturelle Änderungen<br />
zu bekämpfen <strong>und</strong> zu liquidieren wären. Mit diesem Ansatz erfüllten<br />
sie ihre schon erwähnte doppelte Funktion der Apologie der monolithischen<br />
Machtstruktur <strong>und</strong> der Hilfeleistung für die Modernisierung der<br />
Machtapparate.<br />
In dieser Perspektive wurde in der Zeitschrift für Philosophie in der<br />
Sowjetunion im Februar dieses Jahres eine sehr wichtige Studie veröffentlicht,<br />
in der die Möglichkeit anerkannt wird, daß sich in den sozialistischen<br />
Gesellschaften ein Gegensatz zwischen den Machtapparaten <strong>und</strong> den Massen<br />
entfalten könnte. Diese Studie tut einen wichtigen Schritt zur Anerkennung<br />
des Wesens der Bürokratie, sie wurde allerdings einige Monate nach<br />
der Veröffentlichung in der Prawda scharf kritisiert.<br />
Für die kritische Richtung ist das Verständnis des Bürokratieproblems<br />
als einer antagonistischen Beziehung in den Gesellschaften vom osteuropäischen<br />
Typ von zentraler Bedeutung. Die Klassiker des Marxismus setzten<br />
voraus, daß das Problem der Bürokratie nach der Liquidierung des Privateigentums<br />
an Produktionsmitteln automatisch gelöst wird. Die Erfahrungen<br />
haben bewiesen, daß die Bürokratie in diesen Gesellschaften mächtiger <strong>und</strong><br />
unkontrollierter ist als in den westeuropäischen Gesellschaften. Das Bestreben<br />
der Bürokratie, diese Situation zu verewigen, kollidiert immer stärker<br />
mit den Bedürfnissen der Massen, die sich mehr Unabhängigkeit <strong>und</strong> die<br />
Möglichkeit zur Kontrolle über die bürokratischen Apparate wünschen.<br />
Maslow hat sich über die differenzierten Bedürfnisse von Menschen geäußert,<br />
die ihre Gr<strong>und</strong>bedürfnisse bereits befriedigt haben. In den sozialistischen<br />
Ländern in Mitteleuropa hatte sich vor dem zweiten Weltkrieg eine<br />
bedeutende Entwicklung individueller Kultur vollzogen; diese Gesellschaften<br />
wurden schon im Mittelalter vom Geist der Renaissance berührt. In ihren<br />
Menschen lebt der Wunsch nach Autonomie, nach Freiheit <strong>und</strong> Selbstverwirklichung,<br />
nach der Möglichkeit, eigene Bewegungen zu organisieren usf.<br />
Dieses Bedürfnis der Massen ist die soziale Basis der pluralistischen Tendenzen<br />
in den Gesellschaften vom sowjetischen Typ. Der rigide Widerstand<br />
des monolithischen Systems gegen diese Tendenzen ist die Hauptursache<br />
der verschiedenen politischen Krisen in diesen Ländern.<br />
In Polen war im Jahre 1980 mit stürmischem Tempo eine bürgerliche<br />
Gesellschaft entstanden, vor allem dadurch gefördert, daß es hier unter den<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
sozialistischen Ländern die größte Spaltung zwischen der monopolistischen<br />
Machtstruktur <strong>und</strong> pluralistischer Gesellschaft (in dieser Hinsicht spielte die<br />
katholische Kirche eine große Rolle) gab.<br />
Die Machthaber reagierten zu spät auf diese verschiedenen Massenbewegungen;<br />
demzufolge entstand eine Situation, wo die alte Macht nicht mehr<br />
imstande war, zu regieren, <strong>und</strong> die Massenbewegungen die Illusion hatten,<br />
wonach es für sie eine Möglichkeit gäbe, in der Mitte des geteilten Europas<br />
die Macht zu ergreifen. Die Macht war zu schwach für einen Kompromiß<br />
<strong>und</strong> die Massenbewegungen glaubten zu stark zu sein, als daß sie fähig gewesen<br />
wären, einen Kompromiß zu schließen. Das verursachte die tragische<br />
Übernahme der Macht durch das Militär, die natürlicherweise die Gegensätze<br />
zwischen monolithischer Macht <strong>und</strong> der gestärkten pluralistischen Gesellschaft<br />
nicht lösen, sondern nur vertiefen konnte.<br />
Nach dieser kurzen Zusammenfassung möchte ich erwähnen, daß die<br />
Analyse der politischen Krisen der Gesellschaften vom Sowjettyp die retrospektive<br />
Hauptaufgabe der kritischen Richtung ist. Diese Aufgabe könnte<br />
weder von der apologetischen Richtung noch von der empirischen Soziologie<br />
erledigt werden. Wir ungarischen Soziologen müßten vielseitig die soziologischen<br />
Ursachen der ungarischen Revolte von 1956 analysieren.<br />
Nach meiner Überzeugung stehen das Bürokratieproblem, der Gegensatz<br />
von monolithischem System <strong>und</strong> heranwachsenden bürgerlichen Gesellschaften<br />
im Hintergr<strong>und</strong> aller dieser politischen Krisen. Die Hauptaufgabe<br />
der kritischen soziologischen Richtung ist die Analyse dieser Gegensätze<br />
<strong>und</strong> die Darlegung ihrer sozialen Natur.<br />
Auf solche Weise hat die kritische soziologische Richtung natürlicherweise<br />
einen antibürokratischen Charakter, aber ohne die naive Vorstellung, daß<br />
diese Gesellschaften auf dem gegenwärtigen Niveau der ökonomischen Entwicklung<br />
ohne Bürokratie handlungsfähig wären. Die Bürokratie erfüllt einerseits<br />
eine historisch notwendige Funktion, andererseits haben die Massen<br />
mehr <strong>und</strong> mehr Bedürfnisse, die in Richtung auf eine pluralistische Entwicklung<br />
<strong>und</strong> auf den Aufbau der bürgerlichen Gesellschaft weisen. Diese beiden<br />
Faktoren sichtbar zu machen, ist eine sehr wichtige retrospektive Aufgabe.<br />
Die dritte Richtung, die empirische Soziologie, arbeitet in den meisten<br />
Fällen auf Bestellung seitens der bürokratischen Institutionen. Das macht es<br />
schlechthin unmöglich, daß sich antibürokratische Tendenzen entwickeln<br />
können. Ein häufiges Thema empirischer Untersuchungen ist das Funktionieren<br />
der verschiedenen demokratischen Institutionen, aber das Ziel ist<br />
in diesen Fällen nicht, eine wirkliche Kontrolle über die bürokratischen Apparate<br />
zu erreichen, sondern effektive Mittel zu finden, um die ehrenamtlichen<br />
Mitglieder verschiedener demokratischer Institutionen, z.B. der Leitungsorgane<br />
der Gewerkschaften usw., in den Machtapparat zu integrieren.<br />
Zusammenfassend: Alle drei Richtungen der Soziologie behandeln das<br />
bürokratische Syndrom <strong>und</strong> die es begleitenden negativen Folgen. Aber nur<br />
die kritische Richtung kann ihrem Charakter nach die strukturelle Ursache<br />
dieses Syndroms erschließen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Retrospektive Analysen stehen in enger Beziehung mit den Möglichkeiten<br />
der Vorausschau. Schon hier muß man betonen, daß ich an einer<br />
echten Prognose zweifle, die von Soziologen oder Gesellschaftswissenschaftlern<br />
gestellt werden könnte. In dieser Hinsicht sind die großen Irrtümer großer<br />
Wissenschaftler allbekannt. Hinsichtlich der Zukunft der osteuropäischen<br />
Gesellschaften ist die Vorausschau der Klassiker des Marxismus meistens<br />
unbrauchbar. Dies hängt teilweise mit ihrer mangelnden Kohärenz <strong>und</strong> Einheit<br />
zusammen, was es z.B. ermöglicht, daß angesichts der Kritik an der<br />
Sowjetideologie <strong>und</strong> der jugoslawischen Selbstverwaltungsideologie die Vertreter<br />
beider Ideologien genügend klassische Zitate zur Verteidigung ihrer<br />
Vorstellung vom wahren Sozialismus gef<strong>und</strong>en haben.<br />
Die Klassiker des Marxismus setzten, wenn sie über die einheitliche nationale<br />
Wirtschaft oder über die Gesellschaft als Assoziation der freien Produzenten<br />
sprachen, voraus, daß der Sozialismus eine harmonische Gesellschaft<br />
sein werde, wo sich keine strukturellen Gegensätze entfalten werden.<br />
Diese Sozialismus-Vision der Klassiker des Marxismus läßt sich, in den Fakten<br />
des real existierenden Sozialismus, nicht wiederfinden.<br />
In dieser Hinsicht wurde ihre Vorausschau von der historischen Erfahrung<br />
nicht bestätigt. Die zwei charismatischen Führer, die zwischen<br />
zwei Weltkriegen an die Macht kamen, Stalin <strong>und</strong> Hitler, unterwarfen<br />
gleicherweise fast alle Bereiche des Privatlebens der Maschinerie der Bürokratie.<br />
Wenn ich skeptisch bin, was die Prognose betrifft, bedeutet dies nicht,<br />
daß ich es nicht als Aufgabe der Soziologie betrachte, sich mit der <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Zukunft zu beschäftigen. Aber die Ergebnisse solcher Analysen<br />
sind kaum anders denn als die Vorlage einer Serie von alternativen Möglichkeiten<br />
vorstellbar.<br />
Die meisten unter den Soziologen, die eine retrospektive zusammenfassende<br />
Analyse fertiggestellt haben, versuchten auch immer schon die Zukunft<br />
zu bestimmen. Max Weber, der als Klassiker der verstehenden Soziologie<br />
zu betrachten ist, beschäftigte sich z.B. stets mit der zukünftigen Entwicklung<br />
der Gesellschaft. Er stellt nicht nur das Heranwachsen der Bürokratie<br />
in den modernen Gesellschaften fest, sondern sucht nach einem Ausweg,<br />
man könnte sagen, nach einer Ausflucht, um die Gesellschaft von der<br />
bürokratischen Macht befreien zu können.<br />
Was die Zukunft der osteuropäischen Gesellschaften betrifft, so entwerfen<br />
die drei vorher erwähnten soziologischen Richtungen auf der Gr<strong>und</strong>lage<br />
ihrer eigenen retrospektiven Analysen voneinander abweichende Zukunftsbilder,<br />
von denen ein jedes als ein alternatives Zukunftsbild mit mehr oder<br />
weniger Chance zu betrachten ist.<br />
Im Mittelpunkt des Zukunftsbildes der apologetischen Soziologie steht<br />
die Modernisierung des monolithischen Systems, was bedeutet, daß diese<br />
Richtung die Pluralisierung der <strong>gesellschaftliche</strong>n Beziehungen ablehnt <strong>und</strong><br />
die bürgerliche Gesellschaft im engen Rahmen der monolithischen Gesellschaft<br />
halten will.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Obwohl ich eine solche Modernisierung kritisch betrachte, meine ich<br />
doch, daß dies ein wichtiger Schritt weg vom Stalinismus ist <strong>und</strong> positive<br />
Elemente beinhaltet. Diese Richtung folgte teilweise dem Hauptweg der<br />
Modernisierung der westeuropäischen Länder. Deshalb vergrößert diese soziologische<br />
Richtung auch die adaptive Tätigkeit der osteuropäischen Systeme<br />
<strong>und</strong> eröffnet mehr Freiraum für die Menschen, damit diese in ihrem<br />
Privatleben ihre eigenen Ziele <strong>und</strong> Werte realisieren können.<br />
Gleichzeitig werden von diesen Soziologen sehr viele Vorstellungen beibehalten,<br />
die organische Teile der poststalinistischen Ideologie sind, die in<br />
den meisten europäischen Ländern noch immer vorherrscht. Vor allem<br />
denke ich an folgendes: Die relative Freiheit des Privatlebens wird auf das<br />
öffentliche Leben nicht ausgebreitet, wo weiterhin die Bürokratie ihre<br />
Macht unkontrollierbar ausübt, wenn auch im Prozeß der Modernisierung<br />
die Methoden der Machtausübung vervollkommnet <strong>und</strong> für die Menschen<br />
erträglicher werden. Mag die Modernisierung in diesem Rahmen auch noch<br />
so weit vorankommen; eine wirkliche sozialistische Gesellschaft kann sich<br />
nicht entfalten, da die Emanzipation von der bürokratischen Machtstruktur<br />
unmöglich ist. Der denkbar beste Fall könnte nicht anderes sein als eine Herrschaft<br />
der aufgeklärten Bürokratie.<br />
In der apologetischen Soziologie bleibt weiterhin eine Art Gesetzesfetischismus<br />
erhalten. Friedrich Engels hat gemeint, daß die <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Entwicklung Gesetzen unterworfen ist wie die Natur. So schildern sie ihre<br />
Prognosen — <strong>und</strong> seien sie auch noch so irreal — als die Realisierung eines<br />
Entwicklungsgesetzes, das von allen progressiven Kräften unterstützt werden<br />
muß.<br />
In der kritischen Richtung muß man den naiven Antibürokratismus<br />
überwinden. Dieser naive Ansatz dominiert nicht nur in der alten sozialistischen<br />
Denkweise, sondern auch in den verschiedenen antibürokratischen<br />
kritischen Richtungen der Gegenwart. Solche Ansätze waren in China zur<br />
Zeit der chinesischen Kulturrevolution typisch. Sie herrschten bei den verschiedenen<br />
radikalkommunistischen Richtungen wie bei den Trotzkisten<br />
vor. Sie kennzeichnen Bahros berühmtes Buch „Die Alternative".<br />
Aber die historischen Erfahrungen <strong>und</strong> die logischen Analysen auf retrospektiver<br />
Basis haben auch bewiesen, daß in solchen Gesellschaften die<br />
Reproduktion der <strong>gesellschaftliche</strong>n Beziehungen ohne die bürokratische<br />
Machtstruktur, ohne die verschiedenen bürokratischen Institutionen, unvorstellbar<br />
ist.<br />
Innerhalb der kritischen Richtung finden sich zwei Vorstellungen über<br />
die Emanzipation der Gesellschaft. Die Vertreter der einen neigen dazu, die<br />
Einführung des westlichen Parlamentarismus, d.h. des Mehrparteiensystems,<br />
als unerläßlich <strong>und</strong> damit als eine gr<strong>und</strong>sätzliche Zielsetzung zu betrachten.<br />
Andere, unter ihnen auch ich, denken, daß die Realisierung dieser Zielsetzung<br />
sehr gefährlich wäre, sowohl für den inneren wie auch für den europäischen<br />
Frieden. Da diese Systeme über starke militärische <strong>und</strong> polizeiliche<br />
Kräfte verfügen <strong>und</strong> die Einführung des Parlamentarismus ihre Macht<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
gefährdet, werden sie diese Kräfte ausnützen, um ihre Interessen <strong>und</strong> ihre<br />
Macht zu verteidigen. Die unvermeidbare Folge wäre ein Bürgerkrieg. Der<br />
Bürgerkrieg in Europa könnte zum europäischen Krieg, das heißt zum Weltkrieg,<br />
führen. Dies ist das Hauptmotiv, weshalb ich meine, daß nach einem<br />
anderen Weg zur Emanzipation der Gesellschaft von der Bürokratie gesucht<br />
werden muß.<br />
Mir scheint eine Zukunftsalternative möglich, wo neben dem Einheitsparteisystem<br />
verschiedene autonome Bewegungen <strong>und</strong> Institutionen existieren,<br />
darunter jedoch keine politischen Parteien, die nach einem Wahlergebnis<br />
die politische Macht zu ergreifen wünschen oder die Machtausübung verhindern<br />
möchten.<br />
In solchen unabhängigen selbständigen Institutionen könnte sich meiner<br />
Meinung nach eine bürgerliche Gesellschaft ausbilden, die eine Möglichkeit<br />
hätte, die bürokratische Machtstruktur zu kontrollieren <strong>und</strong> zu beeinflussen.<br />
Die soziologische Basis dieser Alternative ist das Heranwachsen von Bedürfnissen<br />
nach <strong>gesellschaftliche</strong>r <strong>und</strong> nicht nur privater Autonomie. Dies<br />
verursacht in diesen Ländern mehr <strong>und</strong> mehr Konflikte zwischen der Macht<br />
<strong>und</strong> den Massen. Gehen diese Konflikte über einen gewissen Grad hinaus, so<br />
entsteht im starren Rahmen der monolithischen Institutionen des Staatssozialismus<br />
eine immer schärfer werdende Spannung, die das System mit einer<br />
politischen Krise bedroht. In dieser Situation hat die Macht ein elementares<br />
Interesse daran, einen Weg zum Pluralismus zu suchen.<br />
Andererseits sehen die verschiedenen Bewegungen <strong>und</strong> die Vertreter der<br />
nach Autonomie strebenden Institutionen als Ergebnis eines längeren Lernprozesses<br />
ein, daß sie im eigenen Interesse die maximalen Ziele beschränken<br />
müssen, um offene Konflikte mit der Macht zu vermeiden.<br />
In dieser Hinsicht sind in den osteuropäischen Ländern die Gruppen der<br />
demokratischen Opposition sehr wichtig. Doch stehen sie an einem Kreuzweg;<br />
sie müssen zwischen zwei Alternativmöglichkeiten wählen: — eine konstruktive<br />
Opposition, die die verschiedenen tatsächlichen ökonomischen,<br />
politischen <strong>und</strong> ideologischen Reformen der <strong>gesellschaftliche</strong>n Beziehungen<br />
unterstützt; — eine radikale Linie, die in einem offenen Konflikt mit der<br />
Macht alle Möglichkeiten zum Dialog zurückweist.<br />
Die gegenwärtige Lage, die gespannte europäische Situation zwischen<br />
den zwei Blöcken <strong>und</strong> die inneren Interessen der Massen dieser Länder erfordern<br />
zur friedlichen Entwicklung von der demokratischen Oppositon<br />
konstruktives Verhalten <strong>und</strong> die Zurücknahme ihrer radikalen Ziele. Auf<br />
diese Weise könnte die Reformierbarkeit dieses Systems vom Sowjettyp<br />
vergrößert werden. Auf dieser Basis läßt sich nur ein <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Kompromiß entwickeln, in dem die Macht die Existenz der unabhängigen<br />
Bewegungen <strong>und</strong> Institutionen toleriert <strong>und</strong> diese nicht danach streben,<br />
die Macht zu ergreifen oder ihre Ausübung zu verhindern. Sie geben sich<br />
mit der Kontrolle über <strong>und</strong> dem Einfluß auf die Macht zufrieden.<br />
Auch innerhalb der empirischen Richtung der Soziologie können Visionen<br />
über die Zukunft der osteuropäischen Gesellschaften gef<strong>und</strong>en wer-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
den. Für gewisse Teilprobleme werden Prognosen erstellt. Die meist verwendeten<br />
Methoden sind:<br />
— Extrapolation <strong>und</strong><br />
— Intrapolation.<br />
Beide Methoden müssen im Hinblick auf die Praxis einer kritischen Beurteilung<br />
unterzogen werden. Die Extrapolation setzt voraus, daß bestimmte<br />
Entwicklungstrends in die Zukunft projizierbar sind <strong>und</strong> keine unerwarteten,<br />
nicht kalkulierbaren Ereignisse auftreten werden. Die Erfahrung dieses<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts weist zuviel solcher Störfaktoren auf. Die Intrapolation<br />
setzt voraus, daß die Gesellschaften verschiedenen Typs dem gleichen Entwicklungsweg<br />
folgen. Unsere Epoche ist jedoch vom Suchen nach einem<br />
Weg gekennzeichnet.<br />
Trotz dieser methodischen Schwierigkeiten bereichern die Prognosen<br />
der empirischen Soziologie die Zukunftsvisionen sowohl der apologetischen<br />
als auch der kritischen Richtung.<br />
In meinem Vortrag verschärfte ich die Unterschiede zwischen den verschiedenen<br />
Richtungen, ohne daß ich die positive Funktion einer jeden zu<br />
bestreiten wünschte. Die Soziologie erfüllt in den osteuropäischen Ländern<br />
meiner Meinung nach eine originär positive Funktion. Ich selbst gehöre<br />
zwar zur kritischen soziologischen Richtung, aber ich habe keine Vorurteile<br />
gegenüber anderen. Im Laufe meines abwechslungsreichen Lebens war ich<br />
nach einer kurzen politischen Laufbahn apologetischer Soziologe, dafür habe<br />
ich akademische Anerkennung <strong>und</strong> den Professorentitel erhalten. Ich<br />
war empirischer Soziologe, mit den begleitenden Vorteilen, <strong>und</strong> schließlich<br />
wurde ich zum kritischen Soziologen mit Verlust meiner Arbeit <strong>und</strong> mit Berufsverbot.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Themenbereich I:<br />
Gesellschaftliche Entwicklung<br />
von Lebenszusammenhängen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
EINLEITUNG<br />
Eckart Pankoke<br />
Im Erwartungs- <strong>und</strong> Bewertungshorizont von „1984" wurde Orwells Vision<br />
totaler Modernisierung zur Aufforderung, über die Bedingungs- <strong>und</strong> Wirkungszusammenhänge<br />
von „Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong>r Entwicklung"<br />
— so das Leitthema des Dortm<strong>und</strong>er Soziologentages 1984 — Rede <strong>und</strong><br />
Antwort zu stehen. Die Vergegenwärtigung von Tendenzen, Krisen <strong>und</strong><br />
Chancen des Modernisierungsprozesses gab den Bezugsrahmen, die Praxis<br />
soziologischer Lehre <strong>und</strong> Forschung in ihren <strong>gesellschaftliche</strong>n Wertungen,<br />
Wirkungen <strong>und</strong> Verantwortungen zu reflektieren.<br />
In gesellschaftstheoretischer Retrospektive erscheint der Modernisierungsprozeß<br />
zumeist als Vergesellschaftung lebensweltlicher Identität <strong>und</strong><br />
Solidarität. Verwiesen wird auf die Systemzwänge von „Arbeitsgesellschaft",<br />
„Organisationsgesellschaft", „Mediengesellschaft", mit denen Orwells Ängste<br />
vor einem Umschlag <strong>gesellschaftliche</strong>r Modernität in die Totalität systemtechnischer<br />
Vergesellschaftung gewiß weiter akut bleiben.<br />
Im Blick auf aktuelle Krisen, strukturelle Grenzen <strong>und</strong> kulturelle<br />
Brüche des Modernisierungsprozesses muß jedoch die Perspektivik wechseln,<br />
da die sozialen Folgen, Kosten <strong>und</strong> Chancen der Moderne sich anders<br />
darstellen, wenn die Chancen moderner Lebensführung knapper<br />
werden.<br />
So sehen wir uns neu damit konfrontiert, daß Modernisierung auf Grenzen<br />
des Wachstums trifft <strong>und</strong> mit Verweis auf diese Grenzen evolutionäre<br />
Errungenschaften der Moderne zurückgenommen werden könnten.<br />
Auf dem Hintergr<strong>und</strong> neu aufreißender gesellschaftspolitischer Problem<strong>und</strong><br />
Randlagen gilt es, nicht nur den sozialen Folgen gesteigerter Modernität<br />
nachzugehen, sondern zugleich auch die soziale Problematik verweigerter<br />
Modernität bewußt zu machen. Dies gilt auch mit Blick auf die lebenspraktischen<br />
Felder sozialen Handelns <strong>und</strong> Erlebens, sozialer Gestaltung <strong>und</strong><br />
Verantwortung.<br />
So wird auf diesem Forum die „<strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung von Lebenszusammenhängen"<br />
zum verbindenden Problem der Sektionen „Familien<strong>soziologie</strong>"<br />
<strong>und</strong> „Frauenforschung", „Stadt<strong>soziologie</strong>" <strong>und</strong> „Sozialpolitik".<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
1. Rückblick: Soziologie <strong>und</strong> Modernisierungsprozeß: „1948"—„1984"<br />
In der durch Orwell markierten Epochenspanne von „1948" <strong>und</strong> „1984"<br />
zeigt der Rückbezug auf erste Nachkriegsjahre zunächst eine Soziologie, die<br />
im Aufwind von Wiederaufbau <strong>und</strong> Wirtschaftsw<strong>und</strong>er mit dem Modernisierungsprozeß<br />
mitzog <strong>und</strong> mit ihren Konstrukten von „moderner Familie",<br />
„moderner Jugend", „moderner Großstadt" <strong>und</strong> „moderner Gesellschaft"<br />
die neue Modernität einer „skeptischen Generation" auf den Begriff brachte<br />
<strong>und</strong> so bestätigen <strong>und</strong> verstärken konnte.<br />
„Soziologie <strong>und</strong> moderne Gesellschaft" — so das Motto des Berliner Soziologentages<br />
1959 — wurde zur Problemformel neuer „Ortsbestimmungen<br />
der Soziologie". Eine modernisierungskritische Wende markierte der Heidelberger<br />
Soziologentag zum Max-Weber-Jahr-1964; die Rezeption Max Webers<br />
gab Anlaß soziologischer Auseinandersetzungen mit der Rationalität der Moderne<br />
<strong>und</strong> den auf ihr lastenden Schatten eines geschichtlich erlittenen <strong>und</strong><br />
bedrohlich bleibenden Umschlags in Ermächtigung <strong>und</strong> Entfremdung. Diese<br />
„Dialektik der Aufklärung" fand Nachhall in einer „kritischen Generation"<br />
<strong>und</strong> im programmatischen Selbstverständnis von „Soziologie als Krisenwissenschaft".<br />
Progressiv gerichtetes Engagement begann damit, die fortschreitende<br />
Modernisierung mit Blick auf moderne Entfremdungen radikal in Frage zu<br />
stellen. Zu einer Schwelle wurde „1968", — schon weit fern von „1948"<br />
<strong>und</strong> fast auch schon gleich fremd für „1984". Für die Soziologie war 1968<br />
das Karl-Marx-Jahr mit dem Frankfurter Soziologentag „Spätkapitalismus<br />
oder Industriegesellschaft", es war zugleich Gründungsphase sozialwissenschaftlicher<br />
Institute <strong>und</strong> Fakultäten <strong>und</strong> Auftakt programmatischer Richtungskämpfe<br />
um kritische Theorie der Gesellschaft <strong>und</strong> um soziologische<br />
Aufklärung moderner Syste<strong>mb</strong>ildung. Noch allerdings ging es jeweils um<br />
konsequenten Durchbruch der Moderne.<br />
Im Bewußtsein wachsender Spannungen zwischen den Systemzwängen<br />
von Modernisierungsprozessen <strong>und</strong> der Betroffenheit sozialer Lebenswelt<br />
richtete sich soziologische Theorie <strong>und</strong> Empirie zunehmend auf die Evolutions-<br />
<strong>und</strong> Konstitutionsprozesse sozialer Deutungsmuster <strong>und</strong> Handlungsfelder.<br />
2. Gegenwartsfragen: „Krisen der Arbeitsgesellschaft"<br />
Daß die Themen dieses Soziologentages hier <strong>und</strong> heute, 1984 in Dortm<strong>und</strong><br />
unter der bedrückenden Gegenwärtigkeit struktureller Arbeitslosigkeit zu<br />
verhandeln sind, rückt diesen in Ba<strong>mb</strong>erg 1982 noch als Frage gefaßten Bezug<br />
„Krise der Arbeitsgesellschaft?" nun dringlicher in das Bewußtsein soziologischer<br />
Verantwortung.<br />
Die „Krisen der Arbeitsgesellschaft" erschienen im Erwartungsrahmen<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>n Wertwandels zunächst als Aufforderung zum „Ausstieg<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
aus der Arbeitsgesellschaft", als Chance neuer Lebensentwürfe, sich nun<br />
von industriellen Zwängen „frei" zu machen <strong>und</strong> auf eine Zukunft post-industrieller<br />
Werte <strong>und</strong> Welten zu setzen. Heute, 1984, sehen wir uns hingegen<br />
anders herausgefordert: nicht nur durch die Erwartung einer sprunghaften<br />
Steigerung moderner Systemtechnik <strong>und</strong> Systemkontrolle, sondern<br />
auch durch unsere Betroffenheit, daß an den „Grenzen des Wachstums"<br />
evolutionäre Errungenschaften der Moderne zurückgenommen werden<br />
könnten.<br />
Beides ist zusammenzusehen: der kulturelle Wandel <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Werte <strong>und</strong> der strukturelle Rahmen <strong>gesellschaftliche</strong>r Lebenslagen <strong>und</strong> Lebenschancen.<br />
Dann wird als Problem bewußt, daß soziokulturelle Lernprozesse<br />
einer Umwertung der Moderne doch an die im Modernisierungsprozeß<br />
institutionalisierten Freiheiten <strong>und</strong> Sicherungen geb<strong>und</strong>en bleiben.<br />
Gerade hier an der Ruhr, dieser von den „Krisen der Arbeitsgesellschaft"<br />
besonders schwer getroffenen alten Industrielandschaft, müssen wir erfahren,<br />
daß industrie<strong>gesellschaftliche</strong> Produktivität sich festgefahren hat, auf<br />
Grenzen trifft, gebrochen wird <strong>und</strong> bei rückläufiger Modernität Rück- <strong>und</strong><br />
Randständigkeit aufbricht. In solchen Problemzonen „sozialer Brache" werden<br />
die Folgekosten konjunktureller <strong>und</strong> struktureller Brüche unabweisbar<br />
akut: verweigerte Lebenschancen, zerrissene Lebenszusammenhänge, verstörter<br />
Lebenssinn.<br />
Schienen im Zeichen des Wachstums die Errungenschaften der Moderne<br />
noch verallgemeinerbar <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong>r Ausgleich noch durchsetzbar,<br />
so wird nun in knapperen Zeiten soziale Ungleichheit wieder härter spürbar:<br />
auf dem Arbeitsmarkt, dem Wohnungsmarkt, in Konsum <strong>und</strong> Freizeit, aber<br />
auch im öffentlichen Bereich sozialer Infrastruktur <strong>und</strong> Dienstleistung. Polarisierung<br />
<strong>und</strong> Marginalisierung reißt auf — <strong>und</strong> der Riß einer sich spaltenden<br />
Gesellschaft trifft gerade auch das Verhältnis der Generationen <strong>und</strong><br />
trennt die Generation 'mit Vergangenheit' (in den 1950 <strong>und</strong> 1960er Jahren)<br />
von einer Generation 'ohne Zukunft' — zumindest soweit Erwartungen<br />
nach Geld <strong>und</strong> Macht verrechnet werden.<br />
Unser Proble<strong>mb</strong>ewußtsein darf sich allerdings nicht nur darauf richten,<br />
daß Chancen knapper werden; gleichermaßen sehen wir uns davon betroffen,<br />
daß auch Horizonte enger werden, gerade für die „Entwicklung von Lebenszusammenhängen":<br />
Dies gilt für eine „Humanisierung der Arbeitswelt",<br />
für eine bewußtere Lebensgestaltung von Familienleben <strong>und</strong> Familiensinn,<br />
— auch im Verhältnis der Geschlechter; es gilt für die kulturelle Entwicklung<br />
<strong>und</strong> sozialräumliche Belebung unserer Städte; insbesondere betrifft<br />
es heute auch lebenspraktische Umwertungen im Verhältnis von <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Arbeit <strong>und</strong> freier Zeit.<br />
Die Beiträge aus den beteiligten Sektionen können die Gefahr struktureller<br />
Verknappung <strong>und</strong> kultureller Verengung nachdrücklich belegen. Dabei<br />
werden verhängnisvolle Transformationen der Moderne gerade dort auffällig,<br />
wo die verinnerlichten Leitbilder moderner Lebensführung nicht<br />
mehr auf die Sicherungen <strong>und</strong> Leistungen <strong>gesellschaftliche</strong>r Modernität<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
auen können, weil Errungenschaften der Moderne zurückgezogen, verweigert,<br />
verdrängt sind.<br />
Doch auch ein zwanghaftes Durchhalten der Muster arbeits<strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Modernität, ein formalistisches Festhalten an den damit gesetzten<br />
Standards industrieller Normalität mit den rigorosen Trennlinien nach Berufs-<br />
<strong>und</strong> Geschlechtsrollen, Funktionszonen <strong>und</strong> Teil-Zeiten wird problematisch,<br />
wenn es gilt, auch jenseits kleinfamilialer Leitbilder ein Engagement<br />
familialer Bindung <strong>und</strong> Verbindlichkeit neu zu entwickeln, eine nicht<br />
über Berufsrollen festgelegte personale Identität zu entfalten, ein von bürgerlicher<br />
Urbanität abhebendes Engagement sozialer Bewegung öffentlich<br />
zu machen oder über neue Formen gemeinschaftlich geteilter Arbeit <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Solidarität neu zu begründen.<br />
Soziologische Orientierungen, welche soziale Betroffenheiten durch gesteigerte<br />
bzw. verweigerte Modernität nicht nur problematisieren, sondern<br />
auch die Handlungs- <strong>und</strong> Entwicklungspotentiale sozialer Kontexte deutlich<br />
zu machen suchen, könnten hier der „Entwicklung von Lebenszusammenhängen"<br />
auch praktisch Perspektiven aufzeigen.<br />
3. Ausblick: „Lebenszusammenhänge" als Problem der Soziologie<br />
Der Anspruch soziologischer Orientierung auf lebenspraktische wie gesellschaftspolitische<br />
Relevanz meldete sich an mit begrifflichen Konstrukten<br />
wie „Lebenslage", „Lebenschance" <strong>und</strong> „Lebenswelt": So greift der Begriff<br />
der „Lebenslage" tiefer als eine Schichtung nach ökonomischer Lagerung.<br />
„Lebenslagen" sind immer auch zu bestimmen über die gesellschaftsbedingte<br />
Perspektivik sozialen Erlebens, Bewertens <strong>und</strong> Erwartens.<br />
„Als Lebenslage gilt der Spielraum, den die äußeren Umstände dem<br />
Menschen für die Erfüllung seiner Gr<strong>und</strong>anliegen bieten, die er bei ungehinderter<br />
<strong>und</strong> gründlicher Selbstbesinnung als bestimmend für den Sinn seines<br />
Lebens ansieht." (Weisser 1956)<br />
Ein solcher Bezug auf die sinnhafte Dimension der Erwartungen <strong>und</strong><br />
Bewertungen sozialer „Lebenswelt" verwies sozialwissenschaftliche Forschung<br />
auf die „subjektiven Indikatoren" sozialer Bedürftigkeit <strong>und</strong> Betroffenheit;<br />
praktisch wurde dies umgesetzt in Konzepte einer „bürgernahen"<br />
<strong>und</strong> „bedürfnisorientierten" Verwaltung; ein qualitatives Verständnis der<br />
„Lebenslage" als „Lebensqualität" wurde zur Programmformel einer an<br />
sozialen Zielgruppen <strong>und</strong> Zielräumen sich orientierenden sozialen Politik.<br />
Zielte der Begriff der „Lebenslage" auf ein qualitatives Verständnis<br />
sozialer Ungleichheit <strong>und</strong> betonte demgegenüber die liberal gewendete<br />
Programmformel der „Lebenschance" die Eigenverantwortlichkeit individueller<br />
Wahlfreiheit <strong>und</strong> Wahlmöglichkeit, so setzt das Konzept des „Lebenszusammenhanges"<br />
den Akzent auf die Entwicklungsdynamik sozialer<br />
Lebensweisen, Beziehungsfelder <strong>und</strong> Vernetzungsprozesse. Gesellschafts-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
politisch geht es dann nicht nur um die Befriedung <strong>gesellschaftliche</strong>r 'Lagen'<br />
oder ein Freimachen <strong>gesellschaftliche</strong>r 'Chancen', sondern um die aktive<br />
Entwicklung von Handlungskompetenzen <strong>und</strong> Handlungskontexten.<br />
Bestimmen wir „Lebenszusammenhänge" nach ihrem „menschlichen<br />
Maß" sozialer Nähe, so geht es nicht um quantitative Maßstäbe <strong>und</strong> Reichweiten,<br />
vielmehr um eine besondere Qualität <strong>und</strong> Intensität sozialer Integration.<br />
In „Lebenszusammenhängen" können die Mechanismen moderner<br />
Systemintegration (Funktionstrennung, Systemdifferenzierung <strong>und</strong> Formalkontrolle)<br />
zurückgenommen werden, da hier in der Gegenwärtigkeit <strong>und</strong><br />
Unmittelbarkeit wechselseitiger Wahrnehmung, also „sozialintegrativ" über<br />
Verhandlung <strong>und</strong> Verständigung, Vertrauen <strong>und</strong> Verantwortung sich „Zusammenhang"<br />
konstituieren <strong>und</strong> stabilisieren kann.<br />
Doch geht es nicht um ein vorbehaltloses Konservieren von gewachsenen<br />
<strong>und</strong> gestandenen „kleinen Netzen" (wie den „natural-networks" von<br />
Verwandtschaft, Nachbarschaft, Kameradschaft), auch nicht um die einseitige<br />
Auslegung von Subsidiarität zum Zwecke der Abwälzung <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Probleme auf die private Sorge primärer Lebenskreise, (die sich dabei<br />
gerade nicht mehr subsidiär gestützt, sondern aus sozialpolitischer Daseinsvorsorge<br />
fallen gelassen sehen). Ordnungspolitische Programmformeln der<br />
„Solidarität", „Subsidiarität" oder „Pluralität" gewinnen vielmehr neuen<br />
Sinn, wenn wir sie bewußt relational <strong>und</strong> reflexiv verstehen — d.h. im Sinne<br />
von Organisations- <strong>und</strong> Relationsformen, die sich in ihren Binnenbeziehungen<br />
wie Umweltrelationen selbst bestimmen <strong>und</strong> selbst steuern können. In<br />
diesem Sinne zielt auch unsere Formel „Entwicklung von Lebenszusammenhängen"<br />
auf die Offenheit der Konstitutionsprozesse selbstbewußter<br />
<strong>und</strong> selbstaktiver Vernetzung.<br />
Für soziologische Forschungsorientierung, gerade auch in den hier vorgestellten<br />
Sektionen, bedeutet dies ein wachsendes Interesse an den Konstitutionsprozessen<br />
<strong>und</strong> der Entwicklungsdynamik sozialer Handlungsfelder<br />
<strong>und</strong> Deutungsmuster: Zu verweisen ist auf Biographieforschung <strong>und</strong> Lebenslaufanalyse,<br />
Familiengeschichte <strong>und</strong> Sozialisationsforschung, Sozialraumanalyse<br />
<strong>und</strong> die Erforschung sozialer Netzwerke. Theoretische wie methodische<br />
Konzepte einer Ethnomethodologie des Alltags, eines sy<strong>mb</strong>olischen<br />
Interaktionismus wie methodologischen Individualismus, Theorien<br />
kommunikativen Handelns <strong>und</strong> selbstreferentieller Systeme entwickeln dazu<br />
ein neues bewußt handlungsorientiertes Verständnis der „sozialen Konstruktion<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>r Wirklichkeit".<br />
Wenn wir nun das Konstrukt des „Lebenszusammenhanges" mit dem<br />
Begriff der „Entwicklung" verbinden, wird die doppelte Perspektivik von<br />
„Entwicklung" zu beachten sein: Transitiv bedeutet „Entwicklung von Lebenszusammenhängen"<br />
die planmäßige Durchsetzung eines Bedingungsrahmens<br />
zur Verbesserung von Lebenslagen. Davon zu unterscheiden ist ein<br />
reflexives Verständnis von „Entwicklung". Dann geht es nicht nur darum,<br />
daß Lebenslagen entwickelt-werden, vielmehr interessiert die Chance, daß<br />
„Lebenszusammenhänge" sich-entwickeln können.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Gerade dann stoßen wir auf die kritischen Punkte, Bruch- <strong>und</strong> Schwachstellen,<br />
Konflikt- <strong>und</strong> Krisenlagen von Modernisierungsprozessen. So sind<br />
die Zeichen ernst zu nehmen, daß die systemintegrative Modernität von<br />
Organisations- <strong>und</strong> Mediengesellschaft die Entwicklung von Lebenszusammenhängen<br />
blockieren kann, daß es im Abseits des Modernisierungsprozesses<br />
erneut <strong>und</strong> verschärft zu Marginalisierung <strong>und</strong> Polarisierung kommt <strong>und</strong><br />
in einer sich spaltenden Gesellschaft die Leitbilder selbstbewußter <strong>und</strong><br />
selbstgesteuerter Lebensführung zur Illusion <strong>und</strong> Ideologie werden können.<br />
Die strukturellen wie kulturellen Krisen sozialer Lebenszusammenhänge<br />
führen zu Fragen nach der praktischen Wirksamkeit soziologischer Orientierung.<br />
Jedoch: wenn es fiskalisch knapp <strong>und</strong> legitimatorisch eng wird, sehen<br />
sich gerade Sozialwissenschaftler in ihrem gesellschaftspolitischen Relevanzanspruch<br />
sehr bald in Frage gestellt. Entlassen aus dem Verwertungsdruck<br />
des Planungs- <strong>und</strong> Legitimationshelfers muß Soziologie sich nun der Frage<br />
stellen, ob ihr Rückzug auf das „menschliche Maß" nicht nur Symptom <strong>und</strong><br />
Reaktion ist auf ihre Verdrängung aus öffentlicher Wirksamkeit <strong>und</strong> Verantwortlichkeit.<br />
Das neue Interesse für die Feinstruktur der interaktiven <strong>und</strong> intersubjektiven<br />
Konstitution des „Sozialen" könnte aber auch darin Gr<strong>und</strong> finden,<br />
daß soziale Lebenszusammenhänge heute in ihrer Spannung zur etablierten<br />
Modernität praktisch zum Problem werden:<br />
— sei es, daß soziale Lebenszusammenhänge unter verschärften Modernisierungsdruck<br />
kommen;<br />
— sei es, daß im Sog einer sich zurückziehenden Modernität die Randlagen<br />
neuer Pauperisierung <strong>und</strong> Marginalisierung sich ausweiten;<br />
— sei es, daß in der Folge strukturellen wie kulturellen Wandels es zu normativen<br />
Umwertungen kommt;<br />
— sei es, daß freigesetzte Subjektivität dann nicht mehr Halt <strong>und</strong> Rahmen<br />
findet, sich verbindlich binden (anders formuliert: „engagieren") zu können;<br />
— sei es, daß die Relationen zwischen der systemintegrativen Steuerung<br />
des Modernisierungsprozesses <strong>und</strong> der sozialen Integration von Lebenszusammenhängen<br />
gesellschaftspolitisch neu zu ordnen, zu gestalten <strong>und</strong> zu<br />
steuern sind.<br />
Im Bewußtsein der Spannungen zwischen <strong>gesellschaftliche</strong>r Syste<strong>mb</strong>ildung<br />
<strong>und</strong> der sozialen Dynamik von Lebenszusammenhängen stellen sich<br />
Fragen der „Vermittlung". Gerade hier könnte sich aus der Sensibilität<br />
„verstehender Soziologie" in Verbindung mit einem kritischen Sinn für Systeme<br />
ein neues Selbstbewußtsein soziologischer Kompetenz begründen:<br />
„Vermittlung" bedeutet dabei allerdings nicht nur die kommunikative Mittlerstellung<br />
des „Grenzgängers" zwischen sozialaktiven Feldern <strong>und</strong> politisch-administrativen<br />
Systemen. Auch bei Spannungsfeldern kann soziologisch<br />
vermittelte Handlungsorientierung Spannungen deutlich <strong>und</strong> öffentlich<br />
machen <strong>und</strong> so erst Verhältnisse „unter Spannung" <strong>und</strong> „in Bewegung"<br />
bringen. Besonders wird dies deutlich, wenn es um ein „Sich-Entwickeln<br />
von Selbststeuerung" geht, d.h. um die Eigendynamik <strong>und</strong> Autonomie ge-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
seilschaftlicher Lebens- <strong>und</strong> Handlungszusammenhänge — gerade auch in<br />
Spannung zu <strong>gesellschaftliche</strong>r Umwelt, zu etablierten Systemen <strong>und</strong> zu<br />
institutionalisiertem Kontext.<br />
Hier könnte die Mittlerstellung des Soziologen sich auch darin bewähren,<br />
daß für das Aktionspotential <strong>und</strong> die Entwicklungsdynamik sozialer<br />
Lebenszusammenhänge neue institutionelle Arrangements sich entwickeln<br />
<strong>und</strong> vermitteln lassen: Dies gilt für die Selbststeuerung familialer Lebenszusammenhänge;<br />
für neue Vereinbarungen <strong>gesellschaftliche</strong>r <strong>und</strong> familialer<br />
Arbeitsteilung; es gilt für eine Aktivierung sozialräumlicher Lebenszusammenhänge<br />
<strong>und</strong> randständiger Lebenslagen wie für neue Bewegungen<br />
sozialer Widerständigkeit im Urbanen Raum <strong>und</strong> in kommunaler Öffentlichkeit;<br />
<strong>und</strong> es gilt im Sinne gesellschaftspolitischer Öffnung der industriegesellschaftlich<br />
durchgesetzten Systemgrenzen <strong>und</strong> Grenzkontrollen<br />
für neue Gestaltungsformen <strong>und</strong> Verteilungsmuster <strong>gesellschaftliche</strong>r Arbeit<br />
<strong>und</strong> freier Tätigkeit.<br />
„Vermittlung" bedeutet dabei immer auch Kommunikationsprozesse<br />
sozialer Verständigung <strong>und</strong> Verantwortung zwischen zuständigen <strong>und</strong> betroffenen<br />
„Subjekten", zugleich aber auch die Verhandlung über institutionell<br />
verbindliche Regulierung <strong>und</strong> Selbstregelung. So geht es immer zugleich<br />
um beides: um soziale Felder <strong>und</strong> um <strong>gesellschaftliche</strong> Systeme. Hier<br />
könnte soziologische Aufklärung für gesellschaftspolitische Verantwortung,<br />
d.h. für offenes <strong>und</strong> öffentliches „Rede-<strong>und</strong>-Antwort-Stehen", auch praktisch<br />
Perspektiven öffnen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
MODERNE FAMILIALE LEBENSFORMEN ALS HERAUSFORDERUNG<br />
DER SOZIOLOGIE<br />
Kurt Lüscher<br />
1. Es gehört zu den Paradoxien des Themas, daß die Beschäftigung mit einer<br />
uns allen vertrauen Lebensform im Gr<strong>und</strong>e genommen erheblicher theoretischer<br />
Abklärungen bedarf; denn sozusagen alles, was Familie betrifft,<br />
ist heutzutage von Ideologien <strong>und</strong> individuellen Erfahrungen, von Werten<br />
<strong>und</strong> Emotionen stark besetzt. In der familienwissenschaftlichen Forschung<br />
erweist sich die Disziplinierung der eigenen Betroffenheit weitaus schwieriger<br />
als in vielen anderen Arbeitsbereichen. Daraus ergeben sich spezifische<br />
Herausforderungen der Soziologie. Sie beginnen schon bei der Verständigung<br />
darüber, was mit Familie gemeint ist.<br />
2. Der Begriff Familie ist der Soziologie wie viele andere Begriffe des täglichen<br />
Lebens vorgegeben <strong>und</strong> weist eine verschlungene Begriffsgeschichte<br />
auf, deren Quintessenz lautet, daß mit Familie — zumindest in der Neuzeit<br />
— öffentlich (meist rechtlich) anerkannte Lebensformen zur Gestaltung<br />
des Verhältnisses zwischen Eltern <strong>und</strong> Kindern gemeint sind. Wesentlich<br />
2<br />
für Familie ist somit ihr doppelter Charakter als eine Art Lebensgemeinschaft<br />
oder Gruppe <strong>und</strong> als <strong>gesellschaftliche</strong> Institution. Dabei sind die Abgrenzungen<br />
zu Ehe, Haushalt <strong>und</strong> Verwandtschaft oft fließend. Sozialgeschichtlichen<br />
Forschungen verdanken wir zu diesem Thema in den letzten<br />
Jahrzehnten eine Fülle wichtiger Einsichten, aus denen sich für unseren<br />
Kulturbereich folgende Generalisierungen ergeben: 3<br />
a) Zu allen Zeiten gab es — oft nebeneinander — verschiedene Formen<br />
des Haushaltes, darin lebten Familien mit wenigen <strong>und</strong> mit vielen Kindern,<br />
<strong>und</strong> zusätzlich lebten darin u.U. weitere Verwandte sowie Bedienstete.<br />
b) Der heute vorherrschende Typ der Kernfamilie, also derjenigen Familie,<br />
die primär auf den Eltern-Kind-Beziehungen beruht, ist dadurch entstanden,<br />
daß den Eltern die primäre Verantwortung für die Pflege <strong>und</strong> Erziehung<br />
der Kinder übertragen <strong>und</strong> ihnen eine gewisse Autonomie der Gestaltung<br />
eines privaten alltäglichen Lebensraumes zugebilligt worden ist.<br />
Diese hervorragende Stellung der Kernfamilie hat sich im wesentlichen<br />
seit dem 18. Jahrh<strong>und</strong>ert herausgebildet. — Sonderformen wie Familien<br />
alleinerziehender Mütter oder Väter wurden im Laufe der Zeit zusehends<br />
als gleichwertig anerkannt. Formen <strong>und</strong> Aufgaben von Familien standen<br />
<strong>und</strong> stehen in Wechselbeziehungen zu den demographischen Entwicklungen<br />
sowie zu wirtschaftlichen, politischen <strong>und</strong> kulturellen Sachverhalten.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
c) Parallel zur Entwicklung dieses relativ autonomen Lebensraumes der<br />
Familie ist ein Netzwerk mehr oder weniger formalisierter sozialer Beziehungen<br />
<strong>und</strong> öffentlicher Einrichtungen entstanden, die die Kernfamilie in<br />
der Pflege <strong>und</strong> Erziehung der Kinder sowie in der Sorge für die Alten unterstützen,<br />
teilweise ergänzen, aber auch mit ihr konkurrieren.<br />
3. Es gab also schon früher eine Pluralität jener Lebensverhältnisse, die wir<br />
von unserem heutigen Verständnis her <strong>und</strong> für die Zwecke der sozialwissenschaftlichen<br />
Analyse als „familiale Lebensformen" bezeichnen können.<br />
Auch gab es schon früher neue Entwicklungen <strong>und</strong> Auseinandersetzungen<br />
um institutionelle Anerkennung. Doch hat es den Anschein, als ob seit Anfang<br />
der 60er Jahre eine neue <strong>und</strong> vor allem überaus rasch ablaufende Phase<br />
des Wandels in Gang gekommen ist. Sie betrifft z.T. Familientypen (z.B.<br />
Familien alleinerziehender Eltern), die wir in gewisser Weise schon von früher<br />
her kennen. Doch die Umstände ihrer Entstehung <strong>und</strong> Verbreitung<br />
scheinen andere zu sein. Folgende demographische Sachverhalte können in<br />
etwa als Indikatoren der Emergenz von derart — in einem eingegrenzten<br />
Sinne des Wortes — neuen familialen Lebensformen verstanden werden: 4<br />
— Rückgang der Eheschließungen, wobei bis etwa 1975 das durchschnittliche<br />
Heiratsalter sank, seither wieder ansteigt.<br />
— Zunahme der Zahl der kinderlosen Paare sowie des relativen Anteils der<br />
Familien mit einem oder zwei Kindern.<br />
— Rückgang der Geburtenziffer, wobei allerdings die eheliche Geburtenziffer<br />
seit 1975 wieder angestiegen ist, der Rückgang neuerdings also<br />
wesentlich mit dem Verzicht auf Eheschluß zusammenhängt.<br />
— Rascher Anstieg der Haushalte unverheirateter Paare — mehr oder weniger<br />
zutreffend „nichteheliche Lebensgemeinschaften" genannt. — Ziemlich<br />
genaue Zahlen liegen aus der Volkszählung 1980 für die Schweiz<br />
vor, wo der Anteil unverheirateter Paare unter allen Paaren ohne Kinder<br />
8% beträgt; unter den 20- bis 24jährigen beträgt der Anteil r<strong>und</strong><br />
25% (Lüscher 1983). — Die Größenordnungen in der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
sind gemäß verschiedener Schätzungen ähnlich (Wingen 1984). Die<br />
Zahl der zum Zeitpunkt der Volkszählung zusammenlebenden unverheirateten<br />
Paare mit Kindern beträgt in der Schweiz 2% aller Familien<br />
mit minderjährigen Kindern. 5<br />
— Zunahme der Scheidungsziffern <strong>und</strong> der Zahl der Ein-Eltern-Familien<br />
sowie der Kinder mit Stiefeltern. — Schwarz (1984) schätzt, daß 8%<br />
aller noch nicht 18jährigen Kinder im Haushalt von Stiefeltern wohnen<br />
(davon gut vier Fünftel mit ihrer natürlichen Mutter). Ferner leben<br />
7,5% der Kinder bei der alleinstehenden Mutter, 1,5% beim alleinstehenden<br />
Vater. 83% der Kinder wachsen derzeit im Haushalt ihrer zusammenlebenden<br />
Eltern auf.<br />
4. Für die Analyse dieser Sachverhalte ist es notwendig, Konzepte heranzuziehen,<br />
die der Dynamik familialer Lebensformen in zweifacher Hinsicht gerecht<br />
zu werden vermögen, nämlich, erstens in bezug auf die Entwicklung<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
der einzelnen Familie <strong>und</strong>, zweitens, in bezug auf die Herausbildung einer<br />
Pluralität von Familienformen, eingeschlossen die beobachtbare teilweise<br />
Ablehnung der Familiengründung. Es geht also um Prozesse der Konstitution<br />
<strong>und</strong> um die Emergenz von Lebensformen im <strong>gesellschaftliche</strong>n Raum.<br />
Konzeptuelle Gr<strong>und</strong>lagen<br />
1. Als Ausgangspunkt für die Analyse wähle ich einen Sachverhalt, der sowohl<br />
theoretisch als auch empirisch relevant ist. Es ist dies der Umstand,<br />
daß der neugeborene Mensch während mehrerer Jahre auf Fürsorge, auf<br />
Pflege <strong>und</strong> Erziehung durch Erwachsene angewiesen ist. Mit der Erfüllung<br />
der dabei anfallenden Aufgaben ordnen aus heutiger Sicht die Eltern ihre<br />
Kinder, sich selbst <strong>und</strong> ihre häusliche Gemeinschaft in eine übergreifende<br />
Entwicklung ein <strong>und</strong> generieren dementsprechend Sinngebungen des Lebens,<br />
kurz, entwickeln individuelle <strong>und</strong> kollektive Identitäten. Die Familienformen<br />
drücken aus, wie die Lebensverhältnisse <strong>und</strong> das Verständnis<br />
dieser Aufgaben unter konkreten historischen Bedingungen zusammenwirken.<br />
Mit anderen Worten, wir können familiale Lebensformen, knapp formuliert,<br />
als „soziale Erfindungen" zur Gestaltung der anthropologisch gestellten<br />
Aufgabe der Pflege <strong>und</strong> Erziehung des Nachwuchses betrachten.<br />
Dabei kann in soziologischer Sicht offen bleiben, inwieweit der Ursprung<br />
von Familie auf glaubensmäßige Überzeugungen oder auf Verhaltensdispositionen<br />
zurückgeführt werden kann oder soll. Ausschlaggebend ist in jedem<br />
Fall, daß sich seit Menschengedenken eine Vielfalt familialer Lebensformen<br />
durch erfahrungsgeleitete Gestaltung konkreter Lebensverhältnisse<br />
konstituiert. Diese Konstitution stellt in einem weiten Sinne des Wortes<br />
eine Leistung dar; dem Begriff kommt ebenso wie demjenigen der Aufgabe<br />
im hier vertretenen Ansatz ein analytischer Stellenwert zu. 6<br />
2. Praktisch handelt es sich heutzutage bei familialen Aufgaben darum,<br />
Wohnen, Haushalten, Erwerbstätigkeit, Kindererziehung, Freizeit usw. in<br />
einem Alltag zu koordinieren <strong>und</strong> zu synchronisieren <strong>und</strong> dabei auch unvorhergesehene<br />
Ereignisse zu meistern. Die vielfältigen Erfahrungen, welche<br />
die Menschen dabei machen, finden ihren Niederschlag in Orientierungen,<br />
beispielsweise in der Form von Handlungsmaximen. Diese Orientierungen<br />
wiederum lassen sich analytisch Ordnungsschematas zuordnen, die ihrerseits<br />
wiederum der Orientierung des weiteren Handelns dienen. Wir sagen also: in<br />
einer menschlichen Handlung vereinigen sich — analytisch gesprochen —<br />
Ziele (Zweck), Kontext <strong>und</strong> Begründung (Norm).<br />
3. Zur weiteren Analyse dieser Zusammenhänge können wir auf den von G.<br />
H. Mead eingeführten Begriff der Perspektiven zurückgreifen. 7 Er faßt systematisch<br />
Orientierungen in einem kommunikativen Kontext zusammen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Alles menschliche Handeln ist demnach an die Bedingung der Perspektivität<br />
geb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> erhält durch einen (mindestens einen) kommunikativen<br />
Kontext seine Bedeutung. — Doch der Kontexte sind, wie die Erfahrung<br />
zeigt, viele. Dementsprechend konstituiert sich gemeinsame Realität in einer<br />
Vielfalt von Perspektiven.<br />
Soweit — knapp umrissen — die Begründung der Perspektivität des Handelns<br />
im Anschluß an Mead. Er ist bei weitem nicht der einzige, der sich<br />
dem Thema zugewandt hat. Wir stoßen darauf u.a. bei Durkheim <strong>und</strong> Simmel.<br />
Doch gebührt Mead besondere Beachtung, weil er als konsequenter<br />
Evolutionist sowohl die differentiellen raumzeitlichen als auch die pragmatistischen<br />
Dimensionen aufeinander bezieht. Darum ist sein Ansatz ebenso<br />
theoretisch wie praktisch bedeutsam.<br />
4. Wichtig sind mir insbesondere die im Anschluß an Mead möglichen „Operationalisierungen"<br />
des Konzeptes, wozu ich hier vor allem drei Vorschläge<br />
machen möchte, die unmittelbar unser Thema betreffen.<br />
(a) Das Konzept der Perspektive verknüpft auf einer generellen Ebene<br />
Handlungsweisen <strong>und</strong> kommunikative Kontexte, also soziale Zugehörigkeiten<br />
des einzelnen. Diese wiederum bilden den Rahmen für soziale Geltung,<br />
8<br />
also zur Begründung von Normen. Dementsprechend können konzeptuell<br />
Perspektiven hinsichtlich des kommunikativen Kontextes unterschieden<br />
werden, in dem sie entstehen, also z.B. als<br />
— subjektive Perspektiven (Kommunikation mit sich selbst)<br />
— private Perspektiven (Kommunikation in privaten, d.h. nichtöffentlichen<br />
Gruppen)<br />
— öffentliche Perspektiven (Kommunikation in Organisationen, im Staat,<br />
öffentliche Meinung)<br />
— religiöse Perspektiven (unter der Annahme einer Kommunikation mit<br />
Gott oder einem Göttlichen).<br />
(b) Gesellschaftliches Handeln ist das Ergebnis von Wechselwirkungen<br />
mehrerer dieser Handlungsperspektiven. So kann der einzelne in seinem<br />
Denken <strong>und</strong> Fühlen eine Abstimmung der Perspektiven vornehmen. Oder<br />
organisatorische Vorgaben vermögen a priori den Geltungsanspruch bestimmter<br />
(meist öffentlicher) Perspektiven festzulegen <strong>und</strong> durchzusetzen.<br />
Wo eine Konvergenz von Handlungsperspektiven nicht oder nicht ausreichend<br />
vorhanden ist, besteht ein Zustand von Anomie.<br />
(c) Eine besondere Kategorie stellen die wissenschaftlichen Perspektiven<br />
dar, eingeschränkter <strong>und</strong> hier primär von Interesse, die soziologischen Perspektiven.<br />
Sie gehören in unserem Schema an sich zu den öffentlichen Perspektiven.<br />
Doch bilden die anderen Perspektiven gewissermaßen ihr Thema:<br />
eben die Handlungsorientierungen von Menschen, analysiert nach Zielen,<br />
Kontext <strong>und</strong> Begründung des Handelns. Für die Soziologie kann somit<br />
postuliert werden (was ich hier vertreten möchte), daß die Interdependenz<br />
unterschiedlicher Perspektiven ein herausragender Gegenstand der theoretischen<br />
<strong>und</strong> empirischen Forschung ist.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Moderne familiale Lebensformen<br />
1. Demographische Daten wie Rückgang der Eheschließungen <strong>und</strong> der Geburtenziffer,<br />
Zunahme der Scheidungsziffer habe ich als Indikatoren der<br />
Veränderung bezeichnet. Doch sie beruhen auf Informationen, die auf einer<br />
überaus heterogenen Aggregierung von Individualdaten hervorgegangen<br />
sind. Einen wichtigen Schritt bis zur eigentlichen Analyse tun wir, wenn<br />
wir uns auf Alterskohorten beziehen, <strong>und</strong> wenn wir uns demgemäß an biographischen<br />
Abläufen orientieren. Zur Kohortenanalyse hat u.a. Mayer Daten<br />
vorgelegt, <strong>und</strong> neuerdings liegen auch seitens der Jugend<strong>soziologie</strong><br />
wichtige Beiträge vor. Demnach gilt für viele jüngere Menschen die biographische<br />
Sequenz nicht mehr, die lange Zeit lautete: Ausbildung, Eintritt<br />
9<br />
ins Erwerbsleben, Eheschluß verb<strong>und</strong>en mit der Gründung eines eigenen<br />
Haushaltes, baldige Geburt von Kindern. Teils ändert sich die Reihenfolge,<br />
teils treten Verzögerungen ein. An die Stelle einer traditionellen, institutionalisierten<br />
Abfolge der Ereignisse tritt eine Art biographischer Mobilität<br />
(Birg 1984), bei der den subjektiven <strong>und</strong> privaten Perspektiven eine erhöhte<br />
Bedeutung zukommt.<br />
2. Für die weitere Darstellung beziehe ich mich zunächst auf biographische<br />
Ereignisse, an denen wichtige Aspekte der Genese neuer familialer Lebensformen<br />
erkennbar sind. Den ersten herausragenden Sachverhalt bildet die<br />
frühe Gründung eines eigenen Haushaltes, heute begünstigt durch relativ<br />
gute Verdienstmöglichkeiten (derjenigen, die Arbeit haben), ferner durch<br />
sozialstaatliche Absicherungen, durch die Unterstützung seitens der Eltern<br />
(was ebenfalls vermehrte Sozialleistungen erleichtern) sowie durch einen<br />
einfachen Lebensstil. Diese jungen Haushalte sind also oft nicht völlig<br />
selbsttragend, was auf die Bedeutung verwandtschaftlicher Beziehungen<br />
<strong>und</strong> sozialer Netzwerke hinweist.<br />
3. Eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung von Haushalten unverheirateter<br />
Paare vor-, neben-, außer- oder nichtehelicher Art — die Fülle<br />
umgangssprachlicher Bezeichnungen belegt in der Sprache die Neuheit des<br />
Phänomens — bildet der Umstand, daß Antikonzeption das Risiko unerwünschter<br />
Schwangerschaften praktisch vollständig auszuschließen ermöglicht.<br />
Dies ist ein Sachverhalt, ob dessen Selbstverständlichkeit wir leicht<br />
übersehen, in wie kurzer Zeit er selbstverständlich geworden ist <strong>und</strong> was er<br />
impliziert: In einem Ausmaß, das historisch erstmalig ist, besteht heute der<br />
Eindruck umfassender Planbarkeit des generativen Verhaltens. Viel radikaler<br />
als je zuvor erwächst den einzelnen Menschen <strong>und</strong> dem Paar die Möglichkeit<br />
<strong>und</strong> die Notwendigkeit, darüber zu entscheiden, ob <strong>und</strong> zu welchem<br />
Zeitpunkt es Kinder haben möchte. — Die Schwierigkeiten <strong>und</strong> A<strong>mb</strong>ivalenzen<br />
<strong>und</strong> ganz persönliche, subjektive Betroffenheit werden mittlerweile<br />
in Schriften intensiv abgehandelt, z.B. in Peter Roos/Friederike Hassauer:<br />
Kinderwunsch — Reden <strong>und</strong> Gegenreden (1982). In einem dort<br />
wiedergegebenen Briefwechsel findet sich u.a. folgende Stelle: „... Mein<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Kind soll nicht 'passieren';"mein Kind soll meine Entscheidung sein <strong>und</strong> die<br />
seines Vaters. Du, ich glaube, damit bin ich an einen wichtigen Punkt gekommen:<br />
Ich habe keinen Anhaltspunkt, warum ich mich für oder gegen<br />
ein Kind entscheiden sollte." (S. 20).<br />
4. Allerdings besteht eine Asymmetrie: Verläßlich ist lediglich die Beeinflussung<br />
der Antikonzeption, nicht aber der Konzeption. Doch auch hier<br />
machen sich Vorstellungen einer prinzipiellen Machbarkeit breit. So gibt<br />
es Berichte über Leihmütter, die eine Schwangerschaft für Dritte übernehmen.<br />
Spektakulär <strong>und</strong> von weitreichender sy<strong>mb</strong>olischer Bedeutung sind die<br />
Entwicklungen in der Medizin. Dabei kommt es leicht zu falschen Vorstellungen<br />
über den tatsächlichen Erfolg der Behandlungen. Gemäß einem Bericht<br />
in der Zeitschrift „Bild der Wissenschaft" (Oktober 1982) sind in der<br />
Frauenklinik Erlangen während der Jahre 1981/82 „etwa 200 Versuche unternommen<br />
worden, acht Kinder wurden lebend geboren". Die Schätzungen<br />
lauten, daß sich in sorgfältig vorausgewählten Populationen bei etwa<br />
20% der Fälle eine Schwangerschaft ergibt; dies u.U. nach wiederholten<br />
Behandlungen über mehrere Monate hinweg.<br />
Alles in allem ist die wachsende Bedeutung subjektiver <strong>und</strong> privater<br />
Perspektiven in diesen Prozessen der Konstituierung von Partnerschaft <strong>und</strong><br />
Familie deutlich zu erkennen; sie relativieren die traditionellen öffentlichen<br />
Perspektiven. Klar tritt die Vorstellung der „Machbarkeit" in Geburtsanzeigen<br />
zutage, also dort, wo subjektive <strong>und</strong> private Auffassungen veröffentlicht<br />
werden. — Gemäß einer Untersuchung der „Gesellschaft für deutsche<br />
Sprache" finden sich in den Annoncen gehäuft Wörter wie „machen",<br />
„planen", so etwa: „Von wegen Storch, da muß ich lachen, man muß die<br />
Sache selber machen"; „Nach neun Monaten Planung oder „Unser geplantes<br />
Projekt ist abgeschlossen", oder, reiselustig <strong>und</strong> kein bißchen prüde:<br />
„Unser Nachwuchs, made in Espana". 10<br />
5. Eine Schwangerschaft, ob gewollt oder nicht, erfordert von einem unverheirateten<br />
Paar Auseinandersetzungen mit den vorherrschenden institutionellen<br />
Regelungen. Ohne Heirat steht das Sorgerecht für das Kind nur<br />
der Mutter zu. Dabei schließt eine gemeinsame Haushaltsführung diese von<br />
den „Mutter-Kind-Programmen" aus, eine Vorschrift, der gelegentlich<br />
durch Kontrollen seitens der Sozialämter Nachdruck verschafft wird. Erhebliche<br />
Schwierigkeiten können ferner im Falle des Todes eines der Eltern<br />
entstehen. In allen diesen Punkten schlägt der auf lange Traditionen zurückgehende<br />
Gr<strong>und</strong>satz durch, wonach die Position des Vaters zum Kind von<br />
seiner rechtlichen Beziehung zur Mutter abhängt.<br />
Viele Paare entschließen sich darum in Erwartung eines Kindes zur Heirat,<br />
wie die vergleichsweise geringe Zahl unverheiratet zusammenlebender<br />
Paare mit gemeinsamen Kindern zeigt. Jedoch dürfen wir nicht außer acht<br />
lassen, daß Zahl <strong>und</strong> Quote der Eheschließungen sinken. Nicht wenige Paare<br />
dürften zunächst lediglich einen Aufschub im Sinn haben, doch kann dieses<br />
Provisorium andauern <strong>und</strong> zum Verzicht auf Familienbildung führen. 11<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
6. Zusammengefaßt verweisen diese Sachverhalte auf einen ersten Faktor,<br />
der aktuelle Spannungen zwischen subjektiven, privaten, öffentlichen <strong>und</strong><br />
religiösen Perspektiven bedingt: der im wesentlichen durch die moderne<br />
Antikonzeption geforderte Zwang nach neuen Sinngebungen des Entscheides<br />
für Kinder. Dabei verlieren die institutionellen Rahmenbedingungen an<br />
Bedeutung.<br />
Wenn es also nicht mehr als selbstverständlich gilt zu heiraten <strong>und</strong> Kinder<br />
zu bekommen, gewinnen umgekehrt private <strong>und</strong> subjektive Perspektiven<br />
an Gewicht. Damit erhöhen sich einerseits die Möglichkeiten, andererseits<br />
die Belastungen individuellen Entscheidens, <strong>und</strong> dementsprechend erhöht<br />
sich auch tendenziell der Pluralismus der Lebensformen, der familialen<br />
ebenso wie der nichtfamilialen.<br />
7. Diese Tendenzen werden nun wesentlich verstärkt durch einen zweiten<br />
Faktor, der in die gleiche Richtung wirkt: Bedingungen der alltäglichen<br />
Lebensverhältnisse. Ich will hier zwei Sachverhalte besonders hervorheben.<br />
Der eine betrifft den Umstand, daß Denk- <strong>und</strong> Handlungsmuster wirtschaftlicher<br />
Rationalität bzw. des Monetarismus in zunehmendem Maße in das familiale<br />
Handeln eindringen <strong>und</strong> es dominieren. Hierzu einige Veranschaulichungen:<br />
Familiales Haushalten erfordert heutzutage überwiegend Entscheidungen<br />
<strong>und</strong> Leistungen im Bereich des Konsums; sein Erlebniswert<br />
ist ein permanentes Thema der Werbung, die in alle Lebensbereiche, sozusagen<br />
bis ins Kinderzimmer <strong>und</strong> ins Schlafzimmer eindringt. Zu bedenken<br />
ist im weiteren die Tendenz, im Verhältnis zwischen Eltern <strong>und</strong> Kindern<br />
von Gesetzes wegen gegenseitige Rechte <strong>und</strong> Pflichten im Konfliktfall,<br />
nicht nur beim Ableben, zu monetarisieren. Doch auch mehr oder weniger<br />
freiwillige finanzielle Leistungen der Großeltern an Eltern <strong>und</strong> Großkinder<br />
spielen gewissermaßen im Austausch gegen Gefühle eine erhebliche Rolle,<br />
worauf Roussel (1976) bereits vor einigen Jahren hingewiesen hat.<br />
Der Anspruch wirtschaftlicher Rationalität auf Priorität kommt besonders<br />
deutlich im Umstand zum Ausdruck, daß die Gleichberechtigung der<br />
Frau eng an ihre aktive, erfolgreiche Teilhabe am Wirtschaftsleben gekoppelt<br />
ist, vorzüglich außerhalb des Haushaltes. Eine angemessene Anerkennung<br />
wirtschaftlicher Leistungen der Frau im Haushalt <strong>und</strong> ihrer Arbeit<br />
mit Kindern ist bis jetzt noch nicht absehbar. 12<br />
Diese wirtschaftlichen Zusammenhänge <strong>und</strong> die sich daraus ergebenden<br />
alltäglichen Konsequenzen fordern also von den Frauen <strong>und</strong> auch den Paaren<br />
bewußte Entscheidungen hinsichtlich der Konstituierung einer Familie,<br />
ihrer Erweiterung <strong>und</strong> den späteren Lebensphasen, wobei Erwägungen über<br />
den subjektiven <strong>und</strong> privaten Nutzen zwangsläufig ein großes Gewicht zukommt.<br />
8. Der andere, das Subjektive <strong>und</strong> Private begünstigende Sachverhalt betrifft<br />
den Aufbau einer Kultur der einzelnen Familie, etwas weniger anspruchsvoll<br />
formuliert, die Schaffung eines Familienklimas. Es äußert sich in den<br />
Formen des gegenseitigen Umganges, des Gespräches, der Konfliktlösung,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
im Spiel, in der Auseinandersetzung mit Bildungsgütern aller Art sowie in<br />
Sinngebungen des Lebens.<br />
Die wohl herausragendste Beeinflussung dieser familialen Leistungen<br />
kommt heutzutage von den elektronischen Medien, die ja in erster Linie<br />
zu Hause genutzt werden. Die Programmstruktur des Fernsehens schafft<br />
mittlerweile für viele Haushalte <strong>und</strong> Familien Orientierungspunkte des Alltags,<br />
<strong>und</strong> die Inhalte bilden einen gemeinsamen F<strong>und</strong>us von Eindrücken<br />
<strong>und</strong> mittelbaren Erfahrungen, meist in Form partikulären, oft exotischen<br />
Wissens. Die Frage des richtigen Ausmaßes der Mediennutzung ist ein verbreitetes<br />
Thema der Familienerziehung. — Zwar läßt sich mit Recht einwenden,<br />
daß die Inhalte vieler Darbietungen den öffentlichen Perspektiven<br />
zuzuordnen sind, <strong>und</strong> zweifelsohne kann daraus eine Beeinflussung des<br />
Konsums <strong>und</strong> politischer Auffassungen resultieren. Aber die Eindrücke,<br />
vorab aus dem kulturellen Bereich, sind wie erwähnt oft bruchstückhaft,<br />
sozusagen zufällig, so daß der einzelne gezwungen ist, eine individuelle<br />
Synthese zu schaffen, was wiederum die subjektiven Perspektiven betrifft;<br />
unter dem Einfluß der modernen Medien <strong>und</strong> ihrer Nutzungsmöglichkeiten<br />
wird Bildung heute gewissermaßen subjektivistisch bestimmt.<br />
13<br />
9. Wir können Aspekte der genannten beiden Faktoren, Sinngebung des<br />
Kinderwunsches <strong>und</strong> Auswirkungen der alltäglichen Lebensverhältnisse,<br />
nun auch in den Bemühungen um „alternative" Lebensformen finden.<br />
Zusätzlich ist darin ein dritter Faktor erkennbar: Angesichts des hohen<br />
Organisationsgrades des modernen Lebens werden die familialen Lebensformen<br />
als der einzige, dem modernen Menschen noch verbleibende Bereich<br />
der Entfaltung sinnvollen subjektiven <strong>und</strong> privaten Handelns aufgefaßt,<br />
also als jener Bereich, der — vermeintlich — einen Rückzug von öffentlichen<br />
Zwängen ermöglicht. Dementsprechend wird der Pflege familialer<br />
Lebensformen eine hohe Bedeutung zugemessen.<br />
Diese Charakterisierung trifft für viele gruppenähnliche Lebensgemeinschaften<br />
zu. Oft steht die explizite Kritik an einem oder mehreren Elementen<br />
der sogenannten bürgerlichen Familie im Vordergr<strong>und</strong>, meist in<br />
Verbindung mit der Ablehnung der Ehe <strong>und</strong> dem Protest gegen die Dominanz<br />
des Wirtschaftlichen. Dafür wird etwa für „Beziehungs-Arbeit"<br />
14<br />
oder für individuelle Meditation viel Zeit eingeräumt.<br />
Alternativen dieser Art gibt es als eigentliche Sozialexperimente mit<br />
schriftlich fixierter Programmatik, so die AA-Kommune „Bauhütte". Sie<br />
existiert, gemäß Duhm (1978: 127/128) „ohne Privateigentum, ohne Zweierbeziehung,<br />
ohne Alkohol <strong>und</strong> Drogen, also ohne fast alles, was dem Kulturmenschen<br />
unserer Zeit das Leben lebenswert macht..."<br />
Doch auch viele informelle Wohngemeinschaften, einzelne Familien<br />
<strong>und</strong> Ein-Eltern-Familien verstehen sich oft in einem oder mehreren Aspekten<br />
als alternativ. Dabei ist die subjektive <strong>und</strong> private Einschätzung der<br />
eigenen Lebensform für Lebensäußerungen aller Art wichtig.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Eine Art Alternative wiederum zu diesen Alternativen suchen diejenigen,<br />
die explizit alle dauerhaften Bindungen ablehnen. Hier begeben wir uns<br />
in einen Bereich unstrukturierter „sozialer Bewegungen", vor allem die sogenannte<br />
„Single"-Bewegung, unter deren Anhängern eigene, bisweilen in<br />
Annoncen explizierte Formen situationsbezogener Beziehungen üblich sind,<br />
oft von extrem subjektivistischer Orientierung, in denen nicht nur das öffentliche,<br />
sondern auch das Private zurückgedrängt wird. 15<br />
10. An dieser Stelle können wir die Ergebnisse unserer Analyse in folgender<br />
These zusammenfassen:<br />
(1) Bei der Konstitution familialer Lebensformen unter Bedingungen von Modernität<br />
kommt subjektiven <strong>und</strong> privaten Perspektiven im Verhältnis zu den öffentlichen <strong>und</strong><br />
religiösen vermehrte Relevanz zu, <strong>und</strong> dies wird durch die alltäglichen Lebensverhältnisse<br />
begünstigt. Daraus resultieren gesteigerte Anforderungen an Entscheidungen <strong>und</strong><br />
Handeln, die ihren Niederschlag in einer zunehmenden Pluralität familialer Lebensformen<br />
finden, teilweise in der Ablehnung von Familiengründung.<br />
Diese erste These impliziert, daß es heute vielen Menschen schwerfällt, die<br />
Leistungen zu erbringen oder als sinnvoll anzusehen, welche die Konstitution<br />
familialer Lebensformen erfordert, was am veränderten Verständnis<br />
der Aufgaben liegt <strong>und</strong> durch die modernen Lebensbedingungen verstärkt<br />
wird.<br />
Die These mag vielleicht zunächst den Anschein erwecken, sie drücke im.<br />
wesentlichen nichts anderes aus als das Dürkheim'sehe Kontraktionsgesetz.<br />
Es geht jedoch um mehr, nämlich um den Zusammenhang zwischen familialem<br />
Handeln, verschiedenen Wissensformen <strong>und</strong> spezifischen Lebensbedingungen.<br />
Es geht auch um etwas anderes als die These, die Beck (1983),<br />
Beck-Gernsheim (1983) u.a. vertreten haben, wonach individuelle Lebensentwürfe<br />
immer wichtiger werden. Zwar läßt sich hier anknüpfen, doch ist<br />
Individualismus ein historisch bedingtes Konzept, das näherer Klärung bedarf,<br />
was m.E. der Rückgriff auf die „Perspektivität des Handelns" erleichtert.<br />
11. Es ist an dieser Stelle nicht möglich, einen ausführlichen Rückblick auf<br />
die Geschichte der Familien<strong>soziologie</strong> zu halten. 16 Kennzeichnend für die<br />
Entwicklungen bis in die 60er Jahre ist — etwas vereinfacht ausgedrückt —<br />
der Umstand, daß zwei Ansätze relativ unverb<strong>und</strong>en nebeneinander standen:<br />
die makrosoziologischen Analysen, die vom institutionellen Verständnis<br />
ausgehen, <strong>und</strong> die interaktionistischen Analysen, die sich in erster Linie<br />
auf die Familien als Gruppen <strong>und</strong> die darin ablaufenden Interaktionen konzentrieren.<br />
Erst in neuerer Zeit sind über die Sozialisationsforschung <strong>und</strong><br />
die Systemtheorie vermehrte Bemühungen in Gang gekommen, die institutionellen<br />
<strong>und</strong> die interaktionistischen Aspekte von Familie aufeinander zu<br />
beziehen. Es läßt sich somit im Hinblick auf die Aufgaben der Soziologie<br />
folgende These formulieren:<br />
(2) Unter den traditionellen, noch heute weitgehend vorherrschenden Paradigmen <strong>und</strong><br />
Ansätzen der Familienforschung überwiegen solche, die Familien primär hinsichtlich<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
einzelner Aspekte betrachten, was zumindest teilweise durch die ideologische, vielleicht<br />
auch faktische Dominanz einzelner Familientypen gefördert worden ist. Demgegenüber<br />
erfordern die aktuellen Bedingungen Theorien <strong>und</strong> Methoden zur Analyse der wechselseitigen<br />
Bedingtheit von familialen Aufgaben, ihrem Verständnis <strong>und</strong> den alltäglichen<br />
Lebensverhältnissen.<br />
Die mit dieser These implizierte Kritik trifft beispielsweise auch auf die unlängst<br />
von Brigitte <strong>und</strong> Peter Berger (1984) vorgelegte Verteidigung der bürgerlichen<br />
Familie zu, nicht nur, weil die beiden das Mißverständnis der unzulässigen<br />
Verallgemeinerung eines historischen Familientyps in Kauf nehmen,<br />
sondern weil sie sich als Schiedsrichter zwischen unterschiedlichen<br />
Positionen aufspielen, ohne selbst eine Analyse der gegenwärtig ablaufenden<br />
Prozesse der Konstitution familialer Lebensformen vorzulegen. — Problematisch<br />
sind ferner Auffassungen, wie sie von gewissen — nicht allen —<br />
Familienpolitikern vertreten werden, wonach sich Probleme schlicht dadurch<br />
lösen lassen, daß die sogenannten alten Werte wieder ins Zentrum<br />
gerückt werden. Wer so argumentiert, übersieht, daß Werte, Handeln <strong>und</strong><br />
Lebensverhältnisse interdependent sind, Werte also stets der Auslegung bedürfen,<br />
was nicht losgelöst von den praktischen Erfahrungen der Menschen<br />
geschehen kann.<br />
Diskussion: Herausforderungen der Soziologie<br />
1. Unsere erste These läßt auch den Schluß zu, daß in dem Maße, in dem unsere<br />
Analysen über die Emergenz neuer familialer Lebensformen zutreffen, es<br />
sich bei diesen Analysen auch um einen Beitrag zum Verständnis der Gegenwart<br />
handelt. Familiensoziologische Arbeit bezieht sich in der Tat auf<br />
wichtige <strong>gesellschaftliche</strong> Institutionalisierungsprozesse. Sie ist dementsprechend<br />
relevant für die allgemeine Soziologie. Klassiker wie z.B. Engels,<br />
Durkheim, Weber <strong>und</strong> Simmel haben diesen Sachverhalt deutlich gesehen,<br />
doch ist er im Laufe der fachlichen Aufsplitterung in den Hintergr<strong>und</strong> getreten.<br />
Soziologie wiederum hat u.a. den Charakter von Geschichtsschreibung<br />
der Gegenwart <strong>und</strong> ist als solche stets auch ein Beitrag zur Zeitdiagnose.<br />
In derartigen Bemühungen, auch solchen außerhalb der Soziologie, mehren<br />
sich Auffassungen, gemäß denen ein wichtiger Aspekt der Gegenwart in einer<br />
neuen Art oder Qualität des Individualismus <strong>und</strong> — damit zusammenhängend<br />
— des sozio-strukturellen Pluralismus zu sehen ist. So ist etwa von<br />
einer „Tyrannei der Intimität" (Sennett 1983) die Rede — oder Hoffmann-<br />
Nowotny (1980) fragt, ob wir auf dem „Weg zu einer autistischen Gesellschaft"<br />
seien. Bourdieu (1982) stellt in diesem Zusammenhang eine Theorie<br />
„der feinen Unterschiede" zur Diskussion.<br />
2. Im Bezugsrahmen einer „Perspektivität des Handelns" können wir dies<br />
ausdrücken, indem wir sagen, in den alltäglichen Handlungsorientierungen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
überwögen die subjektiven Perspektiven. Damit ist, wie gesagt, der kommunikative<br />
Kontext gemeint, in dem Zielsetzung, Handeln <strong>und</strong> Handlungsbegründung<br />
vom einzelnen gewissermaßen im Gespräch mit sich selbst erörtert<br />
werden. Gewiß geschieht dies nicht ohne Bezug auf private <strong>und</strong> öffentliche<br />
Perspektiven, die dem einzelnen, vorab dem Erwachsenen, durchaus<br />
noch bekannt sein können. Doch deren Geltungsansprüche werden erheblich<br />
relativiert. Anders ausgedrückt: Oberste Instanz ist die eigene Erfahrung<br />
oder was dafür gehalten wird. Das Angebot „sedimentierter Erfahrungen"<br />
(Luckmann) früherer Generationen, das uns in Form von Institutionen<br />
vorliegt, wird — wenn überhaupt — nur teilweise oder widerstrebend<br />
genutzt, oft als Zwang empf<strong>und</strong>en, vielfach abgelehnt. Dabei ist für die soziologische<br />
Analyse selbstverständlich von Belang, inwiefern derartige Präferenzen<br />
durch die sozialen Strukturen <strong>und</strong> ihren Wandel begünstigt werden.<br />
— Tendenzen zur Subjektivierung sind nicht bloß strukturell bedingt,<br />
sondern entwickeln ihrerseits eine strukturelle Eigendynamik. Sie besteht<br />
darin, daß die Pluralität der Lebensformen potenziert wird. Dadurch aber<br />
wird gemeinsames öffentliches Handeln erschwert, zumindest soweit es in<br />
demokratische Formen eingeb<strong>und</strong>en ist.<br />
3. Auf der Suche nach einem Konzept für diese „neue" Lebensform, die zugleich<br />
pluralistisch, subjektivistisch <strong>und</strong> strukturell bedingt ist <strong>und</strong> dem einzelnen<br />
stets Leistungen abfordert, denen er sich nur bedingt entziehen kann,<br />
eine Lebensform auch, bei der das Handeln Züge von Zufälligkeit aufweist,<br />
bin ich auf Formen der modernen Musik aufmerksam geworden. — Musik<br />
ist ja ein wichtiges Medium der Kommunikation im <strong>gesellschaftliche</strong>n Raum<br />
<strong>und</strong> drückt zugleich Abläufe aus. Implizit im „Free Jazz" <strong>und</strong> explizit in<br />
einer Richtung der klassischen Musik taucht nun seit einiger Zeit die Spiel<strong>und</strong><br />
Kompositionsform der Aleatorik auf. 17 Hier verlangt der Komponist<br />
innerhalb bestimmter zeitlicher, instrumentaler Vorgaben von den Interpreten<br />
ein spontanes <strong>und</strong> freies Spiel. Es handelt sich nicht um Improvisation,<br />
die ja nach Regeln abläuft, sondern um eine Art veranstalteten Zufalls von<br />
hoher Komplexität. — Vielleicht ist es mehr als nur Zufall, daß in den späten<br />
fünfziger Jahren eine derartige Form von Musik entstanden ist. Im<br />
übrigen findet sich der Begriff der Aleatorik auch bei Gergen (1982), der<br />
damit eine zufällige Form der Konstitution von Identität meint, allerdings<br />
ohne Querverbindungen zur musikalischen Bedeutung des Begriffes. 18<br />
4. Diese „Metapher" scheint mir zur Übertragung in die Soziologie im Hinblick<br />
auf die aktuellen Lebensbedingungen <strong>und</strong> die Emergenz neuer familialer<br />
Lebensformen bedenkenswert, finden wir hier doch erhebliche organisatorische<br />
Vorgaben <strong>und</strong> zugleich Spielräume der freien subjektiven<br />
Gestaltung. Mehr noch, die Gestaltung ist teilweise strukturell erzwungen.<br />
Wichtig ist auch die Zeitstruktur von Aleatorik. Es dominiert das Aktuelle:<br />
Zukunft <strong>und</strong> Vergangenheit werden von der Gegenwart aus konstituiert<br />
<strong>und</strong> nicht umgekehrt die Gegenwart aus Vergangenheit oder Zukunft oder<br />
einer feststehenden Kontinuität zwischen beiden begriffen, wodurch wie-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
derum das Subjektive, das tatsächlich oder "vermeintlich Individuelle herausgefordert<br />
ist.<br />
5. Die Analyse der Verknüpfung <strong>gesellschaftliche</strong>r Bedingungen mit subjektiven<br />
Handlungsentwürfen verweist auf das Stichwort „Sozialisation". Hier<br />
sind m.E. neue Entwicklungen in der Forschung bereits erkennbar, wozu<br />
mehrere Impulse beigetragen haben <strong>und</strong> noch beitragen. 19<br />
— Die Lebenslauf-Forschung hat das alte Konzept der Biographie wieder<br />
aufgegriffen <strong>und</strong> wichtige begriffliche Unterscheidungen eingeführt, etwa<br />
zwischen subjektiver <strong>und</strong> objektiver (Kohli 1983), zwischen aktueller<br />
<strong>und</strong> virtueller Biographie (Birg 1984). Noch wichtiger: der Blick weitete<br />
sich auf den gesamten Lebenslauf <strong>und</strong> seine individuellen Variationen.<br />
Dann braucht es nurmehr wenig um einzusehen, daß die Bezeichnung<br />
„Familienzyklus" unter den heutigen Verhältnissen nicht mehr<br />
zutrifft. Offen ist allerdings nach wie vor, wie Familienbiographien im<br />
eigentlichen Sinne des Wortes erfaßt werden können, d.h. als systemische<br />
Sachverhalte <strong>und</strong> nicht bloß als Addition von Individualdaten der<br />
einzelnen Familienangehörigen.<br />
— Im engen Zusammenhang mit der Biographieforschung stehen neue Ansätze<br />
der Medizin<strong>soziologie</strong>, wo die Aufmerksamkeit der Genese psychischer<br />
Erkrankungen gilt. Dabei haben z.B. Hildenbrand u.a. (1984) — um<br />
nur kurz ein Beispiel zu nennen, das mit familialen Leistungen zusammenhängt<br />
— zeigen können, wie die Unfähigkeit, innerhalb von Familien Entscheidungen<br />
zu fällen, die Entstehung von Schizophrenie begünstigt.<br />
— Eine ganz andere Art von Impulsen für die Erforschung familialer Sozialisation<br />
stellen Haushaltsanalysen dar. Sie machen klar, daß Sozialisationsprozesse<br />
beim Kind wesentlich an die Erfüllung der alltäglichen<br />
Aufgaben im Haushalt geb<strong>und</strong>en sind, also nicht schlicht ein virtuoses<br />
Spiel mit Erziehungsstilen darstellen, sondern Arbeit, die als „Arbeit<br />
mit Kindern", wie unlängst Rerrich (1983) abgehandelt hat, schwieriger<br />
geworden ist, ein Bef<strong>und</strong>, der mit meiner ersten These weitgehend<br />
übereinstimmt. — Noch sind wir weit davon entfernt, die Fülle der aktuellen<br />
Einflüsse auf familiale Sozialisation bei Kindern <strong>und</strong> Eltern zu<br />
erfassen. 20<br />
6. Diese Feststellung stößt uns auf ein zentrales Problem der empirischen<br />
Forschung. Ich will es in die Frage kleiden: Wie authentisch sind die Ergebnisse<br />
unserer Forschung? Die Frage stellt sich nicht nur in der Soziologie,<br />
sondern ebenso beispielsweise in der Psychologie, wo sie etwa Bronfenbrenner<br />
(1981) mit dem Konzept der „ökologischen Validität" thematisiert<br />
hat. In einem weiteren Sinne wird damit eine Problematik angesprochen,<br />
die seinerzeit eine wesentliche Rolle in Verbindung mit dem sogenannten<br />
Positivismusstreit gespielt hat, die Geltung empirischer Sätze, die Möglichkeiten<br />
<strong>und</strong> Grenzen empirischer Methoden.<br />
Gemeint ist damit eine Annäherung an die „gelebte Wirklichkeit", genauer<br />
wohl im Plural: die gelebten Wirklichkeiten. Das impliziert Verfahren<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
der Datengewinnung <strong>und</strong> -analyse, in denen besondere Aufmerksamkeit der<br />
Frage geschenkt wird, wie sich die Sinngebungen der Subjekte, d.h. eigentlich<br />
der „Forschungspartner" zu den auf gleiche Sachverhalte bezogenen<br />
Sinngebungen der Forscher verhalten. Impliziert ist ferner eine systemische<br />
Betrachtungsweise, allerdings derart, daß die Umschreibung der relevanten<br />
räumlichen <strong>und</strong> zeitlichen Lebenszusammenhänge wiederum nicht nur von<br />
den Forschern allein festgelegt wird, sondern möglichst dem „natürlichen"<br />
Horizont entspricht <strong>und</strong> ferner der Pragmatik des Forschungsproblems gerecht<br />
wird.<br />
ökologische Validität (oder wie auch immer wir das zentrale Kriterium<br />
der Gültigkeit soziologischer Daten umschreiben wollen) wird dann (mehr<br />
oder weniger) erreicht, wenn alle jene „Erfahrungen" erfaßt werden, die für<br />
den Handelnden relevant für die Konstitution eines sozialen Sachverhaltes<br />
gewesen sind. Ein Teil dieser Erfahrungen kann abgerufen werden (z.B.<br />
durch Dokumentenanalyse, durch Befragung), ein Teil kann mittels Konfrontation<br />
mit Daten oder Beobachtungen „provoziert" werden <strong>und</strong> ein<br />
Teil ist durch die verstehenden Analysen (frühere Forschungsergebnisse<br />
bzw. Erfahrungen einschließende) zu erschließen. 21<br />
Daraus resultieren zahlreiche forschungspraktische Anforderungen, die<br />
keineswegs immer vollständig unter einen Hut gebracht werden können. Im<br />
Bereich der Familienforschung lauten einige Stichworte:<br />
— Einbezug mehrerer familialer Aufgabenbereiche <strong>und</strong> ihrer Koordination<br />
— Berücksichtigung aller Familienangehörigen <strong>und</strong> sozialen Netzwerke<br />
— Erschließung von Alltagssituationen unter Respektierung von Intimsphären<br />
— Bildung von Kohorten unter Verknüpfung von demographischen <strong>und</strong><br />
monographischen Daten<br />
— Analyse sogenannter „natürlicher Experimente", vorab im Bereich der<br />
Familienpolitik.<br />
Schluß<br />
1. Auf einen kurzen Nenner zusammengefaßt, besteht die besondere Herausforderung<br />
aktueller familialer Lebensformen an die Familien<strong>soziologie</strong>, <strong>und</strong><br />
über sie an die Soziologie, darin, einem neuen Subjektivismus gerecht zu<br />
werden <strong>und</strong> dabei zu bedenken, wie unter diesen Bedingungen öffentliches<br />
Handeln, auch politisches Handeln möglich bleibt, also Anomie vermieden<br />
werden kann.<br />
2. Je besser es uns gelingt, in unserer soziologischen Arbeit „gelebter Wirklichkeit"<br />
gerecht zu werden, desto deutlicher zeichnet sich eine zweite<br />
Herausforderung ab, die von der Familien<strong>soziologie</strong> <strong>und</strong> von der Soziologie<br />
ausgehen kann: ihr Beitrag als Zeitanalyse <strong>und</strong> Orientierungshilfe. Ich plä-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
diere selbstverständlich nicht für eine Rückkehr zum traditionellen, vielen<br />
zurecht antiquiert vorkommenden Postulat der Ideologiekritik. Nicht lediglich<br />
Kritik von Ideologien ist wichtig, sondern die Analyse ihres tatsächlichen<br />
pragmatischen Geltungsbereichs. Das führt in der Regel zu Relativierung<br />
von Ideologien aller Art, aber verweist gleichzeitig auf die unausweichliche<br />
Frage nach angemessenen <strong>und</strong> innovativen normativen Regelungen<br />
des <strong>gesellschaftliche</strong>n Zusammenlebens.<br />
Im Rahmen unseres Themas ist damit das Verhältnis zwischen Familien<strong>soziologie</strong><br />
<strong>und</strong> Familienpolitik angesprochen. Denn im Kern stellen familienpolitische<br />
Maßnahmen <strong>und</strong> Einrichtungen öffentliche Beeinflussungen<br />
der Leistungen dar, die in den familialen Lebensformen <strong>und</strong> durch sie erbracht<br />
werden oder erbracht werden sollen. Daraus resultieren wiederum<br />
alltägliche Begriffe von Familie. 22<br />
So verweist uns schließlich die zweifache Herausforderung, die in den<br />
Veränderungen familialer Lebensformen liegt, auf unsere Verantwortung,<br />
wenn die Welt, die wir analysieren, mit unserem Wissen gestaltet wird. Sie<br />
ist im übrigen auch unsere Welt. Nirgendwo können wir das besser erkennen<br />
als im Bereich von Partnerschaft <strong>und</strong> Familie.<br />
ANMERKUNGEN<br />
1 Dieser Text stellt eine leicht überarbeitete Version des am Soziologentag gehaltenen<br />
Vortrages dar. Für kritische Kommentare zu früheren Fassungen danke ich den<br />
Mitgliedern der Konstanzer Arbeitsgruppe für Familienforschung: Sylvia Gräbe,<br />
Margot Kuon, Elisabeth Lins, Franz Schultheis <strong>und</strong> Michael Wehrspaun, ferner den<br />
Kollegen Alois Hahn (Trier), Franz-Xaver Kaufmann (Bielefeld), Lothar Krappmann<br />
(Berlin), Alfred Lang (Bern), Ilja Srubar (Konstanz) <strong>und</strong> Max Wingen (Konstanz/Stuttgart).<br />
— Eckart Pankoke hat am Zustandekommen der gemeinsamen Sitzung<br />
den größten Anteil; er hat auch diesen Beitrag kritisch begleitet.<br />
2 Zur Begriffsgeschichte von Familie siehe Schwab 1975.<br />
3 Zur Literatur über die Geschichte von Haushalt, Familie <strong>und</strong> Kindheit siehe die umfangreiche<br />
Bibliographie von Hermann et al. 1980. — Als Beispiel einer neueren,<br />
sehr prägnanten <strong>und</strong> insbesondere auch die rechtlich-institutionellen Aspekte behandelnden<br />
Darstellung sei Mesmer 1984 genannt (mit zahlreichen neueren Literaturhinweisen).<br />
— Die folgenden Generalisierungen orientieren sich am Bericht<br />
Familienpolitik in der Schweiz 1982, S. 30-<strong>35</strong>.<br />
4 Die folgenden demographischen Daten stützen sich auf die Angaben in den Werken<br />
der amtlichen Statistik, die regelmäßig in der Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft<br />
erscheinenden Berichte zur demographischen Lage in der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland sowie die Analysen von Schwarz 1984. Siehe auch den Projektbericht<br />
Nave-Herz 1984.<br />
5 Eine umfassende Bibliographie über die Literatur zu unverheiratet zusammenlebenden<br />
Paaren hat — im Auftrag des BMJFG - H. Tyrell (1985) zusammengestellt.<br />
6 Ausführliche Darstellungen dieser Konzeptualisierungen finden sich in Lüscher/<br />
Böckle 1981, Lüscher 1984a <strong>und</strong> Lüscher et al. 1984.<br />
7 Der Begriff der Perspektive wird von Mead an verschiedenen Stellen abgehandelt.<br />
Vergl. dazu z.B. die zusammenfassende Diskussion bei Raiser 1971: 162-167. —<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Eine frühe empirische Übernahme des Konzeptes stellt Becker et al. 1961 dar. —<br />
Wichtige neuere Überlegungen (unter Bezug auf Sozialisation) enthält Krappmann<br />
1985.<br />
8 Diese Vorschläge stützen sich u.a. auf die Überlegungen, daß das Konzept der Perspektive<br />
als eine Generalisierung der Vorstellung von „reference-groups" aufgefaßt<br />
werden kann (vgl. z.B. Shibutani 1961: 96-176). An dieser Stelle habe ich großen<br />
Gewinn aus Diskussionen mit M. Wehrspaun gezogen, vgl. dessen Dissertation:<br />
Konstruktive Argumentation <strong>und</strong> interpretative Erfahrung. Bausteine zur Neuorientierung<br />
der Soziologie, Wehrspaun 1985.<br />
9 Karl Mayer (MPI-Berlin) gemäß einem Referat über laufende Forschungsarbeiten,<br />
gehalten in der FG Soziologie Konstanz 1983. Ferner z.B. Jugend '81; Blancpain/<br />
Zeugin/Hanselmann 1983; Buchmann 1983.<br />
10 Diese Zitate stammen aus einem ausführlichen Artikel in der F.A.Z. vom 21.12.1984.<br />
11 Für diese rechtlichen Aspekte über unverheiratet zusammenlebende Paare stütze ich<br />
mich auf Unterlagen einer im Entstehen begriffenen Dissertation von E. Lins, in der<br />
die „Motivation" zum Eheschluß bzw. zum Verzicht auf Eheschluß durch Interviews<br />
mit verheirateten <strong>und</strong> unverheirateten Paaren in vergleichbaren Lebensverhältnissen<br />
ermittelt werden soll.<br />
12 Diese Thematik wird unter Berücksichtigung der demographischen, ökonomischen,<br />
soziologischen, psychologischen <strong>und</strong> pädagogischen Aspekte ausführlich abgehandelt<br />
im neuesten Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates für Familienfragen<br />
(1984).<br />
13 Für eine ausführlichere Darstellung dieser Überlegungen zur „Medienökologie" siehe<br />
meinen Beitrag in dem von Ringeling/Svilar (1984) herausgegebenen Sammelband.<br />
Uber wichtige Ergebnisse der Medienpsychologie berichtet im gleichen Band<br />
H. Sturm.<br />
14 Vgl. hierzu auch die bereits genannte Bibliographie von Tyrell (Anm. 5). — Beispiel<br />
einer aktuellen „religiösen" Ablehnung von Ehe stellen etwa die Ausführungen von<br />
Bhagwan dar. Siehe: Sannyas, Puvodaya 16/1981 „Beziehungsdrama oder Liebesabenteuer".<br />
15 Z.B. folgende Inserate aus dem „dip", Berlinmagazin 16/1984: 23: „'Entfesselungskünstler'<br />
(30) sucht keine feste Bindung. Mann mit Vollbart ab 32, der ohne Haltbarkeitsgarantie<br />
auskommt, gesucht für alles mögliche. Versuch's, vielleicht ist ja<br />
wirklich was möglich." — „Für gewisse St<strong>und</strong>en ohne Bindungswünsch, zärtlich,<br />
schlank, gesucht von M, 43, 1,75, schlank, sportliche Figur. Nichtraucher, Bart, für<br />
gelegentliche zärtliche Treffs. KW: Ab <strong>und</strong> zu." — „Gutaussehender, sensibler<br />
Mann, 23, sucht W, WW, Paar" oder „Gutaussehender, sensibler Mann, 23, sucht W,<br />
WW, Paar oder Gruppe für Sex ohne Bindung, doch nicht ohne Seele. Bild? Garantiert<br />
zurück. KW: Nicht ohne Seele."<br />
16 Vgl. hierzu auch mein Eingangsvotum zur Sitzung der Sektion Familien- <strong>und</strong> Jugend<strong>soziologie</strong><br />
am Soziologentag in Ba<strong>mb</strong>erg, wiedergegeben im Mitteilungsblatt Nr.<br />
9 der Sektion.<br />
17 Zum Begriff der Aleatorik siehe z.B. die entsprechenden Artikel in „Die Musik in<br />
der Geschichte der Gegenwart", Bd. 15 (1973), 126-130 oder in Brockhaus-Riemann,<br />
Musiklexikon, 1978: 27 f. — Als Musikbeispiel: Witold Lutoslawski, Jeux<br />
Venetiens. Polskie Nagrania, SX0132.<br />
18 Im Unterschied zu Gergen wird hier das Konzept der Aleatorik als Kennzeichnung<br />
eines sozio-strukturellen Zusammenhanges, nicht als Qualität des Menschen verwendet.<br />
Siehe auch Gergen 1979.<br />
19 Der Prozeß der Sozialisation selbst stellt im übrigen ein Geschehen dar, das in gewisser<br />
Weise als die Verknüpfung von zwei „Perspektiven" aufgefaßt werden kann: Bezogen<br />
auf das Individuum sind mit Sozialisation alle Prozesse gemeint, durch die<br />
der einzelne im Umgang mit der Umwelt <strong>und</strong> mit sich selbst relativ dauerhafte Verhaltensweisen<br />
entwickelt, die es ihm ermöglichen, am <strong>gesellschaftliche</strong>n Leben teil-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
zuhaben <strong>und</strong> an seiner Veränderung mitzuwirken. Bezogen auf die Gesellschaft bezeichnet<br />
Sozialisation das differenzierte, auch widersprüchliche Zusammenwirken<br />
aller jener <strong>gesellschaftliche</strong>n Einrichtungen, die der Pflege <strong>und</strong> der Erziehung des<br />
Nachwuchses dienen oder sie beeinflussen (vgl. Lüscher 1982).<br />
20 Ich beziehe mich bei dieser Feststellung stark auf die Erfahrungen <strong>und</strong> Einsichten,<br />
die wir im Konstanzer Projekt „Lebenssituationen junger Familien" gewonnen haben,<br />
so gestützt auf die von Eltern gegebenen Schilderungen <strong>und</strong> Bewertungen der<br />
alltäglichen Lebensverhältnisse <strong>und</strong> der sozialen Beziehungen. Siehe hierzu die zuletzt<br />
erschienenen Berichte: Lüscher/Fisch/Pape 1983, Stein/Lüscher 1984, Gräbe/<br />
Lüscher 1984a, b, Lüscher/Fisch/Pape 1985 sowie das Referat von Gräbe (1985) im<br />
Rahmen der Sitzungen der Sektion Familien- <strong>und</strong> Jugend<strong>soziologie</strong> an diesem Soziologentag.<br />
21 Siehe dazu auch das Referat von Wehrspaun (1985), gehalten im Rahmen der Sitzungen<br />
der Sektion Familien- <strong>und</strong> Jugend<strong>soziologie</strong> an diesem Soziologentag.<br />
22 Die These, wonach über familienpolitische Maßnahmen <strong>und</strong> Einrichtungen „Familie"<br />
(bzw. Familientypen) gewissermaßen legitimiert <strong>und</strong> damit definiert werden,<br />
begründe ich ausführlicher in Lüscher 1984b. Siehe ferner das Referat von<br />
Schultheis (1985) im Rahmen der Sitzungen der Sektion Familien- <strong>und</strong> Jugend<strong>soziologie</strong><br />
an diesem Soziologentag sowie Schultheis 1983.<br />
LITERATUR<br />
Beck, U., ,Jenseits von Stand <strong>und</strong> Klasse? Soziale Ungleichheit, Gesellschaftliche Individualisierungsprozesse<br />
<strong>und</strong> die Entstehung neuer sozialer Formationen <strong>und</strong> Identitäten".<br />
In: R. Kreckel (Hg.), Soziale Ungleichheiten. Sonderheft 2 der Sozialen<br />
Welt. Göttingen 1983.<br />
Beck-Gernsheim, E., „Vom 'Dasein für andere' zum Anspruch auf ein Stück 'eigenes Leben':<br />
Individualisierungsprozesse im weiblichen Lebenszusammenhang". In: Soziale<br />
Welt 1983, 34, 307-340.<br />
Becker, H.S. et al., Boys in white. Chicago 1961.<br />
Berger, B./Berger, P., In Verteidigung der bürgerlichen Familie. Frankfurt 1984.<br />
Birg, H. et al., Arbeitsmarktdynamik <strong>und</strong> Familien<strong>entwicklung</strong>. Forschungsbericht. Universität<br />
Bielefeld: Institut für Bevölkerungsforschung <strong>und</strong> Sozialpolitik 1984 (verv.).<br />
Blancpain, R./Zeugin, P./Hanselmann, E., Erwachsen werden. Bern 1983.<br />
Bronfenbrenner, U., Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Stuttgart 1981.<br />
Bourdieu, P., Die feinen Unterschiede. Kritik der <strong>gesellschaftliche</strong>n Urteilskraft. Frankfurt<br />
1982.<br />
Buchmann, M., Konformität <strong>und</strong> Abweichung im Jugendalter. Diessenhofen 1983.<br />
Duhm, D., Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung — ZEGG —. Konzept eines<br />
ökologischen Dorfes als Forschungs- <strong>und</strong> Bildungszentrum. Lampertheim 1978.<br />
Familienpolitik in der Schweiz. Bern: Eidg. Drucksachen- <strong>und</strong> Materialzentrale 1982.<br />
Gergen, K.J. „Selbstkonzepte <strong>und</strong> Sozialisation des aleatorischen Menschen". In: Montada,<br />
L. (Hg.), Brennpunkte der Entwicklungspsychologie. Stuttgart 1979, <strong>35</strong>8-373.<br />
—, Toward transformation in social knowledge. New York/Berlin 1982.<br />
Gräbe, S., „Soziale Kontakte von Kindern in der Perspektive der Eltern. Vortrag auf<br />
dem 22. Deutschen Soziologentag in Dortm<strong>und</strong>, Oktober 1984". Gekürzte Fassung<br />
erscheint in: H.-W. Franz (Hg.), Materialienband: Beiträge aus den Sektions- <strong>und</strong><br />
Ad-hoc-Veranstaltungen des 22. Deutschen Soziologentages Dortm<strong>und</strong>, 9.-12. Oktober<br />
1984, Opladen.<br />
Gräbe, S./Lüscher, K., „Soziale Beziehungen junger Eltern". In: Zeitschrift für Sozialisationsforschung<br />
<strong>und</strong> Erziehungs<strong>soziologie</strong>, 1984a, 4, 99-121.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Gräbe, S./Lüscher, K., „Soziale Beziehungen alleinerziehender <strong>und</strong> verheirateter Mütter".<br />
In: Zentralblatt für Jugendrecht, 1984b, 71, 492-497.<br />
Hermann, U. et al., Bibliographie zur Geschichte der Kindheit, Jugend <strong>und</strong> Familie.<br />
<strong>München</strong> 1980.<br />
Hildenbrand, U. et al., „Biographiestudien im Rahmen von Milieustudien". In: Kohli,<br />
M./Robert, G. (Hg.), Biographie <strong>und</strong> soziale Wirklichkeit. Stuttgart 1984, 29-52.<br />
Hoffmann-Nowotny, HJ., „Auf dem Weg zur autistischen Gesellschaft". In: Rupp, S.<br />
et al. (Hg.), Eheschließung <strong>und</strong> Familienbildung heute. Wiesbaden 1980, 161-180.<br />
Jugend '81. Frankfurt: Deutsche Shell 1983.<br />
Kohli, M., „Thesen zur Geschichte des Lebenslaufs". In: Conrad, C./Kondratowitz von,<br />
HJ. (Hg.), Gerontologie <strong>und</strong> Sozialgeschichte. Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen<br />
1983, 133-147.<br />
Krappmann, L., „Mead <strong>und</strong> die Sozialisationsforschung". In: Joas,J. (Hg.), G.H. Mead.<br />
Sein Beitrag zur sozialwissenschaftlichen Theoriebildung <strong>und</strong> Forschung. Frankfurt<br />
1985.<br />
Lüscher, K., „Ökologie <strong>und</strong> menschliche Entwicklung in soziologischer Sicht — Elemente<br />
einer pragmatisch-ökologischen Sozialisationsforschung". In: Vaskovics, L. (Hg.),<br />
Umweltbedingungen familialer Sozialisation. Stuttgart 1982, 73-95.<br />
—, „Die Schweizer Familien der achtziger Jahre". In: Neue Zürcher Zeitung. Nr. 244,<br />
19. Oktober 1983.<br />
—, „Die Familien der 80er Jahre als Herausforderung an die Sozialwissenschaften". In:<br />
Cassée, P. et al. (Hg.), Betrifft: Sozialpädagogik in der Schweiz. Bern 1984a, 341-<br />
<strong>35</strong>7.<br />
—, „Perspektiven einer neuen Familienpolitik". In: Deutscher Caritasverband (Hg.),<br />
Der Sozialstaat in der Krise? Freiburg 1984b, 156-168.<br />
—, „Fernsehen — Familie — Gesellschaft. Elemente einer Medienökologie". In: Ringeling,<br />
H./Svilar, M. (Hg.), Die Welt der Medien. Probleme der elektronischen Kommunikation.<br />
Berner Universitätsschriften. Bern: Haupt 1984c, 39-53.<br />
—/ Böckle, F., „Familie". In: Enzyklopädische Bibliothek „Christlicher Glaube in<br />
moderner Gesellschaft", Teilband 7, Freiburg 1981, 87-145.<br />
—/ Fisch, R./Pape, T., „Die Lebenssituationen junger Familien im Urteil der Eltern".<br />
In: Soziale Welt 1983, 34, 450-470.<br />
— et al., Sozialer Wandel <strong>und</strong> familiale Veränderungen. Arbeitspapier der Arbeitsgruppe<br />
Familienforschung an der Universität Konstanz, 1984.<br />
—/ Fisch, R./Pape, T., „Die Ökologie von Familien". In: Zeitschrift für Soziologie 1985,<br />
14, 13-27.<br />
Mesmer, B., Familien- <strong>und</strong> Haushaltskonstellationen, „Fragen an die Rechtsgeschichte".<br />
In: Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte 1984, 1-18.<br />
Nave-Herz, R., Familiäre Veränderungen seit 1950. Eine empirische Studie. Projektbericht.<br />
Universität Oldenburg. Institut für Soziologie 1984.<br />
Raiser, K., Identität <strong>und</strong> Sozialität. <strong>München</strong> 1971.<br />
Rerrich, M.A., „Veränderte Elternschaft. Entwicklungen mit der familialen Arbeit mit<br />
Kindern seit 1950". In: Soziale Welt 1983, 34, 420-449.<br />
Ringeling, H./Svilar, M. (Hg.), Die Welt der Medien. Probleme der elektronischen Kommunikation.<br />
Berner Universitätsschriften. Bern 1984.<br />
Roussel, L., La famille apres le mariage des enfants. Paris 1976.<br />
Schultheis, F., „Französische Familienpolitik im Wandel. Formen <strong>und</strong> gesellschaftspolitische<br />
Funktionen der „Politique Familiale" vor <strong>und</strong> nach der sozialistischen Regierungsübernahme".<br />
In: Zeitschrift für Sozialisationsforschung <strong>und</strong> Erziehungs<strong>soziologie</strong><br />
1982, 2, 306-310.<br />
Schultheis, F., „Mutter, Kind <strong>und</strong> Vater Staat — historische Ursprünge des gesellschaftspolitischen<br />
Interesses an alleinerziehenden Müttern <strong>und</strong> ihren Kindern. Vortrag auf<br />
dem 22. Deutschen Soziologentag in Dortm<strong>und</strong>, Oktober 1984". Gekürzte Fassung<br />
erscheint in: H.-W. Franz (Hg.), Materialienband: Beiträge aus den Sektions- <strong>und</strong><br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Ad-hoc-Veranstaltungen des 22. Deutschen Soziologentages Dortm<strong>und</strong>, 9.-12. Oktober<br />
1984, Opladen 1985.<br />
Schwab, D., „Familie". In: Brunner, O. et al. (Hg.), Geschichtliche Gr<strong>und</strong>begriffe. Bd.<br />
II, 1975, 253-301.<br />
Schwarz, K., „Eltern <strong>und</strong> Kinder in unvollständigen Familien". In: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft<br />
1984, 10, 3-36.<br />
Sennett, R., Verfall <strong>und</strong> Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität.<br />
Frankfurt 1983.<br />
Shibutani, T., Society and personality. New York 1961.<br />
Stein, A./Lüscher, K., „Familienrollen in der Perspektive junger Eltern". In: Familiendynamik<br />
1984, 9, 217-241.<br />
Sturm, H., „Einflüsse des Fernsehens auf die Entwicklung des Kindes". In: Ringeling<br />
H./Svilar, M. (Hg.), Die Welt der Medien. Probleme der elektronischen Kommunikation.<br />
Berner Universitätsschriften. Bern 1984, 55-69.<br />
Tyrell, H., Nicht-eheliche Lebensgemeinschaften in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland.<br />
Literaturbericht. Bonn: B<strong>und</strong>esministerium für Jugend, Familie <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit<br />
1985 (Schriftenreihe BMJFG Bd. 170).<br />
Wehrspaun, M., Konstruktive Argumentation <strong>und</strong> interpretative Erfahrung. Bausteine<br />
zur Neuorientierung der Soziologie. Opladen 1985.<br />
—, „Was heißt „ökologische Validität"? — Überlegungen zu einer konstruktiv-pragmatistischen<br />
Orientierung in der Familien<strong>soziologie</strong>. Vortrag auf dem 22. Deutschen<br />
Soziologentag in Dortm<strong>und</strong>, Oktober 1984". Gekürzte Fassung erscheint<br />
in: H.-W. Franz (Hg.), Materialienband: Beiträge aus den Sektions- <strong>und</strong> Ad-hoc-<br />
Veranstaltungen des 22. Deutschen Soziologentages Dortm<strong>und</strong>, 9.-12. Oktober<br />
1984, Opladen 1985.<br />
Wingen, M., Nichteheliche Lebensgemeinschaften. Zürich 1984.<br />
Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen beim B<strong>und</strong>esministerium für Jugend, Familie<br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit, Familie <strong>und</strong> Arbeitswelt. Stuttgart 1984.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
UNENTGELTLICHE ARBEIT IM LEBENSZUSAMMENHANG VON<br />
FRAUEN UND DEREN REFLEXION IN DEN SOZIALWISSEN<br />
SCHAFTEN<br />
Ursula Beer<br />
Unentgeltliche Frauenarbeit ist in letzter Zeit zu unerwarteten wissenschaftlichen<br />
<strong>und</strong> politischen Ehren gekommen; Probleme des Arbeitsmarkts <strong>und</strong><br />
die Leere öffentlicher Kassen haben deren Entdeckung geradezu provoziert.<br />
Allerdings: „entdeckt" wird deren <strong>gesellschaftliche</strong>r Nutzen, nicht dagegen<br />
die hierzu in Widerspruch stehende Unentgeltlichkeit <strong>und</strong> deren Folgen für<br />
Frauen im System der sozialen Sicherung.<br />
Zum Verständnis der Bedeutung der gegenwärtigen Diskussion um unentgeltliche<br />
Frauenarbeit wird in diesem Beitrag versucht, deren historischen<br />
Wandel in die Analyse einzubeziehen, erstens im Hinblick auf ihre Institutionalisierung,<br />
zweitens durch einen retrospektiven Blick auf die b<strong>und</strong>esdeutsche<br />
Nachkriegs<strong>soziologie</strong>, dem übergreifenden Thema des Forums<br />
„Gesellschaftliche Entwicklung von Lebenszusammenhängen". Vielleicht<br />
erlaubt diese doppelte historische Perspektive eine genauere Verortung<br />
des politischen <strong>und</strong> sozialwissenschaftlichen Stellenwerts dieser Form von<br />
Arbeit, als sie bisher möglich ist.<br />
Zunächst drei Fragestellungen zum Thema: 1. Warum wird unentgeltliche<br />
Familienarbeit — denn von ihr ist im folgenden Text vorwiegend die<br />
Rede — in der Regel von Frauen erwartet <strong>und</strong> geleistet? 2. Wie ist sie institutionell<br />
abgesichert? 3. In welchem Sinne läßt sich von einem <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Nutzen aus dieser Arbeit sprechen? Hierzu drei Thesen, die im folgenden<br />
erläutert werden: 1. Von Ehe- bzw. Familienhausfrauen wird unentgeltliche<br />
familiale Arbeit erwartet, weil deren biologische Fähigkeit zur<br />
Mutterschaft in die soziale Verpflichtung zur Versorgung von Kindern <strong>und</strong><br />
anderen umgedeutet wird <strong>und</strong> weil diese <strong>und</strong> andere Formen von Familienarbeit<br />
hohen ökonomischen Wert besitzen. 2. Institutionell ist diese Form<br />
von Arbeit durch die juristische Verfügung über die Arbeitskraft von Ehefrauen<br />
<strong>und</strong> Müttern im Familien- <strong>und</strong> Unterhaltsrecht abgesichert. Der <strong>gesellschaftliche</strong><br />
<strong>und</strong> hier wiederum primär ökonomische Nutzen dieser Arbeit<br />
ist darin zu sehen, daß Frauen in der Familie Leistungen in Form von<br />
Kinderversorgung, Alten- <strong>und</strong> Krankenpflege zur Verfügung stellen, die über<br />
die Marktökonomie nicht finanzierbar sind. Deren gesamt<strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Nutzen unterliegt den Kriterien der Verfügung oder Nicht-Verfügung über<br />
Produktionsmittel.<br />
Obwohl die Unentgeltlichkeit nicht-marktförmig organisierter Formen<br />
von Frauenarbeit in der aktuellen Diskussion eher am Rande behandelt wird,<br />
so durchzieht das Kalkül mit „umsonst" erbrachten Leistungen doch die ge-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
samte Debatte. Die Ausweitung von Familienarbeit (Beck-Gernsheim 1984)<br />
<strong>und</strong> von ehrenamtlicher Sozialarbeit (Balluseck 1984) verspricht in dem<br />
Sinne zur Lösung von Arbeitsmarkt- <strong>und</strong> Fiskalproblemen des Staates beizutragen,<br />
daß der Rückzug verheirateter Frauen <strong>und</strong> Mütter vom Erwerbsleben<br />
den Arbeitsmarkt entlasten <strong>und</strong> die Beschränkung von Frauen auf die<br />
Familie die Eigenleistung von Haushalten erhöhen könnte. Und eben diese<br />
Erwartung der Erhöhung der „Haushaltsproduktivität" ist verräterisch: ist<br />
sie doch nur möglich durch die gesteigerte Arbeitsleistung von Hausfrauen,<br />
d.h. durch den unentgeltlichen Einsatz von Familienarbeitskraft. Analoges<br />
gilt für ehrenamtliche Sozialarbeit. Auch hier soll unentgeltliche Arbeit<br />
partiell verberuflichte Sozialarbeit ersetzen, dies im Rahmen der Forderung,<br />
die Familienhausfrau möge sich — quasi als Berufsersatz — für ehrenamtliche<br />
Sozialarbeit zur Verfügung stellen, sofern <strong>und</strong> sobald sie nicht (mehr)<br />
mit Erziehungsaufgaben, Altenversorgung <strong>und</strong>/oder Krankenpflege in der<br />
Familie ausgelastet ist.<br />
Es kann jedoch nicht darum gehen, das an Frauen gerichtete Ansinnen<br />
zu beklagen, sie möchten sich ehrenamtlicher Sozial- <strong>und</strong> Familienarbeit<br />
widmen, um B<strong>und</strong>, Länder <strong>und</strong> Kommunen von drängenden sozialen Problemen<br />
<strong>und</strong> Aufgaben zu entlasten, nur um für Ehefrauen einen Schonraum<br />
zu fordern, in dem sie frei von außerhäuslichen <strong>gesellschaftliche</strong>n Verpflichtungen<br />
leben können: nicht ganz zu Unrecht wird die (kinderlose) Ehefrau<br />
gelegentlich als „an unjustified financial bürden on the Community" bezeichnet<br />
(Cuvillier 1979). Vielmehr geht es um den Hinweis auf Tendenzen,<br />
daß sich — so im Rahmen der Selbsthilfe-Diskussion — unter progressiven<br />
Vorzeichen eine Verstärkung der tradierten geschlechtlichen Arbeitsteilung<br />
anbahnt: Verberuflichte Leistungen sollen in die Familie „zurückgeholt"<br />
oder in Nachbarschaftshilfe erbracht werden, der Ausfall (z.B. Schüler-<br />
Bafög) oder die Minderung (z.B. Mutterschaftsgeld) von Transferzahlungen<br />
durch unentgeltliche Familienarbeit ausgeglichen werden. Selbst wenn sie<br />
nicht ausdrücklich erwähnt werden, gemeint ist die Arbeit von Frauen.<br />
Und mehr noch: deren unentgeltliche Arbeit wird häufig den Selbsthilfe-<br />
Bestrebungen derjenigen zugeschlagen, die neue Formen der Arbeits- <strong>und</strong><br />
Lebensgestaltung erproben. Indirekt ist der Bezug auf unentgeltliche Frauenarbeit<br />
insofern, als das Selbsthilfe-Potential der Familie in einem Atemzug<br />
mit individueller Selbsthilfe genannt wird; aber immer handelt es sich<br />
um jene Familienleistungen, die traditionell von Frauen erbracht werden,<br />
zumeist auch in neuen Lebensformen. Nicht sich selbst sollen die Frauen<br />
helfen, sondern die Institution Familie stärken (1). Kritik gilt vor allem<br />
auch den Bestrebungen liberal-konservativer Politik, unter Berufung auf<br />
familiale Formen der „Selbsthilfe" <strong>und</strong> auf das Subsidaritätsprinzip die<br />
öffentlichen Haushalte sanieren zu wollen (2).<br />
Zu kritisieren ist jedoch noch ein zweiter Sachverhalt. In der konservativen<br />
Variante der Selbsthilfe-Diskussion wird unentgeltliche Frauenarbeit<br />
häufig als (kostengünstiges) Emanzipationspotential vorgestellt; der realen<br />
Entfremdung in der Arbeitswelt wird die Möglichkeit der Selbstverwirkli-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
chung in der Familie <strong>und</strong> in sozialen Diensten gegenübergestellt. Unter der<br />
Hand wird zugleich vermittelt, geschlechtliche Arbeitsteilung ermögliche<br />
Frauen deren Selbstverwirklichung, statt sie zu blockieren; so etwa der heutige<br />
B<strong>und</strong>eskanzler Kohl in einer Rede 1976: Es geht für die Frauen<br />
nicht darum, nach männlichen Maßstäben gleichzuziehen, sondern als der<br />
andere Mensch angenommen zu werden, der er eben ist. Die Frau hat eigene<br />
Möglichkeiten der Erfüllung des Lebens, welche dem Mann nicht gegeben<br />
sind." (Geißler 1979, S. 39, Herv. U.B.). Geschlechtliche Arbeitsteilung<br />
wird so zu anthropologischen Konstante der Geschlechterdifferenz erhoben,<br />
ihre <strong>gesellschaftliche</strong> Bedeutung verschleiert.<br />
An dieser Entwicklung sind die Sozialwissenschaften nicht unbeteiligt,<br />
auch fehlt es schlicht an interdisziplinärer Forschung. Von Ausnahmen<br />
abgesehen (Horkheimer 1936), wurde die Arbeit der Frau in der Familie<br />
— als Erziehungs- <strong>und</strong> Pflegeleistung, als Hausarbeit, als betriebliche Mitarbeit<br />
— von der Soziologie bis zur Durchsetzung der Frauenforschung sträflich<br />
vernachlässigt. Die Klage darüber von einigen wenigen Familiensoziologen,<br />
Familienpolitikforschern <strong>und</strong> Haushaltswissenschaftler(n)/innen reicht<br />
zurück bis in die 50er Jahre, so bei König (1946), Egner (1952), Oeter<br />
(1954 <strong>und</strong> 1960), Bühler (1961), Schmucker (1961).<br />
Daß die familiale Ökonomie (3) seit kurzem politisch <strong>und</strong> wissenschaftlich<br />
aufgewertet wird, dürfte sich allerdings kaum dem spontanen Bedürfnis<br />
nach Vervollständigung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung verdanken<br />
— sie wird neuerdings jedoch angestrebt (4). Eher geht es darum, ihren<br />
Wert im Sinne unentgeltlicher Leistungen zu betonen <strong>und</strong> hervorzuheben.<br />
Das soziologische <strong>und</strong> volkswirtschaftliche Bestreben, unentgeltliche Frauenarbeit<br />
aus ihrem Schattendasein herauszuholen, erzeugt jedoch auch Unbehagen.<br />
Sie scheint im Begriff zu sein, zu einer neuen Selbstverständlichkeit<br />
zu werden. War die Familienarbeit der Frau bis vor wenigen Jahren<br />
noch nicht einmal als Arbeit definiert, wird sie heute emphatisch als Leistung<br />
ersten Ranges gepriesen. Und eben dieses Lob macht mißtrauisch:<br />
Etabliert sich unentgeltliche Frauenarbeit — etwa unter dem Begriff der<br />
„Haushaltsproduktion" (Glatzer 1984) — als gleichgewichtiger Beitrag zum<br />
Sozialprodukt neben marktvermittelten Gütern <strong>und</strong> Dienstleistungen?<br />
Droht sich hier die Ideologie breitzumachen, unentgeltliche Leistungen<br />
seien in Tauschgesellschaften ebenso selbstverständlich wie entgeltliche, die<br />
daraus resultierende ökonomische <strong>und</strong> soziale Abhängigkeit zwar bedauerlich,<br />
jedoch unvermeidlich? Je selbstverständlicher eine Verhaltensweise, so<br />
Dieter Ciaessens (1962), desto wichtiger der dahinterstehende <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Wert; unter diesem Gesichtspunkt ist die bisherige wissenschaftliche<br />
Vernachlässigung unentgeltlicher Frauenarbeit kaum Gedankenlosigkeit.<br />
Eher ist anzunehmen, daß auf dem Umweg der sozialpolitischen Diskussion<br />
um leere Kassen <strong>und</strong> fehlende Arbeitsplätze plötzlich ein Thema Eingang in<br />
die wissenschaftliche Diskussion findet, das mit dem Gr<strong>und</strong>konsens tauschorientierter<br />
Industriegesellschaften nicht kompatibel ist: die unentgeltlichen<br />
Leistungen von Frauen in einer Gesellschaftsordnung, die als gr<strong>und</strong>le-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
genden Wert die leistungsgerechte Entlohnung jeder Arbeit (<strong>und</strong> jedes Produktionsfaktors)<br />
für sich in Anspruch nimmt. Um es noch einmal zu betonen:<br />
Kritik gilt nicht der Tatsache, daß in dieser Gesellschaft nicht alle Leistungen<br />
entgolten werden, sondern daß eine Interdependenz zwischen entgeltlicher<br />
<strong>und</strong> unentgeltlicher Arbeit existiert — primär in der Familie —,<br />
die diejenigen von der Partizipation an monetären <strong>und</strong> prestige-trächtigen<br />
Gratifikationen ausschließt, die sie ausüben, <strong>und</strong> daß diese Trennungslinie<br />
zwischen den Geschlechtern verläuft.<br />
In den Gründerjahren der deutschen Familien<strong>soziologie</strong> sprach man<br />
noch emphatisch von der Frau als Sachverwalterin <strong>und</strong> Hüterin des Haushalts,<br />
vom Hauptberuf der Frau als Hausfrau <strong>und</strong> Mutter, von der Frau als<br />
Wahrerin der familialen Gesamtinteressen (Wurzbacher 1952, Schelsky<br />
1953, Oeter 1954, Mayntz 1955). Lediglich Rene König fragte kritisch,<br />
wieso Mutterschaft <strong>und</strong> Hausfrauentätigkeit für die Frau ein Beruf sein soll:<br />
Indem man deren biologische Funktion zu einem Beruf erhob, habe das<br />
Verhältnis der Geschlechter die vielleicht verhängnisvollste Belastung der<br />
Geschichte erfahren (König 1967, S. 34).<br />
Die zunächst intuitive Verbindung von Hausfrauentätigkeit <strong>und</strong> Mutterschaft<br />
in Politik <strong>und</strong> Wissenschaft wurde von Soziologie <strong>und</strong> Haushaltswissenschaften<br />
in späteren Jahren aufgegriffen, so im Rahmen der Frage, warum es<br />
selbstverständlich sei, daß allein die Ehefrau <strong>und</strong> Mutter für Kinderversorgung<br />
<strong>und</strong> Haushalt als zuständig erklärt werde. Rosemarie v. Schweitzer wies wiederholt<br />
auf die Zeitgeb<strong>und</strong>enheit dieses Sachverhaltes hin <strong>und</strong> betonte, durch<br />
die Geschichte hindurch sei zu beobachten, daß diese Arbeiten stets rangniederen<br />
Personen übertragen wurden (Schweitzer 1981, S. 179).<br />
Einer soziologischen Erklärung dieses Sachverhaltes bereitete Friedhelm<br />
Neidhardt den Weg, als er sich Anfang der 70er Jahre mit dem Bedarf<br />
an <strong>gesellschaftliche</strong>n Normen befaßte, die die für das Kind notwendigen<br />
Dauerpflegeleistungen als moralische Verpflichtung einer bestimmten <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Gruppe definieren: Am leichtesten begründbar sei sie für<br />
die Mutter, denn diese habe schließlich das Kind in die Welt gesetzt (Neidhardt<br />
1970). Mehr als zehn Jahre später erweiterte Hartmann Tyrell diesen<br />
Gedanken um die Fragestellung, wie stark eine Gesellschaft das Prinzip der<br />
„leiblichen Elternschaft" institutionalisiere <strong>und</strong> hierüber die Zuständigkeiten<br />
für die Kinderaufzucht reguliere. Die funktionale Differenzierung von<br />
Betrieb <strong>und</strong> Familie sei in der bürgerlichen Kultur mit familialer Arbeitsteilung<br />
verknüpft, die die Frau auf Haushalt <strong>und</strong> Kinder verweise, legitimiert<br />
über die natürlichen Mutterpflichten (Tyrell 1981). Dieses Argument<br />
ging über Neidhardts Position hinaus, indem der Bedarf an <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Normen mit der Notwendigkeit institutioneller Arrangements zur<br />
Sicherung dieser Arbeitszuweisung verb<strong>und</strong>en wurde. In jüngster Zeit wurde<br />
— aus konservativer Perspektive — ein weiteres Argument vorgetragen,<br />
das möglicherweise zu aussagekräftigen Ergebnissen führt: Die Dauerpflegeleistungen<br />
von Müttern als Bestandteil familialer Funktionen seien eigentliche<br />
solche der Ehe (Siebel 1984).<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Siebeis Unterscheidung zwischen „Familie" <strong>und</strong> „Ehe" als einer Institution<br />
öffentlichen Charakters dürfte es erlauben, den inneren Zusammenhang<br />
von Mutterschaft <strong>und</strong> unentgeltlicher Familienarbeit nicht nur im<br />
Rahmen normativer Vorstellungen aufzuzeigen, sondern gleichzeitig deren<br />
<strong>gesellschaftliche</strong> Institutionalisierung <strong>und</strong> ihren gesamtwirtschaftlichen<br />
Nutzen genauer auszuweisen. In der bürgerlichen Gesellschaft, so die hier<br />
vertretene These, erfolgt die Institutionalisierung dieser Arbeit über die<br />
rechtlich abgesicherte Verfügung des Mannes über die Arbeitskraft der<br />
Frau. Diese Form der Verfügung verlor im Zuge der Gleichberechtigungsgesetzgebung<br />
ihre Konturen, am materialen Gehalt hat sich demgegenüber<br />
nicht allzuviel geändert. Allerdings hat Jutta Li<strong>mb</strong>ach kürzlich davor gewarnt,<br />
die Orientierungskraft von Rechtsnormen zu überschätzen. Im Gr<strong>und</strong>e<br />
genommen würden Sitte <strong>und</strong> Norm gesellschaftsprägenderen Einfluß ausüben<br />
als diese (5). Der Hinweis ist wichtig, um der naiven Gleichsetzung<br />
von Rechtsnorm mit deren faktischer Handhabung vorzubeugen. Gleichzeitig<br />
besteht unbestreitbar ein struktureller Zusammenhang zwischen<br />
Rechtsnormen, die die Nutzung familialer — weiblicher — Arbeitskraft<br />
zur Sicherung bestimmter familialer „Funktionen" regulieren, <strong>und</strong> der<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>n Situation von Haus- bzw. Ehefrauen, die durch den Ausschluß<br />
vom Zugang zu Tauschmitteln gekennzeichnet ist: individuell <strong>und</strong><br />
gesellschaftlich sind diese Rechtsnormen ähnlich folgenreich wie jene in<br />
Verbindung mit arbeitsvertraglichen Regelungen (ohne hier Arbeits- <strong>und</strong><br />
Ehevertrag gleichsetzen zu wollen). Wenn ich diese Parallele hier ziehe,<br />
dann zur Akzentuierung einer sozial-ökonomischen Dimension der bürgerlichen<br />
Familie, die bisher wenig erforscht ist: Im folgenden werden Verbindungslinien<br />
zwischen der Ehe als einer Einrichtung von öffentlichem<br />
Charakter <strong>und</strong> der Institutionalisierung unentgeltlicher Familienarbeit<br />
skizziert; andere — ähnlich wichtige — Fragestellungen bleiben zunächst<br />
ausgespart (6).<br />
Die Abhängigkeit des Familienrechts von den ökonomischen Bedingungen<br />
industrialisierter Gesellschaften wurde 1974 von Heinrich Dörner umfassend<br />
dargestellt; für die neuere Entwicklung sei auf die Ausführungen<br />
von Sachße/Tennstedt (1982) verwiesen. Ähnlich der Familien<strong>soziologie</strong>,<br />
die mütterliche Sozialisationsleistungen zwar nicht mehr als „naturgegeben"<br />
betrachtet, allerdings nach wie vor die Frage nach den Gründen <strong>und</strong> Mechanismen<br />
geschlechtlicher Arbeitsteilung ausspart, vernachlässigen jedoch<br />
auch diese Autoren die Analyse des Sachverhalts, der hier zu akzentuieren<br />
versucht wird: daß Verfügungen über den Einsatz von Arbeitskraft nicht allein<br />
Merkmal der Markt-, sondern ebenso der Familien-Ökonomie sind.<br />
Bereits im Allgemeinen Landrecht der Preußischen Staaten (ALR) galten<br />
Mütter als zuständig für die Kinderaufzucht, im Rahmen der Festlegung,<br />
daß Ehefrauen ihre Arbeitskraft der Familie (<strong>und</strong> deren „Oberhaupt")<br />
als Wirtschafts- <strong>und</strong> Lebensgemeinschaft zur Verfügung stellen mußten; die<br />
Ausübung außerhäuslicher Arbeit <strong>und</strong> eigene Gewerbetätigkeit unterlagen<br />
der Genehmigung durch den Ehemann. Die Arbeits- <strong>und</strong> Dienstpflicht der<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Ehefrau erstreckte sich insofern nicht allein auf den Haushalt im engeren<br />
Sinn, sondern zugleich auf das Gewerbe des Mannes, dem auch der Ertrag<br />
aus ihrer Arbeit zufiel. Als Gegenleistung stand ihr standesgemäßer Unterhalt<br />
zu. Dem ALR zufolge bildete die biologische Funktion der Frau, d.h.<br />
ihre Gebärfähigkeit, zusammen mit ihrem Arbeitsvermögen ein Potential,<br />
das der patriarchalen Haus- <strong>und</strong> Erwerbsgemeinschaft voll zur Verfügung<br />
stand.<br />
Die unentgeltliche Dienstpflicht der Frau wurde ins Familienrecht des<br />
BGB übernommen, ebenso die Verpflichtung zur Kinderversorgung (7).<br />
Mit Recht weisen Sachße/Tennstedt darauf hin, daß die Systematik des<br />
Unterhaltsrechts auf die Bedürfnisse von Produktionsmittelbesitzern zugeschnitten<br />
war: Kinder wurden unterhalten, um im Alter den Lebensbedarf<br />
der Eltern zu sichern; freilich fehlt ihrer Argumentation der Hinweis, daß<br />
auch die im Familienrecht festgelegte Arbeits- <strong>und</strong> Dienstpflicht der Ehefrau<br />
deren Erfordernissen entsprach: sie trug durch ihre Arbeit zur Vermögensbildung<br />
bei, <strong>und</strong> das um so mehr, je stärker sie in das Gewerbe des Mannes<br />
eingeb<strong>und</strong>en war.<br />
Mit der Konstitution der Lohnarbeiterschaft im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>und</strong><br />
der Beseitigung von Heiratsverboten <strong>und</strong> Ehebeschränkungen, mit der Gewinnung<br />
politischer Rechte insgesamt, wurden legale Familiengründungen<br />
auch dem Proletariat allgemein möglich. Formal unterlag die Proletarierin<br />
denselben Verfügungen über ihre Arbeitskraft wie die Bauers- oder Handwerkersfrau,<br />
allerdings mit unterschiedlicher <strong>gesellschaftliche</strong>r Zielsetzung.<br />
Sie sollten einerseits weiterhin die familiale Arbeitsteilung sichern, andererseits<br />
den Bedürfnissen der Industrie Rechnung tragen. Sofern die proletarische<br />
Familie auf den Verdienst der Ehefrau angewiesen war — <strong>und</strong> das war<br />
in der Regel der Fall —, konnte der Ehemann das ihm zugestandene Recht<br />
auf deren persönliche Dienstleistungen nur schwer durchsetzen, so daß von<br />
einer partiellen Verlagerung der ökonomischen Tätigkeit der Ehefrau aus<br />
der Familie in Industrie <strong>und</strong> Gewerbe gesprochen werden kann. Die familiale<br />
Arbeitsteilung wurde primär dadurch aufrechterhalten, daß nach wie<br />
vor die Frau allein für die Kinderversorgung verantwortlich blieb <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
im Rahmen ihrer Haushaltstätigkeit erbrachte. Sie dienten jedoch<br />
nicht der eigenen Altersversorgung <strong>und</strong> der familialen Vermögensbildung,<br />
wie noch in der agrarischen Familienökonomie oder in den Selbständigen-Haushalten<br />
des Industriezeitalters.<br />
Der Vergleich von lohnabhängigen Ehefrauen mit den Ehefrauen von —<br />
oft bescheidenen — Produktionsmittelbesitzern zeigt, daß mit der Industrialisierung<br />
<strong>und</strong> dem auf deren Erfordernisse abgestimmten Familien- <strong>und</strong><br />
Unterhaltsrecht der familialen Verfügung über die Arbeitskraft von Frauen<br />
eine über die Familie hinausgehende Bedeutung zukam. Sie hatte Kinder<br />
<strong>und</strong> zugleich Arbeitskräfte für die Industrie großzuziehen, sie unterlag der<br />
häuslichen Arbeitspflicht <strong>und</strong>, meist aus ökonomischer Notwendigkeit, den<br />
Bedingungen von Erwerbsarbeit. Ihre Arbeitskraft verblieb partiell unter<br />
patriarchaler Verfügung im Familienbereich <strong>und</strong> wurde gleichzeitig freige-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
setzt für kapitalistische Verwertungsinteressen. Hier lassen sich die Verflechtungen<br />
von einer patriarchal <strong>und</strong> kapitalistisch organisierten Gesellschaft<br />
deutlich identifizieren: Die patriarchale Verfügung über die Arbeitskraft<br />
der Ehefrau diente zweifells zugleich Kapitalverwertungsinteressen —<br />
der Bereitstellung künftiger Arbeitskräfte, der Versorgung des lohnarbeitenden<br />
Ehemannes —, <strong>und</strong> umgekehrt läßt sich unschwer nachweisen, daß<br />
die industrielle Verfügung über die Arbeitskraft der proletarischen Frau<br />
(nicht nur der Ehefrau) durchzogen war von patriarchalem (individuellem<br />
<strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong>m) Interesse an der Aufrechterhaltung der Geschlechterhierarchie<br />
auch außerhalb des familialen Bereichs. (Auf den Zusammenhang<br />
zwischen familialer Vermögensbildung <strong>und</strong> Kapitalverwertungsinteresse<br />
in sog. Selbständigen-Haushalten kann an dieser Stelle nicht eingegangen<br />
werden. Dort sind patriarchale <strong>und</strong> kapitalistische Interessen an der<br />
Nutzung von Arbeitskraft auf noch andere Weise miteinander verknüpft<br />
(vgl. Beer 1984)).<br />
An der rechtlich abgesicherten Verfügung über die Arbeitskraft von<br />
Ehefrauen änderte sich wenig bis in die Nachkriegszeit. Einen Einbruch in<br />
die patriarchale Familienverfassung versprach die Gleichberechtigungsgesetzgebung<br />
des Jahres 1957. Was sich änderte, war die Terminologie, nicht<br />
der Inhalt von Gesetzesbestimmungen. Die biologistische Begründung für<br />
die Zuordnung der Frau zum Haushalt qua Mutterschaft blieb erhalten, aus<br />
dem Gesetzestext verschwand dagegen der Hinweis auf die Arbeitspflicht<br />
der Frau im Haushalt <strong>und</strong> Gewerbe des Mannes. Sie wurde — durchaus einfallsreich<br />
— nunmehr als Unterhaltspflicht ausgewiesen. „Wir verstehen<br />
heute", so 1958 der angesehene Familienrechtler Gernhuber, „unter dem<br />
Begriff 'Unterhalt' nicht mehr nur eine Bedürfnisbefriedigung durch den<br />
Einsatz von Geld, so daß auch die Mitarbeit im Geschäft oder Beruf des<br />
Partners in Erfüllung der Unterhaltspflicht erfolgen kann, ohne notwendig<br />
eine Verbindung zum Unterhaltsrecht aufzuweisen" (Gernhuber 1958, S.<br />
247). Und zur Umdeutung der Hausarbeitspflicht in eine Unterhaltsverpflichtung<br />
Eißer 1959: „Durch die Haushaltsführung erfüllt die Ehe<br />
8<br />
frau ... im Regelfall ihre Verpflichtung, durch Arbeit zum Unterhalt der<br />
Familie beizutragen. Diese Wertung der Hausfrauenarbeit als Unterhaltsbeitrag<br />
für den Familienunterhalt bringt das Schaffen <strong>und</strong> Wirken der<br />
Hausfrau, das bisher nur nebenbei <strong>und</strong> ohne Beziehung auf die Unterhaltspflicht<br />
erwähnt war, zur verdienten rechtlichen Anerkennung" (Eißer 1959,<br />
S. 1979, Hervorh. i.Orig.). Auch hinsichtlich der Kinderversorgung hielten<br />
Familienrechtler an der traditionellen Arbeitsteilung fest: „Die Pflicht, für<br />
Kinder zu sorgen, wird bei der Kollision mit der Pflicht, durch Erwerbstätigkeit<br />
zum Familienunterhalt beizutragen, regelmäßig stärker sein. Die<br />
Frau ist die natürliche Betreuerin ihrer Kinder" (Brühl 1957, S. 279). Ein<br />
Kommentar zur Gleichberechtigungsgesetzgebung des renommierten Familienrechtlers<br />
Bosch beseitigte mögliche Zweifel, es könne sich allzuviel<br />
ändern: „... der Kunstgriff der Umformung des Unterhaltsbegriffs — im<br />
Gr<strong>und</strong>e nur eine Bestätigung der natürlichen Ordnung! —" verdanke sich<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
gesetzestechnischen Bedürfnissen; lakonisch stellte er fest: „... gleiche Verpflichtung<br />
(ist) keineswegs „dieselbe" Verpflichtung; Gleichberechtigung<br />
bedeutet nicht Identität der Rechtspositionen" (Bosch 1958, S. 83).<br />
Diese Hinweise sind wichtig zum Verständnis der historischen Entwicklung<br />
der familialen Arbeitspflicht von Ehefrauen. In neutralen Begriffen<br />
wurde die traditionelle Aufspaltung der Nutzung weiblicher Arbeitskraft<br />
zwischen Familie <strong>und</strong> Erwerbswirtschaft festgeschrieben, deren historische<br />
Wurzeln verschleiert, die noch in der agrarischen <strong>und</strong> handwerklichen Familienökonomie<br />
voll dem Familienvorstand <strong>und</strong> Eigentümer der Produktionsmittel<br />
zufiel <strong>und</strong> die partiell bis in die 50er Jahre erhalten blieb, heute<br />
jedoch rapide zurückgeht. Die Verfügung über <strong>und</strong> Nutzung von weiblicher<br />
Arbeitskraft verlagerte sich im Laufe der Industrialisierung; in dem Jahrzehnt<br />
zwischen 1950 <strong>und</strong> 1961 wurde der Wandel in den Arbeitsbedingungen<br />
von Ehefrauen <strong>und</strong> Müttern besonders deutlich. Die Erwerbsquote von<br />
Ehefrauen im erwerbsfähigen Alter stieg von 26,4% auf 36,5%. Im gleichen<br />
Zeitraum fiel der Anteil der mithelfenden Ehefrauen an allen Ehefrauen<br />
von 15,4% auf 12,7%, gleichzeitig stieg der Anteil der marktförmig erwerbstätigen<br />
Ehefrauen an allen Ehefrauen von 9,6% auf 21,1% — Zeichen für<br />
den Rückgang familienförmig organisierter <strong>und</strong> für die Zunahme marktförmig<br />
vermittelter Erwerbstätigkeit von Ehefrauen. Im Vergleich betrug 1980<br />
der Anteil der marktbezogenen erwerbstätigen Ehefrauen an allen Ehefrauen<br />
<strong>35</strong>,9%, der Anteil der mithelfenden Ehefrauen an allen Ehefrauen<br />
4,7%, erwerbstätig waren somit 40,6% aller Ehefrauen (Müller/Willms/Handl<br />
1983, S. <strong>35</strong>).<br />
Die zunehmende Aufspaltung <strong>und</strong> gleichzeitige Mehrbelastung weiblicher<br />
Arbeitskraft zwischen Familie <strong>und</strong> Beruf war in den 50er Jahren Anlaß<br />
zu ersten familienpolitischen Interventionen. Durchaus in Übereinstimmung<br />
mit familiensoziologischen <strong>und</strong> -rechtlichen Positionen sollte die Ehefrau<br />
<strong>und</strong> Mutter für Sozialisationsleistungen <strong>und</strong> Hausarbeit zur Verfügung<br />
stehen. Mit Recht beklagt wurde die finanzielle Belastung von Familien mit<br />
Kindern, gefordert wurde die Umverteilung von Familienlasten auf diejenigen,<br />
die offensichtlich von den Anstrengungen der Familien mit Kindern<br />
profitierten — Ledige <strong>und</strong> kinderlose Ehepaare.<br />
Daß sie profitierten, ergab sich mühelos aus der Systematik des Rentenversicherungsrechts.<br />
Die 1957 vollzogene Umstellung auf ein Umlageverfahren<br />
der Aufwendungen, mit dem die Erwerbstätigen die nicht mehr Erwerbstätigen<br />
über Transferzahlungen „unterhielten", legte den Gedanken<br />
nahe, daß diejenigen, die Kinder <strong>und</strong> damit künftige Beitragszahler aufziehen,<br />
eine Leistung zur Sicherung des Gesellschaftsganzen <strong>und</strong> seiner Mitglieder<br />
erbringen, der sich Kinderlose entziehen. Der — nicht honorierte —<br />
Beitrag der Mutter durch unentgeltliche Leistungen wurde akklamativ herausgestellt,<br />
deren eigenständige soziale Sicherung jedoch nicht angestrebt.<br />
Folgerichtig entstanden erste Pläne für einen „Drei-Generationen-Vertrag"<br />
, der die finanzielle Entlastung von Familien mit Kindern mit der Finanzierung<br />
von Altersrenten durch Erwerbstätige verbinden sollte. 9 Heute<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
sind diese Pläne wieder aktuell, auch deshalb lohnt der Rückblick auf die<br />
damalige Diskussion.<br />
Die Soziologie jener Jahre befaßte sich allenfalls mit Teilaspekten dieser<br />
Entwicklung (<strong>und</strong> unter verkürzten theoretischen Fragestellungen, auf die<br />
hier nicht eingegangen werden kann). Ihre Themen waren die zunehmende<br />
Müttererwerbstätigkeit (Pfeil 1961) oder die Einstellungen junger Frauen<br />
zu Familie <strong>und</strong> Mutterschaft in der richtungsweisenden Arbeit von Wurzbacher<br />
u.a. (1958). Der Schwerpunkt familiensoziologischer Forschung lag<br />
in der Analyse der Stabilitätsbedingungen der Familie <strong>und</strong> von deren Funktionsveränderungen.<br />
Sozialpolitische Fragestellungen wurden eher ausgeklammert,<br />
dasselbe gilt für die ökonomische Verflechtung von Familie <strong>und</strong><br />
Gesellschaft. So war es nicht erstaunlich, daß der Aspekt der Verwertungsbedingungen<br />
weiblicher Familienarbeitskraft unter diesen Vorausset<br />
10<br />
zungen überhaupt nicht in den Blick sozialwissenschaftlicher Forschung<br />
geriet.<br />
Theoretisch lassen sich die zunehmende Erwerbstätigkeit von Hausfrauen<br />
<strong>und</strong> Müttern, die rechtliche Umgestaltung der familialen weiblichen Arbeitspflicht<br />
<strong>und</strong> familienpolitische Bestrebungen als Merkmale einer neuen<br />
Form der Vergesellschaftung der Arbeitskraft <strong>und</strong> des Gebärvermögens von<br />
Frauen deuten, denn familienpolitische Interventionen galten nicht allein<br />
dem Ziel, das Arbeitsvermögen der Frau der Familie zu sichern, sondern<br />
gleichzeitig einer weiteren Zielsetzung — der Sicherung einer stabilen Geburtenrate.<br />
In diesem Sinne wird unter „Vergesellschaftung" hier die <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Nutzung <strong>und</strong> Verfügung über diese Potenzen — Arbeits- <strong>und</strong><br />
Gebärvermögen — verstanden. Beide dienten nur noch selten der Reproduktion<br />
einer auf Eigentum beruhenden Familienökonomie. Vollständige Familie<br />
<strong>und</strong> gesicherte Beschäftigung des Ehemannes vorausgesetzt, verblieb<br />
die Arbeitskraft der Ehefrau <strong>und</strong> Mutter entweder dem Haushalt nach dem<br />
Modell der Hausfrauenehe oder sie spaltete sich auf zwischen Haushalt <strong>und</strong><br />
Beruf.<br />
Indem der Staat seit Einführung der Sozialversicherung als Garant der<br />
Existenzsicherung der Besitzlosen im Alter auftrat, lag der Gedanke nahe,<br />
die Sozialisationsleistungen von Müttern (<strong>und</strong> die finanziellen Aufwendungen<br />
der „Familienvorstände") als deren Beitrag zum Erhalt des <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Ganzen zu deuten. Die mit diesem Sachverhalt befaßte familienpolitische<br />
Literatur bedachte allerdings kaum, daß die Systematik des Rentenversicherungsrechts<br />
auf ein Umlageverfahren unter Lohnabhängigen abstellte,<br />
das über monetäre Leistungen die Reproduktion von Individuen <strong>und</strong> deren<br />
Arbeitskraft auf spezifische Weise sicherte. Eine materielle Anerkennung<br />
der Leistungen von Müttern war bei dieser Systemkonstruktion nicht<br />
möglich.<br />
Bei der Berücksichtigung der Tatsache, daß Sozialleistungen über Steueraufkommen<br />
<strong>und</strong> Sozialabgaben finanziert werden, zeigt sich, daß auf Arbeitnehmerseite<br />
über direkte <strong>und</strong> indirekte Steuern <strong>und</strong> Sozialabgaben die<br />
Kosten der sozialen Sicherung innerhalb der Arbeitnehmerschaft umverteilt<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
werden, während von Arbeitgeberseite Soziallasten als Lohnnebenkosten<br />
<strong>und</strong> Steuern über die Preisgestaltung auf die Käufer von Produkten abgewälzt<br />
werden. Die Mittel zu sozialer Sicherung werden allein aus den<br />
Erträgen durch Arbeit finanziert, Kapital- <strong>und</strong> Bodenerträge sind, nach<br />
Abzug von Steuern, nicht davon betroffen. Mit einer Einschränkung:<br />
über direkte <strong>und</strong> indirekte Besteuerung sind Kapital- <strong>und</strong> Bodenbesitzer<br />
persönlich an den Kosten der sozialen Sicherung beteiligt. Rolf Zacher<br />
spricht in diesem Zusammenhang von einem „Paradoxon der Arbeitnehmergesellschaft"<br />
(Zacher 1984).<br />
Schon in den 50er Jahren wurde in der familienpolitischen Literatur<br />
darauf hingewiesen, daß im System der sozialen Sicherung nicht allein<br />
Kosten umgelegt werden, sondern daß dessen Funktionsfähigkeit zugleich<br />
von unentgeltlichen Leistungen abhänge (Sozialisationsleistungen, Altenbetreuung,<br />
Krankenpflege). Auch aus diesem Gr<strong>und</strong> bietet es sich an,<br />
für Industriegesellschaften von einer spezifischen Vergesellschaftung weiblicher,<br />
unentgeltlicher Arbeitskraft zu sprechen, die nicht mehr entsprechend<br />
den Bedürfnissen einer handwerklichen oder agrarischen Familienökonomie<br />
<strong>und</strong> ihrer Produktionsmittelbesitzer genutzt wurde. Als Nutznießer<br />
lassen sich letztlich die Produktionsmittelbesitzer einer anonymisierten,<br />
hochindustrialisierten Gesellschaft identifizieren — ihnen bleibt die<br />
Nutzung von Arbeitskraft im erwerbsfähigen Alter, ohne daß sie mit den<br />
Kosten von deren Aufzucht <strong>und</strong> Erwerbsunfähigkeit belastet sind. Als<br />
Nutznießer unentgeltlicher Frauenarbeit erweisen sich aber auch die männlichen<br />
Lohnabhängigen insgesamt. Erstens kommen ihnen direkt die unentgeltlichen<br />
Arbeitsleistungen von Frauen zugute, die zugleich die Hierarchie<br />
zwischen Erwerbstätigen <strong>und</strong> Nicht-Erwerbstätigen festigt, zweitens profitieren<br />
sie in sehr viel stärkerem Maße als Frauen durch das Umlageverfahren<br />
der Sozialversicherung, das nicht-erwerbstätigen Frauen <strong>und</strong> Müttern<br />
aufgr<strong>und</strong> der Unentgeltlichkeit ihrer Arbeit nur „abgeleitete" <strong>und</strong> in<br />
der Regel mindere Ansprüche zugesteht.<br />
Zusammenfassend: Institutionell abgesichert über Familien- <strong>und</strong> Sozialrecht<br />
reproduziert die Familie durch die Arbeit der Ehefrau <strong>und</strong> Mutter<br />
<strong>und</strong> das Lohneinkommen eines oder beider Ehepartner sich selbst, gleichzeitig<br />
jedoch auch die Bedingungen einer auf privater Aneignung von<br />
Reichtum basierenden Gesellschaft. Diese Reproduktion beruht auf Mechanismen,<br />
in denen Kapitalverwertungsinteressen mit patriarchalen Elementen<br />
durchsetzt sind. Mit den Transformationen des Industriekapitalismus<br />
wandelte sich auch dessen Patriarchalismus. Der vorindustrielle, der sich<br />
bis weit ins Industriezeitalter in der Familienökonomie als Einheit von<br />
Gewerbe <strong>und</strong> Haushalt erhielt, beließ Ehefrauen, deren Arbeitskraft <strong>und</strong><br />
Gebärvermögen, in dieser Wirtschaftseinheit. Er machte einem neuen<br />
Patriarchalismus Platz, der sich nahtlos in die versachlichten Beziehungen<br />
der Industriegesellschaft einfügte. Dem in der Regel nunmehr lohnabhängigen<br />
Ehemann verblieb allein die persönliche Dienstleistung der Ehefrau,<br />
von den Sozialisationsleistungen der Mutter <strong>und</strong> von ihrer eventuel-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
len Erwerbstätigkeit profitierten andere — das staatliche Sozialsystem<br />
<strong>und</strong> das Kapital. Nur in eingeschränktem Maße partizipierten Hausfrauen<br />
<strong>und</strong> Mütter — ob erwerbsfähig oder nicht — an Sozialleistungen zur Sicherung<br />
ihrer Existenz.<br />
Diese Veränderungen einer spezifischen Form des Patriarchalismus<br />
waren nicht Gegenstand soziologischer Forschung. Gerade der von der<br />
kritischen Theorie diagnostizierte (patriarchal-kapitalistische) Autoritarismus<br />
entwickelter Industriegesellschaften wurde von der Familien<strong>soziologie</strong><br />
bestritten. Im Anschluß an Wurzbachers berühmte Untersuchung von<br />
11<br />
1952, auf die sich alle bekannten Werke jener Zeit beriefen, wurde demgegenüber<br />
der Abbau des patriarchalischen Familienleitbildes gefeiert;<br />
verstanden wurde darunter jedoch nicht der Abbau traditioneller Geschlechterrollen<br />
<strong>und</strong> Arbeitsteilung, sondern — auch hier in Übereinstimmung<br />
mit anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen — deren „partnerschaftliche"<br />
Anerkennung.<br />
Die sozio-ökonomische Situation von Frauen verbesserte sich in den folgenden<br />
Jahren ohne jeden Zweifel. Die 1977 vollzogene formalrechtliche<br />
Gleichstellung von Eheleuten bildete eine weitere Zäsur in der Aufweichung<br />
der Verrechtlichung der familialen Arbeitspflicht der Frau, diesmal jedoch unter<br />
völlig veränderten <strong>gesellschaftliche</strong>n Bedingungen: zunehmende Verknappung<br />
von Erwerbsarbeit, zunehmende Scheidungsziffern, abnehmende Geburtenraten,<br />
abnehmende Heiratswilligkeit, Abbau öffentlicher Leistungen.<br />
Im Vergleich zu den 50er Jahren gilt Frauenerwerbstätigkeit heute<br />
als Lebensperspektive; Frauen wollen beides, Beruf <strong>und</strong> Familie. Ehe <strong>und</strong><br />
Familie bieten Frauen heute keine lebenslange ökonomische <strong>und</strong> soziale<br />
Absicherung mehr; die Bedingungen, die seit Beginn der Industrialisierung<br />
allein für Proletarierinnen galten, haben sich mittlerweile verallgemeinert.<br />
Neben Ehe <strong>und</strong> Familie haben sich andere Formen der Lebensgestaltung<br />
etabliert — das sog. Single-Dasein, Paar-Beziehungen außerhalb der Ehe,<br />
Wohngemeinschaften. Diese Lebensformen verweisen Frauen auf eigene<br />
Erwerbstätigkeit, jedoch auch im Falle der ehelichen Bindung ist die Existenzsicherung<br />
der Frau über den Ehemann nicht mehr gewährleistet: Erwerbslosigkeit,<br />
Kurzarbeit, Reallohnsenkungen wirken als ökonomische<br />
<strong>und</strong> soziale Unsicherheitsfaktoren, die den Drang von Frauen in die Erwerbstätigkeit<br />
verstärken. Deshalb erstaunt es nicht, daß sich der Anteil<br />
verheirateter an allen erwerbstätigen Frauen in den letzten 25 Jahren nahezu<br />
verdoppelte, der Anteil von Müttern mit Kindern unter 15 Jahren<br />
fast verdreifachte. Die berufstätige Frau „ist heute älter, verheiratet <strong>und</strong><br />
Mutter" (Reichert/Wenzel 1984).<br />
Der zunehmenden Erwerbsorientierung von Frauen entspricht keine<br />
gleichgewichtige Familienorientierung der Männer — so das Ergebnis<br />
einer Vielzahl neuerer Studien (Glatzer/Herget 1984, Born/Vollmer 1983).<br />
Auf erwerbstätigen Ehefrauen <strong>und</strong> Müttern lastet nach wie vor Familien<strong>und</strong><br />
Erwerbstätigkeit, obwohl die familienrechtliche Zuweisung der Arbeitskraft<br />
der Frau an Legitimität eingebüßt hat. Faktisch gilt die Mutter nach<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
wie vor als angemessene Betreuerin „ihrer" Kinder, rechtlich gilt die familiale<br />
Arbeitsteilung als frei vereinbar unter Ehepartnern <strong>und</strong> Eltern.<br />
Vom Regelfall abweichende Arrangements sind möglich — nur nicht häufig<br />
<strong>und</strong> konterkariert von <strong>gesellschaftliche</strong>n Rahmenbedingungen. Nach dem<br />
Aufbrechen der legalen Bindung unentgeltlicher Frauenarbeitskraft an die<br />
Familie wird heute unterschwelliger über sie verfügt, Jutta Li<strong>mb</strong>ach hat<br />
auf entsprechende juristische Praktiken hingewiesen (Li<strong>mb</strong>ach 1981).<br />
Institutionelle Arrangements zur Sicherung familialer Reproduktionsleistungen<br />
existieren nach wie vor, Eltern sind für die Aufwendungen <strong>und</strong><br />
Arbeitsleistungen der Kinderaufzucht verantwortlich. Sie sind jedoch nicht<br />
mehr eindeutig <strong>und</strong> ausschließlich an die Arbeitskraft der Ehefrau <strong>und</strong><br />
Mutter geb<strong>und</strong>en. Diese Entwicklung läßt sich als institutionelles Aufbrechen<br />
geschlechtlicher Arbeitsteilung interpretieren, begleitet von anderen<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>n Veränderungen: Zunahme der Teilzeitarbeit von<br />
Ehefrauen, Bewußtseinsveränderungen im Zuge der Frauenbewegung.<br />
Frauen sind heute aber nach wie vor, allerdings subtiler, auf die Familie<br />
verwiesen: es gibt Mutterschaftsurlaub, nicht solchen für Väter, Frauenarbeit<br />
ist schlechter bezahlt als Männerarbeit <strong>und</strong> unzureichend zur materiellen<br />
Existenzsicherung, Industrie <strong>und</strong> Gewerbe rechnen nach wie vor<br />
mit der vollen Verfügung über Arbeitskraft, die sich an der von Familienarbeit<br />
entlasteten männlichen Normalbiographie orientiert, Männer zeigen<br />
wenig Interesse an Familienaufgaben. Ehefrauen <strong>und</strong> Mütter unterliegen<br />
insofern einem ungebrochenen strukturellen Zwang zur unentgeltlichen<br />
Arbeit. Allerdings sind sich Frauen der Konsequenzen heute durchaus bewußt:<br />
Lücken in der Arbeits- <strong>und</strong> Rentenbiographie, verschlechterte<br />
Chancen des Zugangs zum Arbeitsmarkt, niedrige Bezahlung in ungeschützten<br />
Beschäftigungsverhältnissen mit der Folge der Armut beim<br />
Scheitern der Ehe <strong>und</strong> im Alter. Frauen durch Mutterschaft an die Familie<br />
binden zu wollen, hat ebenso an Überzeugungskraft eingebüßt. So ist die<br />
Vermutung plausibel, daß Frauen, vor die Alternative „Mutterschaft oder<br />
Beruf" gestellt, sich für den Beruf <strong>und</strong> gegen Kinder entscheiden werden,<br />
zumindest gegen mehr als ein Kind.<br />
Gibt es einen Ausweg aus dem Dilemma? Nicht-marktförmig organisierte<br />
Arbeitsleistungen sind gesellschaftlich notwendig, daran besteht kein<br />
Zweifel. Um sie den Frauen nicht auch in Zukunft zuzuschreiben, kann eine<br />
Lösung des Problems allein im sukzessiven Abbau <strong>und</strong> letztlich in der<br />
Aufhebung geschlechtlicher Arbeitsteilung bestehen. Nicht nur Frauen<br />
würden davon profitieren, auch Männer: die ökonomische Sicherung der<br />
Familie <strong>und</strong> die Arbeit in ihr würden auf beide verteilt, dem Problem des<br />
nachehelichen Unterhalts die Schärfe genommen, die Integration der<br />
Frau ins Berufsleben neue Formen von Partnerschaft ermöglichen. Kurzfristig<br />
geht es um Änderungen im System sozialer Sicherung, die die Diskriminierung<br />
derjenigen beseitigen, die unentgeltliche Leistungen erbringen<br />
(z.B. Anerkennung von Erziehungszeiten in der Rentenversicherung),<br />
um mehr familienergänzende soziale Dienste, insgesamt um den Ausbau<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
statt Abbau des Sozialstaates. Langfristig sind Veränderungen der Arbeitsorganisation<br />
gefordert, insbesondere der Arbeitszeitregelungen, die sich<br />
bisher gegen eine familiengerechte Ausgestaltung des Arbeitslebens sperren,<br />
so daß Frauen <strong>und</strong> Männer Erwerbstätigkeit mit Familienaufgaben<br />
verbinden können. Dies wiederum bedingt eine Veränderung der Einstellung<br />
von Männern zum familialen Bereich, sie ist bislang nicht in Sicht.<br />
ANMERKUNGEN<br />
Hilde v. Balluseck war an der Erarbeitung der familiensoziologischen Literatur<br />
der Nachkriegszeit beteiligt. Für Anregungen <strong>und</strong> Kritik des Manuskripts danke ich:<br />
Sabine Gensior, Carol Hagemann-White, Ulrike Helmer, Christel Rammert-Faber,<br />
Margret Steffen, Helgard Ulshoefer, Marianne Weg <strong>und</strong> Christof Wehrsig.<br />
1 Kritisch zur Subsumierung von Familienarbeit unter Selbsthilfe Gross 1982a <strong>und</strong><br />
1984: er möchte Selbsthilfegruppen unterschieden wissen von Selbst-Hilfe als<br />
Eigenverantwortlichkeit im Sinne des bürgerlichen Individualismus. Zu den heterogenen<br />
politischen Zielvorstellungen <strong>und</strong> Erkenntnisinteressen in der Selbsthilfe-Diskussion<br />
vgl. Murswieck 1983, Deimer/Jaufmann/Kistler/Pfaff 1983, Michalsky<br />
1984; zu Selbsthilfe-Projekten der Alternativ-Ökonomie vgl. die empirische<br />
Studie von Berger/Domeyer/F<strong>und</strong>er/Voigt-Weber 1984.<br />
2 Kritisch aus politischer Sicht Martiny 1984 <strong>und</strong> Opielka 1984; aus wissenschaftlicher<br />
Perspektive Hofemann 1982, Windhoff-Héritier 1982, Deimer u.a. 1983,<br />
Beywl/Bro<strong>mb</strong>ach 1984, Bäcker 1979. Befürwortend: Hegner 1982, Gross 1982b.<br />
3 Zur Definition: Unter familialer Ökonomie verstehe ich die Gesamtheit der Leistungen<br />
im Binnen- <strong>und</strong> Außenverhältnis von Wirtschaftseinheiten, deren Vermögensverhältnisse<br />
durch die Eheschließung reguliert sind, d.h. unterschieden nach<br />
Familienstatus <strong>und</strong> Geschlechtszugehörigkeit. Schweitzer unterscheidet zwischen<br />
Hausarbeit im engeren Sinn, als Familientätigkeit (sie schließt dann Kinderversorgung<br />
ein), als Selbstversorgung (sie schließt dann die Herstellung von Lebensmitteln<br />
<strong>und</strong> Gütern ein; vgl. Schweitzer 1981, S. 172 f. Ich fasse diese drei Formen von<br />
Haushaltstätigkeit unter den — vorläufigen — Terminus „Familienarbeit", der<br />
zugleich die unentgeltliche Erwerbsarbeit der Ehefrau im Betrieb des Mannes bzw.<br />
der Familie einschließt (mithelfende bzw. mitarbeitende Angehörige). Anders als<br />
Hegner 1982, der zwischen familialen <strong>und</strong> ökonomischen Haushaltstätigkeiten<br />
unterscheidet <strong>und</strong> diese aufschlüsselt nach den Aktivitätsformen Arbeiten, Herstellen,<br />
Handeln <strong>und</strong> der keine geschlechtsspezifische Zuordnung vornimmt, wird<br />
hier versucht, Familien- oder Haushaltsaktivitäten im Rahmen gcschlechtssezifischer<br />
Zuweisungen zu identifizieren.<br />
4 Zuletzt in: Das Parlament <strong>35</strong>/36 (1984), bes. S. 10 <strong>und</strong> 19 zum Problem der<br />
Festellung des materiellen Werts der Hausfrauentätigkeit.<br />
5 Diskussionsbeitrag anläßlich der Tagung „Wie männlich ist die Wissenschaft?",<br />
Zentrum für interdisziplinäre Forschung, Universität Bielefeld, 13.-15.12.1984.<br />
6 So die Frage nach dem Prinzip der Reziprozität im Familienverband: welche<br />
Bindungen werden durch unentgeltliche Arbeit geschaffen, die entgeltliche Arbeit<br />
nicht hervorbringt? Wie ist unter diesem Gesichtspunkt die Verknüpfung der<br />
monetären (Markt-)Ökonomie mit der nicht-monetären (Familien-)Ökonomie zu<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
denken? Der Hinweis auf die Notwendigkeit der Analyse der widersprüchlichen<br />
Folgen unentgeltlicher Familienarbeit stammt von Christof Wehrsig.<br />
7 Kaufmann weist darauf hin, daß die höchstpersönliche Verantwortung der Mutter<br />
für die Kinderaufzucht sich erst im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert herausgebildet habe; vgl.<br />
Kaufmann 1981.<br />
8 Die Mitarbeitspflicht wurde nicht im Unterhaltsrecht aufgenommen. Entscheidend<br />
bleibe, so Gernhuber, der Einzelfall. Gefordert war deren Aufnahme im Regierungsentwurf<br />
I <strong>und</strong> im Entwurf der FDP. In den Vorarbeiten zum Regierungsentwurf<br />
sei richtig erkannt worden, so Gernhuber weiter, daß die Mitarbeitspflicht eine<br />
über das Unterhaltsrecht hinausgehende Bedeutung habe. Vgl. Gernhuber 1958,<br />
S. 247, Fußnote 29.<br />
9 So plädierte Schreiber für einen „Solidarvertrag" der Arbeitnehmer, mit dem alle<br />
erwachsenen Erwerbstätigen eine „Kindheitsrente" zur Verfügung stellen sollten.<br />
Selbst herangewachsenen, sollte der Erwerbstätige diese in Kindheit <strong>und</strong> Jugend<br />
erhaltene Rente zurückzahlen <strong>und</strong> damit die Kindheitsrente für die nächste Generation<br />
aufbringen; vgl. Schreiber 1955, S. 31, dargestellt bei Bühler 1961. Vgl.<br />
auch Wingen 1964, S. 234, der in seiner Würdigung des „Schreiber-Plans" denn auch<br />
eine Schwachstelle identifizierte: wie die verheiratete Frau <strong>und</strong> Mutter die in der<br />
Kindheit erhaltene Rente zurückzahlen solle, wenn sie selbst nicht erwerbstätig<br />
sei. Oeter entwarf ähnliche Pläne; er zog in seinen Schriften übrigens Parallelen<br />
zwischen der Verfügung <strong>und</strong> Nutzung von Arbeitskraft in der alten Familienwirtschaft<br />
<strong>und</strong> deren Ubergang an die „Volkswirtschaft", jedoch nur bezogen auf<br />
Kinder <strong>und</strong> nicht auf Frauen. Vgl. Oeter 1954, S. 54.<br />
10 Vgl. v. Ferber 1977 <strong>und</strong> Kaufmann 1977 zum Verhältnis von Soziologie <strong>und</strong><br />
Sozialpolitik. Zu den historischen Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> der Programmgeschichte von<br />
Sozialpolitik vgl. Pankoke 1977 <strong>und</strong> 1984.<br />
11 Die Differenziertheit von Horkheimers Argumentation ging seinerzeit verloren.<br />
So unterschied dieser zwischen rational begründbarer <strong>und</strong> irrationaler Autorität.<br />
„Autorität" kennzeichne immer eine Abhängigkeitsbeziehung, könne jedoch der<br />
Förderung der Interessen der Betroffenen <strong>und</strong> der Entwicklung <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Kräfte dienen. Herrschaft galt ihm nicht von vornherein als destruktiv, sie habe<br />
sich vielmehr auszuweisen durch ihre Mittel <strong>und</strong> Ziele. „Autorität" als legitime<br />
<strong>und</strong> begründbare Form von Herrschaft unterschied er von irrationaler, künstlich<br />
aufrechterhaltener <strong>und</strong> damit historisch überholter Autorität, die dem Interesse<br />
der Allgemeinheit an einer gerechten <strong>und</strong> lebenswerten Gesellschaft zuwiderlaufe.<br />
Diese Form von Autorität trete nicht offen zutage, sondern verhüllt unter dem<br />
Schein freier Vereinbarung (Arbeitsvertrag). Die bürgerliche Familie bilde den<br />
Transmissionsriemen zur Aufrechterhaltung von Klassenherrschaft, indem sie<br />
Individuen hervorbringe, die entgegen ihrem eigenen Interesse zur Aufrechterhaltung<br />
bestehender Autoritätsstrukturen beitrügen. Zugleich thematisierte Horkheimer<br />
das subversive Element familialer (Liebes-)Beziehungen, das diese Mechanismen<br />
unterlaufen könne. Vgl. Horkheimer 1936.<br />
LITERATUR<br />
Balluseck, H. von, 1984: „Zum Verhältnis von unbezahlter <strong>und</strong> bezahlter Sozialarbeit<br />
in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland <strong>und</strong> Berlin (West) von 1950-1980", in: Soziale<br />
Arbeit 8/9, S. 390-404.<br />
Bäcker, G., 1979: „Entprofessionalisierung <strong>und</strong> Laisierung sozialer Dienste — richtungsweisende<br />
Perspektive oder konservativer Rückzug?", in: WSI-Mitteilungen<br />
10, S. 526-537.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Beck-Gemsheim, E., 1984: „Frauen zurück in die Familie? Eine Diskussion der Leitlinien<br />
aktueller Familienpolitik in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland", in: WSI-Mitteilungen<br />
1, S. 223-32.<br />
Beer, U., 1984: Theorien geschlechtlicher Arbeitsteilung, Frankfurt/New York.<br />
Berger, J., Domeyer, V., F<strong>und</strong>er, M., Voigt-Weber, L., 1984: Informeller Sektor <strong>und</strong><br />
Alternative Ökonomie, Forschungsbericht des Forschungsschwerpunktes „Zukunft<br />
der Arbeit", Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie, Bielefeld.<br />
Beywl, W., Bro<strong>mb</strong>ach, H., 1984: Neue Selbstorganisation. „Zwischen kultureller Autonomie<br />
<strong>und</strong> politischer Vereinnahmung", in: Aus Politik <strong>und</strong> Zeitgeschichte, B. 11,<br />
S. 15-29.<br />
Born, C, Vollmer, C, 1983: Familienfre<strong>und</strong>liche Gestaltung des Arbeitslebens, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz.<br />
Bosch, F.W., 1958: „Freiheit <strong>und</strong> Bindung im neuen deutschen Familienrecht", in:<br />
FamRZ 3, S. 81-88.<br />
Brühl, 1957: „Der Familienunterhalt nach dem Gleichberechtigungsgesetz", in: FamRZ<br />
8/9, S. 277-283.<br />
Bühler, H.H., 1961: Familienpolitik als Einkommens- <strong>und</strong> Eigentumspolitik. Diskussion<br />
<strong>und</strong> staatliche Maßnahmen in der B<strong>und</strong>esrepublik, Berlin.<br />
Ciaessens, D., 1962: Familie <strong>und</strong> Wertsystem. Eine Studie zur „zweiten, sozio-kulturellen<br />
Geburt" des Menschen, Berlin 1962, zitiert nach der 2., überarbeiteten Auflage<br />
1967.<br />
Cuvillier, R., 1979: „The Housewife: An Unjustified Financial Burden on the Community",<br />
in: Journal of Social Policy, 1, S. 1-26.<br />
Deimer, K., Jaufmann, D., Kistler, E., Pfaff, M., 1983: „Selbsthilfe in der Sozialpolitik<br />
— ein Lösungsansatz?", in: Aus Politik <strong>und</strong> Zeitgeschichte B34, S. 14-29.<br />
Dörner, H., 1974: Industrialisierung <strong>und</strong> Familienrecht. Die Auswirkungen des sozialen<br />
Wandels dargestellt an den Familienmodellen des ALR, BGB <strong>und</strong> des französischen<br />
Code civil, Berlin.<br />
Egner, E., 1952: Der Haushalt. Eine Darstellung seiner volkswirtschaftlichen Gestalt,<br />
Berlin.<br />
Eißer, G., 1959: „Die Anerkennung der Persönlichkeit der Ehefrau im neuen Eherecht",<br />
i: FamRZ 5, S. 177-188.<br />
Ferber, C.v., 1977: „Soziologie oder Sozialpolitik", in: Ferber, C.v., Kaufmann, F.X.,<br />
Hg., Soziologie <strong>und</strong> Sozialpolitik, Opladen, Sonderheft 19 der KZfSS, S. 12-34.<br />
Geißler, H., 1979: Gr<strong>und</strong>werte in der Politik, Frankfurt/Berlin/Wien.<br />
Gernhuber, J., 1958: „Die Mitarbeit der Ehegatten im Zeichen der Gleichberechtigung",<br />
in: FamRZ 7, S. 243-251.<br />
Glatzer, W., 1984: „Haushaltsproduktion", in: Glatzer, W., Zapf, W., Hg., Lebensqualität<br />
in der B<strong>und</strong>esrepublik. Objektive Lebensbedingungen <strong>und</strong> subjektives Wohlbefinden,<br />
Frankfurt, S. 366-390.<br />
-, Herget, H., 1984: „Ehe, Familie <strong>und</strong> Haushalt", in: Glatzer, W., Zapf, W., Hg.,<br />
Lebensqualität in der B<strong>und</strong>esrepublik. Objektive Lebensbedingungen <strong>und</strong> subjektives<br />
Wohlbefinden, Frankfurt, S. 124-140.<br />
Gross, P., 1982a: „Der Wohlfahrtsstaat <strong>und</strong> die Bedeutung der Selbsthilfebewegung",<br />
in: Soziale Welt 1, S. 26-48.<br />
—, 1982b: „Selbstbestimmung oder Fremdsteuerung der Familie", in: Kaufmann,<br />
F.-X., Hg., Staatliche Sozialpolitik <strong>und</strong> Familie, <strong>München</strong>/Wien, S. 285-312.<br />
—, 1984: „Zur gegenwärtigen Diskussion um Sicherheit <strong>und</strong> Zukunft des 'sozialen<br />
Netzes"', in: Gegenwartsk<strong>und</strong>e SH 4, S. 41-59.<br />
Hegner, F., 1982: „Haushaltsfamilie <strong>und</strong> Familienhaushalt: Vorüberlegungen zu einer<br />
Typologie der Verknüpfung familialer <strong>und</strong> ökonomischer Aktivitäten", in: Kaufmann,<br />
F.-X., Hg., Staatliche Sozialpolitik <strong>und</strong> Familie, <strong>München</strong>/Wien, S. 23-47.<br />
Hofemann, K., 1982: „Weichenstellung in der Sozialpolitik. Alternativen zur Privatisierung<br />
des Sozialstaates", in: Soziale Sicherheit 12, S. 373-379.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Horkheimer, M., Hg., 1936: Studien über Autorität <strong>und</strong> Familie. Schriften des Instituts<br />
für Sozialforschung, Bd. 5, Paris.<br />
Kaufmann, F.-X., 1977: „Sozialpolitisches Erkenntnisinteresse <strong>und</strong> Soziologie. Ein Beitrag<br />
zur Pragmatik der Sozialwissenschaften", in: Soziologie <strong>und</strong> Sozialpolitik,<br />
Sonderheft 19 der KZfSS, Opladen, hrsg. C. v.Ferber, F.-X. Kaufmann, S. 38-75.<br />
—, 1981: „Zur <strong>gesellschaftliche</strong>n Verfassung der Ehe — heute", in: Böckle, F. u.a.,<br />
Hg., Enzyklopädische Bibliothek in 30 Teilbänden, Band 7: Christlicher Glaube in<br />
moderner Gesellschaft, Freiburg/Basel/Wien, S. 44-59.<br />
König, R., 1946: Materialien zur Soziologie der Familie, Bern.<br />
—, 1967: „Die Stellung der Frau in der modernen Gesellschaft", in: Käser, O., Hg.,<br />
Gynäkologie <strong>und</strong> Selbsthilfe, Bd. 1, Stuttgart.<br />
Li<strong>mb</strong>ach, J., 1981: „Das Eheleitbild in der Jurisprudenz", in: Matthes, J., Hg., Lebenswelt<br />
<strong>und</strong> soziale Probleme. Verhandlungen des 20. Deutschen Soziologentages zu<br />
Bremen 1980, Frankfurt/New York, S. 441-450.<br />
Martiny, A., 1984: „Plädoyer für eine realistische Familienpolitik", in: Aus Politik <strong>und</strong><br />
Zeitgeschichte B. 20, S. 15-27.<br />
Mayntz, R., 1955: Die moderne Familie, Stuttgart.<br />
Michalsky, H., 1984: „Parteien <strong>und</strong> Sozialpolitik in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland",<br />
in: Sozialer Fortschritt 6, S. 134-142.<br />
Müller, W., Willms, A., Handl, J., 1983: Strukturwandel der Frauenarbeit 1880-1980,<br />
Frankfurt.<br />
Murswieck, A., 1983: „Handlungsspielräume einer konservativen Sozialpolitik", in:<br />
Soziale Sicherheit 9, S. 276-282.<br />
Neidhardt, F., 1970: „Strukturbedingungen <strong>und</strong> Probleme familialer Sozialisation", in:<br />
Lüschen, G., Lupri, E., Hg., Soziologie der Familie. Sonderheft 14 der KZfSS, Opladen,<br />
S. 144-168.<br />
Oeter, F., 1954: Familienpolitik, Stuttgart.<br />
—, Hg., 1960: Familie im U<strong>mb</strong>ruch, Gütersloh.<br />
Opielka, M., 1984: „Familien-Politik ist „Neue-Männer-Politik". Überlegungen zu einer<br />
ökologischen Familienpolitik", in: Aus Politik <strong>und</strong> Zeitgeschichte B. 20, S. 34-46.<br />
Pankoke, E., 1977: „Sozialpolitik zwischen staatlicher Systematisierung <strong>und</strong> situativer<br />
Operationalisierung. Zur Problem- <strong>und</strong> Programmgeschichte sozialer Politik", in:<br />
Ferber, C.v., Kaufmann, F.-X., Hg., Soziologie <strong>und</strong> Sozialpolitik, Sonderheft 19 der<br />
KZfSS, Opladen, S. 76-97.<br />
—, 1984: „Geschichtliche Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklungen moderner<br />
Sozialpolitik. Von „guter Policey" zur „sozialen Politik", in: Gegenwartsk<strong>und</strong>e SH<br />
4, S. 23-40.<br />
Pfeil, E., 1961: Die Berufstätigkeit von Müttern, Tübingen.<br />
Reichert, P., Wenzel, A., 1984: „Alternativrolle Hausfrau? Eine Analyse von Ursachen<br />
<strong>und</strong> Auswirkungen der Frauenarbeitslosigkeit vor dem Hintergr<strong>und</strong> veränderter<br />
Lebensverhältnisse", in: WSI-Mitteilungen 1, S. 6-14.<br />
Sachße, C, Tennstedt, F., 1982: „Familienpolitik durch Gesetzgebung: Die juristische<br />
Regulierung der Familie", in: Kaufmann, F.-X., Hg., Staatliche Sozialpolitik <strong>und</strong><br />
Familie, <strong>München</strong>/Wien, S. 87-130.<br />
Siebel, W., 1984: Herrschaft <strong>und</strong> Liebe. Zur Soziologie der Familie, Berlin.<br />
Schelsky, H., 1953: Wandlungen der deutschen Familie in der Gegenwart. Darstellung<br />
<strong>und</strong> Deutung einer empirisch-soziologischen Tatbestandsaufnahme, Stuttgart.<br />
Schmucker, H. u.a., 1961: Die ökonomische Lage der Familie in der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland, Stuttgart.<br />
Schreiber, W., 1955: „Existenzsicherheit in der industriellen Gesellschaft. Vorschläge<br />
zur Sozialreform", in: Schriftenreihe des B<strong>und</strong>es Katholischer Unternehmer, Heft<br />
3, Köln.<br />
Schweitzer, R. von, 1981: „Wert <strong>und</strong> Bewertung der Arbeit im Haushalt", in: Dies., Hg.,<br />
Leitbilder für Familie <strong>und</strong> Familienpolitik, Festgabe für Helga Schmucker, Berlin,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
S. 167-192.<br />
Tyrell, H., 1981: „Soziologische Überlegungen zur Struktur des bürgerlichen Typus der<br />
Mutter-Kind-Beziehung", in: Matthes, J., Hg., Lebenswelt <strong>und</strong> soziale Probleme.<br />
Verhandlungen des 20. Deutschen Soziologentages zu Bremen 1980, Frankfurt,<br />
S. 417-428.<br />
Windhoff-Heritiér, A., 1982: „Selbsthilfe-Organisationen. Eine Lösung für die Sozialpolitik<br />
der mageren Jahre?", in: Soziale Welt 1, S. 49-65.<br />
Wingen, M., 1964: Familienpolitik. Ziele, Wege <strong>und</strong> Wirkungen, Paderborn.<br />
Wurzbacher, G., 1952: Leitbilder gegenwärtigen deutschen Familienlebens, Stuttgart.<br />
—, u.a., 1958: Die junge Arbeiterin, <strong>München</strong>.<br />
Zacher, H., 1984: „Der gebeutelte Sozialstaat in der wirtschaftlichen Krise", in: Sozialer<br />
Fortschritt 1, S. 1-12.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ZUR ENTWICKLUNG LOKALER LEBENSZUSAMMENHÄNGE ALS<br />
GEGENSTAND STADTSOZIOLOGISCHER FORSCHUNG<br />
Ulfert<br />
Herlyn<br />
Es ist nicht zufällig, daß auf diesem Soziologentag Lebenszusammenhänge<br />
an zentraler Stelle thematisiert werden, denn mit dieser Kategorie ist ein<br />
Gegenbegriff zur obsolet gewordenen funktionalen Ausdifferenzierung der<br />
Gesellschaft konzipiert, dem in der Gegenwart ein besonderer Stellenwert<br />
zukommt. Auf der lokalen Ebene von Städten <strong>und</strong> Gemeinden ist der Begriff<br />
des Lebenszusammenhangs aus doppeltem Gr<strong>und</strong> aktuell, indem er<br />
einmal gegen die durchmodernisierte <strong>gesellschaftliche</strong> funktionsspezifische<br />
Aufgliederung des städtischen Raumes gewendet ist <strong>und</strong> zum andern durch<br />
die Einbeziehung von Subjektivität sich gegen eine objektivistische Methodologie<br />
in der Stadtforschung richtet. Ein neues <strong>und</strong> wiedererstarktes Bewußtsein<br />
regionaler Verwurzelung — am deutlichsten ablesbar an den nicht<br />
unerheblichen Widerständen gegen die rigorose Gemeindegebietsreform Anfang<br />
der 70er Jahre — ist lokaler Ausdruck der Kritik an übertriebener Rationalisierung<br />
moderner Gesellschaft. Indem sich der Begriff also gegen Segmentierungstendenzen<br />
im Modernisierungsprozeß industriell-kapitalistischer<br />
Gesellschaft wendet, ist in ihm ein normatives Element enthalten, jedoch entwertet<br />
m.E. die implizite Wertung den Begriff nicht als analytischen Begriff.<br />
Versteht man unter Lebenszusammenhang die Art <strong>und</strong> Weise der Vermittlung<br />
verschiedener Lebensbereiche einzelner Personen oder Personengruppen<br />
in gegenwärtiger <strong>und</strong> lebensgeschichtlicher Perspektive, dann bedeutet<br />
der lokale Aspekt, daß die am jeweiligen Ort des alltäglichen Lebens<br />
herrschenden ökonomischen, politischen, sozial-kulturellen <strong>und</strong> räumlichen<br />
Verhältnisse in ihrer Bedeutung für die Konstitution <strong>und</strong> Struktur des Lebenszusammenhanges<br />
analysiert werden. Vor dem Hintergr<strong>und</strong> fortlaufender<br />
Prozesse der funktionalen Ausdifferenzierung <strong>und</strong> Spezialisierung<br />
kommt jenen Faktoren erhöhte Bedeutung zu, die eine Verklammerung der<br />
parzellierten Teilbereiche bewirken können. In der räumlichen Anordnung<br />
<strong>und</strong> Organisation verschiedener Lebensbereiche in der modernen Stadt bzw.<br />
Stadtregion wie Wohnen, Arbeiten, Konsum, Bildung, Erholung etc. liegt<br />
eine Chance zur Aufrechterhaltung bzw. Wiedergewinnung einheitlicher lokaler<br />
Lebenszusammenhänge im Prozeß <strong>gesellschaftliche</strong>r Entwicklung insofern,<br />
als durch Partizipation <strong>und</strong> Identifikation die Aneignung räumlicher<br />
<strong>und</strong> sozialer Umwelt eher gelingen kann.<br />
Unter dieser Perspektive verfolge ich in groben Zügen retrospektiv den<br />
Beitrag der Stadt- <strong>und</strong> Gemeinde<strong>soziologie</strong> nach dem 2. Weltkrieg bis heute<br />
in 6 Punkten:<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
1. Entsprechend der Forderung einer „vorurteilsfreien empirischen Erforschung<br />
der Großstädte" konzentrierte sich die traditionale Gemeinde<strong>soziologie</strong><br />
der 50er Jahre darauf, „das Großstadtleben in der ganzen Breite <strong>und</strong><br />
Fülle seiner Lebenserscheinungen" (E. Pfeil, 1955, S. 240) darzustellen <strong>und</strong><br />
so den lokalen Lebenszusammenhang möglichst umfangreich abzubilden.<br />
Nach dem ersten Entwurf einer „soziologischen Totale" (Chr. v. Ferber,<br />
1957) der Stadt Darmstadt wurden, von R. Königs theoretischer Konzeptionalisierung<br />
der Gemeinde als 'globale Gesellschaft auf lokaler Basis'<br />
(1958) stark beeinflußt, nun verschiedene Gemeinden, insbesondere Städte<br />
als lokale Einheiten mehr oder weniger vollständig empirisch untersucht:<br />
so folgen empirische Untersuchungen über Euskirchen von R. Mayntz<br />
(1958), Steinfeld von H. Croon <strong>und</strong> K. Utermann (1958), Dortm<strong>und</strong> von<br />
R. Mackensen u.a. (1959), Stuttgart von M. Irle (1960), Karlsruhe von A.<br />
Bergstraesser u.a. (1965), Wolfsburg von M. Schwonke <strong>und</strong> U. Herlyn<br />
(1967), um nur die bekanntesten zu nennen. Die Absicht, die betreffenden<br />
Gemeinden in ihrer <strong>gesellschaftliche</strong>n Totalität zu untersuchen vermischt<br />
sich eng mit dem Interesse, durch die vor Ort gef<strong>und</strong>enen typischen sozialen<br />
Strukturen <strong>und</strong> Prozesse paradigmatisch die <strong>gesellschaftliche</strong>n Verhältnisse<br />
überhaupt abbilden zu wollen (vgl. dazu die Kritik von M. Horkheimer<br />
<strong>und</strong> Th.W. Adorno, 1956). Generell schlägt sich in den stadtsoziologischen<br />
Forschungen im „Gründungsjahrzehnt" (R.M. Lepsius, 1979) die Tendenz<br />
nieder, die Stabilität des sozialen Systems Stadt zu dokumentieren. Der <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Rekonstruktion der B<strong>und</strong>esrepublik entsprach die Reorganisation<br />
bzw. der Wiederaufbau der Städte nach alten traditionsreichen<br />
Mustern, was von der damaligen Stadtforschung eher zustimmend verfolgt<br />
als durch Kritik in Frage gestellt wurde. Über die Probleme der Bildung<br />
lokaler Lebenszusammenhänge hätte es gerade in der damaligen Zeit mit<br />
der Integration von Flüchtlingen <strong>und</strong> Vertriebenen experimentgleiche Situationen<br />
gegeben, die jedoch weitgehend ungenutzt blieben. Insofern kann<br />
trotz des Versuchs der ganzheitlichen Erfassung lokaler Lebensweisen für<br />
die 50er Jahre gerade nicht von einem „goldenen Zeitalter" (A. Hahn u.a.,<br />
1979) der Gemeinde<strong>soziologie</strong> in der BRD gesprochen werden.<br />
Mit der rasanten Stadterweiterung <strong>und</strong> dem umfangreichen inneren<br />
Stadtu<strong>mb</strong>au, die beide als Konsequenzen eines tiefgreifenden ökonomisch<br />
bedingten Wandels der Tertiärisierung der Städte begriffen werden müssen,<br />
in deren Verlauf sich sowohl die City-Funktionen ausdehnten als auch<br />
Wohnbevölkerung verdrängt wurde, entstand in den 60er <strong>und</strong> 70er Jahren<br />
ein starker Verwertungsdruck planender Instanzen auf die stadtsoziologische<br />
Forschung, die sich nun — nicht zuletzt auch unter zunehmenden methodischen<br />
Schwierigkeiten einer gesamtstädtischen Analyse — von totalen<br />
Gemeindestudien ab- <strong>und</strong> vornehmlich jenen Teilräumen zuwendete, in<br />
denen für große Gruppen von Menschen neue lokale Lebenszusammenhänge<br />
gestiftet (Neubauviertel) bzw. bestehende lokale Lebenszusammenhänge<br />
durch Sanierung transformiert wurden (Altbauquartiere).<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
2. Nach den bekannten Arbeiten über die Lebensverhältnisse in den modernen<br />
Großsiedlungen am Stadtrand (vgl. K. Zapf u.a., 1969; R. Weeber,<br />
1971; J.P. Kob, 1972; H. Becker, K.D. Keim, 1977) findet dort die räumliche<br />
Fragmentierung des lokalen Lebenszusammenhangs ihren schärfsten<br />
Ausdruck insofern, als nun die Wohnfunktion von anderen Lebensbereichen<br />
— vor allem der Arbeitswelt — isoliert wurde. Die großflächigen monofunktional<br />
strukturierten Stadtgebiete zwingen den Bewohnern in der<br />
Regel ein spezialisiertes Verhalten auf, indem sie einen kurzfristigen Tätigkeits-<br />
<strong>und</strong> Rollenwechsel erschweren <strong>und</strong> damit einer Zersplitterung eines<br />
sich alltäglich herstellenden Lebenszusammenhangs Vorschub leisten. Über<br />
die reale <strong>und</strong> sy<strong>mb</strong>olisch vermittelte Fragmentierung ehemals zusammenhängender<br />
Lebensformen hinaus produziert die „Parzellierung des Alltags"<br />
(F. Romeiß-Stracke) in monofunktionalen Stadtbereichen wahrscheinlich<br />
auch eine bewußtseinsmäßige Trennung der Lebensbereiche. Ist zunächst<br />
eine Überbrückung der getrennten funktionalen Bereiche ein Problem der<br />
physischen Raumüberwindung einschließlich der damit verb<strong>und</strong>enen Kosten,<br />
insbesondere für ökonomisch benachteiligte Gruppen, so stellt sich das<br />
Problem einer Reintegration ungleich komplizierter, wenn aufgr<strong>und</strong> mangelnder<br />
Erfahrbarkeit der Zusammengehörigkeit verschiedener Lebensbereiche<br />
bei den Betroffenen die psycho-soziale Fähigkeit zur Verklammerung<br />
der Handlungsfelder schwindet.<br />
Die stereotype Reihung von Wohnbauten <strong>und</strong> die vornehmlich vertikale<br />
Stapelung der Wohnungen reduziert — so der durchgehende Tenor der damaligen<br />
Studien — die nachbarlichen Beziehungen auf ein Mindestmaß. Diese<br />
Reduzierung der Nachbarschaft, die als einzig lokal begründete Sozialfiguration<br />
immer wieder vorrangig thematisiert wurde (vgl. zusammenfassend<br />
B. Hamm, 1973), auf ein ritualisiertes Distanzgebaren entfunktionalisierte<br />
sie als soziale Pufferzone zwischen der Sphäre der Öffentlichkeit <strong>und</strong><br />
der Privatheit <strong>und</strong> entwertete sie als Medium der kollektiven Selbstorganisation<br />
im Prozeß möglicher Aneignung der quartierlichen Umwelt: anstelle<br />
der nachbarschaftszentrierten leben sie in einer familienzentrierten Gesellschaft<br />
(vgl. E. Pfeil, 1972). Weder auf der Ebene sozialer Verkehrsformen<br />
noch über die als Sy<strong>mb</strong>olvermittler ungeeignete Rasterarchitektur konnten<br />
jene identifikatorischen Prozesse in Gang gesetzt werden, die in Altbauquartieren<br />
zunehmend entdeckt wurden.<br />
3. Der innere Stadtu<strong>mb</strong>au wird durch eine sog. „Krisenforschung" (J. Mühlich-Klinger,<br />
1979) begleitet, die möglicherweise eine sozialromantisierende<br />
Verklärung des real existierenden sozialen Milieus mit sich gebracht hat. Diese<br />
häufig im Zusammenhang mit Stadtu<strong>mb</strong>auprozessen durchgeführte Forschung<br />
hat in Altbauquartieren eine soziale Dichte <strong>und</strong> Vielseitigkeit des<br />
quartierlichen Lebenszusammenhangs entdeckt: die verschiedenen Funktionen<br />
sind danach oft kleinräumig vermischt, Arbeit ist auch noch ein integraler<br />
Bestandteil des quartierlichen Lebens, die in der Regel sozial strukturell<br />
abgesunkene Wohnbevölkerung ist oft schon über Generationen ansässig,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ökonomisch-finanzielle Notlagen verknüpfen sich mit teils engen sozialen<br />
Verwicklungen im 'Milieu', kollektive Aktionen <strong>und</strong> Selbsthilfe werden<br />
möglich <strong>und</strong> oft genug wird die räumliche Umgebung „emotional fixiert"<br />
(R. König) <strong>und</strong> erlangt dann sy<strong>mb</strong>olische Bedeutung als ein wesentlicher<br />
Pfeiler lokaler Identität, deren kollektiver Charakter sich durch oft jahrelange<br />
individuelle Identifikationsprozesse aufschichtet. Die lokale Bindung<br />
der Bewohner in Altbauquartieren wurde insbesondere offenk<strong>und</strong>ig, als<br />
die Deprivationen des sozial-räumlichen Lebenszusammenhangs durch sanierungsbedingte<br />
erzwungene Umsiedlungen erforscht wurden (vgl. M.<br />
Fried, 1971; für BRD: W. Tessin u.a., 1983).<br />
Der Forschung über Neubauviertel <strong>und</strong> Altbauquartiere ist gemeinsam,<br />
die Bedeutung dieser Teilbereiche für das alltägliche Leben, insbesondere der<br />
sozial <strong>und</strong> ökonomisch schwächeren Sozialschichten herausgearbeitet zu haben.<br />
Sie können gewissermaßen auch heute noch als die Scharniere fungieren,<br />
mit denen sich die gemeinschaftliche Aneignung des Raumes einer kleinen<br />
Gruppe mit der kollektiven Aneignung des gesamtstädtischen Raumes<br />
vermittelt oder anders ausgedrückt: „Ist die Gemeinde die Einheit der Gesellschaft,<br />
so ist das Viertel die Einheit der Lebensform" (R. Mackensen,<br />
1959, S. 22). Dies ist umso erstaunlicher, als aufgr<strong>und</strong> erhöhter räumlicher<br />
Mobilität, technologischer Entwicklungen wie Verbreitung von Telefon <strong>und</strong><br />
dem Auto als „Sy<strong>mb</strong>ol <strong>und</strong> wichtigstes Requisit der überlokalen Verflechtung"<br />
(H. Oswald, 1966) sowie dem Medium Fernsehen <strong>und</strong> neuerdings<br />
Bildschirmtext Tendenzen zur Entlokalisierung lokaler Lebenszusammenhänge<br />
möglich geworden sind. Die offenk<strong>und</strong>ige <strong>und</strong> verbreitete Resistenz<br />
ist im Kontext der involvierten Sozialstruktur zu sehen: die Arbeiterschicht<br />
lebt traditional stärker lokal bezogen, während soziale Mittel- <strong>und</strong> Oberschichten<br />
traditional stärker überregional orientiert sind.<br />
4. Indem sich die empirische Stadtforschung darüber hinaus auf lokal zwar<br />
bedeutsame, aber partielle Problemanalysen wie z.B. nachbarliche Beziehungen,<br />
Mobilitäten, politisches Verhalten, Wohnungsfragen, Probleme öffentlicher<br />
Infrastrukturversorgung etc. eingelassen hat, hat die integrations<strong>und</strong><br />
handlungstheoretisch orientierte empirische Stadt<strong>soziologie</strong> den lokalen<br />
Lebenszusammenhang verschiedener sozialer Gruppen immer mehr aus<br />
den Augen verloren. In gewisser Parallelität zu diesen unter politisch-planerischem<br />
Verwertungsdruck stehenden empirischen Teilanalysen — überwiegend<br />
ex post Problematisierungen ohne weitergehenden prognostischen<br />
Gehalt — wurden die Tendenzen der Fragmentierung lokaler Lebenszusammenhänge<br />
theoretisch relativ früh in den 60er Jahren thematisiert <strong>und</strong> unterschiedlich<br />
interpretiert (vgl. die theoretischen Entwürfe über die Stadt als<br />
Typ lokaler Vergesellschaftung von H.P. Bahrdt (1961), A. Mitscherlich<br />
(1965), H. Oswald (1966), H. Berndt u.a. (1968)). Sie diskutierten damals<br />
schon kritisch Phänomene wie Verlust von Urbanität durch funktionale<br />
Spezialisierung <strong>und</strong> soziale Segregation, Entlokalisierungsprozesse durch<br />
geographische Mobilität, Normpluralismus <strong>und</strong> Abnahme lokaler Sozial-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
kontakte sowie den städtebaulichen Funktionalismus <strong>und</strong> die private Verfügung<br />
über Boden <strong>und</strong> Gebäude <strong>und</strong> haben damit mehr Resonanz in der<br />
Öffentlichkeit gef<strong>und</strong>en als die zumeist detaillistischen empirischen Einzelanalysen<br />
(vgl. die Einschätzung der soziologischen Kulturkritik für die Formation<br />
der Gesellschaft durch R.M. Lepsius, 1979).<br />
5. Seit Ende der 60er Jahre kann man von einer Politisierung der Stadt<strong>soziologie</strong><br />
sprechen, die stärker als zuvor eine Anknüpfung an die allgemeine<br />
Gesellschaftsanalyse <strong>und</strong> staatstheoretische Diskussionen suchte. Auf politökonomische<br />
Theorieansätze zurückgreifend wurden vor allem die sich in<br />
der herrschenden Stadtstruktur <strong>und</strong> -Organisation manifestierenden Restriktionen<br />
für eine Verbesserung von Lebenslagen <strong>und</strong> Entfaltung von Lebenszusammenhängen<br />
besonders für benachteiligte <strong>gesellschaftliche</strong> Gruppen<br />
<strong>und</strong> ihre mögliche Überwindung thematisiert (z.B. Kritik des kapitalistischen<br />
Bodenrechts, Reproduktionschancen <strong>und</strong> kollektive Versorgung, lokale<br />
Macht- <strong>und</strong> Entscheidungsstrukturen <strong>und</strong> Partizipation). Wurde in<br />
früheren Phasen der Forschung die Aneignungsseite städtischer Umwelt<br />
besonders betont, so überwogen nun Arbeiten über Entstehungskontexte,<br />
wobei die Bedingungsfaktoren überwiegend in zentral-staatlichen Regelungen<br />
<strong>und</strong> gesamt<strong>gesellschaftliche</strong>n Verhältnissen gesucht werden; verschiedene<br />
lokale Konstellationen erscheinen nurmehr als Phänomene der Oberflächendifferenzierung<br />
(vgl. u.a. H.G. Helms U.J.Janssen, 1970; H. Faßbinder,<br />
1971).<br />
So lebenswichtig für Teil<strong>soziologie</strong>n auch immer gesamt<strong>gesellschaftliche</strong><br />
theoretische Bezüge sind, so problematisch ist das Aufgehen des spezifischen<br />
Gegenstandsbereichs (in diesem Fall der Stadt) in allgemeiner Gesellschaftsanalyse.<br />
Auch wenn H. Häußermann <strong>und</strong> W. Siebel zukünftige Bemühungen<br />
noch als 'Soziologie der Stadt' titulieren, hat für sie der Gegenstand<br />
eigentlich aufgehört zu existieren, wenn sie der heutigen Stadt die<br />
lokale Identität schlechthin absprechen. Nach ihnen kann die Gemeinde,<br />
bzw. Teile von ihr, heute nicht mehr ein eigener Gegenstand soziologischer<br />
Forschung sein, sondern für sie ist „Stadt also nur der Ort, an dem die Gesellschaft<br />
in ihrer Struktur <strong>und</strong> ihren Konflikten erscheint" (1978, S. 483).<br />
Die städtische Ebene jedoch nur als Ausdruck bzw. Niederschlag gesamtgesellschaftlich<br />
produzierter <strong>und</strong> von dort analysierbarer Einflüsse einzuordnen,<br />
verstellt sich den Blick für die politisch <strong>und</strong> sozial wirksamen Impulse,<br />
die von den örtlichen Verhältnissen für die in ihnen lebenden Menschen<br />
ausgehen <strong>und</strong> für deren Studium geeignete Forschungsansätze entwickelt<br />
werden müssen. — Auch der sozialökologisch orientierten Siedlungs<strong>soziologie</strong><br />
(vgl. stellvertretend J. Friedrichs, 1977) droht — freilich<br />
mit anderen Methoden <strong>und</strong> Erkenntnisinteressen — der Gegenstandsbereich<br />
Stadt weitgehend zu entgleiten (vgl. Kl. Schmals, 1983, S. 94).<br />
6. Wie zu Anfang angedeutet, läßt sich heute überall eine Neuentdeckung<br />
bzw. Aufwertung lokalen Lebens, eine 'Renaissance des Regionalismus'<br />
(vgl. Einleitungsreferat von R. Mayntz) beobachten: Bürgerinitiativen, neue<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
zw. alternative lokale Gruppenkulturen, Widerstände gegen die Gemeindereform,<br />
Selbsthilfeaktionen etc. Dieses neue <strong>und</strong> wiedererstarkte Bewußtsein<br />
regionaler Verwurzelung hängt fraglos zusammen mit Stagnationstendenzen<br />
des sozialen Fortschritts in Großsystemen <strong>und</strong> Großorganisationen<br />
<strong>und</strong> offenbart einen „Rückfall" in den erfahrbaren <strong>und</strong> veränderbaren<br />
Nahbereich sozial-räumlicher Zusammenhänge. Wenn nun „lokale<br />
Identität von Stadtteilen als räumliches, soziales <strong>und</strong> sy<strong>mb</strong>olisch-kulturelles<br />
Phänomen existiert" (F. Romeiß-Stracke, 1984, S. 53), dann werden<br />
von der Stad<strong>soziologie</strong> Aufschluß über ihren Formwandel <strong>und</strong> Antworten<br />
auf die Frage erwartet, wie das alltägliche Leben davon geprägt wird. Auf<br />
der methodischen Ebene sind die Antworten der Stadt<strong>soziologie</strong> im Zusammenhang<br />
mit dem Wandel von quantitativen zu qualitativen Verfahren in<br />
der empirischen Sozialforschung zu sehen: Abkehr von großangelegter Umfrageforschung<br />
<strong>und</strong> Hinwendung zur biographischen Methode. Indem sie<br />
an den lebensgeschichtlich begründeten subjektiven Erfahrungen <strong>und</strong><br />
durch sie begründeten Erwartungen ansetzt, gewinnt sie m.E. neue Möglichkeiten,<br />
lokale Zusammenhänge <strong>und</strong> Muster ihrer Aneignung zu erfassen.<br />
Im Rahmen der Trendwende zur historisch-soziologischen Stadtforschung<br />
als Verlaufsforschung muß die A<strong>mb</strong>ivalenz erkannt werden, die<br />
darin liegt, daß über die Erfassung individueller Lebenschancen <strong>und</strong> Lebensrisiken<br />
im räumlichen Zusammenhang die Herausbildung bzw. der Wandel<br />
kollektiver Identitäten verschiedener sozialer Gruppen in diversen Territorien<br />
möglicherweise vernachlässigt wird.<br />
Auf der inhaltlichen Ebene läßt sich z.Z. kaum eine thematische Focussierung<br />
ausmachen; gewissermaßen sind die Freiheitsgrade für stadtsoziologische<br />
Forschung in dem Maße gestiegen, in dem der Verwertungsdruck<br />
abgenommen hat <strong>und</strong> damit mehr Raum für die Diskussion theoretischer<br />
Gr<strong>und</strong>lagen gegeben ist. Wenn man die Bezeichnung „verstädterte Gesellschaft"<br />
ernstnimmt, dann wird der spezifische Formwandel des sozialen<br />
Zusammenhanges in Städten ein Thema der Soziologie bleiben müssen, weil<br />
die Stadt Ausdruck <strong>und</strong> zugleich bestimmendes Element <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Entwicklung ist.<br />
LITERATUR<br />
Bahrdt, H.P. (1961): Die moderne Großstadt. Soziologische Überlegungen zum Städtebau,<br />
Reinbek bei Ha<strong>mb</strong>urg.<br />
Becker, H. <strong>und</strong> Keim, K.D. (1977): Gropiusstadt: Soziale Verhältnisse am Stadtrand,<br />
Stuttgart.<br />
Bergstraesser, A. u.a. (1965): Soziale Verflechtung <strong>und</strong> Gliederung im Raum Karlsruhe,<br />
Karlsruhe.<br />
Berndt, H., Lorenzer, A., Horn, Kl. (1968): Architektur als Ideologie, Frankfurt.<br />
Croon, H. <strong>und</strong> K. Utermann (1958): Zeche <strong>und</strong> Gemeinde, Untersuchungen über den<br />
Strukturwandel einer Zechengemeinde im nördlichen Ruhrgebiet, Tübingen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Fassbinder, H. (1971): „Kapitalistische Stadtplanung <strong>und</strong> die Illusion demokratischer<br />
Bürgerinitiative", in: Probleme des Klassenkampfes, 1971, Sonderheft 1, Berlin.<br />
Ferber, Chr.v. (1957): „Die Gemeindestudie des Instituts für Sozialwissenschaftliche<br />
Forschung, Darmstadt", in: König, R. (Hrsg.), Soziologie der Gemeinde, Sonderheft<br />
1 der KZfSS, Opladen.<br />
Fried, M. (1971): „Trauer um ein verlorenes Zuhause", in: Büro für Stadtsanierung <strong>und</strong><br />
soziale Arbeit (Hrsg.), Sanierung für wen?, Berlin.<br />
Friedrichs, J. (1977): Stadtanalyse. Soziale <strong>und</strong> räumliche Organisation der Gesellschaft,<br />
Reinbek bei Ha<strong>mb</strong>urg.<br />
Häussermann, H. <strong>und</strong> W. Siebel (1978): „Thesen zur Soziologie der Stadt", in: Leviathan,<br />
H. 4, Opladen.<br />
Hahn, A., Schubert, H.A., Siewert, HJ. (1979): Gemeinde<strong>soziologie</strong>, Stuttgart.<br />
Hamm, B. (1973): Betrifft: Nachbarschaft. Verständigung über Inhalt <strong>und</strong> Gebrauch<br />
eines vieldeutigen Begriffes, Düsseldorf.<br />
Helms, H.G., Janssen, J. (Hrsg.) (1970): Kapitalistischer Städtebau, Neuwied.<br />
Horkheimer, M., Adorno, Th.W. (1956): „Gemeindestudien", in: Institut für Sozialforschung<br />
(Hrsg.), Soziologische Exkurse, Frankfurt a.M. u. Köln.<br />
Irle, M. (i960): Gemeindesoziologische Untersuchungen zur Ballung Stuttgarts, Bad<br />
Godesberg.<br />
Kob, J.P. u.a. (1972): Städtebauliche Konzeptionen in der Bewährung: Neue Vahr,<br />
Göttingen.<br />
König, R. (1958): Gr<strong>und</strong>formen der Gesellschaft: Die Gemeinde, Ha<strong>mb</strong>urg.<br />
Lepsius, R.M. (1979): „Die Entwicklung der Soziologie nach dem Zweiten Weltkrieg<br />
1945 bis 1967", in: KZfSS, Sonderheft 21, Deutsche Soziologie seit 1945, hrsg.<br />
von G. Lüschen, Opladen.<br />
Mackensen, R. u.a. (1959): Daseinsformen der Großstadt, Tübingen.<br />
Mayntz, R. (1958): Soziale Schichtung <strong>und</strong> sozialer Wandel in einer Industriegemeinde,<br />
Stuttgart.<br />
Mitscherlich, A. (1965): Die Unwirtlichkeit unserer Städte, Frankfurt a.M.<br />
Mühlich-Klinger, J. (1979): „Das soziale Leben in innerstädtischen Wohnquartieren",<br />
in: Wohnen in der Stadt. Veröffentlichungen des Seminars für Planungswesen der<br />
TU Braunschweig, H. 18.<br />
Oswald, H. (1966): Die überschätzte Stadt. Ein Beitrag der Gemeinde<strong>soziologie</strong> zum<br />
Städtebau, Olten u. Freiburg im Breisgau.<br />
Pfeil, E. (1950 u. ^1972): Großstadtforschung. Entwicklung <strong>und</strong> gegenwärtiger Stand,<br />
Hannover.<br />
—, (1955): „Soziologie der Großstadt", in: A. Gehlen u. H. Schelsky (Hrsg.): Soziologie.<br />
Ein Lehr- <strong>und</strong> Handbuch zur modernen Gesellschaftsk<strong>und</strong>e, Düsseldorf —<br />
Köln.<br />
Romeiß-Stracke, F. (1984): „Freizeitorientierte Wohnumfeldverbesserung <strong>und</strong> lokale<br />
Identität", in: Institut für Landes- <strong>und</strong> Stadt<strong>entwicklung</strong>sforschung (Hrsg.), Handlungsfeld<br />
Freizeit, Dortm<strong>und</strong>.<br />
Schmals, Kl.M. (1983): „Soziologie der Stadt", in: Ders. (Hrsg.): Stadt <strong>und</strong> Gesellschaft,<br />
<strong>München</strong>.<br />
Schwonke, M. u. U. Herlyn (1967): Wolfsburg. Soziologische Analyse einer jungen<br />
Industriestadt, Stuttgart.<br />
Tessin, W. u.a. (1983): Umsetzung <strong>und</strong> Umsetzungsfolgen in der Stadtsanierung, Basel.<br />
Weeber, R. (1971): Eine neue Wohnumwelt, Stuttgart u. Bern.<br />
Zapf, K., Heil, K. u. J. Rudolph (1969): Stadt am Stadtrand, Frankfurt a.M.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ZUR DYNAMIK UND POTENTIALITÄT STÄDTISCHER<br />
LEBENSFORMEN<br />
Karl-Dieter<br />
Keim<br />
Die Herlynsche Zwischenbilanz hinterläßt eine ganze Reihe von A<strong>mb</strong>ivalenzen.<br />
Wir sind weit entfernt von einer klaren Vorstellung darüber,<br />
wie die beobachtbaren städtischen Symptome zu interpretieren wären.<br />
Das gilt für jene Prozesse, die häufig als Segregation oder als Parzellierung<br />
bezeichnet werden. Das gilt für die Frage, welche Bedeutung bei der künftigen<br />
städtischen Entwicklung den örtlichen Lebenszusammenhängen beizumessen<br />
ist. Das gilt vollends für die Frage, inwieweit wir soziologisch<br />
von städtischen Besonderheiten sprechen können, die innerhalb der gesamt<strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Prozesse einen spezifischen Beitrag leisten.<br />
Ich möchte angesichts dieser Einschätzung der Versuchung widerstehen,<br />
die prospektiven Möglichkeiten der Stadt<strong>soziologie</strong> in eine Form<br />
zu kleiden, die inzwischen modisch zu werden scheint: in Szenarios, in<br />
alternative Entwürfe der zukünftigen Stadt. Wir sind mit solchen Aktivitäten,<br />
ob wir dies wollen oder nicht, Mitwirkende bei der Definition <strong>und</strong><br />
Durchsetzung von Bedeutungen, von einem Bild der Stadt. Unverkennbar<br />
gehen in solche Szenarios Ad-hoc-Aussagen, administrativ produzierte<br />
Daten <strong>und</strong> selektive Sichtweisen ein. Das muß dann als problematisch<br />
empf<strong>und</strong>en werden, wenn ohne historische Langsicht <strong>und</strong> ohne den Prozeß<br />
einer distanznehmenden Theoriebildung Vorhersagen versucht werden.<br />
Mein Vorschlag ist daher, an die Frage nach der Zukunft städtischer<br />
Lebenszusammenhänge nicht prognostisch, sondern als Konzeptualisierung<br />
einer Forschungsperspektive heranzugehen. Ich möchte einige Überlegungen<br />
vortragen, wie die Soziologie sich vom künftigen städtischen Leben<br />
einen Begriff machen kann. Diese Absicht bedarf sowohl empirisch gehaltvoller<br />
Konzepte als auch einer normativen Orientierung. Zu beidem gibt<br />
es Entwürfe, insbesondere von französischen <strong>und</strong> englischen Autoren.<br />
Wenn ich ihnen weitgehend folge, so vor allem deshalb, weil sie uns trotz<br />
zum Teil unterschiedlicher städtischer Problemstrukturen in Frankreich<br />
oder England wichtige Impulse zu geben vermögen — Impulse, die von<br />
breiteren Theoriezusammenhängen <strong>und</strong> von der Suche nach synthetischen<br />
Begriffen gekennzeichnet sind. Die Bearbeitung zerstückelter, oft vordefinierter<br />
Fragestellungen anhand einer ausufernden Begrifflichkeit weicht<br />
insoweit einer eher ganzheitlichen Zugangsweise. Die Kategorie des „Lebenszusammenhangs"<br />
könnte dazu ein geeignetes Hilfsmittel sein.<br />
Der Wunsch, städtische Prozesse nicht nur analysierend nachzuvollziehen,<br />
sondern ihre verborgenen Widersprüche, Spannungsmomente <strong>und</strong><br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Strömungen aufzudecken <strong>und</strong> zu strukturieren, bedarf normativer gesellschaftstheoretischer<br />
Bezugspunkte. Wir besitzen solche Bezugspunkte z.B.<br />
in dem skizzenhaften Entwurf einer „Urbanen Gesellschaft" des französischen<br />
Sozialphilosophen Henri Lefebvre (insbesondere Lefèbvre 1972).<br />
Er gewinnt diesen Entwurf aus einer ideologiekritischen Analyse der sog.<br />
urbanistischen Denkweise. Sie, so Lefèbvre, beharrt trotz städtischer<br />
Krisen darauf, mit Hilfe einer industriell-modernen Rationalität ein höheres<br />
Organisationsprinzip für das städtische Leben zu finden <strong>und</strong> durchzusetzen.<br />
Sie organisiert den Zerfall, segmentierte Nutzungs- <strong>und</strong> Verwertungsprozesse,<br />
individualisierte Konsumtions- <strong>und</strong> Kontrollprozesse. Es ist<br />
dieses industriell-moderne Organisationsprinzip, das wir in H<strong>und</strong>erten von<br />
stadtsoziologischen Studien mit reproduziert haben — dabei ist die selektive<br />
Bearbeitung städtischer sozialer Probleme nur die Kehrseite derselben<br />
Medaille. Dem herrschenden Prinzip ist statt dessen die Enthüllung<br />
seiner Ideologie entgegenzusetzen. In destruktiver Weise — so Lefèbvre<br />
weiter — müssen Abtrennungen, Hindernisse, Blockierungen, die in dem<br />
Organisationsprinzip enthalten sind, überw<strong>und</strong>en werden. Und indem<br />
dies (praktisch) geschieht, kommt die neue Qualität des Urbanen zum<br />
Vorschein: „die Einheit aus Widersprüchen, (der) Ort..., an dem Konflikte<br />
Ausdruck finden" (Lefèbvre 1972, 186). Auf diese Weise könne<br />
städtisches Leben neu begriffen werden. Die daraus erwachsende „Urbane<br />
Praxis" müsse sich lösen von den Verheißungen <strong>und</strong> Maßstäben<br />
der Industriegesellschaft, gewissermaßen zu sich selbst kommen, ausgerichtet<br />
an der Kategorie der Möglichkeit. So entstehe ein neuer, offener<br />
Weg — kein fertiges Modell —, verdeutlicht mit Hilfe der politischen<br />
Analyse.<br />
1. Die Urbane Praxis<br />
Im Hinblick auf diese „Urbane Praxis", die von konflikthaften Auseinandersetzungen<br />
gekennzeichnet ist, erscheinen die bisher weit verbreiteten<br />
Deutungsweisen der städtischen Lebenszusammenhänge als unzureichend.<br />
In ihnen wird von einem integrations-theoretischen Gr<strong>und</strong>verständnis<br />
ausgegangen. Auch wenn häufig kritische <strong>und</strong> negative Charakterisierungen<br />
damit verb<strong>und</strong>en sind, bleibt doch die diffuse Vorstellung von einer sozialen<br />
Integration der Maßstab. Das Leben in Städten gewissermaßen als<br />
Garant für den sozialen Zusammenhalt in einer technisierten Gesellschaft —<br />
Urbanität als notwendiges Korrelat zur Urbanisierung.<br />
Es ist auch nicht mehr ausreichend, pauschal von politisch-ökonomischen<br />
Prozessen zu sprechen, die in den Städten <strong>und</strong> in der städtischen<br />
Lebensweise ihren Niederschlag finden. Castells, der französische Stadtsoziologe,<br />
dem wir wichtige Arbeiten nicht nur zur Stadt<strong>entwicklung</strong><br />
in Europa sondern auch in den USA <strong>und</strong> in Lateinamerika verdanken,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ückt in seiner jüngsten Veröffentlichung davon ab, die wesentlichen städtischen<br />
Prozesse pauschal der „Logik des Kapitals" zuzuschreiben.<br />
Was aber dann? Wenn weder die Integrationsfunktion noch die einseitige<br />
Dominanz durch das Kapital zugr<strong>und</strong>e gelegt werden können, worin zeigen<br />
sich heute die wesentlichen Merkmale städtischer Lebensweise?<br />
Es sind vor allem zwei theoretische Konzepte, die uns in dieser Hinsicht<br />
weiterhelfen können:<br />
— Die „kollektive Konsumtion"<br />
Mit zunehmender staatlicher Durchdringung der ökonomischen Prozesse<br />
haben sich im Zusammenwirken von Produktion <strong>und</strong> Konsumtion besondere<br />
städtische Formen herausgebildet. Die allgemeinen marktförmigen Prozesse<br />
prägen das städtische Leben durch Standortentscheidungen, Arbeitsplatzstrukturen,<br />
dichte Zirkulation <strong>und</strong> individuelle Angebotsstrategien.<br />
Charakteristisch für den städtischen Raum sind jedoch in wachsendem Umfang<br />
Dienste oder Einrichtungen, die öffentlich mit nieht-marktförmigen<br />
Zugangsregelungen <strong>und</strong>/oder staatlicher Unterstützung angeboten werden<br />
(Castells 1976, 1977, 1978; Sa<strong>und</strong>ers 1981). Dazu gehören etwa die staatlich<br />
geförderten oder öffentlich verwalteten Wohnungen, die sozialen Dienste<br />
für einzelne Klientengruppen, die öffentlichen Bildungs- <strong>und</strong> Erziehungseinrichtungen,<br />
die Einrichtungen der technischen Infrastruktur (Ver- <strong>und</strong><br />
Entsorgung) für die privaten Haushalte, der öffentliche Verkehr oder auch<br />
die Angebote der kommunalen Kulturpolitik. Derartige Ressourcen, die<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich der Reproduktion der Arbeitskraft dienen, werden zusammenfassend<br />
als Mittel <strong>und</strong> Formen der „kollektiven <strong>und</strong> sozialen Konsumtion"<br />
bezeichnet. Als typisch gelten für sie — <strong>und</strong> das ist eine empirische<br />
Aussage — Widersprüche zwischen den Imperativen ihrer Produktion <strong>und</strong><br />
der Regulierung ihrer Konsumtion (da Marktmechanismen nicht funktionieren,<br />
muß oft der Zwangskonsum herhalten; die Sozialinvestitionen stehen<br />
vielfach in einem Mißverhältnis zu den konkret erbrachten Dienstleistungen).<br />
Ein Teil der Widersprüche beruht zweifellos darauf, daß über die<br />
kollektive Konsumtion Marktprozesse öffentlich vermittelt werden (aktuelles<br />
Beispiel: Kabelfernsehen). Andererseits zeigt sich aber auch, daß in<br />
der Aneignung dieser Ressourcen eigenständige Definitions- <strong>und</strong> Gestaltungsprozesse<br />
höchst unterschiedlicher sozialer Gruppierungen Ausdruck<br />
finden. Mit anderen Worten: In den Mitteln der kollektiven Konsumtion<br />
wird seitens der Anbieter (Staat <strong>und</strong> Versorgungsträger) eine Gewähr dafür<br />
gesehen, daß die für notwendig erachteten städtischen Prozesse nach ihren<br />
Relevanzstrukturen durchgesetzt werden können, während die so politisierte<br />
<strong>und</strong> vereinheitlichte Konsumtion tendenziell auch als Anlaß für soziale<br />
Mobilisierungen dienen kann. Allgemein werden auf seiten der Benutzer<br />
die Gebrauchswerteigenschaften betont, wobei die Interpretations- <strong>und</strong><br />
Aneignungsweisen der Frauen eine besondere Rolle spielen. Der englische<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Stadtsoziologe Pahl wies darauf hin, daß vor allem die produktiven Aspekte<br />
innerhalb der Prozesse der kollektiven Konsumtion über Jahrzehnte hinweg<br />
ignoriert worden seien (Pahl 1983, 377 ff.). Der sog. informelle Sektor<br />
müsse thematisiert, <strong>und</strong> die falsche Trennung der Domänen zwischen Mann<br />
<strong>und</strong> Frau müsse bereits in den Untersuchungsansätzen überw<strong>und</strong>en werden.<br />
— Die „basispolitische Interessendurchsetzung"<br />
Die Eigenart <strong>und</strong> die Widersprüchlichkeit der kollektiven Konsumtion haben<br />
wesentlich dazu beigetragen, daß besondere städtische Konflikte <strong>und</strong><br />
besondere städtische Formen der Konfliktaustragung entstanden sind. Das<br />
bedeutet nicht einfach eine Wiederbelebung lokaler, eng begrenzter Interessenwahrnehmung.<br />
Die allgemein dominierenden Zentralisierungsprozesse,<br />
die zu korporatistisch verfaßten, relativ starren Formen der Interessenorganisation<br />
geführt haben, geben zwangsläufig auch der basispolitischen Auseinandersetzung<br />
ihr Gepräge. In den zahllosen Studien über Probleme der<br />
Stadterneuerung, der Wohnungspolitik, der Verkehrspolitik oder einzelner<br />
sozialer Dienste konnte jedoch nachgewiesen werden, daß Partizipationsforderungen<br />
<strong>und</strong> Konfliktaustragungen einen relativ starken städtischen Bezug<br />
aufweisen. Nicht nur bieten Praktiken der Stadtpolitik häufig den Anlaß;<br />
in den sozialen Aktionen <strong>und</strong> in den Definitionsprozessen von „unten"<br />
kommen auch Vorstellungen von überschaubaren städtischen Einheiten<br />
zum Tragen. Es werden vielfältige, spontane <strong>und</strong> punktuelle Formen der<br />
direkten Interessendurchsetzung gesucht, die freilich häufig einen rein defensiven<br />
Charakter aufweisen. Die von dem Engländer Sa<strong>und</strong>ers wie von<br />
Castells betonten städtischen Konflikte <strong>und</strong> Kämpfe können bereits in ihrer<br />
defensiven Variante ein Potential für Prozesse sozialer Mobilisierung darstellen,<br />
indem kollektive Erfahrungen organisiert <strong>und</strong> alternative Relevanzstrukturen<br />
entwickelt werden. Dies gilt um so mehr dann, wenn die Interessenwahrnehmungen<br />
vereinzelt den Charakter städtischer sozialer Bewegungen<br />
annehmen. Sie sind durchaus — wollen wir Castells weiter folgen — als<br />
reaktiv anzusehen, als Signal, als Symptom dafür, daß mit den Modernisierungsprozessen<br />
auch deren soziale Grenzen aktualisiert werden <strong>und</strong> daß in<br />
den zentralen <strong>gesellschaftliche</strong>n Bereichen der Produktion, der Kultur <strong>und</strong><br />
der politischen Macht notwendige soziale Veränderungen unterbleiben<br />
(Castells 1983, 326 ff.). Städtische soziale Bewegungen transformieren die<br />
Rolle <strong>und</strong> die Bedeutung der Stadt, sie können aber nicht aus ihrer Kraft<br />
<strong>gesellschaftliche</strong> Veränderungen bewirken.<br />
Diejenigen Aspekte städtischen Lebens, die mit den beiden Konzepten<br />
der „kollektiven Konsumtion" <strong>und</strong> der „basispolitischen Interessendurchsetzung"<br />
ins Blickfeld rücken, bilden wichtige Felder der „Urbanen Praxis".<br />
Die Dynamik dieser Prozesse verkörpert zwar weiterhin die industriell-moderne<br />
Rationalität einer urbanistischen Denkweise, aber sie hat offenk<strong>und</strong>ig<br />
auch andersartige, lebenspraktische Handlungsweisen hervorgebracht. Sie<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
vermögen der Ideologie des Urbanismus selbstdefinierte Vorstellungen vom<br />
städtischen Leben entgegenzustellen.<br />
2. Die urbane Form<br />
Die Frage bleibt allerdings bisher unbeantwortet, inwieweit solche lebenspraktischen<br />
Prozesse trotz der trennenden <strong>und</strong> blockierenden Organisation<br />
der städtischen Funktionen wirklich zu Lebenszusammenhängen oder kollektiven<br />
Mobilisierungen führen können. Dies ist die Frage nach der Bedeutung<br />
des städtischen Raums für die soziale Organisation.<br />
Zunächst ist es wichtig zu erkennen, daß die räumlichen Strukturen, getrennt<br />
von den sozialen Strukturen, unter eigenen <strong>gesellschaftliche</strong>n Bedingungen<br />
hergestellt <strong>und</strong> organisiert werden. Es wäre falsch, den Gegenstand<br />
einer Soziologie des Raumes einfach mit dem Gegenstand von Sozialtheorien<br />
zu vermischen. Räumliche Bedingungen sind nicht die Ursache — eher<br />
Ausdruck — städtischer Probleme. Selbstkritisch ist aus der Sicht der Stadt<strong>soziologie</strong><br />
dazu zu sagen, daß in unzähligen Studien vorschnell <strong>und</strong> theorielos<br />
unmittelbare Kausalbeziehungen zwischen räumlichen Merkmalen <strong>und</strong><br />
Sozialverhalten behauptet worden sind. Von erheblichem Interesse ist jedoch,<br />
ob wir von Besonderheiten sprechen können, die sich aus dem Zusammentreffen<br />
raumstruktureller <strong>und</strong> sozialstruktureller Eigenschaften ergeben.<br />
Wir können dies tun — <strong>und</strong> jetzt greife ich einen weiteren konzeptionellen<br />
Vorschlag von Lefèbvre auf —, indem wir das spezifisch Städtische<br />
als eine Form verstehen <strong>und</strong> deren charakteristisches Merkmal als Zentralität<br />
bezeichnen. „Zentralität" ist eine materiell nicht ablesbare städtische<br />
Qualität, die soziale Beziehungen zusammenführen <strong>und</strong> zusammenbinden<br />
kann, die Verstreutes anhäuft, Unterschiedliches versammelt <strong>und</strong> vereinigt.<br />
Sie wirkt dynamisch, fast jeder Ort kann diese Zentralität erlangen, Einzelteile<br />
rücken funktional näher zusammen, andere Orte bzw. Einzelteile werden<br />
abgesondert, peripherisiert. Und sie wirkt produktiv. Sie dramatisiert<br />
Widersprüchliches, soziale Polarisierungen, sie schafft Netze für Austausch<strong>und</strong><br />
für Produktionsbeziehungen, sie spitzt Problemlagen <strong>und</strong> Konflikte zu.<br />
Wenn wir von der industriell-modernen Urbanisierung sprechen, so sind<br />
damit <strong>gesellschaftliche</strong> Veränderungen in der Urbanen Form gemeint, d.h.<br />
im Sog einer dynamischen Zentralität. Dabei wird der wirtschaftlich <strong>und</strong><br />
technologisch induzierte Prozeß befördert, den Zusammenhang zwischen<br />
dem städtischen Leben <strong>und</strong> der räumlichen Bedeutung zu trennen, den<br />
Menschen die auf Erfahrung beruhenden Orte <strong>und</strong> Räume zu nehmen.<br />
„Zentralität" versammelt <strong>und</strong> kanalisiert aber auch die Widerstandsformen,<br />
die sozialen Milieus, die direkte Interessenorganisation. Die urbane<br />
Form verkörpert immer die Ergebnisse aus beiden Prozessen, aus dem Bedeutungsverlust<br />
durch Modernisierung, aus dem Bedeutungszuwachs durch<br />
soziale Mobilisierung.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Das Leben in Städten — so lassen sich die Überlegungen zusammenfassen<br />
— weist Züge auf, die von kollektiver Konsumtion <strong>und</strong> von basispolitischer<br />
Interessendurchsetzung in der Form <strong>und</strong> Dynamik der Zentralität<br />
geprägt sind. Die Formkraft des Städtischen hat mich dazu veranlaßt,<br />
lieber von städtischen Lebensformen als von Lehenszusammenhängen<br />
zu sprechen. Die Lebensformen mögen latent auf Klassenlage oder<br />
Schichtzugehörigkeit beruhen. In ihrer Praxis, in ihrer Ausdrucks- <strong>und</strong> Organisationsfähigkeit<br />
werden sie stets von der je wirksamen Kraft der Urbanen<br />
Form bestimmt — eine Betrachtungsweise, die die Suche nach neuen<br />
sozialstrukturellen Konstitutionsbedingungen nahelegt. Zudem „drängt"<br />
der Begriff „Lebensformen" danach, vor allem auf Minoritäten angewendet<br />
zu werden, die sich gesellschaftlich dadurch Raum verschaffen wollen, daß<br />
sie ihre Lebensauffassungen besonders deutlich (<strong>und</strong> geformt) darstellen —<br />
als Lebensentwürfe, die exemplarisch praktiziert werden.<br />
3. Die Potentialität des Städtischen<br />
Dem englischen Kulturtheoretiker Raymond Williams verdanken wir einige<br />
hervorragende literaturtheoretische Analysen der englischen Großstadtliteratur<br />
des 19..Jahrh<strong>und</strong>erts. Auch dort ist zunächst von Trennung <strong>und</strong> Zerfall<br />
die Rede, von der „Auflösung der Gesellschaft gerade im Moment ihrer<br />
Aggregation". Aber Williams entdeckt in dieser Literatur (insbesondere von<br />
Dickens) nicht nur kompensierende Integrationsstrategien, sondern auch<br />
„neue soziale Denk- <strong>und</strong> Organisationsformen", Elemente der Demokratisierung.<br />
Die neue Lokalverwaltung, die Parlamentsreform, die Ausbildungsregelungen,<br />
der Kulturausbau, nicht zuletzt die Arbeiterbewegung — alle<br />
sen — weist Züge auf, die von kollektiver Konsumtion <strong>und</strong> von basispolitischer<br />
Interessendurchsetzung in der Form <strong>und</strong> Dynamik der Zentralität<br />
geprägt sind. Die Formkraft des Städtischen hat mich dazu veranlaßt,<br />
lieber von städtischen Lehensformen als von Lebenszusammenhänte<br />
haben wir nach anderen Erwiderungen der Stadt zu suchen. Aus methodologischen<br />
Gründen ließe sich sagen, die „urbane Praxis" allein — ihre<br />
Brüche, ihre Erfahrungen, ihre Formen — zeige den künftigen <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Gehalt der Städte an. Dies wäre auch deswegen naheliegend, weil die<br />
weiter wachsende Zentralisierung <strong>gesellschaftliche</strong>r <strong>und</strong> politischer Macht<br />
es schwerlich erlaubt, eine gesellschaftlich bedeutsame Potentialität ausgerechnet<br />
aus den Städten zu erhoffen, ausgerechnet aus den Sphären der<br />
kollektiven Konsumtion <strong>und</strong> der Interessenwahrnehmung von „unten".<br />
Aber wäre das nicht vorschnell? Würde eine solche Haltung der Negativität<br />
nicht leugnen, daß die Städte bis heute immer wieder wichtige Impulse<br />
hervorbringen, <strong>und</strong> daß viele neue Erfahrungen gerade in den genannten<br />
Sphären der „Urbanen Praxis" gemacht werden? Die Antwort besteht in<br />
der methodologischen <strong>und</strong> theoretischen Perspektive, die wir auswählen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Ich halte es für widersprüchlich, „Praxis" zum entscheidenden Kriterium zu<br />
erheben <strong>und</strong> dann selbst in einer „unpraktischen" Haltung der Negativität<br />
zu verharren. Dies muß um so mehr gelten, wenn angesichts elementarer<br />
menschlicher Gefährdungen gerade soziale <strong>und</strong> kulturelle Steuerungspotentiale<br />
als überlebensnotwendig erscheinen. Die zuvor genannten Autoren haben<br />
teilweise selbst einen solchen Perspektivenwechsel vollzogen (insbesondere<br />
Castells). Die überwiegend staatstheoretischen Ansätze haben durch<br />
eher kulturtheoretische Ansätze ein Gegengewicht erhalten.<br />
Zwar wird unsere Lebensweise weiter der industriell-modernen Rationalität<br />
ausgeliefert bleiben. Aber das Städtische daran, die städtischen Lebensformen<br />
werden dem soziale Grenzen <strong>und</strong> eine eigenständige Potentialität<br />
entgegensetzen. Die Organisation der kollektiven Konsumtion <strong>und</strong> die basispolitischen<br />
Interessenwahrnehmungen können vor allem dank der Eigenschaft<br />
der Zentralität auf <strong>gesellschaftliche</strong> Prozesse ausstrahlen. Auf der institutionellen<br />
Ebene können sie sich innovatorisch auswirken, auf der kollektiven<br />
Ebene können sie die Organisation von Erfahrung ermöglichen,<br />
auf der personalen Ebene können sie die Wiederaneignung von Raum <strong>und</strong><br />
Zeit <strong>und</strong> damit eine Stärkung persönlicher Autonomie begünstigen. Vor<br />
dem Hintergr<strong>und</strong> einer nachlassenden Bedeutung der Lohnarbeit, zunehmender<br />
Autonomie- <strong>und</strong> Demokratisierungsansprüche sowie einer Aktualisierung<br />
weiblicher Prinzipien wird diese Potentialität städtischer Lebensformen<br />
die <strong>gesellschaftliche</strong>n Konflikte sichtbar machen <strong>und</strong> in eine ungewohnte<br />
„urbane Praxis" ausmünden.<br />
Eine Charakterisierung des städtischen Lebens kann dann tragfähig konzeptualisiert<br />
werden, wenn es nicht nur als Ausdruck oder Niederschlag der<br />
ökonomischen <strong>und</strong> politischen Prozesse, sondern in seiner Besonderheit<br />
<strong>und</strong> Potentialität unter kulturtheoretischer Perspektive begriffen wird. Auf<br />
diese Weise kann die Soziologie der Stadt zur Theoriebildung der allgemeinen<br />
Soziologie Wesentliches beitragen.<br />
LITERATUR<br />
Bahrdt, H.P., Die moderne Großstadt, Ha<strong>mb</strong>urg 1969.<br />
Castells, M., „Is There an Urban Sociology?", in: CG. Pickvance (ed.), Urban Sociology,<br />
London 1976, S. 33-59.<br />
—, City, Class, and Power, London 1978.<br />
—, Die kapitalistische Stadt, Berlin 1977.<br />
—, The City and the Grassroots, London 1983.<br />
Flora, P., Modernisierungsforschung, Opladen 1974.<br />
Gans, H., „Urbanität <strong>und</strong> Suburbanität als Lebensformen: eine Neubewertung von Definitionen",<br />
in: U. Herlyn (Hrsg.), Stadt- <strong>und</strong> Sozialstruktur, <strong>München</strong> 1974, S. 67-90.<br />
Harloe, M. <strong>und</strong> E. Lebas (eds.), City, Class, and Capital, London 1981.<br />
Lefèbvre, H., Die Revolution der Städte, Frankfurt 1972.<br />
Pahl, R.E., „Concepts in Context: Pursuing the Urban of 'Urban' Sociology", in: D. Fraser/A.<br />
Sutcliffe (eds.), The Pursuit of Urban History, London 1983, S. 371-382.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Pons, V. <strong>und</strong> R. Francis (eds.), Urban Social Research: Problems and Prospects, London<br />
1983.<br />
Sa<strong>und</strong>ers, P., Social Theory and the Urban Question, London 1981.<br />
Smith, P., The City and Social Theory, Oxford 1980.<br />
Williams, R., Innovationen, Frankfurt 1983.<br />
Williams, R., The Country and the City, London 1973.<br />
Wirth, L., „Urbanität als Lebensform", in: U. Herlyn (Hrsg.), Stadt- <strong>und</strong> Sozialstruktur,<br />
<strong>München</strong> 1974, S. 42-66.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
DIE GESELLSCHAFTLICHE ORGANISATION VON ARBEIT ALS<br />
PROBLEM DER SOZIALPOLITIK<br />
Fritz Böhle<br />
1. Ausgangspunkt<br />
Daß zwischen Sozialpolitik <strong>und</strong> Lohnarbeit ein Zusammenhang besteht,<br />
wird in der wissenschaftlichen <strong>und</strong> politischen Auseinandersetzung mit Sozialpolitik<br />
kaum bestritten — ja, es kann dies sogar als ein Allgemeinplatz<br />
angesehen werden, jedoch mit einer Einschränkung: Einigkeit besteht nur<br />
soweit, als dies die historische Entwicklung im 19. <strong>und</strong> zu Beginn dieses<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts betrifft. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand die Vorstellung,<br />
die Probleme der industriellen Lohnarbeit seien sozialpolitisch weitgehend<br />
bewältigt. Daher ging man davon aus, neue Probleme <strong>und</strong> Anforderungen<br />
an die Sozialpolitik würden sich aktuell <strong>und</strong> zukünftig überwiegend in<br />
Bereichen außerhalb der Lohnarbeit ergeben. Indizien hierfür sah man einerseits<br />
in der Veränderung sozialer Risiken <strong>und</strong> Problemlagen, andererseits<br />
in der Ausweitung <strong>und</strong> Differenzierung sozialpolitischer Institutionen.<br />
Eine solche Deutung der historischen Entwicklung prägte nicht nur die politische<br />
Auseinandersetzung; sie beeinflußte auch nachhaltig sozialwissenschaftliche<br />
Forschungsansätze. Erst die Erfahrungen der anhaltenden Massenarbeitslosigkeit<br />
haben die Aufmerksamkeit wieder stärker auf den Zusammenhang<br />
zwischen Sozialpolitik <strong>und</strong> der <strong>gesellschaftliche</strong>n Organisation<br />
von Arbeit gelenkt. Deshalb scheint es mir angebracht, hier einige Ergebnisse<br />
aus einer Richtung von Sozialpolitikforschung vorzustellen, die<br />
eine etwas andere als die zuvor erwähnte Interpretation der historischen<br />
Entwicklungen nahelegen. Meine These ist: Die entscheidenden Impulse<br />
1<br />
für Veränderungen in der Sozialpolitik kamen nicht nur im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert,<br />
sondern auch in der gesamten weiteren Entwicklung überwiegend aus<br />
Problemen der <strong>gesellschaftliche</strong>n Organisation von Arbeit als Lohnarbeit.<br />
Ich will dies zunächst in einer kurzen retrospektiven Betrachtung näher erläutern<br />
<strong>und</strong> auf diesem Hintergr<strong>und</strong> dann eine Einschätzung der aktuellen<br />
<strong>und</strong> zukünftigen Entwicklungen geben.<br />
2. Zur bisherigen Entwicklung sozialer Problemlagen <strong>und</strong> Sozialpolitik<br />
1. Lohnarbeit beruht darauf, daß keine feste <strong>und</strong> dauerhafte Eingliederung<br />
in einen Arbeitszusammenhang besteht. Die Ausgliederung aus einem Be-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
schäftigungsverhältnis ebenso wie die Nichteingliederung sind strukturell<br />
untrennbar mit der Lohnarbeit verb<strong>und</strong>en. Lohnarbeit beruht andererseits<br />
aber auch darauf, daß die Sicherung der Existenz von einem Beschäftigungsverhältnis<br />
abhängig ist. Es besteht daher auch weitgehend Einigkeit darüber,<br />
daß Gefährdungen der Arbeitsfähigkeit <strong>und</strong> -möglichkeit die zentralen Risiken<br />
sind, die sich bei <strong>und</strong> aus Lohnarbeit ergeben. Um die historischen Entwicklungen<br />
<strong>und</strong> d.h. vor allem die Veränderungen in der Sozialpolitik zu<br />
verstehen, sind hier jedoch drei Differenzierungen notwendig:<br />
Erstens: Die Definition der klassischen sozialen Risiken — wie Krankheit,<br />
Erwerbs- <strong>und</strong> Berufsunfähigkeit, Alter — orientiert sich überwiegend am<br />
physischen Arbeitsvermögen, d.h. dessen Beeinträchtigung oder Erhaltung.<br />
Gerade in den Anforderungen an das physische Arbeitsvermögen haben<br />
sich aber seit Beginn der Industrialisierung durch Mechanisierung <strong>und</strong> Automatisierung<br />
von Produktionsprozessen massive Veränderungen vollzogen.<br />
Neben der unmittelbaren physischen Beanspruchung wurde zunehmend die<br />
psychisch-nervliche Belastbarkeit im Arbeitsprozeß wichtig. Damit veränderte<br />
sich auch die konkrete Ausprägung <strong>und</strong> die Ausbreitung sozialer Risiken<br />
(Berufs- <strong>und</strong> Erwerbsunfähigkeit, Ausgliederung älterer Arbeitskräfte<br />
u.a.). Des weiteren wurden neben der physischen Arbeitsfähigkeit auch<br />
neue <strong>und</strong> zusätzliche Dimensionen menschlichen Arbeitsvermögens für die<br />
Entstehung von Risiken <strong>und</strong> Veränderungen in der Sozialpolitik wichtig:<br />
Ein Beispiel hierfür ist die berufliche Qualifikation. Sie wird in den 60er<br />
Jahren sozialpolitisch als Problem der Anpassung von Arbeitskräften an den<br />
wirtschaftlichen Strukturwandel <strong>und</strong> Veränderungen von Produktionstechniken<br />
aufgegriffen. Und schließlich ist zu berücksichtigen: Die Expansion<br />
industrieller Produktion erfolgte — trotz aller Mechanisierung <strong>und</strong> Rationalisierung<br />
— überwiegend auf der Gr<strong>und</strong>lage von vergleichsweise arbeitsintensiven<br />
Formen der Nutzung von Arbeitskraft, <strong>und</strong> zwar gerade auch in den<br />
neu entstehenden Produktionsbereichen wie der Konsumgüterindustrie <strong>und</strong><br />
dem Dienstleistungsbereich. Dies, d.h. die Art, wie Arbeitskraft im Produktionsprozeß<br />
genutzt wurde — <strong>und</strong> nicht das wirtschaftliche Wachstum als<br />
solches —, führte zu einer massiven quantitativen Ausweitung der Nachfrage<br />
nach Arbeitskraft. Daraus ergab sich — neben qualitativen Veränderungen —<br />
auch eine massive quantitative Ausweitung der mit Lohnarbeit verb<strong>und</strong>enen<br />
Risiken, wodurch auch maßgeblich der Ausbau der Systeme sozialer Sicherung<br />
beeinflußt wurde.<br />
Zweitens: Mit Lohnarbeit verbindet sich eine sehr komplexe <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Strukturierung individueller Existenz- <strong>und</strong> Lebensbedingungen, die weit<br />
mehr umgreift als nur die Verrichtung von Arbeit: Wer seine Existenz durch<br />
Lohnarbeit sichern will, muß nicht nur arbeiten können, er muß darüber<br />
hinaus auch in der Lage sein, auf dem Arbeitsmarkt seine Interessen durchzusetzen;<br />
ferner ist mit Lohnarbeit auch das Angewiesensein auf Fremdleistungen<br />
— im Unterschied zur Selbstversorgung — gesetzt; die zum Leben<br />
notwendigen Güter <strong>und</strong> Dienstleistungen müssen erworben, die Organisation<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
der sog. privaten Reproduktion hieran ausgerichtet werden. Ich brauche<br />
dies hier nicht weiter ausführen <strong>und</strong> möchte folgende Interpretation zu der<br />
bisherigen Entwicklung von Sozialpolitik anschließen. Ein gr<strong>und</strong>legendes<br />
Problem im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert ist: Gefährdungen der Arbeitsfähigkeit <strong>und</strong> eine<br />
Unterbrechung der Beschäftigung beinhalten die Gefahr, daß sie auf die<br />
gesamte Lebenssituation durchschlagen <strong>und</strong> zu einem Herauskippen aus der<br />
Lohnarbeit überhaupt führen. Worum es also von Anfang an in der Sozialpolitik<br />
geht, ist die Absicherung der für Lohnarbeit notwendigen Lebensbedingungen.<br />
Nur auf diese Weise ist Lohnarbeit als nicht nur marginale, sondern<br />
als eine vorherrschende <strong>und</strong> dauerhafte Form von Arbeit gesellschaftlich<br />
durchsetzbar. Damit ist aber auch eine Entwicklung eingeleitet, in der<br />
sich — gerade eine auf Lohnarbeit bezogene — Sozialpolitik im weiteren<br />
Verlauf nicht mehr nur auf das Beschäftigungsverhältnis <strong>und</strong> den Arbeitsmarkt<br />
beschränken kann; vielmehr muß Sozialpolitik auch andere mit<br />
Lohnarbeit verb<strong>und</strong>ene Lebenszusammenhänge einbeziehen, d.h. genauer:<br />
das gesamte Spektrum der sowohl marktwirtschaftlichen als auch staatlichrechtlichen<br />
Vergesellschaftung einer mit Lohnarbeit verb<strong>und</strong>enen Lebensform.<br />
Dabei gilt es zunehmend, sozialpolitische Institutionen hierauf bezogen<br />
auszudifferenzieren.<br />
Drittens: Bei Lohnarbeit ist die Sicherung der Existenz von der Verfügung<br />
über spezifische, materielle, zeitliche, soziale <strong>und</strong> personelle Ressourcen<br />
abhängig. Diese werden aber gerade durch Lohnarbeit selbst permanent<br />
gefährdet <strong>und</strong> beeinträchtigt, d.h. insbesondere durch die Art, wie Arbeitskraft<br />
von den Betrieben im Produktionsprozeß eingesetzt <strong>und</strong> genutzt<br />
wird. Ich kann <strong>und</strong> will hier nicht detaillierter über die Entwicklung von<br />
Belastungen <strong>und</strong> Restriktionen im Arbeitsbereich <strong>und</strong> deren Auswirkungen<br />
referieren; hierzu liegen inzwischen vielfältige Dokumentationen vor. Ich<br />
will statt dessen eine mir für die Sozialpolitik sehr wichtig erscheinende<br />
Veränderung in der historischen Entwicklung herausstellen: Zu Beginn der<br />
Industrialisierung sind Gefährdungen im Produktionsprozeß, ebenso wie deren<br />
Folgen, unmittelbar sieht- <strong>und</strong> erfahrbar, so vor allem hohe physische Belastungen,<br />
Unfallgefahren, überlange Arbeitszeiten, niedrige, kaum die Existenz<br />
sichernde Löhne. Veränderungen im Produktionsprozeß, gesetzliche<br />
<strong>und</strong> tarifvertragliche Mindestnormen ebenso wie die schärfere zeitliche <strong>und</strong><br />
soziale Trennung zwischen Arbeitsbereich <strong>und</strong> anderen Lebensbereichen,<br />
bringen es jedoch mit sich, daß im weiteren Verlauf die Gefährdungen im<br />
Arbeitsprozeß zwar nicht weniger gravierend, aber subtiler werden <strong>und</strong> im<br />
Arbeitsprozeß zumeist latent bleiben. Sie manifestieren <strong>und</strong> aktualisieren<br />
sich überwiegend außerhalb des Produktionsbereichs; prägen damit nachhaltig<br />
die Aktivitäts- <strong>und</strong> Handlungsspielräume in anderen Lebenszusammenhängen,<br />
was jedoch immer schwieriger als Folge von Arbeits- <strong>und</strong> Beschäftigungsbedingungen<br />
erkennbar <strong>und</strong> nachweisbar wird.<br />
Ein erstes Resümee: Sozialpolitik — so läßt sich zeigen — hat sich seit ihren<br />
Anfängen im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert nicht von Problemen der Lohnarbeit emanzi-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
piert. Umgekehrt: Die <strong>gesellschaftliche</strong> Organisation von Arbeit als Lohnarbeit<br />
hat sich von einer zunächst eher marginalen zu einer gesellschaftlich<br />
vorherrschenden Strukturierung von Lebenszusammenhängen entwickelt;<br />
ein Prozeß, der auch mit einer Ausdifferenzierung <strong>und</strong> partiellen Autonomisierung<br />
unterschiedlicher Lebensbereiche verb<strong>und</strong>en war. Daraus — <strong>und</strong><br />
dies ist hier entscheidend — ergaben sich auch neue <strong>und</strong> veränderte Anforderungen<br />
an die Sozialpolitik, die ihrerseits wiederum zur Ausweitung <strong>und</strong><br />
Ausdifferenzierung sozialpolitischer Institutionen führten <strong>und</strong> die letztlich<br />
den modernen Sozial- <strong>und</strong> Wohlfahrtsstaat, wie er sich heute darstellt, hervorbrachten.<br />
2. Kennzeichnend für Sozialpolitik ist aber nicht nur, daß sie sich auf<br />
Voraussetzungen <strong>und</strong> Folgen der <strong>gesellschaftliche</strong>n Organisation von Arbeit<br />
als Lohnarbeit bezieht. Charakteristisch ist auch das Wie, also in welchen<br />
Formen dies geschieht. Für das Verständnis der historischen Entwicklung<br />
scheint mir hier wichtig: Im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert steht bei der Auseinandersetzung<br />
mit der Arbeiter- bzw. der sozialen Frage im Zentrum der Sozialpolitik<br />
das Arbeitsverhältnis; im weiteren Verlauf verlagert sich das Schwergewicht<br />
der Sozialpolitik jedoch auf die Bewältigung von Risiken außerhalb<br />
des Produktionsbereichs. Damit entwickelt sich Sozialpolitik in eine Richtung,<br />
in der nicht nur wichtige Ursachen für die Entstehung von Risiken<br />
aus dem Blickfeld geraten. Es wurde darüber hinaus auch der Produktionsbereich<br />
sozialpolitisch entproblematisiert; sozialpolitische Auseinandersetzungen<br />
wurden vom Produktionsprozeß abgezogen <strong>und</strong> auf andere <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Bereiche verlagert. Damit verbinden sich u.a. auch manifeste<br />
politische Interessen: In der politischen Auseinandersetzung wird im 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert der Aufbau der Sozialversicherung explizit als eine Alternative<br />
zu einem Ausbau des Arbeitsschutzes, d.h. der Regelung von Arbeitsbedingungen<br />
<strong>und</strong> des Arbeitsverhältnisses favorisiert. Auch in den 20er Jahren<br />
war die Entscheidung für die Sozialversicherung zugleich eine Entscheidung<br />
gegen den Arbeitsschutz. Arbeits- <strong>und</strong> Beschäftigungsbedingungen<br />
blieben zwar weiterhin im Blickfeld der Sozialpolitik — insbesondere im<br />
Bereich des Ges<strong>und</strong>heitsschutzes. Jedoch wurden diese Entwicklungen<br />
nicht nur gebremst <strong>und</strong> verzögert. Noch viel folgenreicher war, daß Arbeits-<br />
<strong>und</strong> Beschäftigungsbedingungen zunehmend nur mehr zu einem spezialisierten<br />
Teilgebiet der Sozialpolitik wurden. Ja, es wurde schließlich die<br />
mit Lohnarbeit verb<strong>und</strong>ene Sozialpolitik nur mehr hiermit identifiziert.<br />
Zugleich — <strong>und</strong> dies möchte ich als weiteres herausstellen — wurden Prinzipien<br />
sozialer Sicherung institutionalisiert, die eine Rückbindung der Sozialpolitik<br />
an die <strong>gesellschaftliche</strong> Organisation von Arbeit als Lohnarbeit<br />
garantieren, <strong>und</strong> zwar unabhängig davon, ob dies in der jeweils aktuellen<br />
politischen Auseinandersetzung auch beabsichtigt wurde. Charakteristisch<br />
ist hier: Sozialpolitisch gewährte Leistungen orientieren sich in ihrem Inhalt<br />
<strong>und</strong> ihrer Form nach an der durch Lohnarbeit vorgezeichneten Organisation<br />
materieller <strong>und</strong> sozialer Sicherung. Wenn Einkommen nicht durch Erwerbsarbeit<br />
gesichert werden kann, stellt Sozialpolitik nicht Produktionsmittel<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
oder Vergleichbares zur Verfügung; was gewährt wird, sind monetäre Leistungen<br />
im Sinne eines Lohnersatzes. Sofern Dienst- <strong>und</strong> Sachleistungen<br />
bereitgestellt werden, handelt es sich um eine Ergänzung marktwirtschaftlicher<br />
Versorgung; die Abhängigkeit von „Fremdleistungen" wird hierdurch<br />
nicht verändert, lediglich die Formen des Erwerbs <strong>und</strong> ihrer Nutzung sind<br />
unterschiedlich. Ich will es bei diesen Hinweisen belassen. Entscheidend ist:<br />
Auch wenn sich Sozialpolitik mittlerweile in vielfältigen Formen darstellt,<br />
weisen diese ein gemeinsames Merkmal auf: durch sozialpolitisch gewährte<br />
<strong>und</strong> organisierte Leistungen werden <strong>und</strong> wurden bislang keine zur Lohn<strong>und</strong><br />
Erwerbsarbeit alternativen <strong>und</strong> von ihr unabhängigen Produktions- <strong>und</strong><br />
Lebensformen geschaffen oder zumindest Voraussetzungen hierfür abgesichert.<br />
Im Gegenteil: Wer nicht in ein Beschäftigungsverhältnis eingegliedert<br />
ist <strong>und</strong> auch über sonst keine andere materielle Sicherung verfügt, der<br />
soll, zumindest der Form nach, wie jemand leben, der einer abhängigen Beschäftigung<br />
nachgeht. Jedoch — <strong>und</strong> dies ist ein weiteres Merkmal —, es soll<br />
ihm dabei in jedem Fall <strong>und</strong> teilweise erheblich schlechter gehen, durch finanzielle<br />
Einbußen bis hin zum Erleiden besonderer bürokratischer Kontrollen.<br />
Dabei läßt sich ein vergleichbar simples Prinzip ausmachen: Je geringer<br />
die Nähe zu einem Beschäftigungsverhältnis, um so größer die Abstufung<br />
<strong>und</strong> Diskriminierung durch die soziale Sicherung. Mit dieser Verkoppelung<br />
von formaler Angleichung <strong>und</strong> faktischer Differenzierung trägt Sozialpolitik<br />
wesentlich dazu bei, die durch Lohnarbeit geprägten <strong>und</strong> für sie<br />
notwendigen Lebens- <strong>und</strong> Reproduktionsformen als Normalitätsstandards<br />
gesellschaftlich zu institutionalisieren.<br />
In dieser Perspektive läßt sich die Geschichte der Sozialpolitik auch als<br />
eine Geschichte der Transformation, Kanalisierung <strong>und</strong> Kontrolle anderer<br />
Formen der Bewältigung von Risiken <strong>und</strong> Problemlagen nachzeichnen (siehe<br />
hierzu auch den Beitrag von B. Riedmüller). Sozialpolitik wird auf diese<br />
Weise zu einer wichtigen <strong>gesellschaftliche</strong>n Instanz, durch die der Arbeitsmarkt<br />
reguliert <strong>und</strong> die Kaufkraft umverteilt wird, sozio-kulturelle Normen<br />
der Erwerbsarbeit <strong>und</strong> Lebensführung gesellschaftlich institutionalisiert<br />
werden <strong>und</strong> letztlich damit die politische <strong>und</strong> soziale Akzeptanz einer auf<br />
Lohnarbeit beruhenden Lebensform gestützt wird.<br />
Mit dieser Interpretation von Sozialpolitik unterstelle ich jedoch keinen<br />
platten Funktionalismus oder gar eine prästabilierte Harmonie zwischen<br />
den ökonomisch-politischen Interessen von Betrieben <strong>und</strong> Sozialpolitik. Die<br />
Sache ist komplizierter:<br />
Da Sozialpolitik nur partikular <strong>und</strong> selektiv in einzelne <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Bereiche interveniert, kann sie letztlich auch ihre Wirkungen nicht kontrollieren.<br />
Gerade die Entwicklungen im Produktionsbereich, durch die — wie<br />
gezeigt — Sozialpolitik maßgeblich beeinflußt wird, sind — auf der Gr<strong>und</strong>lage<br />
der skizzierten Formen von Sozialpolitik — kaum steuerbar <strong>und</strong> beeinflußbar.<br />
Sozialpolitik kann daher auch nicht verhindern, daß sich im Produktionsprozeß<br />
Veränderungen abspielen, die auch auf sie selbst zurückschlagen,<br />
d.h. die zu neuen Anforderungen führen, wie aber auch politisch<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
intendierte Wirkungen der Sozialpolitik beeinträchtigen, indem diese in der<br />
konkreten Praxis abgewehrt, neutralisiert oder auch gezielt genutzt <strong>und</strong><br />
funktionalisiert werden.<br />
3. Aktuelle Situation <strong>und</strong> zukünftige Entwicklung<br />
Welche Folgerungen ergeben sich aus dieser Betrachtung der bisherigen Entwicklungen<br />
für die gegenwärtige Situation <strong>und</strong> die Zukunft der Sozialpolitik?<br />
Ich möchte hierzu drei Thesen formulieren. Vorab eine Vorbemerkung:<br />
Seit mehreren Jahren grassiert die Rede von den ökonomischen Grenzen <strong>und</strong><br />
einer entsprechenden Krise des Sozialstaats. Ich finde dieses Gerede von der<br />
ökonomisch begründeten Krise des Sozialstaats jedoch so lange ein Ärgernis,<br />
als nicht zugleich auch von einer Krise des „Rüstungsstaats" gesprochen<br />
wird oder von anderen Krisen, die offenbar durch Wachstumsengpässe hervorgerufen<br />
werden. Ich weigere mich also — auch ohne hier detailliertere<br />
Belege vorzulegen —, neue Probleme <strong>und</strong> zukünftige Entwicklungen in der<br />
Sozialpolitik gegenwärtig als Ausdruck von Wachstumsengpässen u.a. zu diskutieren.<br />
Auf diesem Hintergr<strong>und</strong> nun hierzu meine erste These: Nicht die<br />
Veränderung des Wirtschaftswachstums ist ein neuartiges Problem für die<br />
Sozialpolitik; neu sind vielmehr die sich gegenwärtig abzeichnenden Veränderungen<br />
in der betrieblichen Nutzung von Arbeitskraft im Produktionsprozeß<br />
<strong>und</strong> deren Folgen. Die zwar seit langem prognostizierte, aber von niemand<br />
richtig ernst genommene Tatsache, daß die technischen Möglichkeiten<br />
zur Steigerung der Produktivität bislang keineswegs ausgeschöpft wurden,<br />
ist spätestens seit Mitte der 70er Jahre ein nicht mehr zu übersehender<br />
<strong>und</strong> wegzudiskutierender <strong>gesellschaftliche</strong>r Tatbestand. Dies besagt aber<br />
auch: Die Verkoppelung von Wirtschaftswachstum <strong>und</strong> die Ausweitung der<br />
Beschäftigung — wie sie in der bisherigen Entwicklung zutrafen — sind hinfällig<br />
geworden; wirtschaftliches Wachstum ist kein Garant mehr für Beschäftigungssicherung<br />
oder gar Vollbeschäftigung; im Gegenteil, Investitionen<br />
<strong>und</strong> die Expansion der Produktion können <strong>und</strong> werden immer mehr<br />
mit einer Verringerung des Arbeitsvolumens einhergehen. Jedoch Vorsicht,<br />
<strong>und</strong> damit komme ich zur zweiten These: Eine Verringerung des Arbeitsvolumens<br />
muß keineswegs zwangsläufig zu einer Verringerung von Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
führen. Ausschlaggebend hierfür ist, wie jeweils konkret<br />
der Einsatz von Arbeitskraft im Produktionsprozeß organisiert wird,<br />
d.h. insbesondere die zeitliche <strong>und</strong> personelle Verteilung der Arbeit. Die<br />
gegenwärtig in den Betrieben vorherrschende Organisation des zeitlichen<br />
<strong>und</strong> personellen Einsatzes von Arbeitskraft haben jedoch zur Folge, daß<br />
eine Reduzierung des Arbeitsvolumens zwangsläufig auch zu einer Verringerung<br />
von Arbeitsplätzen führt. Daraus ergibt sich aber auch eine Ausweitung<br />
von Problemlagen, die in der bisherigen Sozialpolitik nach wie vor eher<br />
nur als eine Randerscheinung auftauchten: Erweist sich die Ausgliederung<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
aus einem Beschäftigungsverhältnis als dauerhaft, <strong>und</strong> wird somit der Risikofall<br />
zum Normalfall, haben die Betroffenen — trotz aller Erweiterung von<br />
Sozialpolitik — mit erheblichen sozialen <strong>und</strong> materiellen Deprivilegierungen<br />
zu rechnen. Damit komme ich zu einer dritten These. Sie heißt in Kurzform:<br />
Worauf es gegenwärtig ankäme, wäre eine gr<strong>und</strong>legende Neuorganisation<br />
der Verteilung von Erwerbsarbeit. Dies stößt jedoch zugleich nicht nur auf<br />
vielfältige Widerstände, es zeigen sich vielmehr auch konkurrierende Entwicklungen<br />
in der Sozialpolitik. Was heißt dies im einzelnen? Anstelle einer<br />
Aufsplitterung der Bevölkerung in solche, die Erwerbsarbeit leisten <strong>und</strong><br />
solche, die aus der Erwerbsarbeit ausgegliedert sind, wäre eine radikale Um<strong>und</strong><br />
Neuverteilung von Erwerbsarbeit <strong>und</strong> eine Entlastung von Erwerbsarbeit<br />
für alle anzustreben. Dies wäre für mich so etwas wie eine konkrete<br />
Utopie oder einfacher ausgedrückt, das, worauf es gegenwärtig ankäme. Einen<br />
konkreten Ansatzpunkt sehe ich hier darin, neue <strong>und</strong> erweiterte Möglichkeiten<br />
zu steigender Produktivität — außer zur ökonomisch-materiellen<br />
Sicherung — zu einer gr<strong>und</strong>legenden <strong>und</strong> massiven Verkürzung der wöchentlichen<br />
<strong>und</strong> täglichen Arbeitszeit in allen erwerbsmäßig organisierten Arbeitsbereichen<br />
zu nutzen. Dies darf aber zugleich nicht von anderen Bestandteilen<br />
des Beschäftigungsverhältnisses isoliert werden. Fragen der Arbeitsgestaltung,<br />
bis hin zur beruflichen Qualifizierung <strong>und</strong> Mitbestimmung,<br />
müßten hierauf ausgerichtet, umgestaltet <strong>und</strong> weiterentwickelt werden.<br />
Ziel einer solchen sozialpolitischen Strategie hätte es zu sein, die partikulare<br />
Bearbeitung von Folgen des Produktionsprozesses zu überwinden <strong>und</strong><br />
durch eine Umverteilung von Erwerbsarbeit die zeitliche, wie aber auch<br />
physisch-psychische <strong>und</strong> soziale Beanspruchung durch Erwerbsarbeit für<br />
alle deutlich <strong>und</strong> spürbar zu reduzieren. Daher heißt die Alternative zur<br />
Erwerbsarbeit auch nicht zwangsläufig nur: mehr Freizeit. Mit reduzierter<br />
Erwerbsarbeit könnte zugleich der Aufbau alternativer Formen von Arbeit<br />
einhergehen <strong>und</strong> ein individuelles Engagement in unterschiedlichen — weder<br />
nach Prinzipien der Erwerbsarbeit noch notwendigerweise betriebsförmig<br />
organisierten — Arbeitszusammenhängen möglich werden. Erst in dieser<br />
Perspektive scheint es mir auch möglich, in der Sozialpolitik anstelle<br />
staatlich-bürokratischer Versorgungssysteme stärker alternative Formen<br />
der Selbstorganisation zu entwickeln, <strong>und</strong> zwar in einer Weise, daß diese<br />
nicht nur auf bestimmte Personengruppen <strong>und</strong> Situationen eingegrenzt<br />
<strong>und</strong> entsprechend auch marginalisiert werden können. Jedoch — <strong>und</strong> damit<br />
komme ich zu einer eher pessimistischen, aber nach bisherigen Erfahrungen<br />
vermutlich realistischen Einschätzung zukünftiger Entwicklungen: Es wäre<br />
töricht zu glauben, daß der Einsatz neuer Produktionstechniken <strong>und</strong> Technologien<br />
quasi zwangsläufig zu einer allgemeineren Verkürzung der Arbeitszeit<br />
führen, oder daß die Reduzierung der Arbeitszeit <strong>und</strong> Entlastung von<br />
Erwerbsarbeit etwas ist, was die Gewerkschaften schon richten werden,<br />
oder daß soziale Innovationen in der Sozialpolitik sich unabhängig von einer<br />
Umgestaltung von Erwerbsarbeit erfolgreich durchsetzen lassen. Dies zu<br />
glauben, erscheint mir nicht zuletzt deshalb problematisch, weil nicht nur<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Widerstände bestehen, sondern weil historische Erfahrungen wie auch gegenwärtig<br />
sich abzeichnende Tendenzen eher auf eine andere hierzu konkurrierende<br />
Entwicklung verweisen:<br />
Ich sehe die Gefahr, daß gerade die Verringerung von Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
<strong>und</strong> die anhaltende Massenarbeitslosigkeit nicht zu einer <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Umgestaltung von Erwerbsarbeit führen, sondern zu einer<br />
Neustrukturierung des Zusammenspiels zwischen Erwerbsarbeit <strong>und</strong> der<br />
Ausgliederung aus einem Beschäftigungsverhältnis. Die Interessen der Betriebe<br />
laufen — wie ich sehe — nicht in Richtung Arbeitszeitverkürzung <strong>und</strong><br />
Entlastung von Erwerbsarbeit, sondern in Richtung einer Flexibilisierung<br />
des Personaleinsatzes, d.h. vor allem einer Verschärfung des Personalaustauschs<br />
zwischen jeweils aktuell beschäftigten <strong>und</strong> auf dem Arbeitsmarkt<br />
verfügbaren Arbeitskräften. Dabei ist entscheidend: wer aktuell in ein Beschäftigungsverhältnis<br />
eingegliedert ist, dessen Arbeitsvermögen soll nach<br />
wie vor in erster Linie der Erwerbsarbeit zur Verfügung stehen. Auf einen<br />
Nenner gebracht: Die mit dem Einsatz neuer Produktionstechniken mögliche<br />
Steigerung der Produktivität wird nicht zu einer Entlastung von Erwerbsarbeit<br />
genutzt, sondern zu einer schärferen Selektion bei der Ein- <strong>und</strong><br />
Ausgliederung aus einem Erwerbsverhältnis. Dies bedeutet aber auch, daß<br />
die jeweils in ein Beschäftigungsverhältnis Eingegliederten keineswegs als<br />
Privilegierte zu betrachten sind. Für sie wird neben neuen, insbesondere<br />
psychisch-mentalen Belastungen vor allem ein verschärftes Risiko entstehen,<br />
aus dem Beschäftigungsverhältnis wieder ausgegliedert zu werden.<br />
Diesen neuen Richtungen der betrieblichen Personalpolitik entspricht weder<br />
die zuvor umrissene Umgestaltung von Erwerbsarbeit; noch entspricht<br />
ihr aber auch der von konservativ-liberaler Seite favorisierte Abbau des Sozialstaats<br />
<strong>und</strong> die Formen, in denen Sozialpolitik gegenwärtig eine Ausgliederung<br />
aus einem Beschäftigungsverhältnis bearbeitet. Einer solchen Flexibilisierung<br />
des Personaleinsatzes entsprechen vielmehr sozialpolitische Innovationen,<br />
die in der bisherigen Logik <strong>und</strong> den Strukturen einer Ausweitung<br />
von Sozialpolitik verbleiben.<br />
Meine These — eigentlich müßte ich sagen Befürchtung — ist: Sozialpolitik<br />
wird das tun, was sie immer getan hat. Für den Fall einer Ausgliederung<br />
aus einem Beschäftigungsverhältnis wird ein Ersatz angeboten. Heute<br />
<strong>und</strong> zukünftig geht es dabei nicht mehr nur um Lohnersatz oder die Versorgung<br />
mit Gütern <strong>und</strong> Dienstleistungen, sondern um den Ersatz für ein Beschäftigungsverhältnis,<br />
für Arbeit. Ich halte es für wahrscheinlich, daß sich<br />
in Zukunft, neben monetären sowie Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen, ein dritter<br />
Ast der Sozialpolitik entwickeln wird. Ich will ihn hier sozialpolitisch gestützte<br />
<strong>und</strong> organisierte Beschäftigungsverhältnisse nennen. Folgt man den<br />
bisherigen Entwicklungen in der Sozialpolitik, so spricht allerdings wenig<br />
dafür, daß hierdurch Alternativen zur Lohn- <strong>und</strong> Erwerbsarbeit entwickelt<br />
werden <strong>und</strong> entwickelbar sind. Worauf sich Sozialpolitik richten wird, ist:<br />
sie wird einen Ersatz für abhängige Beschäftigung bieten; im Klartext: sozialpolitisch<br />
gestützte Beschäftigungsverhältnisse werden an die Organisation<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
normaler Erwerbsarbeit angeglichen <strong>und</strong> an diesem Vorbild orientiert werden.<br />
Es wäre reizvoll, hier ausführlicher die gegenwärtigen staatlichen Initiativen<br />
im Bereich des zweiten <strong>und</strong> dritten Arbeitsmarkts zu diskutieren. Sie<br />
mögen für viele angesichts anhaltender Massenarbeitslosigkeit notwendig<br />
<strong>und</strong> sinnvoll erscheinen. Ich jedoch sehe die Gefahr, daß sie einer weiteren<br />
Entwicklung Vorschub leisten, die ich in der Retrospektive als die sozialpolitische<br />
Entproblematisierung des Produktionsprozesses bezeichnet habe.<br />
Ohne eine gesellschaftspolitische Umgestaltung von Erwerbsarbeit, die sich<br />
nicht an einzelbetrieblichen Interessen, sondern an gesellschaftlich sinnvollen<br />
<strong>und</strong> wünschbaren Zielen orientiert, ohne eine solche Neuorganisation<br />
von Erwerbsarbeit — <strong>und</strong> dies zeigt m.E. die Geschichte der bisherigen Sozialpolitik<br />
deutlich — werden auch alternative <strong>und</strong> neue Ansätze der Organisation<br />
von Arbeit in anderen <strong>gesellschaftliche</strong>n Lebenszusammenhängen<br />
behindert, eingeschränkt <strong>und</strong> marginalisiert werden.<br />
Mein gesellschaftspolitisches Plädoyer also: Es kann <strong>und</strong> darf keine<br />
Trennungen <strong>und</strong> Abgrenzungen zwischen alten <strong>und</strong> neuen sozialen Bewegungen,<br />
zwischen denen, die Erwerbsarbeit leisten <strong>und</strong> jenen, die hiervon<br />
ausgegliedert sind, geben. Worauf es ankäme, wäre keine isolierte, sondern<br />
eine wechselseitig verschränkte <strong>und</strong> sich abstützende Entwicklung von Alternativen<br />
<strong>und</strong> sozialen Innovationen sowohl im Bereich traditioneller Erwerbsarbeit<br />
als auch in anderen <strong>gesellschaftliche</strong>n Lebensbereichen. Ich<br />
wünschte, Soziologen könnten hierzu einen Beitrag leisten.<br />
ANMERKUNG<br />
1 Siehe zum Forschungsstand <strong>und</strong> Literatur hierzu ausführlicher den Überblick in<br />
Böhle, F.: Produktionsprozeß <strong>und</strong> Sozialpolitik. Sozialwissenschaftliche Forschung,<br />
aktuelle Probleme, theoretische Perspektiven. Arbeitspapier des Forschungsschwerpunkts<br />
Reproduktionsrisiken, soziale Bewegungen <strong>und</strong> Sozialpolitik an der Universität<br />
Bremen, Bremen 1982, S. <strong>35</strong>-62. Zu anderen Richtungen <strong>und</strong> Schwerpunkten<br />
der Sozialpolitikforschung siehe den Überblick bei Kaufmann, F., unter Mitarbeit<br />
von Rosewitz, B. <strong>und</strong> Wolf, H.: „Sozialpolitik. Stand <strong>und</strong> Entwicklung der Forschung<br />
in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland". In: PVS Sonderheft 13/1982, S. 344<br />
ff. - 366; sowie die aus der Sektion hervorgegangenen Veröffentlichungen in der<br />
Reihe Soziologie <strong>und</strong> Sozialpolitik, Oldenburg Verlag <strong>München</strong>, <strong>und</strong> die weiteren<br />
Beiträge der Sektion Sozialpolitik in diesem Band.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
MARGINALISIERUNG ALS SOZIALPOLITISCHE ALTERNATIVE?<br />
Barbara Riedmüller<br />
Die „Krise der Arbeitsgesellschaft" stellt zweifelsohne eine Herausforderung<br />
dar, die Gültigkeit klassischer Paradigmen zu überprüfen. Die Konzeptualisierung<br />
der staatlichen Sozialpolitik als „Funktion" der politischen Durchsetzung<br />
<strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong>n Organisation der Erwerbsarbeit <strong>und</strong> der damit<br />
verb<strong>und</strong>enen Lebensform besitzt nach wie vor eine hohe Erklärungskraft,<br />
wie Fritz Böhle in seinem Beitrag gezeigt hat (vgl. in diesem Band).<br />
Nun gibt es <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklungen der Arbeit (des Verhältnisses<br />
von Erwerbsarbeit zu anderen Formen der Arbeit, Schattenarbeit, informeller<br />
Arbeit, „Schwarzarbeit"), die allgemein als krisenhaft diagnostiziert<br />
werden, die möglicherweise diese Focusierung der staatlichen Sozialpolitik<br />
auf die Erwerbsarbeit infrage stellen <strong>und</strong> neue sozialpolitische Antworten<br />
herausfordern.<br />
Ich möchte in meinem Beitrag die Frage behandeln, ob <strong>und</strong> wie die<br />
heute auftretenden Phänomene marginalisierter Existenzformen <strong>und</strong> Lebenszusammenhänge<br />
(als Arme, als Sozialhilfeempfänger, in der Grauzone<br />
des Arbeitsmarktes, als Mitglied der Alternativkultur) sozialpolitisch hergestellt<br />
<strong>und</strong> verarbeitet werden <strong>und</strong> ob <strong>und</strong> wie diese mit der Normalität<br />
der Arbeitsgesellschaft vermittelt sind.<br />
Ich werde zuerst einige Anmerkungen zum Thema Marginalisierung als<br />
Gegenstand der Soziologie machen, dann will ich Formen von Marginalisierung<br />
unterscheiden <strong>und</strong> sie im aktuellen sozialpolitischen Zusammenhang<br />
interpretieren.<br />
1. Marginalität als Thema der Soziologie<br />
Seit sich die Erwerbsarbeit als dominante Existenzform durchgesetzt hat,<br />
ist Marginalität in bezug auf diese Existenzform <strong>und</strong> deren sozialpolitische<br />
Ersatzmittel definiert worden. Auch die Soziologie ist dieser dominanten<br />
Linie der <strong>gesellschaftliche</strong>n Entwicklung gefolgt — so meine These.<br />
Ich möchte angesichts knapper Zeit nur einige Aspekte dieser Entwicklung<br />
betonen.<br />
In sozialhistorischen Studien über die ökonomischen <strong>und</strong> sozialen Krisen<br />
des 18. <strong>und</strong> 19. Jahrh<strong>und</strong>erts ist Armut, Elend <strong>und</strong> soziale Desintegration<br />
als Bruch bzw. als Widerspruch von Vergesellschaftungsweisen erklärt<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
worden. Gesellschaftliche Strukturen <strong>und</strong> deren Veränderungen sind mit<br />
subjektiven Wertorientierungen <strong>und</strong> Lebenszusammenhängen vermittelt<br />
untersucht worden. (In historischen Studien z.B. der Familien<strong>soziologie</strong><br />
wird dieser Bezug wieder aktualisiert.)<br />
Im Gefolge der Ausdifferenzierung der bürgerlichen Gesellschaft in eine<br />
Erwerbsgesellschaft ändert sich auch der <strong>gesellschaftliche</strong> Diskurs über Marginalität.<br />
Sie wird mit individueller Leistung bzw. individuellem Versagen in<br />
Zusammenhang mit der Existenz durch Erwerbsarbeit einengend interpretiert.<br />
Neuere Studien über die vor- <strong>und</strong> frühbürgerliche Armenpolitik zeigen<br />
anschaulich diesen Übergang zur modernen Arbeits- <strong>und</strong> Leistungsethik, die<br />
dem Armen aufgezwungen wird (Sachße/Tennstedt 1981). Die Differenzierung<br />
in arbeitsfähige <strong>und</strong> -unfähige Arme, in arbeitswillige <strong>und</strong> -unwillige,<br />
läßt sich ebenso nachzeichnen wie die schrittweise Verfeinerung der Kontroll-<br />
<strong>und</strong> Sanktionsmittel (Foucault 1961, Dörner 1975) staatlicher Armenpolitik.<br />
Die Forschungsperspektive auf das Herstellen einer Lebenslage, auf die<br />
Reziprozität von sozialen Prozessen <strong>und</strong> individueller Lebensperspektive,<br />
wird von der Modernisierungswelle des Industriezeitalters überschwappt.<br />
Übrig bleibt das Thema Armut als Gefährdung der sozialen Ordnung, mit<br />
einer Armutspolitik, von der Simmel (1968 (1908), <strong>35</strong>0) sagt, daß sie weniger<br />
die Armut der Armen, sondern die negativen Auswirkungen der Armut<br />
auf die Allgemeinheit bekämpft.<br />
Die subjektive Seite der Marginalität, jene Formen von „abweichenden<br />
Verhalten", wie sie soziologisch diagnostiziert werden, sind kein Thema der<br />
Sozialpolitikforschung. Die sozialpolitische Zentrierung auf Erwerbsarbeit<br />
<strong>und</strong> deren sozialer Sicherung, wie sie im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert beginnt <strong>und</strong> bis<br />
heute fortgesetzt wurde, schlägt sich nieder in einer Abtrennung der individuellen<br />
Lebenszusammenhänge <strong>und</strong> deren subjektiven Deutungen. Andere<br />
Lebens- <strong>und</strong> Arbeitsformen, die nicht dem Muster der Erwerbsarbeit folgen,<br />
geraten in der Folge aus dem Blick (Beispiel: Genossenschaften, andere Inhalte<br />
<strong>und</strong> Formen der Arbeitsteilung zwischen Mann <strong>und</strong> Frau in vorbürgerlichen<br />
Produktionsgemeinschaften); neue Formen von Armut, die durch die<br />
damit verb<strong>und</strong>ene Ausgrenzung aus den Systemen sozialer Sicherheit bedingt<br />
sind, bleiben ausgeblendet. Die wissenschaftliche Hypostasierung der<br />
Erwerbsarbeit als Arbeit schlechthin hat zur Folge, daß z.B. die Frauenarbeit<br />
erst heute wissenschaftlich diskutiert wird. Die Entdeckung der Hausarbeit<br />
als unbezahlte „Schattenarbeit", des „informellen Sektors", <strong>und</strong> der<br />
„Eigenarbeit" stellt heute den Arbeitsbegriff insgesamt zur Disposition.<br />
Die „soziale Frage" des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts scheint mit der staatlichen<br />
Sozialpolitik, die als Arbeiterpolitik auf den Weg kam, gelöst zu sein. Die<br />
politische <strong>und</strong> wissenschaftliche Trennung von Arbeiterpolitik <strong>und</strong> Armenpolitik<br />
(Preußer 1982, 83) läßt sich heute in den Institutionen der Sozialversicherung<br />
<strong>und</strong> dem Unterstock des Sozialhilfesystems zwar noch erkennen,<br />
aber die Sozialpolitikforschung negiert diese Trennung. Sie konzentriert<br />
sich auf die Fort<strong>entwicklung</strong> <strong>und</strong> Modernisierung des Systems sozialer<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Sicherheit, das die Erwerbsarbeit zum Inhalt hat. Andere Lebenszusammenhänge<br />
werden in dieses Muster gepreßt (indem z.B. die Familienarbeit als<br />
„abgeleiteter Anspruch" auf soziale Leistungen verrechtlicht wird). Entsprechend<br />
dieser institutionalistischen Betrachtungsweise der Sozialpolitik,<br />
die sich endgültig vom Zusammenhang staatlicher Sozialpolitik <strong>und</strong> sozialer<br />
Bewegung löst, wie ihn Eduard Heimann (1929) in seiner 'sozialen Theorie<br />
des Kapitalismus' formuliert, spielt die Soziologie in der Sozialpolitik eher<br />
eine randständige Rolle. Denn während Theorien sozialer Probleme <strong>und</strong><br />
Theorien sozialer Kontrolle einen Aufschwung erleben, wird die Sozialpolitiktheorie<br />
zu einer Domäne von Juristen <strong>und</strong> Ökonomen. Erst in den letzten<br />
Jahren, sy<strong>mb</strong>olisiert durch die Gründung der Sektion Sozialpolitik auf<br />
dem Soziologentag in Bielefeld 1976, hat eine Rückkehr zur Sozialpolitikforschung<br />
stattgef<strong>und</strong>en <strong>und</strong> damit zu Fragen, die Hans Achinger bereits<br />
1956 gestellt hat, nach den Folgen eines auf Verrechtlichung <strong>und</strong> Ökonomisierung<br />
aufbauenden Sozialsystems.<br />
Heute, wo die Grenzen des Systems sozialer Sicherheit sichtbar geworden<br />
sind <strong>und</strong> neue Formen solidarischer Hilfe in der Selbsthilfe- <strong>und</strong> Alternativbewegung<br />
gesucht werden, ist die Soziologie erneut gefordert, die <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Entwicklung von Lebenszusammenhängen analytisch zu begleiten.<br />
2. Neue Marginalität<br />
Ich werde mich nun mit dem Problem der Marginalisierung, wie sie sozialpolitisch<br />
hergestellt wird, beschäftigen <strong>und</strong> einige Entwicklungen thesenhaft<br />
zusammenfassen.<br />
Ich definiere Marginalität als Resultat sozialpolitischer Regelung; indem<br />
diese soziale Lebenslagen jenseits der Erwerbsgesellschaft ausgrenzt, stellt sie<br />
Armut, Randständigkeit etc. her. Die Herausbildung <strong>und</strong> Differenzierung<br />
der sozialpolitischen Systeme orientiert sich an der Existenzform durch Erwerbsarbeit<br />
<strong>und</strong> deren Risiken. Zumindest hat die sozialpolitische Rhetorik<br />
die fortschreitende Ausweitung <strong>und</strong> Verbesserung sozialer Sicherung<br />
der Erwerbsarbeit zum Inhalt. Die These, daß diese Entwicklung durch starke<br />
Interessenverbände beeinflußt ist, bestätigt sich dort, wo Gruppen aus<br />
der sozialen Sicherung ausgeschlossen waren <strong>und</strong> bleiben, die keine Interessenvertretung<br />
entlang der traditionellen Organisationsformen der Erwerbsarbeit<br />
organisieren konnten — die Frauen, die Arbeitslosen, die Jugendlichen,<br />
die Rentner, um nur einige zu nennen. Aber diese These übersieht die<br />
strukturelle Basis dieser Ausgrenzung. Denn es läßt sich darüber hinaus zeigen,<br />
daß die Konstruktion des Systems sozialer Sicherung bereits systematisch<br />
den Ausschluß bestimmter Lebenszusammenhänge <strong>und</strong> Problemgruppen<br />
mit sich bringt, daß das System sozialer Sicherung defizitäre Lebenslagen<br />
herstellt, indem sie die individuelle Leistung der Erwerbsarbeit zum<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Maßstab macht. Die Familienarbeit der Frau, die Lebenssituation all derer,<br />
die nicht am Erwerbsprozeß teilnehmen können, bleibt ausgeblendet <strong>und</strong><br />
wird in „Sondersysteme" der Sozialhilfe <strong>und</strong> der verbandlichen Wohlfahrtspflege<br />
abgedrängt <strong>und</strong> nicht nur institutionell, sondern auch wissenschaftlich<br />
marginalisiert. Erst in den letzten Jahren ist verstärkt die Armut z.B.<br />
von Frauen im Alter, die Armut von kinderreichen Familien, von alleinerziehenden<br />
Müttern veröffentlicht worden (Kickbusch/Riedmüller 1984).<br />
Die Sozialindikatorenforschung hat hier ihre Verdienste. Diese Defizitanalyse<br />
enthält bereits den Hinweis darauf, daß es sich bei Marginalisierung um<br />
einen sozialpolitischen Prozeß handelt, in dem Armut etc. hergestellt wird.<br />
Die Sozialpolitik sichert nicht nur die Existenzform Erwerbsarbeit, sie organisiert<br />
auch die Nicht-erwerbsarbeit, die Ausgegrenzten, die Anderen.<br />
Zwar ist, wie Fritz Böhle in seinem Beitrag darstellt, der Normalitätsstandard<br />
der Erwerbsgesellschaft auch hier gültig, indem z.B. die Arbeitsbereitschaft<br />
kontrolliert wird, die „Faulheit" bestraft, die Arbeit der Frau diskriminiert<br />
wird, doch etablieren sich an den Grenzen der Arbeitsgesellschaft<br />
auch Regeln der Nichtarbeit, der Stigmatisierung z.B. von psychisch Kranken,<br />
von Behinderten, der Ausgrenzung in „totalen Institutionen". Diese<br />
Logik der Ausgrenzung läßt sich zwar als Erfordernis der Existenzform<br />
Erwerbsarbeit beschreiben, indem Arbeitskraft ausgegrenzt <strong>und</strong> wieder<br />
integriert wird, indem ein Wechsel von „integrativen" <strong>und</strong> „desintegrativen"<br />
Sozialpolitikstrategien je nach Erfordernis stattfindet; aber ist mit<br />
dieser 'Funktionsanalyse' das Geschehen jenseits der Grenze der Arbeitsgesellschaft<br />
verstehbar <strong>und</strong> beschreibbar?<br />
Diese Frage gilt es zu beantworten. Wenn die Krise der Arbeitsgesellschaft<br />
die Grenze zwischen Erwerbsarbeit <strong>und</strong> Nicht-erwerbsarbeit, zwischen Familienarbeit<br />
<strong>und</strong> Erwerbsarbeit, zwischen dem ersten, zweiten, dritten <strong>und</strong><br />
vierten Arbeitsmarkt flüssig werden läßt, dann sollte die analytische Perspektive<br />
auf die jenseits der Grenze „Erwerbsarbeit" entstehenden Arbeits<strong>und</strong><br />
Lebensformen offen bleiben. Kulturelle Orientierungen, lebensweltliche<br />
Strukturen <strong>und</strong> deren Überlebenschancen jenseits der Arbeitsmarktgesellschaft<br />
sollten in eine sozialpolitische Analyse einbezogen werden.<br />
Wenn ich im folgenden Marginalisierung als institutionellen Prozeß der<br />
Herstellung von randständigen Lebenszusammenhängen jenseits der Normalität<br />
der Arbeitsgesellschaft beschreibe, schließe ich nicht aus, daß die Betroffenen<br />
ihre Lebensform nach anderen Maßstäben bewerten als über die<br />
Teilnahme am Arbeitsmarkt <strong>und</strong> den sozialen Leistungen. Auch nimmt<br />
meine sozialpolitische Definition von Marginalisierung die potentiellen Widerstands-<br />
<strong>und</strong> Protestformen marginalisierter Gruppen nicht negatorisch<br />
vorweg (vgl. für die USA Piven/Cloward 1977) <strong>und</strong> leugnet nicht ihre Rolle<br />
bei der Entwicklung neuer sozialpolitischer Lösungen, wie sie heute diskutiert<br />
werden.<br />
Ich analysiere den Prozeß der sozialpolitischen Herstellung von Marginalisierung<br />
auf zwei Ebenen, denen sich unterschiedliche Lebenszusammenhänge<br />
zuordnen lassen:<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
— Marginalisierung läßt sich im Verhältnis zur Erwerbsarbeit analysieren<br />
— Marginalisierung läßt sich zweitens in Abhängigkeit von obiger Definition<br />
bestimmen im Verhältnis zu den sozialpolitischen Institutionen,<br />
die den Status der Marginalität herstellen <strong>und</strong> verwalten.<br />
Ein Zusammenhang zwischen beiden Ebenen besteht in der sozialpolitischen<br />
Gr<strong>und</strong>orientierung am Status der Erwerbsarbeit, ein Zusammenhang<br />
der sich allerdings nach den oben genannten Einwänden lockern, verselbständigen<br />
oder unterbrechen lassen kann. Nicht jede Produktion einer marginalen<br />
Existenzform (z.B. der Status „Obdachlosigkeit") entspricht den<br />
Erfordernissen des Arbeitsmarktes, sie wird durch die verfügbaren finanziellen,<br />
organisatorischen <strong>und</strong> rechtlichen Ressourcen ebenso beeinflußt wie<br />
von politisch ideologischen Konjunkturen, wie wir sie aktuell am Beispiel<br />
der Remystifizierung der Familienarbeit erleben. Je nachdem, wie eng der<br />
Zusammenhang zur Erwerbsarbeit ist, ändert sich der Politiktypus, der zwischen<br />
harter „sozialer Kontrolle" z.B. der „Arbeitsbereitschaft" von Sozialhilfeempfängern<br />
<strong>und</strong> „Gewährenlassen", z.B. von Selbsthilfe- <strong>und</strong> Alternativprojekten<br />
hin <strong>und</strong> her pendelt.<br />
Entsprechend dieser analytischen Zuordnung zu Politikformen lassen<br />
sich im wesentlichen zwei Formen von Marginalisierung unterscheiden:<br />
— Ausgrenzung als „Verschiebung" in private nicht marktförmige <strong>und</strong><br />
nicht staatliche oder staatlich kontrollierte Lebenszusammenhänge <strong>und</strong><br />
zweitens<br />
— Ausgrenzung als temporäre oder endgültige „Abkopplung" von Erwerbsarbeit<br />
durch staatlich subventionierte <strong>und</strong> kontrollierte Beschäftigungsverhältnisse.<br />
Für den ersten Typus der Ausgrenzung als „Verschiebung" läßt sich als<br />
historisch einmaliges Beispiel die Familienarbeit der Frau nennen, die nur<br />
vermittelt über die Erwerbsarbeit des Mannes, Eingang in die Sozialversicherungspolitik<br />
gef<strong>und</strong>en hat. Sie findet im B<strong>und</strong>essozialhilfegesetz einen<br />
besonderen Vorrang gegenüber der Existenzsicherung durch Erwerbsarbeit.<br />
Die Arbeit der Frau wird — wie Ursula Beer in ihrem Beitrag (in diesem<br />
Band) zeigt — als nicht marktförmige, private Angelegenheit institutionalisiert.<br />
Diese Verschiebung der Frauenarbeit in den privaten Raum der Familie<br />
bedingt in der Folge die Sonderstellung der Frau auf dem Arbeitsmarkt<br />
<strong>und</strong> deren Teilhabe an den sozialen Leistungen.<br />
Ausgrenzung als Politik der Sozialversicherungsinstitutionen im Sinne<br />
einer Verschiebung in private Existenzformen der Familie findet heute<br />
darüber hinaus in hohem Maße durch die restriktiven Zugangsvoraussetzungen<br />
zu den sozialen Leistungen statt. Dies trifft auf alle Systeme der sozialen<br />
Sicherung zu. Im Arbeitsförderungsgesetz (AFG) sind die Voraussetzungen<br />
für Leistungen verstärkt an unmittelbar vorherige Erwerbstätigkeit geb<strong>und</strong>en<br />
worden. Jugendliche Schulabgänger, Fach- <strong>und</strong> Hochschulabsolventen,<br />
Frauen, die nach Jahren der Familienarbeit wieder berufstätig werden<br />
wollen, sind von berufsfördernden Maßnahmen <strong>und</strong> finanziellen Leistungen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ausgeschlossen worden <strong>und</strong> damit auf private Unterstützungssysteme verwiesen<br />
worden.<br />
Eine ähnliche Verschiebung in private, familiäre Subsistenzformen hat<br />
im B<strong>und</strong>essozialhilfegesetz (BSHG) stattgef<strong>und</strong>en, indem verstärkt familiäre<br />
Leistungen in Anspruch genommen werden bzw. soziale Notlagen durch<br />
Kürzung sozialer Hilfen produziert werden (Leibfried/Tennstedt 1985).<br />
Es wäre nun von soziologischem Interesse, ganz im Sinne von Achingers<br />
Frage nach der Wirkung unserer sozialpolitischen Systeme, die Folgen für<br />
die Lebenszusammenhänge der Betroffenen zu untersuchen. Solche Untersuchungen<br />
konzentrieren sich derzeit vor allem auf die subjektiven Folgen<br />
der Arbeitslosigkeit, die institutionelle Seite der Marginalisierung ist dabei<br />
eher ausgeblendet.<br />
Der zweite Typus von Ausgrenzung, den ich als „Abkopplung" von der<br />
Lebensform Erwerbsarbeit bezeichnet habe, ist soziologisch vor allem deswegen<br />
interessant, weil er die unterschiedlichsten Lebenszusammenhänge,<br />
Politikstile <strong>und</strong> Ideologien zusammenfaßt. Auf der einen Seite handelt es<br />
sich um defizitäre Lebenslagen, wie sie heute als „Neue Armut" bekannt<br />
ist, auf der anderen Seite um 'selbstgewählte' Alternativen zur Erwerbsarbeit<br />
klassischen Typs.<br />
Ein besonders krasses Beispiel für eine Strategie der Marginalisierung<br />
als „Abkopplung" ist der im Sozialhilferecht verankerte Zwang zur Sozialhilfearbeit,<br />
der ursprünglich als Kontrolle der „Arbeitsunwilligen" institutionalisiert<br />
war <strong>und</strong> heute verstärkt zur Ausgrenzung von arbeitslosen Sozialhilfeempfängern<br />
eingesetzt wird, deren Zahl laufend zunimmt;<br />
Die diskriminierende Wirkung liegt vor allem im Zwangscharakter der<br />
Sozialhilfearbeit, deren Verweigerung einen Leistungsausschluß zur Folge<br />
hat <strong>und</strong> in dem Prozeß der Dequalifizierung <strong>und</strong> damit Statusverlust, da<br />
jede Arbeit angenommen werden muß (vgl. Münder 1984).<br />
Während diese Praxis der Marginalisierung an die Tradition der sozialen<br />
Kontrolle durch Arbeitszwang im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert erinnert <strong>und</strong> der beschäftigungspolitischen<br />
Rhetorik seit 1945 fremd erscheint, sind andere Formen<br />
der Arbeitspolitik populärer. Vor allem die Beschäftigungspolitik über den<br />
sog. zweiten Arbeitsmarkt (das Ha<strong>mb</strong>urger Modell) steht dafür Pate. Darunter<br />
sind staatlich unterstützte temporäre Beschäftigungsverhältnisse zu verstehen,<br />
die teils aus Mitteln der B<strong>und</strong>esanstalt für Arbeit, teils aus öffentlich<br />
kommunalen Mitteln finanziert werden (vgl. Heinze u.a. 1984).<br />
Gleichwohl der arbeitsmarktpolitische Effekt gering sein dürfte (1984<br />
gab es in der B<strong>und</strong>esrepublik ca. 70.000 Arbeitsplätze im zweiten Arbeitsmarkt),<br />
ist der sozialpolitische Stellenwert dieser Programme möglicherweise<br />
eher in der Verarbeitung der <strong>gesellschaftliche</strong>n Wirkung der Arbeitslosigkeit<br />
als in deren Lösung zu suchen. Diese Politik der Arbeit entspricht u.U.<br />
dem von Fritz Böhle aufgezeigten historisch neuen Transformationsprozeß<br />
von Erwerbsarbeit in Nicht-erwerbsarbeit <strong>und</strong> umgekehrt. Eine empirische<br />
Analyse dieser Arbeitspolitik müßte sich mit dem Effekt der Schaffung eines<br />
neuen rechtlichen Status der Erwerbsarbeit (tarifliche Absicherung, Ar-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
eitszeit etc.) ebenso beschäftigen wie mit den subjektiven Interessen der<br />
Teilnehmer dieser Programme. Was beim Modell des zweiten Arbeitsmarktes<br />
als institutionelle Praxis der Ausgrenzung von Arbeitslosen in einen<br />
„Sonderarbeitsmarkt" erscheint (ein zusätzlich segmentierter Arbeitsmarkt),<br />
kann aus der Sicht der Betroffenen als Chance der Verwirklichung neuer<br />
Arbeitsformen <strong>und</strong> -inhalte gesehen werden, dies vor allem dann, wenn Projekte<br />
„sinnvoller", „ökologischer" <strong>und</strong> „sozialer" Arbeit verwirklicht werden<br />
sollen. Diese Intention wird vor allem aus dem Selbsthilfe- <strong>und</strong> Alternativsektor<br />
aufgegriffen (Bolle, Grottian 1983). Ich möchte daher, um die<br />
Reihe der sozialpolitisch aktuellen Beispiele abzuschließen, meine Typologie<br />
von Marginalisierung als „Abkopplung" durch zwei offene Fragen erweitern,<br />
die ich gerne diskutieren würde.<br />
Ich frage, ob die staatliche finanzielle Unterstützung von Selbsthilfegruppen<br />
<strong>und</strong> Alternativprojekten nur eine Strategie der Marginalisierung<br />
nicht „marktgängiger" Arbeitskraft ist, ob eine Art „a<strong>mb</strong>ulantes Ghetto"<br />
entsteht, oder ob in diesem Bereich die Arbeitspolitik an ihre Grenzen<br />
stößt, da die Subjekte, die sich in diesen Alternativen zusammenfinden,<br />
die Regeln der Erwerbsarbeit <strong>und</strong> deren Lebensumstände für sich aussetzen.<br />
Darauf gibt die vorliegende Literatur über die neuen sozialen Bewegungen<br />
keine befriedigende Antwort. Die zweite Frage, die ich stelle, zielt auf die<br />
staatlich garantierte <strong>und</strong> möglicherweise sozial akzeptierte freiwillige Abkopplung<br />
vom Arbeitsmarkt durch ein „garantiertes Mindesteinkommen".<br />
Diese in letzter Zeit diskutierte „libertäre" Lösung der Krise der Arbeitsgesellschaft<br />
(Schmid 1984) will den Zwang der Erwerbsarbeit lockern, indem<br />
jeder auf der Basis seiner Existenzsicherung für sich entscheidet, ob<br />
er an der Erwerbsarbeit teilnimmt oder nicht. Ich frage, ob sich in dieser<br />
sozialen Utopie neue <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklungen ankündigen, vor allem,<br />
was die soziale Organisation von Arbeit anbelangt oder ob sich hier<br />
nur neue, moderne sozialpolitische Kontrollmittel herausbilden, die den alten<br />
Typus von Erwerbsarbeit verewigen wollen.<br />
Diese Fragen lassen sich m.E. nur beantworten, wenn die sozialpolitische<br />
Analyse objektiver <strong>gesellschaftliche</strong>r Entwicklungen <strong>und</strong> der Rolle der<br />
Institutionen verknüpft wird mit der Analyse der subjektiven Perspektive<br />
<strong>und</strong> Interpretation seitens der Betroffenen.<br />
Wie die aus der Sicht der Arbeitsgesellschaft marginalisierten Gruppen<br />
ihre Lebenszusammenhänge definieren <strong>und</strong> wie sie ihre Interessen durchsetzen,<br />
muß Bestandteil der sozialpolitischen Forschung sein. Vor allem<br />
darf die Forschung die Entwicklung veränderter Lebenszusammenhänge<br />
nicht im theoretischen Vorgriff homogenisieren, indem ein historisches<br />
Modell von Erwerbsarbeit analytisch verallgemeinert wird.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
LITERATUR<br />
Achinger, H. 1958: Sozialpolitik als Gesellschaftspolitik. Von der Arbeitsfrage zum<br />
Wohlfahrtsstaat, Ha<strong>mb</strong>urg.<br />
Dörner, K. 1975: Bürger <strong>und</strong> Irre, Frankfurt a.M.<br />
Foucault, M. 1973: Wahnsinn <strong>und</strong> Gesellschaft, Frankfurt a.M.<br />
Bolle, M./Grottian, P. (Hg.) 1983: Arbeit schaffen - jetzt! Reinbek b. Ha<strong>mb</strong>urg.<br />
Heimann, E. 1980 (1929): Soziale Theorie des Kapitalismus. Frankfurt a.M.<br />
Heinze, R./Ho<strong>mb</strong>ach, B./Mosdorf, S. (Hg.) 1984: Beschäftigungskrise <strong>und</strong> Neuverteilung<br />
der Arbeit, Bonn.<br />
Kickbusch, I./Riedmüller, B. 1984: Die armen Frauen, Frankfurt a.M.<br />
Leibfried, St./Tennstedt, F. (Hg.), 1985: Politik der Armut <strong>und</strong> die Spaltung des Sozialstaats,<br />
Frankfurt a.M.<br />
Münder, J. 1984: „Arbeitsverpflichtung für Sozialhilfeempfänger?" in: Neue Zeitschrift<br />
für Verwaltungsrecht, S. 206-211.<br />
Piven, F./Cloward, R.A., 1977: Poor People's Movements. Why They Succeed, How<br />
They Fall. New York.<br />
Preußer, N., 1982, 1983: Armut <strong>und</strong> Sozialstaat, Bd. 1-4, <strong>München</strong>.<br />
Sachße, M.C./Tennstedt, R. 1980: Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland. Stuttgart.<br />
Schmid, Th. (Hrsg.), 1984: Befreiung von falscher Arbeit. Thesen zum garantierten Mindesteinkommen,<br />
Berlin.<br />
Simmel, G., 1968 (1908): Soziologie, Berlin.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Diskussionsbeiträge zu den Referaten von<br />
Lüscher, Herlyn, Keim <strong>und</strong> Böhle<br />
Rosemarie<br />
Nave-Herz<br />
Ich möchte zwei Anmerkungen anfügen, die die Ausführungen von Herrn<br />
Lüscher ergänzen <strong>und</strong> sich konzentrieren auf das Thema „Veränderungen<br />
familialer Lebensformen als Herausforderung der Soziologie".<br />
Die neuen Lebensformen stellen nach Herrn Lüscher eine Reihe von<br />
Herausforderungen — sowohl konzeptioneller Art als auch im Hinblick auf<br />
die Familienpolitik — an die Familien<strong>soziologie</strong> dar. Diesen Katalog möchte<br />
ich noch erweitern:<br />
Dadurch, daß die deutsche Familien<strong>soziologie</strong> eine zu lange zeitliche<br />
Forschungsabstinenz diesen neuen Lebensformen gegenüber zeigte, wuchs<br />
ihr eine weitere Aufgabe zu, nämlich die der kritischen Analyse massenkommunikativer<br />
Deutungsmuster über die Veränderung familialer Alltagswelten<br />
<strong>und</strong> über die Entstehung neuer Lebensformen. Diese Behauptung<br />
möchte ich kurz begründen.<br />
Aus den familienstatistischen Trendverläufen der letzten Jahre, auf die<br />
Herr Lüscher hingewiesen hat, wird in allen Massenkommunikationsmitteln,<br />
in partei- <strong>und</strong> verbandspolitischen Reden usw. auf einen Bedeutungsverlust<br />
von Ehe <strong>und</strong> Familie geschlossen <strong>und</strong> werden düstere Prognosen für die Zukunft<br />
von Ehe <strong>und</strong> Familie abgeleitet. Doch kann man aus diesen allgemeinen<br />
statistischen Datenreihen nicht ohne weiteres auf die subjektive Bedeutung<br />
oder den subjektiven Bedeutungswandel von Familie <strong>und</strong> Ehe schließen,<br />
wie es in derartigen pseudowissenschaftlichen Deutungsmustern praktiziert<br />
wird. So ist es mehr als dringend notwendig, daß die Familiensoziologen<br />
diese bereits überall verbreiteten Interpretationen statistischer Daten auf<br />
ihren Realitätsgehalt hin überprüfen.<br />
Ich möchte deshalb im folgenden — kurz zusammengefaßt — ein diesbezügliches<br />
Ergebnis eines Forschungsprojektes über familiäre Veränderungen<br />
in der B<strong>und</strong>esrepublik seit 1950, das wir gerade abgeschlossen haben,<br />
vortragen, weil damit die theoretischen Aussagen von Herrn Lüscher eine<br />
Konkretisierung erfahren. Auf Einzelheiten, auf methodische Probleme<br />
usw. kann ich hier natürlich nicht eingehen. Es sei lediglich angemerkt,<br />
1<br />
daß es sich um eine retrospektive Befragung von 314 Familienbiographien<br />
mit unterschiedlichen Eheschließungsjahren (1950, 1970 <strong>und</strong> 1980) handelt.<br />
Die Analyse erfolgte unter systemtheoretischer Perspektive. Die fol-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
genden Thesen stellen selbstverständlich auch nur einen Ausschnitt des Gesamtergebnisses<br />
dar.<br />
Es ist genügend bekannt, daß Ehe <strong>und</strong> Familie historisch gesehen immer<br />
einen instrumenteilen Charakter für die Betroffenen hatten. Sie wurden<br />
eingegangen, um Vermögen, Namen, Rechte usw. weiterzuleiten, die eigene<br />
Versorgung zu garantieren usw. Je mehr die romantische Liebe zum Eheideal<br />
<strong>und</strong> zum einzigen legitimen Heiratsgr<strong>und</strong> sich ideell immer mehr durchsetzte,<br />
umso stärker wurde der Anspruch, den instrumentellen Charakter<br />
von Ehe <strong>und</strong> Familie einzutauschen gegen das Ideal von Partnerschaft, gegenseitiger<br />
emotionaler Beziehung usw. Interessant ist aber nun, daß Ehe<br />
<strong>und</strong> Familie — trotz dieses Anspruches — ihren instrumentellen Charakter<br />
bis heute nicht in dem erwarteten Umfang verloren zu haben scheinen.<br />
Auch heute führen überwiegend weiterhin bestimmte rationale Gründe<br />
letztlich zur Eheschließung. Die Art der Eheentscheidungsgründe haben sich<br />
allein im Zeitablauf verändert. 1950 waren es häufig mehrere Gründe zusammen<br />
(z.B. berufliche, partnerbezogene, sexuelle, wohnungsmäßige), die<br />
bei den einzelnen Paaren die Ehe-Entscheidung beeinflußten. Bis 1980<br />
wurde die Ehe nunmehr in zunehmendem Maße allein zum Instrument der<br />
Erfüllung des Kinderwunsches. Denn — da die emotionellen sexuellen Beziehungen<br />
heute keine öffentlich bek<strong>und</strong>ete Legitimation durch eine Eheschließung<br />
mehr benötigen, die materiellen <strong>und</strong> wohnungsmäßigen Bedingungen,<br />
die Selbständigkeit ermöglichen, liegt somit heute, wenn geheiratet<br />
wird — so zeigen unsere Daten —, überwiegend ein starker, zumindest bewußter<br />
kind- <strong>und</strong> familienzentrierter Entscheidungsgr<strong>und</strong> im Vergleich zu<br />
den Eheschließenden von 1970 <strong>und</strong> 1950 vor. Mit anderen Worten: Im Hinblick<br />
auf das Kind wird eine dem Anspruch nach auf Dauer zielende Beziehung,<br />
nämlich die Ehe mit ihrem gegenseitigen Verpflichtungscharakter, gewählt.<br />
Ehe <strong>und</strong> Famile werden damit überwiegend allein zur bewußten <strong>und</strong><br />
erklärten Sozialisationsinstanz für Kinder (wodurch sich auch ihre Konfliktanfälligkeit<br />
erhöht).<br />
Das von R. Vollmer in Anlehnung an Niklas Luhmann aufgestellte<br />
Postulat der Spezialisierung von Familie auf emotionale Bedürfnislagen ,<br />
2<br />
muß m.E. aufgr<strong>und</strong> unserer Daten weiter differenziert werden, indem zwischen<br />
der emotionellen Partnerbeziehung <strong>und</strong> der kindorientierten emotionellen<br />
Partnerbeziehung zu unterscheiden ist. Selbstverständlich sind zumeist<br />
beide Beziehungsaspekte miteinander verknüpft. Nur, es scheint sich<br />
insofern eine tendenzielle Veränderung anzubahnen, als die partnerbezogene<br />
Emotionalität immer stärker zum Anlaß der Gründung einer nicht-legalisierten<br />
Haushaltsgemeinschaft wird. Bei der Eheschließung dagegen tritt die<br />
kindorientierte Partnerbeziehung in den Vordergr<strong>und</strong>. Damit wird ferner<br />
deutlich, daß sich die Funktion von Kindern für die Eltern verändert hat.<br />
Die Veränderungen in den Außensystemen, vornehmlich dem Rechts<strong>und</strong><br />
Wirtschaftssystem, scheinen also in zunehmendem Maße eine weitere<br />
Ausdifferenzierung in zwei Lebensformen zu bewirken, an die jeweils spezifische<br />
Anforderungen, Bedürfnisse, Erwartungen gestellt werden: die<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Partnerform der nicht-legalisierten Haushaltsgemeinschaft <strong>und</strong> die durch<br />
Heirat legitimierte Ehe-Elternschaft. Beide Lebensformen sind soziologisch<br />
nicht etwa gleichzusetzen, wie es zuweilen in der Literatur zu finden ist, da<br />
nicht nur die Betroffenen sie als unterschiedlich definieren, sondern weil —<br />
wie ich nochmals betonen möchte — jeweils spezifische Erwartungen an beide<br />
Lebensformen gestellt werden.<br />
Damit ist also die Tendenz eines Bedeutungswandels von Ehe <strong>und</strong> Familie<br />
zu bestätigen, aber nicht im Sinne der düsteren Prognose, wie sie —<br />
wie erwähnt — in den Massenkommunikationsmitteln häufig zu finden ist.<br />
Ich möchte noch eine weitere Herausforderung an die Familien-Soziologie<br />
durch die Entstehung neuer Lebensformen kurz erwähnen.<br />
Herr Lüscher gab in seiner Einleitung einen klaren, knappen Abriß über<br />
die Phasen der Familien<strong>soziologie</strong>, rückblickend auf die Zeit seit dem zweiten<br />
Weltkrieg. Doch weder hier, noch später, taucht in seinem Referat irgendwo<br />
der Begriff der interkulturell-vergleichenden Familien<strong>soziologie</strong><br />
auf, was begründbar ist, denn de facto wurde dieser Forschungsschwerpunkt<br />
in der B<strong>und</strong>esrepublik bisher so gut wie ganz vernachlässigt. Ich erwähne<br />
diesen Tatbestand deshalb, weil ich abschließend — ergänzend — hervorheben<br />
möchte, daß gerade die neuen familialen Lebensformen auch eine<br />
Herausforderung für die interkulturell-vergleichende Familien<strong>soziologie</strong> darstellt,<br />
da die Pluralität von Lebensformen in allen west- <strong>und</strong> osteuropäischen<br />
Staaten zunimmt. Zu prüfen wäre jedoch z.B., ob die nicht-legalisierte partnerschaftliche<br />
Haushaltsgemeinschaft in allen Staaten die gleiche Funktion<br />
besitzt, <strong>und</strong> ob ihr die gleiche subjektive Bedeutung zugeschrieben wird <strong>und</strong><br />
anderes mehr. Nur hierdurch wären generalisierende Aussagen, z.B. über die<br />
fortschreitende funktionale Spezialisierung von Ehe <strong>und</strong> Familie, letztlich<br />
erst möglich. Vor allem aber kann nur interkulturelles Vorgehen in der Forschung<br />
— <strong>und</strong> so auch in der Familien<strong>soziologie</strong> — ich zitiere König — ,,zur<br />
Selbsterkenntnis in der Relativierung der eigenen Wertsetzung" <strong>und</strong> ferner<br />
zur „Eigentümlichkeit nationaler Charaktere" beitragen. Übertragen auf eine<br />
interkulturell-vergleichende Familien<strong>soziologie</strong> würde das heißen, daß<br />
nur sie die Chance bieten würde, die Eigentümlichkeit bestimmter nationaler<br />
Familienformen <strong>und</strong> damit auch neuer Lebensformen zu erfassen. Damit<br />
wäre eine weitere Herausforderung umschrieben, der sich die Familien<strong>soziologie</strong><br />
im Hinblick auf die neuen familialen Lebensformen zu stellen<br />
hätte.<br />
ANMERKUNGEN<br />
1 Vgl. hierzu ausführlicher „Familiäre Veränderungen seit 1950 — eine empirische<br />
Studie", Abschlußbericht (gefördert von der Stiftung Volkswagenwerk.), Oldenburg<br />
1984.<br />
2 R. Vollmer: „Die soziale Gravitation von Familie <strong>und</strong> Beruf", in: Bedürfnisse — Stabilität<br />
<strong>und</strong> Wandel, hrsg. von K.O. Hondrich, Opladen 1983, S. 143 <strong>und</strong> 154.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Soziale Praxis <strong>und</strong> Urbanität angesichts einer Krise des Fortschritts<br />
Adalbert Evers<br />
Mit Blick auf die Referate meiner Kollegen Ulfert Herlyn <strong>und</strong> Dieter Keim<br />
drängt es mich, drei Proble<strong>mb</strong>ereiche noch etwas mehr zu konturieren, die<br />
von beiden angesprochen wurden:<br />
a) das Problem des Urbanen Raums als Produkt sozialer Praxis <strong>und</strong> Gegenstand<br />
einer Stadt<strong>soziologie</strong>,<br />
b) die Frage nach den Schlüsselelementen im Prozeß der Restrukturierung<br />
dieses Raums,<br />
c) der Zusammenhang von Stadt- <strong>und</strong> Planungskritik mit der 'Krise der<br />
Moderne'.<br />
'<br />
ad a)<br />
Im Unterschied zu den Positionen, die das Ende des städtischen Raumes als<br />
besonderer stadtsoziologischer Kategorie postulieren, wird sowohl bei Herlyn<br />
wie bei Keim die virtuelle Fruchtbarkeit der Kategorie 'Urbanität' hervorgehoben:<br />
„Zwar wird unsere Lebensweise weiter der industriell-modernen<br />
Rationalität ausgeliefert bleiben. Aber das Städtische daran, die städtischen<br />
Lebensformen werden dem Sozialen Grenzen <strong>und</strong> eine eigenständige<br />
Potentialität entgegensetzen" — so heißt es in dem von Keim vorgetragenen<br />
Beitrag. Herlyn kritisiert seinerseits Ansätze, die „der heutigen Stadt<br />
die lokale Identität schlechthin absprechen". Jenseits des Benennens <strong>und</strong><br />
Zusammentragens von Bruchstücken <strong>und</strong> Elementen zur Rekonstruktion<br />
eines Gegenstandes 'Urbanität' durch die beiden Kollegen müssen wir jedoch<br />
gemeinsam weiterfragen: Wo <strong>und</strong> wie hat die Negierung dieses Topos<br />
„Stadt" ihre Methode? Tatsächlich scheint mir der Springpunkt in der Frage<br />
zu liegen, wie weit man bereit ist, sich „durch die Einbeziehung von Subjektivität<br />
gegen eine strukturell objektivistische Methodologie in der Stadtforschung"<br />
zu wehren (Herlyn). Sieht man etwa die Stadt nur als ökonomisches<br />
Gebilde, genauer, als Agglomeration, so löst sie sich tatsächlich in<br />
räumlichen Austauschbeziehungen <strong>und</strong> Warenströmen auf, in denen etwas<br />
spezifisch Städtisches kaum mehr zu entdecken sein wird. Erst mit dem<br />
Blick auf Subjektivität, soziale Praxis, entdecken wir, in welch unterschiedlicher<br />
Weise es etwa in den USA <strong>und</strong> Europa (nicht) gelungen ist, eine solche<br />
Marktökonomie kulturell, sozial <strong>und</strong> politisch zu prägen <strong>und</strong> zu überformen,<br />
in der Weise, daß auf den genannten Ebenen sich „urbane Praxis"<br />
entwickelt hat. Es ist hier nicht der Platz zu erläutern, warum m.E. ein solches<br />
Basis-Überbau-Schema, auf das ich eben zurückgegriffen habe, in<br />
dem die Priorität einer Instanz (der ökonomischen) behauptet wird, nicht<br />
stimmig ist <strong>und</strong> ich es folglich vorziehen würde, noch einen Schritt weiter<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
zu gehen: <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung ganz <strong>und</strong> gar in Kategorien der<br />
(kulturellen, ökonomischen, sozialen <strong>und</strong> politischen) Praxis zu denken.<br />
Wenn <strong>und</strong> insoweit dies geschieht, läßt sich auch der Streit um die Realität<br />
des Urbanen auflösen: es hat dann keine strukturell garantierte Existenz,<br />
sondern diese hängt davon ab, ob, wo <strong>und</strong> wie Urbanität in den Praxen <strong>und</strong><br />
Diskursen der sozialen Akteure Realität <strong>und</strong> Gestalt gewinnt. So kennen<br />
wir historische Zusammenhänge wie die in weiten Teilen der USA, wo<br />
'Stadt' weder für ökonomische Planungen, noch Mobilitätsentscheidungen<br />
von Arbeitnehmern oder den Aufbau eines Netzes von Fre<strong>und</strong>schaftsbeziehungen<br />
oder den kulturellen Konsum signifikante Bedeutung hat <strong>und</strong><br />
überdies auch nicht als Gegenstand kollektiver Bemühungen, Aufbrüche<br />
<strong>und</strong> Proteste existiert. Gerade in vielen europäischen Ländern scheint mir<br />
aber heute das Gegenteil der Fall zu sein. Während auch hier die ökonomischen<br />
Praktiken mehrheitlich dahin tendieren, immer „gleichgültiger gegen<br />
Raum <strong>und</strong> Zeit" zu werden, häufen sich meines Erachtens andere Formen<br />
der praktischen Versuche, 'Stadt' als soziales Konstrukt, als Element eines<br />
gesellschaftlich verhandelten Lebensentwurfs zu denken <strong>und</strong> Wirklichkeit<br />
werden zu lassen. Um nur einige Beispiele zu nennen: Topoi wie das Quartier,<br />
das 'Recht auf Heimat' im Rahmen kultureller Orientierungen, konkreter<br />
aber auch im Sinne der Verteidigung gewisser 'Rechte auf Immobilität'<br />
in sozialen Auseinandersetzungen, bei Restrukturierungen von Arbeitsmärkten;<br />
die lokale Ebene als Ebene des Verhandeins, des Konflikts<br />
<strong>und</strong> des Entscheidens in Entwürfen zu einer politischen <strong>und</strong> administrativen<br />
Dezentralisierung. Auf all diesen Ebenen, so meine ich, gewinnt Urbanität<br />
als soziales Konstrukt an Bedeutung <strong>und</strong> sollte es somit auch als Gegenstand<br />
sozialwissenschaftlicher Verständigung <strong>und</strong> Forschung tun. Ein<br />
solcher <strong>gesellschaftliche</strong>r <strong>und</strong> gesellschaftswissenschaftlicher Bedeutungsgewinn<br />
des Städtischen entsteht aber nicht im Streit über 'Urbanität', verstanden<br />
als eine strukturelle a priori Kategorie, sondern im Aufspüren von<br />
Urbanität als einem immer wieder herzustellenden historischen <strong>und</strong> sozialen<br />
Konzept, das als solches nicht sein muß.<br />
ad b)<br />
Mehr als fraglich scheint es mir dabei allerdings zu sein, sich auf „die kollektive<br />
Konsumtion" als ein „wesentliches Merkmal städtischer Lebensweise"<br />
zu beziehen, wie das bei Keim in der Rezeption (älterer) französisch/<br />
englischer Theoretisierungen des Urbanen geschieht. Mit dieser Kategorie<br />
wurde in den Rang einer objektiven langfristigen Tendenz gehoben, was<br />
sich heute als durchaus reversible, historische Erscheinung darstellt: die<br />
Übernahme von immer mehr sozialen Tätigkeiten <strong>und</strong> Reproduktionselementen<br />
(Bildung, Erziehung, Ges<strong>und</strong>heit, etc.) in die staatlich-professionelle<br />
Regie. Heute ist aber nicht nur die Objektivität der angeblich „zunehmenden<br />
Vergesellschaftung der Konsumtion*" zu hinterfragen, sondern auch<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
die Einseitigkeit einer Betrachtungsweise, die ein Element von Reproduktions-<br />
<strong>und</strong> Lebensweisen gegenüber anderen zu privilegieren suchte. Entdecken<br />
wir demgegenüber nicht, welche große Bedeutung z.B. die informellen<br />
Ökonomien kleiner Einheiten (im familiären Umfeld, in Selbsthilfegruppen,<br />
etc.) haben <strong>und</strong> daß erst in der Neuzusammensetzung von (a) bezahlter<br />
Arbeit, (b) informellem Tätigsein <strong>und</strong> dem Mittun bei der (c) kollektiven<br />
Konsumtion als der (Ko-)Produktion sozialer Dienste sich die Veränderung<br />
von Lebensweisen erschließen läßt? Alle drei Elemente in ihrer Verknüpfung<br />
<strong>und</strong> Bedeutung für veränderte städtische Lebensweisen zu thematisieren<br />
scheint mir weit fruchtbarer zu sein, als eines davon in einem theoretischen<br />
Konstrukt aufzugreifen, von dem sich seine Protagonisten schon<br />
indirekt distanziert haben (R.E. Pahl z.B. forscht heute vor allem über informelle<br />
Ökonomie).<br />
ad c)<br />
Im Rückblick auf das Konzept der 'kollektiven Konsumtion' erkennen wir<br />
aber gleichzeitig etwas von dem wieder, was der Kollege Eckart Pankoke als<br />
verbindendes Moment für die Beiträge der einzelnen Sektionen herauszuarbeiten<br />
suchte: die Krise der industriellen Moderne, eine Distanz zu ihr, die<br />
auch als Chance ihrer Reflektion verstanden werden kann. Denn mit der<br />
Idee der „Vergesellschaftung der Konsumtion" — konkret der Ausbreitung<br />
einer Stadt <strong>und</strong> Gesellschaft, die mehr <strong>und</strong> mehr strukturiert werden durch<br />
professionelle öffentliche <strong>und</strong> soziale Dienstleistungen, die uns 'Arbeit abnehmen'<br />
— leuchtete einmal mehr ein Fortschrittskonzept auf, nach dem<br />
die Wirklichkeit einer post-kapitalistischen Gesellschaft schon im Schoße<br />
der entfalteten kapitalistischen Produktionsverhältnisse heranreift. In der<br />
Kritik der Grenzen einer Professionalisierung <strong>und</strong> Verstaatlichung von Zuwendung<br />
('care') hat solche Distanz zum Fortschrittsentwurf der industriellen<br />
Moderne, in dem sich herrschende Gruppen <strong>und</strong> soziale Bewegung als<br />
Arbeiterbewegung trafen, konkret faßbare Gestalt angenommen. Keim beruft<br />
sich nun in seinem Beitrag auf Lefèbvre <strong>und</strong> dessen Kritik des Urbanismus<br />
als einer Ideologie <strong>und</strong> Handlungsform von Spezialisten <strong>und</strong> Professionellen,<br />
die die urbane Praxis (verstanden als die ökonomischen, sozialen,<br />
kulturellen <strong>und</strong> politischen Diskurse <strong>und</strong> Praktiken, in denen die sozialen<br />
Akteure dem Urbanen Gestalt verleihen) hemmen, insofern sie sie im 'Stadt-<br />
Plan' ersetzen zu können meinen. Gerade unter dem Aspekt der „Krise<br />
der Modernität" lohnt es sich hier etwas genauer hinzuschauen. Man findet<br />
dann nämlich bei Lefèbvre die Keime einer im Namen „urbaner Praxis" geführten<br />
Kritik jener Fortschrittspraxis, die im Zeichen der Moderne durchaus<br />
von Links <strong>und</strong> Rechts geteilt worden ist. Da ist zum einen die Kritik<br />
einer Idee vollkommener Ordnung des Gesellschaftlichen, einer Vorstellung<br />
also, die gerade im sozialistischen Denken immer zentral gewesen ist. „Die<br />
Illusion der Philosophie besteht darin", schreibt Lefèbvre, „daß der Philo-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
soph glaubt, er könne die ganze Welt in ein — sein — System einschließen ...<br />
Von dem Augenblick an, da bei der Systematisierung der Gedanken einer<br />
endlosen Fähigkeit zur Vervollkommnung mit dem Gedanken der dem System<br />
als solchen immanenten Vollkommenheit in Konflikt gerät, geht die<br />
philosophische Illusion ins Bewußtsein ein ... Wie die klassische Philosophie<br />
will der Urbanismus ein System sein. Er glaubt, eine neue Totalität umfassen,<br />
in sich einbeziehen, besitzen zu können." Gleichzeitig verweist Lefèbvre<br />
auf die damit verknüpfte Illusion des Staates <strong>und</strong> der Planung — <strong>und</strong> wer<br />
wäre ihr näher gewesen als der jahrzehntealte sozialistische Diskurs über eine<br />
rational geplante Stadt <strong>und</strong> Gesellschaft? ,,Die Illusion des Staates besteht<br />
aus einem kolossalen <strong>und</strong> lächerlichen Projekt", schreibt Lefèbvre.<br />
„Der Staat soll imstande sein, die Angelegenheiten von Dutzenden von Millionen<br />
von Subjekten zu leiten ... Der Staat als Vorsehung, als personifizierte<br />
Gottheit wird zum Mittelpunkt aller Dinge <strong>und</strong> des irdischen Gewissens."<br />
Dementsprechend, so argumentiert Lefebvre, entgleite auch dem Stadtplaner<br />
tendenziell jede urbane Praxis. Er glaubt sie durch den Plan ersetzen zu<br />
können. „Er untersucht sie nicht. Für den Urbaniker ist diese Praxis eben<br />
das Blindfeld." (Alle Zitate: Lefèbvre 1972, 162/63).<br />
In der Konkretisierung <strong>und</strong> Entfaltung derartiger radikaler <strong>und</strong> (selbstkritischer<br />
Überlegungen, wie sie Lefèbvre's Urbanismus-, Technokratie- <strong>und</strong><br />
damit auch Modernitätskritik bereits am Anfang der 7Oer-Jahre vorgetragen<br />
hat, besteht, so meine ich, die wichtige Aufgabe einer Stadt <strong>und</strong> Stadtplanungs<strong>soziologie</strong>,<br />
die die Krise der Modernität mit Blick auf das Urbane<br />
ernst- <strong>und</strong> aufzunehmen sucht (als Versuch vgl.: Evers 1985). Folgt sie dabei<br />
einem Gesellschafts- <strong>und</strong> Stadtbegriff, in dem die „soziale" <strong>und</strong> „urbane<br />
Praxis" das Schlüsselelement bilden <strong>und</strong> nicht mehr zuerst das Denken in<br />
Strukturen, Ordnungen <strong>und</strong> Institutionen, dann wäre das auf dem spezifischen<br />
Feld der Stadt<strong>soziologie</strong> eine (wie ich meine, positive) Antwort auf<br />
jene allgemeinere Frage, die Alain Touraine auf dem letzten Soziologentag<br />
in Ba<strong>mb</strong>erg 1982 so formulierte: Soziale Bewegungen — Spezialgebiet oder<br />
zentrales Problem soziologischer Analyse?<br />
LITERATUR<br />
Evers, Adalbert 1985: „Konflikt <strong>und</strong> Konsens in der Stadtplanung, oder: sich auseinandersetzen<br />
heißt auch sich nahekommen", in: Kreuder/Loewy (Hg.): Konservativismus<br />
in der Strukturkrise, Frankfurt a.M.<br />
Lefèbvre, Henri 1972: Die Revolution der Städte, Frankfurt a.M.<br />
Touraine, Alain 1983: „Soziale Bewegungen — Spezialgebiet oder zentrales Problem soziologischer<br />
Analyse?" (Text eines Vortrages auf dem 21. Deutschen Soziologentag<br />
in Ba<strong>mb</strong>erg) in: Soziale Welt, Heft 2/1983.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Thomas Krämer-Badoni<br />
Im Prinzip — so scheint mir — ist der heute von den hier versammelten<br />
Sektionen beschrittene Weg richtig. Aber es ist ein Weg, der nicht leicht<br />
zu beschreiten sein wird <strong>und</strong> der in der Gefahr ist, an institutionellen<br />
Widerständen, professionellen Eifersüchteleien <strong>und</strong> Abgrenzungen zu<br />
scheitern. Denn immerhin bedeutet das Beschreiten dieses Weges notwendigerweise<br />
die Aufgabe partialisierter Soziologien, die an bestimmten<br />
Gegenständen ein theoretisch tragfähiges Gerüst zu entwickeln suchen.<br />
Ich möchte dies — aus taktischen Gründen die Grenzen der anderen<br />
Sektionen achtend — am Beispiel der Stadt<strong>soziologie</strong> verdeutlichen.<br />
Ulfert Herlyn hat eine durchaus zutreffende Beschreibung der Entwicklung<br />
der Stadt<strong>soziologie</strong> seit den 50er Jahren gegeben. Gleichwohl ließe<br />
sich an allen aufeinanderfolgenden Thematisierungen zeigen, daß es sich<br />
weniger um stadtspezifische als um gesellschaftsspezifische Themen handelt.<br />
Die Partialisierung von Lebensbereichen, thematisiert an der Funktionstrennung<br />
von Arbeiten <strong>und</strong> Wohnen, am Beispiel städtischer Neubauquartiere,<br />
ist ein Problem, das in ähnlicher Weise den Stadt-Land-<br />
Gegensatz mit seiner Pendlerproblematik charakterisierte <strong>und</strong> in vielen<br />
Regionen heute noch charakterisiert. Gleiches ließe sich an den Themen<br />
Nachbarschaft, Sanierung, Infrastruktur <strong>und</strong> anderen formulieren, daß<br />
es nämlich immer erst <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklungen sind, die Probleme<br />
<strong>und</strong> Problemlösungen produzieren, <strong>und</strong> zu diesen Problemen <strong>und</strong> Problemlösungen<br />
gehört die Stadt. Herlyn weiß das, wie die meisten Stadtsoziologen<br />
es wissen. Gleichwohl will Herlyn — wie ebenfalls die meisten Stadtsoziologen<br />
— am Gegenstandsbereich Stadt festhalten <strong>und</strong> beklagt die Theoriearmut<br />
der Stadt<strong>soziologie</strong>, die sich trotz weitreichender Entwürfe von<br />
Bahrdt, Mitscherlich u.a. in eben dieser Armut erhalten habe.<br />
Dieter Keim seinerseits bemüht sich, die Stadt als soziologischen Gegenstandsbereich<br />
durch die Konzeptualisierung einer Forschungsperspektive<br />
zu erhalten <strong>und</strong> zieht zu diesem Zweck die theoretischen Entwürfe von<br />
Lefèbvre, Castells <strong>und</strong> Sa<strong>und</strong>ers heran. In diesen findet Keim die zentralen<br />
Konzepte — die kollektive Konsumtion, die basispolitische Interessendurchsetzung<br />
<strong>und</strong> die Zentralität —, die ihm ein Festhalten an der Stadt<strong>soziologie</strong><br />
theoretisch wie empirisch fruchtbar erscheinen lassen. Dabei liest sich<br />
übrigens die Beschreibung der Zentralität als „materiell nicht ablesbare<br />
ten Gegenständen ein theoretisch tragfähiges Gerüst zu entwickeln suchen.<br />
Ich möchte dies — aus taktischen Gründen die Grenzen der anderen<br />
aus professionellen <strong>und</strong> vielleicht anderen Gründen immer noch an etwas<br />
festhalten, über das wir mit Begriffen wie Lebenszusammenhang <strong>und</strong><br />
Lebensform längst hinauszielen. Nicht die Stadt, sondern die gesellschaftlich<br />
bestimmten Formen des Lebens sind es, die unseren eigentlichen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Gegenstand ausmachen. Zu diesen gehört auch das Stadtleben in seiner<br />
jeweiligen historischen Bestimmtheit. Gerade Herlyns Referat, das die<br />
Abfolge „städtischer" Probleme <strong>und</strong> deren Thematisierung in der Stadt<strong>soziologie</strong><br />
darlegt, zeigt deutlich, wie sehr „städtische" Probleme Produkte<br />
abstrakterer Problemlagen sind, seien dies Verwertungsprobleme, Veränderungen<br />
in der Sozialstruktur, in der Lohnarbeit, im Gefüge politischer<br />
Macht usf..<br />
Was also bleibt der Stadt<strong>soziologie</strong>? Castells hat die Frage „Is there<br />
an Urban Sociology?" mit einem eindeutigen , Jain" beantwortet. Insofern<br />
nämlich die Stadt als soziologisch definierte Einheit behauptet wird, ist<br />
sie nicht existent, gibt es folglich auch keine Stadt<strong>soziologie</strong>. Als reales<br />
Phänomen dagegen — Castells spricht von einem „real object" — ist die<br />
Stadt als eine Summe von Orten, in denen sich das tägliche Leben, die<br />
täglichen Kämpfe in ihrer <strong>gesellschaftliche</strong>n Bestimmtheit abspielen, sehr<br />
wohl vorhanden. Aber sie ist nicht als solche theoretisierbar. Viele Stadtsoziologen<br />
haben darauf richtig reagiert, indem sie einzelne Probleme an<br />
einzelnen Städten analysierten <strong>und</strong> sich mit ihren Analysen in den politischen<br />
Prozeß begeben haben. Das sollten wir auch weiter tun, <strong>und</strong> dazu<br />
brauchen wir gesellschaftstheoretische <strong>und</strong> gesellschaftsanalytische Orientierungen.<br />
Stadt<strong>soziologie</strong> ist — <strong>und</strong> damit möchte ich schließen — dann<br />
sinnvoll, wenn sie mit gesellschaftstheoretischer Orientierung konkrete<br />
Probleme analysiert, wenn wir also zuallererst Soziologen <strong>und</strong> dann erst<br />
Stadtsoziologen sind.<br />
Sozialpolitik <strong>und</strong> geschlechtsspezifische Arbeitsteilung: Für einen<br />
vollständigen Blick der Sozialpolitikforschung auf die <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Organisation der Arbeit<br />
Marianne Weg<br />
Meine Anmerkungen zum Beitrag von Fritz Böhle sollen exemplarisch verdeutlichen,<br />
daß es für die Weiter<strong>entwicklung</strong> soziologischer Forschung<br />
notwendig <strong>und</strong> produktiv ist, theoretische Prämissen <strong>und</strong> analytische Ergebnisse<br />
der Frauenforschung aufzugreifen, um zu angemessenen Analysen<br />
auch <strong>und</strong> gerade für Themenbereiche zu kommen, die nicht explizit „Frauen<br />
<strong>und</strong>" benannt sind. Das gilt für Ansätze der Sozialpolitik-Analyse, aber<br />
genauso z.B. für die Industrie<strong>soziologie</strong>, etwa Belastungsforschung (vgl.<br />
Becker-Schmidt 1983).<br />
Mit vielen zentralen Aussagen in Böhles Ansatz hinsichtlich der risikohaften<br />
Entwicklungen im Beschäftigungssystem, bei Umfang <strong>und</strong> Struktur<br />
der Lohnarbeit, bin ich völlig einig. Ich teile auch Böhles Ausgangs-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
these, daß (die) zentrale(n) Impulse für die Entwicklung der Sozialpolitik<br />
aus Problemen der Lohnarbeit kamen <strong>und</strong> kommen.<br />
Ich stelle aber fest, daß diese These <strong>und</strong> der auf ihr gründende Ansatz<br />
einer Sozialpolitik-Analyse erstens differenzierungsbedürftig sind <strong>und</strong> zweitens<br />
ergänzt werden müssen.<br />
Geschlecht — weiblich, männlich — <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Arbeit in<br />
allen Formen — Lohnarbeit, nichtentlohnte Hausarbeit <strong>und</strong> ehrenamtliche<br />
Sozialarbeit — sind keine für die Sozialpolitik-Analyse belanglosen Kategorien.<br />
Forschungsansätze, die für sich Allgemeinheit beanspruchen, müssen<br />
sie berücksichtigen. Sonst geraten sie in die Gefahr einer faktisch androzentrischen<br />
Sichtweise, die Wahrnehmungs- <strong>und</strong> Erkenntnisdefizite<br />
<strong>und</strong> entsprechende Handlungsdefizite mit sich bringt.<br />
Kurz: Der Ansatz der Sozialpolitik-Analyse, den Böhle vorgetragen<br />
hat, müßte von der Frauenforschung lernen <strong>und</strong> eine Reihe ihrer Prämissen,<br />
Thesen <strong>und</strong> bereits gewonnener Erkenntnisse, die ein wesentliches<br />
Strukturprinzip unserer Gesellschaft, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung<br />
betreffen, aufnehmen. Das kann nicht ausgeglichen werden durch<br />
forschungsmäßige „Spezialisierung" <strong>und</strong> quasi Delegierung der „Frauenaspekte"<br />
im Zusammenhang sozialpolitischer Forschungsaufgaben an die<br />
Frauenforschung, die sich damit beschäftigen soll. Vielmehr müssen Ansätze<br />
der Frauenforschung bei der Weiter<strong>entwicklung</strong> der „allgemeinen"<br />
Sozialpolitik-Analyse integriert werden.<br />
Wie hätte das auszusehen?<br />
Gerade heute, angesichts der „Krise der Arbeitsgesellschaft", muß<br />
dringender denn je der Begriff <strong>gesellschaftliche</strong>r Arbeit vollständig gefaßt<br />
<strong>und</strong> differenziert werden, <strong>und</strong> zwar in Erwerbsarbeit <strong>und</strong> in nicht erwerbs-/<br />
marktorganisierte Arbeit. In diesem Zusammenhang ist der klassische<br />
Begriff der Reproduktionsarbeit kritisch zu wenden <strong>und</strong> breiter zu sehen<br />
(vgl. zu dieser Debatte Beer 1983, 136 ff.): Es geht nicht nur um die unentgeltlich,<br />
„privat" geleistete Arbeit zur Reproduktion der Arbeitskraft<br />
für das Kapital, sondern um sämtliche für die Gesellschaft produktiven<br />
Arbeitsleistungen zur Sicherung der Lebensbedürfnisse ihrer Mitglieder in<br />
Form privater Subsistenzarbeit. Die Erkenntnis, daß es verschiedene Bereiche<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>r Arbeit gibt, geleistet von unterschiedlichen Gruppen<br />
<strong>und</strong> Individuen innerhalb der Gesellschaft, ist den Frauen geläufig,<br />
die ja in allen Feldern beteiligt sind <strong>und</strong> vor allem in einem der Felder die<br />
Hauptlast, wenn nicht die alleinige Last tragen. Sie ist in Arbeiten der<br />
Frauenforschung mittlerweile differenziert herausgearbeitet worden. Inzwischen<br />
dringt sie — wenngleich langsam — auch in die links-alternative<br />
Diskussion um die „Zukunft der Arbeit" <strong>und</strong> der „Arbeitsgesellschaft"<br />
ein (vgl. den Entwurf der B<strong>und</strong>estagsfraktion der Grünen zu einem neuen<br />
Arbeitszeitgesetz).<br />
Dies vorausgeschickt, stimme ich Böhle also zu, daß die <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Organisation der Arbeit die Probleme der Sozialpolitik <strong>und</strong> auch ihre<br />
Lösungsstrategien bestimmt. Zugr<strong>und</strong>egelegt werden muß jedoch dieser<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
erweiterte <strong>und</strong> differenzierte Arbeitsbegriff: Sozialpolitik hat nicht nur<br />
zu tun mit den Voraussetzungen <strong>und</strong> Folgen der Organisation von Lohnarbeit,<br />
vielmehr hat sie genauso zu tun mit der <strong>gesellschaftliche</strong>n Organisation<br />
der unbezahlten Arbeit im Familien- <strong>und</strong> Sozialbereich. Kriterien<br />
dieser ganz spezifischen Organisationsform sind: „privat", familial,<br />
in Teilbereichen auch außerfamilial, ehrenamtlich, d.h. nicht marktförmig,<br />
<strong>und</strong> vor allem in geschlechtsspezifischer, hierarchischer Arbeitsteilung.<br />
Relevant sind also die <strong>gesellschaftliche</strong>n Organisationsformen der<br />
Lohnarbeit <strong>und</strong> der Nicht-Lohnarbeit in der Familie <strong>und</strong> in ehrenamtlichen,<br />
sozialen Arbeitsbereichen <strong>und</strong> zwar nicht bloß nebeneinander, sondern<br />
in ihrem Verhältnis zueinander. Die letzteren können nicht als im Lohnarbeitsbegriff<br />
stillschweigend berücksichtigt gelten, indem ihre Strukturen<br />
<strong>und</strong> Entwicklungen auch als auf die Lohnarbeit sich auswirkend gedacht<br />
werden: Das wäre ein black-box-Denken, das dringend anstehende Erkenntnisfortschritte<br />
verhindert. Die Wissenschaft würde hiermit nachvollziehen<br />
anstatt aufzudecken, was schon immer <strong>und</strong> bis heute geschieht:<br />
Wer in der Gesellschaft aus dem Bereich der Lohnarbeit herausfällt, fällt<br />
auch aus der öffentlichen Wahrnehmung heraus.<br />
Wenn Sozialpolitik allein die Voraussetzungen <strong>und</strong> Strukturen der<br />
Lohnarbeit ins Auge faßt <strong>und</strong> an ihnen gestaltend anknüpft bzw. dies tun<br />
würde (sie tut es ja nicht so ausschließlich!), dann würde sie ex ante Chancengleichheit<br />
<strong>und</strong> soziale Gleichstellung für die Hälfte der Bevölkerung<br />
verfehlen: für die Frauen, die entweder wegen ihrer Familienarbeit von<br />
Lohnarbeit vollständig ausgeschlossen sind, oder die, wenn sie Erwerbsarbeit<br />
leisten, eine systematische Lohndiskriminierung wie auch andere berufliche<br />
Diskriminierung erfahren (Kurz-Scherf/Stahn-Willig 1981).<br />
Die Bedeutung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung <strong>und</strong> der<br />
gesamten <strong>gesellschaftliche</strong>n Arbeit der Frauen für die Sozialpolitik, <strong>und</strong><br />
somit auch für die Sozialpolitikforschung, wird an Beispielen unmittelbar<br />
einsichtig:<br />
— Zu fragen ist, welche der sozialen Risiken <strong>und</strong> Lebensbedürfnisse,<br />
die aus der Organisation der Lohnarbeit resultieren, die Sozialpolitik<br />
abdeckt, <strong>und</strong> welche Risiken sie nicht abdeckt, sondern dem sog. „privaten<br />
Sektor", konkreter: den Familien, noch konkreter: den Frauen<br />
überläßt. Das heißt etwa für aktuelle Tendenzen der Sozialpolitik: Warum<br />
<strong>und</strong> wie soziale Risiken zunächst durch Sozialpolitik zumindest partiell vergesellschaftet<br />
wurden (werden mußten) <strong>und</strong> nun im Rahmen konservativer<br />
Haushaltsstrategien reprivatisiert werden (können), hängt mit Strukturen<br />
<strong>und</strong> Entwicklungen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zusammen.<br />
Von Interesse ist dabei auch das ideologische Substrat der Sozialpolitik.<br />
— Wichtige Aspekte sozialer Lebensbedürfnisse wie z.B. Bildung für<br />
Kinder, soziale Kommunikation für Hausfrauen oder für Alte, Schutz<br />
vor familialer Gewalt, scheinen im „Reproduktionssektor" auf, die Gegenstand<br />
von Sozialpolitik sind <strong>und</strong> die nicht oder nicht direkt mit der Organisation<br />
von Erwerbsarbeit zu tun haben.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
— Bei gegenwärtigen Strategien sowohl kompensierender als auch wiedereingliedernder<br />
Arbeitsmarktpolitik wird zwar nirgendwo die Ausgrenzung<br />
von Frauen explizit formuliert. Gleichwohl ist sie systematisch nachweisbar<br />
(Weg 1984, a, b). Die Ausgrenzungen resultieren nicht aus allgemeinen<br />
Strukturen der Lohnarbeit, sie hängen mit Lohnarbeit nur<br />
insoweit zusammen, als bei dieser die Familienbelastung der Frauen diskriminierend<br />
gegen sie gekehrt wird. Restriktive Arbeitsmarktpolitik<br />
knüpft also daran an, daß Frauen unter den Bedingungen geschlechtshierarchischer<br />
Arbeitsteilung die unbezahlte Arbeit leisten. Diese Verteilungsstruktur<br />
der <strong>gesellschaftliche</strong>n Arbeit wird gegenwärtig durch die<br />
Kürzungen im Sozialbereich <strong>und</strong> die Ideologie der „neuen Mütterlichkeit"<br />
weiter verfestigt.<br />
Im übrigen trifft es Frauen systematisch häufiger, daß sie jahrelang<br />
Sozialversicherungsbeiträge gezahlt haben, dafür aber weder Arbeitslosenunterstützung<br />
noch Rente erhalten: Die Zuweisung der Familienarbeit<br />
<strong>und</strong> die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung innerhalb des Erwerbsbereichs<br />
machen Frauen so zu besonders „kostengünstigen" Arbeitslosen oder Rentnern.<br />
Wohlgemerkt: Für Einzelfragestellungen der Sozialpolitik-Analyse,<br />
etwa die historische Entwicklung der Sozialversicherungssysteme, die<br />
Funktion restriktiver Arbeitsmarktpolitik hinsichtlich der industriellen<br />
Reservearmee usw. liefert Böhles Ansatz zutreffende <strong>und</strong> relevante Ergebnisse.<br />
Trotzdem bleiben Fragen offen, etwa nach dem Stellenwert von<br />
Frauenerwerbsarbeit <strong>und</strong> Frauenarbeit insgesamt für diese Entwicklungen.<br />
Nicht analysierbar sind jedoch von Böhles Gr<strong>und</strong>these aus Probleme wie<br />
die folgenden:<br />
— Sozialpolitik geht, mit expliziten oder impliziten gesellschaftspolitischen<br />
Prämissen, über die Anknüpfung an die Organisierung der Lohnarbeit<br />
hinaus <strong>und</strong> knüpft de facto an Reproduktionsarbeit an. Das geschieht,<br />
indem sie diese als Leistung von Müttern, Schwestern, Töchtern für die<br />
Reproduktion der männlichen Arbeitskraft offen oder stillschweigend<br />
voraussetzt <strong>und</strong> hier <strong>gesellschaftliche</strong> Lösungen ausspart.<br />
— In Einzelfällen greift Sozialpolitik die Familienarbeit positiv auf,<br />
d.h. Sozialtransferleistungen für Frauen bewirkend. Ein Beispiel hier-,<br />
für ist die Anerkennung von Erziehungszeiten in der Rentenversicherung.<br />
Auch bei Wiedereingliederungsmaßnahmen im Arbeitsförderungsgesetz<br />
(§ 2, Ziffer 5 des AFG nennt als Ziel ausdrücklich die berufliche Wiedereingliederung<br />
von Frauen) oder bei der Invalidenrente fanden sich solche<br />
Ansätze. Genau diese sind aber im Zuge der konservativen Wende der<br />
Sozialpolitik zurückgeschnitten worden.<br />
— Von gr<strong>und</strong>legender theoretischer <strong>und</strong> praktischer Bedeutung wären<br />
Forschungsarbeiten zur Frage, welche quantitative <strong>und</strong> qualitative Bedeutung<br />
Sozialpolitik <strong>und</strong> unbezahlte Arbeit (der Frauen) wechselseitig<br />
füreinander haben, <strong>und</strong> wie die Bezüge zum frauen- <strong>und</strong> gesellschaftspolitischen<br />
Ziel der Chancengleichheit sind (vgl. Riedmüller in diesem Band).<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
— Bei einer Analyse des Mutterschaftsurlaubs zeigt sich die Verschränkung<br />
von Erwerbsarbeitsorganisation <strong>und</strong> Familienarbeitsorganisation als Ausgangspunkt<br />
sozialpolitischer Gestaltung. Die Gestaltung ist dabei eindeutig<br />
ein „Bis-hierher-<strong>und</strong>-nicht-weiter": Erleichterung, aber nicht Abbau der geschlechtsspezifischen<br />
Arbeitsteilung; letzteres hätte einen Elternurlaub verlangt<br />
<strong>und</strong> Umstrukturierungen des Lohnarbeitssektors.<br />
Die Beispiele zeigen, in welchen Richtungen von einem lohnarbeitszentrierten<br />
Ansatz der Sozialpolitik-Analyse aus die Gefahr von Themenausblendungen<br />
bzw. von unzutreffenden bzw. allenfalls partiell relevanten Ergebnissen<br />
besteht:<br />
Die besondere Betroffenheit von Frauen von positiven/expansiven wie<br />
von restriktiven Strategien der Sozialpolitik könnte weder gesehen noch erklärt<br />
werden. Aber es könnten auch die von hier aus sich spiegelbildlich für<br />
die Männer ergebenden Folgen nicht thematisiert werden: relative Privilegien<br />
im Berufsbereich, gleichzeitig aber auch Defizite in der Teilhabe an<br />
Familie, über Ehe <strong>und</strong> Familie als Zwangseinrichtungen laufende Disziplinierungen,<br />
Mitbetroffenheit von verschärften Arbeitsbedingungen, die die<br />
Unternehmen mittels der besonderen Ausbeutbarkeit von Frauen durchsetzen.<br />
Viele wichtige Themen würden somit nicht explizit zur Analyse anstehen.<br />
Darüber hinaus ist kritisch festzustellen, daß auch relevante Aussagen,<br />
die mit dem bisherigen Ansatz gewonnen werden, u.U. nur für gut 60 % der<br />
Erwerbstätigen, nämlich die männlichen Lohnarbeiter, nicht aber in gleicher<br />
Weise auch für die lohnarbeitenden Frauen Gültigkeit beanspruchen<br />
können. Selbst wenn die Sozialpolitik-Analyse nur z.B. nach den Auswirkungen<br />
sozialpolitischer Konzepte <strong>und</strong> tatsächlicher Maßnahmen für Erwerbstätige<br />
fragen will, ist plausibel <strong>und</strong> in verschiedenen Arbeiten nachgewiesen<br />
(Weg 1984a, Westphal-Georgi 1982), daß es neben offen geschlechtsspezifischen<br />
Maßnahmen (z.B. Kürzungen des Mutterschaftsurlaubsgeldes)<br />
Regelungen gibt, die, obwohl formal geschlechtsneutral, für<br />
Frauen <strong>und</strong> Männer massiv unterschiedlich wirken (z.B. Renten- <strong>und</strong> Arbeitslosengeld/-hilfekürzungen,<br />
die zu Sozialhilfebedürftigkeit führen; keine<br />
Wiedereingliederungsmaßnahmen der Arbeitsförderungspolitik für Nichtleistungsempfänger).<br />
Meine These ist, daß restriktive <strong>und</strong> repressive, individualisierende Prinzipienwechsel<br />
<strong>und</strong> Maßnahmenveränderungen der Sozialpolitik stärker gegen<br />
Frauen als gegen Männer wirken, <strong>und</strong> daß umgekehrt im Bereich positiver<br />
Hilfen (etwa Garantie einer materiellen Gr<strong>und</strong>sicherung), Sozialpolitik<br />
für Frauen weniger effektiv ist als für Männer. Beides sehe ich in der geschlechtsspezifischen<br />
Arbeitsteilung begründet. Dies wären wichtige Fragestellungen<br />
für die Sozialpolitik-Forschung.<br />
Sozialpolitik-Analyse sollte den folgenden Ansprüchen genügen:<br />
1. Sie soll aussagerelevant für die Bedeutung der Sozialpolitik für Frauen<br />
<strong>und</strong> Männer sein. Forschung, die gesellschaftspolitisch relevant sein<br />
will, darf nicht r<strong>und</strong> 40% der Erwerbstätigen, bzw. die Hälfte der Bevölkerung<br />
ausklammern.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
2. Sie soll differenziert alle wesentlichen Ursachen, Bedingungen <strong>und</strong> Folgen<br />
historischer <strong>und</strong> gegenwärtiger Sozialpolitikkonzepte <strong>und</strong> Maßnahmen<br />
untersuchen, <strong>und</strong> nicht nur diejenigen Ursachen, Bedingungen <strong>und</strong><br />
Folgen, die mit dem erwerbswirtschaftlichen Sektor der Gesellschaft zusammenhängen.<br />
3. Sie soll Gr<strong>und</strong>lagen zur konzeptionellen Weiter<strong>entwicklung</strong> der Sozialpolitik<br />
liefern, <strong>und</strong> zwar in der Richtung, die auch Böhle für eine Neuorientierung<br />
fordert: Die einzige Chance für die Zukunft der Arbeitsgesellschaft,<br />
<strong>und</strong> für die Zukunft von Männern <strong>und</strong> Frauen in ihr, ist eine<br />
radikale U<strong>mb</strong>ewertung <strong>und</strong> Umorganisation der Erwerbsarbeit <strong>und</strong> genauso<br />
der unbezahlten Arbeit: Gleichverteilung der reduzierten Volumina<br />
von Erwerbsarbeit, Erweiterung <strong>und</strong> Gleichverteilung von Möglichkeiten<br />
zu selbstbestimmter Arbeit in familialen, sozialen, kulturellen<br />
<strong>und</strong> politischen Zusammenhängen. Das muß — bei materieller Gr<strong>und</strong>sicherung<br />
<strong>und</strong> bei Chancen auch zur Revidierung von individuellen Lebens-<br />
<strong>und</strong> Arbeitsverteilungskonzepten — für beide Geschlechter, für<br />
alle sozialen Gruppen möglich sein.<br />
LITERATUR<br />
Becker-Schmidt, R., 1983: Arbeitsleben — Lebensarbeit. Konflikte <strong>und</strong> Erfahrungen<br />
von Lohnarbeiterinnen, Bonn.<br />
Beer, U., 1983: „Marxismus in Theorien der Frauenarbeit. Plädoyer für eine Erweiterung<br />
der Reproduktionsanalyse", in: Feministische Studien 2, S. 136-147.<br />
Kurz-Scherf, I., Stahn-Willig, B., 1981: „Gleiche Arbeit! Gleicher Lohn! - <strong>und</strong> wer<br />
macht die Hausarbeit? ", in: WSI-Mitteilungen 4.<br />
Weg, M., 1984a: „Dienen <strong>und</strong> Verzichten: Sozialabbau statt Gleichstellung der Frauen",<br />
in: WSI-Mitteilungen 1.<br />
Weg, M., 1984b: „Sozialabbau <strong>und</strong> neue Mütterlichkeit: Das Patriarchat verteilt die<br />
Arbeit um", in: MEMO-Forum. Zirkular der „Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik"<br />
Nr. 4, Bremen, Oktober 1984.<br />
Werlhof, C., von, Bennholdt-Thomsen, V., Mies, M., 1983: Frauen, die letzte Kolonie.<br />
Reinbek.<br />
Westphal-Georgi, U., 1982: Der Abbau sozialstaatlicher Maßnahmen in seinen Auswirkungen<br />
auf Mädchen. Expertise zum 6. Jugendbericht, Juni 1982.<br />
Neue familiale Lebensformen als Herausforderung der Soziologie<br />
Helgard Ulshoefer<br />
Lüscher hat ausgeführt, daß sich die gegenwärtig anzutreffende Vielfalt familiärer<br />
Lebensformen auch in einer Normenvielfalt bei den subjektiven<br />
<strong>und</strong> privaten Perspektiven der einzelnen Menschen niederschlägt. Ich sehe<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
meine Aufgabe darin, zu zeigen, daß sich staatliches Handeln gegenüber dieser<br />
Vielfalt familiären Zusammenlebens nicht neutral verhält, sondern durch<br />
institutionelle Regelungen — mit Hilfe des steuerlichen Ehe- <strong>und</strong> Familienlastenausgleichs<br />
<strong>und</strong> des Sozialversicherungssystems — ganz bestimmte Formen<br />
des Zusammenlebens <strong>und</strong> des generativen Verhaltens, d.h. der Familienbildung,<br />
belohnt <strong>und</strong> damit die von Lüscher als öffentlich bezeichnete<br />
Perspektive repräsentiert.<br />
Die institutionell erwünschte familiäre Lebensform werde ich unter Verwendung<br />
der in der feministischen Wissenschaft entwickelten Begrifflichkeit<br />
analysieren, d.h. ich werde die Familienarbeit, die sich zusammensetzt<br />
aus Beziehungsarbeit, Hausarbeit <strong>und</strong> Erziehungsarbeit in Relation setzen<br />
zu den Formen öffentlicher „Belohnung" <strong>und</strong> dabei aufzeigen, welche Arbeit<br />
finanziell gefördert wird <strong>und</strong> welche nicht.<br />
Wie das staatliche Unterstützungssystem, das aus Art. 6 GG abgeleitet<br />
wird (Ehe <strong>und</strong> Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Staates),<br />
funktioniert, will ich zunächst an meiner eigenen familiären Lebensform<br />
deutlich machen: Ich lebe mit einem 23jährigen „Kind" zusammen, das<br />
studiert <strong>und</strong> deshalb von mir <strong>und</strong> dem Vater zu unterhalten ist (ob der Vater<br />
Unterhalt leistet oder nicht, interessiert für den Familienlastenausgleich<br />
überhaupt nicht). Ich erhalte daher 50,- DM Erstkindergeld — <strong>und</strong> das<br />
maximal bis zum 27. Lebensjahr des Kindes — <strong>und</strong> im indirekten steuerlichen<br />
Familienlastenausgleich über den Kinder- <strong>und</strong> Ausbildungsfreibetrag<br />
in der Steuerklasse 11,1 weitere 50,-- DM. D.h. ich werde mit 100,-- DM entlastet<br />
für Aufwendungen, die sich — gemessen am B<strong>und</strong>esausbildungsförderungsgesetz<br />
— auf mindestens 760,-- DM belaufen. Falls ich auf der Rückfahrt<br />
vom Soziologentag tödlich verunglücke, erhielte mein Kind Unterhaltsersatz<br />
aus meiner Rentenversicherung bis zum 25. Lebensjahr.<br />
Wenn ich dagegen gestern einen gleich alten, d.h. 23jährigen Studenten<br />
geheiratet hätte, den ich genauso unterhalten müßte wie mein Kind, würde<br />
ich im steuerlichen Ehelastenausgleich — bei einem Jahreseinkommen von<br />
70.000 DM (<strong>und</strong> diese Jahreslohnsumme erreichen die Beamten der Besoldungsgruppen<br />
A 13 bis 15 bzw. Cl bis C3 <strong>und</strong> die Angestellten von BAT<br />
IIa bis Ia) — monatlich 750,- DM weniger Lohnsteuer zahlen denn als Ledige.<br />
Würde ich aus dieser familiären Lebensform Ehe auf der Rückfahrt<br />
vom Soziologentag tödlich verunglücken, erhielte mein Ehemann Unterhaltsersatz<br />
aus meiner Rentenversicherung bis an sein Lebensende.<br />
Für welche Art von Familienarbeit wird der Ehelastenausgleich geleistet?<br />
Nicht für Hausarbeit <strong>und</strong> nicht für Erziehungsarbeit, sondern einzig<br />
<strong>und</strong> allein für Beziehungsarbeit! Dank des kirchlichen Dogmas von der<br />
Unauflöslichkeit der Ehe wird meinem Ehemann als Witwer solange Beziehungsarbeit<br />
honoriert, bis er wieder heiratet. Die dann noch fälligen<br />
zwei Jahresrenten „vergolden" den Verstoß gegen das Dogma.<br />
Die Ehe ist eine Erwerbs- <strong>und</strong> Wirtschaftsgemeinschaft. Deshalb wird<br />
im Steuerrecht davon ausgegangen, daß beide Ehepartner zu gleichen Teilen<br />
das Jahreseinkommen erwirtschaftet haben, auch wenn nur ein Ehegatte<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
erwerbstätig war. Das Jahreseinkommen wird nominal durch zwei geteilt,<br />
<strong>und</strong> erst dann wird der entsprechende Steuersatz angewandt. Dieses sog.<br />
Ehegattensplitting kostet zur Zeit 40 Mrd. DM. Für Kindergeld werden rd.<br />
17 Mrd. DM ausgegeben (siehe Sozialberichte der B<strong>und</strong>esregierung).<br />
Da feministische Wissenschaft immer auch feministische politische Strategie<br />
beinhaltet, muß ich an dieser Stelle alle Ehefrauen auffordern, sich<br />
die Hälfte des Jahreseinkommens auch anzueignen, d.h. auf ihr eigenes<br />
Konto überweisen zu lassen. Solange nicht erwerbstätige, teilzeitbeschäftigte<br />
<strong>und</strong> mit der Steuerklasse V erwerbstätige Ehefrauen sich mit Haushaltsgeld<br />
— <strong>und</strong> sei es noch so reichlich — begnügen, werden sich Ehemänner<br />
einbilden, daß sie allein den Familienunterhalt verdienen, daß sie Familienernährer<br />
seien.<br />
Nur durch Einsicht in eine Lohnsteuertabelle oder durch Konsultation<br />
einer Steuerberaterin erfahren sie, wieviel des monatlich ausgezahlten Lohnes<br />
Erwerbseinkommen <strong>und</strong> wieviel Steuerersparnis aus dem Ehegattensplitting<br />
sind. Während Kinder dem Staat — unterschieden nur nach der<br />
Stellung in der Geschwisterreihe — gleich viel wert sind, d.h. für Erst- <strong>und</strong><br />
Einzelkinder werden immer 50,-- DM Kindergeld im Monat gezahlt, erstattet<br />
der Staat für Ehegatten inzwischen bis zu 1.300,- DM monatlich, d.h.<br />
je höher das Einkommen, desto mehr reduziert sich die Steuerschuld, desto<br />
wertvoller wird die Beziehungsarbeit bewertet.<br />
Nur dann, wenn die Ehefrauen sich die Hälfte des Erwerbseinkommens<br />
angeeignet haben, können sie sich als nächstes ihre Erziehungsarbeit anrechnen<br />
lassen. Denn ein Elter kommt seiner Unterhaltspflicht durch Pflege<br />
<strong>und</strong> Erziehung des Kindes nach, der andere leistet Barunterhalt — solange<br />
keine Gleichverteilung der mütterlichen <strong>und</strong> väterlichen Aufgaben stattgef<strong>und</strong>en<br />
hat. Das klingt verwegen, wenn der erwerbstätige Vater aus seinem<br />
Einkommen Kindesunterhalt an die Mutter zahlen soll, die gleichzeitig seine<br />
Ehefrau ist. Aber in einer Gesellschaft, in der zunehmend mehr Ehen<br />
durch Scheidung enden, können sich die Ehepartner nicht früh genug an<br />
die Realitäten gewöhnen.<br />
Wenn die Ehegatten im Falle einer Scheidung aus der privilegierten<br />
Steuerklasse III herausfallen <strong>und</strong> zurückgestuft werden in die Steuerklasse<br />
I oder II, weil keine Beziehungsarbeit mehr stattfindet, die allein ja den<br />
Ehelastenausgleich begründet, dann muß ja auch festgelegt werden, wieviel<br />
Kindesunterhalt derjenige zu zahlen hat an den Elter, der die Erziehungsarbeit<br />
leistet. Ist diesem sorgeberechtigtem Elter eine Erwerbsarbeit nicht zuzumuten,<br />
muß Unterhalt für Erziehungsarbeit gezahlt werden.<br />
Von Wahlfreiheit zwischen Familie <strong>und</strong> Beruf kann überhaupt nicht die<br />
Rede sein. Das Scheidungsfolgenrecht versucht ganz im Gegenteil festzulegen,<br />
wann der sorgeberechtigten Mutter wieviel Erwerbstätigkeit zuzumuten<br />
ist, um die Unterhaltspflicht des Mannes zu senken.<br />
An dieser Stelle können wir der Frage nachgehen, wann eine Frau über<br />
den Heiratsmarkt ihren Lebensunterhalt besser sichern kann als auf dem<br />
Arbeitsmarkt, wann die ökonomische Verführung zur Eheschließung an-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
fängt — bei einem monatlichen Einkommen von 4.000 DM, das der Mann<br />
erzielt. Ich will damit nicht sagen, daß Frauen heute aus ökonomischen<br />
Gründen heiraten, sondern lediglich deutlich machen, daß sie ihren Kinderwunsch<br />
unter zeitweiser oder längerfristiger Aufgabe von eigener Erwerbstätigkeit<br />
nur unter solchen finanziellen Umständen realisieren können, weil<br />
im Ehelastenausgleich der Basisunterhalt (gemessen an Sozialhilfefällen)<br />
transferiert wird. Die von der B<strong>und</strong>esregierung propagierte Wahlfreiheit<br />
zwischen Beruf <strong>und</strong> Familienarbeit besteht nur für solche Frauen. Da Hausarbeit<br />
im Ehelastenausgleich überhaupt nicht zählt (die berufsunfähig werdende<br />
Hausfrau ist auch im neuen Rentengesetz wieder nicht vorgesehen),<br />
ist es ein Kuriosum, daß Hausarbeit in dem Augenblick bewertbar ist, wo<br />
die geschiedene Ehefrau Hausarbeit bei einem anderen Mann leistet. Ihr<br />
Unterhalt kann nämlich zur Zeit um 400,- DM gemindert werden!<br />
Das ab 01.01.1986 geplante neue Rentengesetz sieht für alle dann in<br />
Rente gehenden Mütter ein rentensteigerndes Erziehungsjahr für jedes ihrer<br />
Kinder vor, sofern sie in den ersten 12 Monaten nach der Geburt nicht erwerbstätig<br />
waren. Die CDU/CSU hatten 5 Jahre vor Regierungsantritt versprochen,<br />
damit wenigstens jede Mutter einen eigenen Rentenanspruch bekommt,<br />
nachdem sie diesen den Hausfrauen bzw. allen Ehefrauen ohnehin<br />
nicht gewähren wollte. Nun haben wir ein Jahr erhalten, weil alle Macht habenden<br />
Männer sich einig waren, daß im Rentenrecht Ehezeiten keine Berücksichtigung<br />
erfahren sollen <strong>und</strong> den erwerbstätigen Ehemännern nicht<br />
zugemutet werden sollte, für die nicht erwerbstätige Ehefrau einen zusätzlichen<br />
Rentenbeitrag abzuführen. Auf diese Art <strong>und</strong> Weise sind die Kosten<br />
nicht nur für die alten Menschen, sondern auch für Witwen <strong>und</strong> Witwer im<br />
erwerbsfähigen Alter kollektiviert, während die Kosten für Kinder auch bei<br />
der Einführung eines Babyjahres als individualisiert angesehen werden müssen.<br />
Die Bewertung der Erziehung von Kindern wird sogar als systemwidrige<br />
Leistung im Rentensystem bezeichnet <strong>und</strong> soll deshalb aus dem allgemeinen<br />
Steueraufkommen finanziert werden.<br />
Die Krise der lohnarbeitszentrierten Sozialpolitik <strong>und</strong> die Forderung nach<br />
einem garantierten Gr<strong>und</strong>einkommen. Drei Thesen<br />
Georg<br />
Vobruba<br />
I. Will man soziale Sachverhalte erklären, muß man ein Verständnis ihrer<br />
Entstehung entwickeln. Ich schlage vor, sozialstaatliche Sicherung<br />
als Phase im Wandel des Verhältnisses von „Arbeiten <strong>und</strong> Essen" —<br />
d.h.: von Arbeitseinsatz <strong>und</strong> Einkommensbezug — (vgl. Vobruba 1985)<br />
im Kapitalismus zu interpretieren.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Den Anforderungen des sich entwickelnden Industriekapitalismus folgte<br />
die Arbeitskraft keineswegs automatisch. Erst politischer Eingriff konnte<br />
sie dazu zwingen, sich als Lohnarbeit anzubieten, marktgängig zu werden.<br />
Dieser politische Eingriff schnitt den Arbeitskräften alle Zugänge zu arbeitsmarktexternen<br />
Lebenschancen ab <strong>und</strong> kanalisierte so ihr existentielles Interesse<br />
hin auf Lohnarbeit. In dieser ersten Phase wurde von den Besitzenden<br />
gegenüber den Armen mit dem Satz ernst gemacht, „wer nicht arbeitet,<br />
soll auch nicht essen". Armut wurde zum arbeitsmarktpolitischen Regulativ.<br />
Der Nexus von Arbeiten <strong>und</strong> Essen war un-bedingt.<br />
Die Errichtung von Sozialstaatlichkeit modifizierte den Nexus von Arbeiten<br />
<strong>und</strong> Essen. Dies bedeutete die Installierung eines widersprüchlichen<br />
Arrangements: Einerseits relativierte soziale Sicherung die Drohung der Armut,<br />
lockerte den Nexus. Andererseits mußte sozialstaatliche Sicherung so<br />
angelegt werden, daß sie die Lohnarbeitsbereitschaft nicht stört. Freilich,<br />
mit dem Ausweis dieses „einerseits-andererseits" allein ist nicht viel gewonnen.<br />
Ich will darum eine Formel anbieten, welche die Widersprüchlichkeiten<br />
des sozialstaatlichen Arrangements nicht bloß als A<strong>mb</strong>ivalenz notiert, sondern<br />
sie integriert zu fassen sucht: Sozialstaatliche Sicherung ist die Errichtung<br />
arbeitsmarktexterner Lebenschancen, die unter lohnarbeitszentrierten<br />
Vorbehalten stehen. Die Arbeitszentriertheit soll sichergestellt werden<br />
durch die Geltung der beiden Prinzipien: „erst arbeiten, dann ..." <strong>und</strong> „Arbeitsbereitschaft<br />
zeigen, damit ..." Muster des erstgenannten ist die Alterssicherung,<br />
Muster des letztgenannten ist die Sozialhilfe zum allgemeinen Lebensunterhalt.<br />
Die Arbeitslosenversicherung weist beide Voraussetzungen<br />
auf. Ich nenne diese zweite Phase die Phase des bedingten Nexus von Arbeiten<br />
<strong>und</strong> Essen.<br />
Jedenfalls als kategoriale Möglichkeit läßt sich hier schon andeuten: Die<br />
Entkoppelung von Arbeiten <strong>und</strong> Essen wäre eine dritte Phase, ein institutionelles<br />
Arrangement jenseits der spezifischen Widersprüchlichkeit sozialstaatlicher<br />
Sicherung. Über die soziale Möglichkeit der Realisierung dieser<br />
dritten Phase wird mit der Frage nach der Stabilität der zweiten — der<br />
Funktionstüchtigkeit lohnarbeitszentrierter Sozialpolitik — in der näheren<br />
Zukunft mitentschieden.<br />
II. Die nähere Zukunft wird eine Vertiefung <strong>und</strong> Verdeutlichung der<br />
doppelten Krise der Lohnarbeit bringen. Das arbeitszentrierte System<br />
soziale Sicherung wird durch die doppelte Krise der Lohnarbeit in Mitleidenschaft<br />
gezogen.<br />
In der Krise der Lohnarbeit treffen zwei Entwicklungen zusammen:<br />
Zum einen wird die Zahl der Lohnarbeitsplätze zunehmend quantitativ<br />
unzureichend. Der überwiegenden Zahl der Prognosen zufolge wird sich<br />
die Dauerarbeitslosigkeit noch verschärfen <strong>und</strong> bis in die Neunziger Jahre<br />
erhalten bleiben. Zum anderen werden die vorhandenen Arbeitsplätze zunehmend<br />
als qualitativ unzulänglich angesehen. Trotz Massenarbeitslosigkeit<br />
hält sich hartnäckig ein öffentlicher Diskurs, der die Qualität der industriellen<br />
Lohnarbeit ihrem Inhalt, ihren Rahmenbedingungen <strong>und</strong> ihren<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Begleiteffekten nach der Kritik unterzieht <strong>und</strong> Alternativen zur Sprache<br />
bringt. Diese Konstellation, in der beide Tendenzen zusammentreffen, nenne<br />
ich die „doppelte Krise der Lohnarbeit". (Vobruba 1983) In dieser Situation<br />
droht ein lohnarbeitszentriertes System sozialer Sicherung zunehmend<br />
leerzulaufen. Die Maxime „erst arbeiten, dann ..." ergibt keinen Sinn,<br />
wenn der Einzelne nicht mehr in der Lage ist, eine durchgängige Normal-<br />
Lohnarbeits-Biographie zustande zu bringen. Und die Maxime „Arbeitsbereitschaft<br />
zeigen, damit ..." wird prohibitiv, wenn Arbeitsbereitschaft aufgr<strong>und</strong><br />
des dauerhaften Arbeitsplatzmangels durch den Arbeitssuchenden<br />
nicht mehr belegbar ist, bzw. wenn sie durch Manipulationen am Zumutbarkeitsbegriff<br />
zur politischen Manövriermasse wird. (Vgl. Vobruba 1983a)<br />
Im Gefolge der quantitativen Seite der Krise der Lohnarbeit werden damit<br />
aus Zugangsvoraussetzungen, welche die Arbeitszentriertheit des Systems<br />
sozialer Sicherung absichern sollten, Zugangsbarrieren zum System. Die<br />
mit den genannten Maximen kontrafaktisch aufrechterhaltene Annahme,<br />
daß auf Dauer jede(r) Arbeitswillige/Arbeitsfähige einen Arbeitsplatz finde,<br />
kehrt sich gegen die Sicherungsbedürftigen. Sozialstaatliche Konsequenzen<br />
aus der qualitativen Seite der doppelten Krise der Lohnarbeit erwachsen<br />
dann, wenn die Nicht-Teilnahme an Lohnarbeit mit Versuchen unkonventioneller<br />
Beschäftigungsformen, Selbsthilfe etc. verknüpft wird. Daß das<br />
lohnarbeitszentrierte System sozialer Sicherung für die Nützlichkeit solcher<br />
Tätigkeiten <strong>und</strong> für die Anerkennungsbedürftigkeit „abweichender" Beschäftigungswünsche<br />
nur ein schwaches Sensorium ausgebildet hat, führt<br />
hier zu zwei Konsequenzen. Zum einen nimmt man mit dem Engagement<br />
in unkonventionellen Beschäftigungsformen das Risiko ungleich schlechterer<br />
sozialer Sicherung auf sich. Dies wird insbesondere dann problematisch,<br />
wenn — unter dem Druck der Dauerarbeitslosigkeit — es <strong>und</strong>eutlich wird,<br />
ob dieses Engagement freiwillig oder unfreiwillig erfolgt. Und zum anderen<br />
nehmen sich Versuche, dennoch am lohnarbeitszentrierten System sozialer<br />
Sicherung zu partizipieren, in dessen Logik notwendigerweise als Versuche<br />
des Mißbrauchs sozialstaatlicher Leistungen aus.<br />
Beide Aspekte der „doppelten Krise der Lohnarbeit" schlagen also in<br />
Sozialstaatsdefekte durch: Mit dem quantitativen Unzureichen der Lohnarbeitsmöglichkeiten<br />
werden aus den lohnarbeitszentrierten Zugangsvoraussetzungen<br />
zum System Zugangsschranken. Aus den qualitativen Unzulänglichkeiten<br />
der Lohnarbeit erwachsende Aktivitäten werden durch die<br />
spezifische Selektivität des lohnarbeitszentrierten Systems sozialer Sicherung<br />
mit unverhältnismäßig hohen Risiken belastet. Damit stellt sich die<br />
Frage nach Reorganisationsmöglichkeiten des Systems sozialer Sicherung,<br />
nach einem „U<strong>mb</strong>au des Sozialstaats". (Widersprüche 1984)<br />
III. Die Forderung nach einem garantierten Gr<strong>und</strong>einkommen ist Konsequenz<br />
der Funktionsverluste lohnarbeitszentrierter Sozialpolitik. Ein<br />
garantiertes Gr<strong>und</strong>einkommen könnte Kern eines neuen Paradigmas der<br />
Sozialpolitik sein, würde zugleich die Grenzen des herkömmlichen Sozialstaats<br />
transzendieren <strong>und</strong> insofern ihn „aufheben".<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Indiz dafür, daß ein garantiertes Gr<strong>und</strong>einkommen (vgl. Opielka, Vobruba<br />
1985) in seinen Konsequenzen die geläufigen Grenzen des Sozialstaats<br />
überschreiten würde, ist der Umstand, daß die Untersuchung von Sozialstaatsdefekten<br />
nur ein Anknüpfungspunkt unter mehreren für mögliche Argumentationen<br />
für ein garantiertes Gr<strong>und</strong>einkommen ist.<br />
A. Der sozialpolitische Anknüpfungspunkt<br />
Wenn es stimmt, daß das lohnarbeitszentrierte System sozialer Sicherung<br />
zunehmend leerläuft, dann genügt schon die Besinnung auf die kompensatorische<br />
Sozialstaatsprogrammatik, um die Notwendigkeit arbeitsunabhängiger<br />
Sicherungsmechanismen einzusehen. Zugleich böte eine lohnarbeitsunabhängige<br />
soziale Sicherung all jenen Tätigkeiten, die in Reaktion auf die<br />
qualitativen Unzulänglichkeiten von Lohnarbeit entstehen, verbesserte Entfaltungschancen<br />
(vgl. Greven 1984). Dazu kommt noch, daß die Verallgemeinerung<br />
einer materiellen Basissicherung zum Abbau von sozialstaatlich<br />
bewirkten, gesellschaftspolitisch in hohem Maße problematischen, Interessenprofilen<br />
beitragen könnte. Dies betrifft insbesondere den Interessengegensatz<br />
zwischen Arbeitenden <strong>und</strong> Arbeitslosen in ihrer Eigenschaft als potentiell<br />
<strong>und</strong> akut an Sicherungsleistungen Interessierten: Ersteren muß die<br />
Inanspruchnahme der Leistungen durch letztere als Verschleudern ihrer<br />
Beitragsleistungen <strong>und</strong> als Verletzung ihres Interesses an der langfristigen<br />
Stabilität des Versicherungsfonds erscheinen. (Vgl. Vobruba 1985) Publizistische<br />
Beliebtheit <strong>und</strong> Popularität des Mißbrauchsverdachts bezeugen<br />
die Existenz dieses Interessengegensatzes.<br />
B. Der verteilungspolitische Anknüpfungspunkt<br />
Von der Krise der Arbeitsgesellschaft (vgl. Matthes 1983) ist gemeinhin in<br />
dem Sinn die Rede, daß zunehmende Arbeitsproduktivität dazu führt, daß<br />
sich das BSP-Wachstum vom Beschäftigungswachstum abkoppelt, <strong>und</strong> der<br />
Arbeitsmarkt somit für die Arbeitsfähigen/Arbeitswilligen seine Funktion<br />
verliert. (Vgl. Berger, Offe 1982) Es müsse daher, so wird gefolgert, die Verteilungsfunktion<br />
des Arbeitsmarktes durch andere Mechanismen der Güterverteilung<br />
ergänzt werden. Die hier gr<strong>und</strong>gelegte These einer Produktion-<br />
Produktivitäts-Schere ist für die letzten 10 bis 15 Jahre empirisch kaum<br />
haltbar. (Vgl. MittAB 1/1983:8) Jedenfalls läßt sich die Arbeitslosigkeit in<br />
ihrem Gesamtausmaß damit nicht erklären. Doch muß man diesen Umstand<br />
nicht als Argument gegen die Entkoppelung von Arbeiten <strong>und</strong> Essen gelten<br />
lassen. Ich nenne dafür zwei Gründe. Zum einen spricht alle Voraussicht dafür,<br />
daß in näherer Zukunft erhebliche, zur Zeit in Latenz liegende, Rationalisierungsmöglichkeiten<br />
realisiert werden. (Vgl. Kern, Schumann 1984)<br />
Dann stellt sich nur noch die Frage nach der Alternative zwischen einer po-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
litisch kalkulierten <strong>und</strong> kontrollierten Entkoppelung von Arbeiten <strong>und</strong><br />
Essen oder einer, die unkontrolliert — als noch zunehmende Massenarbeitslosigkeit<br />
— ins Kraut schießt. Zum anderen läßt sich der Hinweis auf<br />
Wirtschaftswachstum trotz hoher Arbeitslosigkeit <strong>und</strong> (leichtem) Rückgang<br />
der Beschäftigung als Indiz für eine in der Krise ungebrochene Leistungsfähigkeit<br />
des ökonomischen Systems nehmen (vgl. Berger 1984)<br />
<strong>und</strong> daran die Schlußfolgerung knüpfen, daß ein solches System Abschöpfungen<br />
eines Teiles seines out-puts <strong>und</strong> dessen Verteilung nach anderen als<br />
den Regeln des Arbeitsmarktes durchaus verkraftet. Arbeitslosigkeit (egal<br />
woher sie kommt) bei steigendem Produktions- <strong>und</strong> Produktivitätsniveau<br />
weist somit darauf hin, daß die Einführung eines garantierten Gr<strong>und</strong>einkommens<br />
möglich ist, selbst wenn man seine Notwendigkeit anders, etwa:<br />
sozialpolitisch, begründet.<br />
C. Der arbeitsmarktpolitische Anknüpfungspunkt<br />
Schließt man die Steigerung der Nachfrage nach Arbeitskräften als allein<br />
tragfähige Strategie zur Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit aus, so bleiben<br />
— auf die Angebotsseite des Arbeitsmarktes zielend — prinzipiell zwei<br />
Maßnahmenbündel: 1. Umverteilung von Arbeitsvolumina durch Arbeitszeitpolitik.<br />
2. Schaffung arbeitsmarktexterner Lebenschancen zwecks<br />
freiwilliger Verringerung des Angebots an Arbeitskräften. Stellt sich nun<br />
heraus, daß — aus welchen Gründen auch immer — sich auf arbeitszeitpolitischem<br />
Wege allein ein hoher Beschäftigungsstand nicht realisieren<br />
läßt, bleibt als flächendeckende Strategie zur Entlastung des Arbeitsmarktes<br />
nur das garantierte Gr<strong>und</strong>einkommen. Dabei geht es insbesondere um die<br />
Chance, freiwillige Arbeitszeitumverteilungspotentiale zu aktivieren, die<br />
— gerade in der Beschäftigungskrise — durch Sicherheitsmotive <strong>und</strong> Besitzstandswahrungs-Mentalität<br />
verschüttet sind: eben dann also, wenn sie am<br />
dringendsten benötigt würden.<br />
LITERATUR<br />
Berger, Johannes 1984. „Alternativen zum Arbeitsmarkt". In: MittAB 17. Jg. 1/1984.<br />
—, Claus Offe 1982. „Die Zukunft des Arbeitsmarktes. Zur Ergänzungsbedürftigkeit<br />
eines versagenden Allokationsprinzips". In: Gerd Schmidt, Hans-Joachim Braczyk,<br />
Jost von dem Knesebeck (Hg.), Materialien zur Industrie<strong>soziologie</strong>. Sonderheft<br />
24 der KZFSS. Opladen.<br />
Greven, Michael Th. 1984. „Der 'hilflose' Sozialstaat <strong>und</strong> die hilflose Sozialstaatskritik".<br />
In: Vorgänge 67. <strong>München</strong>.<br />
Kern, Horst, Michael Schumann 1984. Das Ende der Arbeitsteilung? <strong>München</strong>.<br />
Matthes, Joachim (Hg.) 1983. Krise der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des 21.<br />
Deutschen Soziologentages in Ba<strong>mb</strong>erg. Frankfurt, New York.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Opielka, Michael, Georg Vobruba (Hg.), Das garantierte Gr<strong>und</strong>einkommen Entwicklung<br />
<strong>und</strong> Perspektive einer Forderung. Frankfurt 1985.<br />
Vobruba, Georg 1983. „Arbeitszeitpolitik als Gesellschaftspolitik". In: Emmerich<br />
Talos, Georg Vobruba (Hg.), Perspektive der Arbeitszeitpolitik. Wien.<br />
—, 1983a. Politik mit dem Wohlfahrtsstaat. Frankfurt.<br />
—, 1985. „Arbeiten <strong>und</strong> Essen. Die Logik im Wandel des Verhältnisses von <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Arbeit <strong>und</strong> existentieller Sicherung im Kapitalismus". In: Stephan Leibfried,<br />
Florian Tennstedt (Hg.), Politik der Armut. Frankfurt.<br />
Widersprüche 1984. Nr. 12, U<strong>mb</strong>au des Sozialstaats. Offenbach.<br />
Sozialpolitik aus arbeitspolitischer Sicht<br />
Rolf Rosenbrock<br />
Ich halte den Vorschlag von Fritz Böhle, den weithin von Politik <strong>und</strong><br />
Wissenschaft dethematisierten Zusammenhang zwischen Produktionsprozeß,<br />
Lohnarbeit <strong>und</strong> Sozialpolitik wieder als zentralen Ausgangspunkt<br />
für sozialpolitische Analysen aufzugreifen, für notwendig, überfällig <strong>und</strong><br />
richtungweisend. Als Sozialpolitikforscher aus einem Institut, das sich mit<br />
Arbeitspolitik, also mit Entwicklungsproblemen der Erwerbsarbeit <strong>und</strong><br />
deren <strong>gesellschaftliche</strong>r Regulierung befaßt, fällt mir dieses Kompliment<br />
nicht schwer.<br />
Ich möchte im Anschluß an Böhle einige Bemerkungen zur Realanalyse<br />
der gegenwärtig propagierten <strong>und</strong> politisch bereits exekutiv gewendeten<br />
Krise des Sozialstaats machen.<br />
Sozialpolitik besteht historisch-genetisch <strong>und</strong> wesentlich darin, die<br />
materiellen Voraussetzungen <strong>und</strong> Folgen von Lohnarbeit abzusichern. Im<br />
Kern geht es darum, die materielle Reproduktion im Lebens- <strong>und</strong> Generationsablauf<br />
der auf abhängige Arbeit angewiesenen Schichten der Bevölkerung<br />
in solchen Phasen <strong>und</strong> Lebenslagen abzusichern, in denen dies<br />
durch Lohnarbeit nicht oder nicht ausreichend möglich ist. Instrumente<br />
dazu sind <strong>gesellschaftliche</strong> (d.h. bei uns: staatliche <strong>und</strong> parastaatliche)<br />
Finanzierung, Normierung <strong>und</strong> Institutionen. Sozialpolitik ist also einerseits<br />
mehr als kurzfristige Überbrückungshilfen <strong>und</strong> Reparaturleistungen<br />
für die Ware Arbeitskraft, sie setzt aber andererseits keineswegs die zentrale<br />
Rolle der Lohnarbeit für die Reproduktion der Gesellschaft außer Kraft.<br />
Nicht erst seit der Übernahme keynesianischer Elemente in die Wirtschaftspolitik,<br />
sondern schon seit den Tagen der Bismarckschen Sozialgesetzgebung<br />
folgt die Entwicklung der dafür eingesetzten Systeme weniger<br />
der evolutionären Entwicklungslogik einer gesamt<strong>gesellschaftliche</strong>n Modernisierung,<br />
sondern ist vielmehr Gegenstand kämpferischer Auseinandersetzungen<br />
zweier „Sozialgestalten" <strong>und</strong> „Sozialideen". Die dabei erreichten<br />
Kompromißgleichgewichte sind stets labil, weil ihnen unterschiedliche<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Interessen zugr<strong>und</strong>e liegen <strong>und</strong> ihre jeweilige Ausprägung von den aktuellen<br />
Kräfteverhältnissen abhängig ist. Die andere Seite des Kompromisses<br />
besteht darin, daß die Gestaltungsautonomie bzw. Prärogative der Unternehmen<br />
in bezug auf Investition, Produktion <strong>und</strong> Arbeitskräfteeinsatz<br />
weitgehend unangetastet bleibt.<br />
Dieser Kompromiß scheint in der B<strong>und</strong>esrepublik derzeit in seinem<br />
Kernbestand gefährdet. Dabei deutet sich ein gr<strong>und</strong>legender Wandel in<br />
der wechselseitigen Beziehung zwischen Produktions- <strong>und</strong> Sozialpolitik<br />
an, bei dem die <strong>gesellschaftliche</strong> Bezugsgröße für sozialstaatliche Leistungen<br />
von der Sicherung eines angemessenen Reproduktionsniveaus hin zur<br />
Durchsetzung der Verfügbarkeit von Arbeitskraft zu verschlechterten<br />
Konditionen des Arbeitsvertrages wechselt. Der innere Zusammenhang<br />
zwischen Produktions- <strong>und</strong> Sozialpolitik wird dabei keineswegs aufgelöst,<br />
sondern auf einem neuen, sozialstaatlich erheblich niedrigeren Niveau<br />
restrukturiert. Die politische Bedingungskonstellation hierfür liegt im<br />
Zusammentreffen von drei Entwicklungen bzw. Strategien, die durch die<br />
Massenarbeitslosigkeit auf stabil hohem Niveau teils erst ermöglicht werden,<br />
teils diese erst bewirken oder vergrößern:<br />
— Zum einen werden die Tiefs in den Konjunkturzyklen, seit sie auch in<br />
der B<strong>und</strong>esrepulbik wieder real erfahrbar geworden sind, benutzt, um das<br />
Verhandlungs- <strong>und</strong> Durchsetzungspotential der Lohnabhängigen bei Aushandlungs-Prozessen<br />
innerhalb <strong>und</strong> außerhalb der Produktion zu schwächen.<br />
Dies ist freilich normal, gehört zum „business as usual" des Wirtschaftssystems<br />
<strong>und</strong> wird unter den Bedingungen einer „nur" zyklischen<br />
Wirtschafts<strong>entwicklung</strong> in Phasen des Hochs meist wieder ausgeglichen.<br />
— Eine Verschärfung erhält diese Entwicklung aus dem zyklusüberlagernden<br />
Trend der Verringerung des in Lohnarbeit zu verrichtenden Arbeitsvolumens<br />
in der Gesellschaft durch neue Technologien <strong>und</strong> Organisationsformen<br />
(Produktions-Produktivitäts-Schere) sowie — als Krisenfolge —<br />
durch sinkende Massenkaufkraft. Auch diese Prozesse müßten bei entsprechender<br />
politischer Bearbeitung innerhalb des Wirtschaftssystems<br />
nicht zu Massenarbeitslosigkeit führen, Fritz Böhle hat Richtungen möglicher<br />
Problemlösungen angedeutet.<br />
— Ihre besondere Brisanz aber erhalten diese Entwicklungen aus der Tatsache,<br />
daß diese Probleme in allen kapitalistischen Industrienationen zwar<br />
nicht gleichzeitig, im Effekt aber gleichartig aufgetreten sind <strong>und</strong> in gleicher<br />
Weise wirtschaftspolitisch bearbeitet werden. Das erschwert — wegen der<br />
gewachsenen Synchronität der Konjunkturzyklen — nicht nur wirksam<br />
kompensatorische Exportstrategien, sondern schafft vor allem eine Situation,<br />
in der die nationalen Wirtschaftspolitiken sich auf enger werdenden<br />
Weltmärkten gegenseitig tendenziell blockieren <strong>und</strong> deshalb auch dort<br />
keine Lösung ihrer inneren Wirtschaftsprobleme finden können.<br />
Man muß keine abschließende Bewertung über das komplexe Verhältnis<br />
zwischen Ökonomie <strong>und</strong> Politik auf der Makro-Ebene vornehmen, um zu<br />
der Feststellung zu gelangen, daß für die Bearbeitung dieser Gemengelage<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ökonomischer Probleme auch innerhalb des bestehenden Wirtschaftssystems<br />
durchaus unterschiedliche politische Optionen existieren.<br />
Bezüglich der derzeit international dominanten, angebotsorientierten<br />
Wirtschaftspolitik kann wohl unbestreitbar festgestellt werden: Diese<br />
Politik (sie mag auch neoklassisch, monetaristisch oder neoliberal genannt<br />
werden) verfolgt nicht das Ziel, die Massenarbeitslosigkeit tatsächlich<br />
zu beseitigen:<br />
Wenn als wesentliche Krisenursache gesamtwirtschaftlich eine zu hohe<br />
Lohn- <strong>und</strong> eine zu niedrige Gewinnquote oder einzelwirtschaftlich eine<br />
leistungshindernde Inflexibilität der individuellen Lohnhöhe diagnostiziert<br />
wird („Mindestlohn-Arbeitslosigkeit", „mangelnder Leistungsbezug<br />
der Lohnstruktur"), dann müssen diese Löhne eben gesenkt bzw. flexibilisiert,<br />
d.h. noch stärker differenziert werden. Das geht in liberal verfaßten<br />
Gesellschaften — schließt man eine planmäßig inflationistische Wirtschaftspolitik<br />
aus — nur über a) eine Schwächung der Verhandlungsmacht<br />
der Gewerkschaften, <strong>und</strong> dies am besten durch b) eine breite Reservearmee.<br />
Auf diese Interessenlage hat Kalecki bereits 1943 hingewiesen.<br />
Wenn als wichtigstes Erholungs- <strong>und</strong> Expansionsfeld für die nationale<br />
Ökonomie der Weltmarkt vor allem für Produkte mit avancierter Technologie<br />
angesehen wird (<strong>und</strong> nur in zweiter Linie der Binnenmarkt), dann<br />
muß — aus der Sicht der Akteure einer solchen Politik — das Gegenargument<br />
sinkender konsumptiver <strong>und</strong> öffentlicher Nachfrage durch Fortfall<br />
bzw. Senkung von Lohn- <strong>und</strong> Transfereinkommen nicht mehr so ernst<br />
genommen werden.<br />
Dann müssen vielmehr <strong>und</strong> statt dessen die Voraussetzungen dafür<br />
geschaffen werden, daß die für die Umstrukturierung des Produktionsprozesses<br />
als notwendig angesehenen Voraussetzungen geschaffen werden.<br />
Eine arbeitspolitisch zentrale Voraussetzung dafür besteht auf Seiten der<br />
Arbeitskräfte in deren erhöhter Hinnahmebereitschaft für betrieblich<br />
geforderte Änderungen in bezug auf Löhne, Arbeitszeit, Arbeitsorganisation<br />
<strong>und</strong> qualifikationsgerechten Arbeitseinsatz. Der Bedarf der Unternehmen<br />
an solchen Veränderungen ist hoch: In diesem Punkt schließe<br />
ich mich Kern/Schumann an, nach deren Einschätzung wir uns derzeit<br />
am Ende der Inkubationszeit neuer Basistechnologien befinden. D.h.,<br />
daß die vielfältige <strong>und</strong> schwerwiegende Symptomatik des <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Infekts nunmehr sichtbar zu werden beginnt <strong>und</strong> sich erst in den<br />
kommenden Jahren voll entfalten wird.<br />
Die dabei anfallenden Umstrukturierungen im Betrieb schaffen Durchsetzungs-<br />
<strong>und</strong> Legitimationsprobleme. Neben der durch die Massenarbeitslosigkeit<br />
verschobenen Machtrelation <strong>und</strong> einem gewaltigen ideologischen<br />
Aufwand wird als Ressource zu ihrer Lösung auch die Diffamierung <strong>und</strong><br />
massive Schlechter-Ausstattung (bis hin zum faktischen Entzug) von sozialpolitisch<br />
abgesicherten Auffangpositionen eingesetzt.<br />
Aus dem Arbeitsleben gekippt zu werden, wird nach diesem Konzept<br />
wieder zu einer geradezu existentiellen Bedrohung für die abhängige Be-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
schäftigten. Ausmaß <strong>und</strong> Intensität der Lohnabhängigkeit, die Abhängigkeit<br />
vom Betrieb <strong>und</strong> damit die Hinnahmebereitschaft gegenüber Zumutungen<br />
im Produktionsprozeß wachsen mit zunehmender Massenarbeitslosigkeit wie<br />
auch mit jeder Verschlechterung der materiellen Ausstattung von Sozialleistungen.<br />
Dies gilt nicht nur für die unmittelbaren Lohnersatzleistungen. Zumindest<br />
vermittelt wirkt sich dies auf fast alle Leistungen des Sozialstaates<br />
aus, die ja durchweg in einem nach unten hin abgestuften Verhältnis je nach<br />
Entfernung der sozialpolitisch abgefederten Problemlage zur Lohnarbeit<br />
stehen. Das „umgestülpte Netz" der Sozialleistungen wird tiefer gehängt<br />
<strong>und</strong> an den Rändern steiler gezurrt, um den Sturz vom Seil der Lohnarbeit<br />
bedrohlicher werden zu lassen.<br />
Triebfeder der Lohnarbeit wird dadurch in stärkerem Umfang (wieder)<br />
die Furcht. Sozialpolitik bewirkt damit derzeit auch die systematische<br />
Vermehrung von Angst in der Gesellschaft. Auf diese Tendenz hat auch<br />
Frau Mayntz-Trier in ihrem Eröffnungsvortrag hingewiesen.<br />
Vorbereitet bzw. in Gang gesetzt wird auf diese Weise das große Projekt<br />
der einseitigen Anpassung von Konditionen des Arbeitsvertrages an die<br />
neuen <strong>und</strong> alten Interessen der Unternehmen. Kollektivrechtliche, d.h. im<br />
wesentlichen gewerkschaftlich durchgesetzte Schutznormen erfahren dabei<br />
eine deutliche Absenkung. Ihrer völligen Abschaffung stehen jedoch Durchsetzungsprobleme<br />
<strong>und</strong> die Funktionalität der Gewerkschaften als bindungsfähiger<br />
Ordnungsmacht entgegen.<br />
Die ökonomische Krise des Sozialstaats (<strong>und</strong> nur diese wird von der dominanten<br />
Wirtschaftspolitik bekämpft) ist aus dieser Sicht nicht so sehr eine<br />
Finanzierungskrise oder etwa durch Anspruchsdenken „sozial pervertierter<br />
Sozialcharaktere" induziert. Sie ist auch mehr als eine genutzte Gelegenheit<br />
zur Umverteilung von unten nach oben <strong>und</strong> zur Absenkung der<br />
Staatsquote. Als spezifische politische Reaktionsform auf eine auch anders<br />
beherrschbare ökonomische Problemlage dient sie zugleich der Vorbereitung<br />
<strong>und</strong> Absicherung der produktionspolitischen Strategien der späten<br />
80er <strong>und</strong> der 90er Jahre.<br />
Für diese These bedarf es keiner „Verschwörungstheorie". Vielmehr<br />
zeigt eine Analyse der wesentlichen Triebkräfte <strong>und</strong> Variablen, daß eine<br />
neoklassisch angeleitete Wirtschaftspolitik, der auf einen sozialpolitischen<br />
Paradigmenwechsel hinlaufende Ab- <strong>und</strong> U<strong>mb</strong>au von Sozialstaatlichkeit<br />
<strong>und</strong> die Verbreitung von Leitbildern der Individualisierung <strong>und</strong> Entsolidarisierung<br />
sich gegenseitig ergänzen <strong>und</strong> verstärken können, ohne daß es<br />
eines steuernden Komplotts bedarf. Es ist in diesem Zusammenhang daran<br />
zu erinnern, daß die in der B<strong>und</strong>esrepublik in den 50er Jahren als Variante<br />
der Neoklassik dominante Wirtschaftslehre des Ordo-Liberalismus die Existenz<br />
einer flächendeckend kompensatorischen Sozialstaatlichkeit niemals<br />
in ihre Theorie integriert hat. Das „Opfer" der Integration des sozialen<br />
Elements in die Theorien von der Marktwirtschaft wurde vielmehr pragmatisch<br />
dem damals vorherrschenden Bewußtsein nach der Niederwerfung des<br />
Faschismus, dem politischen Kräfteverhältnis <strong>und</strong> der aufkeimenden Sy-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
stemkonkurrenz gebracht. Damit bleibt die kompensatorische Sozialstaatlichkeit<br />
auch vom Legitimationsbedarf <strong>und</strong> letztlich von <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Kräfteverhältnissen abhängig. Auf dieser Ebene ist derzeit noch vieles<br />
offen. Analysen zu immanenten Grenzen des Abbaus <strong>und</strong> zu neu aufbrechenden<br />
Widersprüchen sind dringend erforderlich.<br />
An Illustrationen für den Prozeß des Ab- <strong>und</strong> U<strong>mb</strong>aus herrscht kein Mangel: Kürzungen<br />
bzw. Verschärfung der Leistungsvoraussetzungen bei Arbeitslosenversicherung, Arbeitslosenhilfe,<br />
Sozialhilfe, Renten, Mutterschaftsurlaub, Schwerbehindertenunterstützung<br />
<strong>und</strong> Ausbildungshilfen aller Art. Von den registrierten über 2 Millionen Arbeitslosen hat<br />
nur noch ein Drittel Anspruch auf Arbeitslosengeld, das Schlagwort von der „neuen Armut"<br />
machte die R<strong>und</strong>e. Erhöhung der Gebühren bei zahlreichen Sozialeinrichtungen,<br />
Einführung bzw. Erhöhung der Selbstbeteiligung bei Arzneimitteln, Krankenhaus <strong>und</strong><br />
Kuren; Sozialversicherungspflichtigkeit von Krankengeld etc. pp. Zwischen Ende 1981<br />
<strong>und</strong> Ende 1983 wurden ca. 250 Steuer- <strong>und</strong> sozialpolitische Rechtsänderungen durch<br />
den B<strong>und</strong>esgesetzgeber verabschiedet. Die Leistungskürzungen summieren sich nach Berechnungen<br />
des DGB allein für 1983 <strong>und</strong> 1984 auf 25 Milliarden DM; nach einer Untersuchung<br />
aus der Universität Köln ergibt sich für die Jahre 1982 bis 1985 eine Kürzung<br />
der Sozialeinkommen um 75 Milliarden DM. Gleichzeitig wird zunehmend die individuelle<br />
Verantwortlichkeit (sei es in Form der Subsiardität, sei es als Versicherungsprinzip)<br />
gegen das Solidarprinzip ausgespielt.<br />
Zentraler Bezugspunkt dieser Sozial- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitspolitik ist das Gesellschafts-<br />
<strong>und</strong> Menschenbild der Neoklassik <strong>und</strong> neoliberaler Wirtschaftslehren,<br />
nach denen der Einzelne seines Glückes Schmied — <strong>und</strong> auch der<br />
Schmied seines Unglücks — ist. Dem entspricht die — auch in der Wissenschaft<br />
um sich greifende — Re-Individualisierung von Lebensrisiken, die<br />
Auflösung bzw. das schlichte Bestreiten <strong>gesellschaftliche</strong>r <strong>und</strong> kollektiver<br />
Verursachungskonstellationen. Sozialwissenschaftliche Analysen können insbesondere<br />
dort einen wirksamen Beitrag zur Aufklärung leisten, wo sich die<br />
Implikationen dieser Politik an der empirisch feststellbaren Realität brechen:<br />
1. Das Gesellschafts- <strong>und</strong> Menschenbild der Neoklassik <strong>und</strong> die ihnen<br />
entsprechende Ges<strong>und</strong>heitspolitik kommen in beträchtliche Begründungsschwierigkeiten<br />
<strong>und</strong> Legitimationsprobleme vor der Tatsache vor allem<br />
schichtenspezifischer Ungleichheit der Verteilung von Lebens- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitschancen.<br />
Eine Folge dessen besteht in der starken Zurückhaltung<br />
bei der Förderung entsprechender Forschungsvorhaben sowie in der faktischen<br />
Nicht-Zurkenntnisnahme von Bef<strong>und</strong>en aus vergleichbaren Industrieländern<br />
(z.B. Black-Report „Inequalities in Health" aus Großbritannien).<br />
2. Die neoliberale Betrachtungsweise steht infolgedessen auch im Gegensatz<br />
zu ges<strong>und</strong>heitspolitischen Ansätzen, die den (in Morbidität <strong>und</strong><br />
Mortalität) dominanten chronischen Volkskrankheiten mit Präventionsstrategien<br />
begegnen wollen, die an ges<strong>und</strong>heitsriskanten Verhältnissen ansetzen.<br />
3. Unverträglich mit der vorherrschenden Betrachtungsweise sind auch<br />
die teilweise bereits erprobten <strong>und</strong> wissenschaftlich weiter zu untermauernden<br />
Ansätze der kollektiven Abwehr ges<strong>und</strong>heitsgefährdender Risiko- <strong>und</strong><br />
Belastungskonstellationen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Die sozialpolitisch dominante Strategie wirkt sich heute allerdings<br />
auch schon in der Arbeitswelt aus. Die arbeitspolitische Beziehung zwischen<br />
Lohnarbeit <strong>und</strong> Sozialpolitik ist wechselseitig. An der Lockerung des Seiles<br />
wird bereits gearbeitet.<br />
Auf der Ebene staatlicher Maßnahmen läßt sich dies u.a. an der Aufweichung<br />
bzw. Abschaffung von Schutznormen des Arbeitsvertrages, an der<br />
Rücknahme von Arbeitsschutz-Bestimmungen, der Zulassung privater Arbeitsvermittlung<br />
<strong>und</strong> der Etablierung von Elementen der Zwangsarbeit in<br />
der Sozialhilfe ablesen.<br />
In den Betrieben führt dies schon heute nicht nur zu vielfältigen Spaltungen<br />
in den Belegschaften <strong>und</strong> zur Flächenrodung betrieblicher Sozialleistungen.<br />
Vielmehr stehen die wenigen Fortschritte, die in den 70er Jahren<br />
z.B. auf dem Gebiet der betrieblichen Ges<strong>und</strong>heitspolitik in Richtung<br />
auf eine „präventive Sozialpolitik" erzielt werden konnten, derzeit insgesamt<br />
zur Disposition. Auch gesetzlich normierte Schutznormen werden<br />
heute in großem Umfang mißachtet. Betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsprobleme<br />
nehmen dabei aus den gleichen Gründen zu, die ihre betriebliche <strong>und</strong> öffentliche<br />
Thematisierung zunehmend erschweren.<br />
Aus alledem folgt, daß es wenig Aussicht auf Erfolg hat, Strategien gegen<br />
die „Krise des Sozialstaats", gegen den massiven Leistungsabbau isoliert<br />
im Sozialbereich mit oder für die Betroffenen außerhalb der Lohnarbeit<br />
zu entwerfen. Wenn mehr als eine solidarische Verwaltung des Elends<br />
angestrebt wird, kann die Wende der Wende nur durch Herstellung der hier<br />
nur angedeuteten Zusammenhänge <strong>und</strong> durch eine Koordination mit den<br />
Auseinandersetzungen im Produktionsbereich eingeleitet werden. Diese<br />
Forderung gilt für die Anlage wissenschaftlicher Untersuchungen ebenso<br />
wie für die Konzipierung politischer Strategien. Wird sie nicht eingelöst, so<br />
führt dies zu künstlichen Isolierungen sozial- oder produktionspolitischer<br />
Probleme <strong>und</strong> entsprechend suboptimierenden Lösungsstrategien mit häufig<br />
kontraproduktiven Ergebnissen. Die sich derzeit in Wissenschaft <strong>und</strong> Politik<br />
abzeichnenden Spezialisierungen für zweite, dritte <strong>und</strong> vierte Arbeitsmärkte,<br />
für Entwicklungsperspektiven alternativer Ökonomie <strong>und</strong> neue Zwischenstufen<br />
zwischen Lohnarbeit <strong>und</strong> Marginalisierung tragen oftmals bereits<br />
den Keim solcher verhängnisvollen Segmentierung in sich. Dabei wird nicht<br />
nur der Zusammenhang zwischen bezahlter Arbeit <strong>und</strong> sozialstaatlichen Auffangpositionen<br />
aufgegeben, der auch ein Lebenszusammenhang ist. Vielmehr<br />
zeichnet sich auch eine beträchtliche Überschätzung der Möglichkeiten politisch<br />
durchsetzungsfähiger Mobilisierung im Sozialbereich ab.<br />
Wenn solche Strategien den Bezug zur Produktionssphäre <strong>und</strong> die diese<br />
steuernden Kräfte (wieder) herstellen, können sie an analytischer Schärfe<br />
<strong>und</strong> an Durchsetzungskraft nur gewinnen. Der Kampf um die Neuverteilung<br />
des <strong>gesellschaftliche</strong>n Arbeitsvolumens (bei mindestens gleichbleibender<br />
Massenkaufkraft <strong>und</strong> ohne zusätzliche Intensivierung der Arbeitsleistung)<br />
sowie für einen Wechsel des wirtschaftspolitischen Paradigmas auf<br />
der Makro-Ebene weisen hierzu die Richtung.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
LITERATUR<br />
Adamy, W., J. Steffen (1984): Zwischenbilanz von Sozialdemontage <strong>und</strong> Umverteilungspolitik<br />
seit 1982, Köln.<br />
Böhle, F. (1984): Die <strong>gesellschaftliche</strong> Organisation von Arbeit als Problem der Sozialpolitik<br />
, in diesem Band.<br />
Kalecki, M. (1943): „Political Aspects of Full Employment", in: Political Quarterly,<br />
Vol. 14, 322 ff., abgedr. in: Frey, B.S., W. Meißner (Hg.): Zwei Ansätze der Politischen<br />
Ökonomie, Frankfurt/M. 1974, 176 ff.<br />
Kühn, H. (1984): „Sozialpolitik bei Massenarbeitslosigkeit", in: Wie teuer ist uns die<br />
Ges<strong>und</strong>heit?, Argument-Sonderband AS 113, Berlin.<br />
Naschold, F. (1982): „Die Zukunft des Wohlfahrtsstaates", in: W. Mommsen (Hg.):<br />
Die Entstehung des Wohlfahrtsstaates in Großbritannien <strong>und</strong> Deutschland 1850-<br />
1950, Stuttgart.<br />
Rosenbrock, R. (1984): Betriebliche Ges<strong>und</strong>heitspolitik in der Krise, IIVG/dp84-221,<br />
Wissenschaftszentrum Berlin.<br />
Rosenbrock, R. (1984): „Ges<strong>und</strong>heitsforschung aus der Defensive", in: Wie teuer ist<br />
uns die Ges<strong>und</strong>heit?, Argument-Sonderband AS 113, Berlin.<br />
Townsend, P., N. Davidson (1982): Inequalities in Health, The Black-Report, Harmondsworth.<br />
Wagner, W. (1982): Die nützliche Armut, Berlin.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Themenbereich II:<br />
Prognosen im Bildungsbereich<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
EINLEITUNG<br />
Ansgar Weymann<br />
Obwohl die Soziologie sich mit <strong>gesellschaftliche</strong>r Entwicklung auch in toto<br />
befaßt, spielt sich ein erheblicher Teil der Forschung doch in engeren 'Anwendungsbereichen'<br />
ab. Einer der hervorragenden Sektoren <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Entwicklung war für anderthalb Jahrzehnte das Bildungswesen. Aus diesem<br />
Gr<strong>und</strong>e bestritt die Bildungsforschung eine der Plenarveranstaltungen.<br />
Die Veranstaltungsreihe zum Thema 'Prognosen im Bildungsbereich'<br />
wurde von den Sektionen 'Bildung <strong>und</strong> Erziehung', 'Soziale Indikatoren'<br />
<strong>und</strong> 'Methoden' getragen. Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung lag in den Händen<br />
der drei Sektionssprecher Weymann, Gehrmann, Küchler.<br />
Unter dem Gesichtspunkt 'Soziologie <strong>und</strong> Gesellschaftliche Entwicklung'<br />
fällt im Bereich des Bildungswesens <strong>und</strong> der Bildungsforschung ein<br />
deutlicher Umschwung auf. In den sechziger Jahren wurde die Bildungspolitik<br />
zu einem der Pfeiler der Gesellschaftspolitik. Weitreichende Hoffnungen<br />
waren mit der Reform des Bildungswesens von der Vorschule bis<br />
zur Hochschule verb<strong>und</strong>en, erhebliche Anstrengungen wurden unternommen,<br />
harte Konflikte ausgetragen. Die sozialwissenschaftliche Forschung<br />
war an dieser Entwicklung beteiligt. Da eine solche 'Nutzung von Soziologie'<br />
oder umgekehrt Einflußnahme auf Politik keineswegs in allen 'Themenkonjunkturen'<br />
der öffentlichen Debatte oder in allen Praxisbereichen<br />
zu finden ist, läßt sich hier die Rückbindung der Bildungsforschung an den<br />
Gang der Bildungspolitik gut beobachten. Rückschläge im Stellenwert der<br />
Bildungspolitik fielen auf die Bildungsforschung auch dann zurück, wenn<br />
beide Seiten für heutige Probleme nur am Rande verantwortlich gemacht<br />
werden können, so z.B. für die Wirtschafts- <strong>und</strong> Arbeitsmarkt<strong>entwicklung</strong>.<br />
Insbesondere Bildungsprognosen (Bedarfs- <strong>und</strong> Angebotsprognosen)<br />
haben größte öffentliche Aufmerksamkeit gef<strong>und</strong>en. Unschärfen <strong>und</strong> Fehlprognosen<br />
sind unter den Stichworten 'Lehrstellenmangel, 'Lehrerberg',<br />
'Akademikerschwemme' jedermann bekannt. Obwohl an solchen Prognosen<br />
Soziologen nur als Minderheit beteiligt waren, werden sie in die Kritik einbezogen.<br />
Schwierige empirisch-analytische Forschungen zu Parametern<br />
solcher Prognosen wie Qualifikationsforschung oder Lebenslaufforschung<br />
(weit eher der Soziologie zuzurechnen), werden hingegen weniger zur<br />
Kenntnis genommen.<br />
Die Veranstaltungsreihe versucht, eine Bilanz angewandter Bildungsforschung<br />
zu ziehen, die heutige Situation zu bestimmen <strong>und</strong> Konsequenzen<br />
zu formulieren. Um die enge Verknüpfung von Soziologie <strong>und</strong> Praxis<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
in diesem Gebiet zum Tragen kommen zu lassen, wurden Bildungspolitiker<br />
<strong>und</strong> staatliche Forschungsinstitute mit einbezogen. Erfreulicherweise wurden<br />
die Einladungen in aller Regel angenommen. Das 'einsame Nachdenken'<br />
der Soziologen über die Bedingungen ihrer Anwendung war nicht das Programm.<br />
Die Veranstaltungsreihe wurde mit zwei Einführungsvorträgen generalisierenden<br />
Zuschnitts eröffnet (Bildung <strong>und</strong> Arbeitsmarkt bzw. Bildung <strong>und</strong><br />
Wertewandel). Es folgte ein Podiumsgespräch zwischen Bildungsforschung<br />
<strong>und</strong> Bildungspolitik, an dem u.a. der Staatssekretär im BMBW H.P. Piazolo<br />
<strong>und</strong> der frühere Bildungsminister B. Engholm teilnahmen. Die parallelen<br />
Nachmittagsreihen konzentrierten sich auf die beiden Schwerpunkte 'Politikberatung<br />
durch Bildungsforschung' bzw. Methodenfragen 'Daten, Erklärungen,<br />
Prognosen — Wege der Annäherung'.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
PROGNOSEN ÜBER BILDUNG UND ARBEIT -<br />
SOZIOLOGISCHER SICHT<br />
EINE BILANZ AUS<br />
Ulrich<br />
Teichler<br />
1. Einleitung<br />
Die Voraussage <strong>gesellschaftliche</strong>r Entwicklungen ist ein Thema; das Wissenschaftler<br />
<strong>und</strong> Politiker in besonderem Maße interessiert. Selbst in der Kritik,<br />
daß der Wert von Prognosen nicht über ein „Kaffeesatzlesen" hinausgehe,<br />
klingt nocht die Sehnsucht nach dem Vorhersehen der Zukunft an. Das<br />
gilt insbesondere für Prognosen über die Entwicklung des Bildungswesens<br />
<strong>und</strong> die Entwicklung der Beziehungen von Bildungs- <strong>und</strong> Beschäftigungssystem.<br />
In kaum einem anderen <strong>gesellschaftliche</strong>n Bereich wurden in der<br />
B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland so eingehende Bemühungen unternommen,<br />
die Zukunft mittelfristig mit großer Präzision auszumalen. Von daher bieten<br />
sich nach über zwei Jahrzehnten von Prognose-Erfahrungen Zwischenbilanzen<br />
an.<br />
Man kann dabei auf einen typischen Bereich von Fragen zurückgreifen,<br />
der die Prognoseforschung sowie die Bildungsplanung <strong>und</strong> -politik bewegt ,<br />
1<br />
etwa<br />
— die ex post facto prüfbare prognostische Validität der Prognosen,<br />
— die methodischen Ansätze der Prognosen,<br />
— die Verschränkungen von Prognosestudien <strong>und</strong> Planungsaktivitäten,<br />
— die Ursachen für unvorhergesehene Entwicklungen.<br />
Hieran orientiert sich in gewissem Umfange auch die folgende Übersicht.<br />
Dies kann jedoch höchstens einer von verschiedenen Fragenkomplexen<br />
sein, denn in einem Dialog zwischen Bildungssoziologen <strong>und</strong> Bildungspolitikern<br />
bzw. -planern begegnen sich nicht Prognoseforscher auf der einen<br />
<strong>und</strong> deren Nutzer auf der anderen Seite. Prognosen über die Entwicklung<br />
des Bildungssystems bzw. die Beziehungen von Bildungs- <strong>und</strong> Beschäftigungssystem<br />
wurden in erster Linie von Bildungsökonomen oder von der<br />
Bildungsverwaltung selbst durchgeführt. Bildungssoziologen haben sich gewöhnlich<br />
danebengestellt, die theoretischen <strong>und</strong> methodischen Vereinfachungen<br />
gegenüber der komplexen Realität kritisiert <strong>und</strong> Schwächen<br />
der prognostischen Validität als Bestätigung ihrer Abneigung gegenüber<br />
solchen Untersuchungen mit Befriedigung zur Kenntnis genommen.<br />
Soziologische Forschung über Bildung, Qualifikation <strong>und</strong> Arbeit hat in<br />
den letzten beiden Jahrzehnten jedoch einer prognostischen Denkweise keinesfalls<br />
ferngestanden. Sei es, daß Trendaussagen, wie etwa die einer „Polarisierung"<br />
der Qualifikationsstruktur , einen Anspruch auf Zukunftsdeu-<br />
2<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
tung zu stellen schienen, sei es, daß die Analyse der Absorption eines unerwarteten<br />
Angebots an Hochschulabsolventen die „potentielle" Entwicklung<br />
des Arbeitsmarktes von Hochschulabsolventen im Zuge der Bildungs<br />
3<br />
expansion zu beschreiben schien. Insofern ist auch in einer solchen Zwischenbilanz<br />
zu diskutieren, was die Erfahrungen in den letzten beiden Jahrzehnten<br />
für die prognostischen Implikationen der soziologischen Forschung<br />
bedeuten.<br />
2. Themen <strong>und</strong> Anlage der Prognosen<br />
Versucht man die „Landschaft" der vorliegenden Prognosen zu beschreiben,<br />
so lassen sich folgende Charakteristika hervorheben:<br />
(a) Wichtigste Themen sind: der Sek<strong>und</strong>arschulbesuch, der Hochschulbesuch,<br />
der Bedarf an hochqualifizierten Arbeitskräften.<br />
Deutlich ist in der Schwerpunktwahl erstens das Interesse des Staates<br />
an der eigenen Ressourcensteuerung; Weiterbildung oder berufliche Bildung<br />
im dualen System, die weniger staatliche Ressourcen binden, waren<br />
kaum Gegenstand von Prognosen; unter den Bedarfsprognosen hatten Lehrerbedarfsprognosen<br />
den höchsten Stellenwert. Zweitens kommt in der<br />
Schwerpunktwahl zum Ausdruck, daß die Planung der Ausbildung für<br />
Hochqualifizierte als ein Bereich der Bildungsplanung verstanden wurde,<br />
bei dem es besonders auf genauere Information <strong>und</strong> treffsichere Entscheidung<br />
ankomme. Variierten die Prognosen über die Zahl der ungelernten<br />
Arbeitskräfte im Jahre 1980, die nur kurzfristig angelegt waren <strong>und</strong> somit<br />
eine hohe Zutreffwahrscheinlichkeit hatten, von 40 bis 17 Prozent , so war<br />
4<br />
dies kaum der Beachtung wert; Differenzen in der Prognose der Zahl der<br />
Lehrer um 10 Prozent sind dagegen schnell Gegenstand erheblicher Kontroversen.<br />
(b) Die meisten vorliegenden Prognosestudien sind Modellrechnungen, die<br />
sich in der Mehrzahl der Parameter auf Trendextrapolationen stützen <strong>und</strong><br />
daneben in einer begrenzten Zahl von Parametern leichte Veränderungen in<br />
Richtung gewünschter Entwicklungen setzen.<br />
Das heißt erstens, die Prognosen suchen in aller Regel nicht Überraschungen,<br />
Sprüngen der Entwicklung auf die Spur zu kommen, wie es etwa manche<br />
Expertenumfragen intendieren. Man kann deshalb von ihnen von vornherein<br />
allenfalls ähnliche Aussagen erwarten wie von Prognosen zur Zeit<br />
der Frühindustrialisierung, die Zahl der Pferde werde mit der weiteren Industrialisierung<br />
zur Sicherung der Transporte zunehmen; unwahrscheinlich<br />
waren Ideen, daß Pferde durch Motorfahrzeuge abgelöst werden könnten.<br />
Zweitens folgt man in der Regel nicht dem berühmten Satz: Was geschieht,<br />
wenn nichts geschieht? Man legt gewöhnlich nicht die Information<br />
für den Fall dar, daß keinerlei Maßnahme erfolgt, sondern hat in der Regel<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
schon ein paar gewünschte Veränderungen eingeschliffen: Die Kultusministerkonferenz<br />
zum Beispiel wies Anfang der achtziger Jahre tabellarisch<br />
gar nicht aus, wie sich die Studentenzahl unter der Annahme entwickeln<br />
würde, daß die Verweildauer in Zukunft nicht sinken werde. 5<br />
(c) Prognosen über die Beziehung von Bildung <strong>und</strong> Arbeit kreisen um den<br />
Arbeitskräftebedarfsansatz (Manpower Requirement Approach) <strong>und</strong> die<br />
Prämisse, daß Bildung ein zu planender Bereich im Rahmen einer kaum geplanten<br />
Gesellschaft ist. 6<br />
Auf der einen Seite gibt es wohl in keinem anderen hochindustrialisierten<br />
Land kapitalistischer Wirtschaftsprägung eine so große Zahl von Arbeitskräftebedarfsprognosen.<br />
Auf der anderen Seite sind Studien auf der<br />
7<br />
Basis des Ertragsratenansatzes nur Glasperlenspiele einiger Bildungsökonomen<br />
geblieben <strong>und</strong> nie in Prognosen eingebracht worden: Offenk<strong>und</strong>ig<br />
8<br />
gibt es in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland keine Ökonomen, die glauben,<br />
daß die quantitative Entwicklung der Studentenzahlen sehr deutlich von<br />
Einkommens<strong>entwicklung</strong>en beeinflußt wird, die ihrerseits abhängig sind<br />
von Über- oder Unterangeboten an Personen mit bestimmten Qualifikationen.<br />
Die Kritik am Arbeitskräftebedarfsansatz hat insgesamt zu dessen<br />
9<br />
Relativierung oder Sophistizierung geführt — in dieser Hinsicht war die<br />
Diskussion in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland abwechslungsreicher <strong>und</strong><br />
phantasievoller als in den meisten anderen Ländern —, nicht jedoch zu einer<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich anderen Wahl von Bedarfsprognosen.<br />
(d) Die meisten Prognosen, die die Schüler- <strong>und</strong> Studentenzahlen vorauszusagen<br />
versuchen, werden von der Bildungsverwaltung selbst erstellt; die<br />
meisten Arbeitskräftebedarfsprognosen sind staatliche Auftragsstudien.<br />
Dabei ist sicherlich zunächst bemerkenswert, daß die in den Meßgrößen<br />
im Prinzip nicht kontroversen Prognosen über Schüler- <strong>und</strong> Studentenzahlen<br />
offenk<strong>und</strong>ig in der Regel vom Staat selbst organisiert werden, während<br />
die Bedarfsprognosen — die immer kontroverse Annahmen über <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Bedürfnisse modellartig zu treffen haben — gerne ausgelagert<br />
werden, <strong>und</strong> zwar typischerweise an Auftragsforschungsinstanzen. Mindestens<br />
ebenso ist zu beachten, daß es keine kontinuierlichen Prognoseanalysen<br />
von Wissenschaftlern gibt, die sich nicht schon von den Bedingungen<br />
der Forschung her die Frage nach den Planungskonsequenzen stellen<br />
müssen.<br />
3. Die Vorhersagekraft der Prognosen<br />
Im Jahre 1980 wurden zwei Texte publiziert, in denen in einem Falle ein<br />
Soziologe <strong>und</strong> im anderen Falle ein Ökonom Prognosedaten retrospektiv<br />
mit der tatsächlichen Entwicklung verglichen:<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
— Hansgert Peisert analysiert in einem Bericht für die Westdeutsche Rektorenkonferenz<br />
„Vorhersagen <strong>und</strong> Wirklichkeit" der Studentenzahlen<br />
insbesondere für den Zeitraum von 1965 bis 1980 <strong>und</strong> diskutiert darüber<br />
hinaus den Stellenwert von Prognosen der Studentenzahlen, die sich auf<br />
die achtziger <strong>und</strong> neunziger Jahre beziehen. 10<br />
— Manfred Tessaring nennt seine Studie „Evaluation" von Prognosen; er<br />
untersucht Prognosen <strong>und</strong> reale Entwicklungen der Zahlen von Studienanfängern,<br />
Studenten, Bildungsabschlüsse der Erwerbstätigen, der Struktur<br />
der Erwerbstätigen sowie des Angebots <strong>und</strong> Bedarfs an Hochschulabsolventen.<br />
11<br />
Peisert betont bei seiner Gegenüberstellung von Prognosen der öffentlichen<br />
Instanzen der Bildungsplanung <strong>und</strong> -Verwaltung (Kultusministerkonferenz,<br />
Wissenschaftsrat, B<strong>und</strong>-Länder-Kommission, Planungsausschuß für den<br />
Hochschulbau) <strong>und</strong> der später eingetretenen Entwicklung die Diskrepanzen<br />
zwischen Vorhersage <strong>und</strong> Realität: „Wie wir wissen, kam alles ganz anders...<br />
Im Rückblick ist nun zu fragen: Welche Parameter haben sich in den letzten<br />
15 Jahren so verändert, daß die hier dargestellte Prognose von 1964 um<br />
100 Prozent danebenging, <strong>und</strong> war dies damals nicht vorauszusehen?" Als<br />
12<br />
Konsequenz dieser Erfahrungen bezeichnet er die prognostizierte „Talfahrt"<br />
der Studentenzahlen in den neunziger Jahren als „nur eine von mehreren<br />
anderen, nicht weniger wahrscheinlichen Alternativen". 13<br />
Peisert hebt hervor, daß man Mitte der sechziger Jahre den Anstieg der<br />
Studentenzahlen vor allem deshalb unterschätzt habe, weil die Abiturientenquote<br />
bis Anfang der siebziger Jahre weitaus stärker als erwartet stieg.<br />
In späteren Prognosen für die siebziger Jahre habe man den Rückgang der<br />
Studierwilligkeit von Studienberechtigten nicht vorhergesehen. — In ähnlicher<br />
Weise habe ich für Prognosen über die Studentenzahlen in den achtziger<br />
Jahren, die Mitte der siebziger Jahre abgegeben wurden, aufgewiesen,<br />
daß man damals mit einer Verkürzung der Studienzeiten — insbesondere<br />
mit einem Ausbau kürzerer Studiengänge — gerechnet hatte, die nicht eingetreten<br />
ist. 14<br />
Als Konsequenz für die Einschätzung der zukünftigen Entwicklung verweist<br />
Peisert ganz auf die Unsicherheit von Prognosen: „Aus heutiger Sicht<br />
gibt es für die Annahme einer ungenügenden Auslastung in den nächsten 40<br />
Jahren keine triftigeren Argumente als für die Annahme einer normalen<br />
Auslastung oder gar wiederholten Überlastung des Hochschulsystems." 15<br />
Er fordert, möglichst viele Parameter zu beachten. Eine gewisse Hoffnung<br />
auf den Stellenwert guter Information wird dennoch beschworen: „Für den<br />
'Konsumenten' stellen sich die verschiedenen Prognosen <strong>und</strong> Modellrechnungen<br />
oftmals widersprüchlich dar. Daher wäre es wünschenswert, wenn<br />
eine Clearingstelle regelmäßig eine Zusammenschau der Annahmen, Verfahren<br />
<strong>und</strong> Ausgangsdaten durchführt <strong>und</strong> die Hochschulen in synoptischer<br />
Form über den jeweils aktuellen Stand von Vorhersagen <strong>und</strong> wirklicher Entwicklung<br />
informiert." 16<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Während Peisert seine Bewertung der Prognosen besonders stark an dem<br />
Kontrast zwischen Wissenschaftsratsprognose von 1964 für das Jahr 1980<br />
<strong>und</strong> der tatsächlichen Entwicklung der Studentenzahlen festmacht, prüft<br />
Tessaring eine sehr große Zahl von Prognosen. Unter anderem gibt er auch<br />
die Schätzungen der Studienanfänger- <strong>und</strong> Studentenzahlen aus Studien an,<br />
die die Relation von Bedarf <strong>und</strong> Angebot an hochqualifizierten Arbeitskräften<br />
zu prognostizieren versuchten.<br />
Tessaring weist sowohl Fälle großer Diskrepanzen von Prognose <strong>und</strong><br />
Realität auf, wobei die Wissenschaftsratsprognose von 1964 über die Studentenzahlen<br />
ebenfalls sein Paradebeispiel ist, als auch Fälle ausgesprochen<br />
hoher Treffsicherheit, etwa bei der Verteilung der Erwerbstätigen nach<br />
Wirtschaftsbereichen oder bei der Hochschulabsolventenquote unter den<br />
Erwerbstätigen. Er kommt zu dem Schluß, daß die Gr<strong>und</strong>prämissen in Studien<br />
zu Angebot <strong>und</strong> Bedarf hochqualifizierter Arbeitskräfte „in ihrer Entwicklungsrichtung<br />
'zutreffend' gesetzt wurden ... Die Feinstrukturen der<br />
Bildungs- <strong>und</strong> Arbeitsmarktstrukturen weisen demgegenüber teilweise hohe<br />
Abweichungen zur Realität auf." Bei vielen Fachrichtungen bzw. Berufsgruppen<br />
beobachtet Tessaring „regelrechte 'Prognosewellen'" : innerhalb<br />
18<br />
17<br />
weniger Jahre wechseln sich Prognosen über Mängel mit solchen über Überschüsse<br />
ab.<br />
Tessarings Schlußfolgerungen sind skeptisch gegenüber Prognosen, betonen<br />
jedoch einen gewissen Informationswert für <strong>gesellschaftliche</strong> <strong>und</strong> individuelle<br />
Entscheidungen. Er schreibt: „Als Resümee des Prognosevergleichs<br />
mit der realen Entwicklung des Bildungswesens <strong>und</strong> der Beschäftigung<br />
hochqualifizierter Arbeitskräfte bleibt festzuhalten, daß Prognosen allenfalls<br />
eine Basis für bildungspolitische Gr<strong>und</strong>überlegungen zu den möglichen<br />
Auswirkungen veränderter/zu verändernder Parameter <strong>und</strong> der sich daraus<br />
ergebenden politischen Handlungsalternativen darstellen. Als alleinige<br />
Gr<strong>und</strong>lage individueller Bildungs- <strong>und</strong> Berufswahlentscheidungen erscheinen<br />
sie jedoch nach wie vor wenig geeignet. Sie können sogar das Risiko einer<br />
Fehlentscheidung erhöhen, z.B. dann, wenn zu viele Individuen gleichgerichtete<br />
Entscheidungen zum gleichen Zeitpunkt treffen." 19<br />
Diese beiden Beispiele zeigen ebenso wie eine Fülle von Publikationen,<br />
die sich mit den Ergebnissen von Prognosen zum Bildungssystem beziehungsweise<br />
zum Verhältnis von Bildungs- <strong>und</strong> Beschäftigungssystem beschäftigen,<br />
kein einheitliches Bild. Es gibt Fälle, in denen Prognose <strong>und</strong> reale Entwicklung<br />
sehr weit auseinanderfallen; es gibt Fälle von Prognosen, die sich — retrospektiv<br />
gesehen — als sehr zutreffend erwiesen haben. Vor allem zeigt<br />
sich jedoch, daß in den Vergleich von Prognose <strong>und</strong> tatsächlicher Realität<br />
bei den jeweiligen Autoren sehr unterschiedliche Erwartungen eingehen.<br />
Das gilt zum einen für den Grad der Übereinstimmung von Prognose <strong>und</strong><br />
realer Entwicklung: was manche als große Abweichung ansehen, kann anderen<br />
als erstaunliche Übereinstimmung erscheinen. Hier wiederholen sich<br />
ähnliche Interpretationsdivergenzen wie in der Diskussion, ob die Reduzierung<br />
ungleicher Bildungschancen in den letzten Jahren „beachtlich groß"<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
oder „sehr gering war" — eine Diskussion, die im Gr<strong>und</strong>e um die Frage<br />
kreist: How much is much? Zum anderen fällt das Urteil unterschiedlich je<br />
nach der Erwartung aus, ob man als „Erfolg" einer Prognose in erster Linie<br />
die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens oder die Information von Planenden<br />
<strong>und</strong> Betroffenen <strong>und</strong> deren Beitrag zur „Zerstörung der Prophetie" sieht.<br />
4. Möglichkeiten <strong>und</strong> Grenzen der methodischen Verbesserungen von<br />
Prognosen<br />
In den letzten beiden Jahrzehnten gab es sehr eingehende Diskussionen darüber,<br />
welche methodischen Verbesserungen von Prognosestudien wünschenswert<br />
<strong>und</strong> erreichbar seien.<br />
Die ersten Prognosen über Studentenzahlen stellten kaum mehr als<br />
Hochrechnungen auf der Basis von veränderten Quoten des Übergangs von<br />
Gr<strong>und</strong>schülern auf das Gymnasium dar. Inzwischen gehören demographische<br />
Veränderungen von Jahrgangsstärken, Übergänge während des Sek<strong>und</strong>arschulbesuchs,<br />
Studierwilligkeit, Übergangsquoten von der Schule zur<br />
Hochschule, Zwischenzeiten zwischen Schulabschluß <strong>und</strong> Studienbeginn,<br />
Studienfachwechsel, durchschnittliche Studiendauer <strong>und</strong> ähnliche Werte<br />
zum Repertoire solcher Prognosen.<br />
Bei den Studien zum Bedarf an Hochschulabsolventen konstatierte Laszlo<br />
Alex Mitte der siebziger Jahre drei Entwicklungsstufen: Relativ kruden<br />
Schätzungen zu Beginn der sechziger Jahre folgten Ende der sechziger Jahre<br />
Untersuchungen, die den Arbeitskräftebedarfsansatz (MRA) als Gr<strong>und</strong>lage<br />
wählten. Im Laufe der siebziger Jahre schließlich wurde das Gr<strong>und</strong>modell<br />
des MRA erheblich differenziert: unter anderem wurden verschiedene<br />
Modellannahmen über wirtschaftliche <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklungen<br />
vorgenommen <strong>und</strong> deren Folgen für den Bedarf an hochqualifizierten Arbeitskräften<br />
berechnet; die Substitutionsmöglichkeiten von Arbeitskräften<br />
wurden systematisch zu berücksichtigen versucht; schließlich konnte mit<br />
Hilfe von Befragungen dazu beigetragen werden, daß der Status quo-ante<br />
nicht automatisch als Normalzustand im Verhältnis von Bildungs- <strong>und</strong> Beschäftigungssystem<br />
angesehen wurde. 20<br />
Als wichtige Richtungen solcher Verbesserungen sind zu nennen:<br />
(a) Datenbasis <strong>und</strong> berücksichtigte Parameter: Erst seit Mitte der siebziger<br />
Jahre haben, um das bekannteste Beispiel der letzten Jahre zu zitieren, demographische<br />
Schwankungen einen systematischen Stellenwert in den Bildungs-<br />
<strong>und</strong> Arbeitskräftebedarfsprognosen der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland.<br />
(b) Transparenz der Modelle <strong>und</strong> Berechnungen: Viele Prognosen gleichen<br />
Verwirrspielen; eine Fülle von Modell-Annahmen geht in die Berechnungen<br />
ein, die dem Leser nicht deutlich gemacht werden. Da Prognosen in ihrer<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Qualität im Gr<strong>und</strong>e von der Setzung plausibler Modell-Annahmen leben<br />
<strong>und</strong> nicht unbedingt von der in Zukunft garantierten Wirkung der angenommenen<br />
Parameter, ist die wichtigere Informationsleistung von Prognosen<br />
nicht die abschließend gegebene Zahl der erwarteten Studenten oder Absolventen,<br />
sondern der Einfluß der Veränderungen eines Parameters auf<br />
eine solche Gesamtzahl. Daher sind Alternativrechnungen mit unterschiedlichen<br />
Modellannahmen, die das Gewicht bestimmter Annahmen für die Gesamtzahl<br />
verdeutlichen, ein Fortschritt der Prognostik. 21<br />
(c) Relativierung der Prämissen, die in eine Prognose eingehen: Im Laufe<br />
der kritischen Auseinandersetzungen mit dem Arbeitskräftebedarfsansatz<br />
wurde z.B. deutlich, daß — wie Jeschek auflistet — folgende gesellschaftspolitische<br />
Voraussetzungen zutreffen müßten, wenn die MRA-Prognosen<br />
die spätere Entwicklung voraussagen könnten:<br />
„(1) Das Beschäftigungssystem muß äußerst unflexible Strukturen aufweisen<br />
<strong>und</strong> so beschaffen sein, daß es den heutigen <strong>und</strong> den zukünftigen Bedarf<br />
an den einzelnen Kategorien von Ausgebildeten erkennen läßt.<br />
(2) Der Bedarf an Ausbildung beziehungsweise Bildung orientiert sich nahezu<br />
ausschließlich an einer ökonomischen oder von spezifischen Dichteziffern<br />
bestimmten Verwertbarkeit, die darüber hinausreichenden Qualifikationselemente<br />
werden nicht berücksichtigt.<br />
(3) Der Bedarf entwickelt sich kontinuierlich <strong>und</strong> ... unbeeinflußt von politischen<br />
Entscheidungen ...<br />
(4) Keinen wesentlichen Einfluß auf den Bedarf haben Veränderungen der<br />
Arbeitsorganisation, der Konsumentennachfragen <strong>und</strong> der Technologien,<br />
die von den heutigen Bedingungen oder aus ihnen resultierenden Entwicklungspfaden<br />
abweichen.<br />
(5) Zwischen den einzelnen Ausbildungsrichtungen <strong>und</strong> Ausbildungsniveaus<br />
finden immer die gleichen <strong>und</strong> in den Basisjahren der Projektionen nicht explizit<br />
erfaßten Mobilitätsprozesse statt.<br />
(6) Der einzelne Staatsbürger existiert nach diesen Ansätzen reduziert nur<br />
als Arbeitskraft, die nur das Ziel verfolgt, langfristig eine im Ableitungszusammenhang<br />
definierte Beschäftigung zu erhalten.<br />
(7) Die Entwicklung des Angebots an ausgebildeten Arbeitskräften verläuft<br />
unabhängig von den Bedarfsvorstellungen. Projektionen des Bedarfs haben<br />
keinen Einfluß auf die Angebotsseite." 22<br />
Mertens meint zu dem „Verfahren der Strukturextrapolation", das bei dem<br />
Arbeitskräftebedarfsansatz — aber auch, das sei hier hinzugefügt, bei den<br />
Prognosen der Schüler- <strong>und</strong> Studentenzahlen — üblich ist: „Was diese unrettbar<br />
auszeichnet, ist eine Art strukturelles Stabilitätsvertrauen (oder sogar<br />
eine Verfestigungsnorm), die man 'Strukturfatalismus' nennen möchte." 23<br />
Allerdings haben Erfahrungen auch gezeigt, daß man nur begrenzte<br />
Hoffnungen in methodische Verbesserungen setzen kann:<br />
— Viele Hoffnungen auf eine Verbesserung der Datenbasis sind verflogen:<br />
Genaue Bestandsaufnahmen der Bildungspfade, wie sie die Arbeitsgruppe<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
für Empirische Bildungsforschung in den sechziger Jahren entwickeln sollte<br />
<strong>und</strong> wie sie mit der Hochschulverlaufsstatistik beabsichtigt waren, wurden<br />
nicht realisiert. Es ist sogar fraglich geworden, ob man in Zukunft die üblichen<br />
Daten der Volkszählung in gleicher Qualität wie in der Vergangenheit<br />
haben wird.<br />
— Eine differenzierte Nutzung von Parametern führt nicht notwendigerweise<br />
zur Erhöhung der prognostischen Validität. So schreibt Tessaring: „Bemerkenswert<br />
an der Lehrerprognostik ist — alles in allem —, daß augenscheinlich<br />
die Eintreffenswahrscheinlichkeit der Prognosen mit der Verfeinerung<br />
der Berechnungsmethoden nicht wesentlich verbessert wird. 'Ältere'<br />
Prognosen, die auf der Bedarfsseite hauptsächlich mit Schüler-Lehrer-<br />
Relationen operieren, kommen in der Größenordnung nicht zu wesentlich<br />
realitätsferneren Ergebnissen als die 'neueren' Prognosen, die darüber hinaus<br />
auch die Klassenstärken, Fächerverteilungen, Wochenst<strong>und</strong>en u.a. einbeziehen."<br />
24<br />
— Je differenzierter Prognosen werden, desto weniger eignen sie sich zur<br />
Begründung politischer Entscheidungen. 25 Auf der einen Seite ist es gerade<br />
bei komplexen Modellen sehr schwer zu durchschauen, welche Entscheidungen<br />
bereits in die Modelle eingehen. Auf der anderen Seite löst<br />
sich bei Prognosen mit Alternativ-Rechnungen in vielen Fällen der prognostische<br />
Charakter angesichts der riesigen Spannweiten praktisch auf:<br />
So kam Kaiser Mitte der siebziger Jahre bei der Berechnung von Substitutionskorridoren<br />
zu dem Schluß, daß der Maximalbedarf an Juristen<br />
3,7 mal so hoch sei wie der Minimalbedarf. 26 Einer 1978 publizierten<br />
Studie zum Akademikerbedarf in Baden-Württe<strong>mb</strong>erg zufolge, wird —<br />
je nach gewählter Modellvariante — das Angebot an Hochschulabsolventen<br />
den Bedarf zwischen 108 Prozent <strong>und</strong> 363 Prozent innerhalb von<br />
15 Jahren abdecken. 27<br />
— Viele zunächst als Fortschritte der Bedarfsprognostik gefeierte neue Vorgehensweisen<br />
erweisen sich bei näherem Hinsehen nicht viel weniger kritikanfällig<br />
als einfachere Verfahren. So wird bei der Aufnahme von Substitutionskorridoren,<br />
wie es das Institut für Arbeitsmarkt- <strong>und</strong> Berufsforschung<br />
betreibt, die Substitution der Vergangenheit in ähnlicher Weise zur Norm<br />
für die Zukunft erhoben, wie dies nach der Kritik des „Strukturfatalismus"<br />
die typische Schwäche des klassischen MRA ist. Auch ist die Ergänzung von<br />
Prognosestudien mit Hilfe von Betriebsumfragen über den Qualifikationsbedarf<br />
problematisch, weil die Befragten mit der Einschätzung des Qualifikationsbedarfs<br />
in der Regel überfordert sind.<br />
— Die Ansätze zur Überwindung der methodischen Schwächen der traditionellen<br />
Prognosen gehen fließend in gr<strong>und</strong>legende Kritik der Prognose-Konzepte<br />
über. Der sogenannte „Integrationsansatz" zum Beispiel, den Riese<br />
<strong>und</strong> Mitarbeiter 28 Anfang der siebziger Jahre wählten, stellt im Gr<strong>und</strong>e das<br />
Konzept des „Bedarfs" an Bildung auf den Kopf, indem er nach Ausdeh-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
nungspotentialen des beruflichen Einsatzes von Hochschulabsolventen in<br />
bisher a-typischen Bereichen sucht. Der Absorptionsansatz stellt die Bedarfsannahmen<br />
des MRA gr<strong>und</strong>sätzlich in Frage. 29<br />
Diese Hinweise sollen nicht generell den Wert methodischer Verbesserungen<br />
von Prognosen in Frage stellen. Das Drängen auf methodische Verbesserungen<br />
hat zu einer Reduzierung gewisser Schwächen beigetragen.<br />
30<br />
Grenzen der prognostischen Validität <strong>und</strong> Probleme in der Beziehung von<br />
Prognose <strong>und</strong> Politik allerdings werden dadurch nur bedingt aufgehoben.<br />
5. Prognostische Implikationen soziologischer Studien<br />
Soziologen haben bei der Bedarfsprognostik im engeren Sinne in der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland keine Rolle gespielt. Bedarfsprognosen gelten als<br />
ein bildungsökonomisches Instrumentarium <strong>und</strong> werden in entsprechenden<br />
Lehrbüchern vermittelt. Auch die großen Visionen über die Bildungsexpansion<br />
<strong>und</strong> deren Bedeutung für das Beschäftigungssystem waren nicht das<br />
31<br />
Werk von Soziologen: Dahrendorf, dessen Schrift „Bildung ist Bürgerrecht"<br />
als eine der großen Prophetien der Bildungsexpansion gilt, lehnte es ausdrücklich<br />
ab, die politische Forderung der Expansion mit dem Verweis auf<br />
den Qualifikationsbedarf zu begründen, da die Bürgerrechtsforderung auch<br />
für den Fall bestehen bleibe, daß ein Uberschuß an Hochschulabsolventen<br />
auf dem Arbeitsmarkt bestehe. 32<br />
Dennoch gibt es einige soziologische Studien, die für prognostische<br />
Überlegungen eine erhebliche Rolle gespielt haben. Dabei kann hier nicht<br />
im einzelnen geprüft werden, in welchem Maße die Autoren dieser Studien<br />
selbst prognostische Deutungen vornahmen bzw. die prognostischen Implikationen<br />
in Schriften anderer Autoren herausgearbeitet wurden.<br />
Als wichtigste soziologische Deutung langfristiger Entwicklungen der<br />
Qualifikationsstruktur ist zum einen die „Polarisierungs"-These zu nennen.<br />
Industriesoziologen des Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituts in<br />
Göttingen hoben hervor, daß einerseits Berufe mit höheren Qualifikationsanforderungen<br />
<strong>und</strong> andererseits An- <strong>und</strong> Ungelernten-Positionen zunähmen<br />
<strong>und</strong> dabei mittlere Qualifikationen an Bedeutung verlören. Darauf baute<br />
vielfach die Kritik auf, expansionsorientierte Bildungspolitik sei illusionär. 33<br />
Zum anderen ist der „Absorptions"-Ansatz der Manpower-Gruppe des<br />
Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung als vieldiskutierte soziologische<br />
Trenddeutung zu nennen. Ausgehend von der Analyse, daß Hochschulabsolventen,<br />
für die es nach den klassischen Prämissen des MRA keinen Bedarf<br />
gab, vom Beschäftigungssystem aufgenommen würden <strong>und</strong> vielfach<br />
ausbildungsnahe Beschäftigung gef<strong>und</strong>en haben, wurde angenommen, daß<br />
Hochschulabsolventen ihre Qualifikationen im Beschäftigungssystem in<br />
weitaus stärkerem Maße zur Geltung bringen könnten, als vorherrschende<br />
Bedarfsdeutungen um 1970 glauben machen. Dies wurde in vielen pro-<br />
34<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
gnostischen Diskussionen dahingehend ausgedeutet, daß der größte Teil der<br />
wachsenden Zahl von Hochschulabsolventen eine mehr oder weniger „adäquate"<br />
Beschäftigung finden werde.<br />
Diese soziologischen Tendenzaussagen ex post facto mit den tatsächlichen<br />
Entwicklungen zu konfrontieren, fällt methodisch schwerer als bei<br />
den Bedarfsprognosen im engeren Sinne, weil erstere ja keine präzisen Zahlen<br />
angaben <strong>und</strong> auch nicht prognostisch sein wollten. Die „Polarisierungs"-<br />
These scheint in der ursprünglichen Form nicht mehr aufrechterhaltbar; viele<br />
ihrer Anhänger sehen sich jedoch in ihrer Vermutung nicht widerlegt, daß<br />
es keinen eindeutigen Höherqualifizierungsbedarf gäbe. Die Absorption der<br />
Hochschulabsolventen erfolgt unter den heutigen Bedingungen bei weitem<br />
nicht durgängig <strong>und</strong> problemlos, ist jedoch weitaus weniger problematisch,<br />
als nach den Bedarfsprognosen zu erwarten gewesen wäre, mit denen sich<br />
der Ansatz um 1970 auseinandergesetzt hatte.<br />
6. Prognosen <strong>und</strong> politische Folgerungen<br />
Betrachtet man die Beziehung von Prognosen <strong>und</strong> Bildungspolitik, so muß<br />
man zunächst einmal feststellen, daß von Fehlprognosen alle verschiedenen<br />
bildungspolitischen Positionen betroffen wurden. Natürlich ist es Teil bildungspolitischer<br />
Polemik, der anderen Seite einzelne Fehlprognosen vorzuhalten:<br />
Gegner einer starken Expansion weiterführender Bildung verweisen<br />
gerne auf Überschätzungen des Qualifikationsbedarfs bei Picht oder auf<br />
Überschätzungen des Lehrbedarfes in den Prognosen um 1970. Befürworter<br />
einer Expansion der weiterführenden Bildung heben demgegenüber hervor,<br />
daß sich der Arbeitsmarkt für Hochschulabsolventen im Laufe der<br />
siebziger Jahre keineswegs so katastrophal entwickelte, wie dies Anfang der<br />
siebziger Jahre im Argument des „Akademischen Proletariats" <strong>und</strong> Mitte<br />
der siebziger Jahre in den Veröffentlichungen der Finanzministerkonferenz<br />
<strong>und</strong> der B<strong>und</strong>esvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände prognostiziert<br />
worden war. „Verlierer" der Erfahrungen mit Prognosen sind<br />
<strong>35</strong><br />
vielmehr quer durch die verschiedenen bildungspolitischen Positionen diejenigen<br />
Argumentationen, die sich auf eine mehr oder minder eindeutige<br />
Unabweisbarkeit bestimmter Trends oder bestimmten Bedarfs zu stützen<br />
suchten.<br />
Eine Gr<strong>und</strong>frage des Verhältnisses von Prognose <strong>und</strong> Politik ist, welche<br />
Leistung die Prognose für politische Entscheidungen erbringen soll: Den<br />
Nachweis des Unvermeidlichen? Die Begründung der politischen Handlung<br />
als sachnotwendig? Die Herausforderung zu einer informierten Entscheidung,<br />
die sich auch gezielt gegen den vorherrschenden Trend stellen mag?<br />
Je nach der Erwartung kann auch die Bewertung von Prognosen sehr unterschiedlich<br />
ausfallen: Nach manchen politischen Erwartungen wird eine<br />
Prognose gerade dann positiv bewertet, wenn sie das tatsächlich Eintref-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
fende gut voraussagt; nach anderen Erwartungen hat die Prognose dann<br />
ihren Dienst getan, wenn sie zu der informierten Entscheidung verhalf, die<br />
zu erwartenden Trends zu verhindern.<br />
Tatsächlich scheinen der Fall einer eindeutigen Trendgläubigkeit ebenso<br />
wie der Fall einer eindeutigen Interventionsbereitschaft gegenüber dem<br />
Trend jedoch Ausnahmen zu sein. Vielmehr gehen gewöhnlich politische<br />
Präferenzen so stark in Modellannahmen ein, daß sie den Handelnden auf<br />
der Ebene der Prognoseergebnisse gar nicht mehr in vollem Maße vor die<br />
Alternative stellen, ob er sich herrschenden Trends anschließen oder ihnen<br />
entgegentreten will. Von daher ist die Kritik verständlich, daß die Prognosen<br />
selbst zu Wellenbewegungen im Bildungsverhalten <strong>und</strong> in der Relation<br />
von Angebot <strong>und</strong> Nachfrage beitragen.<br />
Das bedeutet jedoch keinesfalls, daß sich Prognosen durchgängig als<br />
nachgeordnete Zahlenspielereien von vorgegebenen Annahmen <strong>und</strong> Wünschen<br />
zur zukünftigen Entwicklung verweisen. Es gibt vielmehr eine Fülle<br />
von Fällen, in denen Ergebnisse von Prognosen Anstöße zum Umdenken<br />
gaben <strong>und</strong> überraschende Entwicklungen auslösten.<br />
Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für den politischen Einfluß von<br />
Prognosen stellte die Entdeckung demographischer Wellen im Rahmen der<br />
Bildungs- <strong>und</strong> Arbeitsmarktprognosen Mitte der siebziger Jahre dar: Die<br />
These, daß die Zahl der Ausbildungsplätze aus demographischen Gründen<br />
von Mitte der siebziger Jahre bis Mitte der achtziger Jahre um etwa 40 Prozent<br />
steigen müßte , war ein entscheidendes Argument zugunsten der<br />
36<br />
„Öffnung der Hochschulen" <strong>und</strong> der „Öffnung" weiterer Bildungsbereiche.<br />
Zugleich ging das Argument der demographischen Welle in die Prognose<br />
des Wissenschaftsrats ein, daß Ende der achtziger Jahre die Zahl der<br />
37<br />
Studierenden rapide zu sinken beginnen werde <strong>und</strong> daß sich zur Vermeidung<br />
einer langfristig unbrauchbaren Ressourcenbindung eine „Untertunnelung"<br />
des Studentenberges durch eine temporäre starke Auslastung der<br />
Hochschulen anbiete. Dies hatte tatsächlich zur Folge, daß die Hochschulen<br />
die Öffnungspolitik <strong>und</strong> in der Zeit von 1977 bis 1982 eine etwa<br />
38<br />
25prozentige „kostenneutrale" Steigerung der Studentenzahlen akzeptierten.<br />
Dabei war es angesichts der Dramatik dieser neuen Einsicht — in<br />
39<br />
diesem Falle in die demographischen Schwankungen — möglich, daß bestimmte<br />
fragwürdige Annahmen der Prognosen „geschluckt" wurden. Es<br />
war durchaus vorstellbar <strong>und</strong> so wurde zuweilen auch Mitte der siebziger<br />
Jahre argumentiert, daß die Studentenzahlen nach 1985 keineswegs stark<br />
zurückgehen würden. Inzwischen ist sichtbar, daß man heute nur dann einen<br />
Uberhang von Hochschulkapazitäten für die späten neunziger Jahre<br />
prognostizieren kann, wenn man zwischenzeitige Umdefinitionen in der<br />
Kapazität der Hochschulen akzeptiert. 40<br />
Schließlich haben die bestehenden Schwächen von Prognosen die Instanzen<br />
der Bildungsplanung <strong>und</strong> -Verwaltung nicht entmutigt, laufende<br />
Entscheidungen mit Hilfe von Prognosen zu planen. Sei es, daß man den<br />
Prognosen einen gewissen Vorhersagewert zuspricht, oder sei es lediglich,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
daß man in den Prognosen die beste Voraussetzung sieht, um politische<br />
Kompromisse zur quantitativen <strong>und</strong> strukturellen Gestaltung des Bildungswesens<br />
auszuhandeln.<br />
Als politische Bewertung der Prognosen äußerte 1980 der B<strong>und</strong>esminister<br />
für Bildung <strong>und</strong> Wissenschaft: „Eine verläßliche, mittel- oder gar<br />
langfristige Vorausschau auf den künftigen Arbeitskräfte- <strong>und</strong> Qualifikationsbedarf<br />
gibt es nicht <strong>und</strong> wird es nach dem heutigen Stand der wissenschaftlichen<br />
Erkenntnisse auch nicht geben können. Bedarfsprognosen können<br />
nur Modellrechnungen — Projektionen — sein, die die Abhängigkeit<br />
künftiger Entwicklungen von ausgewählten, zum Teil willkürlich gesetzten<br />
Annahmen deutlich machen. Ihre zahlenmäßigen Ergebnisse dürfen nur mit<br />
diesem Vorbehalt verwertet werden: die 'Richtigkeit' dieser Ergebnisse ist<br />
daher auch kein unbedingtes Gütekriterium einer Prognose. Der Wert liegt<br />
vielmehr darin, daß sie mit dem Aufzeigen von Tendenzen <strong>und</strong> Abhängigkeiten<br />
Hinweise auf politische Gestaltungsmöglichkeit <strong>und</strong> einen eventuellen<br />
Handlungsbedarf geben ...". 41 Tatsächlich haben die Prognosen für Bildungsplaner<br />
einen höheren Stellenwert: Man hofft auf die Treffsicherheit<br />
der zugr<strong>und</strong>eliegenden Annahmen.<br />
7. Fazit<br />
Wir werden weiter mit ihnen leben müssen — den Prognosen über die Entwicklung<br />
des Bildungssystems <strong>und</strong> der Beziehung von Bildungs- <strong>und</strong> Beschäftigungssystem<br />
:<br />
— diesen Projektionen, die oft Annahmen über Trends als mehr oder weniger<br />
unabwendbare Ereignisse suggerieren,<br />
— diesen Zwittern von Projektionen <strong>und</strong> Wunschaussagen, die man nur bei<br />
der Liebe zur Lektüre des „Kleingedruckten" versteht,<br />
— diesen Planspielen, die unterschwellig das hohe Lied der Bedeutung von<br />
quantitativen <strong>und</strong> strukturellen Parametern für die Gestaltung des Bildungssystems<br />
singen,<br />
— diesen Modellen, bei denen Sophistizierung immer mit Verlust der handlichen<br />
Verwertung bedroht ist,<br />
— dieser Spielwiese für politisch eindrucksvolle Rechentricks: Man kann<br />
zum Beispiel den Hochschulen vorrechnen, daß sie Ende der 80er Jahren<br />
höchstens mit 140 Prozent Belastung ihrer Kapazität zu rechnen<br />
haben, obwohl man bei den Kapazitätsmaßstäben zur Zeit der Entscheidung<br />
für die Politik der Öffnung der Hochschulen <strong>und</strong> bei einer Trendextrapolation<br />
auf etwa 200 Prozent käme. 42<br />
Die wissenschaftliche Sozialisation, die Freude an Modellrechnungen der<br />
Prognoseforschung verleiht, ist für Soziologen in der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland nicht üblich: Die Suche nach einem empirisch nicht unplau-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
siblen <strong>und</strong> in den Paradigmen der eigenen Disziplin naheliegenden Satz konsistenter<br />
Modellannahmen, die dann in eine handliche Modellrechnung<br />
überführt werden; der wissenschaftliche Trost, daß eine solche Modellrechnung<br />
im Prinzip immer richtig ist, wenn sie die Modellannahmen richtig<br />
umsetzt, verb<strong>und</strong>en mit der Hoffnung, daß die Realität nicht zu große<br />
Sprünge macht, oder auch mit der gesellschaftspolitischen „Missionstätigkeit",<br />
die Realität den Modellannahmen ein wenig näherzubringen. Aus<br />
einer Distanz zu solchen Denkweisen erwächst schnell der Vorwurf, die<br />
Prognosen seien theoretisch naiv <strong>und</strong> praktisch manipulativ.<br />
Man wird dabei der praktischen Handlungssituation der Bildungsplanung<br />
nicht gerecht: Hier muß eine Lösung angesichts unvermeidlicher<br />
Unsicherheit gef<strong>und</strong>en werden, <strong>und</strong> jede Einsicht, die Handlungserfolg<br />
über die reine Zufallswahrscheinlichkeit hinaustreibt, ist ein Schritt in<br />
Richtung einer sinnvollen Lösung. Obendrein ist im Falle eines nachträglich<br />
sichtbaren Nicht-Zutreffens der Prognosen auch deutlich, daß das Mögliche<br />
getan worden war. Schließlich erlauben die üblichen Planungsmodelle<br />
Abschätzungen, in welchem Umfange jeweils Annahmen zu den einzelnen<br />
Parametern das Ergebnis beeinflussen; sie führen dem Planer plastisch die<br />
Folgerungen von Annahmen <strong>und</strong> Entscheidungen vor Augen.<br />
Vielleicht kann man bei genauer Betrachtung der Argumentationslogik<br />
von Bildungssoziologen erkennen, daß zwischen ihnen einerseits <strong>und</strong> den<br />
Ökonomen <strong>und</strong> Bildungsplanern andererseits nicht solche Distanzen liegen,<br />
wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Thesen, daß die Öffnung des<br />
Hochschulzugangs zur Veränderung der sozialen Herkunft von Studierenden<br />
führe oder umgekehrt die Umstellung des BAFöG auf ein reines Darlehnssystem<br />
zur sozialen Selektivität, unterscheiden sich nicht so sehr von<br />
der Logik <strong>und</strong> den Problemen der prognostischen Forschung.<br />
Die Möglichkeiten <strong>und</strong> Chancen der Bildungs<strong>soziologie</strong> im Kontext der<br />
Prognosen zu Bildung <strong>und</strong> zum Verhältnis von Bildung <strong>und</strong> Arbeit liegen<br />
meines Erachtens jedoch an einer anderen Stelle: In der wissenschaftlichen<br />
Klärung von Phänomenen, bei denen die Prognosen oft unreflektiert eine<br />
Fortschreibung des Status quo unterstellen <strong>und</strong> dann nicht selten von Veränderungen<br />
überrascht werden, <strong>und</strong> ebenso bei der Klärung von Phänomenen,<br />
bei denen in gemischten Projektions- <strong>und</strong> Planungsmodellen Veränderungen<br />
angenommen <strong>und</strong> betrieben werden, die sich dann nicht durchsetzen:<br />
Dazu gehören Analysen über Entwicklungstendenzen im Bildungs<strong>und</strong><br />
Berufswahlverhalten <strong>und</strong> deren Gründe, über den Strukturwandel des<br />
Bildungssystems bzw. Widerstände gegen Strukturveränderungen <strong>und</strong> deren<br />
Ursachen, Veränderungen der Arbeitsorganisation <strong>und</strong> deren Folgen<br />
für den Qualifikationsbedarf, Wirkungen von Diskrepanzen zwischen angenommenem<br />
Bedarf <strong>und</strong> vorliegendem Angebot <strong>und</strong> deren langfristige<br />
Strukturfolgen sowie über Auswirkungen erworbener Qualifikation auf Berufsweg<br />
<strong>und</strong> Arbeitshandeln. Solche Analysen versprechen nicht die Handlichkeit<br />
von Prognoserechnungen, sind aber für die Prognosestudien als Korrektiv<br />
unentbehrlich, um ein Überhandnehmen „strukturfatalistischer" An-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
nahmen zu vermeiden <strong>und</strong> damit wirkliche Chancen zur Prognose der Zukunft<br />
oder zur Intervention gegenüber der befürchteten Zukunft zu bieten.<br />
Daneben sollten Bildungssoziologen einen Weg finden, sich mit der<br />
Prognostik <strong>und</strong> der darauf bezogenen Bildungsplanung kontinuierlich auseinanderzusetzen.<br />
Nur die kontinuierliche Sek<strong>und</strong>äranalyse kann einerseits<br />
die Bildungs<strong>soziologie</strong> dauerhaft für Fragen sensibilisieren, in denen sie<br />
durch Forschungsprojekte der oben genannten Art Erklärungen über <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Wandlungstendenzen geben kann, die in der Prognoseforschung<br />
gewöhnlich übersehen werden.<br />
ANMERKUNGEN<br />
1 Arbeitsgruppen des Instituts für Arbeitsmarkt- <strong>und</strong> Berufsforschung <strong>und</strong> des Max-<br />
Planck-Instituts für Bildungsforschung (Hrsg.): Bedarfsprognostische Forschung in<br />
der Diskussion 1976.<br />
2 H. Kern <strong>und</strong> M. Schumann: Technik <strong>und</strong> Industriearbeit. Frankfurt 1970.<br />
3 D. Hartung, R. Nuthmann <strong>und</strong> W.D. Winterhager: Politologen im Beruf. Stuttgart<br />
1971.<br />
4 M. Tessaring: „Evaluation von Bildungs- <strong>und</strong> Qualifikationsprognosen, insbesondere<br />
für hochqualifizierte Arbeitskräfte". In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- <strong>und</strong> Berufsforschung,<br />
13. Jg. (1980), H. 2, S. 384.<br />
5 Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland: Entwurf: Prognose der Studienanfänger, Studenten <strong>und</strong><br />
Hochschulabsolventen bis 1995. Bonn 1982, vervielf. Manuskript.<br />
6 K. Hüfner: „Higher Educatiqn in the Federal Republic of Germany: a Planned or<br />
Market System? Or a Third Way?" In: R. Avakov u.a. (Eds.): Higher Education and<br />
Employment in the USSR and the Federal Republic of Germany. Paris: Unesco, IIEP<br />
1984, S.185 ff.<br />
7 Vgl. U. Teichler <strong>und</strong> B.C. Sanyal: „Higher Education and Employment in the<br />
Federal Republic of Germany". In: R. Avakov u.a., [Anm. 6], S. 133-1<strong>35</strong>.<br />
8 Siehe K. Hüfner (Hrsg.): Bildungsinvestitionen <strong>und</strong> Wirtschaftswachstum. Stuttgart<br />
1970.<br />
9 Siehe W. Clement: Educational and Labour Market Forecasting Activities in the<br />
Federal Republic of Germany and Austria. Paris: Unesco/IIEP 1982, vervielf. Manuskript.<br />
10 H. Peisert: „Hochschul<strong>entwicklung</strong> seit 1960 <strong>und</strong> Auswirkungen in die 90er Jahre.<br />
Vorhersagen <strong>und</strong> Wirklichkeit." In: Westdeutsche Rektorenkonferenz: Die Hochschulen<br />
in den 90er Jahren. Bonn 1980, S. 49-72.<br />
11 M. Tessaring, [Anm. 4], S. 374-397.<br />
12 Peisert, [Anm. 10], S. 53.<br />
13 [Anm. 10], S. 61.<br />
14 U. Teichler: „Öffnung der Hochschulen" — auch eine Politik für die 80er Jahre?<br />
Bremen: Senator für Wissenschaft <strong>und</strong> Kunst 1983, S. 39-52.<br />
15 Peisert, [Anm. 10], S. 65.<br />
16 Ebenda, S. 64.<br />
17 Tessaring, [Anm. 4], S. 396.<br />
18 Ebenda.<br />
19 Ebenda, S. 397.<br />
20 L. Alex: „Absolventenangebot <strong>und</strong> berufliche Flexibilität." In: U. Lohmar <strong>und</strong><br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
G.E. Ortner (Hrsg.): Die deutsche Hochschule zwischen Numerus clausus <strong>und</strong> Akademikerarbeitslosigkeit.<br />
Hannover 1975, S. 92-105.<br />
21 Vgl. D. Mertens: „Zur Diskussion über das Verhältnis von Bildungs-<strong>und</strong> Beschäftigungssystem:<br />
Entwurf für einen Satz Spielregeln". In: Stifterverband für die deutsche<br />
Wissenschaft (Hrsg.): Bildungsexpansion <strong>und</strong> Beschäftigungsstruktur am Beispiel<br />
des Abiturientenproblems. Essen-Bredeney 1976, S. 9-30.<br />
22 W. Jeschek: „Möglichkeiten <strong>und</strong> Grenzen der Verbesserung bisheriger Prognoseansätze".<br />
In: Arbeitsgruppen des Instituts für Arbeitsmarkt- <strong>und</strong> Berufsforschung <strong>und</strong><br />
des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung (Hrsg.): Bedarfsprognostische Forschungin<br />
der Diskussion. Frankfurt 1976, S. 128.<br />
23 D. Mertens: „Retrospektive <strong>und</strong> prospektive Beschäftigungsorientierung in der<br />
Bildungsplanung". In: Arbeitsgruppen [Anm. 22], S. 241.<br />
24 Tessaring, [Anm. 4], S. 391.<br />
25 Vgl. U. Teichler: Der Arbeitsmarkt für Hochschulabsolventen. <strong>München</strong> 1981, S.<br />
75 f.<br />
26 M. Kaiser: „Zur Flexibilität von Hochschulausbildungen: Ein Überblick über den<br />
Stand der empirischen Substitutionsforschung". In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt-<br />
<strong>und</strong> Berufsforschung, 8. Jg. (1975), H. 5, S. 216 f.<br />
27 Kultusministerium Baden-Württe<strong>mb</strong>erg: Der Arbeitsmarkt für Akademiker in Baden-Württe<strong>mb</strong>erg<br />
bis 1990. Villingen-Schwenningen 1978.<br />
28 P. Heindlmeyer u.a.: Berufsausbildung <strong>und</strong> Hochschulbesuch. Pullach b. <strong>München</strong><br />
1973.<br />
29 W. Ar<strong>mb</strong>ruster u.a.: Expansion <strong>und</strong> Innovation. Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung<br />
1971.<br />
30 So z.B. v. Gottsleben: „Überlegungen zum Thema: Kriterienkatalog zur Beurteilung<br />
beschäftigungsorientierter Bildungs- <strong>und</strong> Arbeitskräfteprognosen." In: Arbeitsgruppen<br />
[Anm. 22], S. 76-91.<br />
31 Siehe z.B. G. Brinkmann u.a.: Bildungsökonomik <strong>und</strong> Hochschulplanung. Darmstadt<br />
1976; L. Alex <strong>und</strong> G. Weisshuhn: Ökonomie der Bildung <strong>und</strong> des Arbeitsmarktes.<br />
Hannover 1980.<br />
32 Vgl. dazu D. Hartung, R. Nuthmann <strong>und</strong> U. Teichler: Bildung <strong>und</strong> Beschäftigung.<br />
<strong>München</strong> 1981, S. 109 f.<br />
33 So z.B. M. Baethge: „Abschied von Reformillusionen". In: betrifft: erziehung, 5.<br />
Jg. (1972), H. 11, S. 19-28.<br />
34 W. Ar<strong>mb</strong>ruster u.a., a.a.O.; U. Teichler, D. Hartung <strong>und</strong> R. Nuthmann: Hochschulexpansion<br />
<strong>und</strong> Bedarf der Gesellschaft. Stuttgart 1976.<br />
<strong>35</strong> Zu neueren Deutungen des Arbeitsmarktes für Hochschulabsolventen siehe z.B.<br />
A. Hegelheimer: Strukturwandel der Akademikerbeschäftigung. Essen-Bredeney:<br />
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 1984; C. Kemmet, H. Linke <strong>und</strong> R.<br />
Wolf: Studium <strong>und</strong> Berufschancen. Herford 1982.<br />
36 G. Kühlewind, D. Mertens <strong>und</strong> M. Tessaring: „Zur drohenden Ausbildungskrise im<br />
nächsten Jahrzehnt". In: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (Hrsg.):<br />
Schülerberg <strong>und</strong> Ausbildung. Stuttgart 1976, S. 26-40.<br />
37 Siehe U. Teichler: „Öffnung .... [Anm. 14], S. 21 ff.<br />
38 Siehe erstmals: Fünfter Rahmenplan für den Hochschulbau nach dem Hochschulbauförderungsgesetz.<br />
Bonn 1975.<br />
39 Teichler: „Öffnung [Anm. 14], S. 31-38.<br />
40 Ebenda, S. 39 ff.<br />
41 B<strong>und</strong>esminister für Bildung <strong>und</strong> Wissenschaft: Stand, Entwicklung <strong>und</strong> Ergebnisse<br />
der Prognoseforschung zum künftigen Arbeitskräfte- <strong>und</strong> Qualifikationsbedarf.<br />
Bonn 1980, S. 145 f.<br />
42 Teichler: „Öffnung [Anm. 14], S. 31 ff.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
BILDUNG UND WERTWANDEL<br />
Helmut Klages<br />
I.<br />
Ich möchte am Anfang meiner Ausführungen fünf sehr allgemein gehaltene<br />
Aussagen zum Wert- oder Wertewandel machen, die ich im weiteren Verlauf<br />
nicht diskutieren, sondern schlicht voraussetzen will.<br />
Die erste dieser Aussagen lautet, daß es aus empirischer Perspektive gesehen<br />
sinnvoll <strong>und</strong> naheliegend ist, von einem „Wertwandel" in der Gesellschaft<br />
der B<strong>und</strong>esrepublik zu sprechen, da es ganz zweifellos eine in bestimmter<br />
Richtung verlaufende Veränderung wesentlicher Teile der Wertausstattung<br />
breiter Bevölkerungsteile gegeben hat, deren Ergebnisse jedenfalls<br />
bisher in ihren Gr<strong>und</strong>zügen erhalten geblieben sind <strong>und</strong> somit zum<br />
„Bestand" unserer Gesellschaft rechnen.<br />
Die zweite Aussage betrifft die Richtung des Wertwandels. Diese wurde<br />
von Ronald Inglehart mit der inzwischen fast schon sprichwörtlich gewordenen<br />
Kurzformel eines Wandels von „materialistischen" zu „postmaterialistischen"<br />
Werten gekennzeichnet. Ich selbst meine, daß es in der Tat möglich<br />
ist, die Richtung des Wertwandels mit einer solchen Kurzformel zu<br />
kennzeichnen, solange man sich der hinter ihr verborgenen Komplexitität<br />
bewußt bleibt.<br />
Auch ich verwende in meinen eigenen Arbeiten gern eine solche Kurzformel,<br />
wobei ich mich allerdings der Inglehartschen Formulierung ungeachtet<br />
des Vorteils ihrer Eingeführtheit enthalte, da sie m.E. zu fehlerhaften<br />
Assoziationen verleitet. Meine eigene Formel lautet, schlagwortartig<br />
formuliert, daß ein Wandel von Pflicht- <strong>und</strong> Akzeptanzwerten zu Selbstentfaltungswerten<br />
stattgef<strong>und</strong>en hat. 1<br />
Meine dritte Aussage betrifft die zeitliche Eingrenzung des Wertwandels.<br />
Man hatte sich in letzter Zeit vielfach schon daran gewöhnt, sich diesen<br />
Wandel als eine bleibende Konstante unserer gegenwärtigen Gesellschafts<strong>entwicklung</strong>,<br />
oder möglicherweise sogar der modernen Gesellschafts<strong>entwicklung</strong><br />
schlechthin vorzustellen <strong>und</strong> hierbei eine unveränderte Wertwandlungsrichtung<br />
zu unterstellen. In der Tat scheint eine solche Auffassung<br />
insoweit nicht falsch zu sein, als sich bei einem internationalen Vergleich<br />
eine deutliche statistische Korrelation zwischen der Höhe des Sozialprodukts<br />
(<strong>und</strong> damit auch des sozio-ökonomischen Entwicklungsstands einer<br />
Gesellschaft) <strong>und</strong> der Ausprägung eines „individualistischen" Wertkomplexes<br />
feststellen ließ, der ganz zweifellos an wichtiger Stelle zu den<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Selbstentfaltungswerten hinzuzurechnen ist. Im übrigen ist jedoch der konkrete<br />
Verlauf dieser säkularen, ganz langfristigen Wertwandlungstendenz in<br />
einem hohen Grade nicht-linear <strong>und</strong> instabil <strong>und</strong> somit auch als Gr<strong>und</strong>lage<br />
für Prognosen in die mittlere Zukunft ungeeignet. Für die B<strong>und</strong>esrepublik<br />
läßt sich feststellen, daß von ihrer Gründung bis zum Beginn der 60er Jahre<br />
von einem „Wertwandel" zunächst noch nicht die Rede sein konnte. Ein<br />
solcher Wandel setzte vielmehr erst Anfang der 60er Jahre (konkret gesagt<br />
um das Jahr 1963) ein. Er entfaltete in den nachfolgenden Jahren eine erstaunliche<br />
Schubkraft, um dann allerdings um die Mitte der 70er Jahre wieder<br />
abzuflauen. Wir haben also, um es ganz deutlich zu sagen, in diesem<br />
Zeitraum einen „Wertwandlungsschub" gehabt, der inzwischen aber zu Ende<br />
gegangen ist, so daß es sehr fragwürdig ist, auch im gegenwärtigen Augenblick<br />
noch von einem in Gang befindlichen oder fortschreitenden Wertwandel<br />
zu sprechen. Wenn ich im folgenden vom „Wertwandel" spreche, so<br />
meine ich immer den Wertwandlungsschub der 60er <strong>und</strong> 70er Jahre, auch<br />
wenn ich dies nicht immer deutlich werden lasse. 2<br />
Meine vierte Aussage knüpft hier unmittelbar an <strong>und</strong> betrifft den Zustand<br />
der Werte, der sich nach dem Abbrechen des Wertwandlungsschubs<br />
vorfindet. Grob gesagt finden wir in der Bevölkerung der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
heute Pflicht- <strong>und</strong> Akzeptanzwerte <strong>und</strong> Selbstentfaltungswerte in einer unentschiedenen<br />
Schwebelage nebeneinander. Dabei lassen sich an den Flügeln<br />
Minderheitsgruppen identifizieren, bei denen entweder die Pflicht- <strong>und</strong><br />
Akzeptanzwerte oder die Selbstentfaltungswerte deutlich überwiegen. Zwischen<br />
diesen Gruppen findet sich jedoch eine breite, jenseits der 50%-Grenze<br />
liegende Majorität, bei der so oder so gelagerte „Mischungen" von Werten<br />
vorliegen. In dieser Majorität haben die Menschen also Wertmuster, die<br />
beide Wertepole zugleich enthalten. Ein gewisses Hin- <strong>und</strong> Herschwanken<br />
der Wertausprägungen zwischen den beiden Polen — oder: eine niedrige<br />
Wertstabilität — scheint zu den Merkmalen der Wertemischung hinzuzugehören.<br />
3<br />
Meine fünfte <strong>und</strong> letzte Aussage betrifft die „soziodemographischen"<br />
Korrelate des Wertwandels (oder, genauer gesagt, des Wertwandlungsschubs)<br />
<strong>und</strong> dies ist eben derjenige Punkt, an welchem nun — aus der Perspektive<br />
der Wertforschung — die Bildung ins Spiel kommt.<br />
Grob gesagt, machte sich der Wertwandlungsschub der 60er <strong>und</strong> 70er<br />
Jahre nämlich vor allem bei jungen Menschen — <strong>und</strong> unter diesen insbesondere<br />
bei Schülern <strong>und</strong> Studenten in der Altersgruppe von 16 bis 24 Jahren<br />
— bemerkbar. Gelegentliche Vorstellungen, der Wertwandel sei ein reines<br />
Jugendphänomen, oder gar eine ausschließliche Erscheinung der Hochschulen<br />
<strong>und</strong> Universitäten, sind allerdings, wie ich gleich hinzufügen möchte,<br />
nicht zutreffend. Ungeachtet deutlicher Intensitätsunterschiede fand ein<br />
in gleicher Richtung verlaufender schwächerer Wertwandel auch bei einem<br />
großen Teil der älteren Menschen statt. Vergleicht man die Werte von jüngeren<br />
mit denen von älteren Menschen seit dem Beginn der 60er Jahre bis<br />
heute, dann kann man feststellen, daß die Jüngeren einen sehr plötzlichen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
<strong>und</strong> schnellen Wertwandel erlebten, während die Älteren langsamer <strong>und</strong> natürlich<br />
auch begrenzter „nachzogen". 4<br />
II.<br />
Soviel zu den angekündigten Aussagen zum Wertwandel, mit denen ich dieses<br />
sehr komplexe Phänomen in groben Strichen umreißen wollte.<br />
Das für das weitere Vorgehen wesentliche Appelldatum ist im Rahmen<br />
des augenblicklichen Themas natürlich die Tatsache, daß dem Merkmal<br />
„Bildungsniveau" — ungeachtet der gerade eben erwähnten Einschränkungen<br />
— im Hinblick auf die Erklärung der Wert<strong>entwicklung</strong> eine erstrangige<br />
Bedeutung zukommt. Wie groß diese Bedeutung ist, wird erkennbar, sobald<br />
man sich die Tatsache vor Augen führt, daß das Merkmal „Bildungsniveau"<br />
in Ko<strong>mb</strong>ination mit dem Merkmal „Lebensalter" — im Hinblick auf die Beeinflussung<br />
<strong>und</strong> Formung der Werte — das herkömmlicherweise dominierende<br />
Merkmal des sozio-ökonomischen Status (oder: der Schicht- <strong>und</strong><br />
Klassenzugehörigkeit) überr<strong>und</strong>et <strong>und</strong> relativiert hat. 5<br />
Es ist von daher nahegelegt, sich die Frage zu stellen, ob vielleicht bestimmte<br />
eingewurzelte Gr<strong>und</strong>vorstellungen herkömmlichen soziologischen<br />
Denkens aufgr<strong>und</strong> der <strong>gesellschaftliche</strong>n Entwicklung überholt sind, ob<br />
konkreter gesagt, vielleicht die „soziale Schichtung" als Inbegriff der von<br />
der Arbeitswelt ausgehenden <strong>und</strong> über die Familie vermittelten <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Umstände die Menschen nur noch in abnehmendem Maße formt, ob<br />
sich vielleicht vor sie neue, dynamischere <strong>und</strong> in starkem Maße von der Bildungswelt<br />
beeinflußte Sozialisationsformen schieben, in denen der Kultursphäre<br />
Sozialisationsmacht zuwächst.<br />
Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß einer solchen Fragestellung<br />
auf der Ebene der gesellschafts- <strong>und</strong> kulturtheoretischen Betrachtung eine<br />
schlechthin entscheidende Bedeutung zukommt. Wendet man sich dieser<br />
Fragestellung mit dem für Details geschärften Blick des Empirikers zu, dann<br />
fallen allerdings sofort schwerwiegende Ungewißheiten ins Auge, von denen<br />
ihre Beantwortung umstellt zu sein scheint. Die im ersten Augenblick unbesehen<br />
plausibel erscheinende Tatsache eines „Zusammengehens" von Bildungsniveau<br />
<strong>und</strong> Wertwandel erscheint dann plötzlich unplausibel <strong>und</strong> erklärungsbedürftig.<br />
Wieso <strong>und</strong> auf welche Weise hängen denn eigentlich — so muß der Empiriker<br />
nämlich fragen — Bildungsniveau <strong>und</strong> Wertwandel überhaupt zusammen?<br />
Was ist es, das diese beiden Sachverhalte zusammenbringt? Und wofür<br />
steht der aus jeder Fragebogen-Soziographie geläufige Ausdruck „Bildungsniveau"<br />
im vorliegenden Zusammenhang? Steht er vielleicht für eine „Prägung"<br />
des Menschen durch Bildungsinstitutionen, die möglicherweise umso<br />
stärker <strong>und</strong> nachdrücklicher zur Geltung gelangt, je länger man sich in ihnen<br />
aufhält? Oder steht der Begriff etwa — das wäre eine gänzlich andersartige<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Möglichkeit — für die Ergebnisse einer dem Schul- oder Hochschulbesuch<br />
vorgelagerten sozialen Auslese junger Menschen mit einer besonders starken<br />
Disposition für Selbstentfaltungswerte, die in den Bildungsinstitutionen<br />
selbst nur „verstärkt" oder „aufgeschaukelt" würde? Oder steht der Begriff<br />
vielleicht gar nur für die Auswirkung der mit der Zugehörigkeit zu Bildungseinrichtungen<br />
verb<strong>und</strong>enen allgemeinen Lebenssituation, so etwa für die<br />
Wirkung des Zusammentreffens einer Freisetzung von Berufsarbeit mit finanzieller<br />
Abhängigkeit? Oder vielleicht auch nur für eine besondere Empfänglichkeit<br />
für Wertpropagierungen?<br />
Und wenn es sich um „Prägung" handeln sollte — handelt es sich dann<br />
hierbei um eine Beeinflussung durch Bildungsinhalte, oder vielleicht auch<br />
durch Bildungsformen <strong>und</strong> -umstände, die für die gehobeneren Bereiche des<br />
Bildungssystems typisch waren <strong>und</strong> sind, bzw. typisch wurden, als ältere<br />
Formen <strong>und</strong> Umstände — in den 60er Jahren — durch neue abgelöst wurden?<br />
Man kann auf den ersten Blick erkennen, daß diese Alternativen der<br />
Deutung des empirisch beobachtbaren Korrelierens von Wertwandel <strong>und</strong><br />
Bildung höchst unterschiedlich <strong>und</strong> kontrovers sind. Man mag sich aber,<br />
wenn man an diesem Punkt der Einsicht angelangt ist, zumindest einen Augenblick<br />
lang mit dem Gedanken trösten, daß die in dem fraglichen Erkenntnisfeld<br />
zahlreich versammelten Forschungsdisziplinen das Problem sicherlich<br />
längst erkannt <strong>und</strong> wahrscheinlich auch gelöst haben werden, so daß es<br />
möglich ist, die Beantwortung der aufgeworfenen Fragen aus vorhandenen<br />
Forschungsergebnissen abzulesen. Man mag hierbei neben der Wertforschung<br />
selbst an die Schul- <strong>und</strong> Hochschulsozialisationsforschung, wie natürlich<br />
auch an die Jugendforschung denken, d.h. also an gut besetzte Disziplinen,<br />
denen gegenüber es wenig Anlaß zur Zurückhaltung hochgespannter<br />
Erwartungen zu geben scheint.<br />
Ich hoffe mich nun allerdings mit den Forschern der betreffenden Disziplinen<br />
in Übereinstimmung zu befinden, wenn ich behaupte, daß eine vertrauensvolle<br />
Wissenszuschreibung dieser Art den gegenwärtig gegebenen Erkenntnisstand<br />
bei weitem überfordern würde. Es läßt sich vielmehr umgekehrt<br />
die These aufstellen, daß die hinter dem statistischen Zusammenhang<br />
von Wertwandel <strong>und</strong> Bildungsniveau stehende Kausalität gegenwärtig noch<br />
verhältnismäßig unerforscht <strong>und</strong> im ganzen genommen unklar ist, so daß<br />
ihre Aufhellung zu den wesentlichen Aufgaben rechnen muß, die sich im<br />
Themenbereich „Bildung <strong>und</strong> Wertwandel" aktuell stellen.<br />
Die Erklärung dieses überraschenden Wissensdefizits muß auf diese<br />
Entwicklungssituation der im Spiele befindlichen Forschungsdisziplinen<br />
eingehen <strong>und</strong> fordert mehr Zeit <strong>und</strong> Raum als an dieser Stelle zur Verfügung<br />
stehen. Ich will es deshalb bei der Negativfeststellung belassen <strong>und</strong><br />
6<br />
mich vielmehr — innerhalb derjenigen Grenzen, die durch den Forschungsstand<br />
gesetzt sind — an die soeben definierte Aufgabenstellung heranbegeben,<br />
d.h. also den Versuch unternehmen, einen Beitrag zur Aufhellung der<br />
zwischen Bildungsniveau <strong>und</strong> Wertwandel bestehenden Kausalbeziehung zu<br />
leisten.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Da der eigentlich wünschenswerte Weg einer Präsentation <strong>und</strong> Erörterung<br />
einschlägiger Daten zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gangbar<br />
ist, wähle ich hierbei als Vorgehensweise den Weg der Hypothesenaufstellung<br />
auf der Gr<strong>und</strong>lage verhältnismäßig unvollständiger empirischer Informationen.<br />
Exakter ausgedrückt, begehe ich in den nachfolgenden Minuten<br />
diejenigen vergleichsweise fre<strong>und</strong>lichen Anfangsteile dieses Weges, in denen<br />
der sozialwissenschaftlichen Phantasie noch keine allzu engen Grenzen<br />
durch Operationalisierungserfordernisse gesetzt sind. Ich trage, noch zurückhaltender<br />
ausgedrückt, Vermutungen zusammen, die in das bestehende<br />
Wissensloch hineinpassen <strong>und</strong> mit denen sich somit eine Hoffnung auf seine<br />
irgendwann einmal nachfolgende, strengeren Prüfkriterien Rechnung tragende<br />
Schließung verbinden läßt.<br />
III.<br />
Ich möchte, wenn ich mich in die Hypothesenformulierung hineinbegebe,<br />
mit einem nochmaligen Blick auf diejenigen Ergebnisse der Wertforschung<br />
beginnen, denen zufolge der Wertwandel bei Schülern <strong>und</strong> Studenten besonders<br />
deutlich war. Konkreter formuliert heißt dies u.a., daß Schüler <strong>und</strong><br />
Studenten der 60er <strong>und</strong> 70er Jahre — zumindest zum Teil — andere Werte<br />
hatten als Schüler <strong>und</strong> Studenten der 50er Jahre. Diese letzteren waren, mit<br />
einem Wort gesagt, „konservativer" (oder: stärker an Pflicht- <strong>und</strong> Akzeptanzwerten<br />
orientiert) als die Angehörigen der nachfolgenden Alterskohorten.<br />
Gleichzeitig läßt sich aber auch feststellen, daß sich die Studenten <strong>und</strong><br />
Schüler aller Kohorten in charakteristischer Weise stets von anderen jugendlichen<br />
Teilgruppen, wie natürlich auch von der Gesamtbevölkerung unterschieden.<br />
So waren auch die Schüler <strong>und</strong> Studenten der 50er Jahre in mancher<br />
— keinesfalls in jeder — Hinsicht „progressiver" (oder: mehr an Selbstentfaltungswerten<br />
orientiert) als Lehrlinge <strong>und</strong> Berufstätige. 7<br />
Was sich aus dieser Duplizität von Ergebnissen ablesen läßt, ist eine Einsicht,<br />
die für die beabsichtigte Aufhellung des Zusammenhangs von Wertwandel<br />
<strong>und</strong> Bildung von gr<strong>und</strong>sätzlicher Bedeutung ist. Wir können hieraus<br />
nämlich — mit einiger Vorsicht <strong>und</strong> in steter Rückbesinnung auf die Unvollständigkeit<br />
der Daten — die Folgerung ableiten, daß dieser Zusammenhang<br />
unterschiedliche Direktheitsgrade aufweist. Erinnern wir uns der zusätzlichen<br />
Tatsache, daß sich der Wertwandel der 60er <strong>und</strong> 70er Jahre bei Schülern<br />
<strong>und</strong> Studenten deutlicher <strong>und</strong> stärker vollzog als bei den anderen Teilen<br />
der Jugend <strong>und</strong> bei der übrigen Bevölkerung, dann haben wir die Voraussetzungen<br />
für die Formulierung einer übergreifenden Leit- <strong>und</strong> Basishypothese<br />
in der Hand, die wie folgt lautet: Schüler <strong>und</strong> Studenten besaßen<br />
schon vor dem Wertwandlungsschub mehrheitlich eine in seine Richtung<br />
weisende besondere Wertdisposition, die aber bei seinem Einsetzen aktiviert<br />
wurde. Hebt man diese Hypothese auf eine höhere Verallgemeinerungsstufe,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
dann lautet sie dahingehend, daß sich „Bildung" — in dem institutionellen<br />
Verständnis, das wir heute mit ihr verbinden — mit einer Disposition für<br />
eben denjenigen Typus der Wertänderung verbindet, den wir in den 60er<br />
<strong>und</strong> 70er Jahren gehabt haben, daß aber die Realisierung <strong>und</strong> Ausschöpfung<br />
dieser Disposition an das Vorhandensein „interagierender" <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Außenbedingungen geb<strong>und</strong>en ist, denen gewissermaßen die Qualität<br />
von Katalysatoren <strong>und</strong> Verstärkern zukommt.<br />
Die nachfolgenden Hypothesengruppen lassen sich dieser zunächst noch<br />
sehr allgemein <strong>und</strong> abstrakt formulierten Leithypothese allesamt als konkreter<br />
ansetzende Verständnishilfen zuordnen. 8<br />
In einer ersten Hypothesengruppe geht es hierbei zunächst um die sehr<br />
gr<strong>und</strong>legende Tatsache, daß das Bildungssystem in unserer heutigen Gesellschaft<br />
— vor allem in seinen gehobenen Regionen — ein Wissen vermittelt,<br />
das den laufenden Wissenschaftsfortschritt aufnimmt <strong>und</strong> verkörpert. Das<br />
verwissenschaftliche Wissen der Schule <strong>und</strong> Hochschule konkurriert hierbei<br />
mit demjenigen <strong>gesellschaftliche</strong>n Alltagswissen, als dessen Hauptträger sich<br />
die Familie ausmachen läßt.<br />
Die gr<strong>und</strong>sätzliche Veraltetheit des „Bekanntheitsraums" der Familie 9<br />
wird in dieser Konkurrenz manifest <strong>und</strong> erfahrungswirksam. Es verbindet<br />
sich hiermit eine Erschütterung der kognitiven Gr<strong>und</strong>lagen der familialen<br />
Autorität <strong>und</strong> somit ein Beitrag zu deren Entmythologisierung. Es werden<br />
hierdurch aber auch wesentliche Legitimationsstützen der von der Familie<br />
vermittelten Pflicht- <strong>und</strong> Akzeptanzwerte in Frage gestellt. Es entsteht im<br />
Bereich dieser Werte somit eine Wertverunsicherung <strong>und</strong> ein Wertverlust.<br />
Dieser wird durch die im Bildungssystem ermöglichte geballte Kommunikation<br />
mit Gleichaltrigen (mit den sog. „peers") noch verstärkt.<br />
Die zweite Hypothesengruppe kann hier unmittelbar anschließen. Es<br />
geht in ihr um den von der Modernisierungstheorie vielfach beobachteten<br />
<strong>und</strong> erörterten allgemeineren Sachverhalt, daß die Konfrontation mit dem<br />
in den höheren Regionen des Bildungssystems vermittelten Wissen zu einer<br />
inneren Ablösung der Menschen aus ihren sozialen Herkunftsmilieus <strong>und</strong><br />
-bindungen beiträgt. Gut belegt sind in diesem Zusammenhang diejenigen<br />
10<br />
Anhebungen beruflicher Aspirationen über die Sozialschicht der Eltern<br />
hinaus, die sich bei Schülern <strong>und</strong> Studenten aus der unteren Mittelschicht<br />
<strong>und</strong> aus den sog. Unterschichten finden. Allgemeiner ausgedrückt weitet<br />
sich der Handlungsraum aus, in welchen man als junger Mensch seine Zukunftsbilder<br />
hineinprojiziert. An die Stelle von Vorstellungen vorherbestimmten<br />
Lebens treten mehr oder weniger ausgreifende, in abgehobene<br />
Regionen des sozialen Möglichkeitsraums vorstoßende Zielbilder, welche<br />
man typischerweise mit besonderen Fähigkeiten, die man sich selbst zuschreibt,<br />
verbindet. Auch hier ergibt sich der Effekt einer Abwertung von<br />
Pflicht- <strong>und</strong> Akzeptanzorientierungen zugunsten von Selbstentfaltungsbezügen.<br />
Die nachfolgenden Hypothesengruppen drei <strong>und</strong> vier unterscheiden<br />
sich von den beiden ersten dadurch, daß sie den Gesichtspunkt einer mit<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Bildung verb<strong>und</strong>enen inneren Ablösung <strong>und</strong> Abwendung von Verbindlichkeiten<br />
auf einen anderen Wirklichkeitsbereich übertragen. Stand eben das<br />
von der Familie bestimmte Herkunftsmilieu im Vordergr<strong>und</strong>, so kommt<br />
nunmehr die Arbeitswelt als Zielbereich der Lerntätigkeit ins Spiel.<br />
Bei der dritten Hypothesengruppe geht es dabei zunächst nochmals um<br />
die Art des Wissens, das in Schulen <strong>und</strong> Hochschulen vermittelt wird. Dieses<br />
Wissen ist typischerweise nicht auf Berufs- <strong>und</strong> Arbeitsrollen bezogen,<br />
sondern hält diesen gegenüber einen gr<strong>und</strong>sätzlichen <strong>und</strong> insgesamt zunehmenden<br />
Abstand offen. Daß dies so ist, wird einerseits durch das im schulischen<br />
Bereich vorherrschende Prinzip einer allgemeinen Gr<strong>und</strong>bildung,<br />
11<br />
weiter aber auch — an den Hochschulen — dadurch herbeigeführt, daß hier<br />
ein Prinzip der Wissenssystematisierung dominiert, das sich an Theoriebildungsinteressen<br />
orientiert. Gegenüber den Wissenserfordernissen der Berufspraxis<br />
ist hier eine kognitive Distanz im Spiel, der „Dissonanz"-Qualitäten<br />
im Sinne der Theorie der kognitiven Dissonanz anhaften. Daß Absolventen<br />
verschiedenster Fachrichtungen — heute mehr als früher — beim Übergang<br />
in die Arbeitswelt einen „Praxisschock" erleiden, ist eines derjenigen Phänomene,<br />
die hier eine Wurzel haben. Dieser Schock läßt sich zwar zum Teil<br />
durch das schlichte Erlebnis der Unvorbereitetheit auf den Beruf erklären.<br />
Es hat seine Ursache aber auch darin, daß im Beruf die Orientierung an<br />
Weltverständnis vermittelnden, den eigenen „Durchblick" erweiternden<br />
Wissenschaftsstoffen durch die Orientierung an pflichtgemäß zu befolgenden<br />
Regeln ersetzt wird, in denen sich die laufenden Funktionserfordernisse<br />
überpersönlicher Arbeitszusammenhänge niederschlagen. Es wird hierin<br />
deutlich, in welchem Maße die Lerntätigkeit in der Bildungswelt Selbsterweiterungsinteressen<br />
anstelle von Disziplinansprüchen Raum gibt.<br />
Die vierte, weitläufiger zu erörternde Hypothesengruppe vermag hier<br />
unmittelbar anzuschließen, wenngleich sie unter einem anderen Systematisierungsgesichtspunkt<br />
steht. Es geht hierbei um eine Mehrzahl von „Freisetzungen"<br />
<strong>und</strong> „Entlastungen", denen Schüler <strong>und</strong> Studenten in Bildungseinrichtungen<br />
aufgr<strong>und</strong> des in ihnen vorherrschenden Organisations- <strong>und</strong><br />
Arbeitsstils unterliegen.<br />
Hierbei ist zunächst einmal an eine f<strong>und</strong>amentale Freisetzung zu einer<br />
die eigene Entwicklung fördernden Tätigkeit zu denken, deren sich der<br />
Schüler selbst oft gar nicht bewußt wird, die aber bei einem Vergleich mit<br />
der Situation des Berufstätigen sofort deutlich wird. „Nicht für die Schule,<br />
für das Leben lernen wir" war <strong>und</strong> ist diejenige charakteristische Leitmaxime,<br />
die den vom Bildungssystem geradezu aufgenötigten Selbstbezug <strong>und</strong><br />
Selbstentfaltungswert des Lernens zum Ausdruck bringt. Der einzelne sieht<br />
sich von daher f<strong>und</strong>amental auf den eigenen Lebenslauf als die wesentliche<br />
Bezugsgröße seines Tuns verwiesen. Er befindet sich damit in einem extremen<br />
Kontrast zur Normalsituation des Berufstätigen in der Arbeitswelt, der<br />
seine Tätigkeitsrolle auch dann, wenn er Aufstiegsinteressen hat, mit voller<br />
Eindeutigkeit primär für die Firma oder Behörde, für den K<strong>und</strong>en oder Bürger,<br />
oder z.B. auch für diejenige Arbeitsgruppe ausübt, mit der er durch ein<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Lohnakkordsystem verb<strong>und</strong>en ist. Auch hierdurch werden Dispositionen<br />
begünstigt, die in Richtung der Selbstthematisierung <strong>und</strong> der Selbstentfaltung<br />
verlaufen.<br />
Solche Dispositionen erfahren nun aber erhebliche weitere Stützungen<br />
durch eine Vielzahl von ,,Situations"-Merkmalen, welche sich mit der Lerntätigkeit<br />
verbinden.<br />
So ist der oder die Lernende typischerweise von der Verantwortung für<br />
die Folgen aktuellen Handelns freigesetzt. Die Mitschüler oder Kommilitonen<br />
leiden nicht darunter, wenn er oder sie in einer Klausur versagt. Er oder<br />
sie selbst ist letztlich auch dazu aufgerufen, aus Leistungserfolgen oder -mißerfolgen<br />
Konsequenzen abzuleiten. Wenn dagegen im BAT (im B<strong>und</strong>esangestelltentarif<br />
also) von „verantwortungsvoller Tätigkeit" die Rede ist, dann<br />
geht es immer nur um die Frage, ob jemand dazu in der Lage ist, ohne direkte<br />
Anleitung <strong>und</strong> Beaufsichtigung etwas zu tun, was sich berechenbar<br />
<strong>und</strong> präzise in den Leistungszusammenhang eines Betriebs einfügt <strong>und</strong> was<br />
selbstverständlich einer hierauf abstellenden Erwartungsnorm, Kontrolle<br />
<strong>und</strong> Bewertung unterliegt. Auch im Bereich der Verantwortungsdefinition<br />
stoßen wir in Bildungseinrichtungen also auf den Sachverhalt eines im Vordergr<strong>und</strong><br />
stehenden Selbstbezugs <strong>und</strong> Selbstentfaltungswerts der Tätigkeit,<br />
d.h. also auf die Hervorhebung des individuellen Persönlichkeitssystems als<br />
der Bezugsinstanz des einzelnen. Auch von hierher läßt sich also von einer<br />
nachdrücklichen Förderung von Dispositionen für Selbstentfaltungswerte<br />
sprechen.<br />
Roland Eckert hat jüngst auf einen weiteren, in diesem Zusammenhang<br />
interessanten Aspekt, hingewiesen, auf die Freisetzung von Zwängen zur<br />
arbeitsteiligen Kooperation nämlich, von denen in der Arbeitswelt höchstgradige<br />
Disziplinanforderungen ausgehen <strong>und</strong> die dort die Erhaltung von<br />
Pflicht- <strong>und</strong> Akzeptanzwerten begünstigen. Der Schüler <strong>und</strong> Student lernt<br />
12<br />
im Regelfall allein, <strong>und</strong> wenn er sich von Zeit zu Zeit mit anderen zu einer<br />
Arbeitsgruppe zusammenfindet, dann handelt es sich charakteristischerweise<br />
um ein Unternehmen auf Gegenseitigkeitsgr<strong>und</strong>lage, das nach dem<br />
Prinzip des Tausches von Hilfs- <strong>und</strong> Unterstützungsleistungen aufgebaut<br />
ist, das also wiederum den Selbstbezug voraussetzt <strong>und</strong> stabilisiert. Die<br />
Freiheiten der individuellen Themenwahl <strong>und</strong> der individuellen Auswahl<br />
von Lehrangeboten bestätigen diesen Sachverhalt sehr nachdrücklich.<br />
Ganz ähnlich verhält es sich nun aber auch hinsichtlich der Freisetzung<br />
von Zwängen zur Identifikation mit Organisationszielen, der sich zumindest<br />
die Inhaber gehobener Stellen in Unternehmungen <strong>und</strong> Behörden in der Regel<br />
nicht entziehen können. Natürlich gibt es auch in Schulen <strong>und</strong> Hochschulen<br />
ein „Organisationsklima", das Identifikationszwänge einschließt.<br />
Legt man die Bedingungen der B<strong>und</strong>esrepublik zugr<strong>und</strong>e, dann wird man allerdings<br />
kaum von einem starken Zwang zur Identifikation mit den Leistungserwartungen<br />
<strong>und</strong> Wissenschaftszielen von Lehrern <strong>und</strong> Dozenten sprechen<br />
können. Eher kommen hier die Gleichaltrigen, die „peers" zum Zuge.<br />
Im unmittelbaren Zusammenhang hiermit kann die relative Freisetzung von<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
hierarchischer Kontrolle erwähnt werden, die es in unseren Bildungseinrichtungen<br />
— insbesondere natürlich an den Universitäten — gibt.<br />
Wiederum muß registriert werden, daß das subjektive Selbst- <strong>und</strong> Situationsbild<br />
von Schülern <strong>und</strong> Studenten diesen Punkt vielfach ausklammert.<br />
Vergleicht man das Ausmaß <strong>und</strong> den Charakter hierarchischer Kontrolle<br />
in Bildungseinrichtungen <strong>und</strong> in der Arbeitswelt, so wird man aber eklatante<br />
Unterschiede finden, die sich allein schon aus dem zahlenmäßigen<br />
Verhältnis zwischen Aufsichtsträgern <strong>und</strong> Aufsichtsunterworfenen ableiten.<br />
Außerdem ist aber insbesondere in der Universität der auf Anweisungs<strong>und</strong><br />
Disziplinierungsfunktionen entfallende Anteil im Zeitbudget der Dozenten<br />
fast gleich Null, während er im Zeitbudget von Vorgesetzten eine<br />
beträchtliche Rolle spielt. Und letztlich steht Lehrern <strong>und</strong> Dozenten natürlich<br />
nur ein winziger Bruchteil derjenigen Anweisungs- <strong>und</strong> Disziplinierungsmittel<br />
<strong>und</strong> -kompetenzen zur Verfügung, die sich in Wirtschafts- oder Behördenbetrieben<br />
in den Händen von Vorgesetzten finden. Auch hier also<br />
wiederum: Weitgehende Angewiesenheit des einzelnen auf sich selbst, d.h.<br />
auf seine eigene Motivationslage <strong>und</strong> moralische Kompetenz in Verbindung<br />
mit den Einflüssen, die von gleichaltrigen Kohortenmitgliedern ausgehen.<br />
Ein letzter Punkt, der im Rahmen der vierten Hypothesengruppe zu erwähnen<br />
ist, betrifft die relativ große Freisetzung zu selbstgewählten, unmittelbar<br />
auf Selbstthematisierung, Selbstdarstellung <strong>und</strong> Selbstverwirklichung,<br />
abstellenden <strong>und</strong> der freien Disposition unterliegenden Tätigkeiten, die<br />
Schülern <strong>und</strong> Studenten zumindest in unseren Bildungseinrichtungen gewährt<br />
ist. Auch hier mögen Schüler <strong>und</strong> Studenten subjektiv einen anderen<br />
Eindruck haben. Immerhin gehört es aber zu den überraschenden Ergebnissen<br />
der Konstanzer Forschungsgruppe Hochschulsozialisation, festgestellt<br />
zu haben, daß bei den untersuchten Studenten bis in die Vorexamenssemester<br />
hinein eine ausgeprägte „Freizeitorientierung eine dominierende<br />
Rolle" spielte. An diese eine Feststellung läßt sich die weitere anschließen,<br />
13<br />
daß Schüler <strong>und</strong> Studenten bei starker finanzieller Abhängigkeit von der<br />
Verantwortung für die Sicherstellung ihrer eigenen materiellen Existenz <strong>und</strong><br />
der Bedürfnisse anderer Menschen weitgehend freigesetzt sind. Man mag<br />
Anlaß sehen, diesen Punkt gesondert zu betrachten <strong>und</strong> mit besonderen Bedeutungsakzenten<br />
zu versehen, <strong>und</strong> man kommt dann zu dem bekannten<br />
Postadoleszenz-Theorem von Keniston. 14<br />
IV.<br />
Ich möchte meine Hypothesenliste für den Augenblick abschließen <strong>und</strong> will<br />
zu einigen Ergänzungen <strong>und</strong> Kommentaren übergehen.<br />
Es wird sich dabei zunächst darum handeln müssen, auf die unbezweifelbaren,<br />
oft mit Händen zu greifenden Unterschiede zwischen Schülern<br />
<strong>und</strong> Studenten verschiedener Schultypen <strong>und</strong> Fachrichtungen hinzuweisen,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
die sich auch auf der Ebene der Wertdispositionen auffinden lassen. In<br />
15<br />
solchen Unterschieden kommen zunächst Abschattierungen in den Ausprägungen<br />
<strong>und</strong> Wirkungen der in meiner Hypothesenliste erwähnten Faktoren<br />
zur Geltung. Es kann keinen Zweifel daran geben, daß das jeweilige Gewicht<br />
der von mir erwähnten Distanzierungs-, Freisetzungs- <strong>und</strong> Entlastungsformen<br />
z.B. vom Charakter des Lehrstoffs <strong>und</strong> von der Art seiner Aufbereitung<br />
<strong>und</strong> Behandlung beeinflußt wird. Ein Fach, das viele Praktika aufweist,<br />
hat andere Sozialisationsfolgen als ein reines Theorie- oder Lektürefach.<br />
Es kommen an dieser Stelle aber unvermeidlich weitere Faktoren wie<br />
der jeweilige Charakter des Lehrpersonals <strong>und</strong> der qualitative „Geist" von<br />
Bildungsinstitutionen ins Spiel. Faktoren solcher Art bringen wiederum<br />
16<br />
— aufgr<strong>und</strong> ihrer Bedeutung für das „Image" von Bildungsinstitutionen —<br />
Folgen für die Auslese bestimmter Schüler- <strong>und</strong> Studententypen mit sich.<br />
Das alles sind Dinge, die von der Schul- <strong>und</strong> Hochschulsozialisationsforschung<br />
mit ausreichender Dichte <strong>und</strong> Stringenz erforscht worden sind <strong>und</strong><br />
die jeder, der sich ein wenig auskennt, aus eigener Erfahrung bestätigen<br />
kann. Ihre systematische Bedeutung darf nun allerdings auch wiederum<br />
nicht überschätzt werden. Sie modifizieren zwar das allgemeine Bild, das<br />
ich in meiner Hypothesenliste einzufangen versucht habe, aber sie bestimmen<br />
es nicht — solange jedenfalls nicht, wie das Globalthema „Bildung<br />
<strong>und</strong> Wertewandel" in unreduzierter Gr<strong>und</strong>sätzlichkeit im Blick behalten<br />
wird. In dem Augenblick, in welchem man dieses Globalthema weicher<br />
oder auch spezialisierter angeht, können sich diese Dinge natürlich in den<br />
Vordergr<strong>und</strong> schieben. Dies ist — im Unterschied zur Wertforschung — sehr<br />
weitgehend in den bisherigen Arbeiten der Schul- <strong>und</strong> Hochschulsozialisationsforschung<br />
der Fall gewesen, welche sich speziell mit Schülern <strong>und</strong> Studenten<br />
beschäftigt hat, <strong>und</strong> welche daher zwangsläufig eine geschärfte Wahrnehmungsfähigkeit<br />
für die zwischen ihnen bestehenden Unterschiede <strong>und</strong><br />
deren Bedingungen entwickelt hat. Im Rahmen der von mir gewählten Behandlungsperspektive,<br />
die durch das Allgemeinthema „Bildung <strong>und</strong> Wertwandel"<br />
bestimmt ist, kann dagegen dem überwiegenden Teil der Ergebnisse<br />
dieser ertragreichen Forschungsrichtung nur ergänzende Aussagekraft<br />
zukommen. Ich sage dies sehr ausdrücklich, um unproduktive Mißverständnisse<br />
auszuschließen.<br />
Ich möchte in einer weiteren ergänzenden Bemerkung auf etwas zurückkommen,<br />
was ich meinen Hypothesen in der vorhergehenden „Basis- <strong>und</strong><br />
Leithypothese" vorangestellt hatte. Ich sagte dort, daß Bildung eine „Disposition"<br />
für Wertänderungen erzeuge, daß deren Realisierung <strong>und</strong> Ausschöpfung<br />
aber an das Vorhandensein „interagierender" <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Außenbedingungen geknüpft sei.<br />
Wir können uns an dieser Stelle nur sehr abgekürzt mit der bislang noch<br />
nicht behandelten Frage beschäftigen, was unter diesen „Außenbedingungen"<br />
zu verstehen ist. Nach alledem, was in der Wertforschung darüber bisher<br />
auszumachen war, handelt es sich hierbei einerseits um das jeweilige<br />
<strong>gesellschaftliche</strong> „Wertklima", d.h. also um die Summe derjenigen Wert-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
evorzugungen <strong>und</strong> Wertlegitimierungen, die — unter Vermittlung durch<br />
die Medien — durch die meinungsbildenden politisch-kulturellen Kräfte der<br />
Gesellschaft hervorgebracht werden. Es handelt sich andererseits aber auch<br />
um die je nach gegebener Lage nach der einen oder anderen Richtung ausschlagenden<br />
Wertermutigungen <strong>und</strong> -entmutigungen, die von den wahrgenommenen<br />
wirtschaftlichen <strong>und</strong> politischen Rahmenbedingungen ausstrahlen.<br />
Führen wir uns die Verhältnisse vor Augen, die in der ersten Hälfte der<br />
60er Jahre zum Einsetzen des Wertwandlungsschubs <strong>und</strong> um die Mitte der<br />
70er Jahre zu seinem Abbrechen führten, so erkennen wir, daß das <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Wertklima <strong>und</strong> die wahrgenommenen Rahmenbedingungen ganz<br />
offenbar gekoppelt waren, d.h. also in einer gewissermaßen „konsonanten"<br />
Weise Wertdispositionen begünstigten oder zurückdrängten. 17<br />
Schwieriger als dies ist vielleicht zu verstehen, was unter dem „Interagieren"<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>r Außenbedingungen mit den innerhalb des Bildungssystems<br />
entstehenden Wertdispositionen konkret verstanden werden<br />
kann. Man trifft die Dinge wahrscheinlich am besten, wenn man davon<br />
ausgeht, daß durch die Sozialisationseinwirkungen des Bildungssystems<br />
„Aspirationen" in bestimmter Richtung erzeugt werden, die durch die <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Außenbedingungen bestätigt, verstärkt <strong>und</strong> legitimiert,<br />
oder aber auch durchkreuzt, gedämpft <strong>und</strong> delegitimiert werden. Diese<br />
Charakterisierung schließt die Möglichkeit vielfältiger psychologischer<br />
Probleme ein, die sich insbesondere bei Widersprüchen zwischen der durch<br />
das Bildungssystem begünstigten Wert<strong>entwicklung</strong>srichtung <strong>und</strong> der Wirkungsrichtung<br />
der <strong>gesellschaftliche</strong>n Außenbedingungen einstellen, wie wir<br />
sie seit dem Ausklingen des Wertwandlungsschubs gehabt haben. Es können<br />
dabei starke „Dissonanzen" auftreten, die vom einzelnen entweder im Sinne<br />
psychologischer Anpassung verarbeitet oder aber auch als Widerspruchs<strong>und</strong><br />
Konfliktstoffe in die Umwelt hineinprojiziert werden. Wenn die Schul<strong>und</strong><br />
Hochschulsozialisationsforschung seit der Mitte der 70er Jahre verstärkt<br />
Schüler- <strong>und</strong> Studententhemen in den Vordergr<strong>und</strong> rückte, bei denen<br />
es, mit Huber gesprochen, um die „Bürokratisierung <strong>und</strong> Standardisierung<br />
der Hochschulumwelt", um den Zwang zum Erwerb eines „von persönlicher<br />
Erfahrung <strong>und</strong> Verwendung abgeschnittenen Wissens", um Probleme<br />
der „Isolation, der Kontaktlosigkeit, der Apathie, der Orientierungslosigkeit,<br />
des gespaltenen Bewußtseins, von Identitätskrisen, von Entfremdung<br />
<strong>und</strong> von Angst" ging , dann hat dies seine Ursache ganz gewiß auch im<br />
18<br />
Eindruck einer zunehmenden Wertversagung nach dem Ende des Wertwandlungsschubs.<br />
Ich habe mir noch eine letzte ergänzende Bemerkung vorgemerkt, die<br />
allerdings im Gr<strong>und</strong>e genommen mehr ist als dies, die vielmehr schon in eine<br />
weiterführende Kommentierung <strong>und</strong> Verarbeitung des bisher Dargestellten<br />
überleitet <strong>und</strong> die deshalb auch eine größere Aufmerksamkeit rechtfertigt.<br />
Ich möchte damit beginnen, daß ich auf eine — ganz bewußt in Kauf genommene<br />
— Besonderheit meiner Hypothesenliste hinweise: Es war in ihr<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
zwar durchweg von wertwandlungsrelevanten Sozialisationsfolgen der Bildung<br />
die Rede, nicht aber von gewollten Einwirkungen des Bildungssystems<br />
auf die Wert<strong>entwicklung</strong>. Es ging, um es konkret zu sagen, nicht um Rahmenrichtlinien<br />
<strong>und</strong> Unterrichtspläne, in denen die Kultivierung von Selbstentfaltungswerten<br />
<strong>und</strong> von Konfliktbereitschaften <strong>und</strong> -fähigkeiten zu ihrer<br />
Durchsetzung zum Programm erhoben wurde. Es ging auch nicht um „linke"<br />
oder „ultra-liberale" Tendenzen beim Lehrer- <strong>und</strong> Dozentenpersonal;<br />
auch nicht um die Schulbuchinhalte, die nach dem Ergebnis einschlägiger<br />
Untersuchungen seit den 60er Jahren in zunehmendem Maße akzeptanzkritischen<br />
Geist ausatmeten.<br />
Wenn ich alle diese Dinge in meiner Hypothesenliste ausgelassen habe,<br />
dann natürlich nicht, um ihre Bedeutungslosigkeit zu behaupten. Selbstverständlich<br />
wäre dies eine Position, die sich schwer vertreten ließe.<br />
Wenn ich mich solchen „intentionalen" Veränderungen im Bildungssystem<br />
gegenüber aber zugegebenermaßen spröde gezeigt habe, wenn ich<br />
mich an ihrer Stelle auf „nicht-intentionale" Einwirkungen konzentriert<br />
habe, so hat dies allerdings trotz alledem seinen Gr<strong>und</strong> in einer Bewertung.<br />
Ich gehe in der Tat davon aus, daß diese nicht-intentionalen Wertbeeinflussungen<br />
im Bildungsbereich die eigentlich ausschlaggebenden waren <strong>und</strong> sind,<br />
<strong>und</strong> daß neben ihnen die intentionalen Einflußnahmen, die wir in massiver<br />
Form gehabt haben <strong>und</strong> immer noch haben, nur einen kleineren, möglicherweise<br />
sogar unbedeutenden Teil der erklärungsbedürftigen Varianz abzudecken<br />
vermögen. 19<br />
Selbstverständlich ist diese Feststellung — wie sehr vieles von den Dingen,<br />
die ich vorgetragen habe — verhältnismäßig spekulativ (oder sagen wir:<br />
„hypothetisch", denn sie läßt sich ja nachprüfen, sobald nur die erforderlichen<br />
Daten verfügbar sind). Ich bin mir auch darüber im klaren, daß diese<br />
Feststellung vor allem für Pädagogenohren sehr provokativ klingen muß.<br />
Ich meine jedoch, daß das, was im anglo-amerikanischen Bereich „Evidenz"<br />
heißt, im vorliegenden Fall dermaßen dicht ist, daß sich auf diese<br />
provokative Feststellung abschließende Problemaufweisungen <strong>und</strong> Folgerungen<br />
aufbauen lassen, denen ich mich jetzt zuwenden will.<br />
Ich möchte hierbei von der Beobachtung ausgehen, daß die Verwirklichung<br />
von „Werten" durch ihre bewußte <strong>und</strong> gezielte Vermittlung von<br />
allem Anfang an das eigentliche Kernthema der Theorie <strong>und</strong> Praxislehre<br />
der Bildung war, der „Pädagogik" nämlich, wie man aus jeder halbwegs<br />
informativen Pädagogikgeschichte entnehmen kann. „Paideia" bedeutete<br />
seit der griechischen Antike die „bildnerische Arbeit am Menschen" auf<br />
bestimmte „Lebens- <strong>und</strong> Bildungsideale" hin, in deren Zentrum „Tugenden"<br />
(oder eben „Werte") standen. Zwar haben sich im Laufe der Zeit<br />
20<br />
sowohl die in Werten begründeten Bildungsleitbilder wie auch die Vorstellungen<br />
über pädagogische Praktiken geändert. Das Ziel einer pädagogischen<br />
Wertvermittlung blieb aber bis heute bestehen.<br />
Wenn ich mich hier auf nicht-intentionale Wertbeeinflussungen im Bildungssystem<br />
konzentriert habe <strong>und</strong> wenn ich überdies hinzugefügt habe,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
daß ich dies wegen des vermutlich geringeren Gewichts intentionaler Einflüsse<br />
getan habe, dann bedeutet dies also, daß ich — volens nolens — das<br />
traditionelle Zentrum des pädagogischen Selbstverständnisses — jedenfalls<br />
insoweit als es um die Verursachung des Wertwandels geht — aus soziologischer<br />
Perspektive in Frage gestellt habe.<br />
Man kann den Sachverhalt, der hier vorliegt, noch schärfer formulieren<br />
<strong>und</strong> sagen, daß — aus der Perspektive der Wert<strong>entwicklung</strong>s- <strong>und</strong> veränderungsdynamik<br />
unserer Gesellschaft betrachtet — Macht <strong>und</strong> Ohnmacht<br />
der Bildung in enger Verknüpfung sichtbar werden. Macht — <strong>und</strong> zwar große<br />
Macht — hat das Bildungssystem in diesem Zusammenhang ganz zweifellos<br />
als Summe struktureller Einwirkungen auf die menschliche Psyche.<br />
Relative Ohnmacht kommt hingegen der Bildung als einem Programm der<br />
gewollten <strong>und</strong> gezielten, an einem Konsens verbindlicher Wertvorstellungen<br />
orientierten menschlichen Selbstgestaltung zu.<br />
Diese Feststellung erfährt eine besondere Akzentuierung <strong>und</strong> nochmalige<br />
Zuspitzung angesichts der Tatsache, daß wir seit geraumer Zeit eine —<br />
dem Bildungswillen entspringende <strong>und</strong> Bildungsoptimismus dokumentierende<br />
— Bildungsexpansion haben, die tendenziell die gesamte Bevölkerung<br />
erfaßt <strong>und</strong> die inzwischen, mit Baethge gesprochen, dazu geführt hat, daß<br />
die Schule für die überwiegende Mehrzahl der Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr<br />
„zur dominanten institutionalisierten Lebensform neben der Familie"<br />
geworden ist. 21<br />
Man denkt, wenn man Probleme dieser Entwicklung ins Auge faßt, gegenwärtig<br />
meist zunächst an Ungleichgewichte zwischen Bildungsangebot<br />
<strong>und</strong> Bildungsnachfrage <strong>und</strong> an die mit ihnen verb<strong>und</strong>enen Arbeitslosigkeitsfolgen.<br />
Eine solche Fokussierung des Problemverständnisses ist aus der aktuellen<br />
Notlage einer zunehmenden Zahl junger Menschen verständlich. Hinter<br />
der Oberfläche des unabweisbaren Problems, das hier vorliegt, dämmert<br />
aber ein viel gr<strong>und</strong>sätzlicheres Problem herauf, das mit einer zunehmenden<br />
nicht-intendierten, dementsprechend auch von niemandem verantworteten,<br />
bisher kaum ausreichend erkannten Einwirkung des expandierenden Bildungssystems<br />
auf die <strong>gesellschaftliche</strong> Psyche zu tun hat.<br />
In paradoxer Zuspitzung läßt sich sagen, daß die nachindustrielle Gesellschaft,<br />
die man inzwischen schon als eine Lern-, Informations- <strong>und</strong> Bildungsgesellschaft<br />
anspricht, in dem Maße, in welchem sie zur „pädagogischen<br />
Provinz" wird, zu einer Gesellschaft mutiert, in welcher neuartige<br />
ungesteuerte, unverantwortete <strong>und</strong> weithin unbekannte Einwirkungsmächte<br />
soziopsychischer Natur zur Geltung gelangen.<br />
Feststellungen solcher Art sind in letzter Zeit speziell in Verbindung<br />
mit den neuen Medien <strong>und</strong> Kommunikationstechniken aufgetaucht. Die Beschäftigung<br />
mit dem Thema „Bildung <strong>und</strong> Wertwandel" erweist jedoch,<br />
daß es falsch wäre <strong>und</strong> möglicherweise zu irrigen Schlußfolgerungen verleiten<br />
würde, nur dort nachdenklich zu werden, wo der Mikrocomputer <strong>und</strong><br />
das Kabelfernsehen einziehen. Man bekommt, wie ich meine, das gesamte<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Problemfeld nur dann in einer unreduzierten Weise in den Blick, wenn man<br />
sich den nicht-intendierten Folgen der Bildungsexpansion im ganzen zuwendet.<br />
Ein Vergleich der Bildungsexpansion (oder: -revolution) mit der industriellen<br />
Revolution mag auf den ersten Blick abwegig erscheinen, oder allenfalls<br />
als Kontrastfall in Frage kommen, da der Arbeiter durch Proletarisierung<br />
von der Arbeit entfremdet wurde, während die Entfremdung des<br />
Schülers <strong>und</strong> Studenten von der Arbeitswelt eher durch Prozesse emanzipatorischer<br />
Art zustande kommt. Andererseits lag auch in der industriellen<br />
Revolution der Sachverhalt vor, daß eine Entwicklung, die von vielen mit<br />
den höchsten Hoffnungen begrüßt wurde, eine Fülle von unerkannten, von<br />
niemandem gewollten <strong>und</strong> verantworteten, gleichsam „naturwüchsig" eintretenden<br />
Nebenfolgen herbeiführte, die die bisherige Gesellschaft erschütterten<br />
<strong>und</strong> sprengten. Man kann sich auf den Standpunkt stellen, daß insoweit<br />
eine Parallele zwischen der industriellen Revolution <strong>und</strong> der Bildungsrevolution<br />
zu ziehen ist, von der in der Tat in der Gegenwart <strong>und</strong> in der vor<br />
uns liegenden Zukunft für die Epoche entscheidende Veränderungen auszugehen<br />
scheinen. Es entstehen hier, wie wir festgestellt haben, strukturelle<br />
Mechanismen, deren offenk<strong>und</strong>ige Nützlichkeit nur die Oberfläche eines in<br />
Wirklichkeit viel breiteren <strong>und</strong> tieferen Wirkungsspektrums gesellschaftsverändernder<br />
Natur markiert. In der Entdeckung dieses Wirkungsspektrums ist,<br />
wie ich meine, die eigentliche Bedeutung der Thematisierung des Verhältnisses<br />
zwischen Bildung <strong>und</strong> Wertwandel zu sehen.<br />
Es muß als Tatsache festgehalten werden, daß uns für die Erfassung der<br />
sozialpsychologischen Veränderungsfolgen der Bildungsrevolution einschließlich<br />
ihrer möglichen Problemdimensionen gegenwärtig noch schlicht<br />
die Begriffe (wie auch teils die Motive) fehlen. Wir müssen uns bisher noch<br />
an verhältnismäßig spärliche <strong>und</strong> isolierte Einzelfakten halten, deren Bewertung<br />
angesichts des noch fehlenden Gesamtüberblicks schwankend <strong>und</strong><br />
widersprüchlich ist <strong>und</strong> sein muß, wobei sich die Folgenidealisierung <strong>und</strong><br />
die Folgenperhorreszierung die Waage halten.<br />
Folgenidealisierend erscheint die Annahme, die mit der Bildungs<strong>entwicklung</strong><br />
zusammenhängenden, in immer breitere Bevölkerungsteile hineingetragenen<br />
Wertwandlungsdispositionen seien reine Fortschrittsphänomene<br />
<strong>und</strong> somit jeglicher Kritik enthoben. Folgenperhorreszierend ist dahingegen<br />
z.B. die von Daniel Bell vertretene Auffassung, der von der Kultursphäre<br />
ausstrahlende Wertwandlungstrend der Gegenwart sei „antinomisch" (d.h.<br />
gegen an <strong>und</strong> für sich bestehende Normen der Gesellschafts<strong>entwicklung</strong>, wie<br />
z.B. das Leistungsprinzip gerichtet) <strong>und</strong> er trage somit zu einem zukünftigen<br />
Zusammenbruch der notwendigerweise auf Selbstdisziplin <strong>und</strong> rationaler<br />
Arbeit beruhenden postindustriellen Zivilisation bei. 22<br />
Was wir empirisch feststellen können ist, daß das Bildungssystem — im<br />
Zusammenhang mit anderen Einwirkungen, von denen hier nicht die Rede<br />
war — Wert- <strong>und</strong> Einstellungsdispositionen erzeugt, die sich mit <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Lebens-, Funktions- <strong>und</strong> Erfahrungsbedingungen außerhalb der Bil-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
dungssphäre oft in einem deutlichen Spannungsverhältnis befinden, wodurch<br />
den Menschen, die diese Dispositionen besitzen, schwerwiegende<br />
Anpassungsprobleme aufgebürdet werden. Diese geben zu mehr oder weniger<br />
produktiven Bewältigungsstrategien Anlaß, die teils individuell <strong>und</strong> unpolitisch,<br />
teils aber auch kollektiv <strong>und</strong> politisch sind. Während das gegebene<br />
Spannungsverhältnis auf der einen Seite individuelles Suchen nach ungehinderter<br />
Wertaustragung, wie auch pragmatisches oder resignatives Rücksteuern<br />
von Werten auf ältere Ausgangslagen begünstigt, begünstigt es auf der anderen<br />
Seite auch die Entstehung von Konfliktlagen, in denen es typischerweise<br />
um die Abwehr entfaltungshemmender „Systemzwänge" bzw., aus entgegengesetzter<br />
Perspektive betrachtet, um die Sicherung von Systemerfordernissen<br />
gegen „anarchische" Infragestellungen geht. Wie die aktuelle politische<br />
Szenerie zeigt, sind diese Konfliktlagen zur Aufsaugung einer Vielfalt unterschiedlichster<br />
Probleme fähig, wodurch ihnen große Expansionskraft <strong>und</strong><br />
disruptive Gewalt zuwachsen kann. Die unausgetragene Spannung zwischen<br />
den Pflicht- <strong>und</strong> Akzeptanzwerten <strong>und</strong> den Selbstentfaltungswerten, die wir<br />
nach dem Abbrechen des Wertwandlungsschubs haben, setzt sich somit über<br />
Spannungen zwischen <strong>gesellschaftliche</strong>n Subsystemen in Antagonismen um,<br />
die den soziopolitischen Minimalkonsens bedrohen. Das „cleveage" der<br />
Werte wird zum Konfliktzentrum einer Gesellschaft, die nach der Überwindung<br />
älterer Klassengegensätze <strong>und</strong> religiöser Schismen auf dem Wege in<br />
eine integrative Entwicklung zu sein schien.<br />
V.<br />
Wenn ich mich nun noch den aus der Analyse ableitbaren Konsequenzen<br />
zuwende <strong>und</strong> mich dabei pflichtgemäß auf die „Prognose" konzentriere, so<br />
möchte ich zunächst noch einmal an meine Basis- <strong>und</strong> Leithypothese erinnern.<br />
Ich hatte schon wiederholt, daß das Bildungssystem zwar eine „Disposition"<br />
für die neuen Werte erzeugt, daß sich die Frage nach der Realisierung<br />
<strong>und</strong> Ausschöpfung dieser Disposition aber stets in dem Charakter<br />
„interagierender" <strong>gesellschaftliche</strong>r Außenbedingungen entscheidet. Konkret<br />
bedeutet dies u.a. auch, daß die reale Entwicklung der <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Wertorientierungen <strong>und</strong> ihr Wandel dem Bildungssystem keinesfalls<br />
exklusiv „zuzurechnen" (oder „anzulasten") sind. Es kommt hinzu, daß<br />
Dispositionen für veränderte Werte im Bildungssystem selbst, wie wir gesehen<br />
haben, sehr vielfältigen Ursachen entspringen, die keineswegs auf<br />
einen einfachen Nenner zu bringen sind. So wie die Dinge liegen, ist realistischerweise<br />
damit zu rechnen, daß die in Richtung der Selbstentfaltungswerte<br />
zielende Wertwandlungsproduktivität des Bildungssystems in Zukunft<br />
eher weiter zu- als abnehmen wird. Da sich voraussichtlich auch der Anteil<br />
der Bevölkerung, der die gehobeneren Bereiche des Bildungssystems durchläuft,<br />
in Zukunft weiter erhöhen wird, ist auch von daher eher mit einer<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
weiter zunehmenden Einflußwirkung des Bildungssystems auf die Wert<strong>entwicklung</strong><br />
zu rechnen.<br />
Die „interagierenden", den Wertwandel auslösenden (oder auch abstoppenden)<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>n Außenbedingungen entziehen sich aber nun —<br />
zumindest im Bereich mittelfristiger Zukunft — dem auf Berechenbarkeit<br />
abstellenden prognostischen Zugriff. So wie die Dinge gegenwärtig <strong>und</strong> auf<br />
absehbare Zeit liegen, scheinen sich diese Bedingungen in einer schwankenden<br />
Verfassung zu befinden, in der eine Art „Konjunkturverlauf" auszumachen<br />
ist, der mit dem wirtschaftlichen Konjunkturverlauf aber keineswegs<br />
voll identisch ist, wenngleich er mit ihm in Beziehung steht. Für die Wertsphäre<br />
bedeutet dies einen Zuwachs an Instabilität <strong>und</strong> Widersprüchlichkeit,<br />
wobei insbesondere in denjenigen Phasen, in denen die Selbstentfaltungswerte<br />
Aufschwünge erleben, heftig aufflammende <strong>gesellschaftliche</strong> Konflikte<br />
erwartbar sind.<br />
Diese Vorhersage gilt nun aber nur unter der einen Bedingung, daß das<br />
gegenwärtige, ins Institutionelle verlängerte Spannungsverhältnis zwischen<br />
den Pflicht- <strong>und</strong> Akzeptanzwerten <strong>und</strong> den Selbstentfaltungswerten weiter<br />
anhält. Es muß mit Nachdruck betont werden, daß hierfür allerdings kein<br />
zwingender Gr<strong>und</strong> besteht. Synthesen zwischen den Wertpolen des Selbstzwangs<br />
<strong>und</strong> der Selbstkontrolle auf der einen <strong>und</strong> der Triebauslebung <strong>und</strong><br />
Selbstaktualisierung auf der anderen Seite waren in der Geschichte aller Gesellschaften<br />
immer wieder zu finden. Die Syntheseaufgabe stellt sich heute<br />
unter der Bedingung ausdifferenzierter <strong>und</strong> gegeneinander weitgehend autonomer<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>r Subsysteme <strong>und</strong> einer historisch erstmaligen<br />
„Entlastung" des Menschen von Fremdzwängen aufgr<strong>und</strong> von Herrschaftszugriffen<br />
<strong>und</strong> Notlagen.<br />
Die Lösung dieser Aufgabe ist nur auf gesamt<strong>gesellschaftliche</strong>r Gr<strong>und</strong>lage<br />
möglich. Weiterentwickelte Formen der Arbeit spielen hier ebenso eine<br />
Rolle wie Fragen einer neuen Ethik <strong>und</strong> einer verbesserten Gesellschaftsorganisation.<br />
Der Bildung, die in alledem bisher als eine blinde Gewalt mitwirkt,<br />
stellt sich in erster Linie die Aufgabe, „sehend" zu werden <strong>und</strong> das,<br />
was sie dann erkennt, ihrer Natur gemäß zu vermitteln. Hiermit ist nicht in<br />
erster Linie Normatives gemeint. Hellsichtigen Gesellschaftsanalysen zufolge<br />
kommt es unter den Bedingungen hochgradiger <strong>gesellschaftliche</strong>r Komplexität<br />
in besonderem Maße auf „reflektierendes Bewußtsein" an. Auf<br />
30<br />
die Bildung bezogen muß dies in erster Linie heißen: Reflexion der nichtintentionalen<br />
Wirkungen der Bildung selbst im Gesamtzusammenhang der<br />
Persönlichkeits- <strong>und</strong> Gesellschafts<strong>entwicklung</strong>. Lassen Sie mich mit der<br />
These enden, daß die Bildung nur dann, wenn sie diese Schwelle bewältigt,<br />
hoffen kann, ihren substantiellen Anspruch unter den Bedingungen der<br />
heutigen Welt einzulösen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ANMERKUNGEN<br />
1 Vgl. H. Klages: Wertorientierungen im Wandel. Rückblick, Gegenwartsanalyse, Prognosen,<br />
Frankfurt/New York 1984, S. 17 ff.<br />
2 idem, S. 17 ff.<br />
3 idem, S. 85 ff; Hinweise auf die Bedeutung von Werte-Mischungen <strong>und</strong> -Ko<strong>mb</strong>inationen<br />
finden sich auch bei W. Jaide: Wertewandel? Gr<strong>und</strong>fragen zur Diskussion,<br />
Opladen 1983, S. 31 ff.; SINUS-Institut: Die verunsicherte Generation. Jugend <strong>und</strong><br />
Wertewandel, Opladen 1983, S. 28 f.; G. Schmidtchen: Neue Technik — Neue Arbeitsmoral.<br />
Eine sozialpsy chologische Untersuchung über die Motivation in der Metallindustrie,<br />
Köln 1984, S. 62 ff.<br />
4 Vgl. hierzu F. Böltken <strong>und</strong> W. Jagodzinski: „Sek<strong>und</strong>äranalyse von Umfragedaten<br />
aus dem Zentralarchiv: Postmaterialismus in der Krise", in: Information 12 des<br />
Zentralarchivs für empirische Sozialforschung.<br />
5 Vgl. K. Klages <strong>und</strong> W. Herbert: Wertorientierung <strong>und</strong> Staatsbezug. Untersuchungen<br />
zur politischen Kultur in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland, Frankfurt/New York<br />
1983, S. 25 ff.<br />
6 Für die Wertforschung ist zu sagen, daß sie das Thema „Bildung <strong>und</strong> Wertwandel"<br />
erst in allerletzter Zeit — in verhältnismäßig seltenen Texten, die bezeichnenderweise<br />
teils noch gar nicht veröffentlicht sind — aufgreift, wobei sie von einer herkömmlicherweise<br />
vorherrschenden sozio-ökonomischen, Einflüsse sozialer Schichtung ins<br />
Zentrum rückenden, den Bildungsprozeß ausklammernden Interpretation des Begriffs<br />
„Bildungsniveau" gehemmt wird.<br />
Die Schul- <strong>und</strong> Hochschulsozialisationsforschung hatte Einflüsse des Bildungsbereichs<br />
auf die Wert- <strong>und</strong> Einstellungs<strong>entwicklung</strong> zwar bereits seit den auf die 30er<br />
Jahre zurückgehenden Bennington College-Studien von Newco<strong>mb</strong> <strong>und</strong> Mitarbeitern<br />
im Auge. Sie scheint aber gerade in letzter Zeit in starke Selbstzweifel darüber zu<br />
verfallen, ob sich die gewonnenen Einzelerkenntnisse zu einem konsistenten Gesamtbild<br />
zusammenfügen <strong>und</strong> ob überhaupt Effekte, die von <strong>gesellschaftliche</strong>n Außeneinflüssen<br />
unabhängig waren, gemessen werden konnten. Thesenhaft formuliert<br />
muß sich diese Forschungsrichtung durch die globale Frage nach dem Zusammenhang<br />
zwischen Bildung <strong>und</strong> Wertwandel überfordert fühlen, da sie von Anfang an<br />
exklusiv auf die Untersuchung von Schüler- <strong>und</strong> Studentenpopulationen abstellte,<br />
sodaß für übergreifende intersektorale Vergleiche <strong>und</strong> für die Kontrolle <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Außeneinflüsse wenig Platz war.<br />
Die Aussagefähigkeit der Jugendforschung endlich wird erstens dadurch eingeschränkt,<br />
daß die Ursachen für Wert- <strong>und</strong> Einstellungsveränderungen, auf deren Erfassung<br />
an <strong>und</strong> für sich großer Nachdruck gelegt wird, vornehmlich im Spannungsfeld<br />
zwischen Familie, Arbeit <strong>und</strong> Politik gesucht werden. Auch dort, wo Schüler<strong>und</strong><br />
Studentenpopulationen untersucht wurden, wurde der wert- <strong>und</strong> einstellungsverändernde<br />
Einfluß der Bildungsumwelt nur selten thematisiert. Es mag dies daran<br />
liegen, daß „die" Jugend schlechthin immer <strong>und</strong> überall die entscheidende Zielgruppe<br />
der Untersuchungen war <strong>und</strong> daß die Sicht nach , jugendtypischen" Einstellungen<br />
<strong>und</strong> Verhaltensweisen im Vordergr<strong>und</strong> stand. Es kam aber zweitens hinzu, daß<br />
bei dieser Suche dort, wo differenziert wurde, dem „abweichenden" Verhalten der<br />
Jugend unter Betonung jugendlicher Sub- <strong>und</strong> Gegenkulturen <strong>und</strong> jugendlichen Protestverhaltens,<br />
wie auch jugendlicher Problemgruppen wie z.B. der Arbeitslosen <strong>und</strong><br />
der Alkohol- <strong>und</strong> Drogenabhängigen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde.<br />
Es mag verständlich erscheinen, daß bei einer solchen Themenfokussierung die Beziehung<br />
zwischen Bildung <strong>und</strong> Wertwandel keine besondere Anziehungskraft zu entfalten<br />
vermochte;<br />
vgl. zur Wertforschung: R. Eckert: Selbstthematisierung <strong>und</strong> Möglichkeitshorizonte.<br />
Zur Wirklichkeitskonstruktion im Bildungssystem (unveröffentlichtes Manuskript);<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
W. Herbert/W. Sommer: „Bildungssystem <strong>und</strong> Wertwandel", in: W. Sommer u. U.A.<br />
Graf von Waldburg-Zeil (Hrsg.): Neue Perspektiven der Bildungspolitik, <strong>München</strong><br />
u.a. 1984, S. 19 ff.<br />
vgl. zur Schul- <strong>und</strong> Hochschulsozialisationsforschung: F.E. Weinert: „Schule <strong>und</strong><br />
Beruf als institutionelle Sozialisationsbedingungen", in: Handbuch der Psychologie,<br />
7. Bd., S. 825 ff.; L. Huber: „Sozialisation in der Hochschule", in: K. Hurrelmann<br />
<strong>und</strong> D. Ulrich (Hrsg.): Handbuch der Sozialisationsforschung, Weinheim <strong>und</strong> Basel<br />
1980, S. 521 ff.<br />
vgl. zur Jugendforschung: B. Hille: .Jugendsoziologische Forschung in der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland. Eine kritische Bilanz", in: ZSE (Zeitschrift f. Sozialisationsforschung<br />
<strong>und</strong> Erziehungs<strong>soziologie</strong>, Jg. 1983), S. 285 ff.; B. Schäfer: Soziologie<br />
des Jugendalters. Eine Einführung, Opladen 1982, passim.<br />
7 Vgl. neben den einschlägigen Einzelstudien z.B. die im Rahmen des Projekts „Integrationsbereitschaft<br />
der Jugend im sozialen Wandel" von K. Allerbeck u. W.J. Hoag<br />
erstellte Vergleichsstudie „16- bis 18-jährige 1962 <strong>und</strong> 1983".<br />
8 Anregungen zu den nachfolgenden Hypothesen verdanke ich vor allem den unter 6<br />
aufgeführten Arbeiten von R. Eckert <strong>und</strong> W. Herbert.<br />
9 H. Schelsky: Wandlungen der deutschen Familie in der Gegenwart. Darstellung <strong>und</strong><br />
Deutung einer empirisch-soziologischen Tatbestandsaufnahme, Stuttgart 1954, S.<br />
93 ff.<br />
10 Vgl. z.B. B.M. Olson: „Rapides Wachstum als Destabilisierungsfaktor", in: Klaus v.<br />
Beyme (Hrsg.): Empirische Revolutionsforschung, Opladen 1973: S. 205 ff.<br />
11 Vgl. hierzu schon Th. Litt: Technisches Denken <strong>und</strong> menschliche Bildung, Heidelberg<br />
1957, passim; in letzter Zeit u.a.: M. Baethge, H. Scho<strong>mb</strong>urg, U. Voskamp:<br />
Jugend <strong>und</strong> Krise — Krise aktueller Jugendforschung, Frankfurt/New York 1983, S.<br />
205 ff.<br />
12 R. Eckert: [Anm. 6].<br />
13 Wissenschaftlicher Bericht 1979-1982 der Forschungsgruppe Hochschulsozialisation<br />
im Sonderforschungsbereich 23 (Universität Konstanz), S. 60.<br />
14 K. Keniston: Young Radicals. Notes on Committed Youth, New York 1968, S.<br />
264 ff.<br />
15 Vgl. zur Schuldifferenzierung F.E. Weinert: [Anm. 6], S. 851 ff.; ein Literaturüberblick<br />
zum Thema der universitären Fachumwelt <strong>und</strong> fachspezifischen Sozialisation<br />
findet sich bei L. Huber: [Anm. 6], S. 543.<br />
16 Vgl. bezüglich der Wirkung „allgemeiner Charakteristika" <strong>und</strong> des „Klimas" von<br />
Hochschulen L. Huber: [Anm. 6J, S. 538 f.<br />
17 Vgl. H. Klages: Wertorientierungen im Wandel, [Anm. l], S. 126 ff.<br />
18 L. Huber: [Anm. 6], S. 530.<br />
19 Im selben Sinne z.B. auch N. Luhmann: Soziale Systeme. Gr<strong>und</strong>riß einer allgemeinen<br />
Theorie, Frankfurt a.M. 1984, S. 644; speziell zum Thema des „hidden curriculum":<br />
L. Huber: [Anm. 6], S. 527 f.<br />
20 A. Reble: Geschichte der Pädagogik, Stuttgart 1951, S. 13.<br />
21 M. Baethge: [Anm. Ii], S. 215 ff.<br />
22 D. Bell: Die nachindustrielle Gesellschaft, Frankfurt/New York 1975, S. 361 ff.<br />
23 B. Fritsch: Wir werden überleben. Orientierungen <strong>und</strong> Hoffnungen in schwieriger<br />
Zeit, <strong>München</strong> 1981, passim.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
BILDUNGSPROGNOSEN: SCHEITERN OHNE ENDE<br />
'AUFBRUCH ZU NEUEN UFERN'?<br />
ODER<br />
Ansgar Weymann<br />
1. Vorbemerkungen<br />
Dieser Beitrag ist ein Bericht über das PODIUMSGESPRÄCH „Prognosen<br />
im Bildungsbereich — Scheitern ohne Ende?", das zwischen Bildungspolitik<br />
<strong>und</strong> Bildungsforschung auf dem Soziologentag geführt wurde. Es stand<br />
im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe zum Thema 'Prognosen im Bildungsbereich'.<br />
An diesem Gespräch in der Westfalenhalle nahmen teil:<br />
P.H. Piazolo: Staatssekretär im B<strong>und</strong>esministerium für Bildung <strong>und</strong> Wissenschaft,<br />
B. Engholm: ehemaliger B<strong>und</strong>esbildungsminister <strong>und</strong> jetziger Vorsitzender<br />
der SPD-Fraktion in Schleswig-Holstein,<br />
U. Beck: Prof. für Soziologie an der Universität Ba<strong>mb</strong>erg,<br />
L. v. Friedeburg: ehemaliger Hessischer Kultusminister <strong>und</strong> Direktor des<br />
Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt,<br />
R. Geipel: Direktor des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung<br />
<strong>und</strong> Hochschulplanung, <strong>München</strong>,<br />
U. Teichler: Direktor des Wissenschaftlichen Zentrums für Berufs- <strong>und</strong> Hochschulforschung,<br />
Gesamthochschule Kassel,<br />
R. Wildenmann: Prof. für Politische Wissenschaft, Universität Mannheim.<br />
Ausgangspunkt des Gesprächs war eine Auseinandersetzung um Fehlschläge<br />
von Bildungsprognosen einerseits <strong>und</strong> um Fehlinterpretationen von Prognosen<br />
durch die Bildungspolitik andererseits, ein Thema, das vor allem die Öffentlichkeit<br />
unter den Stichworten Studentenberg, Lehrerbedarf <strong>und</strong> Lehrstellenmangel<br />
interessiert. Gegenstand des Gesprächs war jedoch über diesen<br />
Ausgangspunkt hinaus die Fortführung des Dialogs zwischen Bildungspolitik<br />
<strong>und</strong> Bildungsforschung unter Voraussetzungen, die gegenüber den<br />
sechziger <strong>und</strong> siebziger Jahren erheblich verändert sind. Welche Ziele <strong>und</strong><br />
Probleme sehen beide Seiten heute, wie beurteilen sie die gegenwärtigen<br />
Kooperationsmöglichkeiten <strong>und</strong> welche Perspektiven bieten sich für die Zukunft?<br />
Welche Rolle spielt nicht zuletzt die universitäre Bildungsforschung<br />
gegenüber der 'ressortnahen' <strong>und</strong> der Auftragsforschung?<br />
Dieser Bericht ist kein Protokoll. Er ist eine Zusammenfassung der wesentlichen<br />
Beiträge aus der Sicht des Verfassers auf der Gr<strong>und</strong>lage einer<br />
Tonbandaufzeichnung. Insofern sollte sich alle Kritik an diesem Bericht auf<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
dessen Verfasser richten, nicht aber auf die Podiumsteilnehmer, denen der<br />
Text nicht zu Autorisierung vorgelegen hat.<br />
2. Die Gesprächsbeiträge<br />
Staatssekretär Piazolo, der ebenso wie der ehemalige B<strong>und</strong>esbildungsminister<br />
Engholm gebeten worden war, das Gespräch mit einem Erfahrungsbericht<br />
zum Thema „Bildungsprognosen" zu eröffnen, unterscheidet drei<br />
Phasen von Politikberatung durch Bildungsprognosen:<br />
Die Situation in den sechziger Jahren ist durch ein ungetrübtes Verhältnis<br />
von Bildungspolitik <strong>und</strong> Bildungsforschung (Soziologie/Psychologie/<br />
Ökonomie) gekennzeichnet. Die Schlagworte Bürgerrecht auf Bildung,<br />
Chancengleichheit, Abbau konfessioneller Differenzen, Abbau regionaler<br />
Unterschiede des Bildungsbverhaltens, Erforschung von Bildungsübergängen,<br />
Förderung von Begabungsreserven <strong>und</strong> Bedarfsrechnungen der Wirtschaft<br />
sind noch heute jedermann vertraut. Der aus verschiedenen Untersuchungen<br />
1965 sich speisende Bedarfsplan des Landes Baden-Württe<strong>mb</strong>erg sieht bis<br />
1980 eine Jahresquote der Abiturienten von 15% vor. Die entsprechende<br />
Quote für die Mittlere Reife lautet 40%. Bereits 1975 sind diese Zahlen<br />
noch in der Umsetzungsphase des Bedarfsplans überholt.<br />
Während in den sechziger Jahren Ausgangspunkt der politischen Bedarfsplanung<br />
die empirische Analyse war, steht mit dem Bildungsgesamtplan<br />
1973 am Anfang eine politisch-normative Gr<strong>und</strong>satzentscheidung. Diese<br />
ist das Ergebnis eines politischen Kompromisses, nicht das Resultat von Bildungsforschung.<br />
Die Zielzahlen für die verschiedenen Abschlüsse sind „frei<br />
gegriffen", nicht das Ergebnis von Bedarfsprognosen oder Angebotsprognosen.<br />
Der Einfluß unabhängiger Bildungsprognosen geht in den achtziger Jahren<br />
noch weiter zurück. Das liegt nicht so sehr an den wiederholt zu niedrigen<br />
Schätzungen, als vielmehr an der sehr starken Stellung der mittlerweile<br />
aufgebauten „ressortnahen" Apparate <strong>und</strong> Forschungsinstitute. Der Bedarf<br />
an universitärer Bildungsforschung ist geringer geworden.<br />
Der Schluß aus der geänderten Rolle der (universitären) Bildungsforschung<br />
ist, daß sie sich mit den komplizierteren Parametern des Bildungsverhaltens<br />
beschäftigen sollte: mit veränderten Studienmotivationen <strong>und</strong><br />
biographischen Entwürfen, mit Reaktionen auf die Arbeitsmarktsituation,<br />
mit neuen Ko<strong>mb</strong>inationen von Ausbildungsgängen <strong>und</strong> mit durch Arbeitslosigkeit<br />
gezeichneten Problemregionen.<br />
Ebenso wie sein Vorredner unterstreicht auch Engholm, daß nach seiner<br />
Einschätzung Bildungsforschung <strong>und</strong> Bildungsberatung nicht gescheitert<br />
sind. Vielmehr hat die Bildungspolitik aus der Forschung Handlungskonsequenzen<br />
abgeleitet, für die sie selbst, nicht aber die Forschung geradestehen<br />
muß. Vor allem aber ist die wesentlich verschlechterte Wirtschafts-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
lage zu berücksichtigen, die auf Bildungsprognosen <strong>und</strong> Bildungspolitik negativ<br />
zurückschlägt.<br />
Soweit die sozialwissenschaftliche Forschung etwas zu Bildungsprognosen<br />
beisteuert, befaßt sie sich mit schwer quantifizierbaren, aber außerordentlich<br />
wichtigen Parametern. Hier sind die Berufs- <strong>und</strong> die Qualifikationsforschung<br />
zu nennen, Untersuchungen zur Unterrepräsentanz von Bevölkerungsgruppen<br />
(z.B. Frauen), Analysen zum Begabungsbegriff <strong>und</strong> zum<br />
Lernverhalten.<br />
Diese <strong>und</strong> andere Forschungsfelder haben die Bildungspolitik beeinflußt<br />
<strong>und</strong> in die richtige Richtung gedrängt. Kritik an sozialwissenschaftlichen<br />
Bildungsprognosen ist vor allem da anzubringen, wo sie zu modellhaft <strong>und</strong><br />
detaillistisch sind, zu monokausal, zu wenig interdisziplinär. Als fatal erweist<br />
sich immer wieder die Abhängigkeit von der Auftragsvergabe, ebenso aber<br />
auch der fehlende Mut der Forschung selbst, Schlußfolgerungen aus ihren<br />
Arbeiten zu ziehen <strong>und</strong> öffentlich zu vertreten. So überläßt man die Schlußfolgerungen<br />
ohne öffentliche Debatte anderen.<br />
Ebenso wie Piazolo hält auch Engholm an der Notwendigkeit sozialwissenschaftlicher<br />
Bildungsforschung <strong>und</strong> Bildungsprognosen auch für die Zukunft<br />
fest.<br />
Ludwig v. Friedeburg, der Entstehung von <strong>und</strong> Umgang mit Bildungsprognosen<br />
von beiden Seiten her kennt, drängt auf eine Unterscheidung<br />
zwischen dem wissenschaftlichen <strong>und</strong> dem politischen Zweck von Prognosen.<br />
Wissenschaftlich dienen sie einer möglichst genauen Vorhersage von<br />
mittelfristigen Entwicklungen, politisch sind sie das Material, das Argumente<br />
für normative Entscheidungen liefert. Verwaltung <strong>und</strong> Politik haben insbesondere<br />
aus quantitativen Prognosen, die überwiegend ohne Soziologen<br />
zustande gekommen sind, das jeweils „Beste" gemacht. Wie die Nutzbarkeit<br />
von Bildungsprognosen selbst innerhalb von Politik <strong>und</strong> Verwaltung<br />
variiert, zeigen die Auseinandersetzungen zwischen Finanz- <strong>und</strong> Bildungsministerien<br />
um die „richtigen" Zahlen <strong>und</strong> ihre angemessene Interpretation.<br />
Die Prognosen selbst haben eine Exaktheit vorgetäuscht, die erst mit<br />
dem Begriff des „Korridor" eingeschränkt wurde. Ihre Qualität leidet schon<br />
im Ansatzpunkt an der mangelhaften Bildungsstatistik, die häufiger aktualisiert<br />
<strong>und</strong> in ihren Indikatoren angereichert werden müßte. Die unvermeidlicherweise<br />
„gegriffenen" Parameter sollten realistisch sein <strong>und</strong> nicht dem<br />
situationsabhängigen Wunschdenken entspringen. Ganz besonders aber muß<br />
die Bildungsforschung wissen, daß qualifizierte Prognosen ohne eine intensive<br />
historische Analyse vorausgegangener Bedingungen <strong>und</strong> Entwicklungen<br />
nicht gelingen können.<br />
Was kann die Bildungspolitik eigentlich selbst tun, um nicht weiterhin<br />
falsche Parameter vorsätzlich ins Spiel zu bringen, weil sie opportun sind?<br />
Zu den zitierten „vorsätzlich" falschen Parametern der Rolle normativer<br />
Zwecksetzung <strong>und</strong> zur Rolle der „Apparate" steuert Geipel einige Beispiele<br />
aus der ressortnahen Forschung bei.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Obwohl Prognosen über Studentenzahlen <strong>und</strong> Lehrerbedarfsprognosen<br />
eigentlich am leichtesten zu erstellen sind, da die Ministerien über die einschlägigen<br />
Zahlen zum guten Teil selbst verfügen, sind diese Prognosen weder<br />
durchweg eingetroffen noch haben sie das Bildungsverhalten wesentlich<br />
beeinflussen können. Ursache ist einmal die Nichtberücksichtigung komplizierter<br />
Parameter, die sich z.B. unter dem Stichwort „Wertewandel" verbergen,<br />
<strong>und</strong> die eine qualifizierte sozialwissenschaftliche Prognose einbeziehen<br />
müßte. Dem „Studentsein" kommt heute eine andere Qualität zu, <strong>und</strong><br />
dieser Lebensabschnitt spielt im gesamten biographischen Entwurf eine andere<br />
Rolle.<br />
Neben dem „Wertewandel" <strong>und</strong> seiner Berücksichtigung in sozialwissenschaftlichen<br />
Prognosen spielen ganz andere politische Gesichtspunkte eine<br />
Rolle im Umgang mit Bildungsprognosen, die mit Bildungspolitik nichts zu<br />
tun haben. So hat beispielsweise die Regionalpolitik einen entscheidenden<br />
Einfluß auf die Standortwahl von Universitätsgründungen gehabt. Da die in<br />
die Randgebiete exportierten Ausbildungsplätze jedoch vorzugsweise zu<br />
den „preiswerten" Literaturfächern zu zählen sind, sind die Berufsaussichten<br />
der Absolventen in den ohnehin „unterentwickelten" Bezirken noch<br />
schlechter als im Durchschnitt.<br />
Probleme der Arbeitsmarkt<strong>entwicklung</strong> <strong>und</strong> Fehlschläge der Wirtschaftspolitik<br />
werden nicht selten dem Bildungswesen angerechnet, anstatt dessen<br />
unbestreitbare Erfolge zu würdigen.<br />
Wildenmann greift das mehrfach angesprochene Problem von Bildungsprognosen<br />
auf: Bildungsprognosen laufen ohne gründliche empirisch-soziologische<br />
Forschung auf ein sinnloses Tun hinaus. Selbst ein so offensichtlicher<br />
Faktor wie die Entwicklung der Geburtenraten wurde lange Zeit<br />
schlicht übersehen. Die Arbeit empirisch-soziologischer Forschung findet<br />
insgesamt nicht die Unterstützung, die sie benötigen würde. Einerseits haben<br />
spekulative Sozialwissenschaften immer noch den größeren Einfluß innerhalb<br />
der Sozialwissenschaft, andererseits sind die Sozialwissenschaften<br />
insgesamt in einem grotesken Ausmaß gegenüber der Förderung von Naturwissenschaften<br />
<strong>und</strong> Ingenieurwissenschaften diskriminiert. Dieser Übelstand<br />
vergrößert die Abhängigkeit von Auftragsforschung, deren Qualität generell<br />
zweifelhaft ist. Das Schlechteste allerdings ist die Parteienforschung samt<br />
ihren Apparaten.<br />
Es sind jedoch nicht nur die Probleme der Forschung, die zur Kritik<br />
herausfordern. Die Bildungspolitik hat nicht gesehen, daß die Bildungsexpansion<br />
nicht Chancengleichheit, sondern Chancenungleichheit vertieft hat.<br />
Sie hat die Durchsetzungsfähigkeit einer „öffentlichen" Versorgungsklasse<br />
ignoriert. Während Partizipation <strong>und</strong> Arbeiterklasse in der Bildungspolitik<br />
zitiert werden, spielt beides faktisch keine Rolle. Politiker <strong>und</strong> Parlamente<br />
sind nicht mehr zu klaren Urteilen in der Lage, da sie zu sehr mit der „Versorgungsklasse"<br />
verschwistert sind.<br />
Wildenmann fordert, das Verhältnis von Bildungspolitik <strong>und</strong> Bildungsforschung<br />
auf eine neue, unbefangene Basis zu stellen, die empirisch-analy-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
tische Forschung zu stärken, ihre Unabhängigkeit zu sichern, <strong>und</strong> die Informationssysteme<br />
zu verbessern.<br />
Beck weist darauf hin, daß das Verhältnis von Bildungspolitik <strong>und</strong> Bildungsforschung<br />
nicht erst in jüngster Zeit, sondern seit den sechziger Jahren<br />
„seine Unschuld verloren hat". Die Verknüpfung von Bildungsprognosen<br />
<strong>und</strong> Bildungspolitik geht so weit, daß veröffentlichte Bildungsprognosen<br />
sich in ihrer Wirkung wechselseitig konterkarieren. Bildungsempfehlungen<br />
<strong>und</strong> Arbeitsmarktbedarfsprognosen schließen sich wechselseitig aus. Bildung<br />
weist keine eindeutigen Chancen mehr zu, zugleich aber ist sie immer<br />
notwendiger geworden, um überhaupt noch verbliebene Chancen nutzen zu<br />
können. Einerseits wird die Forderung erhoben, den Berufsbezug der Bildung<br />
zu intensivieren, andererseits entkoppeln sich Bildung <strong>und</strong> Beschäftigungssystem<br />
zunehmend. Ob sinnvolle Prognosen heute noch möglich sind,<br />
scheint nach Lage der Dinge zweifelhaft.<br />
Teichler stimmt der Einschätzung zu, daß die klassische Rollenverteilung<br />
von Wissenschaft <strong>und</strong> Politik überholt ist, so daß sich die Bildungsforschung<br />
nach ihrer „Umsetzung in Bildungspolitik" auch nicht mehr<br />
als Sündenbock eignet. Die strikte Arbeitsteilung besteht nicht mehr<br />
durch die Professionalisierung der Politiker, durch die Existenz einer<br />
Gruppe von „Mittlern", durch die Forschungsapparate in Politik <strong>und</strong> Verwaltung.<br />
Was kann dann heute noch die Rolle von Bildungsprognosen <strong>und</strong> universitärer<br />
Bildungsforschung insgesamt sein? Ihr wächst paradoxerweise dadurch<br />
eine neue Aufgabe zu, daß die ausgebaute „Apparateforschung"<br />
zwar schnell <strong>und</strong> professionell die „Wunschzettel" der Politik abhakt, daß<br />
sie aber gerade dadurch die zu prüfenden Prämissen bereits vollständig vorab<br />
in ihre Untersuchungen aufgenommen hat. Der Hochschulforschung<br />
kann dadurch die Rolle eines „Obergutachters" zuwachsen.<br />
Die Frage ist allerdings, ob die akademische Soziologie diese Situation<br />
überhaupt sieht <strong>und</strong> bereit <strong>und</strong> in der Lage ist, die gegebenen Chancen zu<br />
nutzen. Ein neuer Dialog zwischen Wissenschaft <strong>und</strong> Ministerien ist jedenfalls<br />
fällig.<br />
Die Wirksamkeit von Bildungsprognosen ist jedoch nicht nur durch die<br />
zahlreichen schon genannten Faktoren in der Bildungsforschung <strong>und</strong> der<br />
Bildungspolitik beeinträchtigt worden, hinzuzufügen ist die Rolle der Gerichte.<br />
Das B<strong>und</strong>esverfassungsgericht hat im Prinzip den unbeschränkten<br />
Zugang zum Bildungssystem festgeschrieben <strong>und</strong> damit Planungsmöglichkeiten<br />
eingeschränkt. Soweit Zulassungsbeschränkungen noch durchgesetzt<br />
werden können, bedürfen sie einer wissenschaftlichen Untermauerung im<br />
Einzelfall. Hier liegt der zweifelhafte Wert der Korridor-Prognosen.<br />
Der neue Dialog zwischen Bildungsforschung <strong>und</strong> Bildungspolitik sollte<br />
nicht an den Apparaten vorbeigehen, sondern sie ergänzen <strong>und</strong> einbeziehen.<br />
Interessanter Gegenstand sind für die Bildungsforschung nicht die Zahlen,<br />
sondern die kritische Auseinandersetzung mit den Parametern der Modellannahmen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Piazolo beantwortet die Frage nach neuen Formen des Dialogs, nach<br />
Kooperationsmöglichkeiten zwischen Bildungsministerien <strong>und</strong> Bildungsforschung<br />
zunächst mit einem Rückgriff auf die Kritik an den normativen<br />
Setzungen im politischen Bereich. In der Auseinandersetzung um solche<br />
normativen Setzungen kann die Bildungsforschung nur eine begrenzte Rolle<br />
spielen. Diese begrenzte Chance vergibt sie sich, wenn sie ihrerseits noch<br />
falsche Bedarfsprognosen vorlegt.<br />
Andererseits ist das weite Feld qualifizierter Untersuchungen zu den<br />
wesentlichen Parametern von Prognosen noch keineswegs beackert. Zum<br />
Verhältnis von Bildung <strong>und</strong> Arbeit gilt, daß auch heute noch eine möglichst<br />
gute Qualifizierung anzustreben ist, keinesfalls die Verringerung des Bildungsniveaus.<br />
Zum Zusammenhang von Bildung <strong>und</strong> Arbeit brauchen wir<br />
jedoch heute beispielsweise biographische Untersuchungen, nicht nur Prognosen.<br />
Generell gilt, daß wir nicht weniger Informationen benötigen, sondern<br />
mehr. Die Disziplinen müssen lernen, interdisziplinär zusammenzuarbeiten.<br />
Sie müssen vor allem in ihrer Forschung ein wesentlich höheres Tempo<br />
einschlagen, damit die Forschungsergebnisse nicht von der Wirklichkeit<br />
überholt werden. Fatal ist die gegenwärtige Neigung zu rückwärts gerichteter,<br />
nur noch evaluierender Forschung, der es an Kreativität fehlt, die Perspektiven<br />
<strong>und</strong> Alternativen nicht mehr entwerfen kann.<br />
Der schnell zu befriedigende, aktuelle Beratungsbedarf darf nicht auf<br />
Kosten der Gr<strong>und</strong>lagenforschung gehen, an die jede angewandte Forschung<br />
zurückgeb<strong>und</strong>en sein muß. Die Umsetzung selbst geschieht allerdings nicht<br />
durch Berichte, sondern durch Expertengespräche, die Ausgangspunkt <strong>und</strong><br />
Endpunkt von Berichten sein können.<br />
Zu den wenig durchdachten <strong>und</strong> schon gar nicht umgesetzten alternativen<br />
Modellen der Verknüpfung von Bildung <strong>und</strong> Arbeit gehört ein lebenslanges,<br />
flexibleres Wechseln von einem Bereich in den anderen, anstelle einer<br />
überlangen Erstausbildung.<br />
Auch in Zukunft wird das B<strong>und</strong>esbildungsministerium auf keinen Fall<br />
auf Politikberatung durch universitäre Bildungsforschung verzichten, was zu<br />
einer alleinigen Angewiesenheit auf die „Apparateforschung" führen würde,<br />
der die Rückbindung an die Gr<strong>und</strong>lagenforschung abhanden kommt.<br />
Auch Engholm unterstreicht noch einmal, daß er keinen vernünftigen<br />
Gr<strong>und</strong> sieht, Bildungsprognosen <strong>und</strong> Bildungsforschung in besonderer Weise<br />
zu kritisieren. Diese Arbeiten seien im Gegenteil besser als manche anderen,<br />
z.B. Energieprognosen oder Gutachten der „Fünf Weisen". Nicht nur<br />
die Schwäche, sondern vor allem auch die Stärke sozialwissenschaftlicher<br />
Forschung liegt in der Berücksichtigung des „Faktors Mensch".<br />
Das Verhältnis von Bildung <strong>und</strong> Arbeit muß zweifellos neu definiert<br />
werden, dennoch ist generell nach wie vor eine möglichst qualifizierte Ausbildung<br />
das Leitziel. Ein neues Problem ist bei steigendem Ausbildungsniveau<br />
das Entstehen einer Gruppe von Unterqualifizierten ohne jede Chance<br />
in einem auf hohe Anforderungen ausgerichteten Beschäftigungssystem.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Ein anderer Punkt, mit dem sich die Bildungsforschung wieder mehr befassen<br />
müßte, ist das Nachdenken über Lern- <strong>und</strong> Bildungsziele für die Zukunft.<br />
Die Effizienz der Ausbildung <strong>und</strong> die kurzfristige Bedarfsdeckung<br />
können nicht die alleinige Zieldefinition sein. Sie werden immer zu kurz<br />
greifen.<br />
Neben dem Problem der Unabhängigkeit von Auftraggebern hat die Bildungsforschung<br />
ein ureigenes Problem zu lösen: sie muß aus ihren Analysen<br />
praktische Folgerungen ziehen <strong>und</strong> den Mut haben, diese auch der Öffentlichkeit,<br />
insbesondere zahllosen hochprofessionalisierten Praktikern in allen<br />
Bereichen zu unterbreiten. Es ist an der Zeit, daß die universitäre Forschung<br />
sich um einen breiten Wissenschaftstransfer bemüht, den es in diesem Lande<br />
bislang kaum gibt.<br />
3. Zusammenfassung<br />
Eine Zusammenfassung für wesentlich gehaltener Gesichtspunkte des Podiumgesprächs<br />
ist unvermeidlicherweise noch subjektiver als die Rekapitulation<br />
der Gesprächsbeiträge. Das vorangestellt, möchte ich folgende Punkte<br />
herausstreichen:<br />
3.1<br />
Angesichts der gegenwärtigen öffentlichen Diskussion um Bildungspolitik<br />
<strong>und</strong> Bildungsforschung, die sich gerade auch an Bedarfs- <strong>und</strong> Angebotsprognosen<br />
festmacht, war das Gesprächsklima bemerkenswert entspannt. Die<br />
Zusammensetzung des Kreises signalisiert meines Erachtens auch, daß Bildungsforschung<br />
<strong>und</strong> Bildungspolitik nicht 'abgedankt' haben.<br />
3.2<br />
Die Bildungsforschung hat der Bildungspolitik wesentliche Impulse gegeben.<br />
Sie hat wichtige Probleme angerissen <strong>und</strong> Perspektiven gewiesen. Es<br />
gibt keinen Gr<strong>und</strong> zu pauschaler Kritik. Auch ihre Prognosen waren besser<br />
als die auf manch anderem Gebiet. Ein Bedarf an Bildungsprognosen <strong>und</strong><br />
Bildungsforschung besteht auch in Zukunft. Es ist zudem unseriös, Bildungsprognosen,<br />
Bildungsforschung <strong>und</strong> Bildungspolitik für Entwicklungen<br />
verantwortlich zu machen, die zur Wirtschaftspolitik <strong>und</strong> zur Regionalpolitik<br />
gehören. Auch sind Handlungsbeschränkungen durch die Gerichte <strong>und</strong><br />
durch die Interessen der 'öffentlichen Versorgungsklasse' zu benennen.<br />
3.3<br />
Der massive Ausbau der 'Apparate' in Ressortforschung, ressortnaher Forschung<br />
<strong>und</strong> Auftragsforschung hat den Stellenwert der universitären For-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
schung in der unmittelbaren Beratung verringert. Da die 'Apparateforschung'<br />
jedoch zu wenig unabhängig ist, 'Verwaltungsmerkmale' zeigt, Anschluß an<br />
die Gr<strong>und</strong>lagenforschung verliert, bedarf sie einer Ergänzung durch die universitäre<br />
Forschung. Es ist allerdings die Frage, ob die Universitätsforschung,<br />
mit Selbstkasteiung beschäftigt, diese Chance sieht <strong>und</strong> zu nutzen versteht.<br />
3.4<br />
Auch in Zukunft besteht Prognosebedarf. Die Forschung muß schnell <strong>und</strong><br />
pragmatisch reagieren. Sie muß vor allem kreativ sein, Problemlösungen vorschlagen,<br />
Alternativen aufzeigen können. Sie sollte nicht 'rückwärtsgewandt'<br />
einhergehen. An neuen Themen sind biographische Studien <strong>und</strong> Lebenslaufuntersuchungen<br />
zunehmend wichtig. Das Verhältnis von Bildung <strong>und</strong> Arbeit<br />
muß neu definiert werden. Nicht eine Absenkung des Bildungsniveaus,<br />
sondern phantasievolle Modelle des lebenslangen Wechseins zwischen Bildungs-<br />
<strong>und</strong> Beschäftigungssystem (recurrent education) sind zu verfolgen.<br />
Eine verbreiterte <strong>und</strong> aktualisierte Bildungsstatistik, umfassendere Informationsflüsse<br />
sind zu verbessernde Forschungsvoraussetzungen. Komplizierte<br />
'qualitative' Untersuchungen zur historischen Entstehung von Handlungsbedingungen,<br />
zum Wertewandel, zu zukunftsorientierten Lernzielen sind<br />
notwendig.<br />
3.5<br />
Die Bildungsforschung der Universitäten braucht Unabhängigkeit. Sie ist<br />
gegenüber den Naturwissenschaften radikal benachteiligt, aber auch durch<br />
eine rein spekulative Sozialwissenschaft beeinträchtigt. Sie darf nicht überwiegend<br />
auftragsabhängig werden. Andererseits fehlt ihr selbst der Mut, aus<br />
Untersuchungen praktische Schlußfolgerungen zu ziehen, so daß sie die Folgerungen<br />
Politik <strong>und</strong> Massenmedien von vornherein überläßt. Es fehlt an einem<br />
eingespielten Wissenschaftstransfer. Normative Entscheidungen der Bildungspolitik<br />
<strong>und</strong> die Notwendigkeit von Kompromissen werden dadurch<br />
nicht aufgehoben, jedoch könnte der Einfluß der Bildungsforschung stärker<br />
sein.<br />
3.6<br />
Die Professionalisierung der Politik <strong>und</strong> die Existenz professioneller Mittler<br />
haben das „Verwendermodell" — hier Bildungsforschung, dort Bildungspolitik<br />
— obsolet gemacht. Alle Seiten zeigen sich an einem „neuen Dialog"<br />
interessiert, wobei die „terms" dieses Dialogs noch zu finden sind.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Politikberatung durch Bildungsforschung?<br />
EINLEITUNG<br />
Friedhelm<br />
Gehrmann<br />
Politiker <strong>und</strong> Ministerialbeamte betonen immer wieder die Notwendigkeit<br />
einer umfassenden <strong>und</strong> kontinuierlichen Politikberatung durch die Wissenschaft.<br />
Nach diesem — von einigen Wissenschaftlern als Lippenbekenntnis<br />
charakterisierten — Hinweis bedauern die politischen Entscheidungsträger<br />
üblicherweise, daß die Politikberatung zu sehr aus fachlich-wissenschaftlicher<br />
Sicht <strong>und</strong> zu wenig aus dem Blickwinkel von Entscheidungsträgern erfolgte.<br />
Diese Aussagen erklären sicherlich nicht allein die geringe Akzeptanz<br />
<strong>und</strong> Implementation der wissenschaftlichen Politikberatung. Jedoch muß<br />
zugegeben werden, daß einige Beratungen in einer Sprach- <strong>und</strong> Abstraktionsform<br />
erfolgen, die zum Teil nur noch von einem kleinen Spezialistenkreis<br />
lesbar sind. Die Wissenschaft ist aufgerufen, die Politikberatung im<br />
Interesse einer Implementation so abzufassen, daß die Berichte „lesbar"<br />
sind <strong>und</strong> zur Entscheidungsvorbereitung für praktische politische Programme<br />
unmittelbar herangezogen werden können.<br />
Entscheidungsträger sind daran interessiert, Handlungssicherheit im Detail<br />
bei gleichzeitiger Reduktion von Komplexität zu erhalten. Je stärker es<br />
der Wissenschaft im Rahmen der Politikberatung gelingt, wirklich implementierbare<br />
Forschungsergebnisse zu präsentieren, desto weniger können<br />
die politischen Entscheidungsträger<br />
— Vorwände zur Umgehung bzw. Verhinderung der gelieferten Vorschläge<br />
finden,<br />
— die Politikberatung zur Legitimation der ohnehin geplanten Programme<br />
„mißbrauchen" <strong>und</strong><br />
— der Politikberatung somit lediglich eine Alibi-Funktion zuweisen.<br />
Die an Implementation orientierte Wissenschaft liefert den Entscheidungsträgern<br />
jedoch nicht Handlungssicherheit im Detail unter Abnahme von<br />
Komplexität; sie führt im Gegenteil eher zu einem Anstieg an Komplexität<br />
ohne Erhöhung der Handlungssicherheit. Durch Offenlegung von Handlungsalternativen<br />
werden die Entscheidungsträger jedoch an ihre eigentliche<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Arbeit herangeführt, nämlich auf der Gr<strong>und</strong>lage wissenschaftlich aufbereiteter<br />
Alternativen politische Entscheidungen zu fällen.<br />
Vor dem Hintergr<strong>und</strong> dieser allgemeinen Problematik von Politikberatung<br />
beschäftigen sich die Verfasser der folgenden fünf Beiträge mit dem<br />
Thema „Politikberatung durch Bildungsforschung?". Der Beitrag von Meulemann<br />
kann als Gr<strong>und</strong>lagenbeitrag zum Themenbereich bezeichnet werden.<br />
Bildungsabschlüsse in modernen Industriegesellschaften sind — so Meulemann<br />
— doppeldeutig: Sie verweisen auf Qualifikationen <strong>und</strong> auf Werthaltungen.<br />
Bildungsabschlüsse bieten Lebenschancen, die sich im Beruf realisieren,<br />
<strong>und</strong> sie fordern eine Lebensführung, die sich in der Familie <strong>und</strong> in der<br />
Freizeit ausdrückt.<br />
Die Beiträge von Alex, Griesbach, Schulenberg <strong>und</strong> Zapf sind auf der<br />
Gr<strong>und</strong>lage von praktischen Erfahrungen in der Politikberatung entstanden.<br />
Wie nicht anders zu erwarten, sind die Erfahrungen bezüglich der Akzeptanz<br />
<strong>und</strong> Implementation von Politikberatung höchst unterschiedlich. Schlagwortartig<br />
<strong>und</strong> verkürzt kann dies durch folgende Zitate belegt werden:<br />
— Das besondere Mandat des B<strong>und</strong>esinstituts für Berufsbildung zur Politikberatung<br />
ist eine Herausforderung, die nicht nur das wissenschaftliche<br />
Selbstbewußtsein stärkt, sondern Mut verlangt, manchen politischen<br />
Unwillen zu ertragen (Alex).<br />
— Gelegentlich bleiben Empfehlungen bei politischen Entscheidungen unberücksichtigt.<br />
Darin sieht HIS keinen Mißerfolg; Ratschläge können von<br />
dem, der sie erbeten hat oder unerbeten erhält, befolgt werden oder<br />
nicht (Griesbach).<br />
— Ein Gutachten im Auftrag des niedersächsischen Wissenschaftsministers<br />
zum Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz spricht sich gegen<br />
die Novellierung des Gesetzes aus. Die Mehrheitsfraktion hat dennoch<br />
die beabsichtigte Novellierung durchgesetzt, der Minister hat die Argumente<br />
seines eigenen Gutachtens kaum vertreten. Eine Farce der Politikberatung<br />
durch Bildungsforschung? (Schulenberg).<br />
— Politiker sind vielbeschäftigte Leute, die in der Regel nicht um Rat fragen<br />
<strong>und</strong> sich auch nicht belehren lassen. Wie andere Führungsgruppen<br />
auch, suchen sie jedoch ständig nach Konzepten <strong>und</strong> Deutungsangeboten<br />
(Zapf).<br />
Zur Vermeidung möglicher Mißverständnisse sei betont: Diese Zitate sind<br />
nicht als Resümee der Beiträge zu interpretieren, sondern sollen lediglich die<br />
Bandbreite der Erfahrungen der Autoren in der praktischen Politikberatung<br />
kennzeichnen.<br />
Politikberatung ist sicherlich ein mühsames Geschäft; das ist eine Binsenweisheit.<br />
Empirische Sozialwissenschaftler sind aber gut beraten, wenn<br />
sie sich dieser mühsamen Herausforderung stellen <strong>und</strong> sich an der Konzeptualisierung<br />
von aktuellen gesellschaftspolitischen Problemen <strong>und</strong> Lösungsvorschlägen<br />
beteiligen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
POLITIKBERATUNG DURCH BERUFSBILDUNGSFORSCHUNG<br />
Laszlo Alex<br />
Ein wichtiges innenpolitisches Thema im Spätsommer eines jeden Jahres ist<br />
die Ausbildungsstellensituation. Fast mit gleichen Rollen, wenn auch mit<br />
unterschiedlichen Akteuren im Falle eines Regierungswechsels, wird jedes<br />
Jahr das gleiche Spektakel geboten. Arbeitgeber <strong>und</strong> Gewerkschaften vertreten<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich unterschiedliche Standpunkte. Was der eine als Erfolg<br />
bezeichnet, verbucht der andere als Mißerfolg. Wird diese Kakophonie der<br />
Stimmen durch eine ungenaue Beschreibung der Lage hervorgerufen? Zum<br />
Teil ja; zum Teil kann die subjektive Sichtweise von dergleichen Lage durchaus<br />
unterschiedlich sein. Müßte sich hier nicht die Forschung um eine Versachlichung<br />
bemühen?<br />
Das B<strong>und</strong>esinstitut für Berufsbildung hat vor Jahren umfangreiche Berechnungen<br />
zur Bestimmung der latenten Nachfrage nach Ausbildungsplätzen<br />
— die nach der Abgrenzung des Ausbildungsplatzförderungsgesetzes<br />
nicht erfaßt wird — aufgestellt. Die damalige B<strong>und</strong>esregierung empfand diese<br />
„Aufhellung der Dunkelziffer" als wenig hilfreich. Auch die jetzige B<strong>und</strong>esregierung<br />
äußerte sich ziemlich ungehalten, als im Septe<strong>mb</strong>er vorigen<br />
Jahres eine Analyse der damaligen Ausbildungsstellensituation vom B<strong>und</strong>esinstitut<br />
vorgelegt wurde. Die Motive für den politischen Unwillen waren<br />
beidesmal die gleichen: Da die Ausbildungsstellensituation seit Eintritt der<br />
geburtenstarken Jahrgänge <strong>und</strong> wegen der anhaltenden Wirtschaftsschwäche<br />
seit Jahren defizitär ist, entsteht durch eine solche Analyse ein politischer<br />
Handlungsdruck. Ein solcher Handlungsdruck ist unerwünscht, da systemkonforme<br />
Instrumente nur sehr beschränkt vorhanden sind. Ein guter Kenner<br />
der berufsbildungspolitischen Szene schrieb hierzu: „Solange die Wirtschaft<br />
sich zu ihrer Ausbildungsverpflichtung bekennt, <strong>und</strong> solange sie in<br />
einem so großen Umfange Ausbildungsplätze ohne zusätzliche Finanzierung<br />
anbietet, wird es keine parlamentarisch-politische Kraft geben, die bereit<br />
<strong>und</strong> in der Lage ist, die Finanzierung dieser Ausbildung durch Umlage<br />
oder aus dem Staatshaushalt zu regeln". 1<br />
Soll sich die Forschung bei der Lagebeschreibung abmelden? Damit sind<br />
wir mitten in unserem Thema. Politikberatung durch Forschung kann sich<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich erstrecken<br />
— auf die Konkretisierung von Zielen mit Hilfe einer genauen Diagnose<br />
der Lage — wobei sich die Diagnose keineswegs nur auf den Ausbildungsstellenmarkt,<br />
sondern auch auf die Qualitätslage (Inhalt <strong>und</strong> Vermittlung<br />
der Ausbildung) erstreckt — <strong>und</strong> einer Status-quo-Prognose („was<br />
geschieht, wenn nichts passiert") <strong>und</strong><br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
— auf die Überprüfung bzw. Entwicklung eines Handlungsprogramms mit<br />
dessen Hilfe die gegenwärtige Lage in eine „Ziellage" überführt wird.<br />
Diese Funktionen gelten auch für die Berufsbildungsforschung. Ohne diagnostische<br />
<strong>und</strong> prognostische Informationen ist eine rationale Berufsbildungspolitik<br />
nicht möglich.<br />
Die Berufsbildung umfaßt die Bereiche: Berufsausbildung (Erstausbildung)<br />
<strong>und</strong> Weiterbildung (berufliche Fortbildung <strong>und</strong> Umschulung). Die<br />
staatlichen Aktivitäten beschränken sich vorwiegend auf den Bereich der<br />
Berufsausbildung, der auch Gegenstand der folgenden Ausführungen ist.<br />
Das Kernstück des deutschen Berufsausbildungssystems ist die duale<br />
Ausbildung, d.h. also Ausbildung in einem Betrieb verb<strong>und</strong>en mit dem Besuch<br />
einer Teilzeitberufsschule. Die Wesenszüge des Systems sind die eigenverantwortliche<br />
Durchführung <strong>und</strong> Finanzierung der Ausbildung durch die<br />
Betriebe. Auf dem Ausbildungsstellenmarkt (ein Teilbereich des umfangreicheren<br />
'Berufsbildungsmarktes') bieten private <strong>und</strong> öffentliche Betriebe<br />
Ausbildungsplätze an. Das Ausbildungsverhältnis wird mit dem Abschluß<br />
eines privatrechtlichen Vertrages zwischen dem Jugendlichen <strong>und</strong> dem Betrieb<br />
begründet. Im Gegensatz zur schulischen Ausbildung ist die betriebliche<br />
Ausbildung privatwirtschaftlich organisiert <strong>und</strong> 'marktwirtschaftlich'<br />
gesteuert: Die quantitative Steuerung erfolgt durch „Kräfte des Marktes"<br />
zwischen Bewerbern <strong>und</strong> Betrieben, die qualitative Steuerung im wesentlichen<br />
durch Absprachen zwischen Arbeitgebern <strong>und</strong> Gewerkschaften, die<br />
staatlich — durch rechtsverbindliche Ausbildungsordnungen — sanktioniert<br />
werden. In diesem von wirtschaftsliberaler Tradition geprägten System sind<br />
die Möglichkeiten des staatlichen Einflusses vorwiegend indirekter Art. Sie<br />
beschränkten sich bis in die 70er Jahre vorwiegend auf die Verbesserung der<br />
Ausbildungsqualität. So nennt die B<strong>und</strong>esregierung im Jahre 1973 als wichtigste<br />
Ziele der Berufsausbildungspolitik:<br />
• „die Systematisierung <strong>und</strong> Pädagogisierung der betrieblichen Ausbildung,<br />
• die curriculare Abstimmung der Ausbildung zwischen der Berufsschule<br />
<strong>und</strong> der betrieblichen Ausbildung,<br />
• die Umgestaltung des ersten Jahres der Berufsausbildung zu einem Berufsgr<strong>und</strong>bildungsjahr,<br />
• die Ergänzung <strong>und</strong> Verbesserung der betriebsbedingten unterschiedlichen<br />
Ausbildungsleistungen der Ausbildungsbetriebe,<br />
• die Erweiterung des Ausbildungsangebots in strukturschwachen Regionen<br />
<strong>und</strong> im Zonenrandgebiet,<br />
• die Förderung der Integration beruflicher <strong>und</strong> allgemeiner Bildung<br />
durch Abstimmung, Verzahnung <strong>und</strong> Verflechtung der Bildungsgänge<br />
in einem Bildungssystem." 2<br />
Auch bei den Beschlüssen zur beruflichen Bildung des im Jahre 1973 verabschiedeten<br />
Bildungsgesamtplanes beschränkte man sich auf die Betonung<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
der bereits durch das Berufsbildungsgesetz 1969 verabschiedeten Gr<strong>und</strong>sätze<br />
zur Qualitätsverbesserung. Quantitative Zielvorstellungen fanden Eingang<br />
nur für drei Bereiche: für die berufliche Gr<strong>und</strong>bildung einschließlich Berufsvorbereitung,<br />
für den Ausbau der überbetrieblichen Ausbildungsstätten <strong>und</strong><br />
für die den betrieblichen Bereich ergänzenden Teilzeitberufsschulen.<br />
Die damalige Vorrangstellung des Qualitätsaspektes in der Berufsbildungspolitik<br />
entsprach nicht nur der — auch heute bestehenden — mangelnden<br />
Möglichkeit zur direkten Kapazitätssteuerung, sondern auch dem geringen<br />
quantitativen Problemdruck: Bis Anfang der 70er Jahre gab es auf<br />
dem Ausbildungsstellenmarkt einen erheblichen Angebotsüberschuß.<br />
Wie die Berufsbildungspolitik selbst, hat auch die Berufsbildungsforschung<br />
erst Ende der 60er Jahre an Konturen gewonnen. „Bildung <strong>und</strong> Beruf<br />
sind zwar schon Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung <strong>und</strong> Forschung.<br />
Erst seit einigen Jahren — so die zutreffende Feststellung des B<strong>und</strong>estags-Ausschusses<br />
für Arbeit bei den Erläuterungen zum Entwurf des Berufsbildungsgesetzes<br />
— hat sich aber die vorwiegend empirisch begründete<br />
3<br />
Erforschung dieser Erscheinungen unter der Bezeichnung Berufsbildungsforschung<br />
durchgesetzt."<br />
Das Hauptgewicht der Forschungsaktivitäten als Gr<strong>und</strong>lage für die Berufsbildungspolitik<br />
lag bis Anfang der 70er Jahre auf der Diagnose der Qualitätslage<br />
<strong>und</strong> auf Maßnahmen zu ihrer Verbesserung.<br />
An erster Stelle sind hier die Arbeiten des Deutschen Bildungsrates von<br />
1965 bis 1975 zu nennen, die sich auf mehr als 50 wissenschaftliche Gutachten<br />
<strong>und</strong> Studien stützten. In den Empfehlungen: „Zur Verbesserung der<br />
Lehrlingsausbildung" (1969), „Strukturplan für das Bildungswesen" (1970)<br />
<strong>und</strong> „Zur Neuordnung der Sek<strong>und</strong>arstufe II" (1974) wurden, gestützt auf<br />
wissenschaftliche Vorarbeiten, wichtige Aussagen zur Lage <strong>und</strong> Verbesserung<br />
der beruflichen Bildung gemacht. Sie bezogen sich auf die Lernprozesse <strong>und</strong><br />
ihre Optimierung an allen Lernorten („Pluralität der Lernorte" galt seit je<br />
als Bestandteil der Berufsbildungspolitik).<br />
Bei den Lernzielen <strong>und</strong> -inhalten ging es um die Neubestimmung der<br />
Lehr- <strong>und</strong> Ausbildungspläne, einer auf einer breiten Gr<strong>und</strong>bildung aufbauenden<br />
beruflichen Sozialisation in allen Berufen sowie um die curriculare<br />
Verzahnung von allgemeiner <strong>und</strong> beruflicher Bildung im Sek<strong>und</strong>arbereich<br />
II.<br />
Auf dem Gebiet der Curriculumforschung lagen auch die Arbeitsschwerpunkte<br />
des im Jahre 1970 gegründeten B<strong>und</strong>esinstitutes für Berufsbildungsforschung<br />
(BBF). Auf diesem Feld sind Forschung <strong>und</strong> Politik engstens miteinander<br />
verb<strong>und</strong>en, wobei zu den politisch Handelnden auch — bei Ordnungsarbeiten<br />
sogar in erster Linie — die Arbeitnehmer- <strong>und</strong> Arbeitgeberorganisationen<br />
gehören. Die Entwicklung einer neuen Ausbildungsordnung,<br />
bis sie als Rechtsverordnung erlassen wird, ist ein mehrjähriger Prozeß, in<br />
dem das B<strong>und</strong>esinstitut eine permanente Beratungsaufgabe wahrnimmt.<br />
4<br />
Dem gemeinsamen Bemühen aller Beteiligten im B<strong>und</strong>esinstitut ist es zu<br />
verdanken, daß die Zahl der anerkannten Ausbildungsberufe von 627 Anfang<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
der 70er Jahre auf zur Zeit 434 reduziert wurde, daß zur gleichen Zeit (bis<br />
Sommer 1984) 154 Ausbildungsordnungen für 190 Ausbildungsberufe mit<br />
ca. 900.000 Auszubildenden (53%) erlassen worden sind.<br />
In diesen Zahlen kommt eindrucksvoll das Bestreben nach Rationalisierung<br />
<strong>und</strong> Qualitätssicherung der Berufsausbildung seit Beginn der 70er Jahre<br />
zum Ausdruck.<br />
Neben den steigenden Aktivitäten im Bereich der Gurriculumforschung<br />
datieren auch die ersten repräsentativen Untersuchungen über die Lage der<br />
Auszubildenden, über den Ausbildungsvollzug in Betrieb <strong>und</strong> Schule vom Beginn<br />
der 70er Jahre (Heinen et al. 1972, Alex et al. 1973, Crusius et al. 1973).<br />
Bei der Auseinandersetzung über die Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates<br />
zur Lehrlingsausbildung, bei den Arbeiten der B<strong>und</strong>-Länder-<br />
Kommission für Bildungsplanung zur Erstellung eines Bildungsgesamtplanes<br />
(vom Juni 1970 bis Juni 1972) war man sich der unbefriedigenden Datenlage<br />
ständig bewußt. Man sah, wie auch bei anderen Refor<strong>mb</strong>emühungen<br />
in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, daß eine wirksame Abhilfe nur<br />
durch den konsequenten Ausbau der Forschung <strong>und</strong> Statistik erzielt werden<br />
konnte. Die Gründung von Bildungsforschungsinstituten in den Ländern<br />
datiert vorwiegend aus dieser Zeit.<br />
Es ist auch kein Zufall, daß in den beiden bedeutsamen Reformgesetzen<br />
des Jahres 1969, in dem Arbeitsförderungsgesetz <strong>und</strong> in dem Berufsbildungsgesetz<br />
die 'institutionalisierte' Arbeitsmarkt- <strong>und</strong> Berufsbildungsforschung<br />
fester Bestandteil der Maßnahme wurde. So wurde mit der Gründung<br />
des B<strong>und</strong>esinstitutes für Berufsbildungsforschung (§ 60 Berufsbildungsgesetz)<br />
anerkannt, daß für die künftige Gestaltung der beruflichen<br />
Bildung, für ihre Anpassung an technische, wirtschaftliche <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Entwicklungen umfassende Informations- <strong>und</strong> Dokumentationssysteme<br />
verb<strong>und</strong>en mit wissenschaftlichen Analysen <strong>und</strong> Prognosen erforderlich<br />
sind (für die Aufgaben des Institutes für Arbeitsmarkt- <strong>und</strong> Berufsforschung<br />
der B<strong>und</strong>esanstalt für Arbeit gelten nach § 6 AFG analoge Bestimmungen).<br />
Ein kurzer Rückblick auf die Vorgeschichte des BBF ist für die Entstehung<br />
der Politikberatungsaufgaben aufschlußreich.<br />
Bereits im Jahre 1966 wurde im Auftrag des Arbeitssenators in Berlin<br />
ein Gutachten der Professoren Blankertz, Ciaessens <strong>und</strong> Edding für die Errichtung<br />
eines Berufsbildungsforschungsinstitutes erstellt. Wichtigste Aufgabe<br />
des Institutes sollte eine fachwissenschaftliche Clearingfunktion sein.<br />
5<br />
Daneben sollten durch Mittler- <strong>und</strong> Experimentierfunktionen die Verbindungen<br />
zur Verwaltung <strong>und</strong> Berufsbildungspraxis aufrechterhalten <strong>und</strong> erweitert<br />
werden. In der Folgezeit wurden die Forschungsfelder für eine Institutsgründung<br />
konkretisiert, die Forschung zur Vorbereitung von Ausbildungsordnungen<br />
gewann eine zunehmende Bedeutung. Die Aufgaben des<br />
nach § 60 Berufsbildungsgesetz gegründeten B<strong>und</strong>esinstitutes für Berufsbildungsforschung<br />
gehen über den von Blankertz-Claessens-Edding genannten<br />
Rahmen hinaus. Als Aufgaben des Institutes sind in den Erläuterungen<br />
des B<strong>und</strong>estags-Ausschusses für Arbeit genannt worden:<br />
6<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
1. Forschungsfunktion (Gr<strong>und</strong>lagenforschung)<br />
2. Forschungsaufgabe mit dem Ziel der Politikberatung<br />
3. Informations- <strong>und</strong> Dokumentationsfunktion<br />
Die Politikberatungsfunktion des BBF ist im Gesetz nicht expressis verbis<br />
genannt worden (s. unten: Ausbildungsplatzförderungsgesetz). Sie wird<br />
aber in den Erläuterungen des B<strong>und</strong>estags-Ausschusses für Arbeit deutlich<br />
herausgestellt. Als konkrete Forschungsarbeiten im Bereich der Politikberatung<br />
werden aufgeführt:<br />
1. Untersuchungen zur materiellen Vorbereitung der Ausbildungsordnungen,<br />
2. Untersuchungen der Berufsbildungsinstitutionen,<br />
3. Untersuchungen zu bildungsökonomischen Problemen (Kosten-Nutzen-<br />
Analysen) einschließlich der Finanzierungsaspekte der beruflichen Bildung.<br />
Wie bereits erwähnt, lagen die Schwerpunkte der Institutsarbeit aus der<br />
„Gründungszeit" zu Beginn der 70er Jahre in der Erforschung curricularer<br />
Gr<strong>und</strong>satzfragen <strong>und</strong> der Entwicklung von Gr<strong>und</strong>lagen für die Ordnungsarbeit.<br />
Neben diesen, mehr auf mittlere Sicht gerichteten Fördermaßnahmen<br />
der Berufsausbildungsforschung, verlangten die Fraktionen der SPD <strong>und</strong><br />
FDP im Frühsommer 1970 die Einsetzung einer Kommission unabhängiger<br />
Sachverständiger zur Verbesserung der Entscheidungsgr<strong>und</strong>lagen auf<br />
7<br />
dem Gebiet der außerschulischen beruflichen Bildung. Die Kommission,<br />
die unter dem Namen ihres Vorsitzenden, Prof. Dr. F. Edding, bekannt<br />
wurde, nahm ihre Arbeit im April 1971 auf <strong>und</strong> legte ihren Abschlußbericht<br />
Anfang 1974 vor. Die bildungspolitische Bedeutung der Forschungsarbeiten<br />
der Edding-Kommission ist beträchtlich. Es liegen erstmalig repräsentative<br />
Daten über die Kosten der außerschulischen Berufsbildung vor. Es<br />
werden erstmalig ausführliche statistische Qualitätsanalysen durchgeführt.<br />
Die statistischen Daten machen die Reformvorschläge „berechenbar". Seit<br />
Vorliegen des Berichtes verstummen schließlich nicht mehr die Stimmen,<br />
die eine auf alle Betriebe sich erstreckende Umlagefinanzierung der Berufsausbildung<br />
verlangen. So hat erst kürzlich (dpa vom 23.08.1984) der bildungspolitische<br />
Sprecher der CDU/CSU-B<strong>und</strong>estagsfraktion erklärt: „Die<br />
Ausbildungsleistungen der Groß- <strong>und</strong> Mittelbetriebe sind nach wie vor völlig<br />
unbefriedigend. Wenn sich das nicht in Kürze ändert, geraten wir immer<br />
mehr unter politischen Druck, die Ausbildung über eine betriebliche Umlage<br />
zu finanzieren".<br />
Mit diesem Zitat ist der Sprung vom Anfang der 70er Jahre bis zur Gegenwart<br />
zu groß, dennoch für die Dialektik der Problemlage sehr bezeichnend.<br />
Seit Mitte der 70er Jahre gerieten die Qualitätsfragen allmählich in<br />
den Hintergr<strong>und</strong>. Zwar wird die Überarbeitung von Lerninhalten <strong>und</strong> -plänen,<br />
die Durchführung von Modellversuchen für die Erprobung der Umsetzbarkeit<br />
neuer Ausbildungsgänge, -konzeptionen, -methoden bildungs-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
politisch weiterhin für wichtig erachtet, quantitative Probleme infolge der<br />
geburtenstarken Jahrgänge schieben sich aber zunehmend in den Vordergr<strong>und</strong>.<br />
Der Ausbildungsstellenmarkt als zentraler Forschungsgegenstand trat<br />
in Erscheinung. Die Politikberatungsfunktion der Berufsbildungsforschung<br />
gewann eine neue Dimension. Das im Jahr 1976 verabschiedete Ausbildungsplatzförderungsgesetz<br />
gab hierfür entscheidende Impulse. Das nach<br />
bewegten bildungspolitischen Auseinandersetzungen am 1. Septe<strong>mb</strong>er 1976<br />
in Kraft getretene Ausbildungsplatzförderungsgesetz enthält drei wichtige<br />
Bestimmungen:<br />
— Eine Finanzierungsregelung im Bedarfsfalle, wenn keine ausreichende<br />
Deckung der Ausbildungsplatznachfrage durch das Ausbildungsplatzangebot<br />
möglich erscheint,<br />
— die Einführung einer Berufsbildungsstatistik <strong>und</strong> eines jährlichen Berufsbildungsberichtes<br />
zum Zwecke der vorausschauenden Berufsbildungsplanung<br />
<strong>und</strong><br />
— die Errichtung des B<strong>und</strong>esinstitutes für Berufsbildung. „Durch das<br />
B<strong>und</strong>esinstitut für Berufsbildung (BIBB), in dem das bisherige B<strong>und</strong>esinstitut<br />
für Berufsbildungsforschung (BBF) aufgegangen ist, erhält die<br />
berufliche Bildung endlich eine 'gemeinsame Adresse', bei der die anstehenden<br />
Aufgaben koordiniert <strong>und</strong> möglichst effektiv gelöst werden:<br />
B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Länder, Staat <strong>und</strong> Wirtschaft, Arbeitgeber <strong>und</strong> Arbeitnehmer,<br />
Berufsbildungspraxis <strong>und</strong> Berufsbildungsforschung arbeiten unter<br />
einem Dach zusammen". Mit dem Ausbildungsplatzförderungsgesetz<br />
8<br />
ist ein qualitativer Sprung in der Beziehung zwischen Politik <strong>und</strong> Berufsbildungsforschung<br />
eingetreten. Die Beratungsfunktion gilt nunmehr<br />
als gesetzliche Aufgabe des Institutes (§14 Abs. 2 Ziff. 3).<br />
Die Beratungsfunktion wird entweder direkt durch das Organ Generalsekretär<br />
oder durch den Hauptausschuß des Instituts, in dem paritätisch Arbeitnehmer,<br />
Arbeitgeber, B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Länder vertreten sind, wahrgenommen.<br />
Der Hauptausschuß beschließt auch das Forschungsprogramm des Institutes,<br />
was dem fruchtbaren Dialog zwischen Forschung <strong>und</strong> bildungspolitisch<br />
Handelnden Rechnung trägt. Besteht aber hierdurch nicht doch die Gefahr<br />
einer politischen Beeinflussung der Forschungsarbeit? Die paritätische Besetzung<br />
des Hauptausschusses schließt eine einseitige Einflußnahme aus.<br />
Auf der anderen Seite ist jedoch nicht zu verkennen, daß die im demokratischen<br />
Meinungsbildungsprozeß so bewährte Kompromißfindung oft nur<br />
auf der Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners erfolgt. Davon sind im<br />
B<strong>und</strong>esinstitut nicht viele, aber manche sozialwissenschaftlichen Forschungsvorhaben<br />
betroffen.<br />
Die Verabschiedung des Ausbildungsplatzförderungsgesetzes wurde zugleich<br />
zur St<strong>und</strong>e der statistischen 'Planungsforschung' im BIBB, die von<br />
nun an neben die weiterbestehenden früheren Aufgaben des BBF auf dem<br />
Felde der Qualifikationsforschung, der Curriculum- <strong>und</strong> Medien<strong>entwicklung</strong><br />
trat. Die sehr umfangreichen Beratungsfunktionen des BIBB in den<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
zuletzt genannten Gebieten, die Erstellung von Aus- <strong>und</strong> Fortbildungsordnungen<br />
im Vorfelde der politischen Sanktionierung, die Betreuung von<br />
Modellversuchen bilden nach wie vor Schwerpunkte der Institutsarbeit.<br />
So ist gerade vor kurzem mit der Durchführung der umfangreichen vom<br />
B<strong>und</strong>esministerium für Bildung <strong>und</strong> Wissenschaft geförderten Modellreihe<br />
„Neue Technologien in der beruflichen Bildung" im B<strong>und</strong>esinstitut begonnen<br />
worden. Dem Institut obliegt die inhaltliche Vorbereitung <strong>und</strong> die fachliche<br />
Betreuung des Modellversuchsprogramms.<br />
Das neue Aufgabenfeld des Institutes, die 'Planungsforschung' ist durch<br />
§ 5 Abs. 1 <strong>und</strong> 2, des AP1FG bzw. durch den identischen Wortlaut bei seinem<br />
Rechtsnachfolger im Berufsbildungsförderungsgesetz (BerBiFG) im<br />
§ 2 Abs. 1 <strong>und</strong> 2 beschrieben. Dabei wird der spezifische Datenbedarf im Absatz<br />
2 umrissen:<br />
„Die Berufsbildungsplanung hat insbesondere dazu beizutragen, daß die Ausbildungsstätten<br />
nach Art, Zahl, Größe <strong>und</strong> Standard ein qualitativ <strong>und</strong> quantitativ ausreichendes<br />
Angebot an beruflichen Ausbildungsplätzen gewährleisten <strong>und</strong> daß sie unter Berücksichtigung<br />
der voraussehbaren Nachfrage <strong>und</strong> des langfristig zu erwartenden Bedarfs an Ausbildungsplätzen<br />
möglichst günstig genutzt werden."<br />
Es wurde bereits erwähnt, daß wegen der marktwirtschaftlichen Konditionierung<br />
des Ausbildungsgeschehens die staatliche Einflußnahme überwiegend<br />
indirekt 9 , über die Beeinflussung des Verhaltens der 'Marktparteien'<br />
geschieht. So vor allem durch<br />
— Veränderung der Zugangsvoraussetzung zum Ausbildungsstellenmarkt (Eignungsvoraussetzungen<br />
für Ausbildungsstätten <strong>und</strong> -personal);<br />
— Maßnahmen in anderen Bereichen des Bildungswesens wie z.B. obligatorischer Besuch<br />
des Berufsgr<strong>und</strong>bildungsjahres als erste Ausbildungsstufe, numerus clausus<br />
an Fach- <strong>und</strong> Hochschulen;<br />
— Veränderung der finanziellen Hilfe des Staates. Man denke hier an die durch die<br />
Bafög-Streichung „induzierte" Nachfragesteigerung nach betrieblichen Ausbildungsplätzen<br />
<strong>und</strong><br />
— Gewinnung <strong>und</strong> Verbreitung von Informationen zur Erhöhung der 'Markttransparenz'.<br />
So unterschiedlich diese Instrumente im einzelnen auch sind, allen gemeinsam<br />
ist ihr Bedarf an empirischen Daten <strong>und</strong> Informationen über die Entwicklungstendenzen<br />
des Ausbildungsstellenmarktes <strong>und</strong> über ihre Bestimmungsfaktoren.<br />
Das ist das Gebiet der 'Planungsforschung'. 'Planungsforschung'<br />
ist folglich immer eine Art Prognoseforschung. Auf der 'Nachfrageseite'<br />
sind einerseits die verschiedenen Ausbildungswege, die Übergänge von<br />
Schule zu Schule <strong>und</strong> in die Berufsausbildung bzw. in den Beruf zu erfassen,<br />
andererseits die wechselseitige Bedingtheit der Bildungsverläufe vor<br />
dem Hintergr<strong>und</strong> von sozioökonomischen Merkmalen, wie z.B. Herkunft,<br />
Geschlecht, Region zu analysieren. Auf der Seite des Angebotes von Ausbildungsplätzen<br />
müssen die wirtschaftlichen, technologischen <strong>und</strong> sozioökonomischen<br />
Einflußgrößen wie Branche, Betriebsgröße, Fachkräfteeinsatz,<br />
Rekrutierungsmöglichkeiten von Auszubildenden <strong>und</strong> Facharbeitern <strong>und</strong><br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
dergleichen systematisch erfaßt <strong>und</strong> die Sensitivität des Angebotes bezüglich<br />
dieser Faktoren getestet werden.<br />
Bevor einiges zu den speziellen Arbeitsgebieten <strong>und</strong> Ergebnissen des soeben<br />
genannten Forschungsfeldes gesagt wird, soll für das allgemeine Verständnis<br />
eine kurze Erläuterung zu den Rechtsgr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong>, z.T. davon<br />
abgeleitet, zu der Frage erfolgen, wie sich der Transfer der Forschungsergebnisse<br />
in die Politik, der Prozeß der Politikberatung vollzieht.<br />
Das Ausbildungsplatzförderungsgesetz ist nach vier Jahren am 10.12.1980 vom B<strong>und</strong>esverfassungsgericht<br />
für nichtig erklärt worden, weil einige verwaltungstechnische Vorschriften<br />
des Gesetzes die Zustimmung des B<strong>und</strong>esrates benötigt hätten. (Das Gesetz<br />
war dagegen 1976 vom Parlament als ein vom B<strong>und</strong>esrat nicht zustimmungsbedürftiges<br />
Gesetz verabschiedet worden). Um die entstandenen Lücken <strong>und</strong> die Rechtsunsicherheit<br />
auf dem Gebiet der Planung, Forschung <strong>und</strong> Statistik zu beheben, brachte die B<strong>und</strong>esregierung<br />
im Januar 1981 den Entwurf des Berufsbildungsförderungsgesetzes im Parlament<br />
ein, das am 1.1.1982 in Kraft trat. Das neue Gesetz hat die Teile Planung, Statistik<br />
sowie das B<strong>und</strong>esinstitut für Berufsbildung des AP1FG übernommen; die vormalige Finanzierungsregelung<br />
ist entfallen.<br />
Ein zentrales Planungsinstrument des alten <strong>und</strong> des neuen Gesetzes ist der<br />
jährliche Berufsbildungsbericht. Berufsbildungsplanung in einem System<br />
von Freiheit der Berufswahl <strong>und</strong> marktwirtschaftlicher Steuerung des Ausbildungsgeschehens<br />
hat die Aufgabe durch „ein umfassendes <strong>und</strong> differenziertes<br />
Informationssystem Entwicklungstendenzen <strong>und</strong> mögliche Konflikte<br />
auf dem Berufsbildungs- <strong>und</strong> Arbeitsmarkt zu verdeutlichen, Strategien<br />
gegen unerwünschte Entwicklungen zu erstellen <strong>und</strong> sie mit Hilfe eines Kommunikationsnetzes<br />
in verhaltensändernde Impulse/Aktionen umzusetzen". 10<br />
Das Kommunikationsnetz in Form eines Systems von Ausschüssen ist<br />
bereits durch das Berufsbildungsgesetz (1969) geschaffen worden. Auf der<br />
Gr<strong>und</strong>lage des Gesetzes sind Ausschüsse mit Beratungs- <strong>und</strong> Beschlußrechten<br />
auf B<strong>und</strong>es-, Landes- <strong>und</strong> lokaler Ebene errichtet worden, die mit Vertretern<br />
des Staates, der Arbeitgeber <strong>und</strong> der Gewerkschaften paritätisch besetzt<br />
sind. Dieses System besteht mit geringfügiger Änderung bis heute; das<br />
frühere Beratungsorgan des B<strong>und</strong>es, der B<strong>und</strong>esausschuß für Berufsbildung,<br />
ist durch den Hauptausschuß des BIBB abgelöst worden. Im Hauptausschuß<br />
sind mit jeweils 11 Stimmen die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer, die B<strong>und</strong>esregierung<br />
<strong>und</strong> die Länder vertreten.<br />
Der Berufsbildungsbericht des B<strong>und</strong>es, in dem über die Entwicklung der<br />
Ausbildungsstellensituation <strong>und</strong> weitere wichtige inhaltliche <strong>und</strong> strukturelle<br />
Veränderungen der beruflichen Bildung berichtet wird, hat vor allem Informationsfunktion.<br />
Beides zusammen, Ausschußsystem <strong>und</strong> Informationsfunktion<br />
des Berufsbildungsberichtes (in der letzten Zeit auch zunehmend<br />
Länder-Berufsbildungsberichte) charakterisieren den auf Informationsverbreitung<br />
(„Mobilisierungs- <strong>und</strong> Konsensfindungsfunktion") angelegten Planungsprozeß.<br />
Die 'Planungsforschung' des BIBB ist integrierter Bestandteil dieses Planungsprozesses.<br />
Das B<strong>und</strong>esinstitut hat den gesetzlichen Auftrag (§ 6 Abs.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
2 Ziff. lb BerBiFG), bei der Erstellung des jährlichen Berufsbildungsberichtes<br />
mitzuwirken (s.o.) <strong>und</strong> im Rahmen dieser Mitwirkung die für die Beurteilung<br />
der Ausbildungsstellenlage notwendigen diagnostischen <strong>und</strong> prognostischen<br />
Informationen beizusteuern.<br />
Vier Forschungsgebiete sind daraus hervorgegangen:<br />
a) Untersuchung über die Bildungs- <strong>und</strong> Ausbildungswege von Schulabgängern,<br />
insbesondere aus beruflichen Schulen;<br />
b) Analyse des betrieblichen Ausbildungsverhaltens, der Flexibilität der<br />
unternehmerischen Ausbildungsplanung;<br />
c) Entwicklung <strong>und</strong> Test von Modellen für die Vorausschau auf den Ausbildungsstellenmarkt,<br />
<strong>und</strong> schließlich<br />
d) Analyse der Entwicklungstendenzen in Regionen sowie Darstellung ihrer<br />
spezifischen Probleme.<br />
Es ist hier kein Platz, die Ergebnisse der Planungsforschung zu diskutieren;<br />
der Hinweis auf den jährlichen Berufsbildungsbericht, in den diese Eingang<br />
finden, <strong>und</strong> einige „Schlagworte" aus Debatten über die Dunkelziffer/Altnachfrage,<br />
regionale Berufsbildungsbilanz, vollzeitschulische Schleifenwege,<br />
Doppelqualifizierungsstrategie von Abiturienten mögen hier genügen. Die<br />
eingangs erwähnten „Fallbeispiele" zeigen, daß die politische Beratung<br />
nicht immer zur Freude des zu Beratenden ausfällt.<br />
Das Thema meines Referates heißt Politikberatung <strong>und</strong> Berufsbildungsforschung.<br />
Ich habe dieses Thema in nicht geringem Maße auf das B<strong>und</strong>esinstitut<br />
für Berufsbildung <strong>und</strong> seine Forschungstätigkeit beschränkt <strong>und</strong> es<br />
damit sicherlich etwas eingeengt. Auf der anderen Seite ist nirgendwo in der<br />
deutschen Forschungslandschaft Forschung <strong>und</strong> Politik so eng aufeinander<br />
bezogen wie im B<strong>und</strong>esinstitut. Das besondere Mandat des B<strong>und</strong>esinstitutes<br />
zur Politikberatung ist eine Herausforderung, die nicht nur das wissenschaftliche<br />
Selbstbewußtsein stärkt, sondern Mut verlangt, manchen politischen<br />
Unwillen zu ertragen.<br />
ANMERKUNGEN<br />
1 Lemke, H.: „Steuerung des Ausbildungsangebotes durch den B<strong>und</strong>", in: Recht<br />
der Jugend <strong>und</strong> des Bildungswesens, Heft 6, 1983, S. 420.<br />
2 Aus: „Richtlinien des B<strong>und</strong>esministers für Bildung <strong>und</strong> Wissenschaft zur Förderung<br />
von überbetrieblichen Ausbildungsstätten vom 19. Septe<strong>mb</strong>er 1973" (B<strong>und</strong>esanzeiger<br />
Nr. 211 vom 9. Nove<strong>mb</strong>er 1973 i.d.F. vom 30. Nove<strong>mb</strong>er 1979).<br />
3 Deutscher B<strong>und</strong>estag, 5. Wahlperiode Drucksache V/4260 S. 21.<br />
4 Vgl. Benner, H.: „Ordnung der staatlich anerkannten Ausbildungsberufe", BIBB<br />
(Hrsg.), Berichte zur beruflichen Bildung Heft 48, 1982.<br />
5 Blankertz, H., Ciaessens, D., Edding, F.: Gutachten zur Frage der Gründung eines<br />
Forschungsinstitutes für Berufsbildung, Berlin 1966.<br />
6 [Anm. 13] Drucksache V/4260 S. 21 ff.<br />
7 6.4.1970, Drucksache VI/741.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
8 Jahresbericht 1976, Der B<strong>und</strong>esminister für Bildung <strong>und</strong> Wissenschaft, S. 21.<br />
9 So wird die Berufsausbildungsplanung nach § 2 BerBiFG nach Maßgabe der verwaltungs-<br />
<strong>und</strong> planungsrechtlichen Literatur zu der influenzierenden <strong>und</strong> indikativen<br />
Planung im Gegensatz zur normativen Planung gerechnet (vgl. Fredebeul et al.:<br />
Berufsbildungsförderungsgesetz, Bielefeld 1982, S. 40).<br />
10 Alex, L.: „Berufsbildungsplanung <strong>und</strong> Berufsbildungsforschung", in: Berufsbildung<br />
in Wissenschaft <strong>und</strong> Forschung Heft 6, 1982, S. 6.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ERGEBNISSE DER FORSCHUNG ÜBER HOCHSCHULEN ALS<br />
GRUNDLAGE HOCHSCHULPOLITISCHER ENTSCHEIDUNGEN -<br />
ERFAHRUNGEN VON HIS<br />
Heinz<br />
Griesbach<br />
1. Einleitung<br />
Hochschulen sind ebensowenig wie das Bildungswesen genuiner Gegenstand<br />
einer Wissenschaft, sondern einer größeren Zahl von Fachdisziplinen. Diese<br />
haben unterschiedliche Erkenntnisinteressen, verschiedene methodische Zugänge<br />
zu den Erfahrungsbereichen <strong>und</strong> verschiedene Absichten der Einordnung<br />
von Erfahrungen in Erkenntnissysteme. Es hat sich gezeigt, daß diese<br />
Zersplitterung der Hochschulforschung auf zahlreiche Fachdisziplinen durch<br />
interdisziplinäre Forschungsansätze nicht überw<strong>und</strong>en werden kann. Das<br />
bedingt nicht nur Hemmnisse in der Kooperation zwischen Wissenschaftssystem<br />
<strong>und</strong> zu beratendem politisch administrativen System, sondern beeinträchtigt<br />
auch die Leistungsfähigkeit der Forschung über Hochschulen hinsichtlich<br />
der Wahrnehmung dieser Beratungsaufgaben. 1<br />
Auf diese Sachverhalte kann hier nicht weiter eingegangen werden. Ich<br />
weise auf sie hin, weil sie Rahmenbedingungen der Institutionen, die sich<br />
mit Forschung über Hochschulen befassen, beschreiben <strong>und</strong> damit auch den<br />
Bewertungsrahmen für deren Leistungsvermögen abgeben.<br />
Forschung über Hochschulen wird an Hochschulen <strong>und</strong> in selbständigen<br />
Einrichtungen durchgeführt. Die Wirksamkeit dieser Institutionen bei der<br />
Beratung ist u.a. abhängig von:<br />
— ihrer Aufgabenstellung,<br />
— den verfügbaren personellen <strong>und</strong> sachlichen Mitteln, verb<strong>und</strong>en durch<br />
interne Organisation, durch die die Leistungsfähigkeit bestimmt wird,<br />
— der Einbindung in das politisch-administrative System, z.B. durch Abhängigkeiten<br />
in der Finanzierung, Besetzung der Gremien usw.,<br />
— der Anerkennung der Leistungen sowohl im wissenschaftlichen als auch<br />
im politisch administrativen Bereich.<br />
Dabei sind der Grad der Unabhängigkeit in der Setzung von Themen, in<br />
der Wahl der Methoden <strong>und</strong> die Erzeugung der notwendigen Resonanz die<br />
wichtigsten <strong>und</strong> zugleich heikelsten Punkte für „politikberatende" Institute.<br />
Wenn — wie es in den Vorbereitungsunterlagen zum 22. Soziologentag<br />
heißt — in Fragen der Politikberatung eine Ernüchterung eingetreten ist, die<br />
gelegentlich schon resignative Züge trägt, so werden die Einrichtungen, die<br />
Forschung über Hochschulen betreiben, davon kaum gleichermaßen betroffen<br />
sein. Lassen Sie mich daher die erwähnten heiklen Punkte in die Mitte<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
der Ausführungen stellen, mit denen ich zunächst exemplarisch HIS beschreibe.<br />
2. Aufgabenstellung, Finanzierung, Arbeitsweise von HIS<br />
HIS hat nach der Satzung u.a. die Aufgabe, „die Hochschulen <strong>und</strong> die für<br />
sie zuständigen Verwaltungen in deren Bemühen um eine rationelle <strong>und</strong><br />
wirtschaftliche Erfüllung der Hochschulaufgaben zu unterstützen durch:<br />
— Untersuchungen <strong>und</strong> Gutachten zur Schaffung von Entscheidungsgr<strong>und</strong>lagen,<br />
— Bereitstellung von Informationen, Organisation von Informationsaustausch".<br />
.<br />
Dieser Auftrag wird in einem jährlich fortzuschreibenden Arbeitsprogramm<br />
konkretisiert. Es kommt als Wechselspiel zwischen Initiativen der Geschäftsführung<br />
<strong>und</strong> Anstößen aus dem Kreis der HIS tragenden Institutionen zustande,<br />
deren unterschiedliche Interessen bei der Beratung <strong>und</strong> Verabschiedung<br />
ausgeglichen werden.<br />
Am Zustandekommen des Arbeitsprogramms sind in den verschiedenen<br />
HIS-Gremien beteiligt: die Hochschulen, die KMK, die Länderfinanzminister,<br />
das BMBW, der Wissenschaftsrat, das Statistische B<strong>und</strong>esamt, das Deutsche<br />
Studentenwerk <strong>und</strong> die Bauverwaltungen der Länder.<br />
Alle wesentlichen Institutionen, die Hochschulpolitik betreiben oder<br />
beeinflussen, sind also vertreten. Umgekehrt werden Mitarbeiter von HIS<br />
zu vielen im Hochschulbereich aktiven Gremien, Beiräten usw. (z.B. WRK-<br />
Plenum, Ausschuß für die Hochschulstatistik beim Statistischen B<strong>und</strong>esamt)<br />
hinzugezogen. Damit kann das gesamte Spektrum aktueller hochschulpolitischer<br />
Fragestellungen einschließlich der unterschiedlichen Einschätzungen<br />
ihrer Dringlichkeit für die Beratung <strong>und</strong> Verabschiedung des Arbeitsprogramms<br />
zum Tragen kommen. Dies ist zugleich auch eine Sicherung gegen<br />
einseitige Ausrichtung des Arbeitsprogramms z.B. auf die Interessen nur<br />
einer dieser Institutionen.<br />
Obwohl in den Gremien überwiegend Institutionen vertreten sind, die<br />
zumindest derzeit vorrangig mit der kurzfristigen Bewältigung der sich aus<br />
der Expansion des Hochschulwesens ergebenden Probleme befaßt sind <strong>und</strong><br />
weniger an der systematischen Entwicklung langfristiger Lösungsstrategien<br />
arbeiten, überwiegen im Arbeitsprogramm von HIS keineswegs Projekte, die<br />
ausschließlich oder überwiegend kurzfristigem Krisenmanagement dienen.<br />
Informationen <strong>und</strong> Analysen zum Verhalten von Studienberechtigten, Studenten<br />
<strong>und</strong> Hochschulabsolventen sowie zu den sie verursachenden Motiven<br />
oder Untersuchungen zu Studien- <strong>und</strong> Berufsverläufen, die im Arbeitsprogramm<br />
dominieren, dienen in der Regel sowohl kurz- wie langfristigen Aspekten<br />
der Hochschulpolitik. HIS führt darüber hinaus auch Projekte durch,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
die sich vorwiegend mit langfristigen Entwicklungslinien, die zu neuen hochschulpolitischen<br />
Ansätzen führen können, befassen wie z.B. das gegenwärtig<br />
bearbeitete Projekt „Studierfähigkeit" — Bestandsaufnahme <strong>und</strong> Analyse<br />
von Positionen zur Neuregelung der Hochschulzugangsberechtigung".<br />
Die Finanzierung von HIS erfolgt durch Zuwendungen der Gesellschafter,<br />
also durch B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Länder im Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel.<br />
Die sonst eher übliche projektweise Finanzierung findet im Prinzip bei<br />
HIS nicht statt. Dies ergibt ein hohes Maß an Unabhängigkeit in der Projektarbeit,<br />
die jedenfalls unmittelbar nicht von Geldgeber-Interessen bestimmt<br />
wird. Nur soweit die Nachfrage nach empirischen Untersuchungen<br />
die durch den Stellenplan festgelegten Kapazitäten übertrifft, werden durch<br />
projektbezogene Einzelvereinbarungen zusätzliche Mittel bei Interessenten,<br />
z.B. Gesellschafter, Hochschulen <strong>und</strong> Stiftungen eingeworben.<br />
Durch spezielle Projektvereinbarungen, die in der Regel formal nicht erforderlich<br />
sind, sollen vor allem die Interessenten an Untersuchungen in die<br />
Pflicht genommen werden, an einer präzisen Zielformulierung mitzuwirken<br />
<strong>und</strong> sich mit dem Projektkonzept zu identifizieren. Dadurch soll gewährleistet<br />
werden, daß die Untersuchungsergebnisse direkt in hochschulpolitische<br />
Planungen <strong>und</strong> Entscheidungen der Interessenten einfließen, also bedarfsgerecht<br />
sind, allerdings nicht im Sinne politisch erwünschter, sondern sachlich<br />
notwendiger Ergebnisse.<br />
Zur Organisation ist zu bemerken, daß im Arbeitsfeld „empirische Untersuchungen"<br />
— das hier allein interessiert — zwölf Stammitarbeiter <strong>und</strong><br />
bis zu fünf wissenschaftliche Zeitvertragskräfte tätig sind. Wegen geringer<br />
Fluktuation bei den Stammitarbeitern verfügt HIS über ein mit Hochschulproblemen<br />
vertrautes <strong>und</strong> ständig damit umgehendes Mitarbeiterteam. Die<br />
einzelnen Untersuchungen werden von Projektgruppen durchgeführt. Zur<br />
Sicherung der Validität der zu erhebenden Daten <strong>und</strong> der Qualität der Analysen<br />
bearbeiten die jeweiligen Projektgruppen alle Phasen einer Untersuchung.<br />
Das Vertrauen, das HIS bei Hochschulen <strong>und</strong> staatlichen Verwaltungen<br />
entgegengebracht wird, fördert die Arbeit, zumal u.a. aus Datenschutzgründen<br />
deren Mitwirkung bzw. Unterstützung häufig für die erfolgreiche Abwicklung<br />
von Untersuchungen erforderlich ist.<br />
3. Bezug zur politischen Diskussion bei der Konzipierung von Untersuchungen<br />
Wie dargestellt, wird bereits bei der Fortschreibung <strong>und</strong> Festlegung des Arbeitsprogrammes<br />
hinsichtlich der zu bearbeitenden Themen ein Bezug zur<br />
politischen Diskussion hergestellt. Dies gilt auch für die Konzipierung der<br />
einzelnen Untersuchungen. Für die Intensität dieses Bezuges spielt eine entscheidende<br />
Rolle, daß sich in den letzten Jahren eine spezifische Aufgaben-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
struktur herausgebildet hat. Bei etwa vier Fünfteln der Projekte, die im<br />
HIS-Arbeitsbereich „empirische Untersuchungen" durchgeführt werden,<br />
handelt es sich entweder um Befragungswellen von aufeinander bezogenen<br />
Längsschnittuntersuchungen oder um in regelmäßigen Abständen durchzuführende<br />
aufeinander bezogene Querschnittsuntersuchungen jeweils mit verschiedenen<br />
Jahrgängen der gleichen Gr<strong>und</strong>gesamtheit. Die restlichen Untersuchungen<br />
gelten bildungspolitisch aktuellen Einzelthemen.<br />
Bei der zuerst genannten Art von Projekten handelt es sich u.a. um:<br />
— Längsschnittuntersuchungen mit Studienberechtigten der Jahrgänge<br />
1976, 1978, 1980, 1983 <strong>und</strong> die in jeweils Dreijahresabstand folgenden<br />
Jahrgänge, die im Verlauf von 10 bis 11 Jahren viermal zum Ausbildungs<strong>und</strong><br />
Berufsverlauf befragt werden;<br />
— Querschnittsuntersuchungen jedes fünften Exmatrikuliertenjahrganges,<br />
die zum Ziel haben, Studienerfolgs- bzw. Studienabbruchquoten sowie<br />
Studienzeiten, Fachwechsel <strong>und</strong> Hochschulwechsel von Hochschulabsolventen<br />
<strong>und</strong> Studienabbrechern zu ermitteln;<br />
— Querschnittsuntersuchungen jedes dritten Studentenjahrganges, um die<br />
wirtschaftliche <strong>und</strong> soziale Lage der Studenten festzustellen (Sozialerhebungen<br />
des Deutschen Studentenwerkes);<br />
— Querschnittsuntersuchungen der Studienanfänger jedes Wintersemesters,<br />
um u.a. Informationen über Einstellungen zum Studium, Motive zur<br />
Studienfachwahl <strong>und</strong> berufliche Ziele als Hintergr<strong>und</strong> für quantitative<br />
Veränderungen der Studienanfängerzahlen zu erhalten.<br />
Jährlich werden etwa 40.000 Fragebogen bearbeitet.<br />
All diese Projekte zielen darauf ab, valide Informationen über Veränderungen<br />
von Situationen <strong>und</strong> Verhältnissen im Hochschulbereich bereitzustellen,<br />
die von der Mehrzahl der Experten als Planungs- <strong>und</strong> Entscheidungsgr<strong>und</strong>lagen<br />
für eine problemorientierte <strong>und</strong> informatorisch abgesicherte<br />
Hochschulpolitik dauerhaft für erforderlich gehalten werden <strong>und</strong> nicht von<br />
der amtlichen Statistik verfügbar gemacht werden können. Dabei analysiert<br />
HIS die sich in den Informationen darstellenden Sachverhalte im Hinblick<br />
auf Kausalzusammenhänge sehr viel ausführlicher als dies die amtliche Statistik<br />
— auch aus ihrem Selbstverständnis heraus — kann.<br />
Gr<strong>und</strong>lage für eine sachbezogene <strong>und</strong> ökonomische Durchführung derartiger<br />
Untersuchungsreihen ist, daß sie<br />
— langfristig von einer Institution bearbeitet werden. Die institutionelle<br />
Finanzierung von HIS ist dafür die sachgerechte <strong>und</strong> notwendige Voraussetzung;<br />
— über einen möglichst langen Zeitraum von einem sich personell nur wenig<br />
ändernden Mitarbeiterteam bearbeitet werden. Nur auf diese Weise<br />
läßt sich die für Zeitreihen erforderliche dauerhaft gleichbleibende Qualität<br />
von Daten sichern;<br />
— möglichst konsequent auf die dauerhaft zu erfüllenden bildungspoliti-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
schen Anforderungen ausgerichtet werden. Es wird versucht, dies dadurch<br />
zu erreichen, daß bei der Einbeziehung eines neuen Jahrganges,<br />
ja bei der Planung jeder einzelnen Befragungswelle der Längsschnittuntersuchungen<br />
auf dem Hintergr<strong>und</strong> der bis dahin erzielten Ergebnisse<br />
überprüft wird, ob <strong>und</strong> inwieweit die Anforderungen von Bildungsplanung<br />
<strong>und</strong> Bildungspolitik besser erfüllt werden können. Dabei ist besonders<br />
hilfreich, daß HIS aufgr<strong>und</strong> seines akkumulierten Datenbestandes<br />
immer häufiger von Bildungsverwaltungen gebeten wird, für die Beantwortung<br />
bzw. Analyse aktueller, meist thematisch begrenzter Fragestellungen<br />
durch Sonderauswertungen entsprechende Informationen<br />
oder Analyseergebnisse bereitzustellen. So bildet sich bei all diesen Untersuchungen<br />
im Laufe der Zeit ein Kernbereich an Fragestellungen<br />
heraus, der sowohl in seinem wissenschaftlichen Erkenntniswert als<br />
auch in seiner bildungspolitischen Notwendigkeit weitgehend unbestritten<br />
ist.<br />
Den bildungspolitischen Anforderungen an derartige Untersuchungen kann<br />
nur entsprochen werden, wenn sich die benötigten Informationen <strong>und</strong> Analyseergebnisse<br />
auf einen möglichst gegenwartsnahen Zeitraum beziehen.<br />
Deshalb sind auch Strategien entwickelt worden, die es ermöglichen, bereits<br />
nach kurzem Bearbeitungszeitraum wesentliche Ergebnisse bereitzustellen.<br />
Bei den Längsschnittuntersuchungen mit Studienberechtigten wird dies<br />
z.B. durch eine stufenweise Aufbereitung der Befragungsergebnisse, der zumeist<br />
großen Stichproben (zwischen 5.000 <strong>und</strong> 20.000 auswertbaren Fällen)<br />
erreicht:<br />
— Zunächst werden durch die Auswertung einer Zufallsstichprobe der beantworteten<br />
Fragebogen kurz nach Abschluß der jeweiligen Erhebung<br />
relativ globale Eckwerte ermittelt <strong>und</strong> veröffentlicht.<br />
— Als nächstes wird ein statistischer Bericht, durch den vor allem Zeitreihen<br />
fortgeschrieben werden, erstellt. Die Daten werden nur kurz kommentiert,<br />
um eher technische Interpretationshilfen zu geben.<br />
— Die dritte Form der Aufbereitung, die den längsten Bearbeitungszeitraum<br />
beansprucht, ist die Analyse der Daten auf bestimmte bildungspolitisch<br />
aktuelle Themen hin, wie z.B. „Ist die Berufsausbildung eine<br />
Alternative zum Studium für Studienberechtigte?".<br />
Auch bei der oben erwähnten zweiten Art von Untersuchungen — Studien<br />
zu Einzelthemen — wird bereits bei der Konzipierung ein enger Bezug zur<br />
aktuellen bildungspolitischen Diskussion hergestellt. So ist bereits 1979<br />
eine Befragung zum Thema „Beschäftigungsprobleme nicht eingestellter<br />
Lehrer" 2 begonnen worden. 1981 wurden die Arbeiten zu einem Projekt<br />
„Attraktivität des Ingenieurstudiums" 3 aufgenommen. Derzeit wird das bereits<br />
erwähnte Projekt zum Thema „Studierfähigkeit" durchgeführt. Diese<br />
Projekte — vor allem das zuletzt genannte — bieten durchaus Ansatzpunkte<br />
für eine systematische Analyse der Funktionen der Hochschule <strong>und</strong> ihrer<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
strukturellen Konsequenzen, also für das, was man als Gr<strong>und</strong>lagenforschung<br />
bezeichnen könnte. Dies kommt auch darin zum Ausdruck, daß z.B. die<br />
beiden zuletzt genannten Projekte durch finanzielle Förderungen von Stiftungen<br />
ermöglicht wurden <strong>und</strong> für das Studierfähigkeitsprojekt ein wissenschaftlicher<br />
Beirat eingerichtet ist. Die Forschungsziele dieser Projekte sind<br />
unbeeinflußt von bestimmten Interessenten im politisch administrativen Bereich<br />
durch HIS-interne Diskussionen entwickelt <strong>und</strong> festgelegt worden.<br />
Ob die Ergebnisse solcher Studien in die politische Diskussion <strong>und</strong> in<br />
bildungspolitische Entscheidungen eingehen, hängt auch entscheidend vom<br />
Bearbeitungszeitraum ab, vor allem wenn es Themen sind, die nur relativ<br />
kurze Zeit aktuell sind. Bisher ist es HIS durchaus gelungen, Ergebnisse solcher<br />
Untersuchungen so frühzeitig vorzulegen, daß sie auch wirksam wurden.<br />
4. Erarbeitung von Empfehlungen auf der Gr<strong>und</strong>lage von Untersuchungsergebnissen<br />
Die Arbeit von HIS <strong>und</strong> damit auch deren Ergebnisse lassen sich in etwa wie<br />
folgt beschreiben, wobei die Übergänge zwischen den verschiedenen Formen<br />
fließend sind.<br />
HIS<br />
— ermittelt Informationen über quantitative Sachverhalte wie Studienzeiten,<br />
Studienerfolg, Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben von Studenten. Dabei<br />
werden Ursachen, die Unterschiede bedingen <strong>und</strong> Wirkungszusammenhänge<br />
von Einflußfaktoren herausgearbeitet;<br />
— analysiert Verhaltensweisen, deren Gründe <strong>und</strong> deren Auswirkungen.<br />
Es werden Konsequenzen für die Erreichung bildungspolitischer Ziele<br />
sowohl des B<strong>und</strong>es als auch der Länder, die durchaus kontrovers sein<br />
können, aufgezeigt <strong>und</strong> auf ggf. alternative Maßnahmen hingewiesen,<br />
die deren Erreichung auch unter veränderten Bedingungen ermöglichen.<br />
So hat HIS z.B. frühzeitig darauf hingewiesen, daß Langzeitstudenten<br />
Kapazitäten von Hochschulen nur in geringem Umfang in Anspruch<br />
nehmen <strong>und</strong> damit zur Aussetzung des Vollzugs der Regelstudienzeiten<br />
beigetragen. 4<br />
— untersucht, ob Vorstellungen bzw. Modelle, die zur Lösung von Problemen<br />
in der Bildungspolitik erörtert werden, geeignet sind, die angestrebten<br />
bildungspolitischen Ziele zu erreichen bzw. welche Voraussetzungen<br />
dafür erforderlich sind.<br />
Das 1979/80 durchgeführte Projekt zu „Entwicklungspolitisch orientierten<br />
Studienangeboten in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland" <strong>und</strong> das<br />
derzeit bearbeitete, bereits erwähnte Projekt zum Thema „Studierfähigkeit"<br />
sind in hohem Maße auf die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen<br />
bzw. von Warnungen vor der Verwirklichung verfehlter Lösungs-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Vorschläge angelegt. Sie sind deshalb auch mit dem höchsten Risiko der<br />
Anerkennung bzw. Ablehnung der Ergebnisse behaftet;<br />
— erstellt kurzfristige Gutachten zu in der Regel thematisch eng begrenzten<br />
bildungspolitisch aktuellen Themen aufgr<strong>und</strong> von ad-hoc-Anfragen<br />
von Hochschulen, Ministerien usw. HIS kann diese — m.E. sehr wirkungsvolle<br />
— Form der Planungs- <strong>und</strong> Entscheidungsunterstützung mit<br />
Hilfe von Daten aus seinen Untersuchungen leisten, weil es über einen<br />
ständig aktualisierten Pool von Informationen zu wesentlichen Bereichen<br />
des Hochschulsystems verfügen kann.<br />
HIS erarbeitet also aufgr<strong>und</strong> seiner Untersuchungsergebnisse der Form, dem<br />
Inhalt <strong>und</strong> der politischen Bedeutung nach sehr unterschiedliche Empfehlungen.<br />
HIS geht dabei weder von einer Position kritischer Sozialwissenschaften<br />
aus, die die <strong>gesellschaftliche</strong>n Verhältnisse gr<strong>und</strong>sätzlich in Frage<br />
stellt, noch fühlt HIS sich der Wahrung von Interessen bestimmter Gruppierungen<br />
durch wissenschaftliche Legitimation verpflichtet. HIS ist nicht<br />
daran interessiert, daß seine Empfehlungen zum Alibi degenerieren. Die<br />
Festlegung, daß alle Ergebnisse von HIS allen Gesellschaftern — also dem<br />
B<strong>und</strong> <strong>und</strong> den Ländern mit ihren unterschiedlichen politischen Orientierungen<br />
— ausnahmslos zur Verfügung stehen sowie die Veröffentlichung<br />
dieser Ergebnisse verhindern, solche Anliegen an HIS heranzutragen oder<br />
mit den Arbeitsergebnissen selektiv verfälschend umzugehen.<br />
Welche Art von Empfehlung bevorzugt wird, hängt entscheidend davon<br />
ab, ob der Adressat die Ministerialbürokratie oder unmittelbar der politische<br />
Bereich ist. Es ist durchaus spürbar, daß Mitglieder der Ministerialbürokratie<br />
— je nach Position <strong>und</strong> Temperament — bei der Beratung von Politikern<br />
mit Wissenschaftlern konkurrieren. Die Verwaltung läßt sich zur Wahrung<br />
ihrer Handlungskompetenz eher Informationen statistisch <strong>und</strong> analytisch<br />
aufbereiten, um die eigentliche politische Empfehlung selbst zu erarbeiten.<br />
Sie steht „Strukturanalysen", die Handlungsalternativen als solche<br />
schon enthalten <strong>und</strong>/oder Empfehlungen mit politischen Handlungsalternativen<br />
eher restriktiv gegenüber. Letztere werden eher von Politikern bzw.<br />
politischen Instanzen bevorzugt, nicht zuletzt auch, um sich einen Spielraum<br />
der Unabhängigkeit von der Ministerialbürokratie zu wahren.<br />
Wenn auch soeben aufgezeigten Tendenzen für HIS durchaus spürbar<br />
sind, so kann nicht von gravierenden Problemen bei der Erstellung von<br />
Empfehlungen gesprochen werden. Gelegentlich bleiben Empfehlungen bei<br />
politischen Entscheidungen unberücksichtigt. Darin sieht HIS keinen Mißerfolg;<br />
Ratschläge können von dem, der sie erbeten hat oder ungebeten erhält,<br />
befolgt werden oder nicht. HIS ist durchaus der Auffassung, daß seine<br />
Arbeitsergebnisse, auch, soweit sie über Empfehlungen vermittelt wurden,<br />
vielfältig wirksam geworden sind, wenn auch z.T. nur indirekt durch Schärfung<br />
von Proble<strong>mb</strong>ewußtsein bei den Adressaten. Allerdings dauert es zuweilen<br />
sehr lange bis Erkenntnisse akzeptiert werden. Dabei spielt u.a. das<br />
Verhalten der Öffentlichkeit eine Rolle. Sie nimmt Ergebnisse empirischer<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Untersuchungen häufig nur wahr, wenn sie in überkommene Argumentationsmuster<br />
passen. Solche, von Medien gepflegten Argumentationsmuster<br />
werden aber auch bewußt oder unbewußt von Angehörigen der Verwaltungen<br />
<strong>und</strong> von Politikern übernommen. So hat es fast sieben Jahre gedauert,<br />
bis daß die von HIS bereits 1975 ermittelte <strong>und</strong> seither auch von anderen<br />
Institutionen 4 immer wieder bestätigte Studienabbruchquote von etwa<br />
10% eines Studienanfängerjahrganges ernsthaft diskutiert wurde. 5 Ähnliche<br />
Erfahrungen hat HIS mit Ergebnissen der Studiendauer gemacht.<br />
Heute noch stößt die Feststellung, daß die durchschnittliche „persönliche"<br />
Studienzeit der Studenten zwischen 1975 <strong>und</strong> 1980 kaum zugenommen<br />
hat, auf großes Erstaunen <strong>und</strong> Ungläubigkeit, weil sie nicht ins Trugbild<br />
vom „bequemen Studenten" paßt. 6 Es läßt sich kaum vermitteln, daß die<br />
durchschnittliche Studienzeit in jenen Jahren lediglich dadurch zugenommen<br />
hat, daß — u.a. wegen des Rückzugs aus den Lehramtsstudiengängen —<br />
vermehrt Studiengänge mit längeren in den Prüfungsordnungen vorgeschriebenen<br />
Studienzeiten gewählt worden sind.<br />
5. Fazit<br />
Insgesamt gesehen hatten <strong>und</strong> haben die Projekte von HIS einen engen Bezug<br />
zu jeweils aktuellen bildungs- bzw. hochschulpolitischen Fragestellungen.<br />
Obwohl sich in ihnen gegenwärtig die vorrangige Notwendigkeit widerspiegelt,<br />
bestehende, sich verschärfende Probleme im Hochschulbereich<br />
kurzfristig bewältigen zu müssen <strong>und</strong> nur wenig Kraft <strong>und</strong> Zeit bleibt, neue<br />
langfristige Entwicklungskonzepte für den Hochschulbereich zu erarbeiten,<br />
dominieren bei HIS keineswegs Projekte, die ausschließlich auf die Unterstützung<br />
der Krisenbewältigung abgestellt sind. Die Ergebnisse der oben erwähnten<br />
Untersuchungsreihen sind sowohl für die Krisenbewältigung als<br />
auch für das Auffinden neuer hochschulpolitischer Ansätze nützlich. Es gibt<br />
darüber hinaus auch Projekte, die allein dem letztgenannten Aspekt dienen.<br />
Weder die Beteiligung aller wesentlichen mit Hochschulpolitik befaßten<br />
Institutionen beim Zustandekommen des Arbeitsprogramms, noch die Art<br />
der Finanzierung <strong>und</strong> der Abschluß von Vereinbarungen mit Interessenten<br />
über die Durchführung von Projekten führen dazu, daß HIS veranlaßt wird<br />
oder gezwungen ist, Studien zu erstellen, die darauf abzielen, bereits getroffene<br />
oder beabsichtigte politische Entscheidungen wissenschaftlich zu legitimieren,<br />
zu begründen bzw. zu bemänteln. Im Gegenteil, die Besetzung der<br />
Gremien, die auch gegenseitige Kontrolle bewirkt, die relative Arbeitsplatzsicherheit<br />
der Mitarbeiter durch die Art der Finanzierung, die personelle <strong>und</strong><br />
materielle Ausstattung dieses Arbeitsbereiches sichert größere Möglichkeiten<br />
als vielfach vermutet, Arbeitsziele <strong>und</strong> Methoden unabhängig zu bestimmen.<br />
Starker Bezug der Arbeiten zur politischen Diskussion bedeutet also<br />
nicht Abhängigkeit der zu bearbeitenden Themen von politischen Wünschen,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
administrative Gängelung bei der Durchführung der Projekte <strong>und</strong> Verlust<br />
der Objektivität der Ergebnisse. Das würde auch dem Selbstverständnis von<br />
HIS widersprechen, das darauf gerichtet ist, auf der Gr<strong>und</strong>lage von mit kritischer<br />
Objektivität erarbeiteten Ergebnissen bildungspolitisch wirksam werdende<br />
handlungsleitende Hilfe zu geben.<br />
LITERATUR<br />
1 Hollmann, Liesel: „Wissenschaftliche Beratung der Politik dargestellt am Beispiel<br />
von IPEKS", in: Beiträge zur Politikwissenschaft, Bd. 27, Frankfurt/M., Bern,<br />
New York 1983.<br />
Lampe, K.: „Wissenschaft <strong>und</strong> politische Steuerung", in: Lampe, K. u.a.: Enquite-<br />
Kommissionen <strong>und</strong> Royal Commissions: Beispiele wissenschaftlicher Politikberatung<br />
in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland <strong>und</strong> in Großbritannien, Göttingen<br />
1981.<br />
Lüdtke, H.: „Legitimation der empirischen Sozialforschung durch praktischen<br />
Nutzen", in: Angewandte Sozialforschung, Jg. 12, H. 1/2.<br />
Oehler, Ch.: „Bildungsforschung <strong>und</strong> Bildungspolitik", in: Transfer 5, Beiheft<br />
zu Deutsche Universitätszeitung H. 6, 1983.<br />
2 Durrer, F.; Kazemzadeh, F.: „Beschäftigungsprobleme nicht eingestellter Lehrer",<br />
HIS-Hoschulplanung 38, Hannover 1981.<br />
3 Kazemzadeh, F.; Minks, K.-H.: „Attraktivität des Ingenieurstudiums — Ergebnisse<br />
einer empirischen Untersuchung", HIS-Hochschulplanung 47, Hannover 1983.<br />
4 Griesbach, H. u.a.: „Studienverlauf <strong>und</strong> Beschäftigungssituation von Hochschulabsolv<br />
Reissert, R., Birk, L.: „Studienverlauf, Studienfinanzierung <strong>und</strong> Berufseintritt<br />
von Hochschulabsolventen <strong>und</strong> Studienabbrechern des Studienjahres 1979",<br />
HIS-Hochschulplanung 41, Hannover 1982.<br />
5 Reissert, R.: „Studienabbruch im Widerstreit von Ergebnissen <strong>und</strong> Meinungen",<br />
in: HIS-Kurzinformationen A1, Hannover 1983.<br />
6 Reissert, R.: „Studienzeiten — Entwicklung <strong>und</strong> Ursachen", in: HIS-Kurzinformationen<br />
Ab, Hannover 1983.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ZUR POLITIKBERATUNG DURCH BILDUNGSFORSCHUNG EVI<br />
BEREICH DER WEITERBILDUNG<br />
Wolfgang Schulenberg<br />
1. Zur Entstehung von Weiterbildungspolitik<br />
Wer im Bereich der Erwachsenenbildung/Weiterbildung von Politik sprechen<br />
will, hier also von Politikberatung durch Forschung, wird zunächst darauf<br />
hinweisen müssen, daß der Bereich der Weiterbildung anders als die Bereiche<br />
Schule <strong>und</strong> Hochschule in unserem Bildungswesen nicht Produkt <strong>und</strong><br />
Veranstaltung des Staates ist. Schulen <strong>und</strong> Hochschulen sind seit Jahrh<strong>und</strong>erten<br />
vor allem politisch von oben eingerichtet <strong>und</strong> organisiert worden,<br />
notfalls gegen den Widerstand der betroffenen Bevölkerung (wie bei der<br />
Durchsetzung der Schulpflicht). Die Ansätze zur Erwachsenenbildung, wie<br />
sie seit Ende des 18. <strong>und</strong> im Laufe des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts von <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Gruppen von unten in Gang gebracht worden sind, erfuhren dagegen<br />
von Seiten des Staates zumeist Widerstand (bis zur polizeilichen Verfolgung)<br />
oder doch mißtrauische Ablehnung. Die Erwachsenenbildung hatte es<br />
schwer, sich auf der Ebene individueller Initiativen, informeller Gruppen<br />
oder lokaler Vereine zu entwickeln. Selbst partikulare politische oder kirchliche<br />
Hilfen waren schwach, ebenso überregionale Verbindungen. (Zur<br />
Erinnerung: Die SPD ist aus kleinen Arbeiterbildungsvereinen hervorgegangen.)<br />
Erst in der Weimarer Verfassung von 1919 findet sich eine bescheidene<br />
staatlich-rechtliche Akzeptierung der Erwachsenenbildung durch die unverbindliche<br />
Empfehlung zur „Förderung" des Volksbildungswesens einschließlich<br />
der Volkshochschulen (Art. 148). Das ging zusammen mit einer<br />
bildungspolitischen Beachtungswelle, änderte aber an dem vereinsmäßigen<br />
Charakter der lokalen Aktivitäten wenig.<br />
Substantielle Gesetze zur Erwachsenenbildung sind erst ab 1970 (Niedersachsen)<br />
beschlossen worden. Mit „substantiell" ist hier gemeint, daß<br />
diese Gesetze von dauerhaften Erwachsenenbildungseinrichtungen ausgehen,<br />
denen ein Rechtsanspruch auf Förderung eingeräumt wird, während dieser<br />
Rechtsanspruch wiederum sich mit qualitativer Normierung für die Einrichtungen<br />
verbindet. Es gibt solche Gesetze inzwischen in den meisten B<strong>und</strong>esländern.<br />
Indes gibt es seit einigen Jahren auch schon deutliche Versuche,<br />
die Verpflichtungen aus diesen Gesetzen wieder abzuschütteln.<br />
Der Bereich der Weiterbildung ist ferner im Vergleich zu den Bereichen<br />
Schule, Hochschule <strong>und</strong> Berufsbildung in den politisch entscheidenden Dimensionen<br />
des hauptamtlichen Personals <strong>und</strong> der öffentlichen Mittel enorm<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
unterentwickelt. Dabei sind neben rechtlichen Regelungen (Institutionalisierungen)<br />
hauptamtliches Personal <strong>und</strong> öffentliche Mittel die wichtigsten Medien<br />
gestaltender Politik, der Politik also, die in der konventionellen Weise beraten<br />
werden kann. Andererseits ist der programmatische Anspruch <strong>und</strong><br />
der Kreis der Adressaten (für alle Erwachsenen) sehr groß, <strong>und</strong> die Zahl der<br />
tatsächlichen Nutzer ist mit Schule <strong>und</strong> Hochschule vergleichbar.<br />
Als in den 50er Jahren die ersten Arbeiten zur neueren Weiterbildungsforschung<br />
entstanden, gab es Tausende von Hochschullehrern <strong>und</strong> zigtausende<br />
von Schullehrern, aber in der Erwachsenenbildung nur ein paar Dutzend<br />
hauptamtliche Leiter <strong>und</strong> pädagogische Mitarbeiter. In den Kultushaushalten<br />
lag der Anteil für die Erwachsenenbildung unter 1%; er ist auch<br />
heute kaum höher. (In den meisten B<strong>und</strong>esländern liegt der Landeszuschuß<br />
zur gesamten Erwachsenenbildung des Landes unter dem Zuschuß für eine<br />
einzige mittlere Universität.)<br />
Während sich also die Bildungsforschung in den Bereichen Schule, Hochschule<br />
<strong>und</strong> Berufsbildung Praxisfeldern zugewandt hat, die seit langem<br />
etabliert <strong>und</strong> relativ hochentwickelt (wenn auch durchweg refor<strong>mb</strong>edürftig)<br />
sind, war die Weiterbildungsforschung gezwungen (oder hatte die Chance),<br />
mit einem selbst überhaupt erst entstehenden Bildungsbereich gleichsam<br />
aufzuwachsen.<br />
Was bedeutet unter diesen Umständen Politikberatung durch Bildungsforschung?<br />
In einem Bereich also, der einerseits außerhalb der anerkannten<br />
Strukturen staatlicher Politik liegt, institutionell immer noch stark provisorisch<br />
konstruiert <strong>und</strong> personell wie materiell äußerst schwach ausgestattet<br />
ist, der aber andererseits unter hohen programmatischen Ansprüchen steht,<br />
die überdies wohlbegründet <strong>und</strong> öffentlich unbestritten sind?<br />
Eine Politikberatung, die sich wie in den Bereichen Schule <strong>und</strong> Hochschule<br />
vor allem als direkte oder indirekte Beeinflussung der staatlichen Politik<br />
versteht, konnte hier nicht statthaben. (Offenk<strong>und</strong>ig wird unter Politikberatung<br />
prototypisch Beratung staatlicher Machtinhaber verstanden —<br />
die gestrige Plenumsdiskussion machte es noch einmal deutlich.) Analoges<br />
gilt übrigens auch für die Weiterbildung der Gewerkschaften, Kirchen usw.,<br />
sofern deren Weiterbildungsaktivitäten überhaupt so weit verselbständigt<br />
sind, daß sie für eine Politik erreichbar werden, die nicht nur eine Verlängerung<br />
oder Ausführung der übergeordneten Politik des Trägers ist.<br />
Die Weiterbildungsforschung mußte erkennen <strong>und</strong> akzeptieren, daß die<br />
Adressaten oder Partner für eine Politikberatung überhaupt erst bereit <strong>und</strong><br />
fähig werden mußten, Weiterbildungspolitik konstruktiv-planmäßig zu sehen<br />
<strong>und</strong> zu betreiben. Die Weiterbildungsforschung mußte sich zwangsläufig<br />
an diesem Konstitutionsprozeß in ihrem Praxisfeld beteiligen. (Daß dazu<br />
nebenbei auch das Entstehen einer wissenschaftlichen Disziplin Erwachsenenbildung<br />
<strong>und</strong> ihre Institutionalisierung an den Hochschulen gehörte, sei<br />
ausdrücklich vermerkt. Daß wiederum deren Forschungsbestände stark sozialwissenschaftlicher<br />
Provenienz sind, <strong>und</strong> z.B. relativ wenig Psychologie<br />
aufgenommen haben, wird aus dieser Genese verständlich.)<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Wissenschaftler, die sich mit Weiterbildungsforschung befaßten, gerieten<br />
so in ein starkes Wechselverhältnis zu ihrem Forschungsfeld <strong>und</strong> seinen Bedingungen,<br />
vor allem auch politischen Bedingungen. Das hat in der alltäglichen<br />
Kommunikation <strong>und</strong> bei der sachlichen Verb<strong>und</strong>enheit zwischen allen<br />
Seiten zu einer eher allgegenwärtigen, aber diffusen Politikberatung im Rahmen<br />
einer breiteren Verwendung der Forschungsergebnisse geführt.<br />
Diese relativ starke Integration hatte auch für den einzelnen Forscher bemerkenswerte<br />
Folgen. Zunächst ist eine durchweg positiv empf<strong>und</strong>ene Folge<br />
zu nennen: Forschungsergebnisse fanden ein ungewöhnlich hohes Maß<br />
an Resonanz, auch im Sinne von politischer Diskussion. Die Rückkopplung<br />
zu allen Seiten (Praxis, Administration, Parlamentarier, Kommunen, Verbände,<br />
Presse etc.) erfolgte oft automatisch, sie war sonst relativ leicht herzustellen,<br />
denn auf allen Seiten fehlte es an der abweisenden etablierten<br />
Routine <strong>und</strong> an der Selbstverteidigung von politischen oder administrativen<br />
Apparaten. Wohlverstanden: Hohe Resonanz heißt nicht allein positive Aufnahme,<br />
sondern oft genug wütende Ablehnung, Verdrehungen, Rückweisungen.<br />
Aber die bitterste Frustration der Forschung, die gleichgültige Nichtbeachtung,<br />
war selten.<br />
2. Einige Beispiele von Politik <strong>und</strong> Forschung in der Weiterbildung<br />
Nach diesen allgemeinen Schilderungen mögen einige konkrete Beispiele angebracht<br />
sein, die veranschaulichen, was ich meine, wenn ich von Integration<br />
<strong>und</strong> Resonanz spreche. (Daß die Beispiele sich auf eigene Arbeiten<br />
beziehen, liegt in der Natur der Sache.)<br />
— 1952 veranlaßte das niedersächsische Kultusministerium eine Untersuchung<br />
in Hildesheim (auf Anregung des Volkshochschulleiters) über Vorstellungen,<br />
Erwartungen <strong>und</strong> Erfahrungen der Bevölkerung zur Erwachsenenbildung.<br />
63 Gruppendiskussionen erbrachten, daß das Bildungsbewußtsein<br />
der Bevölkerung unerwartet hoch (in bewußter Diskrepanz zum Bildungsverhalten)<br />
einzuschätzen sei, daß die Erwartungen an die Volkshochschule<br />
anspruchsvoller waren, als die zirkuläre Selbstbestätigung durch die<br />
laufende Arbeit vermuten ließ, daß die Faktoren Beruf <strong>und</strong> Schule zu Unrecht<br />
vernachlässigt würden u.a.m. Den Bef<strong>und</strong>en folgte keine einzige politische<br />
Maßnahme, dennoch wird ihre bildungspolitische Bedeutung heute<br />
sehr hoch eingeschätzt („realistische Wende"). Die Wirkung ist durch viele<br />
Diskussionen, durch Bewußtseinsprozesse, Beachtungssteigerung <strong>und</strong> indirekte<br />
Einflüsse erfolgt. Die 'Hildesheim-Studie' hat die Entstehung der Göttinger<br />
Seminarkurse gestärkt (Universitäre Erwachsenenbildung), sie hat das<br />
Erwachsenenbildungsgutachten des Deutschen Ausschusses (1961) beeinflußt<br />
<strong>und</strong> darüber die Initiativen für ein Erwachsenenbildungsgesetz in Niedersachsen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
— Zudem wurde von ihr die dreistufige „Göttinger Untersuchung" (1966)<br />
ausgelöst, die wiederum die Arbeiten am Erwachsenenbildungsgesetz vorangetrieben,<br />
den Durchbruch des Zertifikatssystems der Volkshochschulen<br />
(1968) wesentlich begründet <strong>und</strong> den Strukturplan 1970 des Bildungsrates<br />
beeinflußt hat. Alles in allem: Breite Rezeption, Zustimmung <strong>und</strong> Unruhe,<br />
vielfältige Wirkung; aber von klassischer Politikberatung keine Spur.<br />
— Geradezu ein Fehlschlag im Sinne klassischer Politikberatung scheint das<br />
1980 vom niedersächsischen Wissenschaftsminister in Auftrag gegebene <strong>und</strong><br />
1982 übergebene Gutachten zur Wirkung des Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetzes<br />
gewesen zu sein. Nach 10jähriger Geltung wollte die<br />
neue Mehrheitsfraktion im Landtag dieses Gesetz restriktiv novellieren. Das<br />
Gutachten — nach Umfang <strong>und</strong> Charakter ein veritables Stück Forschung —<br />
spricht sich dagegen für Beibehaltung, ja Weiterführung des Gesetzes aus<br />
(welch Lob für Gesetzgeber <strong>und</strong> Fachminister!). Die Mehrheitsfraktion hat<br />
dennoch die beabsichtigte Novellierung durchgesetzt, der Minister hat die<br />
Argumente seines eigenen Gutachtens kaum vertreten. Eine Farce der Politikberatung<br />
durch Bildungsforschung? Unter den spezifischen Bedingungen<br />
des Praxisfeldes der Erwachsenenbildung wird auch hier die indirekte Wirkung<br />
entscheidend sein. Das zeigte schon die Art <strong>und</strong> Weise, wie man das<br />
Gutachten zu neutralisieren trachtete, es zeigt sich weiter in dem Bewußtsein<br />
der unterlegenen Seite, <strong>und</strong> das wird sich mittelfristig in der Vergleichsfunktion<br />
erweisen.<br />
— Einen ähnlichen 'Mißerfolg' erlebte unsere eben abgeschlossene Untersuchung<br />
über „Studienerfahrungen <strong>und</strong> Studienerfolg von Berufstätigen ohne<br />
Reifezeugnis in Niedersachsen". Das zuständige Ministerium hat fast gleichlaufend<br />
mit der Vorlage unserer Ergebnisse die betroffene Prüfungsordnung<br />
in gegensätzlichem Sinne revidiert. Gleichwohl geben uns viele Indizien<br />
die Zuversicht, daß die für eine Öffnung der Hochschulen sprechenden<br />
Bef<strong>und</strong>e auf längere Sicht ihre politische Wirkung nicht verfehlen, wenn<br />
auch die verantwortlichen Politiker heute noch vorziehen, davon unberaten<br />
zu bleiben.<br />
Politische Wirkung der Bildungsforschung <strong>und</strong> klassische Politikberatung<br />
gehen selbst in solchen Fällen auseinander, in denen der prototypische<br />
Adressat der Politikberatung (Minister) im Spiel ist. Ob darin noch eine verdeckte<br />
Auswirkung der Tatsache zu erkennen ist, daß die Erwachsenenbildung<br />
sich einmal gegen die staatliche Politik entwickelt hat, sei dahingestellt.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
3. Bedeutung für die Soziologie als akademisches Fach oder praxisrelevante<br />
Wissenschaft<br />
Unter dem Postulat der Praxisrelevanz von Sozialforschung können meine<br />
Beobachtungen ganz stimuliert klingen. Andererseits mag es an dem, was ich<br />
die hohe Integration zum Feld nenne, liegen, daß die Arbeiten der Weiterbildungsforschung<br />
in der allgemeinen soziologischen Fachdiskussion nur eine<br />
geringe Rolle spielen. Ich will auch hier zwei Beispiele nennen: In der<br />
Weiterbildungsforschung haben seit Jahrzehnten qualitative Methoden kontinuierlich<br />
Anwendung gef<strong>und</strong>en, es gibt hier sogar eine vermutlich einzigartige<br />
Ko<strong>mb</strong>ination quantitativer <strong>und</strong> qualitativer Methoden (Göttinger Untersuchung),<br />
aber die derzeit stattfindende Diskussion um die „Wiederentdeckung"<br />
der qualitativen Forschung greift auf diese Erfahrungen kaum zurück.<br />
Ebenso steht es mit den Biographie- <strong>und</strong> Lebenslauf-Diskussionen, obgleich<br />
in der Forschung zur Erwachsenenbildung diese Ansätze naturgemäß<br />
seit jeher eine Rolle gespielt haben. Der Appetit der Fachdiskussion bevorzugt<br />
hier offenk<strong>und</strong>ig spekulative Aktualität. Das mag wissenschaftssoziologisch<br />
gesehen eben der Preis sein, den man für eine in dem beschriebenen<br />
Sinne praxisverflochtene Forschung zahlen muß. Aber die Soziologie sollte<br />
die Inflationsrate ihrer Papierwährung im Blick haben.<br />
Wenn ich anfangs sagte, daß die Weiterbildungsforschung erkennen <strong>und</strong><br />
akzeptieren mußte, daß sie einbezogen war in den Prozeß der beteiligten<br />
Kräfte, überhaupt erst konstruktiv politikfähig <strong>und</strong> politikbereit zu werden,<br />
so bin ich der Meinung, daß das im wesentlichen auch heute noch gilt. Noch<br />
für einige Zeit wird der Prüfstein für die Relevanz einzelner Forschungen<br />
auf dem Gebiet der Weiterbildung sein, wie weit sich der Forscher auf diesen<br />
Anspruch des Praxisfeldes einläßt. Gleichwohl zeigen sich auch in diesem<br />
Bereich Tendenzen, in denen sich Forschung <strong>und</strong> Praxis stärker separieren<br />
<strong>und</strong> vor allem Politikberatung aus dem Rahmen der wohl weiterhin<br />
stärker integrierten allgemeinen Verwendung sozialwissenschaftlicher Forschung<br />
ausschert <strong>und</strong> sich hier ebenfalls eher als selbständige Funktion der<br />
Wissenschaft versteht. Solche Politikberatung geht freilich das Risiko ein,<br />
mit größerer Beliebigkeit verwertet zu werden, aber für die Forschung mag<br />
diese Distanzierung auch einen Gewinn an Operationsmöglichkeiten versprechen.<br />
LITERATUR<br />
Arbeitskreis Strukturplan Weiterbildung (Schulenberg, W., Dikau, J., Raapke, H.-D.,<br />
Strzelewicz, W., Weinberg, J., Wiebecke, F.): Strukturplan für den Aufbau des öffentlichen<br />
Weiterbildungssystems in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland. Köln 1975.<br />
Bayer, M., Ortner, G.E., Thunemeyer, B. (Hrsg.): Bedarfsorientierte Entwicklungsplanung<br />
in der Weiterbildung, Opladen 1981.<br />
Beck, U., Lau, Chr.: „Bildungsforschung <strong>und</strong> Bildungspolitik". In: ZSE, 2/1983.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Bubenzer, R.: Gr<strong>und</strong>lagen der Staatspflichten auf dem Gebiet der Weiterbildung. Frankfurt/M.<br />
1983.<br />
Feidel-Mertz, H.: Erwachsenenbildung seit 1945, Köln 1975.<br />
Friebel, H.: Studierende Erwachsene im Zweiten Bildungsweg. Braunschweig 1978.<br />
v. Friedeburg, L.: „Konjunkturphasen öffentlichen Interesses an Bildungspolitik <strong>und</strong><br />
Bildungs<strong>soziologie</strong>". In: ZSE, 2/1983.<br />
Führenberg, D. u.a.: Weiterbildung in der Krise — Krise der Weiterbildung? Hg. v.<br />
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Bremen 1984.<br />
Fülgraff, B.: Stellen- <strong>und</strong> Qualifikationsanforderungen in der Erwachsenenbildung.<br />
Hannover 1975.<br />
Geulen, D.: „Bildungsreform <strong>und</strong> Sozialisationsforschung". In: ZSE, 2/1983.<br />
Janssen, A.: Der Zweite Bildungsweg für Schulabgänger ohne Hauptschulabschluß.<br />
Frankfurt/M. 1981.<br />
Keim, H. Olbrich, J., Siebert, H.: Strukturprobleme der Weiterbildung. Düsseldorf 1973.<br />
Knoll, J.H., Pöggeler, F., Schulenberg, W.: Erwachsenenbildung <strong>und</strong> Gesetzgebung.<br />
Köln/Wien 1983 (Gutachten EB-Gesetz Niedersachsen)<br />
Kuhlenkamp, D., Schütze, H.G. (Hrsg.): Kosten <strong>und</strong> Finanzierung der Weiterbildung.<br />
Frankfurt/M. 1982.<br />
Loeber, H.-D.: Beruf, Arbeitssituation <strong>und</strong> Weiterbildung. Diss. Oldenburg 1984.<br />
Lutz, B.: „Bildungssystem <strong>und</strong> Beschäftigungsstruktur in Deutschland <strong>und</strong> Frankreich".<br />
In: Mendius, H.G. (Hg.): Betrieb — Arbeitsmarkt — Qualifikation. Frankfurt/M.<br />
1976.<br />
v. Maydell.J. (Hrsg.): Bildungsforschung <strong>und</strong> Gesellschaftspolitik. Oldenburg 1982.<br />
Meulemann, H.: „Bildungsexpansion <strong>und</strong> Wandel der Bildungsvorstellungen zwischen<br />
1958 <strong>und</strong> 1979". In: Z.f.Soz. 11/1982.<br />
Nave-Herz, R.: Beruf — Freizeit — Weiterbildung. Darmstadt 1976.<br />
—, Erwachsenensozialisation. Weinheim 1981.<br />
Negt, O.: Soziologische Phantasie <strong>und</strong> exemplarisches Lernen. Frankfurt 1968.<br />
Otto, V., Schulenberg, W., Senzky, K. (Hrsg.): Realismus <strong>und</strong> Reflexion. <strong>München</strong><br />
1982.<br />
Plessner, H./Strzelewicz, W.: „Universität <strong>und</strong> Erwachsenenbildung". In: Volkshochschule<br />
— Handbuch der Erwachsenenbildung. Stuttgart 1961.<br />
Raapke, H.-D.,/Schulenberg, W.: Didaktik der Erwachsenenbildung. (Handbuch der<br />
Erwachsenenbildung, Bd. 7). Stuttgart 1984.<br />
Sass, J., Sengenberger, W., Weltz, Fr.: Weiterbildung <strong>und</strong> betriebliche Arbeitskr<br />
Scholz, W.-D., Wolter, A.: „Exklusivität oder Durchlässigkeit des Hochschulzugangs".<br />
In: J. v. Maydell Oldenburg 1982.<br />
Schulenberg, W.: Ansatz <strong>und</strong> Wirksamkeit der Erwachsenenbildung. Stuttgart 1957,<br />
21976 (Hildesheim-Studie)<br />
—,Plan <strong>und</strong> System: Zum Ausbau der deutschen Volkshochschulen. Weinheim 1968.<br />
—, Erwachsenenbildung. Wege der Forschung. Darmstadt 1978.<br />
—, Reform in der Demokratie. Ha<strong>mb</strong>urg 1976.<br />
—, Loeber, H.-D., Loeber-Pautsch, U., Pühler, S.: Soziale Faktoren der Bildungsbereitschaft<br />
Erwachsener. Stuttgart 1978 (Oldenburger Studie)<br />
—, Scholz, W.-D., Wolter, A., Mees. U., Fülgraff, B., v. Maydell, J.: Studienerfahrungen<br />
<strong>und</strong> Studienerfolg von Berufstätigen ohne Reifezeugnis in Niedersachsen. Forschungsbericht<br />
Oldenburg 1984.<br />
Schwab, H.: Schulräte <strong>und</strong> Politik. Oldenburg 1979.<br />
Senzky, K.: „Bildungspolitik als Aufgabe <strong>und</strong> Problem der Weiterbildungsforschung".<br />
In: H. Siebert (Hrsg.): Taschenbuch der Weiterbildungsforschung. Baltmannsweiler<br />
1979.<br />
Siebert, H. (Hrsg.): Praxis <strong>und</strong> Forschung in der Erwachsenenbildung. Opladen 1977.<br />
—, Taschenbuch der Weiterbildungsforschung. Baltmannsweiler 1979.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
—, Gerl, H.: Lehr- <strong>und</strong> Lernverhalten bei Erwachsenen. Braunschweig 1975.<br />
Strzelewicz, W.: Erwachsenenbildung — Soziologische Materialien. Heidelberg 1968.<br />
—, Bildungs<strong>soziologie</strong>. Handbuch der empirischen Sozialforschung, Bd. 14. Stuttgart<br />
1979.<br />
—, Über <strong>gesellschaftliche</strong> Voraussetzungen der Erwachsenenbildung". In: Ruprecht,<br />
H., Sitzmann, G. (Hrsg.): Erwachsenenbildung als Wissenschaft. Weltenburger<br />
Akademie, Bd. 5, 1978.<br />
—, Raapke, H.-D., Schulenberg, W.: Bildung <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong>s Bewußtsein. Stuttgart<br />
1966, Tb. 1972 (Göttinger Untersuchung)<br />
Tietgens, H.: Erwachsenenbildung zwischen Wissenschaft <strong>und</strong> Unterrichtspraxis. Braunschweig<br />
1977.<br />
—, „Wissensstruktur <strong>und</strong> Bildungsprozesse im Blickfeld von Wissenschaft <strong>und</strong> Forschung".<br />
In: H. Becker (Hrsg.): Wissenschaftliche Perspektiven zur Erwachsenenbildung.<br />
Braunschweig 1982<br />
Vath, R.: „Berufsforschung — Der Beruf der Erwachsenenpädagogen". In: Siebert<br />
1979.<br />
Vonderach, G.: Neue Undefinierte „Rollen" in der Wirtschaftsgesellschaft — Anzeichen<br />
des <strong>gesellschaftliche</strong>n Wandels? In: v. Maydell 1982<br />
Weinberg, J.: „Stand der Forschung über Erwachsenenbildung". In: Schmitz, D./<br />
Tietgens, H. (Hrsg.): Erwachsenenbildung (Enzyklopädie Erziehungswissenschaft<br />
Bd. 11). Stuttgart 1984.<br />
—, „Erwachsenenbildung als Gegenstand der Bildungspolitik <strong>und</strong> der Sozialwissenschaft."<br />
In: N. Pol. Lit. 22 (1977).<br />
Weymann, A.: „Weiterbildung zwischen Instrumentalisierung <strong>und</strong> Irritation. In: ZSE<br />
2/1983<br />
—, u.a.: Der Hauptschulabschluß in der Weiterbildung. Erwachsenenbildung zwischen<br />
Bildungspolitik <strong>und</strong> Sozialpolitik. Paderborn 1980.<br />
Wiese, L.v. (Hrsg.): Soziologie des Volksbildungswesens. <strong>München</strong> 1921.<br />
Zapf, W. (Hrsg.): Lebensbedingungen in der B<strong>und</strong>esrepublik. Frankfurt/M. 1977.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
WEITERBILDUNG UND POLITIKBERATUNG<br />
Wolfgang Zapf<br />
In diesem kurzen Beitrag will ich (1) einige Informationen über die bisherigen<br />
Zukunftskongresse der Landesregierung von Baden-Württe<strong>mb</strong>erg<br />
<strong>und</strong> die ihnen zugr<strong>und</strong>e liegenden Kommissionsberichte geben; (2) will<br />
ich die Schwerpunkte des Kommissionsberichts „Weiterbildung: Herausforderung<br />
<strong>und</strong> Chance" nennen, der Mitte Deze<strong>mb</strong>er 1984 vorgelegt wird.<br />
Ich selbst bin kein Experte für Weiterbildung, sondern habe in den letzten<br />
beiden Kommissionen als Sozialwissenschaftler mitgearbeitet <strong>und</strong> Probleme<br />
des sozialstrukturellen Wandels <strong>und</strong> der gesamt<strong>gesellschaftliche</strong>n Innovationschancen<br />
behandelt.<br />
I<br />
Die Landesregierung von Baden-Württe<strong>mb</strong>erg hat, wie andere Regierungen<br />
auch, eine ganze Reihe von Kommissionen mit verschiedenen längerfristigen<br />
Problemanalysen befaßt. Es war aber eine besondere Initiative des Ministerpräsidenten,<br />
im Deze<strong>mb</strong>er 1982 die Ergebnisse der Kommission „Forschungspolitik"<br />
(<strong>und</strong> auch Ergebnisse der Kommission „Neue Medien")<br />
in einem großen öffentlichen Kongreß über „Zukunftschancen eines Industrielandes"<br />
vorzustellen. Dieser Kongreß hat große Aufmerksamkeit<br />
erfahren, aber den Veranstaltern auch den Vorwurf des Technokratentums<br />
<strong>und</strong> der Insensibilität gegenüber den sozialen Folgen neuer Technologien<br />
<strong>und</strong> Medien eingetragen.<br />
Dies war die Situation, in der dann auch Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialwissenschaftler<br />
gefragt waren <strong>und</strong> gefragt wurden. 1983 wurde Rudolf Wildenmann<br />
mit der Leitung einer weiteren Kommission, „Zukunftsorientierte<br />
<strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklungen", beauftragt, <strong>und</strong> in dieser Kommission<br />
haben dann u.a. H. Baier, K.W. Deutsch, B. Fritsch, H. Klages,<br />
H. Lübbe <strong>und</strong> ich selbst — um nur die engeren Fachkollegen zu<br />
nennen — mitgearbeitet. Der Kommissionbericht umfaßte drei Hauptteile:<br />
— Gesellschaftliche Vielfalt — Neue Lebenschancen, erneuerte Institutionen<br />
— Innovative soziale Marktwirtschaft — Beschäftigungschancen in einer<br />
wachsenden Wirtschaft<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
— Humanität, Flexibilität, Produktivität — Neue Chancen in der Arbeitswelt.<br />
Der Bericht <strong>und</strong> der zweite Kongreß „Zukunftschancen eines Industrielandes"<br />
(im Deze<strong>mb</strong>er 1983) haben erneut ein großes Echo gehabt. Mehr<br />
als 20.000 Exemplare des Berichts sind bestellt worden. Akademien haben<br />
Tagungen über die Gesamtthematik <strong>und</strong> einzelne Themen durchgeführt.<br />
Andere B<strong>und</strong>esländer haben ähnliche Veranstaltungen organisiert. Herr<br />
Wissenschaftsminister Krumsiek von Nordrhein-Westfalen hat in seiner<br />
gestrigen Eröffnungsrede unsere Kommission in m.E. unqualifizierter<br />
Weise zur Sprache gebracht, weshalb ich Sie auffordern möchte, sich die<br />
Materialien zu beschaffen <strong>und</strong> sich selbst ein Urteil zu bilden. Die Opposition<br />
in Baden-Württe<strong>mb</strong>erg hat der Regierung vorgeworfen, mit Kom<br />
1<br />
missionen <strong>und</strong> Kongressen durch „exklusive Zirkel" <strong>und</strong> „modische Verfassungsorgane"<br />
am Parlament vorbeizugehen.<br />
Meine Erfahrungen mit dieser Art von Politikberatung sind folgende:<br />
— Man kann keine direkten Wirkungen erzielen, aber vielleicht doch die<br />
Agenda von Diskussionen beeinflussen <strong>und</strong> Akzente setzen. Politiker sind<br />
vielbeschäftigte Leute, die in der Regel nicht um Rat fragen <strong>und</strong> die sich<br />
nicht belehren lassen. Wie andere Führungsgruppen auch, suchen sie jedoch<br />
ständig nach Konzepten <strong>und</strong> Deutungsangeboten.<br />
— In der Beteiligung an der Konzeptualisierung von Problemen <strong>und</strong> Lösungsvorschlägen<br />
haben auch <strong>und</strong> gerade die Sozialwissenschaftler eine<br />
Chance. Wir haben nur wenige eigenständige Kompetenzen, aber empirisch<br />
gestützte Gesellschaftsanalysen bleiben gefragt. Wenn man Sozialwissenschaftler<br />
an solchen Unternehmungen beteiligt, kann man ihre Disziplin<br />
nicht mehr global diffamieren. Wenn sie in den Dialog mit Entscheidungsträgern<br />
eintreten, können sie Gesichtspunkte transportieren, die sonst nicht<br />
ausreichend wahrgenommen werden, z.B. die sozialen Voraussetzungen<br />
<strong>und</strong> Folgen technologischer Entwicklungen, eine differenziertere Sicht<br />
des sog. Wertewandels, kritische Analysen des politischen Prozesses selbst,<br />
<strong>und</strong> ganz generell die Perspektive von Ungleichheiten <strong>und</strong> Konflikten.<br />
— Die Medien reagieren in der Regel nur auf unerwartete Nachrichten.<br />
Inmitten der Krisenmeldungen, Angstkampagnen <strong>und</strong> Orwell-Visionen<br />
der Jahreswende 1983/84 haben unsere Thesen über die Innovationsprozesse<br />
<strong>und</strong> Innovationschancen in Gesellschaft, Wirtschaft <strong>und</strong> Arbeitswelt<br />
deshalb einen Nachrichtenwert gehabt; sie waren sozusagen die ideologiepolitische<br />
Neuigkeit des 1983er Berichts.<br />
II<br />
Aus dem Kongreß von 1983 hat sich „Weiterbildung" als Thema für eine<br />
weitere Kommission <strong>und</strong> den Kongreß Ende 1984 ergeben. Die Kommis-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
sion „Weiterbildung" wird von dem Betriebswirtschaftler Eduard Gaugier<br />
geleitet; ihr Bericht umfaßt wiederum drei Teile sowie zusammenfassende<br />
Empfehlungen:<br />
— Das Innovationspotential der Weiterbildung — Herausforderungen<br />
<strong>und</strong> Ziele; eine Bestandsaufnahme der Weiterbildung; Zukunftsaufgaben<br />
der Weiterbildung<br />
— Allgemeine Weiterbildung: Aufforderung an alle — Ziele <strong>und</strong> Handlungsfelder;<br />
Künftige Schwerpunkte; Adressaten; Zielgruppen mit<br />
besonderem Bedarf<br />
— Berufliche Weiterbildung: Investitition in die Zukunft — Antriebskräfte<br />
<strong>und</strong> Perspektiven; Wachstumsfelder; Gestaltungsaufgaben.<br />
Wiederum mache ich mir keine Illusionen über die direkte Wirksamkeit<br />
der Analysen <strong>und</strong> Empfehlungen der Kommission. Aber ihre Berufung,<br />
ihr Bericht <strong>und</strong> der anschließende Kongreß stellen doch eine unübersehbare<br />
Selbstverpflichtung der Landesregierung dar, die Anstrengungen<br />
auf dem Gebiet der Weiterbildung zu verstärken — zumal Baden-Württe<strong>mb</strong>erg,<br />
bei allen sonstigen Standortvorteilen <strong>und</strong> Erfolgen, in der Weiterbildung<br />
bisher keine Spitzenstellung einnimmt. Ich nehme an, daß sich u.a.<br />
die folgenden Punkte aus dem Kommissionsbericht in der öffentlichen<br />
Diskussion festsetzen werden:<br />
— Die Weiterbildung ist vom quantitativen Gewicht <strong>und</strong> von ihrer zukünftigen<br />
Bedeutung her ein eigenständiger „vierter Bildungssektor" in der<br />
B<strong>und</strong>esrepublik (neben Schule, Berufsausbildung <strong>und</strong> Hochschule). Sie<br />
ist darüber hinaus derjenige Teil unseres Bildungswesens, der überwiegend<br />
nicht-staatlich organisiert oder geregelt ist. Hier gibt es einige der Möglichkeiten<br />
für Kooperation <strong>und</strong> Konkurrenz, für individuelle Wahl <strong>und</strong> Kompensation,<br />
die häufig in den anderen Bildungsbereichen vermißt werden.<br />
— Die Beteiligung an der Weiterbildung ist nach sozialen Gruppen sehr<br />
unterschiedlich, <strong>und</strong> diese Unterschiede haben sich offenbar in den lezten<br />
Jahren noch vergrößert. Die berufliche Weiterbildung wird zunehmend<br />
stärker Anpassungsqualifikation als Aufstiegsqualifikation, d.h. sie wird<br />
ein zentraler Mechanismus für die individuelle Bewältigung des notwendigen,<br />
wirtschaftlichen Strukturwandels. Dabei müssen — in der beruflichen<br />
wie in der allgemeinen Weiterbildung — die bisher unterrepräsentierten<br />
Gruppen verstärkt angesprochen <strong>und</strong> motiviert werden: un- <strong>und</strong> angelernte<br />
Beschäftigte, ältere Arbeitnehmer, Ausländer, Arbeitslose, Frauen,<br />
die in den Beruf zurück wollen, Senioren, die die „dritte Lebensphase"<br />
aktiv gestalten wollen.<br />
— Die staatliche Unterstützung der Weiterbildung muß nachhaltig verstärkt<br />
werden, ohne daß das Prinzip der Selbstbeteiligung der Teilnehmer<br />
<strong>und</strong> der Selbständigkeit der Träger aufgegeben wird: für hauptberufliches<br />
Personal, für nebenberufliche Lehrkräfte, für die Bildungseinrichtungen,<br />
für Organisation <strong>und</strong> Werbung. In diesem Rahmen ist auch das Thema<br />
des Bildungsurlaubs neu zu diskutieren.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Die Kommission „Weiterbildung" hat sich bemüht, eine realistische<br />
Zukunftsperspektive zu entwickeln <strong>und</strong> dabei auch Konflikte, Ungleichheiten<br />
<strong>und</strong> Ausleseprozesse anzusprechen, die in der Weiterbildung auch<br />
angelegt sind. Weiterbildung ist kein Allheilmittel. Insgesamt sieht sie<br />
jedoch im Wissen <strong>und</strong> Lernen eine prinzipiell unerschöpfliche Ressource<br />
der Innovation: der Kompetenzsteigerung, Flexibilisierung, Kompensation<br />
<strong>und</strong> der individuellen Wahlmöglichkeiten.<br />
In unserem Zusammenhang interessiert sicher auch, daß die Kommission<br />
zwei sozialwissenschaftliche Gutachten in Auftrag gegeben hat. 2<br />
Hier konnten Sozialwissenschaftler zeigen, daß sie in der Lage sind, in<br />
wenigen Wochen wesentliche Beiträge zur Klärung schwieriger Sachverhalte<br />
— der unterschiedlichen Beteiligung verschiedener sozialer Gruppen<br />
<strong>und</strong> Berufe <strong>und</strong> ihrer Determinanten — vorzulegen. Dies bestätigt mich<br />
in der Ansicht, daß die Mitarbeit in solchen Kommissionen auch für das<br />
Ansehen unseres Faches <strong>und</strong> für den Nachweis seiner Kompetenz, zu aktuellen<br />
Fragen übersichtliche <strong>und</strong> verständliche Antworten zu geben, eine<br />
wichtige Rolle spielen kann.<br />
ANMERKUNGEN<br />
1 Die Kommissionsberichte <strong>und</strong> Kongreßberichte sind erhältlich beim Staatsministerium<br />
Baden-Württe<strong>mb</strong>erg, Richard-Wagner-Straße 15, 7000 Stuttgart 1: Zukunftsperspektiven<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>r Entwicklungen, Nove<strong>mb</strong>er 1983.<br />
Weiterbildung: Herausforderung <strong>und</strong> Chance, Nove<strong>mb</strong>er 1984.<br />
2 Es handelt sich um folgende Gutachten, die bei den angegebenen Projekten erhältlich<br />
sind:<br />
Heinz-Herbert Noll, „Die Bedeutung der Weiterbildung für Berufsverlauf <strong>und</strong><br />
Qualifikation", Sonderforschungsbereich 3 Frankfurt/Mannheim, Universität<br />
Mannheim.<br />
Angelika Willms/Karin Kurz, „Die Weiterbildungsteilnahme der Berufstätigen in<br />
Baden-Württe<strong>mb</strong>erg", VASMA-Projekt, Universität Mannheim.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
BILDUNG UND WERTWANDEL: AM BEISPIEL VON<br />
„LEISTUNG" IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND<br />
ZWISCHEN 1950 UND 1980 1<br />
Heiner<br />
Meulemann<br />
In der Geschichte der B<strong>und</strong>esrepublik laufen zwei Entwicklungen erstaunlicherweise<br />
fast parallel: die Bildungsexpansion <strong>und</strong> der Wertwandel. Die<br />
Bildungsexpansion bezeichnet die Tatsache, daß in der zweiten Hälfte der<br />
60er <strong>und</strong> der ersten Hälfte der 70er Jahre der Anteil der Sek<strong>und</strong>ar- <strong>und</strong> der<br />
Hochschüler an der Bevölkerung fast doppelt so stark zunimmt wie in den vorausgehenden<br />
Jahren (Meulemann 1982). Sie ist eine fast ruckartige Verstärkung<br />
des säkularen Trends steigender Bildungsteilhabe: Auf einen kontinuierlichen<br />
langsamen Anstieg folgt eine sprunghafte Steigerung, die heute wieder<br />
in eine langsame Steigerung oder gar Stagnation übergeht. Der Wertwandel<br />
läßt sich, wenn man alle verfügbaren, kontinuierlichen <strong>und</strong> längerfristigen<br />
Zeitreihen durchgeht (Meulemann 1983), mit folgenden Trends beschreiben:<br />
Leistung <strong>und</strong> religiöse Werthaltungen gehen zurück, politische Teilhabe <strong>und</strong><br />
Egalitarismus im Privatleben steigen an. Die vier Trends verlaufen weitgehend<br />
parallel. Auf eine Phase relativer Konstanz von 1950 bis in die Mitte der sechziger<br />
Jahre folgt eine Phase des U<strong>mb</strong>ruchs bis in die Mitte der siebziger Jahre,<br />
die wiederum von einer Phase relativer Konstanz abgelöst wird.<br />
Bildungsexpansion <strong>und</strong> Wertwandel fallen also fast genau in der zweiten<br />
Hälfte der sechziger Jahre zusammen, <strong>und</strong> in beiden Fällen ist weiterhin<br />
die Phase des akuten Wandels von Phasen relativer Konstanz vorher<br />
<strong>und</strong> nachher begleitet. Beruht das Zusammentreffen von Bildungsexpansion<br />
<strong>und</strong> Wertwandel auf Wandlungen im Zusammenhang zwischen Bildung<br />
<strong>und</strong> Werten? Auf diese Frage kann man eingehen, indem man Gruppen<br />
unterschiedlicher Bildungsniveaus im Zeitverlauf vergleicht. Gehen<br />
die besser Ausgebildeten im Wertwandel voran? Ändern sich die Zusammenhänge<br />
zwischen Bildung <strong>und</strong> Werten im Laufe der Bildungsexpansion<br />
<strong>und</strong> des Wertwandels? Ich will im folgenden zunächst Hypothesen für<br />
Verlaufsformen des Wertwandels in Bildungsgruppen entwickeln (Abschnitt<br />
1) <strong>und</strong> sie dann an drei Indikatoren für den Wert Leistung überprüfen<br />
(Abschnitt 2).<br />
1. Hypothesen für Verlaufsformen des Wertwandels in Bildungsgruppen<br />
Über den Zeitraum von 30 Jahren können sich die Entwicklungen in den<br />
einzelnen Gruppen zu sehr vielen Bildern zusammenfügen. Um die Mög-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
lichkeiten einzuschränken, setze ich zweierlei voraus: Erstens soll die dreiphasige<br />
Verlaufsform mit Konstanz-Wandel-Konstanz <strong>und</strong> der Rückgang<br />
des Leistungswertes auch für jede Bildungsgruppe gelten. Zweitens soll<br />
zumindest zu Anfang der Entwicklung in den besser ausgebildeten Gruppen<br />
Leistung höher bewertet sein. Dann sind folgende Hypothesen denkbar:<br />
Zunächst könnten die Entwicklungen in beiden Bildungsgruppen<br />
parallel verlaufen <strong>und</strong> die Beziehung zwischen Bildung <strong>und</strong> Werten konstant<br />
bleiben. Dann liegt ein allgemeiner, von der Bildung unabhängiger Trend<br />
vor. Diese Hypothese nenne ich die Globaltrend-Hypothese. Sie geht zwar<br />
nicht auf Zusammenhänge zwischen Bildungsexpansion <strong>und</strong> Wertwandel<br />
ein, aber sie stellt eine Art Nullhypothese dar, von der ich vier weitere<br />
Hypothesen absetzen möchte, die inhaltlich gehaltvolle Aussagen über den<br />
Zusammenhang zwischen Bildung <strong>und</strong> Werten machen.<br />
Die erste Hypothese unterstellt, daß die besser ausgebildete Gruppe in<br />
der Phase des Wandels vorangeht, die schlechter ausgebildete aber schließlich<br />
wieder nachzieht. Bildung hätte hier also die Funktion eines Multiplikators.<br />
Der akute Wertwandel setzt sich von oben nach unten durch,<br />
auf die Dauer aber bleiben die Unterschiede gleich. Entsprechend nenne<br />
ich diese Hypothese die Avantgarde-Hypothese. Sie sagt also nur eine<br />
vorübergehende Veränderung der Beziehung zwischen Bildung <strong>und</strong> Werten<br />
voraus; über den ganzen Zeitraum ändert sich die Beziehung nicht. Sie<br />
dürfte vor allem dann zutreffen, wenn ein Wertwandel rein innerkulturell<br />
ausgelöst wird <strong>und</strong> abläuft: Mit charakteristischen Verzögerungen zwischen<br />
Milieus verschieben sich Werte, die Beziehungen zwischen Milieu <strong>und</strong><br />
Werten aber bleiben langfristig konstant. Das ist mit einem konstanten<br />
Anteil verschiedener Bildungsabschlüsse an der Bevölkerung durchaus<br />
vereinbar. Die erste Hypothese nimmt also keinen Bezug auf die Bildungsexpansion,<br />
die den Wertwandel begleitet. Das aber soll in den übrigen<br />
Hypothesen geschehen, für die die Rolle der Bildungsexpansion im Wertwandel<br />
genauer erläutert werden muß.<br />
Bildungsabschlüsse in modernen Industriegesellschaften sind doppeldeutig.<br />
Sie verweisen auf Qualifikationen <strong>und</strong> auf Werthaltungen. Sie bieten<br />
Lebenschancen, die sich im Beruf realisieren, <strong>und</strong> sie fordern eine Lebensführung,<br />
die sich in der Familie, in der Freizeit ausdrückt. Die Expansion<br />
weiterführender Bildung in den letzten 20 Jahren hat nun — so vermute<br />
ich — den Charakter von Bildung als Lebenschance <strong>und</strong> Lebensführung<br />
verändert. Sie hat die Selbstverständlichkeit des Statusanspruchs von<br />
Bildung erschüttert <strong>und</strong> die Lebenschance Bildung abgewertet. Zugleich<br />
aber wurde Bildung auch als Lebensführung — geistige Arbeit als zweckfrei<br />
betriebener, dennoch aber Sicherheit <strong>und</strong> materielle Versorgung garantierender<br />
Lebensinhalt — aufgelöst. Der Besitz von Bildungspatenten definiert<br />
heute statistische Gruppen, die sich durch die Teilhabe an der allgemeinen<br />
Kultur, durch Mitsprache an den öffentlichen Problemdefinitionen<br />
unterscheiden. Statt Lebenschancen zu bestimmen <strong>und</strong> eine Lebensführung<br />
zu prägen, ist Bildung mit einem kulturellen Lebensstil verb<strong>und</strong>en;<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
vom strukturellen ist Bildung zum kulturellen Merkmal geworden. Wenn<br />
nun durch die Bildungsexpansion der Bedeutungsschwerpunkt der Bildung<br />
sich von Lebenschancen zum Lebensstil verlagert hat, dann müßte<br />
sich auch die Beziehung zwischen Bildung <strong>und</strong> Werten im Zeitverlauf nicht<br />
nur vorübergehend, sondern dauerhaft verändern. Entsprechend lassen<br />
sich drei weitere Hypothesen denken, die alle eine dauerhafte Veränderung<br />
der Beziehung unterstellen.<br />
Die zweite <strong>und</strong> dritte Hypothese unterstellen, daß die Größe der<br />
Differenz zwischen den Bildungsgruppen sich verändert, die Richtung<br />
jedoch gleich bleibt. Die zweite Hypothese nimmt an, daß die Differenz<br />
wächst, die dritte, daß sie schrumpft. Entsprechend bezeichne ich die<br />
zweite als die Differenzierungs-, die dritte als die Nivellierungshypothese.<br />
Die vierte Hypothese unterstellt, daß die Größe <strong>und</strong> die Richtung der<br />
Differenz sich verändert. Ich bezeichne die vierte Hypothese als die Lebensstil-Hypothese.<br />
Die Lebensstil-Hypothese ist eine Radikalisierung der<br />
Nivellierungshypothese. Die Annäherung der beiden Gruppen wird so weit<br />
getrieben, bis die Beziehung sich umkehrt. Wenn das passiert, dann liegt<br />
tatsächlich ein sehr deutliches Indiz vor, daß ganz unterschiedliche Sachverhalte<br />
unter dem Namen Bildung den Wert Leistung beeinflussen. Leistung<br />
ist ein Wert, der soziale Ungleichheiten rechtfertigen kann. Sie kann<br />
darüber hinaus um so eher das subjektive Bild von Selbst <strong>und</strong> Umwelt<br />
prägen, je höher die objektiven Chancen im sozialen Status sind. Solange<br />
Bildung daher ein Indikator für Lebenschancen ist, sollte sie mit der Betonung<br />
von Leistung positiv zusammenhängen. Auf der anderen Seite wurde<br />
das Leistungsprinzip in den letzten Jahren wegen seiner psychischen <strong>und</strong><br />
sozialen Kosten kritisiert, <strong>und</strong> diese Kritik war im höheren Bildungswesen<br />
besonders populär. Sobald also Bildung ein Indikator für einen kulturellen<br />
Lebensstil wird, sollte sie mit der Betonung von Leistung negativ zusammenhängen.<br />
Wenn also Bildung ihren Bedeutungsschwerpunkt von Lebenschancen<br />
zum Lebensstil verlagert hat, dann könnte man eine Umkehrung<br />
der Korrelation mit Leistung erwarten.<br />
Auch ein Umschlagen der Korrelation aber belegt noch keinen Zusammenhang<br />
zwischen Bildungsexpansion <strong>und</strong> Wertwandel. Einen wichtigen<br />
empirischen Hinweis dafür aber kann man gewinnen, wenn man den<br />
Einfluß der Bildung mit dem Einfluß des Berufs, des wichtigsten Indikators<br />
für Lebenschancen, im Zeitablauf vergleicht. Die für die Bildung<br />
unterstellte Umkehrung der Beziehung könnte dann auch für Berufsgruppen<br />
auftauchen. In diesem Falle müßte man für beide Statusvariablen unterstellen,<br />
daß sie früher für Lebenschancen, heute aber für Lebensstile stehen.<br />
Der Wandel des Charakters von Bildung ließe sich nicht spezifisch auf die<br />
Bildungsexpansion zurückführen. Taucht die Umkehrung der Beziehung<br />
jedoch nur bei der Bildung, nicht aber beim Beruf auf, so kann man sagen,<br />
daß Bildung sich von Lebenschancen- zum Lebensstil-Indikator gewandelt<br />
hat, der Beruf aber nach wie vor für Lebenschancen steht. Der Wandel<br />
bei der Bildung ließe sich dann mit einiger Berechtigung auf die Bildungs-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
expansion zurückführen. Ich will Zeitreihen für Bildungsgruppen mit Zeitreihen<br />
für Berufsgruppen an drei Indikator-Fragen für den Wert Leistung<br />
vergleichen.<br />
2. Die Entwicklung von Leistung in Bildungs- <strong>und</strong> Berufsgruppen<br />
Die erste Frage — „Leben als Aufgabe" — wird zwischen 1956 <strong>und</strong> 1968<br />
von etwa 60%, zwischen 1972 <strong>und</strong> 1980 von etwa 50% der Bevölkerung<br />
bejaht. Leistung als umfassender Lebenswert geht also um etwa 10 Prozentpunkte<br />
zurück. Dieser Trend findet sich — wie man in Abb. 1 sehen<br />
kann — in beiden Bildungsgruppen wieder — jedoch in unterschiedlicher<br />
2<br />
Stärke <strong>und</strong> Gestalt. Bei den Volksschulabsolventen findet man nur einen<br />
sehr schwachen Rückgang, bei der Gruppe mit mehr als Volksschulabschluß<br />
dagegen einen um so stärkeren Rückgang, der sich ruckartig zum<br />
Ende der sechziger Jahre durchsetzt. Der Unterschied zwischen beiden<br />
Trends ist so stark, daß die Richtung der Beziehung umschlägt. Zwischen<br />
1956 <strong>und</strong> 1968 hängen Bildung <strong>und</strong> „Leben als Aufgabe" zu vier Zeitpunkten<br />
positiv, zwischen 1972 <strong>und</strong> 1981 zu vier Zeitpunkten negativ<br />
zusammen. Zwischen 1968 <strong>und</strong> 1972 blieb „Leben als Aufgabe" bei<br />
Volksschulabsolventen nahezu konstant, sank aber bei den besser Ausgebildeten<br />
um 15 Prozentpunkte. Diese Ergebnisse bestätigen die Lebensstil-Hypothese.<br />
In den fünfziger <strong>und</strong> frühen sechziger Jahren wird Leistung<br />
als ein sozial legitimierender Wert eher von denen bejaht, die über die besseren<br />
Lebenschancen verfügen; seit den späten sechziger Jahren aber wird<br />
Leistung als ein psychisch <strong>und</strong> sozial kostspieliger Wert eher von denen<br />
zurückgewiesen, die an einem kulturellen Lebensstil teilhaben können.<br />
In den fünfziger <strong>und</strong> frühen sechziger Jahren stand Bildung eher für Lebenschancen,<br />
seit den späten sechziger Jahren eher für einen Lebensstil.<br />
Auch in allen Berufsgruppen findet sich der globale Rückgang wieder,<br />
nun aber überall in ungefähr gleicher Stärke <strong>und</strong> Gestalt. Entsprechend<br />
3<br />
bleibt auch die Beziehung zwischen Beruf <strong>und</strong> „Leben als Aufgabe" über<br />
die Zeit konstant; die Rangfolge der Berufe ist, mit unwesentlichen Ausnahmen,<br />
zu jedem Zeitpunkt gleich: die Landwirte rangieren in der Betonung<br />
von Leistung vor den Beamten <strong>und</strong> Selbständigen <strong>und</strong> vor den<br />
Angestellten <strong>und</strong> Arbeitern. Sieht man von den Landwirten ab, so kann<br />
man die Berufsgruppen unter dem Gesichtspunkt der Lebenschancen als<br />
ordinale Variable interpretieren. Dann ist die Beziehung zwischen den<br />
Berufsgruppen <strong>und</strong> „Leben als Aufgabe" positiv <strong>und</strong> kann als Wirkung<br />
steigender Lebenschancen verstanden werden: Mit den Lebenschancen<br />
wachsen die Wertansprüche, die man an sich <strong>und</strong> sein Leben stellt. Die<br />
höheren Berufsgruppen identifizieren sich über den ganzen betrachteten<br />
Zeitraum stärker mit dem Wert Leistung — so wie die höheren Bildungsgruppen<br />
zu Beginn des betrachteten Zeitraums. Ganz offensichtlich hat<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
sich der Charakter des Berufs nicht gewandelt: Er steht nach wie vor für<br />
Lebenschancen.<br />
Der Wandel des Charakters der Bildung <strong>und</strong> die Konstanz des Charakters<br />
des Berufs legen es uns nahe, die Bildungsexpansion als einen Auslöser<br />
des Wertwandels zu sehen. Nicht nur ist der Anteil höherer Abschlüsse<br />
in der Bevölkerung gestiegen, sondern gerade in den besser ausgebildeten<br />
Bevölkerungsgruppen hat der Wert Leistung an Boden verloren. Die Beziehung<br />
zwischen Bildung <strong>und</strong> „Leben als Aufgabe" hat sich dadurch umgekehrt.<br />
Die Beziehung zwischen Beruf <strong>und</strong> „Leben als Aufgabe" über den<br />
gleichen Zeitraum ist jedoch konstant geblieben. Die Konkurrenz struktureller<br />
<strong>und</strong> kultureller Komponenten, die in Bildung immer enthalten ist,<br />
wird offenbar zunehmend zugunsten der kulturellen Komponenten aufgelöst.<br />
Die zweite Frage — „Leben ohne Arbeit" — wird zwischen 1952 <strong>und</strong><br />
1963 von etwa 12%, zwischen 1972 <strong>und</strong> 1981 von etwa 20% der Bevölkerung<br />
bejaht. Leistung als Lebenssinn geht also — da es sich um eine<br />
negativ formulierte Frage handelt — um etwa 8 Prozentpunkte zurück.<br />
Dieser Trend findet sich auch in beiden Bildungsgruppen. Wie bei „Leben<br />
4<br />
als Aufgabe" ist aber die Stärke der Entwicklung unterschiedlich: Wiederum<br />
ist der Rückgang des Wertes Leistung in der besser ausgebildeten<br />
Gruppe stärker. Allerdings gibt es nur eine Nivellierung der Unterschiede,<br />
kein Umschlagen der Beziehung: In der Periode vor 1963 sind die besser<br />
Ausgebildeten leistungsfre<strong>und</strong>licher, in der Periode nach 1972 gibt es nur<br />
noch minimale Unterschiede <strong>und</strong> einmal sogar ein Umschlagen der Beziehung.<br />
In der kritischen Periode zwischen 1963 <strong>und</strong> 1972 geht zwar in<br />
beiden Gruppen der Wert Leistung zurück, aber in der besser ausgebildeten<br />
Gruppe doch deutlich stärker. Die Ergebnisse bestätigen also nicht die<br />
Lebensstil-, sondern die Nivellierungshypothese. Die Nivellierung kann<br />
als ein Wandel von Lebenschancen zum Lebensstil verstanden werden,<br />
der nicht stark genug war, die Beziehung zwischen Bildung <strong>und</strong> Werten<br />
umzukehren.<br />
Auch in den meisten Berufsgruppen findet sich der globale Rückgang<br />
des Wertes Leistung wieder: „Leben ohne Arbeit" steigt bei Arbeitern,<br />
Angestellten <strong>und</strong> Beamten im Durchschnitt etwa 5 Prozentpunkte an,<br />
bei den Selbständigen <strong>und</strong> Landwirten ist die Entwicklung nicht einheitlich.<br />
Die Rangfolge aber, in der die Berufsgruppen sich ein Leben ohne<br />
Arbeit wünschen, bleibt — als eine Regel mit Ausnahmen — gleich. Die<br />
Regel ist, daß Arbeiter häufiger als Beamte <strong>und</strong> Angestellte <strong>und</strong> als Selbständige<br />
<strong>und</strong> Landwirte ein Leben ohne Arbeit wünschen. Interpretiert<br />
man die Berufsgruppen wiederum als ordinale Variable, so ist die Beziehung<br />
zwischen Beruf <strong>und</strong> „Leben ohne Arbeit" negativ, die Beziehung zwischen<br />
Beruf <strong>und</strong> dem Wert Leistung positiv. Die höheren Berufsgruppen<br />
identifizieren sich durchgängig mit dem Wert Leistung, so wie die höheren<br />
Bildungsgruppen zu Beginn der betrachteten Periode in starkem, zum<br />
Ende in sehr schwachem Maße. Der Charakter des Berufs hat sich nicht<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
gewandelt: Er steht nach wie vor für Lebenschancen. Wie beim „Leben als<br />
Aufgabe" kann man also auch beim „Leben ohne Arbeit" die Bildungsexpansion<br />
als einen Auslöser des Wertwandels sehen. Auch hier ist der<br />
Wandel besonders deutlich in den besser ausgebildeten Gruppen, während<br />
alle Berufsgruppen im wesentlichen gleich bleiben. „Leben ohne Arbeit"<br />
bestätigt also die Ergebnisse zu „Leben als Aufgabe", wenn auch in einer<br />
weniger deutlichen Weise.<br />
Die dritte Frage — „intrinsische Arbeitsqualität" — wird zwischen<br />
1949 <strong>und</strong> 1962 von etwa 55%, von 1974 bis 1979 von etwa 40% der<br />
Bevölkerung bejaht. Leistung als Sinn der Arbeit geht also um etwa 15 Prozentpunkte<br />
zurück. Dieser Trend findet sich in beiden Bildungsgruppen<br />
wieder, in fast vollständig gleicher Stärke <strong>und</strong> Gestalt. Von Differenzierung<br />
oder Nivellierung oder gar einer Umkehrung der Beziehung zwischen<br />
5<br />
Bildung <strong>und</strong> Leistung kann keine Rede sein. Die Ergebnisse bestätigen<br />
sehr klar die Globaltrend-Hypothese. In der Wertschätzung „intrinsischer<br />
Arbeitsqualität" drücken sich also unverändert Lebenschancen aus, die<br />
mit dem Bildungsgrad gemessen werden. Auch in allen Berufsgruppen<br />
findet sich der globale Rückgang wieder, <strong>und</strong> die Beziehung zwischen<br />
Beruf <strong>und</strong> „intrinsischer Arbeitsqualität" bleibt konstant; die Beamten<br />
rangieren in der Betonung von Leistung vor den Selbständigen <strong>und</strong> Landwirten,<br />
den Angestellten <strong>und</strong> den Arbeitern. Wenn man die Berufsgruppen<br />
wiederum als ordinale Variable interpretiert, so ist die Beziehung positiv:<br />
Je höher die Lebenschancen, desto besser die Bewertung der Arbeitsqualität.<br />
Die höheren Berufsgruppen identifizieren sich stärker mit dem Wert<br />
Leistung, genauso wie die höheren Bildungsgruppen. Gemessen an der<br />
Beziehung zur „intrinsischen Arbeitsqualität" hat sich der Charakter weder<br />
der Bildung noch des Berufs gewandelt.<br />
3. Bewertung <strong>und</strong> Schlußfolgerung<br />
Wenn man die Beziehungen aller drei Leistungs-Indikatoren mit Bildung<br />
<strong>und</strong> Beruf zwischen 1950 <strong>und</strong> 1980 überblickt, welche Hypothese schneidet<br />
dann am besten ab? Als erstes fällt auf, daß die Avantgarde-Hypothese<br />
in keinem Falle bestätigt wurde: Als ein rein innerkultureller Multiplikator-Prozeß<br />
kann der Wandel von Leistung nicht verstanden werden. Er<br />
muß im Zusammenhang mit den strukturellen Wandlungen der Bildungsexpansion<br />
gesehen werden: Allein die Globaltrend-Hypothese <strong>und</strong> die<br />
drei Hypothesen, die Bildung im Übergang von Lebenschancen zum Lebensstil<br />
sehen, werden den Ergebnissen gerecht. Von diesen drei Hypothesen<br />
wiederum wird die Differenzierungshypothese nicht, wohl aber die Nivellierungs-<br />
<strong>und</strong> die Lebensstil-Hypothese bestätigt, <strong>und</strong> dort, wo Nivellierungsoder<br />
Lebensstil-Hypothese für die Bildung bestätigt werden, läßt sich für<br />
den Beruf nur ein globaler Trend feststellen. Wenn Bildung also zunehmend<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
auf einen kulturellen Lebensstil deutet, so führt dies nicht zu einer Differenzierung,<br />
sondern zu einer Angleichung bis hin zu einer — wenn man so<br />
will — Überangleichung der beiden Bildungsgruppen. Die Lebensstil-Hypothese<br />
wird durch „Leben als Aufgabe", die Nivellierungshypothese durch<br />
„Leben ohne Arbeit", die Globaltrend-Hypothese durch „intrinsische Arbeitsqualität"<br />
bestätigt. Warum finden wir diese Unterschiede bei Indikatoren<br />
des gleichen Wertes Leistung?<br />
Die Erklärung liegt in der unterschiedlichen Allgemeinheitsstufe der<br />
Konzepte, die in den Frageformulierungen hervorgerufen werden. „Leben<br />
als Aufgabe" evoziert eine umfassende Wertorientierung, die von den realen<br />
Lebensbedingungen des Befragten abgehoben sein kann. „Leben ohne Arbeit"<br />
evoziert zwar den spezifischen Lebensbereich der Arbeit, ohne aber<br />
auf spezifische Dimensionen der Arbeit einzugehen. „Intrinsische Arbeitsqualität"<br />
evoziert spezifische Dimensionen des Lebensbereichs Arbeit. Je<br />
allgemeiner nun die evozierten Konzepte, desto mehr kann die Antwort<br />
durch kulturelle Bedingungen, durch den Lebensstil beeinflußt werden; je<br />
konkreter die evozierten Konzepte, desto mehr wird die Antwort durch<br />
strukturelle Bedingungen, durch Lebenschancen geprägt. „Leben als Aufgabe"<br />
ist daher sensibel für die unterstellte Gewichtsverlagerung der Bedeutungskomponenten<br />
von Bildung zugunsten des Lebensstils; es gibt keine<br />
objektiven Anhaltspunkte, keine Lebenschancen, die die Antworten der Befragten<br />
einschränken könnten. Ähnliches gilt in abgeschwächter Form für<br />
„Leben ohne Arbeit". „Intrinsische Arbeitsqualität" aber wird nicht nur<br />
von Wert-Positionen, sondern auch von den faktischen Bedingungen in der<br />
Arbeit beurteilt; hier brechen sich die Vorurteile des Lebensstils an den<br />
Realitäten der Lebenschancen. Aus diesen konzeptuellen Unterschieden<br />
zwischen den Fragen wird es also verständlich, daß „Leben als Aufgabe"<br />
den unterstellten Wandel des Charakters von Bildung durch eine Umkehrung<br />
der Beziehung zu Werten, „Leben ohne Arbeit" durch eine Nivellierung<br />
der Beziehung zu Werten <strong>und</strong> „intrinsische Arbeitsqualität" überhaupt<br />
nicht widerspiegelt. So gesehen hat sich die Annahme eines Bedeutungswandelt<br />
der Bildung bewährt, wo sie überhaupt eine Chance zur Bewährung hatte:<br />
in Einstellungen, die relativ unabgelenkt durch die Erfahrung realer Lebensbedingungen<br />
Werte repräsentieren können. So gesehen haben bildungsabhängige<br />
Lebensstile ihren Niederschlag in der Bewertung von Leistung gef<strong>und</strong>en.<br />
Akzeptiert man diese Interpretation der unterschiedlichen Trends bei<br />
den drei Indikatoren für den Wert Leistung, so ergeben sich zwei Schlußfolgerungen.<br />
Als erstes muß man die Befürchtungen, die von vielen — etwa<br />
von Kmieciak (1976) <strong>und</strong> Noelle-Neumann (1978) — mit dem Rückgang<br />
des Wertes Leistung verknüpft wurden, nicht unbedingt teilen. Aus dem<br />
Rückgang des Wertes Leistung wird nämlich häufig auf einen Rückgang der<br />
tatsächlichen Bereitschaft zu Leistung geschlossen. Die Ergebnisse hier zeigen<br />
nun, daß zwar der Wert Leistung tatsächlich in allen Gruppen zurückgeht,<br />
daß aber der Rückgang bei den Indikator-Fragen besonders ausgeprägt<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ist, wo er am ehesten auf die Verbreitung kultureller Denkmuster zurückgeführt<br />
werden kann. Wenn aber der Wert Leistung am stärksten sich dort<br />
wandelt, wo er nicht durch Lebenschancen vorgeprägt ist, dann liegt es nahe,<br />
daß der Wandel des Wertes auch das Handeln relativ unberührt läßt. Der<br />
Rückgang von Leistung könnte ein überwiegend ideologisches Phänomen<br />
ohne Folgen für das Verhalten sein. Das aber ließe sich verallgemeinern zu<br />
einer zweiten Schlußfolgerung. So wie der Rückgang von Leistung überwiegend<br />
kulturell bedingt <strong>und</strong> vor allem ideologisch spürbar ist, so könnten<br />
Werte überhaupt von Erfahrungen abgelöst <strong>und</strong> für das Verhalten folgenlos<br />
werden. In dem Maße, in dem Werte nicht mehr durch Erfahrungen gestützt<br />
werden, würden sie auch nicht mehr die Tendenz haben, sich im Verhalten<br />
auszudrücken. Werte dienten dann in erster Linie der Selbstdeutung <strong>und</strong><br />
Selbstdarstellung ihrer Träger. Selbstdeutung <strong>und</strong> Selbstdarstellung aber<br />
sind Funktionen des Lebensstils. So gesehen, sind Werte in jedem Falle,<br />
ganz unabhängig von möglichen Interpretationen <strong>und</strong> Hintergründen des<br />
jüngsten Wertwandels, Gegenstand des Lebensstils.<br />
ANMERKUNGEN<br />
1 Das Referat ist Teil eines längeren Arbeitsberichts „Bildungsexpansion <strong>und</strong> Wertwandel.<br />
Von Lebenschancen zum Lebensstil", der im Herbst 1985 erscheinen soll<br />
in: H. Meulemann/K.H. Reuband (Hg.), Sozialer <strong>und</strong> kultureller Wandel in der<br />
B<strong>und</strong>esrepublik. Frankfurt.<br />
2 Die Ergebnisse beruhen auf Sonderauswertungen des Instituts für Demoskopie,<br />
Allensbach, für die ich Herrn Werner Süßlin sehr herzlich danken möchte. — Die<br />
Frage lautete: Zwei Männer (Frauen) unterhalten sich über das Leben. Der (die)<br />
erste sagt: Ich möchte mein Leben genießen <strong>und</strong> mich nicht mehr abmühen als<br />
nötig. Man lebt schließlich nur einmal, <strong>und</strong> die Hauptsache ist, daß man etwas vom<br />
Leben hat. Der (die) zweite sagt: Ich betrachte mein Leben als Aufgabe, für die ich<br />
da bin <strong>und</strong> für die ich alle Kräfte einsetze. Ich möchte in meinem Leben etwas leisten,<br />
auch wenn das oft schwer <strong>und</strong> mühsam ist. — Dargestellt ist der Prozentsatz<br />
für die zweite Vorgabe.<br />
3 Aus Platzgründen muß ich für diesen <strong>und</strong> für alle folgenden Trends auf eine Abbildung<br />
verzichten.<br />
4 Die Ergebnisse beruhen wiederum auf Sonderauswertungen des Instituts für Demoskopie,<br />
Allensbach, die mir Herr Werner Süßlin fre<strong>und</strong>licherweise zur Verfügung<br />
gestellt hat. — Die Frage lautete: Glauben Sie, es wäre am schönsten zu leben, ohne<br />
arbeiten zu müssen? — Dargestellt ist der Prozentsatz für , Ja".<br />
5 Die Ergebnisse sind aus den EMNID-Informationen entnommen, die vom EMNID-<br />
Institut, Bielefeld, herausgegeben werden. — Die Frage lautete: Empfinden Sie Ihre<br />
Arbeit als schwere Last, notwendiges Übel, Möglichkeit, Geld zu verdienen, befriedigende<br />
Tätigkeit oder Erfüllung einer Aufgabe? — Als „intrinsische Arbeitsqualität"<br />
habe ich den Prozentsatz für „befriedigende Tätigkeit" <strong>und</strong> „Erfüllung einer<br />
Aufgabe" zusammengefaßt.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
LITERATUR<br />
Kmieciak, Peter, 1976: Wertstrukturen <strong>und</strong> Wertwandel in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland.<br />
Göttingen.<br />
Meulemann, Heiner, 1982: „Bildungsexpansion <strong>und</strong> Wandel der Bildungsvorstellungen<br />
zwischen 1958 <strong>und</strong> 1979: Eine Kohortenanalyse." Zeitschrift für Soziologie 11:227-<br />
253.<br />
Meulemann, Heiner, 1983: „Value Change in West Germany, 1950-1980: Integrating<br />
the empirical evidence." Social Science Information 22:777-800.<br />
Noelle-Neumann, Elisabeth, 1978: Werden wir alle Proletarier? Wertewandel in unserer<br />
Gesellschaft. Zürich.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
1956 1960 1964 1968 1972 1975 1978 1981<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776<br />
Abb. 1<br />
„Leben als Aufgabe" in Bildungsgruppen 1956 — 1981<br />
NO
Daten, Erklärungen, Prognosen -<br />
Wege der Annäherung<br />
EINLEITUNG<br />
Manfred Küchler<br />
Die Soziologie hat kein Monopol auf die Analyse <strong>gesellschaftliche</strong>r Entwicklungen,<br />
auf die Erklärung des Vorfindbaren, auf die Vorhersage des Künftigen.<br />
Gleichwohl muß sich ihre Nützlichkeit, ihre Existenzberechtigung als<br />
eigenständige Disziplin in der Erfüllung genau dieser Aufgaben erweisen.<br />
Sie konkurriert dabei mit philosophischen <strong>und</strong> literarischen Deutungen, ja<br />
auch historischen Extrapolationen — einmal ganz abgesehen von den Alltagstheorien<br />
der Politiker, der Journalisten <strong>und</strong> der Durchschnittsbürger.<br />
Die meisten Erklärungen <strong>und</strong> Prognosen über <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklungen<br />
— sei es im Bildungsbereich oder anderswo — lassen sich vermutlich<br />
nicht einmal eindeutig einer dieser Kategorien zuordnen; die Grenzen sind<br />
fließend <strong>und</strong> Hegemonialansprüche nicht hinreichend begründbar. Literatur<br />
mag uns zuweilen mehr über die Wirklichkeit vermitteln als die Ergebnisse<br />
einer Meinungsumfrage, philosophische Begriffsbestimmungen einen<br />
Sachverhalt prägnanter fokussieren als eine operationale Definition. Anzuerkennen,<br />
daß Soziologie — <strong>und</strong> in ihrer konkreten Ausprägung empirische<br />
Sozialforschung — nur eine Möglichkeit ist, soziale Wirklichkeit im Bestand<br />
wie im Prozeß der Veränderung zu erfassen, bedeutet jedoch nicht notwendig,<br />
das empirische Forschen aufzugeben, ungestört von Daten zu philosophieren<br />
oder Romane, Gedichte <strong>und</strong> Essays zu schreiben.<br />
Empirische Sozialforschung ist gegenüber Philosophen <strong>und</strong> Literaten im<br />
Nachteil; sie muß die Basis ihrer Schlußfolgerungen systematisch offenlegen.<br />
Sie muß im Detail beschreiben, genau welche Einzelbef<strong>und</strong>e sie aus der<br />
schier unermeßlichen Fülle von Informationen ausgewählt <strong>und</strong> einer systematischen<br />
— im Prinzip im einzelnen nachvollziehbaren — Analyse unterzogen<br />
hat. Dies gilt für alle Spielarten empirischer Sozialforschung, auch<br />
wenn die Präzision dieser Angaben variiert. Empirische Sozialforschung<br />
kann immer nur einen — in Relation zum Ganzen sehr kleinen — Teil aller<br />
denkbarer Informationen systematisch einbeziehen; die Untersuchungsanlage<br />
oder das Forschungsdesign definiert ein „Fenster", durch das begrenzte<br />
Ausschnitte der Wirklichkeit in den Blick des Forschers geraten. Damit<br />
werden entscheidende Randbedingungen dafür gesetzt, welche Erklärungen,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
welche Prognosen auf der Gr<strong>und</strong>lage des je spezifischen Forschungsvorhabens<br />
möglich sind.<br />
Die Beiträge in dieser Veranstaltung befassen sich mit unterschiedlichen<br />
Typen von Forschungsdesigns; sie versuchen, Vor- <strong>und</strong> Nachteile der einzelnen<br />
Ansätze generalisierend <strong>und</strong>/oder im exemplarischen Detail zu beschreiben.<br />
Ziel dieser Auseinandersetzung ist nicht die Fortführung des alten unfruchtbaren<br />
wissenschaftstheoretischen Streits, was denn die „richtige" Methode<br />
ist, vielmehr sollen Möglichkeiten der gegenseitigen Ergänzung deutlich<br />
werden. Der methodische Schulenstreit, die unversöhnliche Gegenübersetzung<br />
von „qualitativer" <strong>und</strong> „quantitativer" Forschung steht zwar nicht mehr<br />
auf der Tagesordnung, aber über das Stadium der gegenseitigen Duldung sind<br />
wir auch noch nicht hinausgekommen. Wünschenswert wäre — über den gegenwärtigen<br />
Methodenpluralismus hinaus — eine Kumulation verschiedenartiger<br />
methodischer Expertisen beim einzelnen Forscher, indem er/sie sich in aufeinanderfolgenden<br />
Studien unterschiedlicher „Wege der Annäherung" bedient.<br />
Der Normalfall empirischer Sozialforschung, die einmalige Querschnittsbefragung<br />
mit weitgehend standardisierten Erhebungsinstrumenten, braucht<br />
in diesem Zusammenhang nicht explizit behandelt zu werden. Die Grenzen<br />
dieses Forschungsdesign liegen klar auf der Hand. Daß dennoch viele heute<br />
durchgeführte Studien sich dieser Untersuchungsanlage bedienen, ist denn<br />
auch weniger der Borniertheit der Soziologen anzulasten als vielmehr handfesten<br />
praktischen Restriktionen in Form von (primär) verfügbaren Mitteln<br />
<strong>und</strong> (sek<strong>und</strong>är) verfügbarer Zeit. Unabhängig von Einzelfall ist sicher nicht<br />
zu entscheiden, wo ein Kompromiß zwischen methodischer Wünschbarkeit<br />
<strong>und</strong> verfügbaren Ressourcen nicht mehr angemessen ist, wo die Schlichtheit<br />
des Design zu weitgehender Beliebigkeit der Forschungsergebnisse führt.<br />
Eine These, die Martin Irle mit großem Nachdruck in seinem Beitrag über<br />
die Notwendigkeit von „Experimentalplänen in sozialwissenschaftlicher<br />
Forschung" vertritt.<br />
Im zweiten, hier abgedruckten Beitrag — beschäftigt sich Christel<br />
Hopf mit „Fragen der Erklärung <strong>und</strong> Prognose in qualitativen Untersuchungen",<br />
also in Studien, die nicht oder nur sehr begrenzt auf standardisierte<br />
Erhebungsinstrumente <strong>und</strong>/oder auf „Repräsentativität" angelegte Auswahl<br />
der zu untersuchenden Personen (allgemeiner: Einheiten) zurückgreifen.<br />
Das Problem von Kausalerklärungen im Rahmen derartiger Studien — wie<br />
der hier von Christel Hopf exemplarisch herangezogenen klassischen „Marienthal-Studie"<br />
— zu erörtern, mag sowohl dem orthodoxen „kritischen<br />
Rationalisten" wie dem traditionellen „Hermeneutiker" absurd anmuten;<br />
für pragmatisch orientierte, an konkreten Problemlösungen interessierte Sozialforscher<br />
wird damit jedoch ein interessanter Brückenschlag versucht.<br />
Praktische Restriktionen (knappe Fristen, beschränkter Raum) lassen es<br />
leider nicht zu, auch das dritte, von Walter Müller gehaltene Referat in diesem<br />
Band schriftlich zu dokumentieren. Gegenstand dieses Beitrags waren<br />
Möglichkeiten, auch längerfristige (historische) Entwicklungen datenorientiert<br />
mit Hilfe von Longitudinalstudien zu untersuchen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Die Frage nach dem Scheitern der Bildungsprognosen ist in der Plenumsveranstaltung<br />
unterschiedlich beantwortet worden. Die Schroffheit des Urteils<br />
ist sicher abhängig von den Erwartungen, die an die einzelnen sozialwissenschaftlichen<br />
Studien gerichtet wurden. Über die Unterschiede hinaus<br />
ist aber deutlich geworden, daß empirische sozialwissenschaftliche Analysen<br />
nicht obsolet geworden sind, obwohl ihre Triftigkeit sicherlich der Verbesserung<br />
bedarf: nicht durch Rückzug in die Kontemplation, den soziologischen<br />
Lehnstuhl, jedoch, sondern durch kontinuierliche Verbesserung <strong>und</strong><br />
Verfeinerung der Untersuchungspläne, der Instrumente, der Techniken —<br />
kurz der „Werkzeuge der Sozialforschung".<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
EXPERIMENTAL—PLÄNE IN SOZIALWISSENSCHAFTLICHER<br />
FORSCHUNG<br />
Martin Irle<br />
Manche Experimentatoren in verhaltenswissenschaftlicher Forschung haben<br />
es nicht begriffen: Die experimentelle Methode ist die optimale Operationalisierung<br />
des deduktiven Erklärungsmodelles. In diesem Modell besteht das<br />
Explanans strikt aus einer Gesetzesaussage, etwas 'liberaler' aus einer Hypothese,<br />
die aus einer nomologischen Theorie gefolgert wird, <strong>und</strong> aus der Beschreibung<br />
einer konkreten Anfangsbedingung. Diese Anfangsbedingung<br />
muß eine quantitative Variation ihrer Qualität sein; sie kann konstante<br />
Randbedingungen enthalten. Die bezogene Theorie mag in sich logisch<br />
nicht absolut widerspruchslos sein; sie mag partiell tautologisch sein, sie<br />
mag in Gänze — unerkannt — durch eine andere Theorie erklärbar sein.<br />
Auch dann finden wir eine Hypothese — u.U. sogar als einen isolierten<br />
Einzelfall, (noch) nicht auf eine Theorie rückführbar —, die erklärt, warum<br />
ein konkreter Vorgang oder ein konkretes Objekt, als Einzelfall beschreibbar,<br />
ein anderes ebenso beschreibbares Ereignis an demselben Ort<br />
in Zeit <strong>und</strong> Raum herbeiführt: das Explanandum. Die Erklärung ist identisch<br />
mit einer Prognose in einem geschlossenen System. Wenn X hergestellt<br />
. wird oder wie immer eintrifft, dann wird auch Y auftreten. In den<br />
Verhaltens- <strong>und</strong> Sozialwissenschaften können im strikten Sinne geschlossene<br />
Systeme nur sehr selten hergestellt werden. Trotz vieler praktischer<br />
Defizite folgt die experimentelle Methode diesem deduktiven Erklärungsmodell.<br />
Was haben manche Experimentatoren nicht begriffen? Sie haben das<br />
Laboratorium nicht begriffen. Ein Laboratorium ist das Gehäuse von mindestens<br />
partiell neu geschaffenen (Mikro-)Welten. Gemäß Folgerung aus einer<br />
Theorie werden konkrete Anfangsbedingungen hergestellt, die u.U.<br />
raumzeitlich erstmals eintreffen. Sie sind „künstlich", als sie erst- <strong>und</strong>/vielleicht<br />
einmalig sind. Damit sind sie nicht irreal; sie sind empirische Realität,<br />
<strong>und</strong> ebenso sind es die erklärten, prognostizierten, konkreten Konsequenzen.<br />
Auf vorhandene empirische Realitäten kann man nur schließen,<br />
wenn dort dieselben konkreten Anfangs- <strong>und</strong> Randbedingungen herrschen<br />
wie im Labor; denn die Hypothese als Folgerung aus einer Theorie erklärt<br />
den Zusammenhang je konkreter Ereignisse. Sie löst einen problematischen<br />
Sachverhalt auf. Verallgemeinerungen im Sinne induktiver Schlüsse sind logisch<br />
nicht erlaubt; es gibt keine Logik, die induktive Schlüsse begründet.<br />
Die Ergebnisse eines Experimentes, <strong>und</strong> seien sie noch so „natürlich", erlauben<br />
nichts anderes, als das Vertrauen in die Erklärungskraft einer Theorie<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
aufrechtzuerhalten oder zu mindern. Es ist ein anderes — psychologisches —<br />
Problem, daß solche 'Bestätigungen' einer Theorie das Vertrauen in ihre<br />
Erklärungskraft erhöhen: Manche Experimentatoren haben nicht begriffen,<br />
daß sie auch durch beliebig große Zahlen von Experimenten, z.B. durch beliebig<br />
viele Replikationen eines Experimentes, keine Chance haben, konkrete<br />
Ergebnisse generalisieren zu können. Sie prüfen eine Theorie auf ihre<br />
Erklärungskraft. Wollen sie mit dieser Theorie andere problematische Sachverhalte<br />
von Ereignissequenzen erklären, dann müssen sie neue Hypothesen<br />
aus dieser Theorie folgern, die für solche Sachverhalte die konkreten Anteile<br />
des Explanans passend fordern.<br />
Merke: Je kleiner die Zahl der Versuchseinheiten (Personen oder höhere<br />
soziale Einheiten) pro Versuchsbedingung ist, um so eher testet man gegen<br />
die Hypothese(n). Nur wer induktiv generalisieren will, wünscht sich hohe<br />
Zahlen von sozialen Einheiten pro Untersuchungsbedingung, damit auch<br />
geringste Effekte noch statistisch signifikant werden. Erlaubt diese Strategie<br />
eher zu generalisieren, obwohl es keine logische Begründung induktiver<br />
Schlüsse gibt? Sozialwissenschaftlern (z.B. Soziologen) erscheint es unglaublich,<br />
daß Verhaltenswissenschaftler (z.B. die biologiewissenschaftlich orientierten,<br />
aber auch die sozialwissenschaftlich orientierten Psychologen) in<br />
Experimenten mit 8-12 Versuchspersonen pro Versuchsbedingung auskommen<br />
wollen: Die erforschte Welt sei „künstlich", <strong>und</strong> dann wolle man z.B.<br />
noch von 8 Vpn x 4 Experimentalbedingungen =32 Personen auf irgendetwas<br />
schließen. Richtig! Nur, das Irgendetwas kann nichts anderes sein als<br />
der Erklärungsanspruch einer Theorie, der erschüttert oder nicht erschüttert<br />
werden kann.<br />
Die zentrale Aufgabe, die allein das Experiment erfüllen kann, ist diejenige,<br />
alternative Erklärungen auszuschließen. Anders kann empirisch nicht<br />
die Erklärungskraft, die realwissenschaftliche Geltung einer nomologischen<br />
Theorie geprüft werden. Das Experiment ist dazu da, Schlupflöcher zu verschließen.<br />
Wer weniger anspruchsvoll ist, gibt sich mit Deutungen zufrieden;<br />
er diskriminiert Theorien als Deutungsmuster (siehe: Donald T. Campbell<br />
& Julian C. Stanley: Experimental and Quasi-Experimental Designs<br />
for Research. Chicago: Rand McNally, 1966).<br />
Vielleicht eignet sich die Methode des Experimentes nur für ganz gewisse<br />
Typen von Forschungsprogrammen. Theo Herrmann („Die Psychologie<br />
<strong>und</strong> ihre Forschungsprogramme". Göttingen: Hogrefe, 1976) definiert<br />
solche Typen, weil er Psychologe ist, anhand psychologischer Forschung.<br />
Wir verbleiben im deduktiven Erklärungsmodell; wer ein induktives<br />
Erklärungsmodell — logisch <strong>und</strong>/oder sonst wie — für realisierbar hält,<br />
mag widersprechen.<br />
Es handelt sich um Idealtypen. Erstens, ein Forscher verfolge die Aufgabe,<br />
eine Theorie empirisch auf ihren Erklärungsanspruch, auf ihre Erklärungskraft<br />
in einem mit ihr definierten empirischen Geltungsbereich zu<br />
prüfen. Dieser oder diese empirischen Forscher werden die konkreten Explananda,<br />
so extrem wie forschungspraktisch machbar, streuen: Ein Ex-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
planans für beliebig viele Explananda! Oder: Aus einer Theorie lassen sich<br />
beliebig viele Hypothesen folgern. Anders ausgedrückt: Diese Forscher haben<br />
das Forschungsziel, eine Theorie empirisch auf ihre realwissenschaftliche<br />
Geltung zu prüfen. Sie forschen theorieorientiert. Diese Strategie schließt<br />
nicht aus, daß es diesen Forschern als Nebenergebnis zufällt, dann <strong>und</strong><br />
wann einen konkreten, problematischen Sachverhalt aufzuklären. Zweitens,<br />
ein Forscher verfolge die Aufgabe, einen problematischen = unerklärten<br />
Sachverhalt oder eine (raumzeitliche) Serie derartiger Sachverhalte aufzuklären!<br />
So viele Explanantien wie nötig für ein Explanandum!<br />
Der zweite Typ von Forschungsprogrammen ist etwas genauer zu betrachten.<br />
Klassen problematischer Sachverhalte bestehen meistens aus einer<br />
Schar konkreter, operational zu definierender Explananda. Diese streuen in<br />
Zeit <strong>und</strong> Raum. Ein Ereignis (Vorgang/Objekt), das zum Zeitpunkt t-^ Explanandum<br />
war, mag zum Zeitpunkt t2 (an demselben räumlichen Ort)<br />
konkreter Anteil eines Explanans sein. Im Verlaufe der Zeit <strong>und</strong>/oder des<br />
Raumes, also: im Verlaufe der raum/zeitlichen Änderungen, mögen aus<br />
konkreten Anteilen von Explanantien Explananda werden; aus Explananda<br />
mögen konkrete Anteile von Explanantien werden. Neue „states of the<br />
world" mögen auftreten. 'Historische Kausalität' fragt, wie konkrete Anteile<br />
eines Explanans im Laufe der Zeit entstanden sind, 'ursprünglich' als<br />
Explananda! 'Systematische Kausalität' fragt, warum eine räumlich punktuell<br />
bestehende Konstellation konkreter Anteile eines Explanans ein Explanandum<br />
zur Folge haben kann. Ein Ereignis, das an dem einen Ort in Zeit<br />
<strong>und</strong> Raum mit einer Folgerung aus der Theorie A als Explanandum behandelt<br />
wurde, mag an dem nächsten Ort in Zeit <strong>und</strong> Raum gemäß Folgerung aus<br />
der Theorie B als konkreter Anteil eines Explanans behandelt werden.<br />
Die raum/zeitliche Folge für einen einzigen problematischen Sachverhalt<br />
mag eine 'pluralistische' Anwendung von Theorien fordern. Wer nicht<br />
begreift, daß sich ein problematischer Sachverhalt über Zeit <strong>und</strong> Raum erstreckt,<br />
sucht entweder Deutungsmuster aus großen Theorienperspektiven.<br />
Oder er bedient sich statistischer Verfahrensweisen, völlig theorien- <strong>und</strong><br />
somit vorurteilsfrei, um Tatsachen „für sich sprechen" zu lassen. Die empirischen<br />
Fakten <strong>und</strong> ihre Assoziationen sollen im Kausalmodell selbst entscheiden,<br />
wer das Explanans, wer der 'Moderator' <strong>und</strong> wer das Explanandum<br />
sei. Die statistische Datenverarbeitung gebiert die Auswahl eines Modelles<br />
gegen andere Modelle.<br />
Bevor entschieden werden kann, ob sich die Methode des Experimentes<br />
für beide Typen von Forschungsprogrammen: (1) theorie-orientierte Forschung<br />
(Herrmann, 1976: „quasiparadigmatische" Forschung), (2) problemorientierte<br />
Forschung (Herrmann, 1976: ,,Domain"-Forschung), oder nur<br />
für einen oder gar keinen dieser Programmtypen in empirischer Sozialforschung<br />
eignet, bedarf es einer Skizzierung der experimentellen versus 'korrelativen'<br />
Untersuchungspläne.<br />
Der 'Ideal'-Typ des Nicht-Experimentes ist die „one-shot case study"<br />
(Campbell & Stanley, 1966). Ein Ereignis trifft ein, z.B. als Aufhebung ei-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
nes Ruhezustandes; ein zweites Ereignis trifft ebenso an diesem Ort in Raum<br />
<strong>und</strong> Zeit ein. Nur diese beiden Ereignisse werden als problematischer Sachverhalt<br />
registriert; ob das eine dem anderen als Antezedens vorausging oder<br />
ob es Konsequenz des anderen ist, darüber kann nur spekuliert werden, als<br />
auch darüber, welche dritten Ereignisse zu dieser Konstellation der beiden<br />
Ereignisse führten. Just im Augenblick des großen „blackout" vor einigen<br />
Jahren in New York City schloß dort eine Hausfrau ihr Bügeleisen mit geknickter,<br />
defekter Zuleitungsschnur an. Oft kritisiert von ihrem Mann, die<br />
Bügeleisenzuleitung reparieren zu lassen, schloß sie mit erdrückenden Schuldgefühlen,<br />
sie habe den „blackout" verursacht. Oder: Thalidomid sei der<br />
Verursacher einer zirkumskripten Form organischer Mißbildungen. Bis zur<br />
St<strong>und</strong>e ist es empirisch nicht gelungen oder auch nur versucht worden, eine<br />
Hypothese zu widerlegen, daß Thalidomid, z.B. als Contergan, eingenommen<br />
von Frühschwangeren, die Abstoßung mit mißbildenden Zellteilungen<br />
<strong>und</strong> Organe-Organisationen behafteten Föten aufhält. Thalidomid könnte<br />
'segensreich' wirken, wenn es keine Noxe ist, sondern Abstoßungen körperfremder<br />
Implantationen verhindert. Die Umfrage-Untersuchungen zur Wirkungsweise<br />
von Contergan waren ausschließlich korrelative Summierungen<br />
von „one-shot case studies"; man verließ sich auf statistische Signifikanzen,<br />
als könnten statistische Tests das Denken <strong>und</strong> die Entscheidungen zwischen<br />
Theorien ersetzen. Noch schlimmer ist die Naivität empirischer Sozialforschung<br />
in korrelativen Feldstudien via Umfragen, wenn man zusätzlich beachtet,<br />
daß die raumzeitliche Sequenz der Ereignisse anhand des Langzeitgedächtnisses<br />
der Interviewten rekonstruiert wird. Diese Reproduktionen<br />
des Sachverhaltes aus Gedächtnissen sind nicht die ursprüngliche Sequenz<br />
von Ereignissen in Raum <strong>und</strong> Zeit. Die Reproduktionen finden an dem besonderen<br />
raumzeitlichen Ort des Interviews statt: In diesem — 'angezapften'<br />
— kognitiven Feld können längst Ereignisse, die später vonstatten gingen,<br />
die Erinnerungen an frühere Ereignisse rekonstruiert haben: Das Langzeitgedächtnis<br />
ist nicht ein ruhendes Archiv von Akten, dem dann <strong>und</strong><br />
wann wohlgeordnet neue Akten summativ zugefügt werden. Die Panel-Methode<br />
ändert an der methodischen Fragwürdigkeit nichts. Die Panel-Mortalität<br />
ist nicht das eigentliche Problem. Das Problem ist, daß man kognitive<br />
Repräsentationen von außer- <strong>und</strong> inner-personalen Ereignissen als korrekte<br />
Spiegelbilder dieser Ereignisse ansieht. Das Interview, soweit es ausschließlich<br />
über kognitive Repräsentationen (wie reliabel <strong>und</strong>/oder valide<br />
sind die Meßinstrumente, welche theoretischen Variablen operationalisieren<br />
sie?) problematische Sachverhalte zu rekonstruieren sucht, ist kein<br />
Königsweg empirischer Sozialforschung, noch dazu gepaart mit dem Untersuchungsplan<br />
der (repetierten) „one-shot case study". Sicherlich bestimmt<br />
das Sein das Bewußtsein, aber das Bewußtsein spiegelt nicht das Sein, nicht<br />
einmal seitenverkehrt. Das außerpsychische Sein ist empirisch wahr, <strong>und</strong><br />
das Bewußtsein, das andere innerpsychische Sein, ist empirisch wahr. Ihre<br />
Beziehungen zueinander sind mehr oder minder veridikal. Die „one-shot<br />
case study" ist, unter bestimmten Voraussetzungen, in den Wissenschaften<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
der 'unbelebten' Natur ein akzeptabler Untersuchungsplan. In den Verhaltens-<br />
<strong>und</strong> Sozialwissenschaften ist er nur geeignet — aber viel zu aufwendig<br />
für diesen Zweck —, um Hypothesen zu generieren.<br />
Er generiert z.B. die Hypothese der Hausfrau in New York. Aber er liefert<br />
keine empirische Evidenz, auch wenn einer Zufallsstichprobe von New<br />
Yorker Hausfrauen ähnliches an nahen Orten in Raum <strong>und</strong> Zeit passiert<br />
sein sollte. Die empirische Masse macht nicht die empirische Evidenz. Was<br />
hilft es weiter, wenn ein von Null statistisch signifikant abweichender Anteil<br />
in einer Zufallsstichprobe von erwachsenen New Yorkern bek<strong>und</strong>et,<br />
soweit dieser Anteil weiblichen Geschlechtes ist <strong>und</strong> aus Nur-Hausfrauen<br />
besteht, daß Benutzung eines fehlerhaften elektrischen Haushaltsgerätes<br />
zum „blackout" geführt habe? Vielleicht erfährt man etwas über ein Vorurteil<br />
New Yorker Hausfrauen, ohne dieses empirisch als solches belegen zu<br />
können. Man sagt, daß diese Frauen vorurteilig sind, <strong>und</strong> schränkt ihre Menge<br />
per weiterer Randbedingungen ein, unter denen man die Menge der<br />
Hausfrauen mit solchen Vorurteilen maximiert. Gewinnt man Erkenntnis,<br />
wenn man Randbedingungen kennt, unter denen die Korrelationen von<br />
konkreten Anteilen des Explanans von vom Explanandum besonders hoch<br />
ausfallen?<br />
Dieser Untersuchungsplan gehört dem Sachverhalt des Entdeckungszusammenhanges<br />
von Theorien an, nicht dem Geltungszusammenhang von<br />
Theorien.<br />
Man kann die „one-shot case study" zum „one-group pretest posttest<br />
design" erweitern. Das ist die kürzeste Form der Panelstudie, hier via Interviews.<br />
Zum Zeitpunkt t j an einem konstanten Ort im Raum messe man das<br />
Explanandum. Sobald eine qualitative <strong>und</strong>/oder quantitative Änderung der<br />
konkreten Anteile des potentiellen Explanans zum Zeitpunkt t
noch gar keine alternative Erklärung ausgeschlossen, gemäß der X nicht Anteil<br />
eines Explanans für das Explanandum Y ist. Wir sind bei einer Felduntersuchung<br />
angelangt, in der n Variablen in einer Zufallsstichprobe registriert<br />
werden. Man müßte eine Theorie haben, die Beziehungen zwischen allen<br />
diesen empirischen Variablen zeitlich an einem Ort <strong>und</strong> räumlich an verschiedenen<br />
Orten erklären kann, <strong>und</strong> man könnte dennoch nicht alternative<br />
Erklärungen ausschließen. Eine Panel-Studie besteht aus Wiederholungen einer<br />
„multiple static-group comparison"; aus solchen Repetitionen entsteht<br />
kein Quasi-Experiment, geschweige denn ein Experiment.<br />
In einem Experiment, ob im Labor oder im Feld, wird der konkrete Anteil<br />
des Explanans hergestellt <strong>und</strong> planmäßig, der Hypothese folgend, variiert,<br />
<strong>und</strong> konkrete Randbedingungen werden konstant gehalten <strong>und</strong>/oder<br />
zufallig variiert. Übrigens liegt psychologische, besonders sozialpsychologische,<br />
experimentelle Forschung im Argen, wenn sie einerseits inner-personale<br />
Merkmale variiert, indem Versuchspersonen per Zufall den Bedingungs-<br />
Variationen eines Experimentes zugeordnet werden (Fehlervarianz), wenn<br />
sie aber andererseits ökologische Bedingungen konstant hält, ohne dieses<br />
durch die im Explanans enthaltene Hypothese begründen zu können.<br />
Der Typ der Forschungsprogramme, gemäß dem theorieorientierte<br />
(„quasiparadigmatische") Forschung betrieben wird, verlangt fast ohne<br />
Ausnahme nach der Methode des Experimentes. (Eine Ausnahme kann<br />
die Computer-Simulation eines Experimentes sein.) Noch einmal: Aus<br />
einer nomologischen Theorie können beliebig viele Hypothesen abgeleitet<br />
werden. Im Prinzip lassen sich Hypothesen folgern, für die die von ihnen<br />
geforderten Variationen konkreter Anfangsbedingungen als Teil des<br />
Explanans hergestellt <strong>und</strong> systematisch variiert werden können. Im Prinzip<br />
ist jede empirische Prüfung der Erklärungskraft einer Theorie dem Experiment<br />
zugänglich, einer soziologischen Theorie ebenso wie einer psychologischen<br />
Theorie. Man muß sich nur über eines klar sein: Der Aufwand für<br />
multifaktorielle Experimente mit mehr als einer unabhängigen <strong>und</strong> mehr als<br />
einer abhängigen Variablen ist ganz sicher in den Sozialwissenschaften höher<br />
als in den Verhaltenswissenschaften. Hinzu tritt der Aufwand der<br />
nicht mehr intuitiven, 'know-how'-Operationalisierungen der Meßinstrumente:<br />
Es ist das Risiko zu vermindern, daß eine empirische Untersuchung,<br />
statt die Theorie zu falsifizieren, die Korrespondenzregeln <strong>und</strong> folgend die<br />
Operationalisierungen als nicht valide <strong>und</strong>/oder nicht reliabel falsifizieren<br />
kann. Verhaltens- <strong>und</strong> sozialwissenschaftliche Forschung vom Typ: 'Suche<br />
für ein konstantes Explanans variierende Explananda' ist wesentlich teurer,<br />
wenn sie experimentell statt gemäß „multiple static-group comparison" betrieben<br />
wird. Sie wird sich dem finanziellen Aufwand naturwissenschaftlicher<br />
<strong>und</strong> ingenieurtechnologischer Forschung annähern <strong>und</strong> ihn nicht selten<br />
übertreffen. Der 'Königsweg' empirischer Sozialforschung durch Interviews<br />
oder die korrelative Felderhebung ist billig, aber nicht deshalb auch<br />
nur angemessen, geschweige denn königlich. Das Vakuum von z.B. soziologischen,<br />
politikwissenschaftlichen <strong>und</strong> ökonomischen Experimenten könnte<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
indizieren, daß es in diesen Wissenschaften so gut wie keine Forschung dieses<br />
Types gibt. Wenn dem so ist, womit bestreiten dann Sozialwissenschaften<br />
ihren theoretischen Fortschritt? Werden in diesem Zusammenhang vielleicht<br />
klassische Theorien ohne Modifikation kraft empirischer Falsifikationen<br />
weiterhin gelehrt? Ist die theoretische Soziologie nichts anderes als Soziologiegeschichte?<br />
Oder sind soziologische Theorien nichts als Deutungsmuster,<br />
die ad libitum feilgehalten <strong>und</strong> für jede Immunisierung gegen jegliche<br />
empirische Falsifikation benutzt werden? Gibt es gar keine soziologischen<br />
Theorien, um derentwillen es sich lohnt, 'quasi-paradigmatische' Forschungsprogramme<br />
zu betreiben? Es ist hier nicht der Ort um vorzuführen,<br />
in welch erschreckendem Maße Reduktionisten — von Soziologie auf Psychologie<br />
— psychologische Theorien verballhornen, <strong>und</strong> das im „scientific<br />
lag" von ein bis drei Jahrzehnten, ob Theorien von Bandura, Festinger,<br />
Piaget, Skinner oder wem sonst, von Freud ganz zu schweigen.<br />
Wie steht es mit der problem-orientierten oder 'Domain'-Forschung?<br />
Eine Klasse mehrdimensional definierter problematischer Sachverhalte ist<br />
nur derart als Problem zu lösen (auch: aufzuklären), indem konkrete, 'singulare'<br />
Anteile als Explananda erklärt werden können. Diese Problemlösungsversuche<br />
richten sich auf problematische Sachverhalte, ob in der Natur<br />
<strong>und</strong>/oder in der Zivilisation, nicht auf Sachverhalte, die in einer partiell<br />
neuen Welt = Laboratorium hergestellt werden können. Zunahmen von<br />
Drogenkonsum, von verfassungsrechtlich fragwürdigen Gesetzen u.s.f. sind<br />
solche Klassen problematischer Sachverhalte. Diese mögen gar unbrauchbar<br />
indiziert sein; die konkreten Diagnosen/Prognosen sind empirisch unwahr<br />
<strong>und</strong>/oder logisch falsch. Soweit singulare Fälle, die unter eine Klasse problematischer<br />
Sachverhalte subsumiert werden können, nicht in einem Laboratorium<br />
simuliert werden können — <strong>und</strong> wann <strong>und</strong> wo ist dieses schon<br />
möglich? —, können sie nur in situ studiert werden. Puristen des Experimentierens<br />
verdrängen, daß weder die Astronomie noch die Metereologie<br />
(nicht einmal die „Astro-Physik") ihre Forschung dominant experimentell<br />
betreiben. Für einen Protagonisten experimenteller Forschungsmethodik,<br />
der soviel Feld- wie Laborforschung <strong>und</strong> soviel korrelative wie experimentelle<br />
Forschung betrieben hat, ist nur diese eine Strategie essentiell: So sehr<br />
artifizielles, von Artefakten bedrohtes Experimentieren indiziert <strong>und</strong> folglich<br />
eliminiert werden muß (meistens handelt es sich um theoriefreie ad<br />
hoc-Prüfungen einer sehr engen Idee, deren Ergebnisse sodann so induktiv<br />
wie hemmungslos generalisiert werden), so sehr sollten in der Feldforschung<br />
quasi-experimentelle Untersuchungspläne angestrebt werden. Sehr selten,<br />
aber immerhin sind Variationen von Versuchsbedingungen in der Natur<br />
<strong>und</strong> Zivilisation vorzufinden, die der empirische Forscher anderenfalls hätte<br />
im Labor herstellen müssen. Quasi-experimentelle Versuchspläne gemäß derer<br />
entweder nicht die Anfangsbedingungen hergestellt werden können <strong>und</strong><br />
deshalb abgewartet bzw. aufgesucht werden müssen oder gemäß derer die<br />
Zuteilung der sozialen Einheiten (minimal: Personen) zu der einen oder anderen<br />
Versuchsbedingung nicht durchgesetzt werden kann, sind Annäherun-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
gen, die nahezu so viele alternative Hypothesen/Erklärungsansprüche wie<br />
Experimente selbst ausschalten können.<br />
Eine Klasse problematischer empirischer Sachverhalte kann zwar aufgeklärt,<br />
aber im eigentlichen Sinne des Wortes nicht erklärt werden. Es ist<br />
keineswegs viel einfacher, einen einzelnen, konkreten problematischen<br />
Sachverhalt zu erklären, besser: die bevorzugte Erklärung durch Prüfung<br />
dem Scheitern auszusetzen. Es sei noch einmal daran erinnert, daß solche<br />
problematischen Sachverhalte sich derart in Raum <strong>und</strong> Zeit erstrecken, daß<br />
aus Folgen an einem raumzeitlichen Ort Anfangsbedingungen an einem anderen<br />
Ort werden, daß zur Erklärung dieses einen Sachverhaltes oft nicht<br />
nur eine Summe von Theorien, sondern ein Geflecht aufeinander beziehbarer<br />
Theorien erforderlich ist.<br />
Sozial- (ebenso Verhaltens-) technologische Forschung ist problemorientierter<br />
Forschung insofern sehr nahe, als der Entwurf <strong>und</strong> die Planung von<br />
Programmen, von Interventionen multitheoretischer Anwendungen bedarf.<br />
Es mag hier dahingestellt sein, ob solche Verflechtungen wissenschaftlicher<br />
(nomologischer) Theorien schon je eine technologische Theorie sind; genaugenommen<br />
machen technologische Theorien präskriptive Aussagen. Sozialtechnologische<br />
Forschung ist theorienorientierter Forschung insofern sehr<br />
nahe, als sie empirische Prüfungen von Hypothesen erfordert, um technische<br />
Pläne dem Scheitern aussetzen zu können, bevor sie „ernsthaft" realisiert<br />
<strong>und</strong> praktiziert werden. Erbringt die Sozialtechnik als Instrument zur<br />
Erreichung von Zielen die prognostizierten Konsequenzen; folgen unerwartete,<br />
ob wünschbare <strong>und</strong>/oder unerwünschte Konsequenzen?<br />
Meine bange Frage ist diese: Wie lange können wir es uns noch leisten,<br />
Sozial- (Verhaltens-, Politik-, Wirtschafts-, Rechts-) Techniken im Versuch<strong>und</strong><br />
Irrtumverfahren dort zu erproben, wo wir nur positive Konsequenzen<br />
maximieren <strong>und</strong> negative Konsequenzen minimieren dürfen, dort, wo wir<br />
sie praktizieren? Sozial-Techniken haben eines mit Ingenieur-Techniken ge- ,<br />
meinsam, <strong>und</strong> sollte es nur dieses eine sein, daß sie — experimentell — auf<br />
Prüfständen simuliert werden müssen. Man fliegt nicht auf Verdacht zum<br />
Mond. Risiko-Minimierung, nicht nur in der ingenieur-technischen Zivilisation,<br />
wird durch korrelative Evaluationsforschung, auch „Begleitforschung"<br />
(Nomen est omen!) genannt, nicht erreicht: Die Methoden dieser Forschung<br />
führen zu arbiträren Ergebnissen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
FRAGEN DER ERKLÄRUNG UND PROGNOSE IN QUALITATIVEN<br />
UNTERSUCHUNGEN. DARGESTELLT AM BEISPIEL DER<br />
„ARBEITSLOSEN VON MARIENTHAL".<br />
Christel Hopf<br />
1. Problemstellung <strong>und</strong> methodische Vorbemerkungen<br />
Fragen der Erklärung <strong>und</strong> Prognose sind in dem Bereich der Sozialforschung,<br />
in dem überwiegend mit Hilfe offener Verfahren der Erhebung <strong>und</strong> Interpretation<br />
von Daten gearbeitet wird, unterschiedlich diskutiert worden. Es<br />
gibt Positionen, in deren Rahmen der Anspruch, Erklärungen <strong>und</strong> Prognosen<br />
zu erarbeiten, explizit zurückgewiesen wird <strong>und</strong> die Auseinandersetzung<br />
mit spezifischen Gegenstandsbereichen primär als verstehende <strong>und</strong> interpretierende<br />
Beschreibung gekennzeichnet wird. Eine in letzter Zeit in der Soziologie<br />
rasch rezipierte Darlegung dieser Position enthält Clifford Geertz'<br />
(1983) Aufsatzsammlung zu Fragen ethnographischer Forschung , in der<br />
1<br />
die Aufgaben der Kulturanalyse unter dem Schlüsselbegriff der „thick<br />
description" oder „dichten Beschreibung" abgehandelt werden, wobei der<br />
auf Gilbert Ryle zurückgehende Begriff der „dichten Beschreibung" sich<br />
auf die verstehende <strong>und</strong> deutende Beschreibung der Gegenstände unserer<br />
sinnlichen Wahrnehmung bezieht (vgl. Geertz, 1983, S. 10 ff.).<br />
Für andere Autoren ist hingegen der Anspruch, auch im Rahmen qualitativer<br />
Forschung Erklärungen <strong>und</strong> Prognosen zu erarbeiten, so selbstverständlich,<br />
daß er kaum kommentiert wird. Zu ihnen gehören eine Reihe<br />
von Soziologen der Chicagoer Schule. So beschreibt Howard Becker die<br />
Erarbeitung von Prognosen geradezu als definierendes Merkmal wissenschaftlicher<br />
Tätigkeit in der Soziologie (vgl. 1972, S. 219 ff.) <strong>und</strong> ähnlich halten<br />
Glaser <strong>und</strong> Strauss in ihrer Konzeption einer hypothesen- <strong>und</strong> theoriebildenden<br />
Forschung die Entwicklung von Erklärungen <strong>und</strong> Prognosen für einen<br />
zentralen Bestandteil qualitativer Forschung (vgl. 1968, S. 3 ff., oder<br />
1974, S. 246 ff.).<br />
Man könnte geneigt sein, in diesen Unterschieden eine Neuauflage der<br />
Debatte über Erklären <strong>und</strong> Verstehen in den Geschichts- <strong>und</strong> Sozialwissenschaften<br />
zu sehen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Denn wenn man davon<br />
ausgeht, daß zu den zentralen Fragen der Erklären vs. Verstehen-Debatte<br />
gehören:<br />
1. die Frage nach der Relevanz deduktiv-nomologischer Erklärungen<br />
<strong>und</strong><br />
2. die Frage nach der Relevanz von Erklärungen, in denen nach Handlungsintentionen,<br />
Situationsdeutungen <strong>und</strong> Vorstellungen über Zweck-<br />
Mittel-Relationen gefragt wird, die man auch als verstehende oder „ra-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
tionale Erklärungen" im Sinne Drays (1966, S. 118 ff.; 1975) bezeichnen<br />
kann 2 ,<br />
dann wird man feststellen, daß die erwähnten Autoren sich nicht ohne weiteres<br />
der einen oder anderen Seite zuordnen lassen. So orientieren sich auch<br />
jene Autoren, die für sich in Anspruch nehmen, Erklärungen zu erarbeiten,<br />
gleichwohl an der Konzeption einer verstehenden Soziologie <strong>und</strong> haben zudem<br />
mit deduktiv-nomologischen Erklärungen im strikten Sinne, nach dem<br />
die Explananda in Kausalerklärungen aus allgemeinen Gesetzen <strong>und</strong> Antezedensbedingungen<br />
logisch abzuleiten seien, wenig zu tun — weder auf der<br />
Ebene faktisch abgegebener Erklärungen noch auf programmatischer Ebene.<br />
Umgekehrt ist es nicht schwer nachzuweisen, daß auch solche Autoren,<br />
die von der Konzeption einer verstehenden <strong>und</strong> deutenden Beschreibung<br />
ausgehen, an Erklärungen interessiert sind. Wenn beispielsweise Clifford<br />
Geertz schreibt: „Unsere Aufgabe ist eine doppelte: Sie besteht darin, Vorstellungsstrukturen,<br />
die die Handlungen unserer Subjekte bestimmen ... aufzudecken<br />
<strong>und</strong> zum anderen ein analytisches Begriffssystem zu entwickeln,<br />
das geeignet ist, die typischen Eigenschaften dieser Strukturen ... gegenüber<br />
anderen Determinanten menschlichen Verhaltens herauszustellen" (1983,<br />
S. 39), dann werden hier deutlich Erklärungsinteressen artikuliert. Es geht<br />
darum, „Vorstellungsstrukturen" als „Determinanten menschlichen Verhaltens"<br />
im Vergleich zu anderen Determinanten zu analysieren.<br />
Es ist offenbar wichtig zu explizieren, was man meint, wenn man für<br />
oder gegen Erklärungen <strong>und</strong> Prognosen oder für oder gegen Kausalerklärungen<br />
in der Soziologie oder in der ethnographischen Forschung Stellung<br />
nimmt. Insbesondere: Was für Erklärungsbegriffe spielen eine Rolle, wenn<br />
nicht der deduktiv-nomologische? Ist es die Draysche Konzeption der „rationalen<br />
Erklärung" einzelner Handlungen, die eine enge Beziehung zu dem<br />
hat, was bei Max Weber mit Handlungs- <strong>und</strong> Motiv-Verstehen gemeint ist?<br />
Oder spielen andere Erklärungskonzepte eine Rolle: zum Beispiel ein weich<br />
gefaßtes Konzept der induktiv-probabilistischen Erklärung, wie es von Hempel<br />
als durchaus typisch für die Geschichtswissenschaft beschrieben wird<br />
(vgl. hierzu auch Donagan, 1975, S. 82 f.). In diesem Fall würden in die Erklärungen<br />
nicht allgemeine Gesetzesaussagen eingehen, sondern Verallgemeinerungen,<br />
die „ausgeprägte Tendenzen zum Ausdruck bringen, die man<br />
als überschlägige Wahrscheinlichkeitsaussagen formulieren kann" (Hempel,<br />
1972, S. 248; vgl. entsprechend Hempel, 1942, S. 41 f.).<br />
Oder spielen schließlich in qualitativen Untersuchungen Erklärungen<br />
eine Rolle, die sich Max Webers Auffassung von Kausalerklärungen in der<br />
Soziologie annähern? In diesem Fall würde es in qualitativen Studien um<br />
einen Kompromiß zwischen verstehenden <strong>und</strong> induktiv-probabilistischen<br />
Erklärungen gehen: Denn als „richtige kausale Deutung typischen Handelns"<br />
wird in den „Soziologischen Gr<strong>und</strong>begriffen" die Deutung beschrieben, in<br />
der sowohl Aussagen über mehr oder minder präzise formulierte statistische<br />
Zusammenhänge enthalten sind als auch Aussagen zur Verständlichkeit<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
(„Sinnadäquanz") dieser Zusammenhänge (Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft, I,<br />
S. 9; vgl. entsprechend auch Weber, 1973, S. 427 ff.). Selbst die überzeugendste<br />
Feststellung der Sinnadäquanz des als typisch behaupteten Vorgangs<br />
führt nach Max Weber nur in dem Maß zu einer „richtige(n) kausale(n) Aussage,<br />
als der Beweis für das Bestehen einer (irgendwie angebbaren) Chance<br />
erbracht wird, daß das Handeln den sinnadäquat erscheinenden Verlauf<br />
tatsächlich mit angebbarer Häufigkeit oder Annäherung (durchschnittlich<br />
oder im 'reinen' Fall) zu nehmen pflegt." (Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft, I,<br />
S. 9).<br />
Welche der hier vorgestellten Erklärungskonzeptionen in qualitativen<br />
Untersuchungen besonders wichtig sind, ist vorab schwer zu entscheiden.<br />
Nach der Relevanz zu urteilen, die der Verstehensbegriff in der qualitativen<br />
Sozialforschung im allgemeinen hat, könnte man meinen, daß es hier primär<br />
um Erklärungen nach dem Typus rationaler oder verstehender Erklärungen<br />
geht. Dies ist ein Eindruck, der beispielsweise auch in Wilsons (1973)<br />
Unterscheidung zwischen „normativen" <strong>und</strong> „interpretativen" Erklärungskonzeptionen<br />
in der Soziologie nahegelegt wird. Auf der anderen Seite werden<br />
in qualitativen Untersuchungen auch Generalisierungen formuliert <strong>und</strong><br />
es wird nach Regelmäßigkeiten in den Beziehungen zwischen unterschiedlichen<br />
Faktoren gefragt. Dies spräche dafür, daß in qualitativen Untersuchungen<br />
nicht nur intentionsbezogene, rationale Erklärungen, sondern auch<br />
andere Varianten eine Rolle spielen. Welche dies sind <strong>und</strong> wie sie im Kontext<br />
qualitativer Untersuchungen begründet werden, soll Gegenstand der<br />
folgenden Abschnitte sein.<br />
Ich versuche, mich dabei auf eine konkrete Untersuchung zu beziehen,<br />
nämlich auf die 1931/32 von Jahoda, Lazarsfeld, Zeisel <strong>und</strong> anderen durchgeführte<br />
Untersuchung „Die Arbeitslosen von Marienthal" . Bei Marienthal<br />
handelt es sich um einen Ort in der Nähe Wiens (vgl. zur Geschichte<br />
3<br />
dieses Ortes auch Fre<strong>und</strong>, 1983), in dem 1929 die für die Bewohner zentrale<br />
Textilfabrik ihre Produktion einstellte. Zum Zeitpunkt der Erhebung —<br />
Ende 1931, Anfang 1932 — waren mehr als drei Viertel der 478 Familien<br />
des Ortes von Arbeitslosigkeit betroffen <strong>und</strong> die Autoren versuchen in der<br />
Untersuchung, nach den psychischen <strong>und</strong> sozialen Folgen der Arbeitslosigkeit<br />
zu fragen.<br />
Als Beispiel einer qualitativen Untersuchung, an der man Fragen der Erklärung<br />
<strong>und</strong> Prognose — letztere werden in diesem Referat allerdings nur<br />
am Rande <strong>und</strong> in dem eingeschränkten Sinn der mit generalisierenden Hypothesen<br />
verb<strong>und</strong>enen Aussagen behandelt — erörtern kann, ist die Marienthal-Studie<br />
aus verschiedenen Gründen geeignet:<br />
— Sie gilt erstens allgemein als sehr gute, ja vorbildliche Untersuchung.<br />
— Sie repräsentiert zweitens in der Vielfältigkeit des methodischen Zugangs,<br />
bei dem neben offenen Interviews — in diesem Fall biographischen<br />
Interviews — Beobachtungen, Dokumentenanalysen, Expertengespräche<br />
unterschiedlicher Natur u.a.m. eine Rolle spielen, einen Typus<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
von Forschung, für den sich in der amerikanischen Methodenliteratur<br />
der Begriff der „teilnehmenden Beobachtung" eingebürgert hat <strong>und</strong> der<br />
von vielen Autoren geradezu als Prototyp qualitativer Forschung angesehen<br />
wird. 4<br />
— Und sie verfolgt schließlich drittens neben dem Interesse an einer verstehenden<br />
Beschreibung — die Autoren sprechen von dem „Sicheinleben<br />
in die Situation" als relevanter Anforderung (Jahoda u.a., 1975, S.<br />
24) — deutlich auch das Interesse an Erklärungen, <strong>und</strong> zwar kausalen<br />
Erklärungen, wie dies bereits aus dem Untertitel der 1933 zuerst veröffentlichten<br />
Studie hervorgeht: Es wird nach den „Wirkungen langandauernder<br />
Arbeitslosigkeit" gefragt. Da Erklärungsansprüche also direkt<br />
erhoben werden, ist die Untersuchung geeignet, im Rahmen einer genaueren<br />
Analyse empirischer <strong>und</strong> theoretischer Argumentationen zu<br />
fragen, wie denn die Autoren vorgehen, wenn sie sich nicht nur beschreibend<br />
<strong>und</strong> deutend, sondern auch erklärend <strong>und</strong> prognostizierend mit<br />
sozialer Realität auseinandersetzen.<br />
2. Was soll erklärt werden?<br />
Wenn man von einigen klar als Einzelfallstudien ausgewiesenen Untersuchungen<br />
(vgl. als Beispiel Hildenbrand, 1983) absieht, dann wird man für<br />
den Typus der mit dem Begriff der teilnehmenden Beobachtung bezeichneten<br />
Studien sagen können, daß es sich bei den Phänomenen, die Gegenstand<br />
von Erklärungen sind, meist um kollektive Phänomene handelt <strong>und</strong> nicht<br />
um singulare Ereignisse oder Handlungen (vgl. hierzu auch Hopf, 1982).<br />
Dies gilt auch für die „Arbeitslosen von Marienthal". Auch wenn in dem<br />
Untersuchungsbericht eine Fülle einzelner Beobachtungen, einzelner Äußerungen<br />
von Befragten, Textstellen aus Schüleraufsätzen u.a. wiedergegeben<br />
sind, so ist das Ziel der deskriptiven Analyse doch die Erarbeitung von generellen<br />
Aussagen über die Bewohner Marienthals <strong>und</strong> einzelne Untergruppen.<br />
In der Einleitung heißt es hierzu: „Vor allem ist unser Untersuchungsgegenstand<br />
das arbeitslose Dorf <strong>und</strong> nicht der einzelne Arbeitslose. Alles Charakterologische<br />
ist weggefallen, die ganze Psychopathologie fällt aus, <strong>und</strong><br />
nur dort, wo regelhafte Zusammenhänge von Vergangenheit <strong>und</strong> Gegenwart<br />
angedeutet werden konnten, wird die Frage bis nahe an das individuelle<br />
Schicksal herangeführt." (Jahoda u.a., 1975, S. 25)<br />
Die generellen Aussagen, die im Untersuchungsbericht bei der Zusammenfassung<br />
der Ergebnisse eine Rolle spielen, haben dabei, formal betrachtet,<br />
vor allem die folgenden Eigenheiten: Zum Teil handelt es sich um Aussagen,<br />
in denen ohne nähere Spezifizierung oder mit Hilfe unbestimmter<br />
Häufigkeitsbegriffe — wie: in der Regel, typisch, häufig, mitunter etc. —<br />
über die Bewohner Marienthals gesprochen wird. 5 Zum Teil handelt es sich<br />
um Aussagen, in denen direkt quantifiziert wird. Im Vergleich zu anderen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
qualitativen Studien werden in der Marienthal-Untersuchung sogar relativ<br />
viele Informationen in dieser direkt quantifizierenden Form mitgeteilt, wobei<br />
es zum Anspruch der Autoren gehört, auch „komplexe Erlebnisweisen"<br />
quantitativ zu erfassen (vgl. Lazarsfeld, 1960, S. 14; vgl. entsprechend Zeisel,<br />
1975, S. 137 ff.). Paul Lazarsfeld schreibt hierzu in seinem Vorwort zu<br />
der neuen Auflage von 1960: „Der oft behauptete Widerspruch zwischen<br />
'Statistik' <strong>und</strong> phänomenologischer Reichhaltigkeit war sozusagen vom Anbeginn<br />
unserer Arbeiten 'aufgehoben', weil gerade die Synthese der beiden<br />
Ansatzpunkte uns als die eigentliche Aufgabe erschien." (1975, S. 14)<br />
Ein Beispiel für den Versuch, komplexere Erlebnisweisen quantitativ zu<br />
erfassen, welches zugleich zum inhaltlichen Kern der Studie hinführt, ist<br />
die Übersicht über die sogenannten Haltungstypen (vgl. vor allem Jahoda<br />
u.a., 1975, S. 64 ff.): Hier werden auf der Basis biographischer Interviews,<br />
von Informationen zum Tagesablauf oder zur Haushaltsführung in den Familien<br />
typische Formen des Umgangs mit der Arbeitslosigkeit herausgearbeitet,<br />
an Falldarstellungen erläutert <strong>und</strong> — bezogen auf 100 genauer analysierte Familien<br />
— in ihren quantitativen Relationen dargestellt. Aus zusätzlichen Informationen<br />
über die anderen Familien des Dorfes schließen die Autoren,<br />
daß in Marienthal insgesamt 23 Prozent der Familien als ungebrochen gelten<br />
können, 69 Prozent als resigniert <strong>und</strong> acht Prozent als verzweifelt oder<br />
apathisch (S. 74). Die resignierte Haltung, deren wichtigstes Kennzeichen<br />
der Verlust der Zukunftsperspektive <strong>und</strong> die Aufgabe von Planung ist, wird<br />
demnach als die bestimmende beschrieben, die das Ortsleben nach dem Eindruck<br />
der Autoren sogar noch stärker prägt, als es die Zahlen ausdrücken.<br />
Es dominiert im unmittelbaren Kontakt mit der Bevölkerung der „Eindruck<br />
einer als Ganzes resignierten Gemeinschaft, die zwar die Ordnung der Gegenwart<br />
aufrechterhält, aber die Beziehung zur Zukunft verloren hat" (S.<br />
75). An anderer Stelle reden die Autoren auch von einer „müden Gemeinschaft"<br />
(vgl. S. 55 ff.) <strong>und</strong> sie stellen in der Einleitung „die lähmenden<br />
Wirkungen" der Arbeitslosigkeit in den Vordergr<strong>und</strong> (S. 26).<br />
Über diese „lähmenden Wirkungen" wird im Untersuchungsbericht anhand<br />
einer Vielzahl weiterer Fragen <strong>und</strong> Indikatoren gesprochen. Wichtig<br />
ist dabei vor allem der „Zeitzerfall" (S. 25, S. 83 ff.), der bei arbeitslosen<br />
Männern <strong>und</strong> Frauen unterschiedlich ausgeprägt ist, <strong>und</strong> das geringe Niveau<br />
von Ansprüchen <strong>und</strong> Aktivitäten (S. 25; S. 55 ff.), das sich im politischen<br />
Bereich ebenso zeigen läßt wie im kulturellen Bereich.<br />
Da es hier primär um eine methodologische Auseinandersetzung mit der<br />
Studie geht, mag dieser knappe Überblick über das, was aus deskriptiver<br />
<strong>und</strong> interpretierender Ebene als relevantes Ergebnis der Arbeitslosigkeit in<br />
der Studie hervorgehoben wird, genügen. Im folgenden ist zu fragen, ob <strong>und</strong><br />
in welcher Weise die Autoren ihre Erklärungsansprüche einlösen <strong>und</strong> ob es<br />
ihnen gelingt, die dem Bericht zugr<strong>und</strong>e liegende kausale Deutung zu belegen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
3. Wie wird erklärt?<br />
Zunächst ist wichtig festzustellen, daß sich die Autoren bei der Begründung<br />
der Aussage, daß die beschriebenen Phänomene der Resignation <strong>und</strong> der<br />
Lähmung Folge der Arbeitslosigkeit seien, nicht auf vorhandene, wissenschaftlich<br />
f<strong>und</strong>ierte (bzw. induktiv abgesicherte) Generalisierungen stützen<br />
können — ganz zu schweigen von irgendwelchen gesetzesartigen Aussagen<br />
(vgl. zum Verhältnis von Kausalaussage <strong>und</strong> induktiv abgestützten Generalisierungen<br />
Mackie, 1980, S. 29 ff.). Die Diskussionssituation der damaligen<br />
Zeit wird vielmehr von Marie Jahoda wie folgt dargestellt: „Marienthal entstand<br />
zu einer Zeit, in der die öffentliche Debatte über die Konsequenzen<br />
der Massenarbeitslosigkeit scharf geteilt war: Manche hofften — oder fürchteten<br />
—, daß die Situation zur Revolution führen werde; andere behaupteten,<br />
daß die Arbeitslosigkeit den politischen Willen untergraben werde. Es<br />
gab gute Argumente auf beiden Seiten, aber vor unserer Untersuchung wenig<br />
systematische Dokumentation." (1980, S. 140)<br />
Vor dem Hintergr<strong>und</strong> dieser Diskussionssituation kann die Studie beschrieben<br />
werden als eine Untersuchung, in der es<br />
a) um die Überprüfung alternativer Hypothesen zu den Folgen der Arbeitslosigkeit<br />
geht, <strong>und</strong><br />
b) um die Entwicklung generalisierender Hypothesen, die besser als die<br />
damals geläufigen abgesichert sind <strong>und</strong> die — mit aller Vorsicht (vgl.<br />
hierzu die entsprechenden einschränkenden Bemerkungen in Jahoda<br />
u.a., 1975, S. 25 f.; S. 59 f. oder S. 96 f.) — auch prognostisch zu verwenden<br />
sind.<br />
Beides — sowohl die Hypothesenprüfung als auch die Hypothesen<strong>entwicklung</strong><br />
— setzt voraus, daß es den Autoren gelingt, den behaupteten Kausalzusammenhang<br />
zu belegen. D.h. sie müssen belegen, daß es sich bei den beschriebenen<br />
Phänomenen der Resignation <strong>und</strong> der Lähmung tatsächlich um<br />
Folgen der Arbeitslosigkeit handelt <strong>und</strong> nicht um Auswirkungen ganz anderer<br />
Bedingungen (z.B. längerfristig vorhandener kultureller <strong>und</strong> politischer<br />
Traditionen o.a.). 6 An der Art, in der sie dies tun, läßt sich nun zeigen,<br />
daß ihrer Arbeit implizit ein Erklärungskonzept zugr<strong>und</strong>e liegt, welches<br />
der Weberschen Darstellung kausaler Deutungen „typischen Handelns"<br />
(vgl. hierzu Abschnitt 1) am nächsten kommt. Die Autoren gehen erstens<br />
— ebenso wie Max Weber — nicht von einem deterministischen Kausalitätskonzept<br />
aus <strong>und</strong> sie bemühen sich zweitens in der Auseinandersetzung mit<br />
dem „Erlebnis der Arbeitslosigkeit" (Jahoda u.a., 1975, S. 24), das Verhalten<br />
der Marienthaler als verständliche Reaktion auf die Situation zu beschreiben.<br />
Die in Marienthal dominierende resignierte Haltung wird in ihrer Darstellung<br />
zu einem verständlichen Handlungstypus im Weberschen Sinn (vgl. zu diesem<br />
Begriff: Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft, I, S. 9).<br />
Im einzelnen können aus der Art <strong>und</strong> Weise, in der die Autoren der Marienthal-Studie<br />
ihre Ergebnisse darstellen, bei der Begründung von kausalen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Aussagen vor allem die folgenden Formen der Argumentation <strong>und</strong> Beweisführung<br />
herausgearbeitet werden:<br />
1. die vergleichende Analyse von Fällen,<br />
2. die verstehende Deutung,<br />
3. (<strong>und</strong> in einer engen Beziehung zu 2) die Auseinandersetzung mit den<br />
kausalen Deutungen derer, die in die Untersuchung einbezogen sind.<br />
Zu 1: Vergleichende Analyse<br />
Der Vergleich spielt in dem Bericht in verschiedenen Varianten eine Rolle,<br />
wobei für die Unterstützung der kausalen Deutung wohl am wichtigsten der<br />
Vergleich mit dem Ort Marienthal vor Schließung der für den Ort zentralen<br />
Fabrik ist. Auch wenn die Marienthal-Untersuchung keine Längsschnitt-Studie<br />
ist, haben die Autoren durch die Art ihres Forschungszugangs doch die<br />
Möglichkeit, die Vergangenheit des Ortes zu rekonstruieren. Hierzu ziehen<br />
sie schriftliche Quellen ebenso heran wie mündliche Quellen — die biographischen<br />
Interviews, Interviews mit Partei- <strong>und</strong> Vereinsfunktionären, dem<br />
Bibliothekar Marienthals, dem Lehrer etc. Es ergibt sich bei dem Versuch<br />
der historischen Rekonstruktion ein Bild der Vergangenheit, welches der<br />
„einförmigen, bewegungsarmen" (Jahoda u.a., 1975, S. 55) <strong>und</strong> durch Resignation<br />
gekennzeichneten Gegenwart diametral entgegengesetzt ist. Marienthal<br />
war vor Schließung der Fabrik ein kulturell <strong>und</strong> politisch lebendiger<br />
Ort (vgl. S. 55 ff.), von dem die Autoren schreiben, er sei ein „politisch<br />
heißer Boden" gewesen (S. 36). Zum Zeitpunkt der Untersuchung ist hiervon<br />
wenig geblieben. Politische Beteiligung <strong>und</strong> politische Aktivitäten sind<br />
deutlich zurückgegangen (vgl. S. 58 ff.) wie ebenso auch andere Aktivitäten<br />
(vgl. z.B. den Rückgang der Leseaktivitäten <strong>und</strong> der Ausleihzahlen in der<br />
Bibliothek; S. 57 f.).<br />
Eine andere Variante der vergleichenden Analyse, die für die Unterstützung<br />
der kausalen Deutung gleichfalls von Bedeutung ist, <strong>und</strong> die zum festen<br />
Bestandteil der Argumentation in vielen quantitativen Untersuchungen<br />
gehört (vgl. zur Relevanz des Vergleichs für die Hypothesenbildung auf<br />
der Basis qualitativer Studien auch Glaser <strong>und</strong> Strauss, 1968, S. 45 ff.), ist<br />
der Querschnittsvergleich. Es werden in diesem Fall Aufsätze von Kindern,<br />
die in Marienthal leben, mit solchen verglichen, die von Kindern aus Orten<br />
der Umgebung geschrieben wurden, die nicht von Arbeitslosigkeit betroffen<br />
sind (vgl. Jahoda, 1975, S. 75 ff.). An der Analyse dieser Aufsätze läßt<br />
sich zeigen, daß die Marienthaler Kinder in die resignative Gr<strong>und</strong>haltung des<br />
Ortes einbezogen sind <strong>und</strong> sich hierin — im Durchschnitt betrachtet — von<br />
den Kindern der Umgebung unterscheiden.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Zu 2: Verstehende Deutung<br />
Mindestens ebenso wichtig für die Unterstützung der kausalen Deutung ist<br />
das, was in qualitativen Untersuchungen häufiger mit der Forderung, die<br />
untersuchte Realität „von innen her" zu sehen, bezeichnet wird. Die Autoren<br />
der Marienthal-Studie versuchen dies 7 <strong>und</strong> werden darin durch ihren<br />
offenen Forschungszugang unterstützt. Manche Reaktionen, die von außen<br />
betrachtet als rätselhaft erscheinen mögen, verlieren diesen Charakter, wenn<br />
man sie zusammen mit dem betrachtet, was die Autoren über die Erfahrung<br />
der Arbeitslosigkeit 1931/32 in Marienthal schreiben. Die Draysche rationale<br />
Erklärung, die in ihrer Orientierung an der Perspektive der Handelnden<br />
eine enge Beziehung zu den am Verstehensbegriff orientierten Wissenschaftstraditionen<br />
hat 8 , hat hier ihren Stellenwert. Um nur ein Beispiel zu nennen:<br />
Aus der genaueren Analyse einer Reihe von biographischen Interviews ergibt<br />
sich, daß Zukunftspläne von den befragten Männern <strong>und</strong> Frauen selten<br />
gemacht werden (vgl. Jahoda u.a., 1975, S. 77). Und sofern Pläne erwähnt<br />
werden (meist Pläne zur Abwanderung), handele es sich „eher um beiläufig<br />
ausgesprochene Wünsche als um konkrete Pläne" (ebenda).<br />
Die Autoren interpretieren bzw. erklären: „Die kaum überwindlichen<br />
Schwierigkeiten einer individuellen Besserung der Notlage lassen diese Haltung<br />
verständlich erscheinen." (Ebenda) Vor dem Hintergr<strong>und</strong> der an anderen<br />
Stellen des Buches genauer erläuterten Erfahrungen der Vergeblichkeit<br />
der Bemühungen um einen Arbeitsplatz (vgl. z.B. S. 93 f., S. 70 u.a.) werden<br />
Nicht-Handeln <strong>und</strong> Nicht-Planen also zu einem einleuchtenden Resultat<br />
der Abwägung zwischen Handlungszielen <strong>und</strong> wahrgenommenen Möglichkeiten<br />
der Zielverwirklichung.<br />
Wichtig ist jedoch, sich klar zu machen, daß die verstehende oder „rationale<br />
Erklärung" sich hier nicht auf den Einzelfall bezieht, sondern daß<br />
sie in eine zusammenfassende Betrachtung einer größeren Zahl von Fällen<br />
einbezogen ist. In den Begriffen Max Webers: 'Verstehen' heißt in diesem<br />
Fall „die deutende Erfassung" „des durchschnittlich <strong>und</strong> annäherungsweise<br />
gemeinten" <strong>und</strong> nicht „die deutende Erfassung des im Einzelfall real gemeinten"<br />
(Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft, I, S. 7).<br />
Zu 3: Auseinandersetzung mit den kausalen Deutungen derer, die in die<br />
Untersuchung einbezogen sind<br />
Ein Beispiel für das Aufgreifen der Kausalinterpretationen der Untersuchten<br />
findet sich in der Marienthal-Studie im Zusammenhang mit der Darstellung<br />
<strong>und</strong> Interpretation der Veränderung der Lesegewohnheiten (Jahoda<br />
u.a., 1975, S. 57 f.). Bei dem Versuch, verständlich zu machen, warum trotz<br />
der Zunahme an freier Zeit weniger gelesen wird, greifen die Autoren auf die<br />
Selbstdeutungen der Befragten zurück. Als Erklärungen, denen sie häufiger<br />
begegnet seien, werden die folgenden Ausschnitte aus Gesprächen zitiert:<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
„Herr S.: 'Meine freie Zeit verbringe ich größtenteils zu Hause. Seit ich arbeitslos bin,<br />
lese ich fast überhaupt nicht mehr. Man hat den Kopf nicht danach.' —<br />
Frau F.: 'Früher habe ich viel gelesen, ich habe die meisten Bücher in der Bibliothek gekannt.<br />
Jetzt lese ich weniger. Mein Gott, man hat jetzt andere Sorgen!'"<br />
Einerseits sind diese Kommentare in den Versuch einer verstehenden oder<br />
rationalen Erklärung der Veränderung der Lesegewohnheiten einbezogen<br />
<strong>und</strong> könnten insofern zusammen mit der Interpretation der Autoren auch<br />
als Beispiel für die unter 2. abgehandelten Versuche der verstehenden Deutung<br />
herangezogen werden. Auf der anderen Seite wird mit dem Aufgreifen<br />
der kausalen Deutungen der Untersuchten jedoch noch ein anderer Akzent<br />
gesetzt. Sie erfüllen im Argumentationszusammenhang der Autoren die<br />
Funktion eines zusätzlichen empirischen Beleges, der die Kausalinterpretation<br />
der Autoren stützt. Diese von den Autoren eher beiläufig <strong>und</strong> nicht<br />
sehr bewußt eingesetzte Variante der induktiven Absicherung von Kausalhypothesen<br />
wird von Mirra Komarovsky in einer qualitativen Studie über<br />
den Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit <strong>und</strong> Familienstruktur (1973<br />
— zuerst 1940) explizit aufgegriffen. Sie beschreibt unter dem Begriff des<br />
„discerning" eine Methode der Überprüfung von Kausalaussagen, die die<br />
Kausalinterpretationen der Befragten ausdrücklich berücksichtigt (vgl.<br />
1973, S. 1<strong>35</strong> ff.; vgl. zur Kommentierung auch die Einleitung Lazarsfelds<br />
<strong>und</strong> ebenfalls Barton <strong>und</strong> Lazarsfeld, 1979, S. 68 f.).<br />
Man kann die empirische Beweiskraft der kausalen Deutungen der Untersuchten<br />
sicher in unterschiedlicher Weise beurteilen. Kaum zu bestreiten<br />
ist meiner Ansicht nach jedoch, daß sie so oder so ein wichtiges sozialwissenschaftliches<br />
Datum sind. Denn auch wenn man den Kausalinterpretationen<br />
der Untersuchten mit ideologiekritischer Skepsis begegnet, bleiben sie<br />
als Teil der Situationsdefinition <strong>und</strong> als Informationshintergr<strong>und</strong>, der in<br />
verstehende oder rationale Handlungserklärungen eingeht, gleichwohl relevant.<br />
Die hier vorgestellten Varianten der Argumentation, mit der die Autoren<br />
der Marienthal-Studie die kausale Deutung der beschriebenen Phänomene<br />
der Resignation <strong>und</strong> Lähmung stützen, vermitteln sicher kein vollständiges<br />
Bild ihrer Argumentation. Trotzdem kann dieser Überblick doch<br />
dazu beitragen, tragende Elemente des zugr<strong>und</strong>eliegenden Erklärungskonzeptes<br />
zu verdeutlichen. Mit der Integration einer verstehenden <strong>und</strong> vergleichenden,<br />
mehr oder minder explizit quantifizierenden Betrachtungsweise<br />
steht die Marienthal-Untersuchung jener Auffassung von Erklärungen in<br />
der Soziologie am nächsten, wie sie von Weber in den „Soziologischen<br />
Gr<strong>und</strong>begriffen" vorgelegt wurde <strong>und</strong> bei der es um die Forderung geht,<br />
die verstehende <strong>und</strong> die statistische Argumentation — gegebenenfalls auch<br />
nur in vorsichtigen Annäherungen — miteinander zu verbinden: Die Art<br />
des Forschungszugangs macht es den Autoren möglich, reichhaltige Informationen<br />
zu Situationsdeutungen <strong>und</strong> Handlungsintentionen zu erheben,<br />
so daß empirisch abgestützte verstehende oder rationale Erklärungen gegeben<br />
werden können. Gleichzeitig ermöglicht es der an experimentellen An-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Ordnungen orientierte Vergleich — als Längsschnitt- <strong>und</strong> als Querschnittvergleich<br />
—, den Beweis für das Bestehen einer „Chance" zu erbringen, daß unter<br />
den Bedingungen langandauernder Arbeitslosigkeit in Orten wie Marienthal<br />
<strong>und</strong> vergleichbaren Orten (vgl. zu entsprechenden einschränkenden Bemerkungen<br />
Jahoda u.a., 1975, S. 25 f. oder S. 96 f.) „das Handeln den<br />
sinnadäquat erscheinenden Verlauf tatsächlich mit angebbarer Häufigkeit<br />
oder Annäherung ... zu nehmen pflegt." (Weber, Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft<br />
I, S. 9).<br />
4. Anmerkungen zum Begriff der Kausalerklärung<br />
Ich würde abschließend gern einige Bemerkungen zum Begriff der Kausalerklärung<br />
machen <strong>und</strong> damit zugleich auf die Ausgangsfragen dieses Vortrages<br />
zurückkommen: Soll oder kann man im Rahmen qualitativer Forschung<br />
Erklärungen oder Prognosen erarbeiten <strong>und</strong> insbesondere: Soll oder kann<br />
man kausal erklären?<br />
Wenn man sich am Sprachgebrauch der neo-positivistischen Wissenschaftstheorie<br />
<strong>und</strong> des kritischen Rationalismus orientiert, wird man sagen<br />
müssen, daß Kausalerklärungen in qualitativen Untersuchungen keine Rolle<br />
spielen. Denn Kausalerklärungen werden in dieser Tradition bekanntlich<br />
mit deduktiv-nomologischen Erklärungen identifiziert. In der Formulierung<br />
Poppers: „Einen Vorgang 'kausal erklären' heißt, einen Satz, der ihn beschreibt,<br />
aus Gesetzen <strong>und</strong> Randbedingungen deduktiv ableiten." (1966,<br />
5. 31).<br />
In diesem Sinne wird in der Marienthal-Untersuchung wie auch in vielen<br />
anderen sozialwissenschaftlichen Untersuchungen — auch solchen, die mit<br />
Hilfe standardisierter Verfahren arbeiten — genau nichts erklärt, wie dies<br />
von Lazarsfeld in der Einleitung zur Neuauflage von 1960 auch expliziert<br />
wird: In der Marienthal-Untersuchung sei es nicht darum gegangen, die beschriebenen<br />
Phänomene der Lähmung oder des Zeitzerfalls „auf andere<br />
Gesetze oder präzise Zusammenhänge" zurückzuführen (1975, S. 17).<br />
Ebenso handele es sich bei den Folgerungen, die man aus den generalisierenden<br />
Formeln wie etwa der von der „müden Gemeinschaft" ableiten könne,<br />
keineswegs um logische Schlüsse. Die aus den integrierenden Interpretationen<br />
folgenden Hypothesen werden „nicht mit logischer Notwendigkeit"<br />
abgeleitet, sondern „mit großer Plausibilität <strong>und</strong> geleitet von zusätzlichem<br />
Wissen <strong>und</strong> allgemeiner Erfahrung" (ebenda).<br />
Ist es vor diesem Hintergr<strong>und</strong> also erforderlich, den Begriff der Kausalerklärung<br />
aus der Wissenschaftssprache der mit offenen Verfahren arbeitenden<br />
Sozialforschung zu verbannen? Diejenigen Autoren, die meinen, daß es<br />
in der qualitativen oder interpretativen Sozialforschung nicht um die Erarbeitung<br />
von Kausalerklärungen gehe, scheinen dieser Auffassung zu sein<br />
<strong>und</strong> binden sich damit noch in der Negation an die Begrifflichkeit des Neo-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
positivismus. Aber zu fragen ist, ob diese Selbstbindung vernünftig ist <strong>und</strong><br />
ob die neopositivistische Sprachregelung durch die Weiter<strong>entwicklung</strong> der<br />
philosophischen Diskussion nicht überholt ist. So gibt es zum einen in der<br />
analytischen Philosophie eine Reihe von Autoren, die auch verstehende<br />
oder rationale Erklärungen als kausale begreifen (vgl. u.a. hierzu Davidson,<br />
1975). Und es gibt zum anderen Autoren, die der Auffassung sind, daß<br />
auch nicht-deterministische generalisierende Aussagen Kausalerklärungen<br />
stützen können (vgl. hierzu Mackie, 1980, S. 29 ff.). D.h. es gibt einige Argumente<br />
dafür, den Begriff der Kausalerklärung so weit zu fassen, daß er<br />
jene Explikation soziologischer Erklärungen, die Max Weber in den „Soziologischen<br />
Gr<strong>und</strong>begriffen" vorlegte, in sich einschließt.<br />
Orientiert man sich an einem derart weit gefaßten Begriff von Kausalerklärungen,<br />
wird man es kaum rechtfertigen können, in qualitativen Untersuchungen<br />
den Anspruch, Kausalerklärungen zu erarbeiten, rigoros fallen<br />
zu lassen. Man kann eher umgekehrt argumentieren: Gerade der offene <strong>und</strong><br />
am Anspruch des Verstehens orientierte Forschungszugang erleichtert die<br />
Erarbeitung plausibler Kausalerklärungen, <strong>und</strong> zwar dadurch, daß Aussagen<br />
zur Sinnadäquanz des zu erklärenden Handelns im Vergleich zu anderen<br />
Forschungsverfahren empirisch besser begründet werden können.<br />
ANMERKUNGEN<br />
1 Ein empirisches Feld, in dem Geertz' Konzeption zu einiger Prominenz gekommen<br />
ist, ist beispielsweise der Bereich der Studien, in denen in der Organisationsforschung<br />
unter dem Stichwort „corporate culture" überwiegend qualitativ <strong>und</strong> am Vorbild<br />
ethnographischer Forschung orientiert gearbeitet wird (vgl. als Übersicht Smircich,<br />
1983). Ähnlich wie Geertz hebt auch Smircich hervor, daß es in diesen Studien, ungeachtet<br />
theoretischer Unterschiede, nicht primär um Vorhersagen, Generalisierungen,<br />
Kausalität <strong>und</strong> Kontrolle gehe, wie dies für die an standardisierten Verfahren<br />
orientierte vergleichende Organisationsforschung gelte, sondern um Verstehen <strong>und</strong><br />
Auslegung (vgl. insbesondere S. <strong>35</strong>3 ff.). Vgl. zur Rezeption Geertz' auch Sanday,<br />
1979.<br />
2 Vgl. als Übersichten über die unterschiedlichen Phasen der Auseinandersetzung über<br />
Erklären <strong>und</strong> Verstehen in den Geschichts- <strong>und</strong> Sozialwissenschaften von Wright,<br />
1974, oder Apel, 1979; vgl. als Übersicht über unterschiedliche Positionen in der<br />
analytischen Philosophie auch Giesen <strong>und</strong> Schmid, 1975.<br />
3 Die Studie wurde zuerst im Januar 1933 bei S. Hirzl in Leipzig veröffentlicht, wurde<br />
im nationalsozialistischen Deutschland jedoch kurze Zeit nach dem Erscheinen<br />
konfisziert (vgl. hierzu Jahoda, 1981, S. 139 <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>, 1983, S. 22). Eine zweite<br />
deutsche Ausgabe erschien 1960 <strong>und</strong> wurde 1975 durch eine Taschenbuchausgabe<br />
einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Seit Anfang der siebziger Jahre erschienen<br />
auch englische <strong>und</strong> französische Ausgaben <strong>und</strong> heute gilt die Untersuchung<br />
als Klassiker der empirischen Sozialforschung. Vgl. zur wissenschaftsgeschichtlichen<br />
Einordnung der Studie Knoll u.a., 1981, S. 88 ff., oder Lepsius, 1981, S. 464 ff.<br />
Vgl. zur Kommentierung der Studie auch die Beiträge der Autoren, auf die im folgenden<br />
verschiedentlich Bezug genommen wird.<br />
4 Vgl. hierzu verschiedene Textsammlungen <strong>und</strong> einführende Darstellungen zu qualita-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
tiven Verfahren (u.a. McCall <strong>und</strong> Simmons, 1969; Filstead, 1971; Schwartz <strong>und</strong><br />
Jacobs, 1979; Smith <strong>und</strong> Manning, 1982), aus denen — trotz unterschiedlicher inhaltlicher<br />
Akzentsetzungen — hervorgeht, wie stark qualitative Forschung in der<br />
amerikanischen Soziologie mit Feldforschung als „teilnehmender Beobachtung"<br />
verb<strong>und</strong>en ist. In der B<strong>und</strong>esrepublik hat sich dieser Forschungstyp allerdings auch<br />
in neueren qualitativen Untersuchungen nicht in dem Maße durchsetzen können,<br />
in dem man es angesichts der Orientierung an Forderungen nach Untersuchungen,<br />
in denen die natürlichen Lebenskontexte der Individuen berücksichtigt werden, erwarten<br />
könnte. Vgl. als eine Darstellung, in der die von den Autoren als „soziographisch"<br />
bezeichnete Marienthal-Untersuchung dem Typus der teilnehmenden Beobachtung<br />
zugeordnet wird, Jahoda u.a., 1962, S. 82 ff.<br />
5 Diese werden von Lazarsfeld an anderer Stelle auch als „quasi-statistische" Aussagen<br />
bezeichnet (vgl. Barton <strong>und</strong> Lazarsfeld, 1979, S. 69 ff.) <strong>und</strong> spielen in qualitativen<br />
Untersuchungen im allgemeinen eine nicht unerhebliche Rolle — auch bei solchen<br />
Autoren, die der Überzeugung sind, daß ihre eigenen Analysen mit Quantitäten<br />
überhaupt nichts zu tun haben (vgl. zu dieser Frage auch Bryman, 1984, S. 80).<br />
6 Vgl. als Darstellung <strong>und</strong> Diskussion alternativer Deutungen der auch in anderen<br />
empirischen Untersuchungen belegten Zusammenhänge zwischen Arbeitslosigkeit<br />
<strong>und</strong> Resignation <strong>und</strong> Lähmung, die von den Autoren unter einem breit gefaßten Begriff<br />
der Depressivität zusammengefaßt werden, Frese <strong>und</strong> Mohr, 1978, S. 317 f.<br />
7 Vgl. hierzu auch Zeisels Kommentierung (1975, S. 131 f.), in der ein direkter Bezug<br />
zu Webers methodologischen Arbeiten hergestellt wird <strong>und</strong> die Forderung erhoben<br />
wird, die subjektiven Aspekte der jeweils untersuchten Realität (Situationseinschätzungen<br />
der in sozialwissenschaftliche Untersuchungen Einbezogenen) systematisch<br />
zu berücksichtigen.<br />
8 Vgl. z.B. Dray, 1975, S. 263: „Verstehen ist dann erreicht, wenn der Historiker die<br />
Vernünftigkeit, den Sinn der Handlung einsehen kann, gerechnet an den Vorstellungen<br />
<strong>und</strong> Absichten der Handelnden. Seine Handlung kann dann in dem Sinne als erklärt<br />
gelten, als sie als 'angemessen' angesehen werden kann." Vgl. zur Erläuterung<br />
der Beziehungen zwischen „rationalen Erklärungen" <strong>und</strong> den am Verstehensbegriff<br />
orientierten Wissenschaftstraditionen von Wright, 1974, S. <strong>35</strong> ff., oder auch Stegmüller,<br />
1969, S. 379 ff. Vgl. zur Elaborierung des diesen <strong>und</strong> vergleichbaren Erklärungen<br />
zugr<strong>und</strong>eliegenden Argumentationsschemas des „praktischen Syllogismus"<br />
von Wright, 1974, S. 83 ff. <strong>und</strong> S. 36 f.<br />
LITERATUR<br />
Albert, Hans (Hrsg.): Theorie <strong>und</strong> Realität. Ausgewählte Aufsätze zur Wissenschaftslehre<br />
der Sozialwissenschaften. 2. veränd. Aufl., Tübingen 1972.<br />
Apel, Karl-Otto: Die Erklären-Verstehen-Kontroverse in transzendental-pragmatischer<br />
Sicht, Frankfurt am Main 1979.<br />
Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen (Hrsg.): Alltagswissen, Interaktion <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Wirklichkeit, Band 1, Sy<strong>mb</strong>olischer Interaktionismus <strong>und</strong> Ethnomethodologie,<br />
Reinbek bei Ha<strong>mb</strong>urg 1973.<br />
Barton, Allen H. <strong>und</strong> Lazarsfeld, Paul F.: „Einige Funktionen von qualitativer Analyse<br />
in der Sozialforschung." In: Hopf/Weingarten (Hrsg.): Qualitative Sozialforschung,<br />
Stuttgart 1979, S. 41-89.<br />
Becker, Howard: „Typologisches Verstehen." In: Bühl (Hrsg.): Verstehende Soziologie,<br />
<strong>München</strong> 1972, S. 214-251.<br />
Bryman, Alan: „The debate about quantitative and qualitative research: a question of<br />
methodor epistemology?" In: The British Journal of Sociology, <strong>35</strong> (1984) 1,S. 75-92.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Bühl, Walter (Hrsg.): Verstehende Soziologie. Gr<strong>und</strong>züge <strong>und</strong> Entwicklungstendenzen,<br />
<strong>München</strong> 1972.<br />
Davidson, D.: „Handlungen, Gründe <strong>und</strong> Ursachen." In: Giesen/Schmid 1975, S. 310-<br />
324.<br />
Donagan, A.: „Die Popper-Hempel-Theorie der historischen Erklärung." In: Giesen/<br />
Schmid 1975, S. 79-102.<br />
Dray, William: Laws and explanation in history. 3. unveränd. Nachdruck, Clarendon<br />
Press, Oxford 1966 (zuerst 1957).<br />
Ders.: „Historische Erklärungen von Handlungen." In: Giesen/Schmid 1975, S. 261-<br />
283.<br />
Filstead, William J.: Qualitative Methodology: Firsthand Involvement with the Social<br />
World, Chicago 1971 (2. Aufl.).<br />
Frese, Michael/Greif, Siegfried/Semmer, Norbert (Hrsg.): Industrielle Psychopathologie,<br />
Bern 1978.<br />
Frese, Michael/Mohr, Gisela: „Die psychopathologischen Folgen des Entzugs der Arbeit:<br />
Der Fall der Arbeitslosigkeit." In: Frese u.a., 1978, S. 282-338.<br />
Fre<strong>und</strong>, Michael: „Geblieben ist die Tristesse. Marienthal heute — wieder „nur ein Beispiel"?"<br />
In: Psychologie Heute, Juni 1983, S. 21-27.<br />
Giesen, Bernhard/Schmid, Michael (Hrsg.): Theorie, Handeln <strong>und</strong> Geschichte. Erklärungsprobleme<br />
in den Sozialwissenschaften, Ha<strong>mb</strong>urg 1975.<br />
Geertz, Clifford: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme,<br />
Frankfurt am Main 1983.<br />
Glaser, Barney G. <strong>und</strong> Strauss, Anselmi.: The Discovery of Gro<strong>und</strong>ed Theory. Strategies<br />
for Qualitative Research, London 1968 (zuerst 1967).<br />
Dies.: Interaktion mit Sterbenden. Beobachtungen für Ärzte, Schwestern, Seelsorger<br />
<strong>und</strong> Angehörige, Göttingen 1974.<br />
Hempel, Carl G.: „The functions of general laws in history." In: The Journal of Philosophy,<br />
Bd. 39, 1942, S. <strong>35</strong>-48.<br />
Ders.: „Wissenschaftliche <strong>und</strong> historische Erklärungen". In: Albert 1972, S. 237-261.<br />
Hildenbrand, Bruno: Alltag <strong>und</strong> Krankheit. Ethnographie einer Familie, Stuttgart 1983.<br />
Hopf, Christel: „Norm <strong>und</strong> Interpretation. Einige methodische <strong>und</strong> theoretische Probleme<br />
der Erhebung <strong>und</strong> Analyse subjektiver Interpretation in qualitativen Untersuchungen".<br />
In: Zeitschrift für Soziologie, 11 (1982), Heft 3, S. 307-329.<br />
Hopf, Christel/Weingarten, Elmar (Hrsg.): Qualitative Sozialforschung, Stuttgart 1979.<br />
Jahoda, Marie: „Aus den Anfängen der sozialwissenschaftlichen Forschung in Österreich".<br />
In: Zeitgeschichte, 8 (1980/81), S. 133-141.<br />
Jahoda, Marie/Deutsch, Morton/Cook, Stuart W.: „Beobachtungsverfahren". In: König,<br />
II, 1962, S. 77-96.<br />
Jahoda, Marie/Lazarsfeld, Paul F./Zeisel, Hans: Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein<br />
soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit.<br />
Mit einem Anhang zur Geschichte der Soziographie, Frankfurt am Main 1975.<br />
Knoll, Reinhard/Maja, Gerhard/Weiss, Hilde/Wieser, Georg: „Der österreichische Beitrag<br />
zur Soziologie von der Jahrh<strong>und</strong>ertwende bis 1938". In: Lepsius 1981, S.<br />
59-101.<br />
König, Rene' (Hrsg.): Beobachtung <strong>und</strong> Experiment in der Sozialforschung. Praktische<br />
Sozialforschung II, 2. Aufl., Köln, Berlin 1962.<br />
Lazarsfeld, Paul F.: „Vorspruch zur neuen Auflage" (1960), abgedruckt in: Jahoda/<br />
Lazarsfeld/Zeisel 1975, S. 11-23.<br />
Lepsius, M. Rainer (Hrsg.): Soziologie in Deutschland <strong>und</strong> Österreich. Sonderheft 23<br />
der Kölner Zeitschrift für Soziologie <strong>und</strong> Sozialpsychologie, Opladen 1981.<br />
Ders.: „Die sozialwissenschaftliche Emigration <strong>und</strong> ihre Folgen". In: Lepsius 1981, S.<br />
461-500.<br />
Mackie, John Leslie: The cement of the universe. A study of causation. Clarendon<br />
Press, Oxford 1980 (Abdruck der 1. Aufl. von 1974).<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
McCall, George J./Simmons, Jerry L. (Hrsg.): Issues in participant Observation: A text<br />
and reader, Reading, Mass. 1969.<br />
Popper, Karl R.: Logik der Forschung. 2. erw. Aufl., Tübingen 1966.<br />
Sanday, Peggy Reeves: „The ethnographic paradigms". In: American Science Quarterly,<br />
24 (1979), S. 527-538.<br />
Schwartz, Howard/Jacobs, Jerry: „Qualitative sociology. A method to the madness",<br />
New York 1979.<br />
Smircich, Linda: „Concepts of culture and organizational analysis". In: Administrative<br />
Science Quarterly, 28 (1983), S. 339-<strong>35</strong>8.<br />
Smith, Robert B./Manning, Peter K. (Hrsg.): Qualitative methods. Volume II of Handbook<br />
of Social Science Methods, Ca<strong>mb</strong>ridge, Mass. 1982.<br />
Stegmüller, Wolfgang: Probleme <strong>und</strong> Resultate der Wissenschaftstheorie <strong>und</strong> Analytischen<br />
Philosophie, Band I. Wissenschaftliche Erklärung <strong>und</strong> Begründung, Studienausgabe,<br />
Teil 3 (Historische, psychologische <strong>und</strong> rationale Erklärung. Kausalitätsprobleme,<br />
Determinismus <strong>und</strong> Indeterminismus), Berlin, Heidelberg, New York<br />
1969.<br />
Weber, Max: Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft. Gr<strong>und</strong>riß der verstehenden Soziologie. Studienausgabe<br />
(hrsg. von Johannes Winckelmann), 1. Halbband, Köln, Berlin 1964.<br />
Ders.: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. 4., erneut durchgesehene Auflage<br />
(hrsg. von Johannes Winckelmann), Tübingen 1973.<br />
Ders.: „Uber einige Kategorien der verstehenden Soziologie". In: Weber 1973, S. 427-<br />
474.<br />
Wilson, Thomas P.: „Theorien der Interaktion <strong>und</strong> Modelle soziologischer Erklärung".<br />
In: Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen 1973, S. 54-79.<br />
von Wright, Georg Henrik: Erklären <strong>und</strong> Verstehen, Frankfurt am Main 1974.<br />
Zeisel, Hans: Anhang: „Zur Geschichte der Soziographie". In: Jahoda/Lazarsfeld/Zeisel<br />
1975, S. 113-142.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Themenbereich III:<br />
Terrorismus in der<br />
B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
EINLEITUNG<br />
Günter Albrecht<br />
Über viele Jahre hat die deutsche Öffentlichkeit <strong>und</strong> die staatlichen Sicherheitsorgane<br />
kein Thema so sehr beschäftigt wie der Terrorismus, der Sicherheit<br />
<strong>und</strong> Ordnung <strong>und</strong> das staatliche Gewaltmonopol so sehr herauszufordern<br />
schien, daß sich in der Gesellschaft der B<strong>und</strong>esrepublik gravierende<br />
Veränderungen einstellten. Dabei kam dem personellen, technischen <strong>und</strong><br />
organisatorischen Ausbau des staatlichen Kontrollapparates große Bedeutung<br />
zu, nicht zuletzt deshalb, weil er mit dem gleichzeitigen Aufbau von<br />
großen Informations- <strong>und</strong> Datensystemen in staatlicher Hand die Schrekkensvision<br />
vom totalen Überwachungsstaat auf den Plan rief. Sicher genauso<br />
problematisch waren jedoch die durch den Terrorismus <strong>und</strong> seine „politische<br />
Bewältigung" ausgelöste oder forcierte Änderung des politischen Klimas<br />
<strong>und</strong> die Einschränkung liberaler rechtsstaatlicher Prinzipien, die leider<br />
auch einige Jahre nach dem Höhepunkt terroristischer Aktivitäten nicht<br />
wieder vollständig rückgängig gemacht worden ist.<br />
Für die Diskussion der Frage, was der deutsche Terrorismus der 70er<br />
Jahre darstellte <strong>und</strong> wie man seine Entstehung <strong>und</strong> seine Verlaufsform zu<br />
erklären habe, die ja vom benachbarten Ausland trotz scheinbar ähnlicher<br />
Ausgangslage deutlich abwich, sollten sozialwissenschaftliche Forschungsergebnisse<br />
eigentlich eine zentrale Rolle spielen. Längere Zeit fehlte es jedoch<br />
an gr<strong>und</strong>legenden sozialwissenschaftlichen Studien über den deutschen<br />
Terrorismus. Die Soziologen zeigten eine sehr ausgeprägte Berührungsangst<br />
gegenüber diesem eminent wichtigen Phänomen <strong>und</strong> ließen sich<br />
erst durch das verlockende Angebot großzügiger staatlicher Auftragsforschung<br />
aus der Reserve locken. Seit ca. 3 Jahren sind nun mehrere umfassende,<br />
vom B<strong>und</strong>esminister des Inneren in Auftrag gegebene Studien unter<br />
dem Sammeltitel „Analysen zum Terrorismus" (vgl. Baeyer-Katte, Ciaessens,<br />
Feger <strong>und</strong> Neidhardt 1982; Fetscher <strong>und</strong> Rohrmoser 1981; Jäger,<br />
Schmidtchen <strong>und</strong> Süllwold 1981; Matz <strong>und</strong> Schmidtchen 1983; Sack <strong>und</strong><br />
Steinert 1984) erschienen, die von unterschiedlichen theoretischen Standpunkten<br />
<strong>und</strong> aus unterschiedlichem Gesichtswinkel die Problematik des<br />
Terrorismus zu erhellen versuchen. Die Analysen reichen von der Untersuchung<br />
der ideologischen Gr<strong>und</strong>lagen der Terroristen, über detaillierte<br />
Erforschung der Lebensläufe von Terroristen, die exakte Rekonstruktion<br />
der Gruppenprozesse bei der Entstehung, Verfestigung <strong>und</strong> Auflösung<br />
terroristischer Gruppen, die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>n Bedingungen <strong>und</strong> Legitimität in der B<strong>und</strong>esrepublik bis<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
zur brisanten Frage, ob nicht das Verhältnis von Protest <strong>und</strong> staatlicher<br />
Reaktion (oder auch Über-Reaktion) als Schlüssel für das Verständnis des<br />
Terrorismus in der B<strong>und</strong>esrepublik anzusehen ist. Dabei ist von besonderer<br />
Bedeutung die Streitfrage, ob die staatlichen Reaktionen angemessen zu<br />
verstehen sind als durch die terroristische Bedrohung qualitativ <strong>und</strong> quantitativ<br />
zwingend geforderte Reaktionen, bei denen der Politik keine Optionen<br />
offen blieben, durch die möglicherweise die dem Terrorismus zugr<strong>und</strong>eliegende<br />
Problematik politisch <strong>und</strong> nicht strafrechtlich hätte gelöst werden<br />
können. Oder handelte es sich bei diesen „Reaktionen" um Teilschritte<br />
einer „Strategie" der Transformation von aufbrechenden politisch-<strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Konflikten in Rechtskonflikte, durch die der Staat <strong>und</strong> interessierte<br />
mächtige <strong>gesellschaftliche</strong> Gruppen den Vorteil erlangten, auf politisch<br />
gemeinte Herausforderungen mit „Kriminalisierung" der Herausforderer<br />
reagieren zu können?<br />
Die beiden Referate von Friedhelm Neidhardt (Köln) <strong>und</strong> Fritz Sack<br />
(Ha<strong>mb</strong>urg) greifen aus der Vielzahl von Streitfragen unter anderem die auf,<br />
ob sich der Umschlag von Gruppierungen der außerparlamentarischen<br />
Opposition in terroristische Gruppen als Resultat von gruppendynamischen<br />
Prozessen (Neidhardt) oder als Ergebnis von übertriebenen Reaktionen oder<br />
gar Provokationen des Staates (Sack) verstehen läßt. Zugleich bieten beide<br />
Beiträge eine allgemeine soziologische Bestimmung dessen, was Terrorismus<br />
gesellschaftlich bedeutet. Beide Referate können selbstverständlich nur<br />
einen kleinen Teil des Argumentationshaushaltes vortragen, dessen sich die<br />
verschiedenen Studien bedienen, auf die deshalb ausdrücklich verwiesen<br />
werden muß. Beide Vorträge lassen auch erkennen, wie weit bei allem erkennbaren<br />
Bemühen, die Argumente des jeweils anderen aufzunehmen, die<br />
Interpretationen auseinandergehen. Bezieht man alle anderen Teilprojekte<br />
des Untersuchungsprogrammes „Ursachen des Terrorismus" in die Betrachtung<br />
mit ein, so ist nicht zu übersehen, daß die Studien teilweise zu völlig<br />
konträren Interpretationen gelangen, zwischen denen keine Vermittlung<br />
möglich zu sein scheint. So jedenfalls präsentieren es die Autoren der einzelnen<br />
Untersuchungsberichte, die sich in den publizierten Fassungen häufig<br />
äußerst kritisch aufeinander beziehen.<br />
Auch das Ergebnis der Podiumsdiskussion zum Terrorismusproblem, die<br />
als Begleitveranstaltung vorgesehen war (Teilnehmer außer Neidhardt <strong>und</strong><br />
Sack waren Dieter Ciaessens, Berlin, Eike Hennig, Kassel, Heinz Steinert,<br />
Frankfurt, Trutz von Trotha, Hannover/Freiburg, <strong>und</strong> Peter Waldmann,<br />
Augsburg), bestätigte diesen Eindruck der Unüberbrückbarkeit der Differenzen<br />
in den entscheidenden Fragen.<br />
Die Sicherung des wissenschaftlichen Ertrages der deutschen Terrorismusforschung<br />
wird demnach davon abhängen, daß die wissenschaftliche Gemeinschaft<br />
sich kritisch mit den vorgelegten Untersuchungen auseinandersetzt<br />
<strong>und</strong> die Diskussionsblockade zwischen den „Terrorismusforschern",<br />
die vor allem theoretische, wissenschaftstheoretische <strong>und</strong> methodische, aber<br />
auch politische Gründe hat, überwindet.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Nur dann, so behaupte ich, wird der sozialwissenschaftliche Beitrag zum<br />
Terrorismusproblem jener Zielsetzung dienen, die Steinert (1984, S. 391)<br />
für seine Studie wie folgt bestimmte: „Diesem Ziel ist die Untersuchung<br />
also verpflichtet: die Ereignisse des Terrorismus in der B<strong>und</strong>esrepublik, die<br />
Entwicklung, die zu ihnen hinführte, <strong>und</strong> die Art, wie auf diese Ereignisse<br />
aus dieser Entwicklung heraus reagiert wurde, der <strong>gesellschaftliche</strong>n Selbstreflexion,<br />
der Nachdenklichkeit über die eigenen Verhältnisse verfügbarer<br />
machen zu helfen, als sie das in ihrer alltäglichen Selbstverständlichkeit<br />
gewöhnlich sind. Dieser Versuch rechtfertigt sich durch die unentwegte<br />
Hoffnung, daß auch öffentliche Nachdenklichkeit noch folgenreich möglich<br />
ist, daß die Gestaltung möglicher <strong>gesellschaftliche</strong>r Zukünfte zumindest<br />
nicht ausschließlich den Zugriffen der „Macher" auf beiden Seiten überantwortet<br />
ist, nicht nur der manchmal verhängnisvollen „Konsequenz" angeblicher<br />
Sachzwänge folgen muß, sondern zumindest auch der diskursiven<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>n Selbstverständigung zugänglich ist <strong>und</strong> damit die Wahl<br />
zwischen verschiedenen 'Konsequenzen' zuläßt".<br />
LITERATUR<br />
Baeyer-Katte, Wanda von, Dieter Ciaessens, Hubert Feger <strong>und</strong> Friedhelm Neidhardt<br />
(Hrsg.), Gruppenprozesse. Analysen zum Terrorismus, Bd. 3, Opladen 1982.<br />
Fetscher, Iring, <strong>und</strong> Günter Rohrmoser (Hrsg.), Ideologien <strong>und</strong> Strategien. Analysen<br />
zum Terrorismus, Bd. 1, Opladen 1981.<br />
Jäger, Herbert, Gerhard Schmidtchen <strong>und</strong> Lieselotte Süllwold (Hrsg.), Lebenslaufanalysen.<br />
Analysen zum Terrorismus, Bd. 2, Opladen 1981.<br />
Matz, Ulrich, <strong>und</strong> Gerhard Schmidtchen (Hrsg.), Gewalt <strong>und</strong> Legitimität. Analysen<br />
zum Terrorismus, Bd. 4/1, Opladen 1983.<br />
Sack, Fritz, <strong>und</strong> Heinz Steinert (Hrsg.), Protest <strong>und</strong> Reaktion. Analysen zum Terrorismus,<br />
Bd. 4/2, Opladen 1984.<br />
Steinert, Heinz, unter Mitarbeit von Henner Hess, Susanne Karstedt-Henke, Martin<br />
Moerings, Dieter Paas <strong>und</strong> Sebastian Scheerer, „Sozialstrukturelle Bedingungen<br />
des 'linken Terrorismus' der 70er Jahre aufgr<strong>und</strong> eines Vergleichs der Entwicklungen<br />
in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland, in Italien, Frankreich <strong>und</strong> den Niederlanden",<br />
in: Fritz Sack <strong>und</strong> Heinz Steinert (Hrsg.), Protest <strong>und</strong> Reaktion. Analysen<br />
zum Terrorismus, Bd. 4/2, Opladen 1984, S. 387-601.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
GROSSE WIRKUNGEN KLEINER REIZE - SYMBOLISCH VERMIT<br />
TELT. ZUR SOZIOLOGIE DES TERRORISMUS<br />
Friedhelm<br />
Neidhardt<br />
Die Terrorismusforschung ist hierzulande in einem außerordentlichen Maße<br />
von Bedingungen <strong>und</strong> Zwecken der Politikberatung bestimmt gewesen. Das<br />
sogen. ASÖTE-Projekt des B<strong>und</strong>esinnenministeriums hat 22 Wissenschaftler<br />
über mehrere Jahre zum Thema des Terrorismus beschäftigt <strong>und</strong> am Ende<br />
15 Untersuchungsberichte hervorgebracht, die in fünf Bänden veröffentlicht<br />
sind. Fragt man nach dem Ertrag dieser Großveranstaltung angewandter<br />
Forschung, so sind einerseits ihre praktischen Effekte in dem Bereich zu<br />
bestimmen, der sie veranlaßt <strong>und</strong> finanziert hat, also im Politikbereich;<br />
darüber soll in einer gesonderten Veranstaltung heute nachmittag diskutiert<br />
werden. Auf einem Soziologentag ist es andererseits natürlich unerläßlich,<br />
die fachliche Ausbeute dieser Art Forschung zu sichten <strong>und</strong> dann auch zu<br />
verarbeiten.<br />
Unternimmt man eine fachliche Bestandsaufnahme, so wird auch im<br />
vorliegenden Fall erkennbar, daß angewandte Forschung den beteiligten<br />
Wissenschaften leicht überschaubare Gewinne einbringt. Ihr besonderer<br />
Vorteil dürfte darin liegen, daß sie intensive Berührungen mit Materialfeldern<br />
erzwingt, die ohne Vermittlungen des Auftraggebers nicht einmal<br />
zugänglich wären. So sind auch im ASÖTE-Projekt mehrere Fallstudien entstanden,<br />
die man instruktiv <strong>und</strong> animierend finden kann. Die analytische<br />
Verarbeitung der in ihnen aufgebrachten Informationen <strong>und</strong> Einfälle erscheint<br />
jedoch offenk<strong>und</strong>ig gehemmt durch die Art der Fragen, die den<br />
Forschungszusammenhang begründeten, sowie durch die Stärke des Problemlösungsbedarfs,<br />
der ihm simuliert wurde. Von daher ergaben sich Einschnürungen<br />
auf raumzeitlich eng begrenzte Untersuchungsfelder <strong>und</strong> Vorlieben<br />
für Variablen, die einfach übersetzbar <strong>und</strong> praktisch steuerbar erscheinen<br />
— alles Bedingungen, die einer theoretischen Arbeit am Thema<br />
gewiß nicht förderlich waren. Praktisch bestimmte Forschungskontexte<br />
konzedieren den Beteiligten nur geringe Abstraktionstoleranzen; man wird<br />
für's Hier <strong>und</strong> Jetzt zur Kasse gebeten. Hinzu kam im vorliegenden Fall, daß<br />
die außerordentliche Politisierung des Gegenstandes, um den es bei Terrorismuskomplexen<br />
geht, bei allen Beteiligten für mancherlei Befangenheiten<br />
sorgte — mitgebrachten Befangenheiten <strong>und</strong> zusätzlich solchen, die sich mit<br />
der organisatorischen Einbindung der Projektgruppe in den Einflußbereich<br />
einer der Konfliktparteien einstellten. Ihre Zuordnung zum B<strong>und</strong>esinnenministerium<br />
mußte selber schon als Politikum begriffen werden. Jeder Beteiligte<br />
konnte wissen, daß bei allen Ko<strong>mb</strong>attanten Erkenntnisfragen auch<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
<strong>und</strong> nicht zuletzt als Schuldfragen verrechnet werden, <strong>und</strong> er mußte davon<br />
ausgehen, daß dies auf der einen wie auf der anderen Seite tendenziös geschehen<br />
würde. Von daher ergab sich der Hang zu einer mindestens untergründigen<br />
Moralisierung der Argumentation, auch die Tendenzen zu ihrer<br />
taktischen Inszenierung. Es gab in dieser Lage kein Recht zur Unbekümmertheit.<br />
Unbekümmertheit aber braucht man für den Prozeß theoretischer Reflexion.<br />
Mit dem Versuch der Verallgemeinerung verläßt man den gut<br />
recherchierten Einzelfall, überzieht die gesicherte Erfahrung, bemächtigt<br />
sich auch des nur ungefähr Vergleichbaren, verdrängt dabei eine Fülle von<br />
im Einzelfall wichtigen Details. Theoriearbeit ist eine Art Ausschreitung,<br />
die ohne Skrupellosigkeit <strong>und</strong> Indifferenz gar nicht gelingen kann. Mir<br />
scheint, daß man in der Terrorismusforschung beim gegenwärtigen Stand<br />
der Dinge solche Ausdrucksformen einer inneren Distanz zum Gegenstand<br />
eher ermuntern als ihre unstrittige Eigenproblematik beschwören sollte.<br />
Allerdings entsteht sofort die Frage, ob Terrorismus als ein Phänomen<br />
besonderer Art für Theoriebildung überhaupt taugt. Walter Laqueur, einer<br />
der erfahrensten Empiriker der Terrorismusforschung, bestreitet dies, wenn<br />
er sagt: „Im Auftreten des Terrorismus läßt sich auch ein Zufallselement<br />
feststellen. Aus diesem Gr<strong>und</strong>e ist eine wirklich wissenschaftliche, prognostische<br />
Untersuchung in der Tat unmöglich." (Laqueur 1977, S. 51 f.). Nun<br />
ist es sicher richtig, daß Zufallsmomente sowohl in den Innenbereichen als<br />
auch in den Umwelten des Terrorismus eine besondere Rolle spielen. Terrorismus<br />
ist Ergebnis <strong>und</strong> fortlaufender Bestandteil von Konflikten, die in<br />
der Regel wenig institutionalisiert sind, also keine festen Normen <strong>und</strong> Formen<br />
besitzen (Neidhardt 1981, S. 245 ff.). Insofern gibt es in seiner Entstehung<br />
<strong>und</strong> in seinem Ablauf eine hohe Wahrscheinlichkeit von Überraschungen<br />
<strong>und</strong> Unwägbarkeiten — mit der Folge auch, daß einzelnen Personen <strong>und</strong><br />
ihren oft geheimnisvoll bleibenden Besonderheiten eine außerordentliche<br />
Prozeßbedeutung zukommt. Aber solche Merkmale eines Handlungssystems<br />
sind letztlich nur eine Gradfrage. Nichts ist ohne Zufall, <strong>und</strong> nichts ist nur<br />
Zufall. Insofern ist Theorie allemal möglich, nur muß sie den Zufallsmengen<br />
ihres Gegenstandsbereichs angemessen sein. Das heißt unter anderem: Sie<br />
muß mehr oder weniger Raum lassen für bloße Deskription <strong>und</strong> darf diese<br />
nicht desavouieren <strong>und</strong> verdrängen wollen. Manches läßt sich eben nur erzählen<br />
<strong>und</strong> nicht mehr erklären.<br />
Unabhängig davon — zweifelhaft ist, ob sich die Soziologie überhaupt<br />
auf jenen Aspekt des Terrorismus fixieren lassen sollte, den Walter Laqueur<br />
so resignativ anspricht, nämlich sein „Auftreten" — die Frage also: unter<br />
welchen Bedingungen <strong>und</strong> auf welche Weise er entsteht. Ohne diese Frage<br />
gering zu schätzen, läßt sich doch die andere Frage nach seinen Wirkungen<br />
als die für Soziologen vielleicht aufschlußreichere ansehen. Terrorismus als<br />
Stimulus! Wann immer <strong>und</strong> wo immer er auftritt, bedeutet er eine Aufstörung<br />
von Normalität, eine Beunruhigung eingepegelter Gleichgewichte. Er<br />
schafft Ausnahmezustände. Ist dies nicht verw<strong>und</strong>erlich, wenn man be-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
denkt, daß Terrorismus typischerweise Kleingruppenhandeln ist — seine<br />
Wirkung also einen Ubergriff von Mikroereignissen auf Makrodimensionen<br />
des Gesellschaftlichen dargestellt? Was gibt dem kleinen Reiz so große Wirkungen?<br />
Welche Empfindlichkeiten müssen Gesellschaften besitzen, um von<br />
ein paar Terroristen durcheinandergebracht werden zu können? — Ich will<br />
mich im folgenden vor allem diesen Fragen zuwenden.<br />
1. Terrorismus als Kleingruppenpolitik<br />
Um am Beispiel des Terrorismus die scheinbare UnVerhältnismäßigkeit von<br />
Reiz-Reaktion-Sequenzen begreifen zu können, muß man sich zuerst der<br />
Stimulusqualität des Terrorismus vergewissem. Sog. „Reaktionsansätze"<br />
dürfen in der Soziologie nicht dazu führen, daß der Stimulus unbelichtet<br />
bleibt, auf den reagiert wird. Es gilt festzustellen, was am Terrorismus in<br />
welcher Weise provozieren kann. Dem läßt sich in ersten Schritten näherkommen,<br />
wenn man das, was Terrorismus genannt werden kann, mit zwei<br />
benachbarten, aber doch aufschlußreich abweichenden Phänomenen vergleicht,<br />
erstens mit Gewaltkriminalität, zweitens mit Guerillakampf.<br />
Zum ersten: Terrorismus ist eine politische Handlungsstrategie, die<br />
durch Ausübung von Gewalt erschrecken will. Insofern Gewaltausübung<br />
widerrechtlich ist, stellt Terrorismus ex definitione Gewaltkriminalität<br />
dar. Als bloßer Teil dieser Gewaltkriminalität ist er jedoch in den meisten<br />
Gesellschaften, die ihn erleben, eine völlig harmlose Größe. In der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
wird die materielle Schadenswirkung, die der Terrorismus in<br />
10 Jahren erreichte, von der „gewöhnlichen" Gewaltkriminalität innerhalb<br />
einer Woche übertroffen. Es ist dann auch gar nicht die Gewaltausübung<br />
als solche, die am Terrorismus erregt, sondern der Anspruch, daß seine<br />
Gewaltausübung legitim sei. Dieser politisch gemeinte sy<strong>mb</strong>olische „Kriminalitätsüberschuß"<br />
(Sack 1984, S. 40) ist das Besondere am Terrorismus.<br />
Sein Rechtmäßigkeitsanspruch kollidiert mit dem Gewaltmonopolanspruch<br />
aller modernen Staaten. Da Monopole ex definitione unteilbar<br />
sind, ist diese Kollision total; es gibt keine Kompromißchancen.<br />
Zum zweiten: Wie wenig die Störung durch Terrorismus mit seiner materiellen<br />
Schadenswirkung zu tun hat, wird mit seinen Unterschieden zum<br />
Guerillakampf vielleicht noch deutlicher. „Geht es der im Rahmen der<br />
Guerillastrategie angewandten Gewalt vornehmlich um deren physische<br />
Folgen, die Sprengung von Straßen, Brücken, Eisenbahnlinien usw., bzw.<br />
um die Vernichtung gegnerischer Kampfverbände, so intendiert terroristische<br />
Gewaltanwendung vor allem psychische Reaktionen." (Fetscher et al.<br />
1981, S. 26). Die terroristische Strategie setzt nicht auf Raum- <strong>und</strong> Materialgewinne,<br />
sie ist eine Strategie der Nadelstiche, die den Zweck verfolgt,<br />
die staatliche Gewalt zu kompromittieren — zu kompromittieren auf zweierlei<br />
Weise: erstens durch eine „Propaganda der Tat", durch den Nachweis<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
nämlich, daß Gegengewalt überhaupt möglich ist, zweitens durch Provokation<br />
staatlichen Fehlverhaltens, nämlich durch „Auslösen einer Reaktion,<br />
die skandalisiert werden kann" (Steinert 1984, S. 439). Es geht also beim<br />
Terrorismus nicht um unmittelbare Herrschaftsaneignung, sondern um weniger:<br />
um Delegitimierung bestehender Herrschaft als Voraussetzung dafür,<br />
daß diese danach direkt angegriffen <strong>und</strong> gestürzt werden kann.<br />
Die Unterscheidung zwischen Guerillakampf <strong>und</strong> Terrorismus gibt mit<br />
diesen Differenzierungen nun auch Hinweise auf die empirischen Entstehungsbedingungen<br />
beider Typen politischer Gewalttätigkeit. „Die Differenz<br />
der beiden strategischen Konzepte entsteht daraus, daß die Guerillastrategie<br />
prinzipiell davon ausgeht, die Guerillagruppe werde bei ihren Aktionen<br />
durch die Bevölkerung unterstützt, während die terroristische Strategie<br />
diese Unterstützung durch die Bevölkerung gerade nicht voraussetzt, sondern<br />
sie durch ihre Aktionen erst gewinnen will." (Fetscher et al. 1981,<br />
S. 98). Terrorismus ist insofern ein Indiz politischer Schwäche, ein Mittel<br />
der Wahl machtloser Gruppen, von Kleingruppen, die ein Defizit an sozialen<br />
Ressourcen durch Militarisierung ihres eigenen Einsatzes zu kompensieren<br />
versuchen.<br />
Für diese Interpretation spricht der empirische Bef<strong>und</strong>, daß terroristische<br />
Gruppen häufig als Ausfallprodukte sozialer Protestbewegungen zu<br />
einem Zeitpunkt entstanden sind, als diese, ohne ihr Ziel erreicht zu haben,<br />
resignierten <strong>und</strong> zusammenbrachen. Das trifft nicht nur auf die deutsche<br />
RAF zu (Neidhardt 1982, S. 339 ff.), sondern z.B. auch auf die russische<br />
Narodnaja Volja sowie auf die Terroristen der Sozialrevolutionären Partei<br />
Rußlands im späten 19. bzw. im frühen 20. Jahrh<strong>und</strong>ert (Hildermeier 1982,<br />
S. 107). Sie begriffen sich als Avantgarde erschlaffter Protestpotentiale, <strong>und</strong><br />
die terroristische Tat war als Initialzündung eines neuen Aufbruchs kalkuliert.<br />
Das Gelingen dieser Kalkulation ist allerdings höchst voraussetzungsvoll.<br />
Es geht darum, daß der kleine Konflikt, den Terroristen mit eigener<br />
Kraft bewerkstelligen können, zu einem großen Konflikt eskaliert. Diese<br />
Eskalation hängt nicht nur von den Operationen der Terroristen ab, sondern<br />
wesentlich von den Reaktionen der Gegenspieler; <strong>und</strong> entscheidend<br />
für den Ausgang ist, wie beide Seiten von den Massen wahrgenommen <strong>und</strong><br />
gedeutet werden. Es geht beim Terrorismus (anders als im Guerillakampf)<br />
in erster Linie nicht um rohe Machtfragen, sondern in deren Vorfeld um<br />
Legitimitätskonkurrenzen. Und diese entscheiden sich im Bewußtsein der<br />
Massen <strong>und</strong> nicht auf den Schlachtfeldern.<br />
2. Staatliche Reaktionen<br />
Reagiert ein politisches System auf terroristische Provokationen in einer<br />
Weise, die von den Massen verstanden <strong>und</strong> gebilligt wird? Reagiert es<br />
überhaupt? Und wenn ja: warum?<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
In einem klugen Aufsatz über „Die Strategie des Terrorismus" hat<br />
David Fromkin folgendes notiert: „Der Terrorismus kann nur siegreich sein,<br />
wenn man in der von den Terroristen gewollten Form reagiert... Wenn man<br />
es vorzieht, überhaupt nicht oder aber in einer anderen als von ihnen gewünschten<br />
Weise zu reagieren, wird es ihnen nicht gelingen, ihre Ziele<br />
zu erreichen. Die entscheidende Schwäche des Terrorismus besteht darin,<br />
daß seine Gegner die Wahl haben." (Fromkin 1977, S. 97 f.). Haben, so<br />
kann man dagegen fragen, seine Gegner wirklich die Wahl? Können sie<br />
sich etwa leisten, gar nicht zu reagieren?<br />
Man darf die Provokation des Terrorismus nicht mit dem Argument<br />
unterschätzen, daß sein Angriff materiell relativ unerheblich ist <strong>und</strong> weder<br />
die Produktionsbasis einer Gesellschaft noch deren „human resources"<br />
ernsthaft verletzt. Die Provokation der Terroristen liegt nicht in den kriminellen<br />
Aktionen, die sie begehen, sondern in den sogen. Bekennerbriefen,<br />
die sie dazu schreiben. Ihr Angriff reizt vor allem durch seine Sy<strong>mb</strong>olik.<br />
Dies wird unterstützt durch die Auswahl der Angriffsobjekte: Amerikahaus<br />
<strong>und</strong> jüdischer Friedhof, Schleyer <strong>und</strong> Buback, Polizisten <strong>und</strong> Türken — das<br />
sind im Einzelfall auswechselbare Repräsentanten von Sinnzusammenhängen<br />
<strong>und</strong> Sachverhalten, die hinter ihnen stehen. Und diese unter Einsatz<br />
von Gewalt nicht nur tatsächlich zu verletzen, sondern dafür auch Rechtmäßigkeit<br />
zu beanspruchen, beeinträchtigt nicht in erster Linie <strong>und</strong> unmittelbar<br />
das Gewaltmonopol des Staates, sondern den Mythos, den dieses<br />
Privileg offensichtlich braucht, um intakt zu bleiben.<br />
Die Soziologie wird solche Zusammenhänge nicht angemessen begreifen,<br />
wenn sie die kulturellen Dimensionen <strong>gesellschaftliche</strong>r Prozesse nicht<br />
ernsthaft <strong>und</strong> systematisch bedenkt. Gesellschaften sind neben allem anderen<br />
Sy<strong>mb</strong>olgemeinschaften, die sich über Mythen <strong>und</strong> Tabus ebenso steuern<br />
wie über Geld <strong>und</strong> Macht. Deshalb gibt es auch gegenüber Kollektiven so<br />
etwas wie Beleidigung, Ehrverletzung <strong>und</strong> Schuld; unser Strafgesetzbuch<br />
spricht in seinen §§ 96 <strong>und</strong> 97 sicherlich nicht gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> folgenlos von<br />
„Beschimpfung der B<strong>und</strong>esrepublik" <strong>und</strong> „Verunglimpfung von Organen".<br />
Wir Soziologen haben zu wenig kategoriale Sensibilität gegenüber diesen<br />
Dimensionen entwickelt, <strong>und</strong> deshalb sind in der Soziologie des Terrorismus<br />
die <strong>gesellschaftliche</strong>n Reaktionen auf Terrorismus weithin unbegriffen<br />
geblieben; verschwörungstheoretische Konstruktionen haben für Scheinerklärungen<br />
gesorgt.<br />
Natürlich kann man sich vorstellen, daß sich Gesellschaften gegen den<br />
Terrorismus durch konsequente Verdrängung immunisieren, also ihn gar<br />
nicht zur Kenntnis nehmen; dann wäre in der Tat seine Wirkung harmlos.<br />
Gegen diese Möglichkeit spricht allerdings ein Sachverhalt, der zumindest in<br />
liberal-demokratischen Gesellschaften mit hoher Eigendynamik Realitäten<br />
eigener Art schafft, nämlich die Existenz der Massenmedien. Da Terrorismus<br />
einen außerordentlichen Unterhaltungswert besitzt, ist er aus der Massenkommunikation<br />
gar nicht herauszuhalten. Massenmedien sind deshalb allemal<br />
sehr wirkungsvolle Unterstützer terroristischer Strategie, werden von<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ihnen auch, wie wir wissen, ausdrücklich mitkalkuliert. Sie diff<strong>und</strong>ieren den<br />
kleinen Reiz der terroristischen Aktion <strong>und</strong> dramatisieren ihn auf diese Weise<br />
in den Rang eines öffentlichen Problems. Er kann dann nicht als Dunkelziffer<br />
gehalten werden. Unter solchen Bedingungen können Gesellschaften<br />
allgemein <strong>und</strong> politische Systeme im besonderen schwerlich nicht reagieren.<br />
Über Art <strong>und</strong> Ausmaß dieser Reaktionen ist damit allerdings noch<br />
nichts gesagt. Fragt man nach deren Bedingungen, so stößt man jenseits<br />
soziostruktureller <strong>und</strong> konkret politischer Konstellationen sehr bald wieder<br />
auf Faktoren, die dem soziokulturellen Bereich zugehören. So findet Heinz<br />
Steinert bei seiner interessanten international vergleichenden Terrorismusstudie<br />
etwas, was er in Unterscheidung zu niederländischen, französichen<br />
<strong>und</strong> italienischen Reaktionsstilen die „deutsche Emfindlichkeit" nennt, <strong>und</strong><br />
er spricht in diesem Zusammenhang von der hierzulande auffälligen „Linksfürchtigkeit"<br />
(Steinert 1984, S. 549 <strong>und</strong> 561) — ich würde gern hinzugesetzt<br />
sehen: auch Rechtsfürchtigkeit. Dergleichen läßt sich nicht zum Produkt<br />
von Gegenstrategien auflösen, mit denen die politischen Nutznießer<br />
des Terrorismus durch Angsterzeugung ihr Geschäft betreiben. Ist auch dies<br />
mit im Spiel, so ist das in unserer Gesellschaft gegenüber Extremismus <strong>und</strong><br />
Terrorismus vorfindliche Überreaktionspotential selber doch viel allgemeiner<br />
bedingt. Diese nationale Disposition ist ein kulturell verselbständigter<br />
Reflex auf kollektive Erfahrungen — auf Weimar, auf Holocaust, auf geopolitische<br />
Frontlagen im „kalten Krieg", auf anhaltende Defizite an nationaler<br />
Souveränität <strong>und</strong> sicher vielem mehr. Unsere Gesellschaft besitzt wenig<br />
Selbstbewußtsein, ist deshalb auch leicht irritierbar — <strong>und</strong> das sichert dem<br />
Terrorismus Anfangserfolge allein dadurch, daß er selbst bei mäßigem Reiz<br />
schon zu einem Problem definiert wird, das Notstandsgrößen erreicht.<br />
Überreaktionswahrscheinlichkeiten ergeben sich allerdings auch unabhängig<br />
von kollektiver Reizbarkeit aus den Reizen des Terrorismus selber.<br />
Zweierlei ist in diesem Zusammenhang zu beachten. Erstens: Hat ein politisches<br />
System die Herausforderung von Terroristen angenommen, dann<br />
gewinnt deren Verfolgung sehr schnell zumindest den Anschein von Unverhältnismäßigkeit.<br />
Dies resultiert aus dem Sachverhalt, daß Terrorismus ein<br />
Kleingruppenphänomen ist. Hängt zwar damit zusammen, daß er aus eigener<br />
Kraft nicht gewinnen kann, so zieht er aus dem gleichen Umstand aber<br />
auch taktische Vorteile, die ausreichen, um den Verfolgern Serien von Niederlagen<br />
zuzufügen. Einerseits fällt es sog. Verfolgungsbehörden sowieso<br />
schwer, einem Handlungssystem auf die Spur zu kommen, das nicht der<br />
Logik ihrer eigenen bürokratischen Organisationsform, sondern den abweichenden<br />
Rationalitätskriterien von Kleingruppen folgt. Und andererseits<br />
brauchen diese, weil klein, nur winzige Nischen, um sich dem Zugriff<br />
der Verfolgung zu entziehen. Daraus ergibt sich für die Reaktion die Tendenz,<br />
nicht nur mit sogen. Zielfahndung, sondern auch mit jenem Typus<br />
der Rasterfahndung zu antworten, der an Rollkommandos <strong>und</strong> Flächenbo<strong>mb</strong>ardements<br />
erinnert. Zu viele Unbeteiligte geraten damit in Verdacht<br />
<strong>und</strong> unter Druck. Dergleichen geht an die liberale Substanz einer Gesellschaft.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Zweitens: In die gleiche Richtung zielt die allgemeine Präponderanz<br />
des Sy<strong>mb</strong>olischen am Phänomen des Terrorismus. Da sein Skandal sich<br />
weniger aus Kriminalität als solcher denn aus den Gesinnungen ergibt, die<br />
an diese Kriminalität gekoppelt sind, liegt die Versuchung nahe, nun auch<br />
Gesinnungen zur Spurensuche zu verwenden, mehr noch: sie selber schon<br />
für kriminell zu halten. Die Differenz zwischen Recht <strong>und</strong> Moral, die für<br />
liberale Gesellschaften konstitutiv ist, wird zusammengedrückt. Da reicht<br />
am Ende schon die „klammheimliche Freude" eines nicht einmal eindeutigen<br />
Sympathisanten, um Großalarm auszulösen. Und wer den Rassenwahn<br />
der Nazis für eine gute Sache hält, riskiert nicht nur den Widerspruch <strong>und</strong><br />
Verachtung, sondern Gefängnis.<br />
Die Wahrscheinlichkeit ist also gegeben, daß sich politische Systeme<br />
unter dem Druck von Terroristen mehr oder weniger dem Bilde anzunähern<br />
beginnen, das diese zur Begründung ihres Angriffs schon entworfen hatten.<br />
Sie unterstützen insofern deren Begründung <strong>und</strong> tragen in diesem Sinne<br />
zur Produktion des Reizes bei, auf den sie nur zu reagieren meinen. Die<br />
Frage ist allerdings, ob Terroristen von diesem Zirkel letztlich profitieren.<br />
3. Koalitionschancen<br />
Die Profite in diesem Kampf werden am Ende von den Zuschauern entschieden.<br />
Beide Akteure, Terroristen <strong>und</strong> staatliche Instanzen, agieren auf<br />
einer Bühne, <strong>und</strong> der Beifall des Publikums bestimmt den Sieger. Er kann<br />
sogar dem Verlierer des Kampfes zufallen <strong>und</strong> insofern den sichtbaren<br />
Spielausgang ins Gegenteil drehen. Ein gelingender Anschlag kann ein<br />
Fiasko sein, wenn er als Unrecht gedeutet wird, <strong>und</strong> die physische Vernichtung<br />
von Terroristen kann umgekehrt ihren Triumph über den Gegner bedeuten,<br />
wenn ihr Tod als Indiz für die Grausamkeit dieses Systems erscheint.<br />
Es geht bei allen Aktionen wesentlich um die Gunst des Publikums.<br />
Und insofern der Einfluß dieses „Dritten" im Kalkül beider Akteure gesehen<br />
<strong>und</strong> berücksichtigt wird, ist ihr Kampf auch nicht völlig regellos. Man<br />
kann das am besten an dem erkennen, was sie nicht tun, obwohl es technisch<br />
möglich <strong>und</strong> taktisch nützlich wäre, es zu tun. Der angestrebte Publicity-Effekt<br />
schränkt die Angriffsziele <strong>und</strong> Handlungsmittel auf beiden Seiten<br />
ein (F. Neidhardt 1982, S. 467 f.).<br />
Wer unter diesen Bedingungen am Ende die Oberhand behält, läßt sich<br />
in allgemeiner Betrachtung natürlich nicht pauschal bestimmen. Sicher<br />
hängt der Verlauf der Kämpfe neben allen Zufällen auch von sozio-ökonomischen<br />
<strong>und</strong> politischen Lagebedingungen ab, die den Legitimitätsbestand<br />
der gegebenen Herrschaft mitbestimmen. Inmitten innerlich schon zerrütteter<br />
Systeme <strong>und</strong> angesichts eines schon vorhandenen Umsturzpotentials<br />
kann der kleine Reiz terroristischer Aktionen Auslöser kräftiger Veränderungen<br />
in Richtung des Reizes sein. Dieser Effekt läßt sich aber in der<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
großen Zahl empirischer Fälle, soweit ich sehen kann, nur äußerst selten<br />
beobachten. Häufiger sind terroristische Aktionen für die politische Bewegung,<br />
der sie voranhelfen sollten, kontraproduktiv gewesen. Um das zu begreifen,<br />
ist davon auszugehen, daß der Ausgang der Kämpfe nicht nur,<br />
wahrscheinlich nicht einmal in erster Linie, von den Legitimitätsproblemen<br />
des vorhandenen politischen Systems bestimmt ist, sondern auch, vielleicht<br />
mehr noch, von den davon unabhängigen Legitimitätsproblemen des Terrorismus<br />
selber.<br />
Das Ausmaß der Rechtfertigungsschuld, die den Terrorismus zuerst<br />
einmal in eine moralische Defensive bringt, ist in elementarster Weise kulturell<br />
bestimmt, nämlich abhängig davon, in welchem Maße sich Gewalttabus<br />
allgemein durchgesetzt haben. Sind diese mit der Zivilisationsgeschichte<br />
von Gesellschaften in der Bevölkerung verinnerlicht worden, dann löst<br />
ihre Verletzung peinliche Begründungszwänge aus. Um diese zu lösen, reicht<br />
es wahrscheinlich nicht aus, daß es der terroristischen Theorie gelingt, die<br />
Kritik an dem bestehenden System zu dramatisieren, wenn sie nicht gleichzeitig<br />
überzeugende Bilder eines machbaren besseren Lebens entwerfen<br />
kann. Es geht hierbei um Utopie. Besitzt sie die Qualität, Nachfolge zu mobilisieren?<br />
Dies dürfte nicht nur von ihrer sozialen Validität abhängen, d.h.<br />
davon, in welchem Maße sie die in einer Gesellschaft tatsächlich vorhandenen<br />
Überschüsse an Wünschen <strong>und</strong> Träumen authentisch aufgenommen <strong>und</strong><br />
verarbeitet hat; sondern auch von dem, was man Utopiequantum nennen<br />
könnte, dem Ausmaß nämlich, in dem das als ideal Vorgestellte den Status<br />
quo übersteigt. Der soziale Effekt dieser Größe läßt sich mit dem aus der<br />
Motivationspsychologie bekannten Gesetz der „dosierten Diskrepanz"<br />
(H. Heckhausen) kalkulieren. Ein zu geringes Utopiequantum rechtfertigt<br />
nicht den Aufwand des Kampfes, ein zu großes schreckt ab, weil es ins<br />
Unvorstellbare verschwimmt <strong>und</strong> als nicht einlösbar erscheint. Terroristische<br />
Gruppierungen unterscheiden sich in dieser Hinsicht folgenreich. Wahrscheinlich<br />
operiert der Terrorismus separatistischer Bewegungen — siehe die<br />
baskische ETA oder die nordirische IRA (Waldmann 1984) — deshalb relativ<br />
erfolgreich, weil ihr Ideal, nämlich Autonomie, gleichzeitig stimulierend<br />
<strong>und</strong> faßbar ist. Sozialrevolutionäre Umsturzbewegungen sind in dieser Hinsicht<br />
in der Regel ehrgeiziger <strong>und</strong> überfordernder. Alles soll anders werden.<br />
Auch die Terroristen dieser Idee können Bew<strong>und</strong>erung auslösen. Ihr bewaffneter<br />
Kampf fasziniert wegen seiner heroischen Konsequenz. Aber<br />
Heroismus ist kein generalisierbares Handlungsmuster. Diese Terroristen<br />
geraten deshalb häufig in die absurde Lage einer Avantgarde von nichts.<br />
Wahrscheinlicher als Nachfolge ist unter den genannten Bedingungen<br />
eine Gegenbewegung für „law and order". Wenn sich terroristische Gewalt<br />
nicht als gleichzeitig notwendige <strong>und</strong> produktive Gegengewalt rechtfertigen<br />
kann, befördert sie eher eine Ritualisierung des Status quo. Man weiß, was<br />
man hat. Und wer wenigstens dies garantiert, erhält im Notfall Rückendekkung.<br />
Zu diesem Reaktionsmuster ist einschlägig, was Heinrich Popitz über<br />
den „Ordnungswert der Ordnung als Basislegitimität" geschrieben hat<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
(Popitz 1968, S. 33 f.). Auf den Status quo, sofern er nur eine Struktur besitzt,<br />
kann man sich einstellen <strong>und</strong> einrichten. Dies ist die Voraussetzung<br />
für alles weitere. Wer sie angreift, verstärkt ihre Bedeutung.<br />
Es ist genau dieser Mechanismus, der sich in unserem Lande während<br />
der siebziger Jahre als Reaktion auf Terrorismus abgespielt hat. Wie Manfred<br />
Murck mit empirischen Daten hat belegen können (Murck 1980,<br />
S. 148 ff.), kam es in der Bevölkerung zum Terrorismusthema zwar zu gewissen<br />
Polarisierungen, aber deutlich stärker werdende Mehrheiten sahen<br />
einerseits unseren Staat durch Terroristen „in eine schwere Krise gestürzt"<br />
<strong>und</strong> forderten andererseits, der Staat müsse gegen Terroristen „hart <strong>und</strong> mit<br />
allen erdenklichen Mitteln zurückschlagen". Ich stimme der Ansicht von<br />
Murck zu, daß sich im Vergleich zu diesen <strong>gesellschaftliche</strong>n Reaktionen,<br />
die sich in den Bewegungen der öffentlichen Meinung niederschlugen, die<br />
staatlichen Reaktionen als eher zögerlich <strong>und</strong> behutsam ausnahmen. Sie<br />
wurden von den Massen keineswegs als Überreaktionen gedeutet. Die Provokation<br />
des Terrorismus erzeugte zu Lasten liberaler Kultur einen <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
backlash ins Reaktionäre, der vom politischen System zum<br />
Teil, aber eben nur begrenzt aufgefangen <strong>und</strong> ausbalanciert wurde. Natürlich<br />
kann auch eine Regression auf „law and order" im Zielkatalog von<br />
Terroristen stehen. Man wird diese eher auf der rechten als auf der linken<br />
Seite des politischen Spektrums finden können <strong>und</strong> darf in diesem Zusammenhang<br />
durchaus die Folgerung ziehen, daß der Rechtsterrorismus mehr<br />
als der Linksterrorismus die Chance besitzt, anhaltende Gewinne zu erzielen.<br />
Er ist — bei sonst gleichen Ausgangsbedingungen — tendenziell erfolgreicher,<br />
weil die politische Reaktion auf ihn selber mit höherer Wahrscheinlichkeit<br />
in die Richtung seiner eigenen Zwecke führt.<br />
4. Streit um Worte<br />
Wie weit eine reaktionäre Tendenz sich durchsetzt <strong>und</strong> in welchem Maße<br />
widerstandslos die damit verb<strong>und</strong>enen Prozesse ablaufen, ist von zusätzlichen<br />
Faktoren abhängig <strong>und</strong> von Fall zu Fall gesondert zu beurteilen.<br />
Wichtig sind in dieser Hinsicht nicht nur die durchschnittlichen Meinungstendenzen,<br />
sondern vor allem die vorhandenen Meinungsverteilungen. Auch<br />
in der B<strong>und</strong>esrepublik ließ sich als Reaktion auf Terrorismus nicht nur die<br />
zunehmend repressive Stimmung wachsender Mehrheiten erkennen, sondern<br />
bei sich deutlich profilierenden Minderheiten auch die scharfe Opposition<br />
dazu, insgesamt also eine Polarisierung der öffentlichen Meinung.<br />
Entsteht diese Konstellation, dann wird die unmittelbare Auseinandersetzung<br />
mit dem Terrorismus von einem Meta-Konflikt überlagert <strong>und</strong> durchsetzt,<br />
der im wesentlichen eine Auseinandersetzung über die staatlichen<br />
Reaktionen auf den Terrorismus darstellt. Ein solcher Meta-Konflikt besitzt<br />
die Tendenz, sich zu verselbständigen <strong>und</strong> mit hoher Eigendynamik weit<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
über seine eigentlichen Anlässe hinauszuführen. Er äußert sich vor allem als<br />
ein Streit um Worte. Sprache wird zum Mittel des Kampfes. Dies ist für den<br />
Soziologen lehrreich, weil es ihn auf etwas stößt, das zu begreifen immer<br />
wieder lohnt: daß Wirklichkeit eine verfügte <strong>und</strong> verhandelte Fiktion ist,<br />
ein soziales Definitionsprodukt, das sich über die Gegenstände legt, sich von<br />
ihnen entfernt, ein Eigenleben beginnt, sich abschließt. Die große Wirkung<br />
des kleinen Reizes, den Terrorismus darstellt, macht diesen allgemeinen<br />
Sachverhalt am besonderen Fall hervorragend deutlich. Die Frage ist, warum<br />
dies am Beispiel des Terrorismus so deutlich wird <strong>und</strong> was es für diesen<br />
Fall am Ende auch für die Soziologie bedeutet.<br />
Terrorismus ist selber von Anfang an sy<strong>mb</strong>olisches Handeln. Seine Botschaft<br />
ist ein Angriff auf die sozialen Bestandsgarantien von Herrschaft,<br />
nämlich auf deren Legitimation oder — um es mit Max Weber zu sagen —<br />
auf ihr „Prestige der Vorbildlichkeit oder Verbindlichkeit" (Weber 1956,<br />
S. 23). Der Adressat dieser Botschaft ist das Bewußtsein der Massen. Es<br />
soll aufgerührt <strong>und</strong> verändert werden. Darum ist es nicht zufällig, daß die<br />
„Propaganda der Tat" von Terroristen so häufig mit Erläuterungen <strong>und</strong><br />
Rechtfertigungen, also mit Sprache, komplettiert wird. Der Terrorismus ist<br />
eine untypisch redselige Art von Kriminalität; er liefert die Metakommunikation<br />
über sein Handeln regelmäßig mit. In gewisser Weise ist auch dies ein<br />
Indiz seiner Schwäche. Der Rekurs auf Sprache ist im politischen Bereich<br />
ein Anzeichen dafür, daß es Defizite an Geld, Macht <strong>und</strong> Prestige gibt. Dies<br />
trifft nun auch auf politische Systeme zu, die von Terroristen angegriffen<br />
werden, insofern ihre Herrschaft der Zustimmung der Unterworfenen bedarf.<br />
Je mehr sie sich dieser Zustimmung ungewiß sind, umso mehr werden<br />
auch sie dazu neigen, Überzeugungsarbeit mit Hilfe von Sprachpolitik zu<br />
betreiben. Beiden Seiten geht es darum, das eigene Recht gegen das Unrecht<br />
des Gegners zu erklären.<br />
Bei dieser Konkurrenz geht es vordergründig <strong>und</strong> unmittelbar um Fragen<br />
der Benennung. Lassen sich bestimmte Sachverhalte in bestimmten<br />
Wörtern unterbringen, mit ihnen etikettieren? Darf z.B. die Praxis unserer<br />
Gefängnisse „Isolationsfolter" genannt werden? Ist Heinrich Böll ein „Sympathisant"?<br />
Die Entscheidung solcher Fragen ist folgenreich; sie bereitet<br />
Handlungen vor. Unabhängig davon wird an den Beispielen aber auch schon<br />
der Effekt erkennbar, der über die konkreten Situationen hinausführt, indem<br />
er sich kulturell verankert: Es geht nicht nur um die Anwendung von<br />
Wörtern, sondern auch <strong>und</strong> nachhaltiger um ihre Definition. Die Sprache<br />
selber wird verhandelt. Und je mehr sich der Konflikt um Terrorismus<br />
ausdehnt <strong>und</strong> vervielfältigt, umso mehr Sprache gerät in den Wirbel. Begriffe<br />
werden ausgedehnt oder eingeschränkt, erhalten positive oder negative<br />
Ladungen. Kapitalismus, Imperialismus, Faschismus, deutsch, Gewalt,<br />
Regelverletzung, Verfassungsfeind, Extremismus, links, rechts — all dies ist<br />
nachher nicht mehr das, was es vorher war. Und die <strong>gesellschaftliche</strong> Praxis<br />
sog. Ursachenforschung sorgt für eine Potenzierung der semantischen<br />
Umdispositonen. Das fängt z.B. bei Marxismus <strong>und</strong> „Frankfurter Schule"<br />
an <strong>und</strong> hört bei Wohngemeinschaften <strong>und</strong> Familie noch nicht auf.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Eine Soziologie, die solche Prozesse beobachtet, besitzt ein angestammtes<br />
Aufgabenfeld darin, die Strukturen dieser Prozesse festzustellen <strong>und</strong> sie<br />
zur Erklärung der Prozeßausgänge zu benutzen. Sie wird dabei auf hierarchische<br />
Ungleichgewichte in dem Streit um Worte stoßen <strong>und</strong> z.B. bei der<br />
Prüfung der Funktionen von Gerichten, Parlamenten <strong>und</strong> Massenmedien<br />
folgenreiche Probleme hinsichtlich der <strong>gesellschaftliche</strong>n Kontrolle dieses<br />
Streits erkennen können. Fritz Sack hat dies in seiner ASÖTE-Studie zur<br />
„Pathologie politischer Konflikte" mit Recht angesprochen (Sack 1984,<br />
bes. S. 45 ff.). Vor zweierlei sei allerdings gewarnt.<br />
Zum ersten: die Soziologie darf die Organisierbarkeit kultureller Prozesse<br />
nicht überschätzen. Sicher begegnen ihr in diesem Felde Manipulationen,<br />
Verdrängungsmechanismen der Zensur, auch glatte Fälschungen, mit<br />
denen von oben nach unten Einfluß ausgeübt wird. Aber es darf nicht übersehen<br />
werden, daß Manipulationen von den Menschen, auf die sie einwirken,<br />
auch angenommen werden müssen. Und ob sie angenommen werden,<br />
entscheidet sich nicht schon mit dem Geschick der Manipulateure <strong>und</strong> der<br />
Macht, die sie besitzen. Sie selber bedürfen einerseits eines Minimums an<br />
Vertrauen, das sie sich haben erwerben müssen, andererseits muß ihre Botschaft<br />
dem „gemeinen Menschenverstand" plausibel sein, in seine Erfahrungen<br />
passen, seinen Wirklichkeitskonstruktionen konsonant sein, Öffentlich<br />
wirksamer Betrug ist natürlich für eine engagierte Sozialforschung<br />
eine beachtliche, weil mit Recht skandalisierbare Entdeckung. Aber die<br />
konkrete Empörung sichert noch keinen allgemeinen Erkenntnisgewinn.<br />
Die theoretische Bedeutung aufgedeckter Manipulationen bleibt marginal,<br />
wenn sie nicht im Rahmen der äußerst diffusen Prozesse analysiert werden,<br />
die über ihre kollektive Wirkung entscheiden. Dies bleibt unvollständig,<br />
wenn die kritische Größe unbefragt bleibt, die wir Bevölkerung oder Masse<br />
oder Öffentlichkeit nennen. Wir Soziologen haben uns angewöhnt, sie den<br />
Meinungsbefragungsinstituten zu überlassen.<br />
Zum zweiten: Wir Soziologen sollten sehr vorsichtig sein bei der Behauptung<br />
dessen, was in Konfliktlagen wirklich <strong>und</strong> wahr sei. Wirklichkeit<br />
begegnet auch uns überwiegend als Sprache. Und wenn diese in <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Konfliktlagen auseinanderbricht, dann begegnen uns zu dem gleichen<br />
Sachverhalt mehrere Wirklichkeiten, hinter denen ungleiche Menschengruppen<br />
mit unterschiedlichen Erfahrungen, Interessen <strong>und</strong> Überzeugungen<br />
stehen. Was gibt uns die Kriterien, um die eine Wirklichkeit für angemessener<br />
als die andere zu halten? Woher nehmen wir die Maßstäbe, um z.B. von<br />
der Überreaktion einer Seite zu sprechen? Unsere Schwierigkeit beginnt<br />
schon mit der Sprache, die wir reden. Wessen Sprache reden wir, wenn die<br />
Wörter strittig <strong>und</strong> ihre Bedeutung parteilich ist? Kann man in der Analyse<br />
Wörter wie Imperialismus oder Sympathisant oder Gewalt noch anders als<br />
in Anführungszeichen benutzen? Vielleicht besteht die allgemeinste <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Funktion der Soziologie gegenüber den Parteien darin, Zitate zu<br />
übersetzen, soll heißen: die Sprachsysteme der einen Seite der anderen Seite<br />
verständlich zu machen. Das könnte dazu beitragen, daß eine Kommunikation<br />
zwischen den Gegnern möglich bleibt, die ohne Waffen auskommt.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
LITERATUR<br />
Fetscher, Iring, Herfried Münkler <strong>und</strong> Hannelore Ludwig 1981, „Ideologien der Terroristen<br />
in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland", in: I. Fetscher <strong>und</strong> G. Rohrmoser<br />
(Hrsg.), Ideologien <strong>und</strong> Strategien, Opladen, S. 16-273.<br />
Fromkin, David 1977, „Die Strategie des Terrorismus", in: M. Funke (Hrsg.), Terrorismus.<br />
Untersuchungen zur Struktur <strong>und</strong> Strategie revolutionärer Gewaltpolitik,<br />
Düsseldorf, S. 83-99.<br />
Hildermeier, Manfred 1982, „Zur terroristischen Strategie der Sozialrevolutionären<br />
Partei Rußlands (1900-1914)", in: W.J. Mommsen <strong>und</strong> G. Hirschfeld (Hrsg.),<br />
Sozialprotest, Gewalt, Terror, Stuttgart, S. 100-108.<br />
Laqueur, Walter 1977, Terrorismus, Kronberg.<br />
Murck, Manfred 1980, Soziologie der öffentlichen Meinung, Frankfurt/M.<br />
Neidhardt, Friedhelm 1981, „Über Zufall, Eigendynamik <strong>und</strong> Institutionalisierbarkeit<br />
absurder Prozesse. Notizen am Beispiel einer terroristischen Gruppe", in: H. v.<br />
Alemann <strong>und</strong> H.P. Thum (Hrsg.), Soziologie in weltbürgerlicher Absicht. Festschrift<br />
für René König zum 75. Geburtstag, Opladen, S. 243-257.<br />
Ders. 1982, „Soziale Bedingungen terroristischen Handelns. Das Beispiel der 'Baader-<br />
Meinhof-Gruppe' (RAF)", in: W. v.Baeyer-Katte, D. Ciaessens, H. Feger <strong>und</strong><br />
F. Neidhardt (Hrsg.), Gruppenprozesse, Opladen, S. 318-393.<br />
Popitz, Heinrich 1968, Prozesse der Machtbildung, Tübingen.<br />
Sack, Fritz, unter Mitarbeit von U. Berlit, H. Dreier <strong>und</strong> H. Treiber 1984, „Staat, Gesellschaft<br />
<strong>und</strong> politische Gewalt: Zur Pathologie politischer Konflikte", in: Ders. <strong>und</strong><br />
H. Steinert (Hrsg.), Protest <strong>und</strong> Reaktion, Opladen, S. 18-387.<br />
Steinert, Heinz 1984, „Strukturelle Bedingungen des 'linken Terrorismus' der 70er Jahre.<br />
Aufgr<strong>und</strong> eines Vergleichs der Entwicklungen in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland,<br />
in Italien, Frankreich <strong>und</strong> den Niederlanden", in: F. Sack <strong>und</strong> Ders. (Hrsg.),<br />
a.a.O., S. 388-601.<br />
Waldmann, Peter 1984, Gewaltsamer Separatismus. Am Beispiel der Basken, Franco-<br />
Kanadier, Katalanen <strong>und</strong> Nordiren. Mskr.<br />
Weber, Max 1964, Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft. Studienausg. 1. Halbbd., Köln <strong>und</strong><br />
Berlin.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ZUR SOZIOLOGIE DES TERRORISMUS<br />
Fritz Sack<br />
Einleitung<br />
Die heutige Veranstaltung wird im offiziellen Programm der Gesellschaft als<br />
Forum bezeichnet, auf dem — so wird gesagt — „teilweise sehr kontroverse"<br />
Ergebnisse dargestellt <strong>und</strong> erörtert werden sollen. Den Beitrag, den ich dazu<br />
leisten möchte, besteht darin, meine eigenen Erfahrungen, Entscheidungen<br />
<strong>und</strong> Lösungen zur Bewältigung der Aufgabe <strong>und</strong> des Auftrags, den „Ursachen<br />
des Terrorismus" nachzugehen, darzulegen. In Erinnerung der Diskussionen,<br />
die es bei der Erstellung meiner Studie gab, <strong>und</strong> angesichts der Tatsache,<br />
daß sich in einem Referat manche Dinge weniger umwegreich <strong>und</strong><br />
systematisch eingebettet sagen lassen als in einem Bericht mehrerer h<strong>und</strong>ert<br />
Seiten, werden sicher auch hier Kontroversen nicht ausbleiben. Sie würden<br />
allerdings gewiß heftiger ausfallen, wenn an der heutigen Veranstaltung das<br />
volle personelle Spektrum der Wissenschaftler repräsentiert wäre, das an der<br />
Erforschung der „Ursachen des Terrorismus" beteiligt war. „Ursachen des<br />
Terrorismus" — das war auch der offizielle Arbeitstitel des wissenschaftlichen<br />
Unternehmens, das im Verlaufe der gewalteskalierenden Konflikte<br />
zwischen der Studentenbewegung <strong>und</strong> der außerparlamentarischen Opposition<br />
Anfang bis Mitte der 70er Jahre in amtlichen Kreisen allmählich heranreifte.<br />
Zur organisatorischen <strong>und</strong> finanziellen Verwirklichung kam es aber<br />
erst, als im Jahre 1977 mit den drei spektakulärsten terroristischen Handlungen<br />
— der Ermordung des Generalb<strong>und</strong>esanwaltes Buback, der Ermordung<br />
des Bankiers Ponto <strong>und</strong> der blutigen Entführung <strong>und</strong> späteren Ermordung<br />
des damaligen Arbeitgeberführers Schleyer — das offizielle <strong>und</strong> alltägliche<br />
Leben in der B<strong>und</strong>esrepublik ganz in den Sog des Terrorismus zu geraten<br />
schien.<br />
Ich möchte drei Punkte behandeln, unter die sich die Probleme fassen<br />
lassen, von denen ich mir vorstellen könnte, daß sie Teil der heutigen Diskussion<br />
werden. Es sind dies:<br />
— Über die Suspendierung der natürlichen Anschauung der Dinge <strong>und</strong> des<br />
Untersuchungsauftrages<br />
— Theoretische Überlegungen <strong>und</strong> empirische Bef<strong>und</strong>e zum Zusammenhang<br />
von Politik, Recht <strong>und</strong> Gewalt<br />
— Probleme der empirischen Erschließung von Konfliktabläufen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
1. Die Suspendierung der natürlichen Anschauung der Dinge <strong>und</strong> des<br />
Untersuchungsauftrages<br />
Was hiermit gemeint ist, bedarf, so denke ich, einer längeren Erläuterung.<br />
Die Soziologie kennzeichnet über ihre verschiedenen theoretischen Positionen<br />
hinweg ein, wie P.L. Berger (1963, S. 38) es m.E. treffend bezeichnet<br />
hat, methodologisch f<strong>und</strong>iertes spezifisches Bewußtsein, das die Dinge nicht<br />
so nimmt, wie sie sind oder erscheinen. Hiermit ist offensichtlich mehr gemeint<br />
als eine im engeren Sinne ideologiekritische Attitüde. Eine der zentralen<br />
Pointen funktionalistischer Analysen besteht in der systematischen<br />
Suche nach den Ironien sozialer Strukturen <strong>und</strong> Institutionen, für die sie<br />
das Konzept der latenten Funktionen bereitgestellt hat. Marxistische Gesellschaftstheorie<br />
hat seit ihren Anfängen bis auf den heutigen Tag den Impetus<br />
durchgehalten, die Dinge von ihrem Kopf auf die Füße stellen zu wollen.<br />
Im Kontext interpretativer Theorieansätze schließlich wird die Suspendierung<br />
bzw. Einklammerung der Wirklichkeit bis zu ihrer vollständigen<br />
Verflüchtigung methodologisch radikalisiert. Wirklichkeit ist nicht unmittelbar<br />
<strong>und</strong> jungfräulich zur Hand, sondern sie wird uns nur über Sprache, Sy<strong>mb</strong>ole<br />
<strong>und</strong> Zeichen zugänglich <strong>und</strong> verfügbar. Diese aber sind den Dingen der<br />
Wirklichkeit nicht schlicht zu entnehmen. Sie werden vielmehr an sie<br />
herangetragen <strong>und</strong> gehen mit ihnen eine Verbindung ein, die mehr oder<br />
weniger eng ist <strong>und</strong> sich nach Graden der Löslichkeit unterscheidet. In diesem<br />
Sinne hat der Linguist F.D. Saussure die Sprache als Konvention bezeichnet.<br />
Was das auch für die Sprache meint, ist in unnachahmlicher Weise<br />
von L. Carroll in einem Dialog zwischen seinen Märchenfiguren Alice <strong>und</strong><br />
Goggelmoggel ausgedrückt: „Aber" — so beginnt dieser Dialog — „Glocke"<br />
heißt doch gar nicht ein „einmalig schlagender Beweis", wandte Alice ein.<br />
„Wenn ich ein Wort gebrauche", sagte Goggelmoggel in recht hochmütigem<br />
Ton, „dann heißt es genau, was ich für richtig halte — nicht mehr <strong>und</strong> nicht<br />
weniger". „Es fragt sich nur", sagte Alice, „ob man Wörter einfach etwas<br />
anderes heißen lassen kann". „Es fragt sich nur", sagte Goggelmoggel, „wer<br />
der Stärkere ist, weiter nichts!". Ganz offensichtlich ist es die Dimension<br />
der Macht, die hier ins Spiel kommt <strong>und</strong> in eine Nähe zur Sprache <strong>und</strong><br />
ihren einzelnen Elementen gebracht wird. Und diese Nähe, wird man einmal<br />
auf sie gestoßen, macht bekanntlich sprachlos, was nichts anderes heißt, als<br />
die Logik der Sprache durch die sozialer Beziehungen <strong>und</strong> Verhältnisse auszutauschen.<br />
Bei Carroll heißt es dann auch weiter: „Alice war viel zu verwirrt,<br />
um darauf noch eine Antwort zu finden, <strong>und</strong> so sprach Goggelmoggel<br />
nach kurzem Stillschweigen weiter".<br />
Die Analyse des Terrorismus war von vornherein eingebettet in einen<br />
Kampf um die angemessenen Kategorien, Begriffe <strong>und</strong> Interpretationen. Sie<br />
werden sich vielleicht noch daran erinnern, daß es eine bis ins Parlament<br />
hineingetragene <strong>und</strong> mit großen emotionellen <strong>und</strong> politischen Investitionen<br />
gespickte Diskussion darüber gab, ob man die terroristischen Täter als<br />
Bande, Vereinigung oder schlicht als Gruppe zu bezeichnen habe. Wohl-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
gemerkt, diese Diskussion spielte sich nicht zwischen den Terroristen auf<br />
der einen <strong>und</strong> der Öffentlichkeit auf der anderen Seite ab, sondern sie entzweite<br />
<strong>und</strong> teilte die Öffentlichkeit <strong>und</strong> deren Repräsentanten <strong>und</strong> Träger.<br />
Es lassen sich eine Reihe anderer Beispiele anführen, die ähnlich dem<br />
Streit um das richtige Wort für den kollektiven Charakter des Terrorismus<br />
signalisierten, daß es bei dem Terrorismus nicht nur um<br />
Rechtsgutsverletzu<br />
keinen Zweifel, daß die Taten selbst, die Morde, Entführungen, Bo<strong>mb</strong>enanschläge<br />
keine strafrechtlichen Subsumptionsprobleme darstellten. Daß<br />
trotz dieser Eindeutigkeit geradezu beschwörend auf ihr insistiert wurde;<br />
daß dies nicht von den dazu allein befugten staatlichen Amtsträgern, den<br />
Gerichten, Staatsanwaltschaften <strong>und</strong> Polizeibehörden, sondern von Politikern,<br />
Publizisten, Trägern <strong>und</strong> Sprechern der verschiedenen <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Institutionen <strong>und</strong> Bereiche getan wurde; daß weiter die Verfolgung<br />
dieser Straftaten nicht nur in dem beschriebenen Sinne institutionell entgrenzt<br />
wurde, sondern auch unter Verletzung einer Reihe staatlicher, überstaatlicher<br />
<strong>und</strong> strafrechtlicher Regeln <strong>und</strong> Prinzipien der Strafverfolgung<br />
geschah: alle diese Umstände kann die soziologische Analyse des Terrorismus<br />
m.E. nicht aus sich entlassen <strong>und</strong> in den Kontext des zu analysierenden<br />
Geschehens verweisen.<br />
Die zitierten Ereignisse der Entgrenzung institutioneller Art, wie ich<br />
sie gerade angedeutet habe, belegen, daß Politiker, Journalisten <strong>und</strong> nichtwissenschaftliche<br />
Repräsentanten handelnd soziologische Einsichten vollzogen,<br />
denen gegenüber die Vertreter der Disziplin ein Nachsehen hatten<br />
<strong>und</strong> nicht so recht auf die Spur kommen konnten. Auf einem anderen Blatt<br />
steht natürlich, daß die Handlungen von Politik <strong>und</strong> Öffentlichkeit dem<br />
Terrorismus gegenüber von einer Rhetorik begleitet waren, die keine Kandidaten<br />
für die Aufnahme in soziologische Bücher oder Zeitschriften hervorbrachte,<br />
jedenfalls nicht in alle <strong>und</strong> jede.<br />
Ich wüßte indessen nicht, daß diese Diskrepanz nachhaltig der Anstrengung<br />
soziologischer Registrierung oder gar soziologischer Analyse für wert<br />
bef<strong>und</strong>en worden wäre.<br />
Ich erinnere mich statt dessen noch gut an eine Diskussion im R<strong>und</strong>funk<br />
oder Fernsehen aus jener Zeit des „deutschen Herbstes" — so der Titel<br />
eines Buches, das die Ereignisse im Jahre 1977 sprachlich treffend zusammengezogen<br />
hat. In dieser Diskussion versagte sich ein deutscher Soziologe,<br />
nach einer analytischen <strong>und</strong> soziologischen Bemerkung zum Terrorismus gefragt,<br />
die Antwort mit dem Hinweis darauf, daß dies nicht die St<strong>und</strong>e der<br />
Analyse, sondern die der strafrechtlichen Verfolgung, der Polizei sei.<br />
Zu jener Zeit war allerdings in Kreisen von Staat <strong>und</strong> Politik längst das<br />
Eingeständnis herangereift, daß Strafrecht <strong>und</strong> Polizei nicht die angemessene<br />
<strong>und</strong> volle Anwort auf den Terrorismus böten. Der damalige Justizminister<br />
hat die folgende Feststellung des Politologen Lübbe: „Im Kampf<br />
gegen den Terror können Polizei <strong>und</strong> Gerichte nur Nacharbeit leisten, an<br />
die Ursachen des Terrorismus kommt man mit Verfahren <strong>und</strong> Verurteilun-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
gen nicht heran", zu der Schlußfolgerung weitergeführt: „Deshalb sind gerade<br />
die geistig-politische Auseinandersetzung <strong>und</strong> die kriminologische Ursachenforschung<br />
von herausragender Bedeutung" (1979, S. 41). Die hier<br />
vorzustellenden <strong>und</strong> heute zu diskutierenden Studien sind u.a. das Produkt<br />
dieser Einsicht.<br />
Freilich wird man genau hinhören müssen: geistig-politische Auseinandersetzung<br />
<strong>und</strong> kriminologische Ursachenforschung: Handlungsaufforderung<br />
das eine, handlungshemmender Ruf nach Wissenschaft das andere. Nur<br />
im nachhinein mag man in dieser Formulierung eine Bedachtsamkeit obwalten<br />
sehen, die sich auf den ersten Blick nicht erschließt. Die geistig-politische<br />
Auseinandersetzung mit dem Terrorismus war mehr oder weniger identisch<br />
mit der Wortschöpfung des Sympathisanten <strong>und</strong> den nicht nur sy<strong>mb</strong>olischen<br />
Kampagnen gegen diese Spezies unserer Gesellschaft. Ich erinnere an<br />
die Spalten der Presse, die Minuten der Tagesschau, die Akten der Staatsanwaltschaft<br />
füllenden Ereignisse um das sog. Mescalero-Flugblatt, an<br />
Sendungs- <strong>und</strong> Auftrittsverbote in den Medien, an die Attacken auf Konfliktpädagogik,<br />
hess. Rahmenrichtlinien, an Kritik an Schulbüchern, öffentlichen<br />
Bibliothekssortimenten. Die Liste ist verlängerbar <strong>und</strong> ließe sich zu<br />
einem empirischen Reservoir für eine Soziologie der sozialen <strong>und</strong> politischen<br />
Skandalisierung anhäufen. Beobachter wie Betroffene dieser Vorgänge<br />
mögen unter ihnen sein, <strong>und</strong> ich kann mir deshalb Einzelheiten, Belege<br />
<strong>und</strong> weitere Beschreibungen aus zweiter Hand ersparen.<br />
Diese geistig-politische Auseinandersetzung mit dem Terrorismus wies<br />
<strong>und</strong> griff, wie das Zitat verspricht, über das Strafrecht hinaus, freilich in<br />
einem ganz anderen Sinne als man es auch vermuten könnte. Sie verlängerte<br />
<strong>und</strong> generalisierte das Strafrecht in die Gesellschaft. Sie war beherrscht <strong>und</strong><br />
bestimmt von der Rhetorik <strong>und</strong> dem Ziel der Ausgrenzung von Ideen, Personen<br />
<strong>und</strong> Gruppen. Es war deshalb nur folgerichtig <strong>und</strong> entsprach dem öffentlich<br />
wirksam gewordenen Programm staatlicher Reaktion auf den Terrorismus,<br />
wenn der gezielte — <strong>und</strong> keineswegs wohl zufällige — Zugriff auf<br />
gerade die kriminologische Ursachenforschung fiel. Damit auf jene Teildisziplin<br />
innerhalb der Sozial- <strong>und</strong> Verhaltenswissenschaften, die in ihrer bisherigen<br />
Geschichte zweifellos den größten alltagspraktischen, kriminalpolitischen<br />
<strong>und</strong> forensischen Verwertungszumutungen ausgesetzt war <strong>und</strong> weitgehend<br />
auch willfahren hat. Das ist knapp <strong>und</strong> in den Ohren mancher<br />
sicherlich zu polemisch formuliert. Was in einer unverfänglicheren, wissenschaftlich<br />
lizensierteren Sprache damit gemeint ist, hat Luhmann in seinen<br />
oft unnachahmlich a<strong>mb</strong>ivalenten Theorieüberlegungen — hier in seiner<br />
Rechts<strong>soziologie</strong> — wie folgt zum Ausdruck gebracht. Die Abwicklungen<br />
von Erwartungsenttäuschungen, wie Luhmann abweichendes Verhalten<br />
theoretisch faßt, geschähe in modernen Gesellschaften nach dem Prinzip<br />
der lernunwilligen — <strong>und</strong> -unfähigen, „kontrafaktischen Stabilisierung"<br />
von Erwartungen. „Schon die Tatsache", so Luhmann (1972, S. 55), „daß<br />
ein enttäuschendes Verhalten überhaupt als Abweichung erlebt wird, bestätigt<br />
die Norm ... Damit ist die Norm schon gerettet <strong>und</strong> der Nor<strong>mb</strong>recher<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
fast schon verloren". „Die Erklärung (...) muß daher das enttäuschende Ereignis<br />
von der Norm distanzieren" (S. 56) — den Terrorismus, so lautet die<br />
Übersetzung für unsere Zwecke, von der Gesellschaft. Auf diese Weise entziffert<br />
Luhmann die gesamte „kriminologische Ursachenforschung" in dem<br />
hier gemeinten Sinn als „moderne Varianten pseudowissenschaftlicher Begriffe<br />
<strong>und</strong> Gesetzmäßigkeiten" (S. 56), deren Vorverständnis geprägt sei<br />
durch die „unüberschreitbaren Grenzen", die „moderne Rechtsordnungen"<br />
der „wissenschaftlichen Erklärung abweichenden Verhaltens" setzten, statt<br />
dessen letztere durch „eine weitgehend fiktive Erklärung ersetzten: durch<br />
die Annahme individueller Schuld" (S. 58).<br />
Eine solche „vorsoziologische Konzeption abweichenden Verhaltens<br />
bleibe geb<strong>und</strong>en an eine vorgegebene Präferenzstruktur" (a.a.O., S. 121)<br />
des Guten <strong>und</strong> des Bösen, wohingegen eine soziologische Analyse gerade<br />
diese Präferenzstruktur zum Problem zu machen hätte. Dabei bestreite<br />
diese vorsoziologische Konzeption des abweichenden Verhaltens dem Bösen<br />
in „einseitiger Parteilichkeit die eigene Normativität <strong>und</strong> (verquickte) den<br />
Gegensatz von Gut <strong>und</strong> Böse mit dem von Norm <strong>und</strong> Faktum" (a.a.O.). Die<br />
Soziologie des abweichenden Verhaltens habe sich, obwohl sie „außerhalb<br />
der Rechts<strong>soziologie</strong> ... konsolidiert" sei, gerade in diese Richtung zu entwickeln,<br />
da sich ihr „theoretischer Ansatz" „im Gr<strong>und</strong>e von der Rechts<strong>soziologie</strong><br />
nicht trennen lasse" (a.a.O.). Diese letzte Bemerkung verweist<br />
Luhmann (1972) zwar in den Status einer Fußnote, er hätte dies jedoch<br />
sicherlich nach der inzwischen erfolgten theoretischen Diskussion innerhalb<br />
der Rechts<strong>soziologie</strong> <strong>und</strong> der Soziologie des abweichenden Verhaltens<br />
heute nicht mehr nötig.<br />
Es kann keine Frage sein, daß die wissenschaftliche Analyse des Terrorismus,<br />
die staatlicherseits unter Federführung eines ministeriellen Arbeitsstabes<br />
mit dem Titel „Öffentlichkeitsarbeit zum Terrorismus" auf den Weg<br />
gebracht wurde, eine Forschung nicht im Sinn hatte, die eine solche soziologische<br />
Perspektive zum Ausgangspunkt nehmen würde. Statt dessen war<br />
eine Analyse anvisiert, die gerade nicht darin bestand — ich zitiere nochmals<br />
Luhmann —, „abweichendes Verhalten ... als normales Korrelat von Systemstrukturen<br />
(zu sehen), nicht mehr als bedauerliche, auf die Natur des<br />
Menschen zurückführbare Ungehorsamsquote, sondern als eine Folge von<br />
Strukturentscheidungen des sozialen Systems" (a.a.O., S. 122).<br />
Ich habe genau dies versucht, muß aber natürlich Luhmann aus der Haftung<br />
für diese Einlösung herausnehmen. Allerdings möchte ich, bevor ich<br />
detaillierter in den Versuch einer so verstandenen Analyse eintrete, Risiken<br />
<strong>und</strong> Voraussetzungen dafür nochmals im Luhmanns Worten bezeichnen:<br />
„Sie (die soziologische Analyse — F.S.) ist nur denkbar, wenn der Forscher<br />
aus der Perspektive des moralischen Urteils heraustritt <strong>und</strong> die Beschäftigung<br />
mit abweichendem Verhalten <strong>und</strong> sein Urteil darüber nicht ihm selbst<br />
zum Vorwurf gereichen ... Die Auswahl der Erklärung darf, mit anderen<br />
Worten, weder subjektiv noch objektiv durch die Moralität des zu erklärenden<br />
Ereignisses behindert werden". (Ebd.).<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Ganz offensichtlich geht es hier nicht alleine mehr um das Verhalten<br />
des Wissenschaftlers, der eine solche Analyse probiert, sondern um den<br />
Kontext, in den ein solcher Versuch gestellt ist. Das relativ späte Erscheinen<br />
des Bandes, in dem meine Studie, zusammen mit anderen, unter dem<br />
Gesamttitel „Protest <strong>und</strong> Reaktion" veröffentlicht ist, hatte nicht nur mit<br />
seiner späten Fertigstellung, sondern auch damit zu tun, daß sie u.a. dem<br />
Vorwurf mangelnder Vertragserfüllung ausgesetzt war <strong>und</strong> daß ihre Publizierbarkeit<br />
in der staatlich subventionierten Reihe in Zweifel stand.<br />
2. Theoretische Überlegungen <strong>und</strong> empirische Bef<strong>und</strong>e zum Zusammenhang<br />
von Politik, Recht <strong>und</strong> Gewalt<br />
Den Zusammenhang von Politik, Recht <strong>und</strong> Gewalt, um den es mir in meinem<br />
zweiten Punkt geht, möchte ich unter drei Gesichtspunkten erörtern:<br />
— erstens möchte ich unter Rückgriff auf R.K. Merton (1957, S. <strong>35</strong>7 ff.)<br />
die soziale Dynamik politischer Kriminalität beleuchten;<br />
— zweitens will ich daraus Überlegungen zur Verknüpfung von Studentenbewegung<br />
<strong>und</strong> Terrorismus herleiten;<br />
— drittens geht es mir um die Analyse von Eskalationsprozessen <strong>und</strong> die<br />
Rolle staatlichen Handelns in ihnen.<br />
a) Zur Dynamik politischer Kriminalität<br />
Ich komme zunächst zu dem Problem der genaueren theoretischen Interpretation<br />
des politischen Elements des Terrorismus. In Anknüpfung an die<br />
Arbeit von S. Ranulf (1938) unterscheidet Merton zwei Typen abweichenden<br />
Verhaltens, deren Differenz er nicht gemäß ihren manifesten, strafrechtlich<br />
definierten Handlungen bestimmt, sondern die er bezugsgruppentheoretisch<br />
faßt. Manifest <strong>und</strong> empirisch faßbar wird nach Merton die Differenz<br />
zwischen beiden Formen abweichenden Verhaltens — Merton nennt<br />
sie die „Nonkonformität" in einem, „Abweichung" in einem anderen Falle<br />
— in der Art der sozialen Reaktion auf sie. Diese die beiden Typen abweichenden<br />
Verhaltens differenzierende soziale Reaktion bestimmt Merton<br />
nun in der Weise, daß im Falle der Abweichung die Reaktion sich gründe<br />
auf einer „im wahrsten Sinne des Wortes aferinteressierten moralischen Entrüstung",<br />
wohingegen im Falle der Nichtkonformität die moralische Entrüstung<br />
eine interessierte sei.<br />
Es geht hierbei — <strong>und</strong> das ist erstens zu unterstreichen — um die Reaktion<br />
nicht der unmittelbar von einem kriminellen Geschehen be- <strong>und</strong> getroffenen<br />
Mitglieder einer Gesellschaft, sondern um die Reaktion der daran un-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
eteiligten Mitglieder der Gesellschaft. Merton sieht die Effektivität <strong>und</strong> die<br />
Wirksamkeit sozialer Kontrolle in diesem — wie er es nennt —, „Reservoir<br />
moralischer Entrüstung" begründet: Ohne es „wären die Mechanismen sozialer<br />
Kontrolle in ihrer Funktionsweise erheblich beschränkt", „denn" —<br />
so Merton weiter — „nicht nur die relativ geringe Anzahl der durch die Abweichung<br />
unmittelbar beeinflußten Personen, sondern auch die anderen<br />
Mitglieder einer Gesellschaft, die die kulturell akzeptierte Norm teilen, werden<br />
aktiviert, um den Abweichenden ... auf die Linie der Norm zurückzuholen."<br />
Eine zweite Anmerkung möchte ich zum Begriff der „desinteressierten<br />
moralischen Entrüstung" anfügen. Moral <strong>und</strong> Interesse sind zwei entgegengesetzte<br />
Organisationsprinzipien: Moral ist ein generalisierter, unbedingter<br />
<strong>und</strong> bedingungsloser Verhaltensanspruch, wohingegen Interesse für partikulare,<br />
geb<strong>und</strong>ene <strong>und</strong> abgeleitete Erwartungen steht. Insofern ist „desinteressierte<br />
moralische Entrüstung" im Gr<strong>und</strong>e ein Begriffspleonasmus <strong>und</strong> „interessierte<br />
moralische Entrüstung" ein semantischer Widerspruch. Denn eine<br />
interessierte moralische Entrüstung bedeutet ja, daß sie nicht mehr gleichsam<br />
automatisch <strong>und</strong> unvermittelt verfügbar ist <strong>und</strong> wirkt, sondern nur<br />
nach Maßgabe <strong>und</strong> in Abhängigkeit von spezifischen <strong>und</strong> partikularistischen<br />
Interessen. Damit ist aber der sozial-integrative Beitrag, die Einigungsfunktion<br />
von Moral für das Kollektiv gefährdet, Moral in den Sog von Interessen<br />
geraten <strong>und</strong> auf den Weg der Zersetzung gebracht.<br />
Die soziale <strong>und</strong> politische Brisanz einer solchen Interessenbefleckung<br />
der Moral mag an zwei Episoden demonstriert sein, von denen die eine am<br />
Anfang, die zweite am Ende der Periode des Terrorismus steht, die eine nur<br />
in historischen Quellen nachlesbar, die andere Kristallisationspunkt öffentlicher<br />
<strong>und</strong> offizieller Erregung <strong>und</strong> von mir oben bereits erwähnt. Das<br />
Mescalero-Flugblatt mit seiner Zwar-Aber-Haltung zur Ermordung des damaligen<br />
Generalb<strong>und</strong>esanwalts Buback — der „klammheimlichen Freude"<br />
einerseits <strong>und</strong> der umwegreichen Ablehnung der Gewalt gegen Personen aus<br />
politischen Motiven andererseits — signalisierte genau jenen Prozeß der moralischen<br />
Entkonditionierung <strong>und</strong> der Unterwerfung der Moral unter das<br />
politische Interesse. Den soziologisch gleichen Gehalt hatte ein Vorgang im<br />
Zusammenhang mit dem Mordanschlag auf Rudi Dutschke am 11.4.1968,<br />
der auch nicht nur ,,desinteressierte moralische Entrüstung" auslöste,<br />
sondern — dem Historiker der „Ära Brandt-Scheel", A. Baring (1982,<br />
S. 76/77), zufolge — z.B. den CSU-Vorsitzenden veranlaßte, dem damaligen<br />
B<strong>und</strong>eskanzler ,,Kiesinger schon wegen seines Telegramms an Gretchen<br />
Dutschke eine empörte Szene" zu machen.<br />
Diese Beispiele stehen m.E. für einen zentralen soziologischen Aspekt<br />
des Terrorismus überhaupt. Sie machen deutlich <strong>und</strong> erklären die Heftigkeit<br />
der politischen <strong>und</strong> öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Terrorismus.<br />
Trotz aller geradezu beschwörenden Versuche, die Terroristen als<br />
nichts anderes als gemeine Mörder <strong>und</strong> Kriminelle zu betrachten, hatten<br />
letztere — um noch einmal Merton zu zitieren — die „Chance, wenn nicht<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
immer die Wirklichkeit der Zustimmung <strong>und</strong> Billigung durch andere ... Mitglieder<br />
der Gesellschaft für sich" (a.a.O., S. 363). „Nichts einigt eine Gesellschaft<br />
mehr als ihre Mörder" — das auf diese zynische Kurzformel gebrachte,<br />
von Durkheim soziologisch begründete Integrations- <strong>und</strong> Nützlichkeitspostulat<br />
des Verbrechens für eine Gesellschaft, schien im Falle des Terrorismus<br />
nicht mehr automatisch verbürgt zu sein, sondern bedurfte der staatlichen,<br />
politischen <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong>n Einübung qua Dramatisierung,<br />
Mobilisierung <strong>und</strong> Aktivierung sämtlicher verfügbarer Ressourcen. Umgekehrt<br />
wurden daran die Bedingungen deutlich, unter denen die moralische<br />
Dimension der rechtlich vermittelten <strong>und</strong> konstituierten Kriminalität seine<br />
<strong>gesellschaftliche</strong> Funktion entfaltet bzw. unter denen der Verhaltensaspekt<br />
von Kriminalität sich von seinem moralischen Bewertungskontext abzulösen<br />
tendiert.<br />
b. Die soziologische Verknüpfung von Studentenbewegung <strong>und</strong><br />
Terrorismus<br />
Ich möchte diese Überlegungen nutzen, um nunmehr einen Brückenschlag<br />
zu der dem Terrorismus nicht zur zeitlich, sondern in vieler Hinsicht auch<br />
inhaltlich vorangegangenen politischen Bewegung der Studenten <strong>und</strong> der<br />
außerparlamentarischen Opposition zu tun. Ich spinne dafür den Faden<br />
weiter, den ich Mertons Unterscheidung des Abweichers <strong>und</strong> des Nonkonformisten<br />
entnommen habe. Es hat auch gegenüber der Studentenbewegung<br />
massive Versuche gegeben, ihren politischen Gehalt dadurch zu ignorieren,<br />
zu desavouieren <strong>und</strong> zu diskreditieren, daß man die Träger der Bewegung<br />
isolierte, dämonisierte <strong>und</strong> kriminalisierte.<br />
Diese Strategie der Auseinandersetzung mit der Studentenbewegung<br />
<strong>und</strong> der außerparlamentarischen Opposition läßt sich auch im Sinne Mertons<br />
als Versuch interpretieren, gegen die Träger des Protests jenes die<br />
Reaktion auf den Kriminellen verstärkende <strong>und</strong> Effektivität verbürgende<br />
Reservoir „desinteressierter moralischer Entrüstung" ins Feld zu führen.<br />
Wir wissen aber, daß gerade diese Versuche außerordentlich a<strong>mb</strong>ivalent,<br />
risikoreich <strong>und</strong> zum Teil kontraproduktiv waren. Und dies galt auch <strong>und</strong> in<br />
besonderer Weise für die Verfolgung von Straftaten gegen die Studenten<br />
<strong>und</strong> Träger des Protests. Solche Maßnahmen gegen Studenten <strong>und</strong> Demonstranten<br />
— <strong>und</strong> es gibt zahlreiche Beispiele dafür — hatten oft die Isolierung<br />
der Studenten aufbrechende Solidarisierungen <strong>und</strong> Mobilisierungen von Anhängern<br />
zur Folge. Das der Erinnerung wohl noch zugänglichste Beispiel<br />
einer solchen kontraproduktiven Wirkung strafrechtlicher Sozialkontrolle<br />
waren sicherlich die Vorgänge um den Schah-Besuch Anfang Juni 1967 in<br />
Berlin, als der Student B. Ohnesorg von einer Polizistenkugel tödlich getroffen<br />
wurde. Die öffentliche, weit ins Ausland reichende Empörung darüber<br />
war zwar einerseits <strong>und</strong> langfristig auf eine ironische Weise für die Studentenbewegung<br />
wegen des damit verb<strong>und</strong>enen zusätzlichen Handlungsdruckes<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
eher abträglich <strong>und</strong> zerstörerisch, aber dieser Vorgang ließ sehr deutlich das<br />
riskante Moment sichtbar werden, das in dem Versuch begründet liegt, politischen<br />
Bewegungen mit den Mitteln des Strafrechts <strong>und</strong> seiner Instanzen<br />
zu begegnen.<br />
Damit ich nicht mißverstanden werde: es gab genügend Anlässe <strong>und</strong><br />
Handlungen auf Seiten der Studentenbewegung, die unter strafrechtliche<br />
Tatbestände mühelos zu subsumieren waren — Hausfriedensbruch, Nötigungen,<br />
Beleidigungen, Sachbeschädigungen, Verstöße gegen das Strafrecht <strong>und</strong><br />
seine Nebengesetze, Ordnungswidrigkeiten. Und es gab die sog. Strategie<br />
der begrenzten Regelverletzungen.<br />
Das aber ist nicht der entscheidende Punkt. Soziologisch allein interessant<br />
<strong>und</strong> politisch relevant scheint mir die Tatsache zu sein, daß deren<br />
staatliche Verfolgung der Studentenbewegung nicht das politische Wasser<br />
abzugraben vermochte, sondern das Protestpotential eher stärkte. Ja, man<br />
kann sagen, daß die Strategie der begrenzten Regelverletzung sich aus der<br />
Sicht der Bewegung rentierte. Man könnte diesen Effekt Überreaktionsgewinne<br />
von Regelverletzung politischer <strong>und</strong> sozialer Bewegungen nennen, die<br />
darauf zurückführbar sind, daß in solchen Fällen die strafrechtlich-repressive<br />
Reaktion als ,,Überreaktion" darstellbar ist, ganz unabhängig von der<br />
Frage der subsumtionslogischen <strong>und</strong> legalen Korrektheit oder Unkorrektheit<br />
der staatlichen Maßnahmen.<br />
Will man den Unterschied <strong>und</strong> die herzustellende Verknüpfung zwischen<br />
Studentenbewegung <strong>und</strong> Terrorismus auf eine griffige Pointe bringen,<br />
so läßt sich dies unter Rückgriff auf die eingangs schon erwähnte Figur des<br />
sog. Sympathisanten tun, die ja in der Auseinandersetzung mit dem Terrorismus<br />
eine zentrale Rolle spielte. Sympathisanten der Studentenbewegung<br />
gab es natürlich auch, <strong>und</strong> es gab sie zahlreicher, vor allem aber <strong>und</strong><br />
anders als zur Zeit des Terrorismus: zur Zeit der Studentenbewegung gab<br />
es keinen Anlaß, sich dieses Etiketts zu erwehren, im Gegenteil: man konnte<br />
sich seiner eher rühmen, <strong>und</strong> man konnte damit auch politische <strong>und</strong> andere<br />
Karriere machen. Man kann diesem Gedanken noch eine andere Wendung<br />
geben <strong>und</strong> sagen, daß sich zur Zeit der Studentenbewegung das Zwar<br />
ihrer politischen Anliegen <strong>und</strong> Inhalte nicht durch das Aber ihrer regelverletzenden<br />
Aktionsformen bändigen oder kontrollieren ließ, wohingegen der<br />
Terrorismus gerade dies ermöglichte. Was nichts anderes heißt, als daß die<br />
politischen Inhalte entweder wieder zurückzuversetzen waren in die Welt<br />
der wissenschaftlichen Rhetorik <strong>und</strong> des politischen Rituals oder sie ganz<br />
zum Schweigen zu bringen waren.<br />
c) Die Analyse von Eskalationsprozessen <strong>und</strong> der Rolle der Gewalt in<br />
ihnen<br />
Dem skizzierten Unterschied zwischen Studentenbewegung <strong>und</strong> Terrorismus<br />
in bezug auf die Effektivität staatlicher <strong>und</strong> strafrechtlicher Kontrolle<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
entsprach auf der Ebene des Verhaltens <strong>und</strong> der Aktionsformen eine zunehmende<br />
Gewalthaftigkeit <strong>und</strong> kriminelle Form. Dieser Prozeß wird oft<br />
als der der Gewalteskalation beschrieben, selten jedoch genauer analysiert<br />
<strong>und</strong> nachgezeichnet. Dies will ich andeutungsweise tun.<br />
Betrachtet man das Geschehen unter konfliktanalytischen Gesichtspunkten<br />
<strong>und</strong> teilt das Ergebnis unserer bisherigen Überlegungen, daß nämlich<br />
die Bändigung <strong>und</strong> Domestizierung des politischen Gehalts der Studentenbewegung<br />
erst mit dem Terrorismus leichter gelang, dann läßt sich zunächst<br />
feststellen, daß die Eskalation der Auseinandersetzungen in die Gewalthaftigkeit<br />
objektiv die Adressaten des Protests gegenüber seinen Trägern<br />
in die Oberhand brachte. Die Gewalt des Protests entlegitimierte diesen<br />
<strong>und</strong> seine Inhalte — das ist die auf allen Seiten gebrauchte Formel für<br />
diesen Vorgang, wenn auch die Distanzierung auf Seiten derjenigen, die<br />
zwar den Protest zur Zeit der Studentenbewegung teilten, den Schritt in<br />
die Gewalt jedoch nicht mitgingen, von zeitlichem Zögern, hinhaltendem<br />
Argumentieren <strong>und</strong> von der Angst vor falscher Motivattribution geprägt<br />
<strong>und</strong> bestimmt war.<br />
Ich will damit nicht die Antwort auf eine Frage geben, die sich bei solchen<br />
Eskalationen von Konflikten in die Gewalthaftigkeit immer stellt,<br />
nämlich die Frage danach, wer den ersten Stein warf, das Feuer schürte <strong>und</strong><br />
die Eskalation in Gang hielt. Ich möchte diese Frage auch ausdrücklich als<br />
jenseits wissenschaftlicher Zielsetzung liegend zurückweisen. Sie stellt sich<br />
ja vor allem aus Gründen der politischen <strong>und</strong> vor allem strafrechtlichen<br />
Haftbarmachung, <strong>und</strong> die Schwierigkeit der wissenschaftlichen Analyse besteht<br />
darin, die eigenen Bef<strong>und</strong>e nicht in eine solche Grammatik überführen<br />
zu können. Eskalationsprozesse lassen sich methodologisch nicht als unilineare<br />
Ursache-Wirkungs-Beziehungen rekonstruieren, zudem nicht als solche,<br />
die die Bedingungen strafrechtlicher Subsumtion erfüllen, nämlich eindeutige<br />
Zurechnungen von Ursachen <strong>und</strong> Wirkungen zu handelnden Personen<br />
zu ermöglichen. Vielmehr erfordern sie eine Methodologie wechselseitiger<br />
Kausalbeziehungen, um Prozesse zu beschreiben, die ein „unbedeutendes<br />
oder zufälliges Ausgangsereignis ausweiten, zu einer Abweichung aufbauen<br />
<strong>und</strong> zu einer Entfernung vom Ausgangszustand treiben" (M. Maruyama<br />
1968, S. 304). Dabei läßt sich der sogen, „initial kick", das die Eskalation<br />
auslösende Ausgangsereignis, natürlich schwer zeitlich <strong>und</strong> örtlich<br />
genau bestimmen. Er ist im Gr<strong>und</strong>e — <strong>und</strong> das ist für die Logik solcher<br />
Modelle der springende Punkt — indeterminiert, d.h., er steht zum Eskalationsprodukt<br />
— hier der Gewalt — in höchst beliebiger <strong>und</strong> zufälliger Beziehung.<br />
Dies sei vorausgeschickt, um die folgenden Ausführungen gegen eine<br />
kausale oder strafrechtliche Um- oder Parallelinterpretation zu wappnen.<br />
Sicherlich laufen auf der anderen Seite soziale Eskalationsprozesse nicht<br />
naturwüchsig <strong>und</strong> irreversibel ab. Da es sich um Konfliktabläufe mit verschiedenen<br />
Konfliktpartnern handelt, sind die zentralen Elemente des Geschehens<br />
die jeweiligen Entscheidungen der einzelnen Konfliktpartner, ihre<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Strategien, ihre einzelnen Konflikt- bzw. Spielzüge, um eine Begrifflichkeit<br />
einzuführen, die sichtbar machen soll, daß es hier auch nicht um voraussetzungslose,<br />
sondern um regelgeleitete Handlungen geht. Dabei fasse ich<br />
den Regelbegriff in Anlehnung an die sozialhistorischen Arbeiten um<br />
Ch. Tilly (1978) sehr weit: damit sind sowohl präskriptive Regeln im Sinne<br />
geschriebener Vorschriften, also Rechtsnormen, gemeint als auch implizite<br />
Regeln im Sinne von ungeschriebenen Anwendungsregeln, wie sie gerade<br />
im Zusammenhang mit präskriptiven Regeln des ersten Typs existieren.<br />
Darunter fallen aber auch Regeln im Sinne von faktischen Regelmäßigkeiten,<br />
die zwar nicht ausdrücklicher oder ausgesprochener Bestandteil von<br />
Einzel- oder Globalstrategien sind, aber als Ressourcen oder situationsbezogene<br />
Umstände zum unterstellbaren, gewußten oder unbewußten Kalkulations-<br />
oder Erwartungshorizont der Konfliktpartner hinzugehören.<br />
Ich komme nunmehr zurück auf die Frage nach den Bedingungen, terminologisch<br />
treffender: den Mechanismen der Eskalation des Konflikts in<br />
die Gewalthaftigkeit. Ich konzentriere mich dabei auf die Seite der staatlichen<br />
Akteure <strong>und</strong> deren Strategien, <strong>und</strong> zwar, wie ich meine, deshalb aus<br />
gerechtfertigten systematischen Erwägungen, weil infolge der Legitimität<br />
physischer Gewaltanwendung <strong>und</strong> infolge des daraus herzuleitenden Systems<br />
eines berufsrollenmäßig organisierten, routinierten <strong>und</strong> insoweit normalisierten<br />
Umgangs mit Gewalt die Wahrscheinlichkeit der Einführung von<br />
Gewalt in einen Konflikt, der hier untersuchten Art auf Seiten der staatlichen<br />
Konfliktpartner am größten ist. Diese Vermutung ist im übrigen für<br />
Konflikte zwischen politischen <strong>und</strong> sozialen Bewegungen <strong>und</strong> den etablierten<br />
politischen <strong>und</strong> staatlichen Instanzen empirisch vielfach bestätigt <strong>und</strong><br />
belegt.<br />
Als gewaltbegünstigende generelle Strategie von Seiten der staatlichen<br />
<strong>und</strong> politischen Institutionen kann man zunächst festhalten, daß das staatliche<br />
Handeln von dem Bestreben bestimmt war, den politischen Konflikt<br />
in einen rechtlichen bzw. in eine Serie rechtlicher, genauer: strafrechtlicher<br />
Konflikte zu verwandeln. Dies begünstigt staatliche Gewaltanwendung insofern,<br />
als die Umsetzung einer solchen Strategie in konkretes Handeln ja<br />
bedeutet, daß Täter identifiziert, sistiert werden <strong>und</strong> sog. unmittelbarer<br />
Zwang in zahlreichen konkreten Interaktionen exekutiert wird. Insofern ist<br />
Rechtsdurchsetzung <strong>und</strong> -Implementierung, insbesondere im Kontext des<br />
sogen, staatlichen Strafanspruchs, immer <strong>und</strong> systematisch mit dem Einsatz<br />
staatlicher Gewalt verb<strong>und</strong>en.<br />
Tatsächlich ist staatliche, polizeiliche Gewaltanwendung — <strong>und</strong> dies ist<br />
einer der zentralsten, umstrittensten, analytisch m.E. wichtigsten Momente<br />
in der Gewalteskalation — nicht nur häufig praktiziert, sondern taktisch<br />
eingesetzt worden zur Erteilung von Lektionen, zur Demonstration von<br />
staatlicher Gewalt oder — wie es so schön in politisch-euphemistischer Umschreibung<br />
heißt — damit „der Staat Flagge zeigt", damit das Selbstverständnis<br />
der B<strong>und</strong>esrepublik als „wehrhafte Demokratie" Ausdruck erhält.<br />
Tatsächlich ist weiter — <strong>und</strong> dies so zu sagen, ist gewiß riskant — staatliches<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Handeln unter Verletzung der Regeln geschehen, die diesem gesetzlich vorgegeben<br />
sind, <strong>und</strong> das nicht nur ausnahmsweise <strong>und</strong> vereinzelt, sondern vielfach<br />
<strong>und</strong> — wie ich meine — strukturell induziert. Konkret: staatliche Amtsträger<br />
haben unter Paragraphen des Strafrechts, der Strafprozeßordnung,<br />
des Ordnungswidrigkeitenrechts subsumierbare Handlungen begangen, von<br />
denen sicherlich als bekanntestes Beispiel die von einem Gericht als tatbestandsmäßige<br />
<strong>und</strong> rechtswidrige Tötung von B. Ohnesorg festgestellte Handlung<br />
zu bezeichnen ist.<br />
Unter dem Thema der Einführung von Gewalt in den Konflikt seitens<br />
staatlicher Instanzen ist insbesondere für das Entstehen <strong>und</strong> die Aussonderung<br />
terroristischer Subsysteme auch der Bereich staatlicher Kontrollaktivitäten<br />
einzubeziehen, der mittlerweile zum rechtlichen, politischen <strong>und</strong><br />
öffentlichen Diskussionsthema gehört: der Einsatz <strong>und</strong> die Praxis sog.<br />
proaktiver bzw. präventiver Kontrollstrategien. Damit sind Konfliktstrategien<br />
gemeint, die generell darin bestehen, sich in Nähe zum Konfliktpartner<br />
zu dem Zweck zu bringen, dem Konflikt eine für sich günstige Wendung zu<br />
geben. Solche Strategien gehören zum normativen <strong>und</strong> damit erwartbaren<br />
Routineinventar staatlicher Kontrolle <strong>und</strong> werden insbesondere dort <strong>und</strong><br />
dann eingesetzt, wo der Konfliktgegner einen gewissen Organisationsgrad<br />
aufweist <strong>und</strong> Systemgrenzen unterhöhlt. Politische Bewegungen, das weiß<br />
man aus der Literatur <strong>und</strong> aus vielen Beispielen, gehören zum bevorzugten<br />
Objekt solcher proaktiver Kontrollstrategien. Diese auch rechtlich umstrittene<br />
Kontrollstrategie bringt in den Verlauf eines Konflikts insofern eine<br />
Eskalationsgefahr, als sie Ausdruck einer Gewalterwartung <strong>und</strong> -Zumutung<br />
gegenüber dem Objekt seiner Anwendung ist, deren Manifestation um so<br />
dringlicher wird, je rechtlich zweifelhafter sie erscheint. Das ist der Moment<br />
des agent provocateurs, der Regelverletzungen entweder unter Dissimulation<br />
seiner Identität begeht oder Arrangements des Handlungsszenarios<br />
besorgt, die das Begehen von kriminellen Handlungen oder das Eintreten<br />
von Gewalt möglich machen, begünstigen, nahelegen usw.<br />
Obwohl dieser Bereich staatlichen Handelns auch in bezug auf Gewalteskalation<br />
der 60er <strong>und</strong> 70er Jahre keineswegs voll ausgeleuchtet ist, sind<br />
Zipfel solchen Geschehens doch gelüftet. Die Frage indessen, inwieweit sie<br />
nicht nur für konkrete Konfrontationsereignisse, so etwa für die Osterunruhen<br />
im Jahre 1968 im Anschluß an das Attentat auf R. Dutschke, als ein<br />
staatlicher V-Mann Molotow-Cocktails <strong>und</strong> deren Handhabung bereitstellte,<br />
eskalierend wirkten, sondern einen darüber hinausgehenden Beitrag zur zunehmenden<br />
Gewalthaftigkeit der Ereignisse leisteten, scheint mir — auch für<br />
den Wissenschaftler — neben der empirischen Evidenz vor allem von der<br />
Intensität <strong>und</strong> der subjektiven Gewißheit der Gewaltvermutung gegenüber<br />
den Adressaten solcher Konfliktpraktiken abzuhängen.<br />
Ich möchte weiter einen gewalteskalierenden Faktor ansprechen, der<br />
mir nicht nur empirisch von besonderem Gewicht zu sein scheint, sondern<br />
der auch das rechtstaatliche Selbstverständnis von Demokratien im allgemeinen<br />
<strong>und</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik im besonderen betrifft. Vermutlich — dies<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ist konfliktanalytisch ebenso erklärbar wie empirisch belegbar — hat nichts<br />
den Konflikt so angeheizt wie die fehlende oder versagende Kontrolle von<br />
Regelverletzungen durch staatliche Instanzen in der Auseinandersetzung<br />
mit der Studentenbewegung. Die Entgrenzungen staatlicher Gewalt, die sich<br />
auf der Basis der Rekonstruktion konkreter Konfliktereignisse detailliert<br />
nachzeichnen lassen, blieben ungeahndet. Ihnen gegenüber versagten die<br />
Kontrollinstitutionen, denen gemäß dem Prinzip staatlicher Gewaltenteilung<br />
die Aufgabe zukommt, staatliche Gewalt in Grenzen zu halten.<br />
Kontrollimmunität ließ sich bezüglich der Durchführung justizieller<br />
Verfahren gegen Regelverletzungen staatlicher Instanzen ebenso feststellen,<br />
wie es fast ausnahmslos zum Ritual der politisch Verantwortlichen gehörte,<br />
nach Konfrontation zwischen Demonstranten <strong>und</strong> den staatlichen Instanzen<br />
Rechtmäßigkeitserklärungen noch vorab aller Rechtmäßigkeitsprüfungen<br />
abzugeben. Und wiederum trat dies am eindrucksvollsten aus Anlaß des<br />
Schah-Besuchs in Berlin zutage, als der damalige Regierende Berliner Bürgermeister<br />
bald nach der Teilnahme am Festakt in der Berliner Staatsoper<br />
der Polizei öffentlich behutsames <strong>und</strong> in den Grenzen des Rechts <strong>und</strong> der<br />
Vorschriften gebliebenes Handeln bescheinigt hatte, was ihn — neben dem<br />
damaligen Polizeipräsidenten <strong>und</strong> dem Innensenator — ja auch dann bald<br />
das Amt kostete. Und selbst noch in der Arbeit des Berliner parlamentarischen<br />
Untersuchungsausschusses, der die Vorgänge um den 2. Juni aufklären<br />
sollte, wurde das Kontrolldefizit sichtbar, das gegenüber den staatlichen<br />
Instanzen obwaltete. Im übrigen kann man dies alles als eine zynische verhaltensmäßige<br />
Materialisierung dessen betrachten, was in der Zeit der Auseinandersetzung<br />
als das notwendige „Zusammenrücken aller staatlichen<br />
Instanzen <strong>und</strong> Gewalten" genannt, gefordert <strong>und</strong> praktiziert wurde.<br />
Gravierender <strong>und</strong> verhängnisvoller — <strong>und</strong> dies soll meine letzte Bemerkung<br />
zu Eskalationsmechanismen sein — als die Regelverletzung selbst <strong>und</strong><br />
das Nichtfunktionieren der Kontrollinstitutionen war für die Eskalation des<br />
Konflikts ein weiterer Umstand, der sich als eine Steigerung des institutionellen<br />
Zynismus begreifen läßt. Nicht nur wurden Gewaltentgrenzungen<br />
<strong>und</strong> Rechtsverletzungen der staatlichen Instanzen geleugnet, ignoriert, mit<br />
Gegenanzeigen der Verleumdung oder des Widerstands gegen die Staatsgewalt<br />
konterkariert, sondern zum Beweis der Begründetheit dieser Leugnung<br />
<strong>und</strong> zur Rechtmäßigkeit des Handelns wurde die Tatsache genommen, daß<br />
Anzeigen <strong>und</strong> Verfahren gegen staatliche Amtsträger eingestellt, nicht verfolgt<br />
<strong>und</strong> abgewiesen wurden. Die sich darin ausdrückende staatliche Selbstgerechtigkeit,<br />
die strukturell begründet ist in der buchstäblich zu verstehenden,<br />
rechtlich verankerten Möglichkeit <strong>und</strong> Praxis der Herrschaft über die<br />
Wirklichkeit, scheint mir zum einen der treffendste Begriff für die beschriebenen<br />
Zusammenhänge, zum anderen eine spiegelbildliche Aufnahme <strong>und</strong><br />
Reaktion des Staates <strong>und</strong> seiner Amtsträger auf den moralischen Rigorismus<br />
der Studenten <strong>und</strong> ihrer daraus verständlichen Behauptung, daß der<br />
Rechtsstaat nur Maskerade sei.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
3. Empirische Probleme der Analyse<br />
Lassen Sie mich jetzt zu den empirischen Schwierigkeiten der Analyse kommen.<br />
Ich glaube, ich kann mich dazu kurz fassen, weil die Probleme eigentlich<br />
schon im Vorhergehenden implizit deutlich geworden sind. Ich möchte<br />
drei allgemeine Bemerkungen machen. Die erste bezieht sich darauf, daß die<br />
Analyse von Konfliktabläufen, die noch in die Gegenwart hineinreichen,<br />
empirisch deshalb an Grenzen stößt, weil die Informationen, Daten <strong>und</strong><br />
Dokumente über sie in den Sog <strong>und</strong> den Verlauf des Konflikts auf vielfältige<br />
Weise hineingeraten. Zweifellos trifft das für sämtliche im Forschungsverb<strong>und</strong><br />
„Ursachen des Terrorismus" angefertigte Studien zu. Die Konfliktbeteiligten<br />
handeln <strong>und</strong> informieren unter strategischen <strong>und</strong> taktischen Gesichtspunkten,<br />
<strong>und</strong> das heißt vor allem mit Blick auf die Konfliktgegner,<br />
aber auch mit Blick auf unbeteiligte Dritte, auf Öffentlichkeit, Kontrollinstitutionen<br />
etc., die ja für den weiteren Verlauf eines Konflikts eine kritische<br />
Größe darstellen, wie wir gesehen haben. Die Konfliktereignisse aus<br />
der Studentenbewegung, erst recht diejenigen aus der Zeit des Terrorismus,<br />
ragen auf vielfache Weise bis in unsere Zeit hinein, in Form rechtlicher <strong>und</strong><br />
politischer Verarbeitungen der Rechtfertigung, Warnung, der Konfliktfortsetzung<br />
usw.. Dies gilt sicherlich für beide Konfliktseiten, <strong>und</strong> amtliche<br />
Dokumente, erst recht daran in irgendeiner Form beteiligte Amtsträger,<br />
die nicht befragt zu haben, meiner Studie den im Vorwort des Herausgebers<br />
abgedruckten Vorwurf des Verzichts auf Primärerhebungen eintrug, sind<br />
davon aus den oben genannten Gründen der Selbstrechtfertigung natürlich<br />
in besonderer Weise geprägt. Erst in dem Maße, in dem solche Ereignisse<br />
in den Horizont der Geschichte eintreten, stellt sich auch jene Absonderung<br />
des Interesses an der Darstellung eines Geschehens vom Geschehen selbst<br />
ein, die als eine Bedingung wissenschaftlicher Rekonstruktion zu betrachten<br />
ist. Man steht damit als Sozialwissenschaftler vor dem Dilemma, daß die<br />
zeitliche Nähe der Analyse zu ihrem Gegenstand zwar einerseits der erinnernden<br />
Verzerrung engegensteht, aber andererseits <strong>und</strong> aus differenten<br />
Gründen, die selektive Information begünstigt. Eine zweite Bemerkung<br />
möchte ich in Anknüpfung an das von H.S. Becker (1967) theoretisch <strong>und</strong><br />
methodologisch gemeinte Konzept der „Hierarchie der Glaubwürdigkeit"<br />
machen, über sämtliche Konfliktereignisse gab es naturgemäß verschiedene<br />
<strong>und</strong> oft widersprüchliche Informationen aus separaten Datenquellen. Ihre<br />
analytische Verwertung erzwang deshalb Entscheidungen über die empirische<br />
Triftigkeit der Informationen, die in der Tat oft nicht auskamen ohne<br />
Glaubwürdigkeitsurteile oder -Vermutungen. Ein Problem ist dabei sicherlich<br />
die Kontrolle der eigenen Subjektivität. Ich möchte diese für mich sehr<br />
persönlich beantworten. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß Verlautbarungen,<br />
Dokumente <strong>und</strong> Darstellungen staatlicher Handlungen <strong>und</strong> Maßnahmen<br />
unter einem erklärbar strengeren Druck der Organisierung, der<br />
Folgen- <strong>und</strong> Konsequenzenantizipation standen als solche der Konfliktgegenseite.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Für staatliches Handeln gilt die Regel, daß es sich in der Darstellung von<br />
Ereignissen an den präskripten Regeln seiner Handlungsbefugnisse orientiert,<br />
daß gleichsam die Deskription mit der Präskription in Übereinstimmung<br />
gebracht wird, d.h. daß staatliche Dokumente des Konfliktgeschehens<br />
unter einem strukturellen Glaubwürdigkeitsverdacht stehen.<br />
Die dritte Bemerkung schließlich bezieht sich auf einen Kernpunkt<br />
meiner Studie, nämlich die staatlichen Regelverletzungen. Hier besteht ein<br />
Dilemma nicht nur in empirisch-phänomenologischer Hinsicht, sondern<br />
auch mit Blick auf jenes Eingangszitat aus Alice im W<strong>und</strong>erland. Ich möchte<br />
das Problem in die Form einer Frage bringen: darf man in einer wissenschaftlichen<br />
Untersuchung Bilddokumente, unwidersprochene Zeugenaussagen<br />
über Polizisten, die auf am Boden liegende Demonstranten einschlagen,<br />
in den Kategorien <strong>und</strong> der Sprache des Strafrechts beschreiben, also<br />
etwa als Körperverletzungen im Amt <strong>und</strong> damit als kriminell bezeichnen,<br />
auch wenn etwa eine entsprechende Anzeige eingestellt, eine gerichtliche<br />
Überprüfung aus Gründen der strafprozessualen Unklärbarkeit negativ ausgefallen<br />
oder —- was die Regel zu sein scheint —, wenn ein solcher Vorgang<br />
überhaupt nicht zur Aufmerksamkeit der Justiz gebracht wird? Mit guten<br />
Gründen ließe sich argumentieren, daß solche Feststellungen <strong>und</strong> die Verwendung*<br />
solcher Kategorien des Strafrechts der Zuständigkeit der staatlich<br />
dafür vorgesehenen Instanzen <strong>und</strong> Prozesse vorbehalten bleiben sollten.<br />
Andererseits basiert z.B. die Dunkelfeldforschung der Kriminologie<br />
darauf, solche juristischen Wertungen <strong>und</strong> Feststellungen zu treffen. Andererseits<br />
auch läßt sich für die Studien zur Studentenbewegung <strong>und</strong> zum<br />
Terrorismus zeigen, daß es offenbar keine Hemmungen gibt, die Handlungen<br />
der Studenten umstandslos in die Semantik des Strafrechts zu übertragen,<br />
bei der Beschreibung der Handlungen der staatlichen Instanzen<br />
jedoch schlicht von Regelverletzungen zu sprechen, sie, wenn nicht juristisch<br />
erwiesen, als nichtexistent zu betrachten oder sie in einer Weise zu<br />
beschreiben, die die subjektive Komponente, d.h. das intentionale Element<br />
einer strafbaren Handlung ausspart.<br />
Das Dilemma besteht, auf eine kurze Formel gebracht, in dem Verhältnis<br />
von justizieller zur wissenschaftlichen Wahrheit: ist man als Wissenschaftlicher<br />
den Kriterien, Indikatoren, Beweisregeln <strong>und</strong> Urteilen unterworfen,<br />
die das Recht vorschreibt <strong>und</strong> anwendet, um die Wirklichkeit<br />
festzustellen? Ist die Wirklichkeit fürs Recht auch diejenige für die Wissenschaft?<br />
Die Frage so gestellt, scheint zwar die Antwort schon mitzuliefern,<br />
es empfiehlt sich aber, bei ihrer genauen Formulierung eine sprachliche<br />
Anleihe bei Radio Eriwan zu machen, um nicht wie ein kriminologischer<br />
oder sozialwissenschaftlicher Don Quichotte dazustehen: Im Prinzip hat<br />
die Wissenschaft natürlich ihre eigenen Regeln der Wirklichkeitserfassung,<br />
aber es kommt darauf an, wen <strong>und</strong> was sie untersucht.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Schlußbemerkung<br />
Ich bin damit am Ende meiner Skizzen <strong>und</strong> Überlegungen zu den Bef<strong>und</strong>en<br />
der Terrorismusforschung <strong>und</strong> zu den begrifflichen, methodischen<br />
<strong>und</strong> empirischen Problemen ihrer Gewinnung.<br />
Meine Damen <strong>und</strong> Herren, lassen Sie mich als letzte Bemerkung die<br />
Hoffnung ausdrücken, daß mir hier gelungen ist, was mir offenbar gegenüber<br />
dem Auftraggeber meiner Studie mißlungen ist.<br />
LITERATUR<br />
Baring, Arnulf 1982, Machtwechsel. Die Ära Brandt-Scheel, Stuttgart.<br />
Becker, Howard S. 1967, „Whose Side Are We On?", in: Social Problems, Bd. 14,<br />
1967, S. 239-247.<br />
Berger, Peter L. 1963, Invitation to Sociology, Garden City, N.Y.<br />
Maruyama, Magoroh 1968, „The Second Cybernetics: Deviation-Amplifying Mutual<br />
Causal Processes", in: American Scientist, Bd. 51, 1963, S. 164-179; wieder abgedr.<br />
in: W. Buckley (Hrsg.), Modern Systems of Research for the Behavioral Scientist,<br />
Chicago 1968, S. 304-312.<br />
Luhmann, Niklas 1972, Rechts<strong>soziologie</strong>, 2 Bde., Reinbek 1972 (2. Aufl. 1983).<br />
Merton, Robert K. 1957, Social Theory and Social Structure, New York—London.<br />
Sack, Fritz 1984, unter Mitarbeit von Uwe Berlit, Horst Dreier <strong>und</strong> Hubert Treiber,<br />
„Staat, Gesellschaft <strong>und</strong> politische Gewalt: Zur 'Pathologie Politischer Konflikte",<br />
in Ders. <strong>und</strong> Heinz Steinert (Hrsg.), Protest <strong>und</strong> Reaktion. Analysen zum Terrorismus,<br />
Bd. 4/2, Opladen, S. 18-387.<br />
Tilly, Charles 1978, From Mobilization to Revolution, Reading, Mass.<br />
Vogel, Hans-Jochen 1979, „Möglichkeiten <strong>und</strong> Grenzen der strafrechtlichen Terrorismusbekämpfung",<br />
in: B<strong>und</strong>eszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Freiheit <strong>und</strong><br />
Sicherheit. Die Demokratie wehrt sich gegen den Terrorismus, Bd. 148 der Schriftenreihe,<br />
Bonn 1979, S. 37-43<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Themenbereich IV:<br />
Gesellschaftliche<br />
Voraussetzungen von<br />
Technik<strong>entwicklung</strong><br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
EINLEITUNG<br />
Hartmut Neuendorff, Gert Schmidt<br />
Kernenergie, Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie, Robotereinsatz, BTX <strong>und</strong> nicht zuletzt<br />
Mikroelektronik sind Signalworte eines erneuten „Streites um die<br />
Technik". Technikangst <strong>und</strong> -feindlichkeit belasten die allgemein<strong>gesellschaftliche</strong><br />
Verständigung zum Thema „Technik <strong>und</strong> Gesellschaft" ebenso<br />
wie Technikeuphorie <strong>und</strong> naiver Technikoptimismus.<br />
Die Hauptreferate <strong>und</strong> die Diskussionsbeiträge im Rahmen der Plenarveranstaltung<br />
„Gesellschaftliche Voraussetzungen von Technik<strong>entwicklung</strong><br />
— Soziale Konsequenzen <strong>und</strong> interessenpolitische Optionen für den Arbeitskräfteeinsatz"<br />
zeigen zu je verschiedenen Themen <strong>und</strong> an methodisch ganz<br />
unterschiedlich verfahrenden Untersuchungen anknüpfend, daß empirische<br />
Sozialforschung den Anspruch auf gesellschaftlich relevante Technikforschung<br />
<strong>und</strong> Prognoseorientierung aufgreift.<br />
Gegen verbreitete „einfache" <strong>und</strong> „einseitige" Vorstellungen über das<br />
Verhältnis von Gesellschaft <strong>und</strong> Technik, die nicht nur in der Öffentlichkeit,<br />
sondern auch in wissenschaftlichen Behandlungen dieses Themas anzutreffen<br />
sind, entwickelt B. Joerges aus Berlin in seinem Vortrag über „Technologie<strong>entwicklung</strong><br />
zwischen Eigendynamik <strong>und</strong> öffentlichem Diskurs"<br />
theoretisch-analytische Vorschläge, um die Komplexität dieses Verhältnisses<br />
angemessen in den Griff zu bekommen.<br />
Durch die Analyse der für einzelne Techniken verschiedenen Organisations-<br />
<strong>und</strong> Steuerungszusammenhänge zwischen den relevanten Akteuren<br />
(Wissenschaft, Industrie, politisch administratives System, Öffentlichkeit),<br />
die auf die Entwicklung von Techniken Einfluß nehmen, soll geklärt werden,<br />
ob in diesen Entwicklungen Rationalitätsmuster aufzufinden sind, die<br />
die Möglichkeit vernünftiger Steuerung von technischen Entwicklungen erhöhen.<br />
Die beiden Kommentare (W.Ch. Zimmerli aus Braunschweig <strong>und</strong><br />
H. Neuendorff aus Dortm<strong>und</strong>) behandeln Defizite, die auch das vorgeschlagene<br />
umfassende Analyseschema gleichwohl noch enthält.<br />
Aufbauend auf eine breit angelegte empirische Untersuchung in der<br />
Automobilindustrie, in der Chemie-Industrie <strong>und</strong> im Maschinenbau, die Erhebungen<br />
sowohl auf der Seite des Managements wie bei betrieblichen Interessenvertretungen<br />
<strong>und</strong> Arbeitnehmern einbezieht, kommen die beiden<br />
Göttinger Industriesoziologen H. Kern <strong>und</strong> M. Schumann zu dem Ergebnis,<br />
daß die betriebliche Nutzung neuer Fertigungstechnologien in wichtigen<br />
Industriebereichen künftig verstärkt zu „Neuen Produktionskonzepten"<br />
führt, deren wichtigste Merkmale eine radikale Abkehr von „tayloristi-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
schen" Arbeitsformen, eine erweiterte Einbeziehung von Qualifikationsreserven<br />
der Arbeitskräfte <strong>und</strong> eine veränderte, betriebspolitisch stärker<br />
partnerschaftliche, Wahrnehmung des qualifizierten Teils der Arbeiterschaft<br />
seitens des Managements sind. Der Vortrag von H. Kern <strong>und</strong> M.<br />
Schumann provozierte pointiert-kritische Kommentare: Die von ihnen<br />
beabsichtigte Herausforderung ist gelungen. Die Skepsis der Forscher-<br />
Kollegen (zu Wort kamen Rudi Schmidt aus Erlangen <strong>und</strong> Klaus Düll<br />
aus <strong>München</strong>) wider die „optimistische" Tendenzaussage der Göttinger<br />
bezüglich der „Neuen Produktionskonzepte" ist groß.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
TECHNOLOGIEENTWICKLUNG ZWISCHEN EIGENDYNAMIK UND<br />
ÖFFENTLICHEM DISKURS.<br />
KERNENERGIE, MIKROELEKTRONIK UND GENTECHNOLOGIE IN<br />
VERGLEICHENDER PERSPEKTIVE<br />
Bernward Joerges, Gotthard Bechmann, Rainer<br />
Hohlfeld<br />
1. Vorüberlegungen<br />
Der folgende Beitrag ist ein Diskussionsangebot „aus der Retorte" — er<br />
formuliert, aus einem gemeinsamen Arbeitsprozeß heraus, Fragen <strong>und</strong> Thesen<br />
zu einer zukünftigen Wissenschafts- <strong>und</strong> Technikforschung. Der heuristische<br />
Charakter dieser Überlegungen ergibt sich aus der gegenwärtigen Situation:<br />
Für die Analyse großtechnischer Systeme hat bislang keine Disziplin<br />
ein Konzept vorgelegt, das der Komplexität <strong>und</strong> Brisanz der Phänomene<br />
Rechnung trägt.<br />
Der Vorschlag, drei wichtige wissenschaftlich-technische Felder — Kernenergie,<br />
Mikroelektronik <strong>und</strong> Gentechnologie — in einen analytischen Rahmen<br />
zu stellen, wirft unmittelbar die Frage auf, ob es denn überhaupt zulässig<br />
sei, von „der" Kerntechnik, „der" Mikroelektronik <strong>und</strong> „der" Gentechnologie<br />
zu sprechen (Sorge 1984), <strong>und</strong> warum gerade diese drei gewählt<br />
werden. Einmal natürlich, weil sie in aller M<strong>und</strong>e sind <strong>und</strong> als irgendwie<br />
einheitliche Phänomene wahrgenommen werden. Zum anderen, weil gerade<br />
sie „modern" genannt werden können, jedenfalls aus wissenschaftssoziologischer<br />
Sicht. Mit ihnen wird in großem Stil der Schritt von einer Verarbeitung<br />
von Natur zu ihrer Konstruktion <strong>und</strong> industriellen Produktion getan:<br />
Von der Entnahme von Energieträgern zur Konstruktion von Energieträgern<br />
<strong>und</strong> ihrer Herstellung in fortgeschrittenen Reaktoren, vom Denken<br />
mit dem Hirn zur Konstruktion von programmierbaren Denkmaschinen,<br />
von der Zuchtwahl zur Konstruktion neuer Organismen.<br />
Modern sind diese Technologien also insofern, als eine sich verändernde<br />
Gesellschaft in ihnen der Natur in großem Umfang Aufgaben abnimmt, im<br />
doppelten Wortsinn, die sie ihr früher überlassen hat. In konsequenter Fortführung<br />
eines neuzeitlichen Rationalisierungsprozesses, der mit der Idee der<br />
neuen Naturwissenschaften <strong>und</strong> mit dem Prozeß der Industrialisierung im<br />
17. <strong>und</strong> 18. Jahrh<strong>und</strong>ert seinen Anfang nahm, wird vorfindliche Natur <strong>und</strong><br />
traditionell gewachsene Sozialität auf breiter Front substituiert durch theoretisch<br />
<strong>und</strong> technisch beherrschbare Konstrukte, Apparaturen <strong>und</strong> Systeme.<br />
Habermas (1969) <strong>und</strong> viele andere haben die „Errungenschaften der Moderne",<br />
als deren Synthese dieser Prozeß betrachtet werden kann, herausgearbeitet:<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
— wissenschaftliche Beherrschung von Naturprozessen in einem industriellen<br />
Rahmen;<br />
— Anwendung von bürokratischen Organisationsprinzipien bei der Planung,<br />
Erzeugung <strong>und</strong> Nutzung entsprechender Technologien;<br />
— Ausdifferenzierung einer Vielzahl von technischen Einzelelementen <strong>und</strong><br />
Arbeitsvorgängen <strong>und</strong> deren Integration zu einer Systemstruktur;<br />
— Verschränkung <strong>gesellschaftliche</strong>r Subsysteme (Politik, Wirtschaft, Wissenschaft)<br />
bei der Erzeugung solcher Technologien;<br />
— Verlust konkreter Zuschreibung von Verantwortlichkeit.<br />
Der Titel dieses Beitrags faßt in eine Formel, was vielen Leuten dabei am<br />
meisten auffällt: die augenscheinlich unangreifbare Eigendynamik technologischer<br />
Entwicklungen <strong>und</strong> die umfassenden <strong>gesellschaftliche</strong>n Kontroversen,<br />
die sie auslösen.<br />
Ein drittes Phänomen ist der mythenbildende Charakter moderner<br />
Technologien: Kernenergie, Mikroelektronik, Gentechnologie <strong>und</strong> ihre<br />
„Leitfossile" Reaktoren, Mikroprozessoren, Gene aus der Retorte geben für<br />
viele Leute mächtige Metaphern ab, Kristallisationskerne gewissermaßen für<br />
vielerlei <strong>gesellschaftliche</strong> Leitideen, Ängste <strong>und</strong> Hoffnungen, ja für umfassende<br />
Deutungen gegenwärtiger <strong>und</strong> künftiger Wirklichkeiten.<br />
Schaut man nach, wer sich in den Sozialwissenschaften mit großen<br />
technischen Systemen befaßt, dann sind das — soweit Soziologen beteiligt<br />
sind — neben einigen Wissenschaftssoziologen vor allem Forscher aus dem<br />
Bereich der Industrie<strong>soziologie</strong> <strong>und</strong> der sogenannten Technologiefolgenabschätzung<br />
(TA) (so z.B. Conrad 1983, Janshen u.a. 1981, Kruedener &<br />
Schubert 1983, Liao & Darby 1982, Paschen u.a. 1978, Rapp 1982, Ropohl<br />
u.a. 1978, Wynne 1975 u.v.a.). Von einer Kritik der TA wird im folgenden<br />
ausgegangen, in der Absicht, einen Analyseansatz <strong>und</strong> einige vorläufige<br />
Thesen zur wissenschaftlich-technischen Entwicklung zu formulieren,<br />
die das Konzept einer sozialwissenschaftlichen Technologiefolgenabschätzung<br />
ergänzen sollen.<br />
Theorie <strong>und</strong> Praxis der Technologiefolgenabschätzung greifen nach unserer<br />
Auffassung in mindestens dreierlei Hinsicht zu kurz:<br />
— Sie interessiert sich wenig für die wechselseitige Artikulation wissenschaftlicher<br />
<strong>und</strong> technischer Entwicklungen (Verwissenschaftlichung<br />
von Technik/Technisierung von Wissenschaft). Moderne Technik isi zunächst<br />
großwissenschaftlich ermögüchte <strong>und</strong> gesicherte Substitution vorgef<strong>und</strong>ener<br />
stofflich-natürlicher Prozesse durch konstruierte Prozesse. Man<br />
kann also moderne Technik kaum verstehen, wenn man die Bedingungen<br />
der Produktion wissenschaftlichen Wissens ausblendet (Knorr-Cetina 1981,<br />
Shruns 1984). Anders gesagt: Die TA arbeitet mit einem verkürzten Technikbegriff.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
— Sie vernachlässigt die überbetrieblichen Formen, Strategien <strong>und</strong> Medien<br />
der Steuerung wissenschaftlich-technologischer Entwicklungen im Zusammenwirken<br />
<strong>und</strong> Gegeneinanderwirken politisch-administrativer, industrieller<br />
<strong>und</strong> wissenschaftlicher Akteure (Horwitch 1979; dagegen Keck 1985,<br />
LaPorte 1984). Damit läßt sie diejenigen sozialen Prozesse weitgehend<br />
außen vor, die den äußeren Schein eines Selbstlaufs der Technik zu allererst<br />
erzeugen.<br />
— Sie erfaßt kulturelle Implikationen technischer Entwicklungen nur ungenügend.<br />
Die Substitutionsleistungen technischer Systeme müssen kulturell<br />
angeeignet werden; das kann gelingen oder mißlingen. In Gestalt einer Akzeptanz-<br />
oder Akzeptabilitätsforschung ist die TA dieser Frage auf der<br />
Spur, aber man kann nicht sagen, sie hätte geeignete Konzepte erarbeitet<br />
für die Analyse alltäglicher Widerstände <strong>und</strong> öffentlicher Debatten (gegebenenfalls<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>r Diskurse), die dem Sinn, der Richtung, der Frage<br />
legitimer Kontrolle technischer Entwicklungen gelten (Bechmann &<br />
Wingert 1981, Douglas & Wildavsky 1982, Joerges u.a. 1985, Sachs 1985,<br />
Thompson 1983, Winner 1980, Wynne 1983).<br />
Ein weiterer Kritikpunkt kommt hinzu <strong>und</strong> bringt die genannten Defizite<br />
auf einen gemeinsamen Nenner: Technologiefolgenabschätzungen bleiben<br />
generell blind für die zeitlichen Verhältnisse der Technik<strong>entwicklung</strong>. Wie<br />
kommt es, daß einmal adoptierte technische Entwicklungslinien fast immer<br />
irreversibel sind? Wie kommt es, daß technische Entwicklungen gerechtfertigt<br />
werden können mit Bedürfnissen <strong>und</strong> Bewußtseinslagen, die mit Sicherheit<br />
von ihnen verändert werden? Wie kommt es, daß Probleme, die einer<br />
wachsenden Komplexität moderner Technik zugeschrieben werden, durch<br />
Techniken höherer Komplexität angegangen werden? Wie kommt es, <strong>und</strong><br />
was bedeutet es, daß zum selben Zeitpunkt, zu dem in den Labors von heute<br />
die entscheidenden Arbeiten für die Nachfolgetechnologien der Gentechnik<br />
gemacht werden, öffentliche Kontroversen sich an den Spätfolgen der<br />
Vorläufertechnologien entzünden? Wie interagieren verschiedene, aber zeitlich<br />
versetzte technische Entwicklungen?<br />
2. Vorschlag für einen vergleichenden Ansatz<br />
Eine Technikforschung, die über Technologiefolgenabschätzung hinausführt,<br />
sollte demnach mindestens zweierlei Dinge leisten:<br />
— Sie sollte sich auf zentrale <strong>gesellschaftliche</strong> <strong>und</strong> kulturelle Kategorien<br />
<strong>und</strong> Prozesse beziehen, von denen gesagt wurde, sie blieben in Technologiefolgenabschätzungen<br />
tendenziell ausgeblendet.<br />
— Sie sollte eine vergleichende Perspektive einnehmen, wobei der Vergleich<br />
sowohl auf Gemeinsamkeiten als auch auf Unterschiede zwischen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
verschiedenen wissenschaftlich-technischen Entwicklungsschüben abstellt.<br />
Am Beispiel der drei Technikfelder Kernenergie, Mikroelektronik <strong>und</strong> Gentechnologie<br />
wird im folgenden eine entsprechende Vorgehensweise skizziert<br />
<strong>und</strong> anhand einiger inhaltlicher Thesen erläutert.<br />
Zunächst zur Selektion zentraler Kategorien <strong>und</strong> Prozesse. Da eine ausgeführte<br />
Theorie wissenschaftlich-technischen Wandels, aus der Vergleichsgesichtspunkte<br />
für einzelne Technologien abzuleiten wären, nicht verfügbar<br />
ist, schlagen wir die Entwicklung eines einheitlichen Analyseschemas vor,<br />
das es erlaubt, Materialien zu verschiedenen Technik<strong>entwicklung</strong>en schrittweise<br />
aufzuarbeiten <strong>und</strong> zu interpretieren. Interpretationsleitend ist dabei<br />
die Frage nach der Steuerung wissenschaftlich-technischer Entwicklungen,<br />
d.h. die Vorstellung, daß tatsächliche Entwicklungen als Produkt „rationaler<br />
Projekte" unterschiedlicher <strong>gesellschaftliche</strong>r Akteure begriffen werden<br />
können. Ein solches Analyseschema ist noch keine Theorie, sondern ordnet<br />
lediglich bestimmte Beobachtungen einer Reihe von Analyseschritten zu,<br />
die an verschiedenen Stellen den Rückgriff auf ganz unterschiedliche theoretische<br />
Überlegungen möglich <strong>und</strong> erforderlich machen. Das Schema<br />
sieht im wesentlichen drei Analyseschritte <strong>und</strong> eine entsprechende Reihe<br />
von Vergleichen vor.<br />
Ein erster, eher beschreibender Schritt sollte in einer zeitlich (gegebenenfalls<br />
räumlichen) Anordnung wichtiger wissenschaftlich-technischindustrieller<br />
Entwicklungen bestehen. Wir unterscheiden dabei ganz konventionell<br />
zwischen den Bereichen Gr<strong>und</strong>lagenforschung; ingenieurmäßige<br />
Forschung <strong>und</strong> Entwicklung; erste industrielle Anwendung; breiter industrieller<br />
Einsatz; Ablösung durch neue Generationen technischer Systeme,<br />
gegebenenfalls Abschwung einer Technik. Am Beispiel der Kerntechnik<br />
hieße das also: Entwicklungen in der Kernphysik; Reaktorforschung <strong>und</strong><br />
Versuchsreaktoren; erste kommerzielle Nutzung; breiter Einsatz von Kernkraftwerken;<br />
Ablösung durch neue Reaktortypen. Dabei wird in keiner<br />
Weise eine strikte zeitliche Abfolge dieser Stufen unterstellt; es geht hier<br />
vielmehr um die zeitliche Spezifizierung mehr oder weniger parallel verlaufender<br />
Prozesse in diesen fünf (oder anderweitig zweckdienlich abgegrenzten)<br />
Bereichen. 1<br />
Dieser erste Schritt gilt primär der Analyse der spezifischen Substitutionsleistungen<br />
einer gegebenen technischen Entwicklung in natürlichen<br />
<strong>und</strong> in sozialen Systemen (siehe Abschnitt 3). Einfaches Beispiel: Ein Aufzug<br />
substituiert bestimmte Wege <strong>und</strong> körperliche Aktivitäten, Bauformen,<br />
die Kehrwoche, die Notwendigkeit, mit Nachbarn zu kommunizieren usw.<br />
durch eben Aufzugtechnik mit allem, was dazu gehört — etwa neuen baupolizeilichen<br />
Verordnungen, bestimmten Kommunikationsformen, Service-<br />
Organisationen, hohen statt flachen Bauformen usw.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Ein zweiter Schritt gilt der Analyse der beteiligten Akteure, ihrer Strategien<br />
<strong>und</strong> Rollen, der Arenen, in denen sie agieren, <strong>und</strong> der Konfigurationen<br />
<strong>und</strong> Konflikte, die sich ergeben im langen Verlauf einer mehr oder weniger<br />
erfolgreichen Durchsetzung <strong>und</strong> soziokulturellen Aneignung technischer<br />
Entwicklungen. Wir schlagen vor, auch diesem Schritt ein einfaches<br />
Klassifikationsschema zugr<strong>und</strong>e zu legen, in dem einerseits dominante, an<br />
der Durchsetzung einer gegebenen Technologie interessierte Akteure<br />
(Wissenschaft <strong>und</strong> Großforschung, Industrie <strong>und</strong> Betreiber, politisch-administrative<br />
Akteure), andererseits <strong>gesellschaftliche</strong> Mit- <strong>und</strong> Gegenspieler<br />
(organisierte Öffentlichkeit, soziale Bewegungen, kritische Wissenschaft)<br />
unterschieden werden. 2<br />
Dieser zweite Schritt gilt der Analyse einer Reihe von Prozessen (siehe<br />
Abschnitt 4): den Interessenlagen, Steuerungsmedien, Entscheidungs- <strong>und</strong><br />
Rechtfertigungsstrategien, Folgeerwartungen <strong>und</strong> Folgewahrnehmungen<br />
einzelner dominanter Akteure; den wechselnden Konstellationen, die sich<br />
zwischen ihnen ergeben; den Reaktionsformen bestimmter <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Gruppen <strong>und</strong> den Rückwirkungen auf das System dominanter Akteure;<br />
Prozessen der kulturellen Assimilation sozio-technischer Systeme (auch<br />
Abschnitt 6).<br />
Ein dritter Schritt ist in hohem Maß interpretativ <strong>und</strong> gilt der Rekonstruktion<br />
von Rationalitätsmustern, aus denen heraus tatsächliche Entwicklungen<br />
verständlich werden (siehe Abschnitte 5 <strong>und</strong> folgende). Unter Rationalitätsmuster<br />
werden hier die verschiedenen Deutungsmuster <strong>und</strong> Orientierungen<br />
verstanden, die dem Handeln verschiedener Akteure zugr<strong>und</strong>e<br />
liegen. So könnten etwa, mit Habermas <strong>und</strong> anderen, zweckrationale Handlungsmuster<br />
oder eine „instrumenteile Rationalität" von einem verständigungsorientierten<br />
Handeln <strong>und</strong> einer „kommunikativen Rationalität" unterschieden<br />
werden.<br />
Sodann zur Vergleichsperspektive. Wir haben bewußt drei zeitlich versetzte,<br />
sich überlagernde wissenschaftlich-technische Entwicklungen herausgegriffen:<br />
Kerntechnik, interpretiert als eine in den siebziger Jahren voll<br />
industrialisierte <strong>und</strong> konfliktgenerierende Technik (z.B. Radkau 1983;<br />
Roßnagel 1983); Mikroelektronik, interpretiert als eine Technik, die in<br />
den achtziger Jahren voll durchgesetzt sein <strong>und</strong> Konfliktstoff liefern<br />
wird (z.B. Friebe & Gerybadze 1984; Halfmann 1984; OECD 1981, 1982a);<br />
Gentechnologie, interpretiert als ein System, das in den neunziger Jahren<br />
auf breiter Front industrielle Anwendungen <strong>und</strong> Konfliktpotentiale zeugen<br />
wird (z.B. Nordhoff 1985; OECD 1982b).<br />
Der Versuch, diese drei Fälle vergleichend zu betrachten, soll sich an<br />
zwei Fragestellungen orientieren:<br />
— Wenn man die drei Technikfelder oder Technikschübe je gesondert ansieht,<br />
lassen sich dann charakteristische Gemeinsamkeiten einerseits,<br />
auffällige Unterschiede andererseits ausmachen?<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
— Wenn man die drei Technikfelder als Komponenten eines Gesamtprozesses<br />
auffaßt, läßt sich dann eine übergreifende Dynamik ausmachen?<br />
In Termini des Titels formuliert: Kommt es im Lauf der Zeit zu einer<br />
Verstärkung der Eigendynamik technischer Entwicklungen gegenüber<br />
Versuchen ihrer <strong>gesellschaftliche</strong>n Steuerung <strong>und</strong> Aneignung oder<br />
kommt es zu <strong>gesellschaftliche</strong>n Lernprozessen <strong>und</strong> zur Institutionalisierung<br />
öffentlicher Diskurse, damit vielleicht zu einem vernünftigeren<br />
Umgang mit einer augenscheinlich autonomen Technik<strong>entwicklung</strong>?<br />
3. Natürliche <strong>und</strong> soziale Substitutionsleistungen technischer Systeme<br />
Um die zeitliche Entwicklung technischer Systeme wissenschafts- <strong>und</strong> techniksoziologisch<br />
adäquat fassen zu können, schlagen wir also vor, zunächst<br />
die Geschichte ihrer natürlichen <strong>und</strong> sozialen Substitutionsleistungen (<strong>und</strong><br />
gegebenenfalls deren räumlicher Inzidenz) zu verfolgen. In äußerst verkürzter<br />
Form lassen sich die drei Technikfelder unter diesem Gesichtspunkt<br />
etwa folgendermaßen charakterisieren.<br />
In der Kerntechnik wird ein gewaltiger Schritt in Richtung eines Übergangs<br />
von der Nutzung in der Natur vorfindlicher Energieträger zur gezielten<br />
Konstruktion eines Energieträgers getan. Die Außerordentlichkeit dieses<br />
Vorgangs kann man sich daran klarmachen, daß er ausdrücklich verb<strong>und</strong>en<br />
wurde <strong>und</strong> wird mit der Vorstellung, zumindest in diesem Bereich<br />
könne es gelingen, ein an natürliche Knappheiten geb<strong>und</strong>enes Verteilungsproblem<br />
endgültig in ein Produktionsproblem zu überführen. In der Atomwirtschaft<br />
wird der Versuch unternommen, zahllose auf die Bereitstellung<br />
großer Energiequanten angewiesene Handlungskontexte weitgehend abzulösen<br />
von einer laufenden Brennstoffzufuhr aus vielen fossilen Energiequellen.<br />
Statt dessen wird in einem eigens dafür aufgebauten, äußerst komplexen<br />
Handlungsgefüge ein Energieträger konstruiert, industriell produziert<br />
<strong>und</strong> verwertet. In weit höherem Maß als in der Verwertung von öl<br />
oder Kohle wird in der verfügbaren Fissionstechnik, <strong>und</strong> zumal in Brüter<strong>und</strong><br />
möglicherweise bevorstehenden Fusionstechnologien, Naturgeschichte<br />
durch artifizielle Prozesse ersetzt — man kann auch sagen: durch ihre weitgehende<br />
Verwandlung in ein System von Artefakten wird Natur sozialisiert,<br />
in einem ganz bestimmten Sinn vergesellschaftet.<br />
Kerntechnik substituiert nicht nur natürliche (organische) Prozesse. Die<br />
produktionstechnischen Lösungen, die sie ermöglicht <strong>und</strong> erfordert, lassen<br />
zahlreiche menschliche Handlungssysteme entfallen oder verlegen sie in<br />
vorgefertigte kraftwerkstechnische Einrichtungen <strong>und</strong> Kontrollsysteme. In<br />
diesem Sinn werden menschliche Handlungssysteme durch materialisierte<br />
ersetzt. Theoretisch würde diese Entwicklung in der Schließung der Brennstoffkreisläufe<br />
in Form weitgehend integrierter <strong>und</strong> automatisierter Reaktor-<br />
<strong>und</strong> Wiederaufbereitungssysteme kulminieren, vorbereitet in der Idee<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
der „safeguards" <strong>und</strong> der „inhärenten Sicherheit" (Radkau 1963: 366ff.,<br />
369ff.).<br />
Doch der Prozeß ist offenbar nicht ab schließbar. Der Ausschluß natürlicher<br />
<strong>und</strong> sozialer Kontingenzen der <strong>gesellschaftliche</strong>n Bereitstellung von<br />
Energie erfordert den Anschluß an neue, umfassendere natürliche <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Bedingungen. Naturseitig werden zum Beispiel die natürlichen<br />
Wärmehaushalte systemrelevant oder das Problem, mit zusätzlicher<br />
radioaktiver Strahlung umzugehen. Handlungsseitig ist nun mit Faktoren zu<br />
rechnen wie der Wissenschaftsintensität des Ingenieursystems (Häfele 1963,<br />
1974), der Disziplinierbarkeit des Bedienungspersonals, der Organisierbarkeit<br />
<strong>und</strong> Finanzierbarkeit langfristiger interorganisationeller Großprojekte<br />
(LaPorte 1984), der Steuerungskapazität des politischen Systems (Keck<br />
1984, 1985), der Tragfähigkeit des bestehenden Rechts (Roßnagel 1983),<br />
der Fähigkeit zur kulturellen Reinterpretation augenscheinlich kontextfrei<br />
funktionierender Systeme von Großartefakten (Wynne 1983).<br />
Die kernenergietechnische Entwicklung bringt also zunehmend neue<br />
natürliche <strong>und</strong> soziale Kontingenzen ins Spiel, für deren Bearbeitung verfügbare<br />
kognitive, institutionelle <strong>und</strong> sozialaffektive Handlungsmuster nicht<br />
(oder noch nicht) ausreichen. Sie ist aus diesen Gründen an einem schwierigen<br />
Punkt ihrer Entwicklung angekommen; fraglich ist insbesondere der<br />
mögliche Übergang zur Brüter- oder Fusionstechnik. Es wäre aber unvorsichtig<br />
zu glauben, das kerntechnische Projekt sei an diesen Problemen<br />
endgültig gescheitert. Sofern bestimmte wissenschaftlich bereitzustellende<br />
Konstruktionspotentiale <strong>und</strong> gesellschaftlich — in Teilen vielleicht auch<br />
sozialwissenschaftlich — bereitzustellende Kontroll- <strong>und</strong> Verarbeitungspotentiale<br />
mobilisiert werden, kann es zu einem weiteren Ausbau kommen<br />
— wenn auch nicht unbedingt hierzulande (Collingridge 1984).<br />
Im Fall der Mikroelektronik haben wir es mit einem fortschreitenden<br />
Übergang von Prozessen der Informationsverarbeitung, die im Medium<br />
natürlicher Sprachen <strong>und</strong> dafür geeigneter stofflicher Träger bewerkstelligt<br />
werden, zu einer Verarbeitung im Medium maschinell realisierter artifizieller<br />
Sprachen <strong>und</strong> entsprechender Datenträger zu tun. Die vor allem formalwissenschaftlich<br />
zu leistende Entwicklung <strong>und</strong> Weiter<strong>entwicklung</strong> solcher<br />
Sprachen, ihre mikroelektronische Implementierung <strong>und</strong> die industrielle<br />
Produktion entsprechender Geräte bzw. Netze ermöglichen wiederum<br />
zweierlei: Auf der Seite der organischen Natur werden in wachsendem<br />
Umfang von menschlichen Organismen abzuwickelnde Informations<strong>und</strong><br />
Kommunikationsprozesse substituiert; auf der Handlungsseite werden<br />
Prozesse geistiger Arbeit <strong>und</strong> tradierter sozialer Kommunikation sowie eine<br />
Unzahl von organisatorischen Strukturen substituiert (z.B. Steinmüller<br />
1982).<br />
Prinzipiell wäre diese Technik abgeschlossen mit der Möglichkeit, hermeneutische<br />
Kommunikationsprozesse durch technische, d.h. auf maschinell<br />
implementierbaren Regeln basierende Kommunikation zu ersetzen.<br />
Vorläufig kulminiert die Entwicklung in der Konstruktion von Denkappara-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ten, die nicht nur fähig sind, eingegebene Informationen zu bearbeiten <strong>und</strong><br />
miteinander auszutauschen, sondern sie selbsttätig in einer Weise zu transformieren,<br />
die sie den Benutzern dieser Technik als neu, die Geräte in diesem<br />
Sinne als kreativ erscheinen läßt: Produktion künstlicher Intelligenz<br />
(Becker 1984; Rich 1983; Ritchie 1984). Äußerst kontrovers wird gegenwärtig<br />
diskutiert, ob — etwa mit der Entwicklung einer fünften Generation<br />
von Computern in Verbindung mit anstehenden Ergebnissen der Gehirnforschung<br />
— eine Stufe der Sy<strong>mb</strong>olverarbeitung zu erreichen ist, in der solche<br />
Systeme so etwas wie eine eigene Semantik erzeugen, quasi-intentionalen<br />
Charakter annehmen werden (in diesem Zusammenhang Dennett 1984).<br />
Worauf es uns hier ankommt, ist, daß die Substitutionsleistungen der<br />
Mikroelektronik in ähnlichen Kategorien gefaßt werden können, wie wir sie<br />
in der Analyse der Kernenergie <strong>und</strong> anschließend der Gentechnik verwenden:<br />
Mikroelektronik als eine Form der schrittweisen Ablösung bestimmter<br />
Handlungskontexte von natürlichen (organismischen) <strong>und</strong> gleichzeitig sozialen<br />
Kontingenzen. Wiederum setzt diese Entwicklung allerdings den Anschluß<br />
an weitere natürliche <strong>und</strong> soziale Kontingenzen voraus: Naturseitig<br />
kommen etwa neue organische Belastungen oder im Verb<strong>und</strong> mit biotechnischen<br />
Entwicklungen Interferenzen mit umfassenderen Ökosystemen ins<br />
Spiel; handlungsseitig ist dieser Prozeß beispielsweise durch soziale Krankheitsbilder<br />
wie die von Weizenbaum (1978) oder Turkle (1984) beschriebenen<br />
obsessiven <strong>und</strong> narzistischen Syndrome, oder die gesamte Problematik<br />
des „gläsernen Menschen" im öffentlichen <strong>und</strong> betrieblichen Bereich<br />
(Seltz 1984), oder die Verwandlung von Ingenieuren in Arbeiter in bestimmten<br />
Industrien, möglicherweise eine umfassende kulturelle Prägung<br />
durch die „Definitionsmacht" der Computertechnik (Bolter 1984) indiziert.<br />
Die anstehende Entwicklung macht eine Vielzahl neuer kognitiver,<br />
institutioneller <strong>und</strong> sozialaffektiver Zusatzleistungen erforderlich, die ihrerseits<br />
gegebenenfalls weitere Substitutionsprozesse ermöglichen.<br />
Im Fall der Gentechnologie wird die bisher übliche Selektion erwünschter<br />
Organismen aus einem vorgegebenen Pool ersetzt durch die Konstruktion<br />
<strong>und</strong> industrielle Produktion von Organismen. Am augenfälligsten<br />
3<br />
wird das in der Anwendung molekulargenetischer Verfahren zur Herstellung<br />
künstlicher Mikro-Organismen, die ihrerseits zur Produktion, Reduktion<br />
oder Veränderung zahlreicher Stoffe eingesetzt werden können. Organismen<br />
werden hier endgültig zu Artefakten. Molekulargenetiker <strong>und</strong> Biochemiker<br />
können nun „machen, was die Natur noch nicht gemacht hat". Damit<br />
ist die Biologie in die Phase einer „synthetischen" Wissenschaft (Winnacker<br />
1984: 58f.) eingetreten <strong>und</strong> erreicht ein technisches Niveau, wie es<br />
im Bereich der Chemie mit der Ablösung der Naturstoffchemie durch die<br />
Chemie der zyklischen Kohlenwasserstoffverbindungen im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert,<br />
zunächst in der technischen Synthese organischer Farben möglich<br />
wurde.<br />
Gentechnik würde prinzipiell in einer gezielten genetischen Umwandlung<br />
auch höherer Lebewesen kulminieren. Sollte es gelingen, molekularge-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
netische, zell- <strong>und</strong> <strong>entwicklung</strong>sbiologische Verfahren zur partiellen Rekonstruktion<br />
höherer Organismen — <strong>und</strong> letzten Endes von Menschen — einzusetzen,<br />
wird dabei ihr Anwendungsbereich weit über den der industriellen<br />
Produktion im engeren Sinn hinausgehen. Anfänge dieser Entwicklung sind<br />
in der Fortpflanzungsmedizin realisiert (Jüdes 1983; Hohlfeld 1984).<br />
Eine Charakterisierung der sozialen Substitutionsleistungen der Gentechnik<br />
ist bisher schwierig, weil ihre Anwendungsmöglichkeiten — ähnlich<br />
wie in der Mikroelektronik — äußerst vielfältig <strong>und</strong> offen sind. Anschaulich<br />
<strong>und</strong> gegenwärtig breit diskutiert sind die sozialen Substitutionsleistungen<br />
eines schnell wachsenden Angebots an technischen Lösungen im Vorfeld<br />
molekulargenetischer Technik für das Problem der Unfruchtbarkeit. Die<br />
,,biopsychosoziale Einheit" von Mutter- <strong>und</strong> Elternschaft wird durch die<br />
moderne Fortpflanzungsmedizin technisch in ihre Komponenten aufgelöst,<br />
Voraussetzung für fast beliebige menschliche Brutprogramme (Grobstein<br />
u.a. 1983). Die Fortschritte, die hier in der Auseinandersetzung mit einer<br />
widrigen Natur gemacht werden, suspendieren eine Vielzahl sozialer Orientierungen<br />
<strong>und</strong> Handlungsmuster bei allen Beteiligten: von den Eltern über<br />
Forscher <strong>und</strong> Ärzte, Rechtsanwälte, Richter, Gesetzgeber, Leihmütter <strong>und</strong><br />
Samenspender, bis zu den Kindern. Kulturell einigermaßen verbindliche<br />
affektiv-soziale Bezüge, institutionelle Regelungen <strong>und</strong> kognitive Orientierungen<br />
verlieren ihren Sinn <strong>und</strong> erfordern Ersatz (Benda 1984).<br />
Im Fall der Gentechnik käme man kaum auf die Idee, diese Prozesse<br />
seien technisch abschließbar, weder im Sinne einer abschließenden wissenschaftlich-technischen<br />
Kontrolle, etwa von Fortpflanzungsvorgängen, noch<br />
im Sinne einer widerstandslos hingenommenen sozialen <strong>und</strong> kulturellen<br />
Entleerung <strong>und</strong> Verödung. In der Gentechnik scheinen vielmehr schon in<br />
der Frühphase der Substitution relativ unkontrollierter organischer <strong>und</strong><br />
sozialer Prozesse eine Unzahl von neuen Widrigkeiten der Natur <strong>und</strong> sozialen<br />
Widerständigkeiten aufzutauchen. Entsprechend scheint diese Technologie<br />
schneller <strong>und</strong> auf breiterer Front neue Kontingenzen <strong>und</strong> Handlungsherausforderungen<br />
zu generieren als beispielsweise die Kerntechnik. Das gilt<br />
sowohl naturseitig, also im wissenschaftlich-ingenieurtechnischen „Zuständigkeitsbereich",<br />
als auch auf der Handlungsseite, also juristisch-gesetzgeberisch,<br />
politisch, ökonomisch, lebensweltlich — <strong>und</strong> damit im „Zuständigkeitsbereich"<br />
der Sozialwissenschaften.<br />
Diese wenigen Hinweise auf Inhalt <strong>und</strong> Richtung der Entwicklung in<br />
den drei Feldern müssen hier genügen. Mit der Vorstellung von natürlichen<br />
Substitutionsleistungen (Ablösung von natürlichen Kontingenzen) auf der<br />
Gr<strong>und</strong>lage konstruktiv-synthetisierend verfahrender Wissenschaften, von<br />
damit einhergehenden sozialen Substitutionsleistungen (Ablösung von<br />
sozialen Kontingenzen), von dadurch neu ins Spiel kommenden natürlichen<br />
wie sozialen Kontingenzen <strong>und</strong> entsprechenden neuen Handlungsanforderungen<br />
ist ein Technikbegriff umrissen, der sich, wie wir glauben, auf moderne<br />
wissenschaftlich-technische Entwicklungen ganz allgemein fruchtbar<br />
anwenden läßt.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
4. Prozesse der Steuerung wissenschaftlich-technisch-industrieller<br />
Entwicklungen<br />
Eine Beschreibung der Konstruktion <strong>und</strong> der natürlichen <strong>und</strong> sozialen Substitutionsleistungen<br />
bestimmter technischer Systeme ist zwar im Detail<br />
nicht möglich ohne Bezugnahme auf bestimmte soziale Akteure, sagt aber<br />
noch nicht viel über Prozesse der Steuerung, also der strategischen Organisation<br />
<strong>und</strong> Kontrolle wissenschaftlich-technischer Entwicklungen. Eine vorläufige<br />
Betrachtung der Interaktionsdynamik im System dominanter Akteure<br />
<strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong>r Gegenspieler ergibt folgende Hinweise für unsere<br />
drei Beispiele.<br />
Zunächst ist für alle drei Fälle festzustellen, daß im Bereich der Wissensproduktion<br />
die institutionelle Trennung von akademischer Forschung <strong>und</strong><br />
industrieller Forschung <strong>und</strong> Entwicklung effektiv aufgehoben ist. Es entstanden<br />
oder entstehen Großforschungskomplexe mit einem starken wissenschafts-<br />
<strong>und</strong> technikpolitischen Management, in denen es zu enger Zusammenarbeit<br />
<strong>und</strong> gegenseitigen Aushandlungsprozessen zwischen Akteuren<br />
aus dem Wissenschaftssystem, dem industriellen System <strong>und</strong> dem politischadministrativen<br />
System kommt (z.B. Prüß 1974; Keck 1984; Weinberg<br />
1970).<br />
Typischerweise wechselt die Führungsrolle in diesen quasi-korporatistischen<br />
Verbündeten über Zeit <strong>und</strong> von Technologie zu Technologie. So ist<br />
die kerntechnische Entwicklung in der B<strong>und</strong>esrepublik zunächst vom wissenschaftspolitischen<br />
Establishment in Zusammenarbeit mit staatlichen Bürokratien<br />
in Gang gebracht worden. Die Industrie, insbesondere die Energiewirtschaft,<br />
hat sich erst relativ spät <strong>und</strong> dann auch nur zögernd in die Entwicklung<br />
eingeschaltet <strong>und</strong> spielte im ganzen eher eine bremsende Rolle<br />
(Keck 1984; Radkau 1983).<br />
Bei der Mikroelektronik befinden sich, erst seit kurzem, Ansätze zu<br />
neuen Verb<strong>und</strong>systemen in Entstehung, in denen universitäre Wissenschaft,<br />
staatliche Großforschungseinrichtungen <strong>und</strong> Industrie zusammengeschlossen<br />
werden. (So zum Beispiel im Projekt „Entwicklung integrierter Schaltkreise",<br />
an dem 30 universitäre Lehrstühle, die Gesellschaft für Mathematik<br />
<strong>und</strong> Datenverarbeitung <strong>und</strong> Siemens beteiligt sind.)<br />
Bei der Gentechnologie erweisen sich sowohl die vom politischen<br />
System initiierten Großforschungseinrichtungen als auch industrielle <strong>und</strong><br />
akademische Hierarchien als zu starr, um Ergebnisse der Molekulargenetik<br />
<strong>und</strong> Gentechnologie für eine industrielle Modernisierung nutzbar zu machen.<br />
Gegenwärtig übernehmen offenbar auch hier bestimmte Forschungseliten<br />
die Führungsrolle in relativ durchlässig <strong>und</strong> flexibel in Form von<br />
„Technologieparks" organisierten Genzentren (Hack & Hack 1985). Dieser<br />
Vorgang ist zugleich mit einem stärkeren Engagement der Industrie <strong>und</strong><br />
einer geschickteren staatlichen Förderung verb<strong>und</strong>en als etwa im Fall der<br />
Kerntechnik.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Sodann läßt sich feststellen, daß andere, außerhalb dieser relativ geschlossenen<br />
wissenschaftlich-industriell-politischen Komplexe agierende<br />
Gruppen <strong>und</strong> Instanzen die Bühne der Auseinandersetzungen typischerweise<br />
erst spät betreten (Kitschelt 1980). Im pauschalen Vergleich scheint das<br />
im Fall der Kerntechnik sehr spät, in der Mikroelektronik bislang überhaupt<br />
nur bedingt, in der Gentechnologie relativ früh geschehen zu sein. Soweit<br />
<strong>gesellschaftliche</strong> Gegenspieler — repräsentiert vor allem in einem Teil der<br />
Medien, in mehr oder weniger organisierten sozialen Bewegungen <strong>und</strong> Initiativen<br />
kritischer Wissenschaftler — sich in die Debatten eingeschaltet<br />
haben, kam es allerdings bislang kaum zu einer effektiven Erweiterung der<br />
Entscheidungs- <strong>und</strong> Kontrollbasis (Nelkin 1977). Die Bedeutung öffentlicher<br />
Auseinandersetzungen lag eher darin, daß — in der Kernenergie sehr<br />
erfolgreich — ein erhöhter Legitimationsbedarf für technologiepolitische<br />
<strong>und</strong> unternehmerische Strategien angemeldet wurde, <strong>und</strong> zwar im Hinblick<br />
auf eine äußerst breite Palette naturseitiger <strong>und</strong> gesellschaftsseitiger Folgewirkungen.<br />
Sowohl Akteure im politisch-administrativen System wie in den<br />
betreffenden Industrien haben aus dieser typischen Ablaufstruktur gelernt<br />
<strong>und</strong> entwickeln heute für Teilbereiche der Informationstechnologie <strong>und</strong> der<br />
Molekularbiologie/Gentechnik Formen der Vorabproduktion von Legitimation.<br />
Der Zusammenschluß dominanter Akteure zu quasi-korporatistischen<br />
Komplexen erlaubt noch keine Rückschlüsse auf die Strategien, die von den<br />
beteiligten Akteuren verfolgt werden. Betrachtet man ihr Zusammenspiel<br />
im langen Verlauf, dann läßt sich für alle drei Fälle vermuten, daß keine der<br />
beteiligten Akteursgruppen durchgehend einen beherrschenden Einfluß<br />
nehmen konnte (z.B. Keck 1984; Mettler-Meibom 1983; Rammert 1982).<br />
Darüber hinaus kann man zeigen, daß keine dieser Gruppen sich durchgängig<br />
auf diejenigen Steuerungsmedien verläßt, auf deren Rationalität sie<br />
sich prinzipiell berufen (Meixner 1983). Weder läßt sich sagen, daß wissenschaftliche<br />
Instanzen nach Regeln einer autonomen wissenschaftlichen Forschung<br />
agieren (Borkenbus 1983), noch daß industrielle Instanzen sich<br />
allein an Marktverhältnissen orientieren, noch daß politisch-administrative<br />
Systeme sich vorwiegend auf parlamentarisch-administrativ-rechtliche Formen<br />
der Kontrolle stützen. Die Betrachtung der kerntechnischen Entwicklung<br />
legt den Schluß nahe, daß hier sowohl politisches System wie Wirtschaft<br />
<strong>und</strong> Wissenschaft, gemessen an ihren je eigenen Rationalitätskriterien,<br />
in der Steuerung einer technischen Entwicklung versagt haben (Kosolowski<br />
1983, in einer etwas anderen Interpretation Keck 1984b).<br />
5. Übergreifende Rationalitätsmuster?<br />
Mit dem bisherigen ist schon gesagt, daß es uns schwerfällt, in der Interaktion<br />
zwischen dominanten Akteuren der Technik<strong>entwicklung</strong> eine übergrei-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
fende, auf einem einheitlichen Rationalitätsmuster beruhende Strategie zu<br />
entdecken, die gelegentlich postuliert wird (Ullrich 1979). Zwar rechtfertigt<br />
die konstitutive Rolle des Wissenschaftssystems <strong>und</strong> die hochgradige institutionelle<br />
Verschränkung von Wissenschaft, Industrie <strong>und</strong> Politik die Rede<br />
von der Herausbildung wissenschaftlich-industriell-politischer Komplexe.<br />
Im Ergebnis verlaufen aber die Entwicklungen in den drei Technikfeldern<br />
weder planmäßig noch geradlinig. Die Analyse natürlicher <strong>und</strong> sozialer<br />
Substitutionsleistungen neuer Technologien ebenso wie die Analyse der<br />
Konfliktdynamik im System dominanter Akteure <strong>und</strong> im Verhältnis zu<br />
organisiertem <strong>gesellschaftliche</strong>m Protest machen diesen Bef<strong>und</strong> durchaus<br />
verständlich. Etwaige Zugewinne an strategischer Rationalität werden offenbar<br />
laufend wettgemacht durch neu auftretende Kontrollerfordernisse<br />
— sowohl auf der Ebene der Produktion von Wissenschaft <strong>und</strong> Ingenieurtechnik<br />
als auch der Legitimationsbeschaffung für industrielle <strong>und</strong> politische<br />
Projekte <strong>und</strong> der Bearbeitung lebensweltlicher Störungen.<br />
Es entsteht ein paradoxes Bild. Einem Defizit an gesamt<strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Rationalität <strong>und</strong> Rechtfertigungsstrategien steht ein im Detail fraglos<br />
erratischer, im Gesamtverlauf ebenso fraglos eigendynamischer <strong>und</strong> irreversibel-gerichteter<br />
Entwicklungsgang gegenüber. Die Weiterverfolgung der<br />
Kerntechnik, die Anstrengungen zur sozialen Installation von Informationstechnologien<br />
<strong>und</strong> zur Realisierung der Möglichkeiten einer „synthetischen<br />
Biologie", verb<strong>und</strong>en mit einem gegenüber den siebziger Jahren wiedererstarkten<br />
Glauben an Fortschritt <strong>und</strong> Wachstum, technische Machbarkeit<br />
<strong>und</strong> rationale Konfliktbewältigung, zeigen an, daß die Dynamik dieser<br />
Prozesse ungebrochen ist. Warum also wird das Projekt sukzessiver wissenschaftlich-technologischer<br />
Modernisierung dennoch durchgehalten <strong>und</strong> ertragen,<br />
wenn es doch kaum auf durchgängige Rechtfertigungsstrategien<br />
zurückgreifen kann <strong>und</strong> im langen Verlauf seiner Realisierung immer risikoreicher<br />
erscheint <strong>und</strong> kontroverser diskutiert wird? Wie hat man sich den<br />
Prozeß der <strong>gesellschaftliche</strong>n Durchsetzung neuer Technologien vorzustellen,<br />
wenn er nicht so sehr als Ergebnis rational handelnder Subjekte rekonstruierbar<br />
ist, sondern sich „hinter dem Rücken" der Akteure einzustellen<br />
scheint, durch die das „Dogma von der industriellen Vernunft" als verbindliches<br />
Deutungsmuster hochindustrialisierter Gesellschaften gleichsam „hindurchgreift"<br />
(Habermas 1982: 297 ff.)? Dieser Frage wollen wir im folgenden<br />
Abschnitt ein wenig nachgehen.<br />
6. Kulturelle Deutungen wissenschaftlich-technischer Entwicklungen<br />
Der enge Zusammenhang zwischen bestimmten technischen Innovationen<br />
<strong>und</strong> soziokulturellem Wandel ist vielfach untersucht worden. Man denke an<br />
die Schlüsselrolle, die Sozialhistoriker <strong>und</strong> Sozialtheoretiker so verschiedenen<br />
Techniken wie künstlichem Feuer, Pflug, Uhr, Steinaxt <strong>und</strong> Steigbügel,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Druckerpresse, mechanischen Webstuhl, Dampfmaschine, Auto, TV, Computer<br />
zugeschrieben haben. Man kann dabei unterscheiden zwischen für <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Wandel „wichtigen" Technologien <strong>und</strong> dem, was Bolter<br />
(1984) „definierende" Technologien nennt: Technologien, die in besonderer<br />
Weise „deutungsmächtig" sind, die umfassend in die Interpretationen<br />
sozialer <strong>und</strong> natürlicher Verhältnisse einer Gesellschaft eingreifen <strong>und</strong> selbst<br />
zu Metaphern erwünschter oder befürchteter gesamt<strong>gesellschaftliche</strong>r Entwicklungen<br />
werden. Wir haben solche Prozesse eingangs als mythenbildende<br />
Funktionen gerade der hier interessierenden Technologien apostrophiert.<br />
Welche Bedeutung könnte technischen Mythen <strong>und</strong> Gegenmythen für die<br />
langfristige Stabilisierung (oder DeStabilisierung) wissenschaftlich-technischer<br />
Entwicklungen zukommen? 4<br />
In technischen Mythen ist die soziale Realität einer Technik sy<strong>mb</strong>olisch<br />
repräsentiert; sie haben umfassend handlungsorientierenden Charakter <strong>und</strong><br />
sind bei jeder beteiligten Gruppe, ob dominanten oder marginalen Akteuren,<br />
ob Experten oder Laien, nachzuweisen (z.B. Cotgrove 1982). Sie ermöglichen<br />
eine drastische Reduktion vieler disparater Sinndeutungen, über<br />
Differenzen in der sozialen Struktur <strong>und</strong> im historischen Verlauf hinweg.<br />
Das ist möglich durch ihre Bildhaftigkeit <strong>und</strong> ihre einfache, oft binäre Kodierung:<br />
Technik erscheint als gut oder böse, bedeutet ewiges Feuer oder<br />
Weltenbrand, Superman oder Frankenstein, das Füllhorn der Ceres oder die<br />
schwarze Box der Pandora. s<br />
Der Wandel technischer Mythen <strong>und</strong> Gegenmythen im langen Verlauf<br />
der Entwicklung großer technischer Systeme ist nicht leicht zu rekonstruieren<br />
— Mythen kann man eigentlich nur nacherzählen. Am Fall der Kernenergie<br />
kann man ablesen, daß Mythen <strong>und</strong> Gegenmythen von den frühesten<br />
politisch-spekulativen Anfängen an in den Debatten präsent waren.<br />
Charakteristisch für das Frühstadium der Entwicklung waren ganzheitliche<br />
(aber relativ „techniknahe") Deutungen, normative Appelle <strong>und</strong>, unbeschadet<br />
mahnender Stimmen, eine insgesamt positive Zukunftsperspektive.<br />
Im weiteren Verlauf wurden dann die Anfangsmythen sukzessive abgewandelt<br />
<strong>und</strong> abgearbeitet. Emphatische Zukunftsbilder wurden demontiert<br />
<strong>und</strong> tauchten nun zum Teil als empirisch belegte Argumente auf. Im Zuge<br />
der Konkretisierung <strong>und</strong> sozialen Installation verschiedener technischer<br />
Varianten erwiesen sich ständig frühere Prophezeiungen <strong>und</strong> Erwartungen<br />
als unrealistisch oder überholt, <strong>und</strong> der Wechsel der Akteure <strong>und</strong> der Umstände<br />
erzwang einen häufigen Austausch von Legitimationsmustern. Diese<br />
Prozesse der Verwissenschaftlichung <strong>und</strong> Veralltäglichung von Ausgangsmythen,<br />
sowohl auf der Seite der Befürworter wie auf der Seite der Gegner<br />
der Kernenergie, in denen zunehmend auf empirische Evidenz <strong>und</strong> augenscheinlich<br />
rationale Bewertungsverfahren zurückgegriffen wurde, haben<br />
allerdings kaum zu einer Minderung der Konflikte um die Kernenergie<strong>entwicklung</strong><br />
beigetragen. Im Gegenteil, die Alternativität von Werthaltungen<br />
<strong>und</strong> zunehmend allgemein-<strong>gesellschaftliche</strong>n Deutungen trat besonders<br />
scharf hervor (dazu Del Sesto 1980; Wildavsky & Tenenbaum 1981; Wynne<br />
1982).<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Es stellt sich dann die Frage nach der Mächtigkeit <strong>und</strong> Funktion von<br />
technischen Gegenmythen. Zunächst kann man festhalten, daß nur ganz<br />
wenige Gruppen einfach die negative Seite der Anfangsmythen weiter ausbauen<br />
in Gestalt eines reinen Mythos vom „Leben ohne Technik". Gegenmythen<br />
dieser Art hat bisher vor allem die Auseinandersetzung mit der<br />
Kerntechnik hervorgebracht. Vielmehr kommt es typischerweise zur<br />
Ausarbeitung von Vorstellungen über ein „Leben mit anderer Technik"<br />
oder „Technik für ein anderes Leben", oder zu beidem.<br />
Sodann wird man sagen können, daß solche Gegenmythen von ganz erheblicher<br />
Bedeutung für die Herausbildung <strong>und</strong> Bündelung einer sozialen<br />
Identität in der Regel sehr disparater Gegenakteure sind. Das ist wiederum,<br />
in einem historisch einmaligen Ausmaß gerade in der B<strong>und</strong>esrepublik, am<br />
Beispiel der Antikernkraftbewegung abzulesen. Dieser Fall zeigt aber auch,<br />
daß Gegenmythen bislang kaum zur Herausbildung alternativer institutioneller<br />
Strukturen auf der Stufe der Wissens- <strong>und</strong> Technikproduktion geführt<br />
haben. Im Fall der Mikroelektronik <strong>und</strong> der Gentechnik dürfte das<br />
nicht anders sein. In der Auseinandersetzung um die Kerntechnik haben<br />
Gegenmythen also vor allem zu einer Verlangsamung <strong>und</strong>, im Zusammenspiel<br />
mit einer zeitweilig recht breiten Abkehr vom umfassenden Wachstumsmythos,<br />
zu einer (zeitweiligen) Blockierung bestimmter Projekte beigetragen.<br />
Die Funktion von Gegenmythen dürfte darüber hinaus in einer Kaschierung<br />
der Interessenlagen von im dominanten System strukturell schwach<br />
verankerten Akteuren liegen. Bemerkenswert ist, daß die Gegenmythen der<br />
Antikernkraftbewegung teilweise eine Verbindung mit Anfangsmythen im<br />
Bereich der Mikroelektronik <strong>und</strong> der Biotechnologie eingegangen sind. In<br />
Form einer „Technik für ein anderes Leben" werden diese Zukunftstechnologien<br />
als zumindest potentiell sanfte, gute Technik gedeutet <strong>und</strong> einer harten,<br />
bösen Kerntechnik gegenübergestellt (Wiesenthal 1982). 6<br />
7. Eine abschließende Überlegung zur übergreifenden Dynamik<br />
Die letzte Beobachtung führt hinüber zur Frage der Interaktionen zwischen<br />
den drei technischen Entwicklungslinien. Man kann, wie eingangs angedeutet,<br />
die Frage nach einer übergreifenden Dynamik sukzessiv sich überlagernder<br />
wissenschaftlich-technischer Schübe auf zweierlei Weise formulieren:<br />
Wird eine Weiterführung des Kurses der Moderne in Richtung einer progressiven<br />
„Rekonstruktion der äußeren, sozialen <strong>und</strong> inneren Natur des Menschen"<br />
stabilisiert durch die weitere Entwicklung quasi-korporatistischer<br />
Steuerungskomplexe, möglicherweise ultrastabilisiert durch technische<br />
Mythenbildung <strong>und</strong> teilweise durchaus funktionale Gegenmythen; oder lernen<br />
<strong>gesellschaftliche</strong> Kräfte, Teile der Öffentlichkeit, soziale Bewegungen,<br />
kritische Wissenschaft, ihre Einwände <strong>und</strong> Widerstände gegen einen solchen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Kurs zu institutionalisieren, strategischen Einfluß in Systemen dominanter<br />
Akteure zu gewinnen <strong>und</strong> andere kulturelle Deutungsmuster bis in das<br />
Kernsystem der Wissens- <strong>und</strong> Technikproduktion hineinzutragen?<br />
Manches spricht dafür, die erste Frage mit einem vorsichtigen Ja zu beantworten.<br />
Im Vergleich zur Kerntechnik scheint im Fall der Mikroelektronik<br />
<strong>und</strong>, ganz gezielt, im Fall der Gentechnik die Steuerung des Innovationstransfers<br />
zwischen Wissenschaftssystem <strong>und</strong> Produktionssystem flexibler<br />
<strong>und</strong> offener, die staatliche Katalysatorrolle effektiver organisiert zu<br />
werden. Das politisch-administrative System bemüht sich um die Installation<br />
von Frühwarnsystemen, Ansätze einer Technologiefolgenabschätzung<br />
setzen früher ein, sinnvollere institutionelle Arrangements für die Einbindung<br />
von Öffentlichkeit <strong>und</strong> kritischer Wissenschaft <strong>und</strong> damit Legitimationsbeschaffung<br />
sind zu beobachten (BMFT 1984a: 22-30).<br />
Die zweite Frage wäre also mit einem vorsichtigen Nein zu beantworten.<br />
Die Institutionalisierung von „Gegenmacht" aus der Öffentlichkeit, aus<br />
sozialen Bewegungen <strong>und</strong> aus einer kritischen Wissenschaft hat bislang nur<br />
im Ausstrahlungsbereich der Kerntechnik stattgef<strong>und</strong>en <strong>und</strong> ist insgesamt<br />
schwach geblieben. Die Installation mikroelektronischer Systeme <strong>und</strong> entsprechender<br />
Netze hat vorerst überhaupt nicht zu einer vergleichbaren breiten<br />
Ausarbeitung von Gegenmythen <strong>und</strong> Gegenstrategien geführt. Ein Teilbereich<br />
ist hier von den im System dominanter Akteure wohl verankerten<br />
Gewerkschaften okkupiert, die über erprobte Strategien der Konfliktbegrenzung<br />
<strong>und</strong> -austragung verfügen. Im Fall der Gentechnologie fällt eine<br />
Interpretation noch außerordentlich schwer. Der Stand der öffentlichen<br />
Diskurse <strong>und</strong> die Aufnahme einer parlamentarischen Debatte (Benda 1984;<br />
BMFT 1984b; Deutscher B<strong>und</strong>estag 1984a,b) zu einem Zeitpunkt, zu dem<br />
die industrielle Nutzung noch keine vollendeten Tatsachen geschaffen hat,<br />
könnte für einen <strong>gesellschaftliche</strong>n Lernprozeß sprechen, der über partielle<br />
Rationalitätsgewinne im System dominanter Akteure hinausgeht. Andererseits<br />
dürfte die Mannigfaltigkeit der zu erwartenden physischen <strong>und</strong> sozialen<br />
Risiken <strong>und</strong> die Diffusität der Folgewirkungen biotechnischer Entwicklungen<br />
eine Konzertierung der Gegenstimmen hier erheblich schwieriger<br />
machen als im Fall der Kernenergie.<br />
Insgesamt ist es wohl so, daß die Erfahrungen mit der Kernenergiedebatte<br />
einen gleichzeitig sensibilisierenden <strong>und</strong> kultivierenden Effekt für<br />
Folgedebatten gehabt haben. Kritische einzelne mikroelektronische, biotechnologische<br />
<strong>und</strong> -medizinische Entwicklungen werden allerorts schneller<br />
aufgenommen, während die Debatten insgesamt weniger polarisiert verlaufen.<br />
Es wäre verfrüht, aus diesen Überlegungen zu einer vergleichenden<br />
Technikanalyse ein Resümee zu ziehen. Immerhin scheint uns die Abfolge<br />
von Kerntechnik, Mikroelektronik <strong>und</strong> Gentechnologie zu zeigen, daß im<br />
Bereich der Technik<strong>entwicklung</strong> keine Auflösung von „mythischen Gestalten<br />
in Vernunftwahrheiten" geschieht. Die Komplexität der Verhältnisse<br />
erlaubt es nicht, den Gang der Entwicklung so zu denken, als folge nach<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
einer Epoche des mythisch-verklärten technischen Fortschritts ein Zeitalter<br />
des vernünftigen Umgangs mit Technik. Der Mythos von einer rationalen<br />
Technik im Sinne der möglichen <strong>und</strong> legitimen Substitution vorgef<strong>und</strong>ener<br />
Natur durch konstruierte <strong>und</strong> industriell produzierte Natur ist zentral im<br />
kulturellen System moderner Gesellschaften (dazu Lenk 1982). Auf dieser<br />
Folie treiben zu mächtigen Komplexen zusammengeschlossene wissenschaftlich-industriell-politische<br />
Akteure erratisch, aber irreversibel entsprechende<br />
Projekte voran. Die partiellen <strong>und</strong> widersprüchlichen Rationalitätsmuster<br />
dieser Akteure scheinen dabei stets hinter den neuen Kontrollerfordernissen,<br />
die ihre Projekte schaffen, zurückzubleiben. Und es könnte dieser<br />
mehr oder weniger große, mehr oder weniger disproportional wachsende<br />
Überschuß an Kontrollerfordernissen sein, der die Dynamik der Entwicklung<br />
maßgeblich speist.<br />
So gesehen paßt das vielgebrauchte Bild im Titel dieses Beitrags nicht<br />
so recht. Die technische Entwicklung ist nicht eingespannt zwischen eine<br />
geheimnisvolle Eigendynamik <strong>und</strong> einen öffentlichen Diskurs. Sie ist vielmehr<br />
durch mehrere Eigendynamismen gekennzeichnet: Eine Eigendyna<br />
7<br />
mik der Beantwortung neuer naturwissenschaftlich-ingenieurtechnischer<br />
Kontrollprobleme durch mehr Naturwissenschaft <strong>und</strong> Ingenieurtechnik;<br />
eine Eigendynamik der Beantwortung soziokultureller Störungen <strong>und</strong> Enteignungen<br />
durch diskursive Prozesse, durch Etablierung von Widerstand<br />
<strong>und</strong> U<strong>mb</strong>au kultureller Deutungsmuster; eine Eigendynamik schließlich<br />
der Beantwortung von Legitimationsverlusten, Machtverlusten, Verlusten<br />
an Wettbewerbspositionen <strong>und</strong> Kontrolle über Ressourcen durch die<br />
Herausbildung institutioneller Superstrukturen in den Systemen dominanter<br />
Akteure.<br />
ANMERKUNGEN<br />
1 Die Beobachtung ist sicher zutreffend, daß die institutionelle Trennung von Gr<strong>und</strong>lagenforschung<br />
<strong>und</strong> ihrer industriellen Anwendung weitgehend aufgehoben ist (vgl.<br />
z.B. Hack & Hack 1985, auch weiter unten in diesem Beitrag). Das kann jedoch<br />
nicht darüber hinwegtäuschen, daß systematische Unterschiede bestehen bleiben,<br />
wie sich leicht an der zeitlichen Rekonstruktion des theoretischen Vorlaufs industrieller<br />
Forschung <strong>und</strong> Entwicklung zeigen läßt (Böhme, van den Daele, Hohlfeld<br />
1979). In der Kernenergie wurden die Gr<strong>und</strong>lagen ihrer Nutzung in den dreißiger<br />
<strong>und</strong> vierziger Jahren gelegt, in der Mikroelektronik, was die formalwissenschaftliche<br />
Seite angeht, wohl in den vierziger Jahren, in der Gentechnologie zwischen 1953<br />
<strong>und</strong> 1973. Die institutionelle Aufhebung der Trennung mag vielmehr u.a. ein Indikator<br />
dafür sein, daß in immer mehr Bereichen der Naturbeherrschung die „gr<strong>und</strong>legende<br />
Arbeit" getan ist, jedenfalls in den Bereichen, in denen industrielle Nutzungen<br />
absehbar sind.<br />
2 Der hier verwendete Technikbegriff rückt <strong>gesellschaftliche</strong> Akteure, Arenen <strong>und</strong><br />
Konflikte ins Zentrum der Technikanalyse. Er grenzt sich sowohl von kausalen wie<br />
von finalen Technikbegriffen ab, in denen Technik als nicht <strong>gesellschaftliche</strong> Sach-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
verhalte gefaßt wird, deren Sozialität sich erst in den sozialen Folgewirkungen<br />
der Anwendung von Technik zeigt. Vielmehr gehen wir vom systemischen Charakter<br />
der Technik aus: Technik nicht als eine Ansammlung isolierter Artefakte, sondern<br />
als ein System von Leistungen <strong>und</strong> Beziehungen, das durch strategisch handelnde<br />
<strong>gesellschaftliche</strong> Akteure erzeugt <strong>und</strong> durch divergierende Orientierungskomplexe<br />
bestimmt wird.<br />
3 Angesichts der relativen Neuheit dieser Technologie scheint es angebracht zu betonen,<br />
daß es sich bei der Gentechnologie, ebensowenig wie bei der Kerntechnik <strong>und</strong><br />
bei der Mikroelektronik, nicht um eine wissenschaftliche Disziplin handelt, die<br />
durch einen geschlossenen Gegenstandsbereich definiert werden kann (wie z.B. die<br />
Molekulargenetik (molekulare Prozesse <strong>und</strong> Strukturen der Vererbung bei Organismen)).<br />
Gentechnologie ist vielmehr ein Verfahren: die Neuko<strong>mb</strong>ination von beliebigem<br />
genetischen Material im Reagenzglas, das sog. Genspleißen. Gegenwärtige Brisanz<br />
<strong>und</strong> Bedeutung liegen darin, daß mit ihrer Hilfe bestimmte phylogenetische<br />
<strong>und</strong> ontogenetische Barrieren der Verfügbarkeit von Organismen überw<strong>und</strong>en werden<br />
können. „Playing God" ist die damit mögliche Konstruktion bzw. Rekonstruktion<br />
der genetischen Basis von Leben plastisch genannt worden. Will man diese<br />
Technik bewerten, muß deshalb die Gentechnologie immer im Zusammenhang mit<br />
den Phänomenbereichen betrachtet werden, die mit ihrer Hilfe beherrschbar gemacht<br />
werden sollen, z.B. im Zusammenhang mit der Weiter<strong>entwicklung</strong> herkömmlicher<br />
biotechnologischer Verfahren oder der Erweiterung humangenetischer<br />
Diagnostik oder der Korrektur befruchteter Eizellen in der „Kei<strong>mb</strong>ahntherapie".<br />
4 Wenn wir von Mythos sprechen, ist damit keine einfache Opposition von „Logos<br />
<strong>und</strong> Mythos" gemeint, etwa in dem Sinn, daß der rationalen Technik ein Alltagsmythos<br />
der Technik gegenübergestellt wird. Vielmehr wäre gerade die Verschränkung<br />
von Mythos <strong>und</strong> Vernunft aufzuzeigen. Dem Mythos selbst ist Vernunft nicht<br />
unverträglich, <strong>und</strong> die Vernunft kann selbst wieder mythisch werden. Die Komplexität<br />
dieses Verhältnisses läßt sich gerade an den technischen Mythen im Zusammenhang<br />
mit Kernenergie, Computer- <strong>und</strong> Gentechnik aufzeigen, beruhen sie doch<br />
zu einem guten Teil auf wissenschaftlichen Prognosen <strong>und</strong> diskursiven Strukturen,<br />
bei gleichzeitiger Überhöhung durch ganzheitlich-<strong>gesellschaftliche</strong> Deutungen der<br />
jeweiligen Technologien. (Zur Analyse des Mythos als semiologischem System vgl.<br />
sehr erhellend Barthes 1964: 85ff.).<br />
5 Wir erinnern an die Schlußfolgerung, die Max Weber aus seinen Analysen universeller<br />
Rationalisierungs- <strong>und</strong> Vergesellschaftungsprozesse als „Entzauberung der Welt"<br />
zieht: „Die alten vielen Götter, entzaubert <strong>und</strong> daher in Gestalt unpersönlicher<br />
Mächte, entsteigen ihren Gräbern, streben nach Gewalt über unser Leben <strong>und</strong> beginnen<br />
miteinander wieder ihren ewigen Kampf" (1968: 610). Technische Mythen,<br />
obwohl es sich schon um rationalisierte Deutungsmuster handelt, haben den Charakter<br />
„unpersönlicher Mächte", die den Prozeß der Technisierung mitsteuern. Ob<br />
man hier von der Paradoxie des Rationalisierungsprozesses insgesamt sprechen<br />
kann, wie das Schluchter (1979) im Anschluß an Weber tut, mag dahingestellt<br />
bleiben.<br />
6 Der Charme der Mikroelektronik hat „linke" <strong>und</strong> „grüne" Gruppierungen in beeindruckender<br />
Weise in seinen Bann gezogen. Ein schönes Beispiel ist Andre Gorz'<br />
(1981) postindustrialistischer <strong>und</strong> antiproduktionistischer Sozialismus.<br />
7 „Dis-kursus: Das ist ursprünglich die Tätigkeit des Hin- <strong>und</strong> Herlaufens, das ist<br />
Kommen <strong>und</strong> Gehen, 'Machenschaften', 'Ränkeschmieden'..." (R. Barthes).<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
LITERATUR<br />
Barkenbus, J.N., 1983: „Is Self-Regulation Possible?", Journal of Policy Analysis and<br />
Management 2, 576-588.<br />
Barthes, R., 1964: Mythos des Alltags, Frankfurt.<br />
Bechmann, G., <strong>und</strong> B. Wingert, 1981: „Technology Assessment als Rationalisierung<br />
technologiepolitischer Entwicklungen." In: J. Matthes (Hrsg.), Lebenswelt <strong>und</strong><br />
soziale Probleme, Frankfurt/New York, 314-328.<br />
Becker, B., 1984: „Wissen <strong>und</strong> Intelligenz in Computern." Frankfurter Hefte 9, 44-53.<br />
Benda, E., 1984: Erprobung der Menschenwürde am Beispiel der Humangenetik, Freiburg:<br />
Institut für öffentliches Recht.<br />
Böhme, G., W. van den Daele <strong>und</strong> R. Hohlfeld, 1978: „Finalisierung revisited". in:<br />
G. Böhme u.a. (Hg.), Die <strong>gesellschaftliche</strong> Orientierung des wissenschaftlichen Fortschritts,<br />
Frankfurt.<br />
Bolter, J.B., 1984: Turing's Man — Western Culture in the Computer Age, Duckworth.<br />
Der B<strong>und</strong>esminister für Forschung <strong>und</strong> Technologie, 1984a: B<strong>und</strong>esbericht Forschung<br />
1984, Bonn.<br />
Der B<strong>und</strong>esminister für Forschung <strong>und</strong> Technologie, 1984b: Ethische <strong>und</strong> rechtliche<br />
Probleme der Anwendung zellbiologischer <strong>und</strong> gentechnischer Methoden am Menschen,<br />
<strong>München</strong>.<br />
Collingridge, D., 1984: „Lessons of Nuclear Power". Energy Policy 12, 46-67, 189-200.<br />
Conrad, J. (Hrsg.), 1983: Gesellschaft, Technik <strong>und</strong> Risikopolitik, Berlin.<br />
Cotgrove, S., 1982: Catastrophe or Cornucopia — The Environment, Publics and the<br />
Future, Chichester/Sussex.<br />
Del Sesto, S.L., 1980: „Conflicting Ideologies of Nuclear Power. Congressional Testimony<br />
of Nuclear Reactor Safety." Public Policy 12, 39-70.<br />
Dennett, D.C., 1984: „Computer Models and the Mind — A View from the East Pole."<br />
Times Literary Supplement, Dece<strong>mb</strong>er 14, 1453f.<br />
Dertouzos, M.L., <strong>und</strong> J. Moses, 1980: The Computer Age — A Twenty Year View,<br />
Ca<strong>mb</strong>ridge, Mass.<br />
Deutscher B<strong>und</strong>estag, 1984a: Einsetzung einer Enquete-Kommission „Gentechnologie",<br />
Beschlußfassung <strong>und</strong> Bericht, Drucksache 10/1581;<br />
Deutscher B<strong>und</strong>estag, 1984b: Antwort der B<strong>und</strong>esregierung auf die große Anfrage der<br />
Abgeordneten Frau Dr. Hickel <strong>und</strong> der Fraktion Die Grünen, Drucksache 10/2199.<br />
Douglas, M., <strong>und</strong> A. Wildavsky, 1982: Risk and Culture, New York/London.<br />
Friebe, K.P., <strong>und</strong> A. Gerybadze (Hg.), 1984: Microelectronics in Western Europe — The<br />
Medium Term Perspective 1983-1987, Berlin.<br />
Gorz, A., 1980: Abschied vom Proletariat, Frankfurt.<br />
Grobstein, C, M. Flower <strong>und</strong> J. Mendeloff, 1983: „External Human Fertilization — An<br />
Evaluation of Policy". Science 222, 127-133.<br />
Habermas, J., 1969: Technik <strong>und</strong> Wissenschaft als „Ideologie", Frankfurt.<br />
Habermas, J., 1981: Theorie des kommunikativen Handelns, Band 2, Frankfurt.<br />
Hack, L., <strong>und</strong> J. Hack, 1985: „Brauchen wir einen neuen 'akademisch-industriellen<br />
Komplex'?" In: Technik <strong>und</strong> Gesellschaft, Jahrbuch 3, Frankfurt.<br />
Halfmann, J., 1984: Die Entstehung der Mikroelektronik — Zur Produktion technischen<br />
Fortschritts, Frankfurt/New York.<br />
Häfele, W., 1963: „Neuartige Wege naturwissenschaftlich-technischer Entwicklung". In:<br />
Forschung <strong>und</strong> Bildung, Schriftenreihe des BMWF 4, 17-38.<br />
Häfele, W., 1974: „Hypotheticality and the New Challenges — The Path Finder Role of<br />
Nuclear Energy." Minerva 12, 303-323.<br />
Hohlfeld, R., 1984: „Der Mensch als Objekt von Biotechnologie <strong>und</strong> biomedizinischer<br />
Forschung". Gewerkschaftliche Monatshefte <strong>35</strong>, 591-604.<br />
Horwitch, M., 1979: „Designing and Managing Large-Scale, Public-Private Technological<br />
Enterprises — A State of the Art Review". Technology in Society 1, 179-192.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Janshen, D., O. Keck <strong>und</strong> W.D. Webler (Hg.), 1981: Technischer <strong>und</strong> sozialer Wandel<br />
— Eine Herausforderung an die Sozialwissenschaft, Königstein/Taunus.<br />
Joerges, B., u.a., 1985: Technik im Alltag — Bericht über eine Kolloquienreihe. IIUG,<br />
Berlin.<br />
Johnston, R., 1984: „Controlling Technology — An Issue for the Social Studies of<br />
Science". Social Studies of Sciences 14, 97-113.<br />
Jüdes, U. (Hrsg.), 1983: In-vitro-Fertilisation and E<strong>mb</strong>ryo-transfer (Retortenbaby),<br />
Stuttgart.<br />
Keck, O., 1984: Der Schnelle Brüter. Eine Fallstudie über Entscheidungsprozesse in<br />
der Großtechnik, Frankfurt/New York.<br />
Keck, O., 1985: „Der naive Souverän: Uber das Verhältnis von Staat <strong>und</strong> Industrie in<br />
der Großtechnik". In: K. Meyer-Abich <strong>und</strong> R. Ueberhorst (Hg.), Ausgebrütet —<br />
Argumente zur Brutreaktorpolitik, Basel.<br />
Kitschelt, H., 1980: Kernenergiepolitik — Arena eines <strong>gesellschaftliche</strong>n Konflikts,<br />
Frankfurt/New York.<br />
Knorr-Cetina, K.D., 1981: The Manufacture of Knowledge, Oxford/New York.<br />
Kosolowski, P., 1983: „Markt- <strong>und</strong> Demokratieversagen?" Politische Vierteljahresschrift<br />
24, 166-187.<br />
von Kruedener, J., <strong>und</strong> K. von Schubert (Hg.), 1981: Technikfolgen <strong>und</strong> sozialer Wandel<br />
— Zur politischen Steuerbarkeit der Technik, Köln.<br />
LaPorte, T., 1984: „Technology as Sozial Organization." Institute of Governmental<br />
Studies, University of California, Studies in Public Organization 84-1.<br />
Lenk, H., 1982: „Technisierung der Ersten <strong>und</strong> Zweiten Natur? Zum Mythos der<br />
Machbarkeit der Natur." In: H. Lenk, Zur Sozialphilosophie der Technik, Frankfurt,<br />
249-296.<br />
Liao, T.T., <strong>und</strong> W.P. Darby, 1982: „Technology Assessment" Bulletin of Science,<br />
Technology and Society 2, 583-624.<br />
Meixner, H., 1983: „Die ökonomische Logik der Kernenergie". Jahrbuch für Sozialwissenschaft:<br />
34, 59-93.<br />
Mettler-Meibohm, B., 1983: „Breitbandkommunikation auf dem Marsch durch die Institutionen".<br />
In: Technik <strong>und</strong> Gesellschaft, Jahrbuch 2, Frankfurt, 13-39.<br />
Nelkin, D., 1977: „Technology and Public Policy". In: I. Spiegel-Rösing <strong>und</strong> D.J. de<br />
Solla Price (Hg.), Science, Technology and Society, London/Beverly Hills.<br />
Nordhoff, H.B., 1985: „Die Gentechnologie ist keine Wissenschaft, sondern eine universal<br />
einsetzbare Technik." In: U. Steger (Hrsg.), Die Herstellung der Natur, Bonn.<br />
OECD, 1981: Microelectronics, Robotics and Jobs, Paris.<br />
OECD, 1982a: Information Activities, Electronics and Telecommunication, Paris.<br />
OECD, 1982b: Biotechnology, International Trends and Perspectives, Paris.<br />
Paschen, H., K. Gresser <strong>und</strong> F. Conrad, 1978: Technology Assessment — Technologiefolgenabschätzung.<br />
Ziele, methodische <strong>und</strong> organisatorische Probleme, Anwendungen,<br />
Frankfurt.<br />
Prüß, K., 1974: Kernforschungspolitik in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland, Frankfurt.<br />
Radkau, J., 1983: Aufstieg <strong>und</strong> Krise der deutschen Atomwirtschaft, Ha<strong>mb</strong>urg.<br />
Rapp, F. (Hg.), 1982: Ideal <strong>und</strong> Wirklichkeit der Techniksteuerung, Düsseldorf.<br />
Rammert, W., 1982: „Soziotechnische Revolution: Sozialstruktureller Wandel <strong>und</strong> Strategien<br />
der Technisierung. Analytische Perspektiven einer Soziologie der Technik."<br />
In: R. Jokisch (Hg.), Technik<strong>soziologie</strong>, Frankfurt, 32-81.<br />
Rich, E., 1983: Artificial Intelligence, London/New York.<br />
Ritchie, D., 1984: Gehirn <strong>und</strong> Computer — Die Evolution einer neuen Intelligenz,<br />
Stuttgart.<br />
Ropohl, G., u.a., 1978: Maßstäbe der Technikbewertung, Düsseldorf.<br />
Roßnagel, A., 1983: Bedroht die Kernenergie unsere Freiheit? Das künftige Sicherheitssystem<br />
kerntechnischer Anlagen, <strong>München</strong>.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Schluchter, W., 1979: Die Entwicklung des okzidentalen Rationalismus — Eine Analyse<br />
von Max Webers Gesellschaftsgeschichte, Tübingen.<br />
Seltz, R., 1984: Neue betriebliche Machtressourcen <strong>und</strong> Wandel des Kontrollsystems<br />
durch elektronische Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnologien, Berlin.<br />
Shruns, W., 1984: „Scientific Speciality and Technical System." Social Studies of<br />
Sciences 14, 63-90.<br />
Sorge, A., 1984: „Vom wissenschaftlichen Dauerbrenner zum <strong>gesellschaftliche</strong>n Mythos:<br />
Mikroelektronik." Soziologische Revue, Sonderheft Arbeit, Technik, Betrieb,<br />
Gewerkschaft, 105-113.<br />
Steinmüller, W., 1982: Die Zweite industrielle Revolution hat eben begonnen — Uber<br />
die Technisierung der geistigen Arbeit." Kursbuch 66, 152-187.<br />
Tetens, H., 1982: „Was ist ein Naturgesetz?" Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie<br />
12, 70-83.<br />
Thompson, M., 1983: „Postscriptum: Eine kulturelle Vergleichsbasis." In: H. von Kunreuther<br />
<strong>und</strong> J. Linnerooth (Hg.), Risikoanalyse <strong>und</strong> politische Entscheidungsprozesse,<br />
Berlin/<strong>München</strong>.<br />
Turkle, S., 1984: „Die Wunschmaschine " — Vom Entstehen der Computerkultur,<br />
Reinbek.<br />
Ullrich, O., 1979: Technik <strong>und</strong> Herrschaft — Vom Hand-Werk zur verdinglichten Blockstruktur<br />
industrieller Produktion, Frankfurt.<br />
Weber, M., 1968: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen.<br />
Weinberg, A., 1970: Probleme der Großforschung, Frankfurt.<br />
Weizenbaum, J., 1978: Die Macht der Computer <strong>und</strong> die Ohnmacht der Vernunft,<br />
Frankfurt.<br />
Wiesenthal, H., 1982: „Alternative Technologien <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Alternativen."<br />
In: Jahrbuch Technik <strong>und</strong> Gesellschaft 1, 48-78.<br />
Wildavsky, A., <strong>und</strong> E. Tenenbaum, 1981: The Politics of Mistrust, Beverly Hills.<br />
Winnacker, E.L., 1984: Gene <strong>und</strong> Klone, Weinheim.<br />
Winner, L., 1980: „Do Artifacts have Politics?", Daedalus 109, 121-163.<br />
Wynne, B., 1975: „The Rhetoric of Consensus Politics — A Critical Review of Technology<br />
Assessment", Research Policy 4, 108-158.<br />
Wynne B., 1982: Rationality and Ritual: The Windscale Inquiry and Nuclear Decisions<br />
in Britain, British Society for the History of Sciences, Chalfont St. Giles.<br />
Wynne, B., 1983: „Technology as Cultural Process", Working Paper 83-118, International<br />
Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Kommentare zum Beitrag von<br />
Joerges, Bechmann, Hohlfeld<br />
TECHNOLOGIEENTWICKLUNG<br />
ÖFFENTLICHEM DISKURS<br />
ZWISCHEN EIGENDYNAMIK UND<br />
Hartmut<br />
Neuendorff<br />
Das vorgestellte Analyseschema beansprucht nicht, schon eine Theorie zu<br />
sein, trotz verschiedener theoretischer Anleihen, die in ihnen enthalten<br />
sind. Ich verzichte auf den Versuch, dem vorgeschlagenen Analyseraster<br />
eine implizit vorhandene theoretische Technikkonzeption nachzuweisen<br />
<strong>und</strong> beschränke mich auf einige Bemerkungen zu einer fehlenden Analyseebene<br />
in dem Vorschlag. Die Ausarbeitung dieser Leerstelle dürfte allerdings<br />
den theoretisch-konzeptuellen Überlegungen zur Erfassung von Technik<strong>entwicklung</strong><br />
eine etwas andere Richtung geben, die zugleich engere Anknüpfungspunkte<br />
zu Fragestellungen der Industrie<strong>soziologie</strong> eröffnet. In dieser<br />
Hinsicht scheint mir dann auch der aus den aufgezeigten Defiziten der bisherigen<br />
soziologischen Technikthematisierung entwickelte neue Technikbegriff<br />
selbst noch nicht umfassend genug, bzw. zu unbestimmt zu sein.<br />
Obwohl in dem Analyseschema unter der Rubrik: Akteure — Arenen —<br />
Strategien alle <strong>gesellschaftliche</strong>n Teilsysteme genannt werden, die mit der<br />
Entwicklung von Techniken positiv oder negativ zu tun haben (Wissenschaftssystem,<br />
Industrie <strong>und</strong> Betreiber, politisch administratives System,<br />
Öffentlichkeit, soziale Bewegungen, kritische Wissenschaft) werden diese<br />
Akteure <strong>und</strong> Arenen in ihren Konfigurationen, Interaktionsbeziehungen<br />
<strong>und</strong> Konflikten fast ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Steuerung<br />
<strong>und</strong> Kontrolle von technischen Entwicklungen gesehen.<br />
In dieser Blickrichtung wird m.E. aber schon analytisch unterstellt, daß<br />
Techniken tendenziell eigendynamisch sich entwicklen, wobei das Hauptaugenmerk<br />
der Soziologie dann dem Aufweis der Möglichkeiten ihrer Steuerung<br />
<strong>und</strong> Kontrolle zu gelten habe.<br />
Ausgeblendet oder zumindest für nicht primär entscheidend hält man in<br />
diesem analytischen Zugriff auf Technik die Frage, worin die besonderen<br />
Bedingungen <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong>n Organisationsformen der Erzeugung<br />
— also der Produktion — neuer Technologien bestehen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Das Neue bzw. die spezifische Differenz der hier verglichenen Technologien<br />
gegenüber früheren scheint mir nämlich nicht nur in ihren Wirkungen<br />
— den besonderen Substitutionsleistungen — sondern gerade auch in den<br />
neuartigen Strukturen ihrer Generierung zu liegen.<br />
Die Veränderungen in der Erzeugungsstruktur von neuen Technologien<br />
sind zwar angesprochen worden: Zum einen etwa mit den Verweisen auf<br />
die Durchbrechung des altehrwürdigen linearen Modells der Stufen technischer<br />
Entwicklung (von der Gr<strong>und</strong>lagenforschung bis zur Anwendung)<br />
durch Querverbindungen zwischen diesen Stufen, die vor allem in den<br />
Großforschungszentren „zielorientierter Forschung" systematisch organisationsstrukturell<br />
zu bewältigen sind. In die gleiche Richtung gehen auch<br />
die Hinweise auf relativ geschlossene „wissenschaftnch-industriell-politische<br />
Komplexe" bzw. auf „quasi korporatistische Komplexe zwischen<br />
Akteuren, deren Dominanz im Verlauf der Entwicklung einer Technik<br />
wechselt" oder auch der Verweis auf die Verwissenschaftlichung der Technik<br />
<strong>und</strong> die gegenläufige Technisierung der Wissenschaft.<br />
Ich halte es aber für notwendig, über die Analyse der neuen institutionellen<br />
Arrangements hinauszugehen <strong>und</strong> die Klärung der sich in diesem Zusammenhang<br />
vollziehenden neuen Produktions- <strong>und</strong> Arbeitsstrukturen zur<br />
Erzeugung von Techniken ins Zentrum zu rücken. Das dürfte m.E. auch<br />
dazu beitragen, die Frage nach den Rationalitätsmustern technischer Entwicklung<br />
neu zu beleuchten. Außerdem scheint mir mit den <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Formen der Erzeugung wissenschaftlichen <strong>und</strong> technischen Wissens<br />
auch die Analyseebene angegeben zu sein, von der her die Verbindung zu<br />
Fragestellungen der Gesell Schaftstheorie herzustellen wäre. Denn zur<br />
Klärung der <strong>gesellschaftliche</strong>n Strukturwandlungen <strong>und</strong> Entwicklungstendenzen<br />
gehört m.E. nach wie vor zentral die Analyse des Produktionssystems<br />
einer Gesellschaft, zu dem heute als integraler Bestandteil das<br />
Wissenschaftssystem gehört.<br />
Auf diese Ebene gesamt<strong>gesellschaftliche</strong>r Analyse zielt m.E. auch die<br />
das Produktionsproblem ins Zentrum rückende Rede von der Industrialisierung<br />
der Wissenschaft <strong>und</strong> der Verwissenschaftlichung der Industrie.<br />
Damit ist — zumindest in der Version, die L. Hack <strong>und</strong> I. Hack in ihrer<br />
Untersuchung über die „Wirklichkeit, die Wissen schafft" dieser doppelten<br />
Entwicklung gegeben haben — ein wechselseitiges Begründungsverhältnis<br />
gemeint in der Weise, daß „Strukturen der Industrialisierung", die genetisch<br />
<strong>und</strong> strukturell ihr Muster in der kapitalistisch organisierten Warenproduktion<br />
haben, heute das an die Besonderheit von wissenschaftlicher <strong>und</strong><br />
technischer Wissenserzeugung angepaßte <strong>und</strong> insofern das von der materiellen<br />
Produktion auch verschiedene Modell bilden, das zunehmend die Organisationsformen<br />
der Erzeugung von wissenschaftlichen <strong>und</strong> technischen<br />
Entwicklungen bestimmt.<br />
Die Zentralität dieses Wissens <strong>und</strong> nicht erst der Techniken ergibt sich<br />
gerade aus seiner konstitutiven Rolle für die technische <strong>und</strong> organisatorische<br />
Effektivierung kapitalistischer Warenproduktion. Die Industrialisie-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ung der Wissensproduktion — nicht nur in der Industrieforschung, sondern<br />
auch in den Organisationen der Großforschung <strong>und</strong> tendenziell auch in der<br />
Hochschulforschung — besteht also in der Entwicklung von Organisationsformen,<br />
die Ökonomisierungszwängen gerecht werden müssen, die sich in<br />
der Warenproduktion immer schon geltend gemacht haben.<br />
Der allzu knappe Hinweis auf das wechselseitige Bedingungsverhältnis<br />
von Industrialisierung der Wissenschaft <strong>und</strong> Verwissenschaftlichung der<br />
Industrie kann zu einer instrumentalistischen Mißdeutung im Sinne der<br />
1<br />
kruden Handlangertheorie „das Kapital steuert die Wissenschaft" führen.<br />
Eine solche Interpretation wäre jedoch von vorneherein nicht nur verkürzt,<br />
sondern sachlich falsch. Denn die empirisch <strong>und</strong> theoretisch-kategorial<br />
zugleich zu vollziehende Ausarbeitung dieses wechselseitigen Bedingungsverhältnisses<br />
setzt ja geradezu voraus, daß die Herstellung von wissenschaftlichem<br />
<strong>und</strong> technischem Wissen in seiner kognitiven Struktur <strong>und</strong> gemäß<br />
den Rationalitätsmustern der dazu erforderlichen Organisations- <strong>und</strong><br />
Handlungsstrukturen eine gegenüber den Rationalitätsstrukturen kapitalistischer<br />
Warenproduktion verschiedene Sache darstellt. Unter Beachtung<br />
der sachlichen Verschiedenheit von Wissenserzeugung <strong>und</strong> Warenproduktion<br />
gleichwohl eine Ebene der Begriffsbildung auszuarbeiten, auf der auch<br />
die strukturellen Gemeinsamkeiten in dem gleichzeitig sich vollziehenden<br />
Prozeß der Industrialisierung der Wissenschaft <strong>und</strong> der Verwissenschaftlichung<br />
der Industrie erfaßt werden können, scheint mir die vordringliche<br />
Aufgabe zu sein, wenn man den Prozeß der technischen Entwicklung<br />
im Gegenwartskapitalismus — also die sich fortsetzende kapitalistische<br />
Industrialisierung — verstehen will, um dann auch die Grenzen <strong>und</strong> Möglichkeiten<br />
seiner Kontrolle <strong>und</strong> Steuerung zu klären.<br />
Dazu ist wohl auch die enge Kooperation von Wissenschafts- <strong>und</strong> Industrie<strong>soziologie</strong><br />
notwendig, <strong>und</strong> dies dürfte auch den Abschied von tradierten<br />
<strong>und</strong> liebgewonnenen Vorstellungen in beiden Disziplinen über das notwendig<br />
machen, was die sozialen Strukturen der Wissenserzeugung einerseits<br />
<strong>und</strong> die Produktions- <strong>und</strong> Arbeitsstrukturen kapitalistischer Warenproduktion<br />
andererseits sind.<br />
LITERATUR<br />
L. Hack, I. Hack: Die Wirklichkeit, die Wissen schafft. Zum wechselseitigen Begründungsverhältnis<br />
von 'Verwissenschaftlichung der Industrie <strong>und</strong> Industrialisierung<br />
der Wissenschaft', Frankfurt/M. 1985.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
DEFIZITE DER TECHNIKSOZIOLOGIE<br />
Walther Ch. Zimmerli<br />
Die Überlegungen des vorhergehenden Beitrags gehen aus von „Defiziten<br />
der Technologiefolgenabschätzung". Krugs enzyklopädisch-philosophisches<br />
Lexikon verzeichnet im 1832 erschienenen ersten Band der 2., verbesserten<br />
<strong>und</strong> vermehrten Auflage, daß „Defect oder Deficit (von deficere,<br />
mangeln)" „ein Mangelndes oder Fehlendes" sei, „das sich nicht bloß in<br />
Cassen <strong>und</strong> Rechnungen, sondern auch in Wissenschaften, mithin auch in<br />
der Philosophie zeigen kann". Der Artikel endet allerdings mit der versöhnlichen<br />
Bemerkung, daß „übrigens ... das Deficit in allen Wissenschaften unvermeidlich"<br />
sei, „weil sie alle dem beschränkten Menschengeiste ihr Dasein<br />
verdanken <strong>und</strong> daher immerfort ergänzt werden müssen" (Krug 1832 I,<br />
567). Insofern <strong>und</strong> in diesem versöhnlichen Sinne liegt mir daran, von philosophischer<br />
Seite her einige der Defizite des von Herrn Joerges vorgelegten<br />
Forschungsprogrammes zu benennen <strong>und</strong> zu diskutieren.<br />
Beginnen möchte ich mit einem — allerdings auch dem einzigen — Satz,<br />
dem ich vollkommen zuzustimmen vermag: Bei den thematischen Technologien,<br />
sagen die Autoren, sei die wissenschaftlich-technische Wissensproduktion<br />
so organisiert worden, „daß die institutionelle Trennung wissenschaftlicher<br />
Gr<strong>und</strong>lagenforschung, angewandter Forschung <strong>und</strong> industrieller<br />
Forschung <strong>und</strong> Entwicklung effektiv aufgehoben ist". Dies trifft zur Kennzeichnung<br />
der gegenwärtigen Wissenschafts- <strong>und</strong> Techniksituation fraglos<br />
zu, — allerdings nur von Seiten der Wissenschaft. Hier ist es weder sinnvoll<br />
noch faktisch der Fall, daß eine abgeschottete Gr<strong>und</strong>lagenforschung des älteren<br />
Typs weitergeführt würde. Wissenschaftliche Innovationen geschehen<br />
vielmehr sowohl in der Kernfissionstechnologie als auch in der Informations-<br />
<strong>und</strong> der Biotechnologie auf dem Wege der Ausbreitung <strong>und</strong> Distribution<br />
des Wissens im immediaten Bezug zur industriellen Anwendung. Umgekehrt<br />
aber bedarf die industrielle Nutzung einer eimal implementierten<br />
Technologie nicht zwingend der Begleitung oder gar der Durchdringung der<br />
Wissenschaft.<br />
Mit dieser so korrigierten Gr<strong>und</strong>einsicht gehen jedoch die meisten Überlegungen<br />
des vorgelegten Papiers nicht konform, <strong>und</strong> daran lassen sich die<br />
meisten Defizite dieses Ansatzes festmachen, deren gemeinsame Quelle<br />
m.E. in der mangelnden historischen Differenzierung liegt. Die Autoren haben,<br />
wie ich meine, den epochalen Charakter unterschätzt, den der Schritt<br />
zur Informations- <strong>und</strong> zur neuen Biotechnologie unter Einschluß der Gentechnologie<br />
bedeutet. Ich will dies in einer ersten These so formulieren:<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Obwohl sich in gewissen Bereichen sicher Ähnlichkeiten feststellen lassen,<br />
krankt der Vergleich der drei genannten Technologien an deren<br />
technologietheoretischer Ungleichzeitigkeit. Während die Kerntechnik<br />
(oder wie ich lieber sage: Kernfissionstechnologie) im Prinzip energietechnisch<br />
traditionell verfährt, handelt es sich bei der Mikroelektronik<br />
(ich sage lieber: Informationstechnologie) <strong>und</strong> der Gentechnik (ich sage<br />
allgemeiner: Biotechnologie) um sogenannte 'reflexive Technologien'.<br />
Mit diesen beiden Technologien ist eine qualitativ neue Stufe mit qualitativ<br />
neuen Problemen erreicht.<br />
Diese These bedarf des Kommentars. Die von Herrn Joerges <strong>und</strong> seinen<br />
Ko-Autoren namhaft gemachten Kennzeichnungen der Kernfissionstechnologie<br />
treffen, sieht man genauer zu, allesamt auch auf jede traditionelle<br />
Energietechnologie der zweiten Stufe zu. Mit 'Energietechnologie der zweiten<br />
Stufe' ist jener Typ von Technologie gemeint, bei dem mindestens zwei<br />
Umwandlungsschritte nötig sind: Heizen durch Verbrennen von Holz ist<br />
eine Energietechnologie erster Stufe, während Heizen durch Verbrennen<br />
von Holz zur Erzeugung von warmem Wasser, das die Heizkörper füllt, eine<br />
Energietechnologie zweiter Stufe ist, ebenso natürlich alle Wasserdampftechnologien<br />
<strong>und</strong> so auch die Kernfissionstechnologie. Zwar trifft zu, daß,<br />
wie die Autoren sagen, „diese wissenschaftlich-technische Leistung im<br />
energetischen Bereich Naturgeschichte durch einen artifiziellen Prozeß"<br />
ersetzt, aber dies trifft für jede andere zweitstufige Energietechnologie auch<br />
zu. Und daraus gar zu folgern, daß „Natur in ihrer Funktion als Energiereservoir<br />
... durch ihre Umwandlung in ein System von Artefakten sozialisiert,<br />
vergesellschaftet" werde, halte ich entweder für trivial oder aber für<br />
betriebsblind. Ebenso trifft nicht zu, daß in einer qualitativ verändernden<br />
Art <strong>und</strong> Weise durch die Kernfissionstechnologie „eine große Zahl menschlicher<br />
Handlungssysteme substituiert bzw. obsolet" würden, vielmehr wird<br />
durch die industrielle Nutzung der Kernfissionstechnologie nur die Zahl<br />
der in diesen Handlungssystemen Tätigen drastisch reduziert.<br />
Ganz anders verhält es sich indessen bei der Informationstechnologie,<br />
deren Thematisierung in dem vorliegenden Konzept erstaunlich knapp,<br />
kurz <strong>und</strong> materialiter inadäquat erfolgt. Man geht meiner Einschätzung<br />
zufolge wohl kaum zu weit, wenn man in dieser Technologie eine sowohl<br />
qualitativ als auch quantitativ umwälzende Änderung unseres ganzen<br />
Systems erblickt. Walther Helberg hat bereits 1962 die Differenz zwischen<br />
klassischer Technik <strong>und</strong> nichtklassischer Ausweitung derselben weit vorausblickend<br />
formuliert:<br />
„Die bisherige Erfahrung hat ... erwiesen, daß die zuerst in Anlehnung an die Mechanik<br />
gegebene klassische Charakterisierung der Technik zu eng geworden ist. Technik ist<br />
mehr als nur herstellender <strong>und</strong> gebrauchender Umgang mit Gegenständen. Technik wird<br />
heute als Umwandlung <strong>und</strong> Veränderung von vorgef<strong>und</strong>enen oder vorgegebenen Daten<br />
sehr verschiedener Art erfahren." (Helberg 1962, 15 7).<br />
Während jede andere Technik zwar in der Tat auch jene menschlichen Leistungen,<br />
die sie ersetzt (Organprojektionsthese Kapp 1877), übertrifft,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
leibt aber immer noch die intellektuelle Steuer- <strong>und</strong> Kontrollfunktion im<br />
Besitz <strong>und</strong> im Griff des Menschen. Die Informationstechnologie ersetzt nun<br />
aber eben die Steuer- <strong>und</strong> Kontrollkapazität selbst. Sie ist deswegen eine<br />
wesentlich reflexive Technik, <strong>und</strong> seit es sie gibt, <strong>und</strong> seit sie in alle anderen<br />
Techniken hineindiff<strong>und</strong>iert, macht es keinen Sinn mehr, die eingangs angeführte<br />
Differenz zwischen reiner theoretischer Gr<strong>und</strong>lagenforschung, angewandter<br />
Forschung <strong>und</strong> Entwicklung zu machen, da alle diese Bereiche dadurch<br />
geeint sind, daß sie informationstechnologievermittelt sind. Insofern<br />
sprechen wir seither — <strong>und</strong> zwar mit Recht — nicht mehr schlicht von<br />
'Technik', sondern von 'Technologie'. Der epochale Wandel, von dem die<br />
Rede war, besteht also im Wandel vom wissenschaftlich-technischen zum<br />
technologischen (von anderen auch als 'technetronisch' bezeichneten) Zeitalter.<br />
Die Durchsetzung dieser Sorte von Technologie bedarf keiner Lobby,<br />
<strong>und</strong> es ist nicht verw<strong>und</strong>erlich, daß die Proteste gegen sie eine andere <strong>und</strong><br />
viel kleinere Dimension haben als diejenigen gegen die Kernenergie. Kurz:<br />
Ich denke, daß die im Kontext der Informationstechnologie sich ergebenden<br />
Probleme die wichtigsten Gegenstände einer wissenschafts- <strong>und</strong> technikforscherischen<br />
Aktivität der Sektion Wissenschaftsforschung in den<br />
nächsten Jahren sein sollten.<br />
Und die gentechnologisch arbeitende Biotechnologie? — Zum einen halte<br />
ich es für eine Engführung des Papiers, wenn es sich hier auf die Gentechnik<br />
beschränkt, zumal im engeren Sinne mit 'Gentechnik' stets vor allem<br />
die Humananwendung, genauer noch: die Humananwendung durch Gentransfer<br />
in Kei<strong>mb</strong>ahnzellen assoziiert wird. Und dabei handelt es sich nun<br />
keinesfalls um eine mit der Informationstechnologie vergleichbare, wirtschaftlich<br />
angewendete, industriell genutzte Technologie. Vielmehr muß in<br />
den Vergleich die industriell bereits breit genutzte Enzy<strong>mb</strong>iotechnologie<br />
einbezogen werden. Zum anderen aber sollte man sich nicht durch die hohe<br />
Publizität, die die Gentechnologie derzeit aufgr<strong>und</strong> der Notwendigkeit einer<br />
politischen Regulierung des Umgangs mit ihr hat, dazu verleiten lassen, das<br />
Augenmerk auf die falschen Elemente zu richten. Zwar trifft zu, daß die<br />
gentechnologisch arbeitende Enzy<strong>mb</strong>iotechnologie eine in dem Sinne reflexive<br />
Technologie ist, daß die sonst immer nur vorausgesetzte Naturbasis,<br />
mit der von der Käsezubereitung bis hin zur Waschmittelproduktion gearbeitet<br />
werden mußte, selbst zum möglichen Gegenstandsbereich des technologischen<br />
Umwandlungseingriffes des Menschen wird. Aber es sind gerade<br />
nicht jene Sektoren, die den Mythos der Gentechnologie ausmachen, sondern<br />
dort geht es um die Humananwendung. Der hier zu erwartende <strong>und</strong><br />
sich bereits formierende Protest der öffentlichen Meinung richtet sich daher<br />
gegen etwas ganz anderes als die zu untersuchende Technologie. Auch hier<br />
müßte genauer differenziert werden. Und letztlich handelt es sich — bei genauerem<br />
Zusehen — auch bei der gentechnologisch arbeitenden Biotechnologie<br />
um eine von ihrem Theorieansatz her informationstechnologisch<br />
geprägte Technologie. — Aber dies nur nebenbei.<br />
Soviel zu den Defiziten der Gegenstandsbereichswahl. Ein weiteres, in<br />
meinen Augen entscheidendes Defizit ergibt sich aus dem Entwickelten für<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
den theoretisch-methodologischen Gr<strong>und</strong>ansatz. Abgesehen davon, daß die<br />
Kritik an den vorliegenden theoretischen Konzepten der Technikfolgenabschätzung<br />
sehr pauschal <strong>und</strong> im einzelnen unzutreffend ist (welches<br />
Monitum Sie mir als dem Vorsitzenden des Bereiches „Mensch <strong>und</strong> Technik"<br />
des VDI erlauben mögen), fällt auch hier die ahistorische Konzeption<br />
ins Auge. Ein im einzelnen nicht genauer vorgeführtes Raster dreidimensionalen<br />
Zuschnitts (Würfelraster) soll den beschwerlichen Versuch einer genaueren<br />
begrifflichen Bestimmung der Untersuchungsgegenstände ersparen<br />
helfen. Dabei wird ein Schrittmuster in Ansatz gebracht, das völlig an der<br />
klassischen Technik orientiert ist, <strong>und</strong> deswegen mindestens zwei der drei<br />
genannten Technologien, nämlich die Informationstechnologie <strong>und</strong> die<br />
gentechnologisch arbeitende Biotechnologie, von vornherein schon verfehlen<br />
wird. Ich formuliere diesen Einwand als zweite These:<br />
Mit einer einheitlichen Fragen-Checklist an unterschiedliche Technologien<br />
heranzugehen, macht nur unter der Voraussetzung Sinn, daß die<br />
Fragen gegenstandsbereichsrelevant sind. Weder das Stufenmodell noch<br />
die Frage nach Akteuren <strong>und</strong> Gegenspielern noch auch die Thematisierung<br />
von Konfigurationen <strong>und</strong> Prozessen kultureller Aneignung wissenschaflich-technischer<br />
Entwicklungen greifen bei allen thematisierten<br />
Technologien. Der Versuch, abschließend ein Rationalitätsmuster zu rekonstruieren,<br />
beruht auf dem Kategorienfehler, daß die Rationalität der<br />
Rekonstruktion mit der Rationalität des Rekonstruierten verwechselt<br />
wird. Nur unter der Bedingung dieser Verwechslung hängt von der Rekonstruktion<br />
des Rationalitätsmusters die Prognostizierbarkeit, die ökologische<br />
<strong>und</strong> soziale Tragbarkeit, die Kontrollierbarkeit <strong>und</strong> die kulturelle<br />
Assimilierbarkeit ab.<br />
Es würde wenig Sinn machen, die Tatsache, daß der Pilot eines Ju<strong>mb</strong>o-Jets<br />
vor jedem Abflug eine Checklist überprüft, mit dem Ausdruck zu umschreiben:<br />
Er verfügt über ein theoretisches Konstrukt. Außerdem würde<br />
es keinen Sinn machen, einen Piloten eines Alouette-Hubschraubers mit<br />
derselben Checklist auszurüsten. Mithin bedarf es eines theoretischen Modells<br />
der zu untersuchenden Technologien, bevor ein solches Frageraster<br />
angelegt wird. Um die Bestimmung des Gegenstandsbereiches kommt man<br />
eben auch auf diesem Wege nicht herum. Hier scheint mir wie auch in der<br />
Detailarbeit, die noch sehr viel differenzierter die unterschiedlichsten jetzt<br />
in eine Fragedimension verpackten Hinsichten auseinanderzuhalten hat, für<br />
die einzelnen Projekte innerhalb der Sektion noch sehr viel zu tun zu sein.<br />
LITERATUR<br />
Helberg, Walther: Beitrag zum Strukturverständnis des technischen Daseins. In: VDI-<br />
Zeitschrift 104 (1962), Nr. 15; Teilabdruck in: Sachsse, H. (Hg.): Technik <strong>und</strong> Gesellschaft<br />
3: Selbstzeugnisse, Philosophie der Technik (<strong>München</strong> 1976).<br />
Kapp, Ernst: Gr<strong>und</strong>linien einer Philosophie der Technik (1877, Neudruck <strong>München</strong><br />
1976).<br />
Krug, Traugott Wilhelm: Enzyklopädisches philosophisches Wörterbuch. Allgemeines<br />
Handbuch der philosophischen Wissenschaften. Bd. I-V. Faksimile-Neudruck der<br />
2. Aufl. von 1832/38 (Stuttgart-Bad Cannstatt 1969).<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
INDUSTRIEARBEIT IM UMBRUCH-VERSUCH EINER VORAUSSAGE<br />
Horst Kern, Michael<br />
Schumann<br />
Sehen um vorauszusehen diesem Comte'schen Anspruch an „wahrhafte<br />
Wissenschaft" ist in der neueren Industrie<strong>soziologie</strong> kaum widersprochen<br />
worden — zu behaupten, sie hätte sich an ihm abgearbeitet, wäre aber sicher<br />
übertrieben. Lange stand vielmehr die Entdeckung des Gegenwärtigen im<br />
Vordergr<strong>und</strong> ihrer Forschung. Ziel war, ein authentisches Bild von Produktion,<br />
Arbeit <strong>und</strong> Arbeitern zu gewinnen, Bestandsaufnahmen zu machen<br />
<strong>und</strong> geltende Interpretationen in handfester Empirie zu überprüfen. Manche<br />
gängige Formel um Arbeiterverbürgerlichung <strong>und</strong> Gesellschaftsnivellierung<br />
wurde so dem Druck der Tatsachen ausgesetzt. Ideologiekritik stand bei<br />
vielen Industriesoziologen also zunächst auf dem Programm. Und als sich<br />
das Wissen über vorfindbare Sachverhalte <strong>und</strong> Strukturen sicherte <strong>und</strong> verbreiterte,<br />
gewannen zwar Fragen ihrer Genesis <strong>und</strong> der Identifizierung von<br />
allgemeinen Mechanismen an Bedeutung: Beim Versuch, noch so differenzierte<br />
Ex-post-Analysen über die Erklärung des Gegenwärtigen aus dem Vergangenen<br />
als dezidierte Trendaussagen zu fassen, fühlten wir Industriesoziologen<br />
uns aber meist auf zu dünnem, ungesichertem Eis. Oft wurde daraus<br />
erst in der Rezeption der Studien Handfestes über künftige Entwicklungen.<br />
Die Polarisierungsthese ist hierfür ein ganz hübsches Beispiel.<br />
Man kann der Industrie<strong>soziologie</strong> der letzten 30 Jahre kaum einen gewissen<br />
Beitrag zur <strong>gesellschaftliche</strong>n Aufklärung streitig machen. Selbstkritisch<br />
ist nur gleichermaßen festzuhalten: Zu Voraussagen, mit denen sich<br />
heute <strong>und</strong> auch morgen wirklich etwas anfangen ließe, konnten ihre Ansätze<br />
nicht führen. Die Gründe liegen auf der Hand: 1. Das einfache <strong>und</strong><br />
früher so beliebte Verfahren einer unreflektierten Verlängerung des empirisch-faßbaren<br />
Status quo ist heute ganz <strong>und</strong> gar unsinnig. In einer Situation<br />
des ökonomischen <strong>und</strong> politischen U<strong>mb</strong>ruchs, der natürlich auch alle industriesoziologischen<br />
Phänomene betrifft, kann das nur zu Trugschlüssen führen.<br />
2. Die Alternative einer Verarbeitung unseres Wissens zu einer Theorie<br />
der Gesamt<strong>entwicklung</strong>, aus der sich schlüssig auf die künftige Gestalt der<br />
für uns wichtigen Variablen schließen ließe — ein Weg, auf den viele Industriesoziologen<br />
im Zusammenhang mit der Rezeption der politischen Ökonomie<br />
große Hoffnungen gesetzt hatten — hat sich als domenreicher als<br />
gedacht erwiesen <strong>und</strong> ist immer noch nicht in einem gangbaren Zustand.<br />
Die Bemühungen einer Deduktion konkreter Entwicklungen (z.B. „Abstraktifikation<br />
der Arbeit") aus allgemeinen Theorien (z.B. „reelle Subsumtion<br />
unter's Kapital") mögen als Abstraktionen ihre Verdienste haben. Triftige<br />
Verlaufsaussagen haben sie nach aller Erfahrung nicht gebracht.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Manchmal hat man den Eindruck, daß angesichts dieses Ausmaßes der<br />
Schwierigkeiten, die Gegenwart als Spiegel der Zukunft zu betrachten, in<br />
den letzten paar Jahren in unserer Industrie<strong>soziologie</strong> viele den Anspruch<br />
auf Voraussage stillschweigend ganz fallengelassen haben. Der Zug zur<br />
immer weiteren Detaillierung <strong>und</strong> Ausdifferenzierung in der Beschreibung<br />
industriesoziologischer Sachverhalte, der die Chancen üb ergreifender Interpretationen<br />
verbauen muß, ist dafür ein Indiz. Ist nicht aber auch das Sich-<br />
Einlassen vieler Industriesoziologen auf das Geschäft der Beratung <strong>und</strong> der<br />
konkreten betrieblichen Gestaltung als eine Antwort auf das Voraussageproblem<br />
zu verstehen? Voraussicht war ja entsprechend den Soziologietraditionen,<br />
in denen die meisten von uns denken, die Brücke zur <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Praxis. Als diese einzustürzen schien, hat mancher sich an der kleinen<br />
Praxis im Diesseits festzuklammern versucht.<br />
Daß sich die Soziologie mit ihrem diesjährigen Kongreß wieder ausdrücklich<br />
dem Anspruch stellt, das im gewachsenen Fach gewaltig akkumulierte<br />
Wissen in Voraussagen umzusetzen, sehen wir auf diesem Hintergr<strong>und</strong><br />
als Schritt in die bessere Richtung. Doch das bereits Gesagte dürfte auch<br />
verdeutlichen, wie vorsichtig tastend hier Schritte zunächst nur gesetzt<br />
werden können. Als wir uns in unserer neuen Studie dem Zwang unterworfen<br />
sahen, den Blick nach vorn zu wagen, ist uns besonders klar geworden,<br />
wie wenig vorbereitet wir in der Industrie<strong>soziologie</strong> auf Forschungen sind,<br />
die ausdrücklich auch einen Ergebnisstatus anpeilen, der Voraussage sein<br />
will. Insofern handelt unser Erfahrungsbericht über diese Studie mehr von<br />
Schwierigkeiten, improvisierten Lösungen <strong>und</strong> vorläufigen Resultaten denn<br />
von gesicherten Beständen.<br />
In fünf Punkten werden wir zunächst den methodisch-konzeptionellen<br />
Ansatz für unsere auch auf Voraussage gerichete Studie kurz beschreiben,<br />
um anschließend in sieben Thesen unsere wichtigsten inhaltlichen Ergebnisse<br />
zu umreißen.<br />
I<br />
Unsere neue Untersuchung war ursprünglich als reine Folgestudie zu ,,Industriearbeit<br />
<strong>und</strong> Arbeiterbewußtsein" gedacht gewesen: Analyse der Rationalisierungsbewegungen<br />
in den Jahren 1965 bis 1980, also Beitrag zur Rekonstruktion<br />
der historischen Verlaufs formen von Rationalisierung. Im Laufe<br />
unserer Arbeit verdichtete sich freilich immer stärker der Eindruck, daß<br />
man die Rationalisierungs<strong>entwicklung</strong> der letzten fünfzehn Jahre nur richtig<br />
versteht, wenn man sie auch <strong>und</strong> vor allem als Inkubationszeit begreift, d.h.<br />
als Aufbau eines Rationalisierungspotentials. Die Hauptsache, die industrielle<br />
Anwendung im großen Maßstab, lag <strong>und</strong> liegt — so unser Eindruck —<br />
noch in der Zukunft. Diese noch ausstehenden Entwicklungen in den Betrieben<br />
mußten wir auf jeden Fall mit zu erfassen suchen, wollten wir nicht<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
am Ende als schlichte Biographen von Rationalisierungsverläufen dastehen<br />
— noch dazu von einer Phase, deren Spezifik gerade darin liegt, daß die für<br />
sie charakteristischen Konzepte bald auf dem Schrottplatz der Rationalisierungsgeschichte<br />
abgelegt sein könnten. Das war der in der Sache liegende<br />
Zwang zur Antizipation, zur Prédiction im Sinne Horkheimers, zur historischen<br />
Voraussage also, dem wir uns ausgesetzt sahen. Wie aber kann man<br />
sich angesichts der schon deutlich gewordenen Schwierigkeiten darauf<br />
einlassen?<br />
II<br />
Gewiß, ungelöste Probleme gibt es zuhauf, aber auch manche brauchbaren<br />
Anknüpfungspunkte <strong>und</strong> viel verwertbares Wissen. Es bestehen u.E. gute<br />
Gründe, in folgenden Überlegungen Bausteine einer Antizipation von Rationalisierung<br />
zu suchen:<br />
a) Die Logik kapitalistischer Rationalisierung (Bemühung um die höhere<br />
Ergiebigkeit der lebendigen Arbeit mit dem Ziel besserer Kapitalverwertung)<br />
realisiert sich entsprechend den spezifischen markt- <strong>und</strong> produktionsökonomischen<br />
Bedingungen in konkreten, typisierbaren Formen der Rationalisierung.<br />
Mit einer Veränderung der Rationalisierungsformen ist dann zu<br />
rechnen, wenn veränderte Verwertungsbedingungen oder auch nur Interpretationen<br />
die Suche nach adäquateren Produktionskonzepten stimulieren.<br />
Die Verwertungsprämisse drängt dann nach neuen Einlösungen. Offenbar<br />
befinden wir uns gegenwärtig in einer solchen U<strong>mb</strong>ruchsituation.<br />
b) Alle bisher bekannten Formen kapitalistischer Rationalisierung suchten<br />
eine Einlösung der Verwertungsprämisse entlang folgender Linien: Lebendige<br />
Arbeit wurde als zu überwindende Schranke der Produktion verstanden,<br />
das Residuum lebendiger Arbeit als potentieller Störfaktor. Die markt<strong>und</strong><br />
produktionsökonomischen Bedingungen bewirkten Differenzierungen<br />
nur auf den durch diese Linien definierten Bahnen. Wir sehen aber keine<br />
theoretische Notwendigkeit für die Schlußfolgerung, kapitalistische Rationalisierung<br />
müsse sich ad infinitum auf diesen Bahnen bewegen. Hier liegt<br />
auch ein empirisches, theoretisch für uns nicht vorab entscheidbares Problem.<br />
c) Gegenüber empirisch begründeten Zukunftsaussagen muß immer ein<br />
Wahrheitsvorbehalt aufrechterhalten werden; über ihre letztendliche Richtigkeit<br />
kann nur die geschichtliche Entwicklung selbst entscheiden. Ob also<br />
die aktuelle U<strong>mb</strong>ruchsituation so radikal ist, daß die Rationalisierungsformen<br />
aus den bisherigen Bahnen herausgehoben werden oder nicht, wird sich<br />
mit unseren empirischen Recherchen heute nicht definitiv feststellen lassen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
d) Im Bewußtsein dieser Einschränkung sehen wir aber Möglichkeiten,<br />
die Empirie gezielter als bisher üblich für Ergebnisse mit Voraussage-Status<br />
einzusetzen. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von einer „Ex-ante-<br />
Empirie". Diese macht sich zwei theoretisch wie empirisch zweifelsfreie<br />
Tatbestände zunutze. Die Ungleichzeitigkeit von Rationalisierungsmaßnahmen<br />
<strong>und</strong> die (jedenfalls im Großunternehmen typische) Langfristigkeit<br />
von Rationalisierungsplanungen. Durch empirische Analyse von stilbildenden<br />
Rationalisierungen — das wären in Schumpeters Sprache die „neuen<br />
Ko<strong>mb</strong>inationen" im noch nicht abgeschlossenen Innovationsschub — sowie<br />
von darauf gerichteten längerfristigen Planungsmaßnahmen — „neue Ko<strong>mb</strong>inationen"<br />
im Status nascendi — läßt sich der Vorhang zur Zukunft ein<br />
Stückweit lüften. Zur uns interessierenden Frage, ob die gegenwärtige Rationalisierungsbewegung<br />
in den alten Bahnen verharrt oder ob sie den Duktus<br />
kapitalistischer Rationalisierung tangiert <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>legend gewandelte<br />
Formen bewirkt, lassen sich also mit einer Ex-ante-Empirie Argumente beibringen.<br />
Entsprechend diesen vier Gr<strong>und</strong>überlegungen studierten wir die Verwertungsbedingungen<br />
zentraler Industriezweige im Hinblick auf die in ihnen<br />
enthaltenen Impulse für weitere Rationahsierungen. In allen Branchen<br />
stießen wir in der Tat auf Veränderungskonstellationen. Unser Programm,<br />
diese genau auszuloten, in Stichworten:<br />
— Genaue Ex-post-Analysen, bei denen wir auf unsere Empirie aus „Industriearbeit<br />
<strong>und</strong> Arbeiterbewußtsein" aufbauen konnten, verschafften<br />
uns Klarheit über bisher typische Lösungen.<br />
— Durch Adäquanzüberlegungen — inwieweit passen die alten Formen in<br />
die aktuelle Verwertungssituation? — gewannen wir Vorstellungen darüber,<br />
wo in den Betrieben heute die offenen Flanken liegen. Soweit wir<br />
dann auf konkrete Projekte, erprobte Modelle oder wenigstens seriöse<br />
Planungsvorhaben stießen, mit denen flankenschließende Intentionen<br />
verfolgt wurden, haben wir diese aufgenommen <strong>und</strong> weiter recherchiert.<br />
— In einer abschließenden Evaluation versuchten wir ein Urteil darüber zu<br />
gewinnen, inwieweit diese Maßnahmen plausible Antworten auf die<br />
heutigen Verwertungsprobleme darstellen. Bei einem positiven Bef<strong>und</strong><br />
sprechen wir von stilbildenden Rationalisierungen, d.h. von technischorganisatorischen<br />
Maßnahmen, die — nach vorne geschaut — eine große<br />
Diffusionschance besitzen <strong>und</strong> Spitze eines Eisbergs sein könnten, obwohl<br />
sie für die Realität der Betriebe heute noch nicht unbedingt bestimmend<br />
sind.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Gestützt auf diese Analysen behaupten wir als zentrale These, daß sich gegenwärtig<br />
vor unseren Augen ein gr<strong>und</strong>legender Wandel in der Nutzung der<br />
Arbeitskräfte vollzieht. Neue Produktionskonzepte werden formuliert <strong>und</strong><br />
durchgesetzt, deren Generalnenner lautet: keine technische Autonomisierung<br />
der Produktionsprozesse um jeden Preis, wachsende Wertschätzung<br />
von Qualifikation <strong>und</strong> fachlicher Souveränität. Der Duktus kapitalistischer<br />
Rationalisierung wird anders. Bei unveränderter Logik der Rationalisierung<br />
bilden sich doch gr<strong>und</strong>legend neue Formen aus.<br />
Diese These von den neuen Produktionskonzepten formulieren wir<br />
nicht als Postulat, sondern als Resultat einer interpretierenden Verarbeitung<br />
empirischer Erfahrungen nach dem Konzept der Ex-ante-Empirie. Wenn<br />
wir die neuen Produktionskonzepte prognostizieren, so umreißen wir die<br />
Entwicklungsrichtung, in die hinein die U<strong>mb</strong>ruchsituation in den Betrieben<br />
nach unserer Einschätzung aufgelöst wird. Die neuen Produktionskonzepte<br />
stellen aus unserer Sicht also heute mehr dar als eine objektive Möglichkeit,<br />
nur vorübergehende Irritationen bei der Einführung neuer Technologien<br />
oder bloße Insellösungen. Sie markieren die Bandbreiten der weiteren Entwicklung<br />
in den industriellen Kernsektoren.<br />
IV<br />
„Bandbreite" umreißt eine bestimmte Entwicklungsrichtung, innerhalb<br />
derer aber viele Pfade mit gleichem Marschziel gegangen werden können.<br />
Damit wollen wir unsere Voraussage gegenüber eindeutiger Prognose im<br />
Sinne der definitiven Behauptung einer bestimmten Entwicklungslinie abgrenzen.<br />
Daß eine derart exakte „Prognose" erkenntnislogisch gar nicht<br />
haltbar wäre, können wir nur noch einmal wiederholen. Unterhalb dieser<br />
prinzipiellen Schwelle bestehen freilich Voraussagemöglichkeiten, <strong>und</strong> zwar<br />
unterschiedlichen Genauigkeitsgrades. Dabei erscheint uns klar, daß wir den<br />
vorhandenen Genauigkeitsspielraum heute noch nicht ausschöpfen können.<br />
Auch wenn wir mit der Industrie<strong>soziologie</strong> heute schon manches Terrain<br />
erschlossen haben: Viel nachgreifende Forschung ist noch nötig.<br />
Die Aussageunsicherheiten, die bei einem Antizipationsversuch bestehen,<br />
bestimmen sich aber immer auch aus dem spezifischen Forschungsgegenstand.<br />
Bei unserem Thema — der betrieblichen Rationalisierung — ist zu<br />
bedenken, daß der technisch-organisatorische Wandel im Betrieb in all seinen<br />
Phasen sozial determiniert ist. (Uber die Technokratiethese, die etwas<br />
anderes behauptet, braucht man wohl nicht mehr zu streiten.) Soziale<br />
Determiniertheit der Rationalisierung bedeutet aber, daß Rationalisierung<br />
im Betrieb aus einem dynamischen sozialen Kräftefeld heraus entsteht <strong>und</strong><br />
daß über ihre konkreten Konturen in vielschichtigen Bargaining-Prozessen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
entschieden wird, deren Details nicht vorherzusehen sind. Auch wenn man<br />
nun — wie wir dies in unserer Studie versucht haben — die hier relevanten<br />
betrieblichen Handlungskonstellationen in ihrer inneren Dynamik <strong>und</strong> Konfliktualität<br />
in die Analyse mit einbezieht, so müssen wir trotz solcher Bemühungen<br />
konstatieren: Der Ausgang der Prozesse selbst ist prinzipiell<br />
noch offen. Über das letztendliche Resultat, den Fahrweg der Rationalisierung,<br />
ist noch nicht entschieden. Diese Offenheit besteht umso mehr, als<br />
die Beschreibung der Handlungskonstellationen — sofern sie politisiert<br />
wird — ihrerseits zu einer Veränderung des Kräftefeldes führen kann. In<br />
unserem Fall, bei einer praxisorientierten Sozialforschung, ist diese Veränderung<br />
ja sogar ausdrücklich gewünscht. Antizipierbar sind aber solche<br />
Rückkopplungseffekte kaum.<br />
Der Begriff Bandbreite hebt also die Offenheit <strong>und</strong> Gestaltbarkeit der<br />
Situation, das Faktum der noch bestehenden Eingriffschancen hervor. Die<br />
These von den neuen Produktionskonzepten umreißt in unserem Verständnis<br />
eine neue Konstellation, eine vermutlich wichtiger werdende Handlungs<strong>und</strong><br />
Gestaltungsmöglichkeit, nicht aber einen definitiven Vorgang <strong>und</strong><br />
schon im Detail bestimmte Ergebnisse. Sie soll nach unserer Vorstellung<br />
einmünden in eine Politik der Modernisierung, die die in der beschriebenen<br />
Konstellation hegenden Chancen nach vorn hin öffnet: Modernisierung als<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>s Projekt. Antizipierbar erscheinen uns in erster Linie die<br />
Problemkonstellationen, die Entwicklungsrichtung <strong>und</strong> die Handlungsmöglichkeiten,<br />
nicht aber schon die konkreten Resultate.<br />
V<br />
Unser Verfahren der Voraussage können wir also zusammenfassend als<br />
theoretisch angeleitete <strong>und</strong> empirisch gestützte Bandbreitenbestimmung<br />
kennzeichnen. „Theoretisch angeleitet", weil wir uns auf eine Theorie der<br />
kapitalistischen Entwicklung beziehen, die von der Unterscheidung zwischen<br />
Logik <strong>und</strong> Formen der Rationalisierung ausgeht <strong>und</strong> bestimmte Annahmen<br />
über den Formwandel („bisherige Formen", „Ungleichzeitigkeitstheorem",<br />
„Planungstheorem", „Bargainingtheorem") enthält. „Empirisch<br />
gestützt", weil wir den Nachweis einer beginnenden Ablösung der alten Formen<br />
durch neue Produktionskonzepte mit empirischen Mitteln führen. Der<br />
Begriff der „Bandbreite" soll Felder <strong>und</strong> Grenzmarken abstecken, innerhalb<br />
derer die weitere Entwicklung zu erwarten ist.<br />
Es dient vielleicht dem Verständnis unseres Verfahrens, wenn wir anmerken,<br />
daß wir gelegentlich einen Seitenblick auf die Prognoseansätze in<br />
der Wirtschaftsforschung <strong>und</strong> der Unternehmens- <strong>und</strong> Politikberatung geworfen<br />
haben. Orientierungshilfen brachten sie uns kaum — <strong>und</strong> zwar nicht<br />
nur wegen der Unterschiede im gesellschaftstheoretischen Gr<strong>und</strong>verständnis<br />
<strong>und</strong> im Erkenntnisinteresse. Dabei sind die Fortschritte in diesen Diszipli-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
nen nicht zu übersehen: Mit Projektionen im Sinne schlichter Prolongationen<br />
vergangener Trends, früher dort durchaus hoffähig, gibt sich heute<br />
kaum noch jemand zufrieden. So werden bei Prognosen vom Typ der indikativen<br />
Vorausschätzung die mathematisch-statistischen Trendverlängerungen<br />
zumeist in theoretische <strong>und</strong> empirisch-qualitative Erwägungen eingebettet<br />
<strong>und</strong> insofern relativiert; das bedeutet einen Gewinn an Realitätsnähe.<br />
Und bei Prognosen in der Form von hypothetischen Szenarien wird auf<br />
exakte Vorausberechnungen von Verlauf <strong>und</strong> Zeitpunkt künftiger Ereignisse<br />
häufig ganz verzichtet, <strong>und</strong> man beschränkt sich darauf, Gefahrenpunkte<br />
<strong>und</strong> Grenzwerte der Entwicklung zu benennen; dies kann durchaus<br />
nützliche Anregungen für effektive Problemlösungen erbringen. Dennoch<br />
konnten diese Ansätze für uns kein Modell sein. Zu sehr sind sie immer<br />
noch durch ein auffälliges Mißverhältnis zwischen nicht nachvollziehbaren<br />
oder nicht nachprüfbaren Annahmen einerseits <strong>und</strong> der beanspruchten Aussagegenauigkeit<br />
andererseits gekennzeichnet. Es bleibt ein Unbehagen, weil<br />
pauschale Statements <strong>und</strong> fragwürdige empirische Annahmen mit detailliertesten<br />
quantitativen Aussagen ko<strong>mb</strong>iniert werden.<br />
Daß sie der Magie der Quantifizierung erliegen könnte, ist gewiß nicht<br />
das Problem der Industrie<strong>soziologie</strong>. Doch wo sind unsere Chancen, es<br />
besser zu machen? Wer als Industriesoziologe sein Handwerk einigermaßen<br />
gelernt hat, kann vielleicht einen gewissen Realitätssinn für sich in Anspruch<br />
nehmen, der ihn die Vielfältigkeit <strong>und</strong> Widersprüchlichkeit sozialer<br />
Phänomene in der Industrie halbwegs deutlich sehen läßt. Das Gesetz<br />
der komparativen Kostenvorteile nutzend, war es folglich unser Bemühen,<br />
bei der Vorbereitung unserer Antizipation sehr genau hinzuschauen <strong>und</strong> die<br />
Lösung gerade nicht auf dem Wege der Glättung <strong>und</strong> der Handhabbarmachung<br />
der industriellen Wirklichkeit für Modellzuordnungen zu suchen.<br />
Unsere Aussagen beruhen auf in cross examination gewonnenen Informationen.<br />
Sie sollen sein: Zusammenfassung <strong>und</strong> Verdichtung eines reichhaltigen<br />
Datenmaterials zu einem integrierten Konzept; ein die Widersprüche<br />
austragender Gesamteindruck, der sich in Form von Evidenzargumenten<br />
aus unserem Material dokumentieren läßt <strong>und</strong> der sich mit unseren theoretischen<br />
Kenntnissen zumindest zu einem plausiblen Bild zusammenfügt.<br />
Was wir anstrebten waren transparente, nachvollziehbare Gesamtinterpretationen.<br />
So viel zu der methodischen Plattform, die wir uns zusammengezimmert<br />
haben, um einen Blick auf die Zukunft der Industriearbeit werfen zu<br />
können. Nun die Aussicht selbst in Kurzbeschreibung. In den restlichen<br />
sieben Punkten wollen wir die Entwicklung der, sagen wir, nächsten zehn<br />
Jahre umreißen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Unsere Hauptaussage bedeutet: In den industriellen Kernsektoren vollzieht<br />
sich vor unseren Augen ein gr<strong>und</strong>legender Wandel in der Nutzung der Arbeitskräfte.<br />
Zu beobachten ist ein Umdenken in der Arbeitsgestaltung, der<br />
Ausbildungs- <strong>und</strong> Personalpolitik sowie des Arbeitseinsatzes. Durchaus<br />
kann man von einem arbeitspolitischen Paradigmenwechsel in den Betrieben<br />
des industriellen Kernbereichs sprechen. Dieser steht im Zusammenhang<br />
mit jenem umfassenden Gesamtprozeß, den wir als das Aufkommen<br />
neuer Produktionskonzepte bezeichnet haben <strong>und</strong> der uns deshalb so bemerkenswert<br />
erscheint, weil seine Arbeitsimplikationen kapitalistischer Rationalisierung<br />
eine neue Gestalt geben.<br />
Dieser Wandel ist freilich weitgehend verborgen geblieben, weil sich die<br />
Diskussion um die Wirkungen der neuen Technologien ganz auf deren gesteigerte<br />
Freisetzungspotenz konzentrierte. Der gewerkschaftliche Kampf<br />
um die <strong>35</strong>-St<strong>und</strong>en-Woche unterstreicht diese Wahrnehmung: Rationalisierung<br />
steht heute mehr denn je als Synonym für massenhafte Arbeitsplatzvernichtung.<br />
Nun erwarten auch wir in der Zukunft in dieser Hinsicht<br />
Problemverschärfungen. In vielen Industrien endet gerade erst die schon<br />
erwähnte Inkubationszeit, in der das erweiterte Rationalisierungswissen aufgebaut<br />
wurde. Erst jetzt <strong>und</strong> in den kommenden Jahren werden diese Möglichkeiten<br />
ausgereizt. Da es keinerlei Anhaltspunkte dafür gibt, daß die Karte<br />
der Kompensation noch sticht, wird dem <strong>gesellschaftliche</strong>n Skandal der<br />
Arbeitslosigkeit nur mit politischen Lösungen beizukommen sein.<br />
Doch die gesteigerte Freisetzungspotenz stellt nur das eine neue Moment<br />
der eingeleiteten Rationalisierungsbewegungen dar. Im Bruch mit der<br />
bisher üblichen Arbeitspolitik liegt die zweite, vielfach noch übersehene<br />
Veränderung. Es klingt paradox: Gerade zu jenem historischen Zeitpunkt,<br />
zu dem die technischen Möglichkeiten zur Substitution menschlicher Funktionen<br />
geradezu explodieren, steigt gleichzeitig das Bewußtsein für die qualitative<br />
Bedeutung menschlicher Arbeitsleistung; steigt die Wertschätzung<br />
der besonderen Qualitäten lebendiger Arbeit. Denn das Credo der neuen<br />
Produktionskonzepte lautet:<br />
a) Autonomisierung des Produktionsprozesses gegenüber lebendiger Arbeit<br />
durch Technisierung ist kein Wert an sich. Die weitestgehende Komprimierung<br />
lebendiger Arbeit bringt nicht per se das wirtschaftliche Optimum.<br />
b) Der restringierende Zugriff auf Arbeitskraft verschenkt wichtige Produktivitätspotentiale.<br />
Im ganzheitlicheren Aufgabenzuschnitt liegen keine<br />
Gefahren, sondern Chancen. Qualifikation <strong>und</strong> fachliche Souveränität auch<br />
der Arbeiter sind Produktivkräfte, die es verstärkt zu nutzen gilt.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Für die von uns en detail untersuchten Branchen — Automobilindustrie,<br />
Werkzeugmaschinenbau, chemische Industrie — lassen sich die neuen Produktionskonzepte<br />
in bezug auf die technische <strong>und</strong> organisatorische Produktionsgestaltung<br />
wie folgt konkretisieren:<br />
Die neuen Produktionskonzepte — Funktionsgestaltung<br />
Technisch<br />
Arbeitsorganisatorisch<br />
Automobilindustrie<br />
Offensive Nutzung der<br />
neuen Technologien —<br />
insbesondere in den<br />
bisher arbeitsintensiven<br />
Montagesektoren;<br />
Mechanisierungssprung<br />
auf teilautomatisierte<br />
Einzelaggregate <strong>und</strong><br />
Maschinensysteme<br />
Trendwende in der<br />
Arbeitsgestaltung:<br />
— Aufgabenintegration<br />
— Reprofessionalisierung<br />
der Produktionsarbeit<br />
Werkzeugmaschinenbau<br />
Offensive Nutzung der<br />
neuen Technologien in<br />
der spanabhebenden<br />
Fertigung;<br />
Mechanisierungssprung<br />
auf teilautomatisierte<br />
Einzelaggregate <strong>und</strong><br />
Maschinensysteme<br />
Facharbeiterbetrieb<br />
als positives Gestaltungskonzept,<br />
nicht<br />
mehr „notwendiges<br />
Übel"<br />
Chemische Industrie<br />
Schrittweise Komplettierung<br />
des Automatisierungsgrades<br />
in<br />
Richtung Vollautomation<br />
Fortsetzung des Trends<br />
zur Professionalisierung<br />
der Produktionsarbeit<br />
Gemeinsamer Nenner<br />
Forcierte Technisierung,<br />
aber keine Komprimierung<br />
der lebendigen<br />
Arbeit um jeden Preis<br />
Der ganzheitliche Aufgabenzuschnitt<br />
erschließt<br />
neue Produktivkräfte<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Daß sich in diesen Branchen die neuen Produktionskonzepte durchzusetzen<br />
beginnen, sehen wir nicht zuletzt im ökonomischen F<strong>und</strong>ament <strong>und</strong><br />
in den Zukunftsperspektiven dieser Industriezweige begründet. In unterschiedlichem<br />
Ausmaß hat die „Krise der Wachstumsökonomie" zwar auch<br />
an diesen Industrien genagt, doch bestand <strong>und</strong> besteht genug Substanz für<br />
eine nach vorne gerichtete Strategie, wie sie in den neuen Produktionskonzepten<br />
zum Ausdruck kommt, Ökonomische Potenz bildet ohne Zweifel<br />
eine notwendige Voraussetzung für einen weittragenden Sprung in Richtung<br />
Modernisierung der Produktionsapparate <strong>und</strong> damit zusammenhängenden<br />
Produktinnovationen. Deswegen scheint es uns angebracht, in den industriellen<br />
Kernsektoren insgesamt, also im Zentralbereich der Industrieproduktion,<br />
soweit er nach wie vor auf halbwegs soliden Beinen steht, das<br />
Experimentier- <strong>und</strong> Diffusionsfeld der neuen Produktionskonzepte zu<br />
sehen. Das bedeutet umgekehrt: Unsere These von den neuen Produktionskonzepten<br />
ist keine Aussage über den industriellen Sektor. Sie gilt nur für<br />
das funktionierende Zentrum der Industrieproduktion.<br />
Daß in diesen Industrien neue Produktionskonzepte eine Bewährungschance<br />
bekommen, hat u.E. mit einer umfassenden Umgruppierung <strong>und</strong><br />
Neubewertung der Verwertungsbedingungen zu tun <strong>und</strong> läßt sich nicht<br />
etwa nur technologisch begründen. Das Umdenken in Richtung neuer arbeitspolitischer<br />
Konzepte erhält aber umso mehr Anstöße, je mehr neue<br />
Technologien Anwendung finden. Das hängt besonders damit zusammen,<br />
daß (von stark rückläufigen Bedienungspositionen abgesehen) an automatisierten<br />
Großanlagen oft kein Platz mehr ist für ganz <strong>und</strong> gar unqualifiziertes<br />
Personal. Auch in der Fertigung, in welchem Ausmaß immer, wird der<br />
geschickte, diagnosefähige, verhaltenssouveräne Arbeiter gebraucht.<br />
VIII<br />
Die arbeitssoziologische Bedeutung einer Produktionsgestaltung nach dem<br />
Muster der neuen Konzepte liegt darin, daß diese nur unter der Voraussetzung<br />
einer Wiedereinführung <strong>und</strong> Verankerung von Produktionsintelligenz<br />
praktiziert werden können. Kapitalverwertung selbst erfordert den U<strong>mb</strong>ruch<br />
in der Nutzung von Arbeitskraft. Je mehr die Produktkonzeption<br />
auf die Erzeugung hochkomplexer Qualitätsartikel hinausläuft <strong>und</strong> die<br />
Produktionskonzepte auf den breitflächigen Einsatz der neuen Technologien<br />
abzielen, desto mehr bietet sich als optimales Arbeitseinsatzkonzept<br />
der ganzheitlichere Aufgabenzuschnitt <strong>und</strong> die breitere Verwendung von<br />
Qualifikationen an. In der Frage, wo im Betrieb die produktionsnotwendige<br />
Intelligenz verankert werden soll: allein in werkstatt-externen Planungs<strong>und</strong><br />
Dispositionsagenturen, denen eine rein ausführende Fertigung ohne<br />
jede Kompetenz <strong>und</strong> Qualifikation gegenübersteht (das wäre die Fortschreibung<br />
alter Linien), oder aber auch in der Produktion selbst, deren Know-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
how <strong>und</strong> Erfahrung nicht als ärgerliches Residuum, sondern als unverzichtbarer<br />
Bestandteil der Produktivkraft<strong>entwicklung</strong> anerkannt wäre (das sind<br />
die neuen Produktionskonzepte), gewinnt die zweite Position allmählich die<br />
Oberhand. Höhere Produktivität ist unter den gegenwärtigen Umständen<br />
ohne pfleglicheren, „aufgeklärteren" Umgang mit der lebendigen Arbeit<br />
nicht zu bekommen — das ist eine Erfahrung, die auch das Kapital machen<br />
muß.<br />
IX<br />
Je nach konkreter Ausprägung der neuen Produktionskonzepte weisen<br />
die Arbeitsveränderungen, die wir hier im Auge haben, unterschiedliche<br />
Konturen auf. Bezieht man sich wiederum auf die drei Bereiche, in denen<br />
wir hauptsächlich empirisch gearbeitet haben, so sind in bezug auf die vorherrschenden<br />
Arbeits- bzw. Berufstypen <strong>und</strong> deren Qualifikationsprofile<br />
folgende Differenzierungen angebracht:<br />
Die neuen Produktionskonzepte — Arbeitsveränderungen<br />
Arbeits-/Berufstyp<br />
Qualifikationsinhalt<br />
Automobilindustrie<br />
Werkzeugmaschinenbau<br />
Chemische Industrie<br />
Produktionsfacharbeiter<br />
neuen Typs: orientiert<br />
am Berufsbild eines<br />
„Fertigungsmechanikers"<br />
Weiter<strong>entwicklung</strong> des<br />
Zerspanungs-Handwerkers<br />
zum „Syste<strong>mb</strong>etreuer"<br />
Chemie-Facharbeiter<br />
als Produktionsarbeiter<br />
Ausbaufähige Gr<strong>und</strong>kenntnisse<br />
über technisch-physikalische<br />
Funktionsprobleme<br />
moderner Produktionsanlagen<br />
mit maschinentechnischer<br />
Akzentuierung<br />
Ergänzung der Zerspanungskenntnisse<br />
<strong>und</strong> der handwerklichen<br />
Fähigkeiten um<br />
Gesamtübersicht <strong>und</strong> Eingriffskompetenz<br />
in CNC-gesteuerte<br />
Maschinensysteme<br />
Ausbaufähige Gr<strong>und</strong>kenntnisse<br />
über die chemischphysikalischen<br />
Abläufe bei<br />
Stoffumwandlung mit produktionstechnischen<br />
Bezügen<br />
Gemeinsamer Nenner Produktionsfacharbeiter Erweiterte technisch/physikalisch/chemische<br />
Gr<strong>und</strong>kenntnisse<br />
<strong>und</strong> Eingriffskompetenzen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Diese Entwicklungen stellen für die Zukunft der Industriearbeit sicher<br />
keine Marginalien dar. Es geht um den Erhalt bzw. die Reetablierung von<br />
Facharbeit. Das Ende der Arbeitsteilung — darauf könnte unter dem Einfluß<br />
der neuen Produktionskonzepte die Entwicklung in einem wichtigen<br />
Teil der industriellen Produktion hinauslaufen.<br />
X<br />
Mit den neuen Produktionskonzepten werden vielen Arbeitern in den industriellen<br />
Kernbereichen Offerten gemacht. Die höhere Attraktivität der verbleibenden<br />
Arbeit bietet bessere Chancen für ein Arrangement mit Rationalisierung.<br />
Zugleich liegt in der größeren Wertschätzung der lebendigen<br />
Arbeit durch die Betriebe für die Beschäftigten eine Möglichkeit, den Druck<br />
auf die Arbeitskonditionen einschließHch der Arbeitsplatzsicherheit abzufangen.<br />
Weil der Unternehmer mit den Arbeitern modernisieren will, muß<br />
er auch etwas bieten. Deswegen können die Belegschaften <strong>und</strong> ihre Vertretungen<br />
auch einen Preis fürs Mitspielen im betrieblichen Prozeß der Modernisierung<br />
fordern.<br />
Bezogen auf die allgemeine Betriebspolitik heißen die verbreiteten<br />
Forderungen:<br />
• Entlassungsschutz bzw. akzeptable Übergangsregelungen; bei unabweislichem<br />
Personalabbau gesicherte <strong>und</strong> finanziell tragbare Frühverrentung;<br />
„Arbeitszeitverkürzung" als Antwort auf Arbeitsplatzvernichtung.<br />
• Besitzstandsicherung bei innerbetrieblichen Umsetzungen.<br />
• Beteiligung am Rationalisierungsgewinn als Ausgleich für übernommene<br />
Risiken <strong>und</strong> Lasten <strong>und</strong> als Anspruch an Produktivitätssteigerungen.<br />
Hinsichtlich der Ausgestaltung der Modernisierung<br />
Erwägungen:<br />
stießen wir auf folgende<br />
• Anspruchsvolle Arbeitsplatzdefinitionen für möglichst viele Arbeiter;<br />
d.h. keine Bündelung der Qualifikationseffekte für kleine Spezialistentruppen,<br />
wie es oft Betriebspraxis ist; mutiges Ausschöpfen der erweiterten<br />
Gesamtmasse qualifizierterer Funktionen.<br />
• Ausrichtung der Bildungsinhalte an einem umfasssenden Qualifikationsbegriff;<br />
d.h. keine Beschränkung auf prozeßspezifische Fähigkeiten, worauf<br />
sich viele Betriebe zunächst zu beschränken suchen. Orientierung an souveräner<br />
Berufsarbeit; vielfältige berufliche wie private Anwendbarkeit der<br />
Kenntnisse <strong>und</strong> Fähigkeiten.<br />
• Verpflichtung auf den Leistungskompromiß; d.h. keine einseitige Festlegung<br />
der Leistungsanforderungen, wie sie in der heutigen betrieblichen<br />
Praxis oft geschieht <strong>und</strong> zu gravierender Arbeitsintensivierung gerade an<br />
den neuen Arbeitsplätzen führt.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Alles in allem: statt des Kampfes für alternative Rationalisierung also<br />
Kampf um die angemessene Beteiligung an betrieblicher Rationalisierung<br />
<strong>und</strong> die systematische Einbeziehung von Beschäftigteninteressen in die betrieblichen<br />
Modernisierungsstrategien. Ein politisches Programm, welches<br />
Modernisierung über ihre einzelwirtschaftliche, betriebliche Borniertheit<br />
hinaustreiben will, könnte an diesen Belegschaftsforderungen anknüpfen.<br />
XI<br />
Die neuen Produktionskonzepte markieren — wie gesagt — in unserem Verständnis<br />
den wahrscheinlichen Entwicklungspfad allein der industriellen<br />
Kernsektoren. Sie sind ein wichtiger Bestandteil von deren Versuch, den<br />
Kopf aus der Schlinge der Krise zu ziehen <strong>und</strong> im nationalen wie internationalen<br />
Wettbewerb den Boden unter den Füßen zu halten oder wiederzubekommen.<br />
Am anderen Pol stehen die krisenhaften Branchen, die heute<br />
kaum noch eine Perspektive haben <strong>und</strong> in denen es ums nackte ökonomische<br />
Überleben geht. Vor allem also die Werften, die Stahlindustrie, der<br />
Bergbau. In diesen industriellen Krisensektoren ist wenig Platz für die Idee<br />
neuer Produktionskonzepte: Ihr Überlebenskampf steht unter dem Zeichen<br />
der Kapazitätsvernichtung <strong>und</strong> der Auspowerung.<br />
Innerhalb der Arbeiterschaft spiegeln sich diese ökonomischen Strukturen<br />
in einer Verfestigung interner Grenzlinien wider. Für die innere Dynamik<br />
des sich herausbildenden Sozialgefüges scheinen uns vier Konstellationen<br />
<strong>und</strong> Gruppen von besonderer Bedeutung:<br />
Erste Gruppe: Die personellen Träger der neuen Produktionskonzepte:<br />
moderne Produktions-Facharbeiter, Instandhaltungsspezialisten; außerdem<br />
das ganze Feld derer, die allmählich in solche Positionen einrücken könnten.<br />
Sie sind die Rationalisierungsgewinner. Im Rationalisierungsprozeß ist<br />
ihr Verhalten das der Mitspieler, der Protagonisten der betrieblichen Umgestaltung;<br />
sie haben einen hohen betrieblichen Status <strong>und</strong> können für sich<br />
Gratifikationen reklamieren. Sie dürften aus dieser Entwicklung sogar mit<br />
Machtzugewinn herauskommen.<br />
Zweite Gruppe: Die Arbeiter auf den traditionellen Arbeitsplätzen in<br />
den Kernsektoren, die aber wegen persönlicher Merkmale — fortgeschrittenes<br />
Alter, keine polyvalenten Qualifikationen — für einen Arbeitseinsatz<br />
nach dem neuen Produktionskonzept den Betrieben nicht attraktiv erscheinen.<br />
Ihr Verhalten im Rationalisierungsprozeß dürfte das der Rationalisierungsdulder<br />
sein. Sie sind zwar überwiegend durch Tarifvertrag <strong>und</strong> Betriebsvereinbarung<br />
vor dem Schlimmsten geschützt. Doch ist ihre Interessenwahrnehmung<br />
gehemmt, weil für sie allemal die Gefahr besteht, ausgefiltert<br />
zu werden. Die Kämpfe bei Talbot 1983 zeigen die Brisanz, die dann<br />
entsteht, wenn die Beschäftigteninteressen dieser Gruppe betrieblich nicht<br />
mehr eingelöst werden <strong>und</strong> sie dadurch ganz auf die Verliererstraße geraten.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Dritte Gruppe: Die Arbeiter in den krisenbestimmten Branchen. Sie<br />
sind schon Verlierer. Bei kollektiver Betroffenheit, d.h. bei Betriebsstillegungen,<br />
ist hier ein sehr hohes Aktivitätspotential gegeben. Die Betriebsbesetzungen<br />
in der Werftindustrie 1983 deuten dies an. Das Verhalten dieser<br />
Gruppen im Rationalisierungsprozeß ist zumeist nicht gegen betriebliche<br />
Rationalisierung gerichtet, sondern gegen „falsche" Betriebskonzepte bzw.<br />
gegen den gänzlichen Verzicht auf Rationalisierungsbemühungen, die das<br />
Überleben des Betriebes vielleicht sichern könnten.<br />
Vierte Gruppe: Die Risiko träger am Arbeitsmarkt <strong>und</strong> vor allem die<br />
Dauerarbeitslosen. Sie werden noch stärker ins Ghetto der Dauerarbeitslosigkeit<br />
verbannt, weil mit den neuen Produktionskonzepten die Außenabschottung<br />
der Betriebe ebenso wächst wie die spezifischen Qualifikationsnachfragen.<br />
Ein konkreter Bezug auf betriebliche Rationalisierungskonzepte<br />
fällt bei dieser Gruppe zwangsläufig weg.<br />
Das Ende der Arbeitsteilung im Inneren der Zentren der Industrieproduktion<br />
fällt also zusammen mit einer tendenziellen Verschärfung der Abgrenzung<br />
nach außen. Deshalb sprechen wir auch von der Segmentierung<br />
als einer neuen Variante der Polarisierung. Seit den unmittelbaren Nachkriegsjahren<br />
sind die Lageunterschiede innerhalb der Arbeiterschaft noch<br />
nie so groß gewesen wie jetzt. Noch nie sind die mit industrieller Arbeit<br />
verknüpften Risiken <strong>und</strong> Chancen unter den Arbeitern so unterschiedlich<br />
verteilt gewesen wie heute.<br />
XII<br />
Es ist dieses Novum, das uns dazu veranlaßt, im Hinblick auf die gegenwärtige<br />
Phase der <strong>gesellschaftliche</strong>n Entwicklung den Begriff der Neoindustrialisierung<br />
einzuführen. Neo- in Abgrenzung zur Reindustrialisierung, einem<br />
durch einen korporativistischen Politikansatz zur Förderung des vernachlässigten<br />
Investitionsgütersektors in den USA plötzlich hochgespielten Terminus.<br />
Reindustrialisierung redet der Wiederentdeckung der industriellen<br />
Kernsektoren das Wort <strong>und</strong> fordert ausschließlich Erneuerung der Infrastruktur<br />
auf der Basis der neuen Technologien. Neoindustrialisierung soll<br />
mehr ausdrücken: eine an die Substanz gehende Neufassung des Begriffs<br />
kapitalistischer Rationalisierung. Der Prozeß, den wir damit benennen wollen,<br />
meint nicht Restitution von Bekanntem, sondern Eindringen in Neuland<br />
— neue Produktionskonzepte auch <strong>und</strong> gerade durch einen anderen<br />
Umgang mit der lebendigen Arbeit. Neoindustrialisierung verstehen wir entsprechend<br />
nicht als technologisches Phänomen, sondern als einen komplexen<br />
U<strong>mb</strong>ruch der Industriestruktur, für den uns der arbeitspolitische Paradigmenwechsel<br />
in den Betrieben konstitutiv zu sein scheint.<br />
Obgleich wir die Eingeb<strong>und</strong>enheit der neuen Produktionskonzepte in<br />
die industriellen Kernsektoren sehen müssen, markiert ihre Entstehung <strong>und</strong><br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Verallgemeinerung einen Vorgang von übersektoraler, man kann ruhig sagen:<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>r Bedeutung. Im Gravitationsfeld jener Prozesse, die<br />
hier in Rede stehen, werden die Reproduktionsmöglichkeiten <strong>und</strong> Lebenschancen<br />
innerhalb der Gesellschaft umverteilt. In dem Maße, in dem auf der<br />
Gr<strong>und</strong>lage der neuen Produktionskonzepte die Modernisierung der industriellen<br />
Kernsektoren gelingt, werden diese Bereiche zu ökonomischen<br />
Machtzentren, aus denen für jeden etwas abfällt, der zu ihnen Zugang hat<br />
<strong>und</strong> behält. Auch wenn hinter den krisenhaften Zuspitzungen in den Grenzsektoren<br />
industrieller Produktion <strong>und</strong> im Arbeitslosen-Segment des Arbeitsmarktes<br />
ein ganzes Bündel von Gründen steckt: Am Elend dieser Bereiche<br />
ist die Modernisierung der industriellen Kernsektoren als eine Ursache<br />
durchaus mitbeteiligt. Teils sind es die Abwälzungsstrategien, mit denen die<br />
mächtigen Kernsektoren einen Teil der „Kosten" ihrer Modernisierungserfolge<br />
„sozialisieren"; teils sind es aber auch Abschottungspraktiken, mit<br />
denen sich die Branchen des Kernbereichs einer solidarischen Übernahme<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>r Aufgaben entziehen. Das Vorhandensein solcher Mechanismen<br />
bedeutet allemal, daß die Kernsektoren in einem gewissen Maße<br />
zu Lasten anderer Bereiche gedeihen.<br />
In diesen disparitären Lebensverhältnissen sind große Probleme der <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Integration begründet. Wenn die von uns beobachteten Segmentierungstendenzen<br />
weiter verstärkt <strong>und</strong> verfestigt werden, dann wird<br />
Neoindustrialisierung in die sogenannte Zwei-Drittel-Gesellschaft einmünden.<br />
Gelänge es aber, durch eine am Begriff gesamt<strong>gesellschaftliche</strong>r Rationalität<br />
orientierte Politik der Modernisierung die disparitären, betrieblich<br />
bornierten Momente auszugleichen, dann könnte Neoindustrialisierung<br />
langfristig zu <strong>gesellschaftliche</strong>m Fortschritt führen.<br />
Auf den großen Segelschiffen im Zeitalter der Entdeckungen hatte der<br />
Mann im Ausguck einen reizvollen, aber reichlich riskanten Platz. Er konnte<br />
abstürzen oder gar das Schiff auf Gr<strong>und</strong> setzen. Mancher schlechte Ausrufer<br />
soll als Strafe auf einer einsamen Insel ausgesetzt worden sein.<br />
Über so harte Sanktionen verfügt unser Fach glücklicherweise nicht. Wir<br />
wissen, daß unsere Voraussage, mit neuen Produktionskonzepten werde<br />
der Duktus kapitalistischer Rationalisierung gr<strong>und</strong>legend verändert, für Sie<br />
zunächst nur eine These sein kann. Unserem eigenen Anspruch auf empirische<br />
Belege sowie auf Transparenz <strong>und</strong> Nachvollziehbarkeit der Argumentation<br />
konnten wir in unserem Vortrag kaum genügen. Aber Sie haben ja die<br />
Möglichkeit, die im Untersuchungsbericht enthaltenen Details in Ruhe zu<br />
prüfen. Den Skeptikern bleibt im übrigen der Trost: Irrtümer in einer<br />
1<br />
Analyse, in der es auch um Antizipation geht, werden ans Licht kommen<br />
— durch den Gang der Dinge.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ANMERKUNG<br />
1 Horst Kern, Michael Schumann, Das Ende der Arbeitsteilung? Rationalisierung in<br />
der industriellen Produktion: Bestandsaufnahme, Trendbestimmung, <strong>München</strong><br />
1984.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Kommentare zum Beitrag von<br />
Kern, Schumann<br />
EINIGE KRITISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUM ENDE DER ARBEITS<br />
TEILUNG<br />
Klaus Düll<br />
Horst Kern hat die tragenden Gedankengänge der Konzeption einer „Neoindustrialisierung"<br />
so brillant vorgetragen, daß der Korreferent vor der unbequemen<br />
Wahl steht, die Rolle des Claqueurs oder die des notorischen<br />
Nörglers zu übernehmen. Als Ausweg bietet sich wohl nur die Flucht nach<br />
vorn: Ich will versuchen, die Gedanken, die mir bei der Lektüre des Referatstextes<br />
<strong>und</strong> des neuen Buches durch den Kopf geschossen sind (<strong>und</strong> die<br />
auch in den Diskussionen mit Norbert Altmann, Günter Bechtle <strong>und</strong> anderen<br />
Kollegen aus dem <strong>ISF</strong> auftauchten), zu einer immanenten Kritik zu verdichten<br />
<strong>und</strong> auf ihrer Basis einige Gegenthesen aufzustellen.<br />
Mit diesen Gegenthesen will ich nicht das Verdienst schmälern, das<br />
Horst Kern <strong>und</strong> Michael Schumann für das spannende Unternehmen zukommt,<br />
mit den Methoden einer Follow-Up-Studie zu prognostischen Aussagen<br />
über die Entwicklung kapitalistischer Rationalisierung vorzustoßen<br />
<strong>und</strong> in ihrem Lichte bisherige — <strong>und</strong> vor allem auch eigene — industriesoziologische<br />
Ergebnisse zu überprüfen <strong>und</strong> zu revidieren. Wenn ich in den folgenden<br />
Thesen einige ihrer Argumente <strong>und</strong> Schlußfolgerungen in Zweifel<br />
ziehe, so geschieht dies vor allem deshalb, weil ich diesen eine zentrale Bedeutung<br />
für die Diskussion um eine prognose-orientierte <strong>und</strong> prognosefähige<br />
Industrie<strong>soziologie</strong> zumesse. Ich will meine Thesen auf die drei folgenden<br />
Fragen konzentrieren:<br />
1. Reichen die von Kern/Schumann vorgetragenen Ergebnisse <strong>und</strong> Argumente<br />
aus, um die weitreichende These eines arbeitspolitischen Paradigmenwechsels<br />
im Rahmen kapitalistischer Rationalisierung zu stützen?<br />
2. Berechtigen die von Kern/Schumann vorgestellten Bef<strong>und</strong>e dazu, in<br />
neuen Produktionskonzepten Ansatzpunkte einer konsistenten <strong>und</strong> verall-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
gerneinerungsfähigen Modernisierungspolitik zu sehen, die es bei allem<br />
Wenn <strong>und</strong> Aber auch politisch zu unterstützen gilt?<br />
3. Und schließlich: Heißt die in den Thesen von Kern/Schumann enthaltene<br />
Aufforderung zu einer Ex-ante-Empirie <strong>und</strong> zu vorausschauender<br />
Interpretation, daß die Industrie<strong>soziologie</strong> ihr Selbstverständnis <strong>und</strong> ihre<br />
theoretischen Prämissen allein deshalb zum alten Eisen werfen muß?<br />
Um die erste Frage zu beantworten, ist es notwendig, sich über einen<br />
Schlüsselbegriff der Konzeption von Kern/Schumann klar zu werden, nämlich<br />
über den Stellenwert der „neuen Produktionskonzepte". Bilden die Planungen<br />
<strong>und</strong> policies des Managements wesentliche Inhalte ab, die einer veränderten<br />
Struktur der Kapitalverwertungsstrategien entsprechen, bringen<br />
sie also einen Paradigmenwechsel zum Ausdruck? Unterstellt man allerdings<br />
nicht von Anfang an einen Gleichklang zwischen Managementkonzeptionen<br />
<strong>und</strong> der realen Durchsetzung von Strategien der Kapitalverwertung, dann<br />
wird die Frage nach dem Realitätsgehalt von „neuen Produktionskonzepten"<br />
zum Prüfstein einer darauf aufbauenden, vorausschauenden Industrie<strong>soziologie</strong>.<br />
Nun entsprechen die „neuen Produktionskonzepte" in ihrem Inhalt ja<br />
vielfach Bef<strong>und</strong>en, die andere <strong>und</strong> auch unsere eigenen Analysen veränderter<br />
Formen der Nutzung von Arbeitskraft zutage gefördert haben. Als<br />
Stichworte seien genannt: die These der facharbeitergestützten Rationalisierung<br />
oder die These einer qualitativ veränderten Leistungspolitik im Zusammenhang<br />
mit Maßnahmen der Arbeitsstrukturierung. Nur berechtigen<br />
diese Bef<strong>und</strong>e nicht — <strong>und</strong> damit beginne ich mit meiner ersten Gegenthese<br />
—, von einem Paradigmenwechsel kapitalistischer Rationalisierung zu<br />
sprechen. Das, was wir beobachten, ist ein Formwandel kapitalistischer<br />
Rationalisierung insofern, als Formen der Nutzung von Arbeitskraft entwickelt<br />
<strong>und</strong> durchgesetzt werden, die die immanenten Schranken tayloristischer<br />
<strong>und</strong> fordistischer Produktionsmodelle zu überwinden trachten oder<br />
aber den Einsatz des Arbeitsvermögens an den veränderten Nahtstellen der<br />
Mensch-Maschine-Systeme neu bestimmen. Es ist nun wahrlich keine neue<br />
Einsicht, daß die Betriebe beim erweiterten Zugriff auf das Arbeits- <strong>und</strong><br />
Leistungsvermögen vorhandene oder verfügbare Qualifikationen nutzen<br />
oder sie als Überschußqualifikation bereithalten, ja in den Grenzen ihrer<br />
Nutzungsinteressen Qualifikationen auch neu aufbauen. Darin kommt aber<br />
kein „an die Substanz gehender" arbeitspolitischer Paradigmenwechsel zum<br />
Ausdruck, sondern in der Tat die unveränderte Logik der Kapitalverwertung,<br />
die darin besteht, auf dem jeweils erreichten Niveau der Produktivkraft<strong>entwicklung</strong><br />
die historisch gegebenen Schranken der Nutzung von Arbeitskraft<br />
hinauszuschieben. In diesem Sinne war auch in der Vergangenheit<br />
das „Residuum lebendiger Arbeit" niemals nur potentieller Störfaktor;<br />
lebendige Arbeit wird immer zu einem Störfaktor nur insoweit, als die historisch<br />
durchgesetzten Formen ihrer Nutzung die Verwertungsstrategien<br />
des Kapitals beschränken.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Zur zweiten Frage: Das Postulat einer <strong>gesellschaftliche</strong>n Modernisierungspolitik,<br />
die sich die „neuen Produktionskonzepte" zunutze macht,<br />
baut in der von Kern/Schumann vorgetragenen Argumentation zumindest<br />
auf den drei folgenden Voraussetzungen auf:<br />
(1) daß die „neuen Produktionskonzepte" sich mit großer Breitenwirkung<br />
durchsetzen;<br />
(2) daß die „neuen Produktionskonzepte" in den Kernsektoren der Industrie<br />
eine Professionalisierung der Produktionsarbeit einleiten;<br />
(3) <strong>und</strong> schließlich, daß den Arbeitskräften, die auf der Seite der Rationalisierungsgewinner<br />
stehen, eine neue bargaining power gegenüber dem Management<br />
zuwächst.<br />
Gegen alle drei Voraussetzungen lassen sich einige Bedenken ins Feld führen:<br />
Erstens: Viele von Kern/Schumann selbst vorgetragenen Belege — aber<br />
auch unsere eigenen Bef<strong>und</strong>e — deuten darauf hin, daß veränderte Formen<br />
der Nutzung von Arbeitskraft, die beim Einsatz neuer Technologien durchgesetzt<br />
werden, einen insularen Charakter aufweisen. Dies gilt insbesondere<br />
für den Bereich der Massenfertigung, aber auch im Werkzeugmaschinenbau<br />
sind die zukünftigen Entwicklungslinien — auch nach den Aussagen von<br />
Kern/Schumann — durchaus offen. (Die Chemie-Industrie mag hier in der<br />
Tat einen Sonderfall darstellen.) Neue Produktionskonzepte entstehen<br />
— nicht zufällig — an jenen Schnittstellen des betrieblichen <strong>und</strong> zwischenbetrieblichen<br />
Produktionszusammenhangs, die als die größten Barrieren<br />
zeitökonomischer Rationalisierung wirksam wurden <strong>und</strong> die bei dem Einsatz<br />
neuer Technologien besonders hohe Rationalisierungspotentiale versprechen;<br />
dies führt in der Regel zu neuen Formen der Abspaltung <strong>und</strong><br />
Gliederung von Produktions- <strong>und</strong> Arbeitsprozessen zu neuen Formen differentiellen<br />
Arbeitskräfteeinsatzes. Der insulare Charakter „neuer Produktionskonzepte"<br />
ist nicht das Ergebnis von „Halbherzigkeiten" oder von<br />
Erprobungssperren oder auch von differentiellen Positionsinteressen auf Seiten<br />
des Managements, sondern entspricht der Logik kapitalistischer Rationalisierung:<br />
nämlich die in Arbeitskraft <strong>und</strong> in neuen Technologien angelegten<br />
Ressourcen isoliert <strong>und</strong> partikular zu nutzen, diese aber gleichzeitig<br />
durch Organisierung des Produktionszusammenhangs <strong>und</strong> durch Strukturierung<br />
des betrieblichen Gesamtarbeiters zu integrieren <strong>und</strong> zu optimieren.<br />
Gerade der Einsatz neuer Informations- <strong>und</strong> Steuerungstechnologien begünstigt<br />
die Vernetzung von Produktionsprozessen mit unterschiedlichem<br />
technischem Niveau <strong>und</strong> erleichtert Insellösungen, ohne die Möglichkeiten<br />
betrieblicher Kontrolle über Produktionsprozesse <strong>und</strong> Arbeitskraft einzuschränken.<br />
Zweitens: Ich bestreite durchaus nicht, daß mit dem Einsatz neuer<br />
Technologien auch neue Formen der Nutzung von Arbeitskraft mit einem<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ganzheitlichen Aufgabenzuschnitt durchgesetzt werden. Daraus allein kann<br />
aber nicht auf eine allgemeine Tendenz der Professionalisierung der Produktionsarbeit<br />
in den industriellen Kernsektoren geschlossen werden. Ein ganzheitlicher<br />
Aufgabenzuschnitt <strong>und</strong> der erweiterte Zugriff auf das Arbeits<strong>und</strong><br />
Leistungsvermögen enthalten ja nicht nur eine qualifikatorische, sondern,<br />
<strong>und</strong> dies sogar in erster Linie, eine leistungspolitische Komponente.<br />
Bei der Neubestimmung der betrieblichen Leistungspolitik verbinden sich<br />
fachliche Anforderungen immer enger mit neuen Anforderungen an Verhalten<br />
<strong>und</strong> Belastbarkeit; die erweiterte Fachkompetenz reicht — nach allen<br />
unseren Erfahrungen — gerade so weit wie der betriebliche Leistungsanspruch.<br />
Auch in den Bef<strong>und</strong>en von Kern/Schumann bleiben schließlich der<br />
Einsatz von Produktionsfacharbeitern im traditionellen Angelerntenbereich<br />
<strong>und</strong> der Aufbau neuer technischer Qualifikationen im herkömmlichen<br />
Facharbeiterbereich quantitativ begrenzt.<br />
Drittens: Ich muß gestehen, daß mir der innere logische Zusammenhang<br />
von zwei zentralen Thesen verschlossen geblieben ist: der These nämlich,<br />
daß die neuen Produktionskonzepte für die Kapitalverwertung keine Gefahren,<br />
sondern Chancen enthalten, <strong>und</strong> der gleichzeitig vertretenen These, daß<br />
die Rationalisierungsgewinner in den Kernsektoren über eine verbesserte<br />
bargaining power verfügen. Die Begründung für die These, daß die Unternehmen<br />
bei der Durchsetzung neuer Produktionskonzepte den „Arbeitern<br />
auch etwas bieten" müßten, um sie zu „Protagonisten der Modernisierung"<br />
zu machen, leuchtet mir angesichts andauernder Massenarbeitslosigkeit <strong>und</strong><br />
deutlich verbesserter Selektionschancen der Betriebe auf den internen <strong>und</strong><br />
externen Arbeitsmärkten ganz <strong>und</strong> gar nicht ein. Mir scheint, daß sich<br />
Kern/Schumann mit ihren — ja sicherlich richtigen <strong>und</strong> wichtigen — Segmentationsthesen<br />
<strong>und</strong> einer vielleicht allzu glatten typologischen Unterscheidung<br />
in Rationalisierungsgewinner, -dulder, -Verlierer <strong>und</strong> Dauerarbeitslose<br />
den Blick auf die Selektionsmechanismen verstellen, die bei der<br />
Konstitution der Kerngruppen, also der Gewinner, wirksam werden. Es sind<br />
aber gerade Selektionsmechanismen, die den betrieblichen Kontroll- <strong>und</strong><br />
Leistungsanspruch über die neu entstehenden Kerngruppen sichern <strong>und</strong><br />
deren bargaining power von vornherein begrenzen. Auch scheint mir, daß<br />
eine theoretische Tradition, die aufbaut auf der identitätsstiftenden Kraft<br />
ganzheitlicher Arbeitsvollzüge, den Blick für die Doppelbödigkeit von Nutzungsformen<br />
trübt, die die Arbeitskraft mit ihren motivationalen Fähigkeiten<br />
auch als Person dem Verwertungsprozeß unterwerfen.<br />
Meine zweite Gegenthese lautet also: Neue Produktionskonzepte setzen<br />
sich nicht generell, sondern überwiegend nur inselförmig durch <strong>und</strong> führen<br />
nicht zu einer weitreichenden Reprofessionalisierung der Produktionsarbeit.<br />
Der Inselcharakter „neuer Produktionskonzepte" stellt ein Element betrieblicher<br />
Strategie dar. Solche Konzepte sind verb<strong>und</strong>en mit einem verschärften<br />
Kontroll- <strong>und</strong> Leistungsanspruch der Betriebe, die ihrerseits Selektionsmechanismen<br />
auch nutzen, um relevante bargaining power neu entstehender<br />
Kerngruppen ex ante zu blockieren. „Neue Produktionskonzepte" sind<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
damit nicht der Angelpunkt einer verallgemeinerungsfähigen <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Modernisierungspolitik, sondern verlangen umgekehrt von den Gewerkschaften<br />
<strong>und</strong> den Betriebsräten neuartige Formen der Interessenvertretung<br />
<strong>und</strong> der Steuerungs- bzw. Schutzpolitik — auch für die Gruppe der<br />
„Rationalisierungsgewinner".<br />
Zur dritten Frage: Man kann Horst Kern <strong>und</strong> Michael Schumann nicht<br />
Mut absprechen, wenn sie da oben im Ausguck den Blick in die Ferne wagen,<br />
aber die Gefahr ist groß, daß sie die Riffe nicht rechtzeitig erkennen.<br />
Der Aufforderung an die Industrie<strong>soziologie</strong>, prognosefähige Ansätze <strong>und</strong><br />
prognostische Aussagen zu liefern, kann sich kein Vertreter unseres Faches<br />
mit ernsthaften Argumenten widersetzen. Die Frage ist nur, ob der auch<br />
von Kern/Schumann erhobene <strong>und</strong> pauschale Vorwurf, die Industrie<strong>soziologie</strong><br />
habe bisher nur Ex-post-Analysen geliefert, berechtigt ist <strong>und</strong> ob der<br />
von ihnen propagierte Weg der Ex-ante-Empirie <strong>und</strong> der vorausschauenden<br />
Interpretation wirklich den Königsweg darstellt, der die Industrie<strong>soziologie</strong><br />
zu neuen Höhen führt. Was den ersten Gesichtspunkt betrifft, so ist man in<br />
einer ersten Reaktion dazu geneigt, Kern/Schumann alt gegen Kern/Schumann<br />
neu in Schutz zu nehmen. Schließlich hat „Industriearbeit <strong>und</strong> Arbeiterbewußtsein"<br />
ja deshalb allgemeine <strong>und</strong> prognostische Aussagen über den<br />
Gang kapitalistischer Rationalisierung zutage gefördert, weil in empirisch<br />
gehaltvollen Analysen die Konzepte <strong>und</strong> Ideologien des Managements mit<br />
harten Fakten betrieblicher Wirklichkeit konfrontiert wurden. Hierfür ist<br />
die Polarisierungsthese in der Tat ein „hübsches Beispiel". Was den zweiten<br />
Gesichtspunkt betrifft, so bezweifle ich, ob der Rückgriff auf eine phänomenologisch<br />
ausgerichtete „verstehende" Soziologie wirklich die tragfähige<br />
Brücke sein kann, die über den Abgr<strong>und</strong> führt, der zwischen kapitaltheoretischen<br />
Annahmen <strong>und</strong> der Analyse betrieblicher Wirklichkeit klafft. Das<br />
Bild ganzheitlicher Arbeit als Gegenbild zur Arbeitsteilung, das in der Frühgeschichte<br />
unserer Disziplin Proudhon <strong>und</strong> Marx entgegensetzt (<strong>und</strong> in der<br />
französischen Industrie<strong>soziologie</strong> zu einer berühmt gewordenen Kontroverse<br />
zwischen G. Friedmann <strong>und</strong> P. Naville geführt) hat, paßt zu fugenlos zu<br />
dem Postulat einer ganzheitlichen Methode, als daß man den Vater des Gedankens<br />
nicht erahnen könnte. Die Ex-ante-Empirie, in der Ex-post-Analysen,<br />
Adäquanzüberlegungen <strong>und</strong> ganzheitliche Zusammenschau eine neuartige<br />
Verbindung eingehen, <strong>und</strong> in der das Bandbreitentheorem eine<br />
methodische Schlüsselstellung einnimmt, mag es erlauben, Rationalisierungskonzepte<br />
in der „Inkubationszeit" zu erkennen <strong>und</strong> die empirischen<br />
Einzelbef<strong>und</strong>e gewissermaßen gegen den Strich zu bürsten; sie birgt aber<br />
gleichzeitig die Gefahr in sich, daß die einmal identifizierten Konzeptionen<br />
gegen empirische Gegenbeweise immunisiert werden — das Bandbreitentheorem<br />
erlaubt Abweichungen, zwingt aber nicht dazu, darin Gegentendenzen<br />
zu erkennen.<br />
Mir scheint — <strong>und</strong> damit leite ich meine letzte Gegenthese ein —, daß<br />
nur die geduldige Weiterarbeit an dem freilich ungelösten Problem der Vermittlung<br />
zwischen kapitaltheoretischen Annahmen <strong>und</strong> der Analyse empi-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
isch <strong>und</strong> historisch erfahrbarer Wirklichkeit der Industrie<strong>soziologie</strong> jene<br />
Prognosefähigkeit sichern oder neu beschaffen kann, die sie heute dringender<br />
benötigt denn je. Dieses aber setzt voraus, daß Managementkonzeptionen<br />
auf die eigenen, ihnen innewohnenden <strong>und</strong> durchaus widersprüchlichen<br />
Interessenstrukturen zurückgeführt <strong>und</strong> ihrerseits gegen den Strich gebürstet<br />
werden.<br />
Ich weiß nur zu gut, daß das Postulat — oder vielleicht besser das Desiderat<br />
—, die Industrie<strong>soziologie</strong> könne prognostische Aussagen nur auf der<br />
Gr<strong>und</strong>lage einer ausgebauten Theorie kapitalistischer Rationalisierung entwickeln,<br />
solange Gefahr läuft, „Klinkengeld für offene Türen zu bezahlen",<br />
als konkrete Wege seiner Umsetzung nicht aufgezeigt sind. Aber vielleicht<br />
gibt das andere — scheinbar paradoxe — Postulat zu denken, daß eine<br />
vorausschauende Industrie<strong>soziologie</strong> nur historisch verfahren könne. Dies<br />
bedeutet, daß prognostische Aussagen nur dort gelingen, wo mit Ex-post<br />
Analysen <strong>und</strong> präzisen Bestandsaufnahmen die Potentiale der Produktivkraft<strong>entwicklung</strong><br />
ausgemacht werden, die betriebliche Strategien nutzen<br />
können, um die jeweiligen historischen Schranken der Kapitalverwertung<br />
<strong>und</strong> -realisierung zu überwinden. An diesen Schranken werden aber gleichzeitig<br />
die Chancen höherer individueller <strong>und</strong> kollektiver Handlungsautonomie<br />
durch die Kontroll- <strong>und</strong> Herrschaftsinteressen der Betriebe begrenzt.<br />
Es ist zweifellos eines der Verdienste des neuen Buches von H. Kern <strong>und</strong><br />
M. Schumann, daß es auch die Skeptiker unter uns zwingt, über Voraussetzungen<br />
<strong>und</strong> Chancen einer Politik der „Neoindustrialisierung" genauer<br />
als bisher nachzudenken. Sinn dieser Anmerkungen war es, auf die leistungspolitischen<br />
Aspekte <strong>und</strong> die Kontrollinteressen der Betriebe aufmerksam<br />
zu machen, die mit dieser Entwicklung verknüpft sind, Implikationen,<br />
die gerade jene sich mit besonderer Schärfe vor Augen halten müssen, die<br />
darin auch Ansatzpunkte einer <strong>gesellschaftliche</strong>n Politik der Modernisierung<br />
erkennen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ANMERKUNGEN ZUM KONZEPT EINER INDUSTRIELLEN<br />
'MODERNISIERUNG ALS GESELLSCHAFTLICHEM PROJEKT'<br />
Rudi<br />
Schmidt<br />
Der provozierende Titel des neuen Buches von Kern/Schumann „Ende der<br />
Arbeitsteilung?"* tut schon allenthalben seine Wirkung. Die von den Autoren<br />
zur Beantwortung dieser Frage in die Debatte geworfenen Begriffe wie<br />
„Neoindustrialisierung", „Reprofessionalisierung" geben den von ihnen<br />
beobachteten „neuen Produktionskonzepten" <strong>und</strong> den Aufgabenerweiterungen<br />
an den technologisch gr<strong>und</strong>legend veränderten Arbeitsplätzen in<br />
zentralen Bereichen dreier Kernbranchen der deutschen Industrie ein programmatisches<br />
Gewicht. Über die damit benannten neuen Inhalte scheint<br />
ein Pfad in eine technologische <strong>und</strong> arbeitspolitische Entwicklung eröffnet,<br />
welche nach ihrer Vorstellung in eine nicht allein den Kapitalinteressen<br />
dienende „Politik der Modernisierung" münden soll <strong>und</strong> zu „langfristigem<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>n Fortschritt" (a.a.O., S. 23) führen könnte.<br />
Ist damit der säkulare Kompromiß gef<strong>und</strong>en zwischen Kapital <strong>und</strong> Arbeit<br />
unterhalb des unversöhnlichen Klassenantagonismus?<br />
„Visionen sind wieder gefragt" heißt es kokett zu Beginn des 7. Kapitels<br />
ihres neuen Buches. Und sie stehen nicht an, gleich damit aufzuwarten.<br />
Ihr Mut ist zu bew<strong>und</strong>ern, denn Propheten hatten seit jeher einen schwierigen<br />
Stand. Eben haben wir von Klaus Düll gehört, wie massiv die Einwände<br />
vorgetragen werden; <strong>und</strong> es dürften sicher nicht die einzigen bleiben.<br />
Nun verfahren Kern/Schumann in der ausführlichen Präsentation ihrer<br />
differenzierten Bef<strong>und</strong>e sehr behutsam <strong>und</strong> sichern sich vielfach konjunktivisch<br />
ab. Eine in zehn, fünfzehn Jahren vorgenommene Bestandsaufnahme<br />
fände kaum Anlaß zur Kritik, wenn sich die aufgezeigten Anzeichen einer<br />
neuen arbeitspolitischen Entwicklung als insulare Prozesse ohne nachhaltige<br />
Diffusion herausstellen sollten. Uberhaupt sollte bei aller Kritik an den<br />
visionären Ausblicken nicht übersehen werden, daß hier die gegenwärtig<br />
wohl umfassendste <strong>und</strong> differenzierteste Gesamtanalyse dreier Industriebranchen<br />
mit zentraler wirtschaftlicher Bedeutung vorgelegt worden ist, die<br />
auch für die weiterführenden Diskussionen ein F<strong>und</strong>ament bleiben wird.<br />
Problematisch sind ja in erster Linie die Interpretationen der Beobachtungen,<br />
die zuweilen allzu schlanken, euphorischen Konklusionen, aus denen<br />
die jetzt angefachte Debatte auch ihre Schärfe bezieht.<br />
Trendbestim<br />
Rationalisierung in der industriellen Produktion: Bestandsaufnahme,<br />
mung, <strong>München</strong> 1984<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Wenn ich auch die Düllschen Einwände überwiegend teile <strong>und</strong> deshalb<br />
hier nicht wiederholen will, so sehe ich doch in den über den empirischen<br />
Sachverhalt hinausreichenden perspektivischen Überlegungen keinen netzlosen<br />
Drahtseilakt, sondern einen wichtigen provokatorischen Anstoß, der<br />
nicht in der Kritik am z.T. ungesicherten Wirklichkeitsbezug verloren gehen<br />
sollte.<br />
Man muß sich das nur drastisch genug vor Augen führen: da, wo alle kritischen<br />
Geister nur auf die negativen Folgen gegenwärtiger <strong>und</strong> erst recht<br />
künftiger Rationalisierung weisen <strong>und</strong> nur zu düsteren Gesamtanalysen gelangen:<br />
dauerhafte <strong>und</strong> eher noch ansteigende Massenarbeitslosigkeit, eine<br />
durch Mitgliederauszehrung <strong>und</strong> Interessendivergenz geschwächte Gewerkschaftsbewegung,<br />
eine konservative Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialpolitik der Privatisierung<br />
von materieller Not <strong>und</strong> Daseinsfürsorge da treten Kern <strong>und</strong><br />
Schumann auf den Plan <strong>und</strong> verkünden das Projekt der 'Modernisierung'<br />
mit der gesellschaftsimmanenten Intention technologischer <strong>und</strong> arbeitsstruktureller<br />
Erneuerungen unter weiterhin kapitalistischen Vorzeichen.<br />
Wo Defätismus um sich greift, Aussteigermentalität in Richtung auf<br />
eine '2. Gesellschaft' sich breitmacht <strong>und</strong> auch Industriesoziologen aus dem<br />
Scheitern zu weit gespannter sozialreformerischer Hoffnungen eines staatlich<br />
initiierten Programms der 'Humanisierung der Arbeit' die resignative<br />
Konsequenz ziehen, den irreversiblen Restriktionen im 'Reich der Notwendigkeit'<br />
sei nur mit permanenten Arbeitszeitverkürzungen beizukommen<br />
<strong>und</strong> im übrigen in die Distanz des unbeteiligten Beobachters sich zurückziehen,<br />
da setzen Kern <strong>und</strong> Schumann die entschiedene These entgegen,<br />
daß das Industriesystem „als conditio sine qua non weiteren <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Fortschritts" aufgefaßt werden müsse (321), <strong>und</strong> daß die industrielle<br />
Arbeit für den nach wie vor dominanten Typ des Vollzeitarbeiters „eine so<br />
wichtige Handlungssphäre (ist), daß Identitätsbildung nicht losgelöst von<br />
Arbeit erfolgen kann <strong>und</strong> die Perspektive der Lebensautonomie ohne mehr<br />
Autonomie in der Arbeit eine Fiktion bleibt." (326)<br />
Darin sehe ich den Kern ihrer programmatischen Aussagen <strong>und</strong> von hier<br />
aus sind ihre weitreichenden Interpretationen vorerst nur keimhaft erkennbaren<br />
arbeitsorganisatorischen <strong>und</strong> qualifikationspolitischen Wandels im<br />
Gefolge einer sozial beeinflußten technologischen Innovation zu verstehen.<br />
Nur wenn man diese Gr<strong>und</strong>annahme teilt — <strong>und</strong> nicht die Fähigkeit des<br />
Subjekts zu rigorosem Instrumentalismus <strong>und</strong> zu einer nichtpathologischen<br />
dichotomischen Existenz unterstellt — wird man überhaupt bereit sein, sich<br />
auf den von Kern/Schumann aufgezeigten Pfad zu begeben <strong>und</strong> allen eben<br />
sichtbaren Anzeichen für eine „Wiedereinführung <strong>und</strong> Verankerung von<br />
Produktionsintelligenz" (322) <strong>und</strong> für einen „ganzheitlichen Aufgabenzuschnitt"<br />
(323) die gleiche hochgespannte Aufmerksamkeit zu leihen.<br />
Nun wäre es sicher falsch, Kern <strong>und</strong> Schumann angesichts der aktuell<br />
negativen Rahmenbedingungen Naivität vorzuhalten; ihre Projektidee der<br />
strukturellen Modernisierung von Industriearbeit hat auch in ihren Augen<br />
nur Chancen, wenn die „neuen Produktionskonzepte" aus „ihrer privati-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
stischen Verengung" (321) „mit politischen Mitteln befreit" werden (324).<br />
„Eine dem Begriff gerecht werdende Modernisierungspraxis verlangt die<br />
soziale Steuerung der Innovation". (322) Ohne diese Intervention von<br />
außen würden „die <strong>gesellschaftliche</strong>n Disparitäten nur verschärft" (321),<br />
eine 2/3-Gesellschaft etabliert. Indessen, woher soll die politische Intervention<br />
kommen?<br />
Bei den von den Autoren genannten Forderungen für die konkrete<br />
„Ausgestaltung der Modernisierung" werden die Belegschaften, die Betriebsräte<br />
<strong>und</strong> Gewerkschaften auf die Herren Blüm <strong>und</strong> Bangemann nicht<br />
zählen dürfen. Sie sind auf sich selbst verwiesen.<br />
Wie weit reicht gegenwärtig ihre Gestaltungsmacht?<br />
Angesichts einer millionenfachen industriellen Reservearmee vor den<br />
Fabriktoren <strong>und</strong> noch ungewissen, auf unabsehbare Zeit wohl noch nicht<br />
verarbeiteten Spätfolgen der 84er Streiks sieht es im zentralen Metallbereich<br />
für die unerläßlichen 'politischen Interventionen' nicht eben günstig<br />
aus.<br />
Dennoch liegen die Chancen in der aufgezeigten Perspektive, an denen<br />
es festzuhalten gilt. Wenn man die Erwartungen vielleicht nicht so hoch<br />
schraubt <strong>und</strong> statt einer „Modernisierung als <strong>gesellschaftliche</strong>m Projekt"<br />
sich schon mit der systematischen Verbesserung der Lage relevanter Teile<br />
der Industriebelegschaften zufriedengibt, wäre für die gewerkschaftliche<br />
Rationalisierungspolitik vielleicht ein Ausweg aus dem konzeptionslosen<br />
Reagieren gef<strong>und</strong>en. Statt der Praxis monetärer Kompensation von Belastungen<br />
aus dem für unvermeidlich gehaltenen Fortschritt wie in früheren<br />
Jahren, der eher hilflos-restriktiven Reaktion, wie es gegenwärtig zu beobachten<br />
ist, ließen sich hieraus Anhaltspunkte für eine offensive Rationalisierungspolitik<br />
der Gewerkschaften entwickeln, die ihren Ausstrahlungseffekt<br />
auch auf andere Arbeitsbereiche haben könnte. (Vgl. das Referat<br />
von E. Hildebrandt/R, Seltz, S. 434 ff.)<br />
Dies setzt freilich eine intensivierte Betriebsarbeit <strong>und</strong> verbesserte<br />
Qualifikation der gewerkschaftlichen Kader voraus; aber um die Bewältigung<br />
dieser Aufgabe kommen die Gewerkschaften ohnehin nicht herum.<br />
Um ein die Debatte nur unnötig verschärfendes Mißverständnis gleich<br />
aus der Welt zu schaffen, möchte ich eine m.E. unzutreffende Interpretation<br />
der von Kern <strong>und</strong> Schumann vorgestellten unterschiedlichen Managementphilosophien<br />
<strong>und</strong> der sich darin ausdrückenden „neuen Produktionskonzepte"<br />
durch Klaus Düll zurechtrücken.<br />
Die beiden Autoren sprechen verschiedentlich von einem veränderten<br />
„Duktus kapitalistischer Rationalisierung", von „einem gr<strong>und</strong>legenden<br />
Wandel der Produktionskonzepte" (Ende der Arbeitsteilung?) <strong>und</strong> von<br />
einem „arbeitspolitischen Paradigmenwechsel"; ich kann mich aber keiner<br />
Passage entsinnen, wo sie — wie Düll es ihnen unterstellt — einem „Paradigmenwechsel<br />
kapitalistischer Rationalisierung" (Düll, S. 399, Hervorhebung<br />
durch Verf.) das Wort reden. In dieser Redeweise vermag ich<br />
ohnehin keinen Sinn zu erkennen; das Verwertungsinteresse industriel-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
len Kapitals zielt immer darauf, die Produktivität lebendiger Arbeit zu<br />
erhöhen. Es kann daher überhaupt nur einen Formenwandel geben. Anderenfalls<br />
hätten wir es mit dem sozialen Wandel zu philanthropischen<br />
Stiftungen zu tun. Schließlich heißt es auch ausdrücklich bei Kern <strong>und</strong><br />
Schumann: „Bei unveränderter Logik der Rationalisierung bilden sich<br />
doch gr<strong>und</strong>legend neue Formen aus."<br />
Andererseits wäre eine präzisere Begrifflichkeit bei der Beschreibung<br />
der neuen Phänomene wünschenswert gewesen. Trotz des wohl unvermeidlichen<br />
Höhenwinds im Ausguck der Visionäre — eine Wendung wie diese<br />
provoziert vermeidbare Mißverständnisse: im Begriff der „Neoindustrialisierung",<br />
heißt es in der Buchfassung, drücke sich „eine an die Substanz gehende<br />
Neufassung des Begriffs kapitalistischer Rationalisierung" aus.<br />
(a.a.O., S. 24)<br />
Wenn ich es recht sehe, treffen auch Dülls kritische Anmerkungen zur<br />
phänomenologischen Methode bei Kern <strong>und</strong> Schumann nicht deren wirkliches<br />
Vorgehen. Ich glaube nicht, daß sie hierdurch einer ganzheitlichen<br />
Methode in der Industrie<strong>soziologie</strong> das Wort reden wollten, die am Ende die<br />
f<strong>und</strong>amentale Widerspruchsstruktur ihres Gegenstands eskamotiert. Der bei<br />
ihnen neue Gedanke ist doch nur, den Betrieb stärker als sozialen Wirkungszusammenhang,<br />
als „Sozialsystem" (34) zu sehen <strong>und</strong> die beteiligten Gruppen<br />
entsprechend ihrer Funktion, Lage <strong>und</strong> ihren Interessen durch die jeweilige<br />
Selbstdarstellung hindurch möglichst umfassend <strong>und</strong> differenziert<br />
auch unter der Perspektive zu beschreiben, daß in ihnen Subjekte im Rahmen<br />
bestimmter, gestaltbarer Spielräume agieren.<br />
Ich finde dies Verfahren legitim <strong>und</strong> meine deshalb, daß Kritik daran<br />
sich nur am Resultat festmachen sollte. In dem damit erzielbaren Ergebnis<br />
sehe ich eher einen Gewinn: denn es verstellt doch den Zugang zu konkreten<br />
Analysen der Konzepte <strong>und</strong> Strategien des Managements, wenn dessen<br />
Vertreter — wie lange Zeit in der polit-ökonomisch verkürzten Diskussion<br />
üblich — bloß als Charaktermasken <strong>und</strong> blinde Exekutoren des Rentabilitätsprinzips<br />
verstanden werden <strong>und</strong> man sie nicht vielmehr als individuelle<br />
Funktionsträger begreift, die angesichts der prinzipiellen Anarchie des<br />
Marktes die Antizipation einer sich als profitabel erweisenden Produktionsgestaltung<br />
aus einer Fülle historisch disparaten, auch spekulativen <strong>und</strong> ideologisch<br />
gefärbten Erfahrungswissens heraus zu treffen haben <strong>und</strong> nicht allein<br />
auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnis, welcher Provenienz auch<br />
immer. Folglich wird es stets unterschiedliche Vorstellungen im Management<br />
darüber geben, wie die notwendigen Anpassungen der Produktionsstruktur<br />
an geänderte ökonomische Erfordernisse vorzunehmen seien. Je<br />
komplexer <strong>und</strong> differenzierter die dem Flexibilitätsgebot folgenden neuen<br />
Produktionsstrukturen gestalten werden, umso weniger kann von einem einheitlichen,<br />
konsistenten Rationalisierungsmuster gesprochen werden; damit<br />
wachsen — zumindest potentiell — auch die arbeitspolitischen Modifikationschancen.<br />
(Vgl. hierzu das Referat von Krohn/Rammert „Technik<strong>entwicklung</strong>:<br />
Autonomer Prozeß oder industrielle Strategie"?, hier S. 411 ff.)<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Rechtfertigt es der auf diese Weise neu in den Blick genommene Spielraum<br />
betrieblicher Rationalisierungspolitik — unter der freilich unveränderten<br />
Maxime der Kapitalrentabilität — von der Existenz zweier so gr<strong>und</strong>legend<br />
verschiedener Managementlinien auszugehen, daß der Sieg der einen<br />
die Verlängerung der Misere von Dequalifikation, Spezialisierung <strong>und</strong> Heteronomie,<br />
der Sieg der anderen aber den <strong>gesellschaftliche</strong>n Fortschritt auf<br />
dem Wege der Entfaltung individueller Fähigkeiten <strong>und</strong> mehr Autonomie<br />
begründen?<br />
Und daran anschließend: können die Vertreter der ,,empirisch-unideologischen"<br />
Linie, die ,,Modernisten" — ihre empirische Relevanz unterstellt —<br />
sich gegenüber den „Technokratisch-Bornierten", den „Traditionalisten" so<br />
weit vom konsensualen Zwang zu einem kompromißfähigen betrieblichen<br />
Rationalisierungsmuster dispensieren, daß sie in der Lage sind, einen „stilbildenden"<br />
Modus herauszubilden <strong>und</strong> einen Sog auszulösen?<br />
Ohne die bereits bekannten Argumente pro <strong>und</strong> contra zu wiederholen,<br />
soll das eher skeptische Resümee der möglichen Antworten anhand ergänzender<br />
Überlegungen gezogen werden.<br />
Die Entwicklung der industriellen Weltmarkt struktur hat zu einer Auslagerung<br />
lohnintensiver Serienfertigung von Gebrauchsgütern aus den hochindustrialisierten<br />
Staaten in die der Dritten Welt <strong>und</strong> in die Schwellenländer<br />
geführt, wovon inzwischen auch klassische Industriebranchen wie die Stahl<strong>und</strong><br />
Werftindustrie erfaßt worden sind. In den kapitalistischen Industriestaaten<br />
konzentriert sich die Fertigung zunehmend auf komplexe Güter<br />
hoher Produktqualität, die sich gegen die Weltmarktkonkurrenz behaupten<br />
können. Ihr verkürzter Innovationszyklus <strong>und</strong> die vor allem durch die Elektronik<br />
mögliche Prozeßinnovation verlangen bzw. erlauben eine komplexe<br />
<strong>und</strong> flexible Produktionsstruktur. Dies erfordert (sichert?/erweitert?) auch<br />
künftig den Einsatz qualifizierter Facharbeit, bei indessen weiterhin sinkendem<br />
Gesamtarbeitsvolumen.<br />
Der steigende Kapitaleinsatz für diese flexiblen Fertigungsstrukturen<br />
relativiert andererseits die Lohnkosten (in einzelnen Sektoren der Metallindustrie<br />
sind sie bereits unter 10 % gesunken) <strong>und</strong> erleichtert die Finanzierung<br />
des Qualifikationsüberschusses von Arbeitskraft als Sicherheitsreserve<br />
gegenüber dem schwer eliminierbaren Rest des maschinellen Störungspotentials.<br />
Die Flexibilitätsanforderungen der komplexen Fertigungsstrukturen<br />
nötigen aber nicht nur zum Einsatz erweiterter Arbeitsqualifikationen,<br />
sondern unterstellen auch ein gewandeltes Arbeitsverhältnis. Bemerkenswert<br />
ist in diesem Zusammenhang die mühelose Integration der durch<br />
konservatives Lamento angezettelten Debatte über den sog. „Wertewandel"<br />
in die strategischen Überlegungen einer progressiven Unternehmerfraktion<br />
zu einer neuen Führungs- <strong>und</strong> Personalpolitik. Der Anspruch auf Selbstverwirklichung,<br />
mehr Autonomie <strong>und</strong> Kreativität, der demzufolge als Resul<br />
1<br />
tat sozio-kulturellen Wandels über die jugendliche Alternativbewegung<br />
hinaus Bedeutung gewonnen habe, fügt sich offenbar besser in das Flexibili-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
tätskonzept als die traditionelle Arbeitsmoral mit ihrem Untertanenkanon<br />
von Pflicht, Fleiß <strong>und</strong> Gehorsam, ohne ganz verzichtbar zu sein. Aber wo<br />
bereits über Arbeitnehmermentalität <strong>und</strong> Risikoscheu in Führungsetagen<br />
geklagt wird, ist eine alternative Subjektivität willkommen, deren erratische<br />
Widerständigkeit man über die betrieblichen Identifikationsangebote<br />
schon glaubt domestizieren zu können.<br />
So weit steht es nicht schlecht um die Chancen der 'Modernisten', ihre<br />
Linie weg von der subjektgleichgültigen Leistungsforderung durchzusetzen,<br />
der Trend der Zeit spräche für sie.<br />
Nun führen Kern/Schumann ihren Nachweis für die These, daß der technologisch<br />
ermöglichte, betriebspolitisch erwünschte arbeitspolitische Paradigmenwechsel<br />
konstitutiv für „einen komplexen U<strong>mb</strong>ruch der Industriestruktur"<br />
sei <strong>und</strong> eine „Neoindustrialisierung" einleite, trotz gegenteiliger<br />
Beteuerung fast ausschließlich mit technologischen Bef<strong>und</strong>en <strong>und</strong><br />
z.T. noch mit arbeitsorganisatorischen Argumenten. Nun ist aber gerade<br />
die technologische Entwicklung <strong>und</strong> d.h. die sich enorm steigernde <strong>und</strong><br />
für unterschiedliche Richtungen offene Prozeßinnovation eher ein Unsicherheitsfaktor<br />
als eine sichere Orientierungsbasis für Prognosen über<br />
eine künftige Industriestruktur. Die von Kern/Schumann einbezogene<br />
Interessenperspektive von Belegschaftsgruppen, Betriebsrat <strong>und</strong> Gewerkschaft<br />
müßte eher noch ernster genommen <strong>und</strong> um weitergehende soziale<br />
<strong>und</strong> gesellschaftspolitische Erwägungen ergänzt werden.<br />
Auch die Managementvertreter der 'traditionalistischen' Rationalisierungsformen<br />
sind um Argumente nicht verlegen. Da im Kampf zweier Linien<br />
um die größere Effizienz <strong>und</strong> die höhere Rentabilität nur die Resultate<br />
zählen, werden die 'Technokratisch-Bornierten', die zur Übertechnisierung<br />
neigen, nicht ruhen, bis sie den Nachweis für das störungsfreie Funktionieren<br />
vollintegrierter flexibler Fertigungssysteme erbringen können oder bis<br />
ihnen z.B. die enge Verknüpfung von CAD- <strong>und</strong> CNC-Maschinen in Richtung<br />
CAD/CAM friktionslos gelingt. Wenn der Übergang vom zweidimensionalen<br />
Entwurf auf die dreidimensionale Konstruktion bewältigt ist, wird<br />
man diesem Ziel einen entscheidenden Schritt nähergerückt sein. Und dann<br />
muß vom Konstrukteur am Bildschirm bis zum Maschinenführer mit der<br />
Kompetenz zur Programmoptimierung arbeitspolitisch alles neu aufgerollt<br />
werden; dies ginge wohl kaum in Richtung des von Kern/Schumann erhofften<br />
erweiterten Aufgabenprofils oder wenn doch, dann um den Preis<br />
einer nochmaligen dramatischen Ausdünnung der Belegschaft. Das bleibende<br />
Aktionsfeld der 'Traditionalisten' begründen auch die von Klaus Düll<br />
schon vorgetragenen Argumente, darunter insbesondere sein Hinweis auf<br />
die Fähigkeit der Unternehmen, Insellösungen' divergierender Produktionsstrukturen<br />
durch die entwickelte Informations- <strong>und</strong> Steuerungstechnologie<br />
kompatibel zu vernetzen.<br />
Wenn also Argumente für eine neue Arbeitspolitik der „fachlichen Souveränität"<br />
beigebracht werden sollen, dann glaube ich nicht, daß sie in<br />
erster Linie aus dem unmittelbar technologischen Begründungszusammen-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
hang zu erlangen sind, sondern aus vielfältigen Rahmenerwägungen, von<br />
den Implikationen einer weltmarktbestimmten Produktqualität bis hin zur<br />
Neuf<strong>und</strong>ierung von Arbeitsmotivationen. Die technologische Entwicklung<br />
schafft die materiellen Bedingungen für die Umsetzung nicht-fordistischer<br />
Produktionskonzepte, erleichtert ihre Realisierung, nur — daß sie auch in<br />
dieser Richtung genutzt wird, ist zum wenigsten immanente technologischorganisatorische<br />
Konsequenz, ist vielmehr ein eminent politisches Problem<br />
der beteiligten Gruppen, vor allem von Belegschaft, Betriebsrat <strong>und</strong> Gewerkschaft.<br />
Sie erhalten mit der Analyse von Kern/Schumann eine perspektivische<br />
Argumentationsgr<strong>und</strong>lage, wie sie bei den anstehenden Rationalisierungen<br />
in technologisch avancierten Teilbereichen der prosperierenden<br />
Industrie auch ihre Forderung nach mehr Entfaltungschancen in der Arbeit,<br />
mehr Mitbestimmung am Arbeitsplatz offensiv, d.h. über eine partielle<br />
Koinzidenz mit einer gewandelten Produktions struktur begründen können.<br />
Das ist weniger, als die Vision einer „Modernisierung der Gesellschaft"<br />
verheißt, aber es könnte mehr sein, als der skeptische Attentismus unserer<br />
Zunft für möglich hält.<br />
ANMERKUNG<br />
1 So inzwischen Mark Wössner in seinem Referat am 23.11.84 auf dem Berliner<br />
'Symposium zur Zukunft der Industriegesellschaft'. Vgl auch Ernst Zander <strong>und</strong><br />
Claus Zoellner in Die Zeit vom 7.12.84<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
TECHNOLOGIEENTWICKLUNG: AUTONOMER PROZESS<br />
UND INDUSTRIELLE STRATEGIE<br />
Wolfgang Krohn, Werner Rammert<br />
Einleitung<br />
Zwei allgemeine Beobachtungen zu den Beziehungen von wissenschaftlichtechnischer<br />
<strong>und</strong> industrieller Entwicklung dürfen auf breite Zustimmung<br />
rechnen:<br />
Die erste Beobachtung ist die einer zunehmenden Verwissenschaftlichung<br />
der technischen Entwicklungen. Man kann dabei die Zunahme anwendungsorientierter<br />
<strong>und</strong> angewandter Wissenschaften im Auge haben, wie<br />
auch die Entstehung von Technikwissenschaften. Achtet man auf institutionelle<br />
Tatbestände, sind die Ergebnisse in beiden Fällen gleich: Zunahme der<br />
Forschungs- <strong>und</strong> Entwicklungslabors, des akademisch qualifizierten Personals,<br />
<strong>und</strong> von Transferinstitutionen, die zwischen Gr<strong>und</strong>lagenforschung <strong>und</strong><br />
technischer Entwicklung vermitteln.<br />
Die zweite Beobachtung ist die einer zunehmenden Industrialisierung<br />
<strong>und</strong> Vergesellschaftung der wissenschaftlich-technischen Forschung, Prozesse,<br />
die sich zunächst auf die Zielplanung <strong>und</strong> auf die Arbeitsorganisation<br />
erstrecken, dann auch auf die veränderten Abhängigkeitsverhältnisse der<br />
Forschung von ihren Ressourcen, <strong>und</strong> schließlich (mit geteilter Zustimmung)<br />
auf die Determination der Entwicklungsrichtungen.<br />
Die beiden Beobachtungen scheinen zueinander gegenläufig zu sein:<br />
entweder Verwissenschaftlichung oder Industrialisierung. „Eine Formulierung<br />
wie 'Industrialisierung der Wissenschaft' läßt sich jedenfalls nicht als<br />
eine selbstverständliche Deskription unproblematischer empirischer Tendenzen<br />
handhaben, sie ist vielmehr als Paradoxon zu definieren." (Hack<br />
1984, 13).<br />
Die Argumentationsziele dieses Aufsatzes sind auf die Bewältigung dieser<br />
paradoxalen, zumindest kontroversen Situation gerichtet. Wir wollen<br />
zeigen, daß reduktionistische Strategien versagen. Reduktionistische Strategien<br />
beabsichtigen, die Dominanz des einen Entwicklungsmusters über<br />
das andere darzustellen. Die Dominanz der Verwissenschaftlichung zu behaupten,<br />
bedeutet letztlich einen Rekurs auf die Annahme, daß die <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Entwicklung durch eine „Logik" der Technologie- oder Wissenschafts<strong>entwicklung</strong><br />
bestimmt sei. Die Dominanz der Vergesellschaftung<br />
zu behaupten, enthält die Annahme, daß die wissenschaftlich-technische<br />
Entwicklung der Steuerung <strong>und</strong> Kontrolle politischer <strong>und</strong>/oder ökonomischer<br />
Instanzen, die ihrer eigenen „Logik" folgen, unterworfen ist oder<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
wird. Beide Formen des Reduktionismus unterstellen, wenn auch mit verschiedenen<br />
Rollenverteilungen, ein statisches Verhältnis der Funktionalisierbarkeit<br />
des einen für das andere.<br />
Aber eine solche Funktionalisierbarkeit ist nicht durchführbar. Wir werden<br />
zeigen, daß es stattdessen zur Ausbildung komplexer Handlungsstrategien<br />
kommt, die sowohl industriell wie wissenschaftspolitisch neu sind. Die<br />
neuen Merkmale sind die Beteiligung von Akteuren aus verschiedenen Lagern,<br />
die Einbeziehung zusätzlicher Kontingenzfaktoren hinsichtlich der<br />
Zukunftserwartungen, die Vermehrung von Eingriffschancen in die Planungsprozesse,<br />
die Abnahme einsinnig wirkender Entscheidungsimperative.<br />
Um die Unterschiede zuzuspitzen, nennen wir den neuen, industrielle <strong>und</strong><br />
forschungsplanende Entscheidungen koordinierenden Strategietypus: wissenschaftlich-reflexiv.<br />
Im günstigen Fall führt eine solche Strategie dazu, sowohl<br />
die Funktionalität der Forschung zu steigern als auch ihre Innovativität.<br />
Damit würde sich ein klassischer Trend der modernen Gesellschaft in<br />
diesem Bereich umkehren: nicht mehr die Ausdifferenzierung von spezialisierten<br />
Handlungssystemen (oder Sozialstrukturen), sondern die Organisation<br />
komplexer, systemübergreifender Handlungsfelder verspricht die<br />
erfolgreichsten Beschleunigungseffekte.<br />
Unsere Analyse, die gleichermaßen auf Ansätze der Wissenschafts- <strong>und</strong><br />
Technikforschung wie der Industrie<strong>soziologie</strong> zurückgeht, gliedert sich in<br />
zwei große Teile. Im ersten wird die Technik<strong>entwicklung</strong> aus zunächst<br />
handlungstheoretischen dann strukturtheoretischen Perspektiven dargestellt.<br />
Er ist ein Versuch, einen tragfähigen Begriff von technologischer<br />
Rationalität aufzubauen. Der zweite Teil behandelt den Vergesellschaftungsprozeß<br />
von Wissenschaft <strong>und</strong> Technik, beginnt also strukturtheoretisch,<br />
<strong>und</strong> untersucht dann neue Handlungsstrategien, die zur Bewältigung<br />
<strong>und</strong> Dynamisierung dieser Entwicklung beitragen.<br />
1. Technische Entwicklung <strong>und</strong> innovatorisches Handeln<br />
Es ist ausgeschlossen, die technische Entwicklung zusammenhängend <strong>und</strong> in<br />
allen ihren Dimensionen zu analysieren. Wir wählen als Ausgangspunkt eine<br />
Kennzeichnung der Technik, die erstens spezifisch zutreffend ist für die<br />
industrielle, wenn nicht <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung in Europa, die zweitens<br />
im Verlauf dieser Entwicklung zunehmend an Bedeutung gewonnen<br />
hat. Dieser Ausgangspunkt ist die Analyse der Technik<strong>entwicklung</strong> als innovatorisches<br />
Handeln. Die historische Herausbildung <strong>und</strong> soziale Integration<br />
dieses Typus des Handelns ist der alleinige Gr<strong>und</strong> dafür, daß eine vermeintliche<br />
oder tatsächliche Autonomie der technischen Entwicklung überhaupt<br />
als Thema aufgeworfen werden kann. Für alle Gesellschaften, in denen<br />
innovatorisches Handeln als eine spezialisierte, legitimierte <strong>und</strong> institutionalisierte<br />
Form des Handelns nicht ausgebildet ist, würde man schwerlich auf<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
die Idee kommen, für die vorfindlichen Techniken <strong>und</strong> deren Verwendungen<br />
einen anderen als einen sozialen Rahmen zu suchen. Daß technische<br />
Entwicklung in der Moderne vornehmlich in der Erzeugung neuer Techniken<br />
besteht, läßt sich noch einmal verschärfen: die zentrale Kategorie, der<br />
das technikbezogene innovatorische Handeln zuzuordnen ist, ist die der<br />
Forschung als eine auf Erfinden, Entdecken, Vorhersage <strong>und</strong> Konstruktion<br />
gerichtete Tätigkeit.<br />
Forschung soll hier als eine Kategorie eingeführt werden, die der Unterteilung<br />
in „Wissenschaft" <strong>und</strong> „Technologie" übergeordnet ist <strong>und</strong> keine<br />
problematischen Vorentscheidungen benötigt. Insbesondere soll Forschung<br />
nicht auf Wissenschaft oder wissenschaftliche Interessen eingeschränkt werden<br />
<strong>und</strong> dann der Technologie die sek<strong>und</strong>äre Rolle einer „angewandten"<br />
Wissenschaft oder einer „Entwicklungstätigkeit" zugewiesen werden. Im<br />
Gegenteil: Forschungen im Bereich der Technik sind eher älter als solche<br />
im Bereich der Wissenschaften bzw. Naturphilosophien (vergl. z.B. Zilsel<br />
1976, 98ff. zur Entstehung der experimentellen Methode). Noch wichtiger<br />
ist, daß kein F<strong>und</strong>ierungsverhältnis zwischen Wissenschaft <strong>und</strong> Technologie<br />
oder auch nur eine systematische wechselseitige Abhängigkeit besteht<br />
(Brooks 1965). Die historisch angemessene <strong>und</strong> im Ansatz einfache Lösung<br />
ist daher, Forschung als einen übergeordneten Handlungstypus einzuführen,<br />
der sich dann — abhängig von Orientierungskomplexen <strong>und</strong> den in ihnen<br />
artikulierten Erkenntnisinteressen <strong>und</strong> Relevanzkriterien — als stärker wissenschaftlich<br />
oder technisch orientiert spezifizieren läßt. Das Ausmaß der<br />
Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft <strong>und</strong> Technik wird dann zu einer<br />
historischen Fragestellung, die nicht durch unzweckmäßig eingerichtete<br />
analytische Trennungen verstellt wird.<br />
Allerdings hat die Entscheidung, das durch Forschung gekennzeichnete<br />
innovative Handeln als übergeordnete, generische Kategorie einzuführen,<br />
auch die Ausgrenzung von Bereichen der technischen Entwicklung zur Folge,<br />
die unter anderen Perspektiven wichtig sein können. So spielen in der<br />
folgenden Untersuchung weder die materialen Aspekte der Abfolge <strong>und</strong><br />
Kumulation der technischen Entwicklung eine Rolle, wie sie etwa in den<br />
Produktivkrafttheorien (Schuchardin 1963) analysiert werden, noch die<br />
anthropologischen Aspekte, die etwa von den Funktionskreistheoretikern<br />
herausgestellt worden sind (Gehlen 1957). Durch die Fokussierung auf die<br />
Kategorie der Forschung können weder diese noch andere Theorieansätze<br />
ersetzt werden. Zu betonen ist, daß daher auch die Beziehung zwischen<br />
technischer Entwicklung (die nicht unbedingt an Forschung geb<strong>und</strong>en ist,<br />
aber für die <strong>gesellschaftliche</strong> Arbeit konstitutiv ist) <strong>und</strong> Technologie<strong>entwicklung</strong><br />
(die an Forschung geb<strong>und</strong>en ist <strong>und</strong> weniger integriert sein kann)<br />
nicht thematisiert wird. Wir wollen speziell einen Zugang zu den dynamischen<br />
Aspekten der Technologie<strong>entwicklung</strong> eröffnen.<br />
Was ist Forschung? Soziologisch ist Forschung die Ausdifferenzierung<br />
eines bestimmten, auf Erfindung, Entdeckung, Prognose <strong>und</strong> Konstruktion<br />
gerichteten Handlungstypus. Die <strong>gesellschaftliche</strong> Bedeutung dieses Hand-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
lungstypus kann am besten vor Augen gestellt werden durch Darstellung<br />
der wichtigsten Stationen seiner historischen Ausdifferenzierung.<br />
(1) Entstehung des innovatorischen Handelns<br />
(13./14. Jahrh<strong>und</strong>ert)<br />
Um 1<strong>35</strong>0 entstand das deutsche Wort „Vorscher" durch Conrad von Megenburg (1309<br />
-74) in seinem „Poch der Natur" als Bezeichnung für diejenigen, die die „Haimlichkeit<br />
der Natur ervorschen wolt ..." Ähnliche Bezeichnungen derselben Zeit sind „Incignerius",<br />
„Ingeniator", die in den Bauhütten entstanden. Sie standen im Zusammenhang<br />
mit einer Beschleunigung des technischen Fortschritts in vielen Berufszweigen des Spätmittelalters,<br />
die mit einer starken Vermehrung der Zünfte <strong>und</strong> Gilden verb<strong>und</strong>en war.<br />
Dennoch waren die Zünfte durchgängig traditional. Innovatorische Aktivitäten wurden<br />
nur (a) gelegentlich (b) im Kontext eines Berufsfeldes <strong>und</strong> (c) im Falle der Verträglichkeit<br />
mit der Tradition akzeptiert.<br />
(2) Ausgrenzung des Handlungstypus des Forschungshandelns<br />
(15./16. Jahrh<strong>und</strong>ert)<br />
Im Zeitalter der Renaissance kommt es zur sozialen Definition des Forschens als einer<br />
spezifischen <strong>und</strong> eigenständigen Tätigkeit. Zugang zu den darunter fallenden Tätigkeiten<br />
fanden Forscher aus ganz unterschiedlichen Traditionen: Handwerker <strong>und</strong> Kaufleute,<br />
die aus den Zunft- <strong>und</strong> Gildentraditionen ausbrachen, humanistisch gebildete Architekten,<br />
Ärzte <strong>und</strong> Literaten, die sich auf neue Wissensgebiete einließen, schließlich Scholastiker,<br />
die die experimentelle Methode assimilierten. Der Verschiedenheit dieser sozialen<br />
Herkunft entspricht, daß weder ein gemeinsames Handlungsfeld noch eine epistemologische<br />
Kohärenz über die Interpretation des neuen Wissens, das durch Forschungsprozesse<br />
erzeugt wird, bestand. Die Wissensziele <strong>und</strong> Arbeitsbereiche dieser Zeit reichen von den<br />
Geheimwissenschaften über die Astrologie, den traditionellen Naturphilosophien, über<br />
Bergbau, Meteorologie bis hin zu den neuen Ingenieurwissenschaften <strong>und</strong> künstlerischästhetischen<br />
Bereichen.<br />
(3) Die Legitimation des Forschungshandelns<br />
(17./18. Jahrh<strong>und</strong>ert)<br />
Mit der Gründung der Akademien <strong>und</strong> wissenschaftlichen Gesellschaften <strong>und</strong> den technischen<br />
Corps gibt es für Forscher eine soziale Anerkennung durch Mitgliedschaft in<br />
Institutionen. Die Institutionen sind ihrerseits im Zeitalter des Absolutismus mit Privilegien<br />
ausgestattet (z.B. Kommunikationsfreiheit, Druckprivileg, Erlaubnis der medizinischen<br />
Sektion, auch die Entfaltung des Patentwesens ist unter die Privilegien zu<br />
rechnen).<br />
(4) Professionalisierung der Forschung<br />
(19. Jahrh<strong>und</strong>ert)<br />
Bis in das 19. Jahrh<strong>und</strong>ert herrschte in den Wissenschaften <strong>und</strong> Techniken der Amateur<br />
<strong>und</strong> versierte Generalist vor. Im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert kommt es zur Einrichtung aller wesentlichen<br />
Elemente einer spezifischen auf Forschung hin angelegten Berufswelt. (Entstehung<br />
der technischen Universitäten, spezialisierte Studiengänge, Entstehung von Forschungslaboratorien<br />
in den Universitäten, Entstehung von SpezialZeitschriften, Kongresse<br />
usw., Erweiterung der akademischen Berufsfelder in der Gesellschaft). Die Herausbildung<br />
dieser selbstreferenziellen Binnenstrukturen (Forschung — Lehre — Ausbildung —<br />
Berufsfeld, arbeitsteilige Organisation — Fachpublikationen <strong>und</strong> -kritik) sind die wesentlichen<br />
soziologischen Bedingungen, die für die autonome Organisation des Handlungsfeldes<br />
gegeben sein müssen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Für die soziologische Systemtheorie ist die Herausbildung des Forschungs<strong>und</strong><br />
Lehrbetriebs im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert ein klassischer Fall der Autonomisierung.<br />
Die Beschleunigungseffekte des weitgehend der Selbstregulation<br />
überlassenen Subsystems sind so erheblich, daß die Verwendung der Ergebnisse<br />
weit nützlicher war als der Versuch, die Produktion der Ergebnisse<br />
nach außerwissenschaftlichen Nützlichkeitskriterien zu steuern (Pasteur:<br />
,,Es gibt keine angewandte Wissenschaft; es gibt nur Wissenschaft <strong>und</strong> ihre<br />
Anwendung" (1922, VII, 215). In einem späteren Abschnitt, der die Weiter<strong>entwicklung</strong><br />
der Forschungsstrukturen über die Phase der Autonomisierung<br />
hinaus zum Gegenstand hat, werden wir allerdings zeigen, daß<br />
schon im letzten Drittel des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts die autonomistische Ideologie<br />
überholt wurde durch die Gründung einer großen Zahl anwendungsorientierter<br />
Forschungseinrichtungen (Industrieforschung, industrielle Gemeinschaftsforschung,<br />
staatliche Forschungsanstalten, Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft).<br />
Sie machen zwar die akademischen Einrichtungen nicht überflüssig,<br />
entkräften aber die Gleichung, daß der Nutzen der Forschung von Handlungsentlastung<br />
<strong>und</strong> institutioneller Autonomie abhängt. Dennoch ist als<br />
Ergebnis der Darstellung der sozialen Ausdifferenzierung des Forschungshandelns<br />
das folgende festzuhalten:<br />
These 1:<br />
Im Verlauf der Neuzeit mit einem Kulminationspunkt im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert ist<br />
es zu einer <strong>gesellschaftliche</strong>n Ausdifferenzierung des Forschungshandelns gekommen,<br />
die folgende Elemente umfaßt: Definition der Tätigkeitsmerkmale;<br />
Legitimation der Tätigkeit; Institutionalisierung <strong>und</strong> Professionalisierung. Soweit<br />
Wissenschaft <strong>und</strong> Technik an diesem ausdifferenzierten System partizipieren,<br />
sind sie im soziologischen Sinn autonom: ihre Innensteuerung <strong>und</strong><br />
Selbstreferenz dominiert die Außensteuerung <strong>und</strong> Referenz.<br />
2. Die Orientierungskomplexe der technischen Forschung<br />
Bei dem Ansatz, Forschung als übergeordnete Kategorie der technologischen<br />
<strong>und</strong> wissenschaftlichen Entwicklung zu wählen, bleibt die Frage nach<br />
den Bezugspunkten der Forschung offen. Bisher standen die Struktur des<br />
Handlungstypus <strong>und</strong> seine historische Entfaltung, nicht dessen sachliche<br />
Ziele oder Tätigkeitsfelder zur Diskussion. Auch für das autonomistische<br />
Forschungssystem der Universitäten <strong>und</strong> Technischen Hochschulen des<br />
19. Jahrh<strong>und</strong>erts ist nur diese Struktur thematisiert worden. Wir wollen die<br />
sachlichen Bezugspunkte der Forschung über die Kategorie der „Orientierungskomplexe"<br />
einführen (vergl. hierzu, wenn auch begrifflich anders,<br />
Weingart 1982). Orientierungskomplexe der Forschung sollen als Verbindungsglieder<br />
zwischen Forschung <strong>und</strong> denjenigen Bereichen der Gesellschaft<br />
dienen, in denen Forschung institutionalisiert worden ist. Kategorial<br />
ist es mögüch, Orientierungskomplexe auf jeder Aggregationsebene<br />
des sozialen Handelns (etwa individuelle, institutionelle, subsystemische<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Orientierungskomplexe) zu unterscheiden. Für die gesellschaftstheoretischen<br />
<strong>und</strong> historischen Dimensionen dieses Aufsatzes müssen hoch aggregierte<br />
Ebenen gewählt werden. Historisch betrachtet lassen sich dann vier<br />
Orientierungskomplexe unterscheiden, die zunächst idealtypisch mit dem<br />
Ziel aufgeführt werden, analytische Trennungen herauszuheben. Später<br />
wird argumentiert, daß der entscheidende soziale Prozeß der Modernisierung<br />
gerade in der wechselseitigen Durchdringung besteht. Der Rückweg<br />
in systemtheoretische Abgrenzungen dient also nur begrifflichen Zwecken.<br />
(a) Der Orientierungsrahmen<br />
der Realitätserkenntnis<br />
Dieser Orientierungsrahmen ist der Standardrahmen der Wissenschaften <strong>und</strong><br />
ihrer klassischen akademischen Institutionen, durch den Forschung zum<br />
Zweck der Realitätserkenntnis als legitimes Ziel anerkannt wird. Seinen<br />
historischen Hintergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> systematischen Kern bilden philosophische<br />
Problemstellungen (Naturphilosophie <strong>und</strong> Erkenntnistheorie), deren universalistische<br />
Ansprüche allerdings weitgehend durch die nicht-philosophischen<br />
Verfahren der Forschung modifiziert sind. Insbesondere wird ihnen<br />
gegenüber keine Rechenschaft durch den einzelnen Wissenschaftler verlangt.<br />
Sie sind virtualisiert <strong>und</strong> werden nur in der historischen Verkettung<br />
der Forschungsprogramme sichtbar (Henrich 1982). Dem Orientierungsrahmen<br />
der Wirklichkeitserkenntnis kommt gegenüber allen Forschungsprozessen,<br />
die an anderen Orientierungsrahmen ausgerichtet sind, eine privilegierte<br />
Stellung zu: Jede Forschung ist mit irgendeiner Form der Wirklichkeitserkenntnis<br />
verknüpft <strong>und</strong> damit anknüpfbar an die Forschungsprogramme<br />
<strong>und</strong> Geltungskriterien, die dieser Orientierungsrahmen setzt. Auf<br />
diesen inneren Zusammenhang von wissenschaftlicher Orientierung <strong>und</strong> der<br />
Erweiterung des erfolgskontrollierten Handelns durch Forschung werden<br />
wir unter dem Thema der technologischen Rationalität zu sprechen kommen.<br />
(b) Der kulturelle<br />
Orientierungskomplex<br />
Der gemeinsame Nenner dieses Komplexes sind <strong>gesellschaftliche</strong> Wert- <strong>und</strong><br />
Sinnorientierungen. Hineinzurechnen sind etwa ästhetische Orientierungen,<br />
die in der Forschung der Renaissance eine große Rolle spielten (Architektur,<br />
Musik, perspektivische Malerei), hedonistische Varianten, die allerdings<br />
heute über die Unterhaltungsindustrie großenteils dem ökonomischen<br />
Sektor zugehören, dann auch besonders ethisch-ideologische Varianten, die<br />
als Szientismus <strong>und</strong> Naturalismus am Ende des 19. <strong>und</strong> im 20. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
zu großer Bedeutung kamen <strong>und</strong> in enger Verbindung mit politischen<br />
Orientierungen standen (Sozialdarwinismus, Eugenik, usw.). Schließlich<br />
können auch die Orientierung der medizinischen Wissenschaften an ihren<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
esonderen Werten (Krankheit, Ges<strong>und</strong>heit) sowie weitere Humanwissenschaften<br />
hier hineingerechnet werden.<br />
(c) Der politisch-administrative<br />
Orientierungskomplex<br />
An diesem Komplex sind alle Forschungen, die der Staat für seine eigene<br />
Ordnungs- <strong>und</strong> Leistungsverwaltung betreibt, orientiert. Zu nennen sind<br />
hier heute vor allem der Rüstungssektor, das Meß- <strong>und</strong> Eichwesen, öffentliche<br />
Prüfung <strong>und</strong> Kontrolle in Bereichen wie Sera, Arzneien, Kosmetika,<br />
Pflanzengiften, Lebensmittel, Materialprüfungen, usw.; weiter spielt die<br />
öffentliche Infrastruktur <strong>und</strong> die Ökonomie nichtmarktfähiger Güter eine<br />
Rolle <strong>und</strong> schließlich die Forschung auf dem Gebiet aufwendiger <strong>und</strong> risikoreicher<br />
Zukunftstechnologien. Etwa seit dem letzten Viertel des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
hat die Mobilisierung der Forschung für staatliche Zwecke zu<br />
einem weitverzweigten Netz öffentlicher Forschungseinrichtungen geführt<br />
(Forschungsanstalten mit behördlichen Befugnissen <strong>und</strong> nachgeordneten<br />
Ämtern, Forschungsinstituten <strong>und</strong> Großforschungseinrichtungen). Die<br />
Entwicklung der staatlichen Forschung entwickelte sich qualitativ <strong>und</strong><br />
quantitativ annähernd parallel zum ökonomischen Sektor.<br />
(d) Der ökonomische<br />
Orientierungskomplex<br />
Die Relevanz dieses Orientierungskomplexes für Forschung ist in seinen Ursprüngen,<br />
genauer in seinen ideologischen Formulierungen bis in die Zeit<br />
der wissenschaftlichen Revolution zurückzuverfolgen (Francis Bacon). Die<br />
tatsächliche institutionelle Entfaltung beginnt allerdings gleichzeitig mit<br />
dem staatlich-administrativen Sektor erst im letzten Drittel des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts.<br />
Beginnend mit der chemischen <strong>und</strong> elektrotechnischen Industrie,<br />
gefolgt von den Kommunikationsmedien <strong>und</strong> der Aeronautik ist es zu einer<br />
ständig zunehmenden Verflechtung von auf Innovation gerichteter Erkenntnis<br />
<strong>und</strong> ökonomischen Betriebszielen gekommen. Die Entwicklung dieser<br />
Wechselwirkungen wird weiter unten im Detail dargestellt.<br />
Damit sind die vier f<strong>und</strong>amentalen Orientierungskomplexe der Forschung<br />
umrissen. Diese sind natürlich nicht wechselseitig exklusiv. Es gibt sowohl<br />
Übergangsformen wie Überlappungen. Es kommt in unserem Zusammenhang<br />
auch nicht darauf an, ob die hier gewählte Klassifikation der Orientierungskomplexe<br />
besonders zweckmäßig ist. Sie folgt der bekannten<br />
Aufgliederung der generalisierten Medien der <strong>gesellschaftliche</strong>n Problemlösungen<br />
(Wahrheit, Werte, Macht, Geld) (Luhmann 1975, 177 ff.). Wichtig<br />
ist dagegen nur, daß alle Forschungsvorhaben Orientierungskontexten zuzuordnen<br />
sind, ohne die Forschung richtungslos wäre.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Forschung ist, so wurde im ersten Abschnitt argumentiert, im Kern eine<br />
ausdifferenzierte Handlungskompetenz, zu Entdeckungen, Erfindungen,<br />
Prognosen oder Konstruktionen zu kommen. Handlungsziele <strong>und</strong> Relevanzkriterien<br />
ergeben sich nicht aus dieser, sondern aus den Orientierungskomplexen.<br />
Wir fassen die Ergebnisse des ersten <strong>und</strong> zweiten Abschnittes zusammen:<br />
These 2: Technik<strong>entwicklung</strong> ist determiniert einerseits durch die ausdifferenzierten<br />
Handlungselemente der Forschung <strong>und</strong> andererseits durch die Aufgabenbereiche<br />
<strong>und</strong> Zielhorizonte der Forschung, die durch die Orientierungskomplexe<br />
gegeben sind. Die erste Determination betrifft den Aspekt der Autonomie<br />
<strong>und</strong> der mit dieser gegebenen institutionellen Handlungsvorteile; die zweite<br />
Determination betrifft die funktionale Angewiesenheit der Technik<strong>entwicklung</strong><br />
auf nichttechnische Handlungsbereiche.<br />
3. Technologische Rationalität<br />
Technologie ist nicht als ein eigenständiger Orientierungskomplex eingeführt<br />
worden. Damit ist trotz aller faktischen Überschneidungen ein gr<strong>und</strong>sätzlicher<br />
Unterschied zwischen Wissenschaft <strong>und</strong> Technologie unterstellt.<br />
Während Wissenschaft im Rahmen des Ansatzes zur Orientierung der Forschung<br />
auf Realitätserkenntnis bestimmt wurde, kann Technologie offenbar<br />
nur indirekt als die Bereitstellung von Wissen definiert werden, das in den<br />
jeweiligen Orientierungskomplexen als relevant gilt. Ist damit eingeräumt,<br />
daß es keine Autonomie der technologischen Entwicklung gibt? Wir werden<br />
diesen Schluß, der aus professionellen Gründen unter Sozialwissenschaftlern<br />
leicht Zustimmung findet, nicht ziehen, allerdings auch nicht schlichtweg<br />
den entgegengesetzten. Wir werden einen Begriff von technologischer Rationalität<br />
einführen, der in der Zwischenlage dieser Alternative verbleibt <strong>und</strong><br />
die Hauptthese des Aufsatzes vorbereitet, daß Funktionalität <strong>und</strong> Autonomie<br />
der Technologie aus einer spezifischen Rationalität der technologischen<br />
Forschung folgen. Wir gehen zunächst von einem soziologisch gefaßten<br />
„Autonomie-Begriff" aus (These 1). In Frage steht also nicht eine immanente<br />
Eigengesetzlichkeit („Entwicklungslogik") der Technologie. Wenn<br />
technische Handlungsziele sich nicht aus der Technologie, sondern nur aus<br />
Orientierungskomplexen ergeben können, dann kann eine Autonomie allenfalls<br />
in einer auf die Forschung selbst bezogenen Rationalität bestehen.<br />
Wenn man also auf der einen Seite der Technologie keine immanenten<br />
Orientierungsleistungen imputiert, so kann man auf der anderen Seite durch<br />
die exponierte Kategorie der Forschung der Technologie<strong>entwicklung</strong> Beschleunigungseffekte<br />
zusprechen, die die Orientierungskomplexe zu Anpassungsleistungen<br />
zwingen. Woher kann die technologische Forschung diese<br />
Handlungsvorteile beziehen? Dies soll anhand der besonderen Beziehung,<br />
die zwischen Wissenschaft <strong>und</strong> Technologie eben durch diese Kategorie eingerichtet<br />
ist, diskutiert werden.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Es ist heute ein Gemeinplatz, daß zwischen Technologie <strong>und</strong> Wissenschaft<br />
trotz heterogener Wurzeln <strong>und</strong> verbleibender institutioneller Unterschiede<br />
nicht mehr substantiell, sondern nur noch kontextuell (nämlich<br />
durch Rekurs auf Orientierungskomplexe) unterschieden werden kann<br />
(Layton 1977, Böhme, van den Daele, Krohn 1978, Barnes 1982). Aber es<br />
wird dabei durchgängig übersehen, daß damit keine Identifikation ausgesprochen<br />
wird, die streng genommen einen der beiden Ausdrücke überflüssig<br />
oder an jeder Stelle des anderen einsetzbar machen würde. Unter der<br />
Hand wird auf einer zumindest analytischen Trennung beharrt, deren Bestimmung<br />
allerdings geschenkt wird. Aber gerade die Bestimmung von<br />
Gemeinsamkeit <strong>und</strong> Differenz ist der Schlüssel für ein Verständnis der technologischen<br />
Rationalität. Die wichtigste <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>legende Gemeinsamkeit<br />
besteht darin, daß Wissenschaft <strong>und</strong> Technologie über die Kategorie der<br />
Forschung an denselben operativen Wahrheitsbegriff geb<strong>und</strong>en sind. Dieser<br />
Wahrheitsbegriff besagt, daß die Erkenntnis von etwas in der Angabe der<br />
Möglichkeiten seiner Erzeugung besteht. Ein Naturgesetz ist „mehr <strong>und</strong><br />
mehr nur eine Angabe über die Möglichkeit <strong>und</strong> den Ausfall von Experimenten;<br />
ein Gesetz unserer Fähigkeit, Phänomene hervorzubringen" (von<br />
Weizsäcker 1960, 173). Es gibt Wissensbereiche, in denen die Diskrepanz<br />
über lange Zeit groß ist (z.B. die Erklärung der Planetenbahnen durch die<br />
Gravitation <strong>und</strong> die Erzeugung von künstlichen Planeten; z.B. alte Medikamente,<br />
deren Wirkungsweise unerklärt ist). Sieht man von zahlreichen<br />
methodologischen Verfeinerungen ab, <strong>und</strong> liest die Äquivalenz von Erklärung<br />
<strong>und</strong> Erzeugung als ein regulatives Ideal, dann lassen sich zwei gr<strong>und</strong>legende<br />
<strong>und</strong> exemplarisch leicht belegbare Aussagen formulieren: Jede<br />
wissenschaftliche Wirklichkeitserkenntnis entwickelt ein Potential zur<br />
Konstruktion von Realität auf theoretischer Gr<strong>und</strong>lage, — <strong>und</strong> das heißt<br />
zur Technologie. Und umgekehrt, jede Entwicklung von Technik <strong>und</strong> Technologie<br />
kann ein wissenschaftliches Interesse nach Erklärung oder nach<br />
rationaler Rekonstruktion des erfolgreichen Funktionierens nach sich<br />
ziehen. Für die Wissenschaft spielt es im Prinzip keine Rolle, ob sich die<br />
Realitätserklärung auf naturgegebene oder auf technische Wirklichkeiten<br />
bezieht. In ihren Theorien besteht zwischen beiden Realitäten keine Grenzziehung.<br />
Für die Technologie ist es im Prinzip gleichgültig, ob sie auf wissenschaftlich-theoretischer<br />
Gr<strong>und</strong>lage oder „durch Versuch- <strong>und</strong> Irrtum"<br />
arbeitet; die Entscheidungen werden pragmatisch getroffen.<br />
Damit sind implizit die Unterschiede zwischen Wissenschaft <strong>und</strong> Technologie<br />
schon angesprochen. Auf ihren allgemeinsten Nenner gebracht bestehen<br />
sie darin, daß Wissenschaft letztlich analytisch <strong>und</strong> reduktionistisch<br />
orientiert ist, Technologie dagegen synthetisch <strong>und</strong> holistisch. Diese Unterscheidung<br />
lehnt sich an historisch eingespielte Klassifikationen an, — z.B.<br />
der in analytische <strong>und</strong> technische Mechanik, in analytische <strong>und</strong> synthetische<br />
Chemie in (reduktionistische) genetische Biologie <strong>und</strong> (synthetische)<br />
Gentechnologie. Sie ist auch darauf abbildbar, daß in den Wissenschaften<br />
möglichst einfache Theorien <strong>und</strong> idealisierte Modelle bevorzugt werden,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
während in der Technologie die Zwecke des Designs zur Komplexität zwingen<br />
(Layton 1977, Simon 1969). Verzichtet man an dieser Stelle auf die<br />
Detaildiskussion von Einschränkungen <strong>und</strong> Komplikationen, dann läßt sich<br />
mit Hilfe der Unterscheidung eine wichtige Asymmetrie zwischen Wissenschaft<br />
<strong>und</strong> Technologie formulieren: Die wissenschaftiiche Analyse ist<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich finit <strong>und</strong> gerät zu relativ endgültigen Resultaten, (z.B. verläßliche<br />
Modelle (periodisches System der Elemente) <strong>und</strong> abgeschlossene<br />
Theorien (klassische Mechanik)). Die technologische Synthese ist immer offen<br />
<strong>und</strong> ziellos; sie stellt ein Potential dar, dem immanente Relevanzkriterien<br />
<strong>und</strong> Erkenntnisinteressen fehlen. Diesem Tatbestand entspricht die Angewiesenheit<br />
der Technologie auf Orientierungskomplexe.<br />
Diese Herausstellung von Gemeinsamkeiten <strong>und</strong> Unterschieden zwischen<br />
Wissenschaft <strong>und</strong> Technologie ist idealtypisch. Man kann sie nicht<br />
ohne weiteres auf Organisationen, Berufsfelder <strong>und</strong> Disziplinenbezeichnungen<br />
anwenden. Nach traditionalen Benennungen ausgebildete Wissenschaftler<br />
(Physiker, Biologen) können technologische Forschung betreiben<br />
<strong>und</strong> umgekehrt; die Benennung dieser Forschung hängt wiederum vom Organisationstypus<br />
ab: Dieselbe Tätigkeit wird in der Hochschule Wissenschaft,<br />
im betrieblichen Labor Technologie genannt. Schließlich folgt die<br />
Bezeichnung der Gebiete (engineering sciences; science of the artificial)<br />
stärker legitimatorischen als sachlichen Gesichtspunkten. Dennoch werfen<br />
diese wechselhaften Benennungen kein gr<strong>und</strong>sätzliches Problem auf. Denn<br />
die idealtypische Kennzeichnung von Wissenschaft <strong>und</strong> Technologie soll ja<br />
gerade die enge Wechselwirkung zwischen ihnen herausstellen.<br />
Diese Wechselwirkung wird garantiert durch den gemeinsamen operativen<br />
Wahrheitsbegriff, in dem „Erklären" <strong>und</strong> „Erzeugen", „knowing" and<br />
„doing" amalgamiert sind. Durch diesen Bezugspunkt kann Forschung als<br />
eine Art „Schleuse" funktionieren, über die die Niveauunterschiede zwischen<br />
wissenschaftücher Analyse <strong>und</strong> technischer Synthese, die durch unterschiedliche<br />
Orientierungen entstehen, ausgeglichen werden können. Jede<br />
Technik kann verwissenschaftlicht, jede Wissenschaft kann zur Technologie<br />
werden. Was läßt sich im Ergebnis für den Begriff der technologischen Rationalität<br />
festhalten?<br />
Die technologische Rationalität wird aus zwei Ressourcen gespeist: Auf<br />
der einen Seite ist sie zieloffen <strong>und</strong> bezieht Handlungsinteressen <strong>und</strong> Relevanzkriterien<br />
aus den Orientierungsrahmen. Auf der anderen Seite besteht<br />
eine immanente Beziehung zur wissenschaftlichen Rationalität: Beide sind<br />
über eine im Prinzip nicht unterscheidbare Realitätserkenntnis verknüpft,<br />
die demselben Wahrheitsbegriff unterliegt. Technologische Rationalität<br />
besteht in einer spezifischen Vermittlung dieser beiden Ressourcen. Von<br />
Seiten der Orientierungskomplexe der Technologie aus leistet sie durch Anbindung<br />
an Forschung <strong>und</strong> Wahrheitsentscheid eine Dekontextualisierung<br />
<strong>und</strong> Verwissenschaftlichung der Handlungsziele (Interessen, Präferenzen).<br />
Sie erzeugt „Erkenntnisdruck". Von Seiten des wissenschaftlichen Orientierungskomplexes<br />
aus leistet sie gegenläufig deren Kontextualisierung als<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ökonomisierung <strong>und</strong> Politisierung. Sie erzeugt „Relevanzdruck". Je stärker<br />
diese Beziehungen ausgebaut <strong>und</strong> je flexibler sie genutzt werden, desto<br />
stärker wird der Entwicklungsdruck, den die technologische Rationalität<br />
für alle Orientierungskomplexe erzeugt. Zusammengefaßt in eine These<br />
lautet das Ergebnis:<br />
These 3: Technologische Rationalität besteht in einer speziellen Vermittlungsleistung<br />
zwischen sozialen Handlungszielen <strong>und</strong> Realitätserkenntnis. Je enger sie an<br />
die Forschung geb<strong>und</strong>en ist, desto unabhängiger <strong>und</strong> determinierender kann<br />
diese Vermittlung in beide Richtungen werden. Daher kann durch denselben<br />
Prozeß sowohl die Funktionsfähigkeit als auch ihre Autonomie gesteigert<br />
werden.<br />
4. Stufen der Interdependenz von Industrie <strong>und</strong> Forschung<br />
Bisher haben wir uns mit dem Spezifikum moderner Technik<strong>entwicklung</strong><br />
befaßt: ihrem Charakter als Forschungshandeln <strong>und</strong> der <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Ausdifferenzierung der Forschung als Bedingung für ihre „funktionelle<br />
Autonomie". Jetzt wechseln wir die Thematisierungsrichtung <strong>und</strong> betrachten<br />
die Formen, in denen die <strong>gesellschaftliche</strong> Orientierung der Technologie<strong>entwicklung</strong><br />
verlaufen ist. Dabei beschränken wir uns auf den ökonomischen<br />
Orientierungskomplex, der auf die industrielle Entwicklung im Kapitalismus<br />
<strong>und</strong> ihr Verhältnis zur Forschung einwirkt.<br />
Gesellschaftliche Orientierungskomplexe hatten wir bisher phänomenologisch<br />
eingeführt. In analytischer Perspektive lassen sie sich als Rationalitätsmuster<br />
der funktional ausdifferenzierten Subsysteme der Gesellschaft<br />
begreifen, z.B. als Kapitalrechnung in der Wirtschaft, als Machtdifferential<br />
im politischen System oder als operativer Wahrheitsentscheid in der Wissenschaft.<br />
Die meisten vorliegenden gesellschaftstheoretischen Ansätze zum Verhältnis<br />
von Industrie <strong>und</strong> Forschung greifen jeweils eines dieser Rationalitätsmuster<br />
auf <strong>und</strong> leiten daraus für die Orientierung moderner Technologie<strong>entwicklung</strong><br />
jeweils eine „Logik" der Vergesellschaftung, z.B. der Verwissenschaftlichung,<br />
der Subsumtion unter das Kapital oder der Beherrschung<br />
ab. Außerdem neigen sie dazu, die Industrie als empirisches Phänomen<br />
ausschließlich unter der Abstraktion als ökonomisches System zu betrachten,<br />
als ob es nicht eine Politik der Industrie, eine politische Kultur<br />
der industriellen Beziehungen oder eine Industriekultur geben würde, die<br />
für die <strong>gesellschaftliche</strong> Orientierung der technischen Entwicklung ebenfalls<br />
von Bedeutung wären.<br />
Gegenüber diesen reduktionistischen <strong>und</strong> ökonomischen Vorgehensweisen<br />
nehmen wir die Interdependenzen zwischen den ausdifferenzierten<br />
Teilsystemen der Gesellschaft ernst <strong>und</strong> fragen nach dem historischen Wandel<br />
ihrer Intensität <strong>und</strong> ihrer Form. Was in anderen Ansätzen vorab als Sub-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
sumtion der Wissenschaft unter das Kapital oder als Entdifferenzierung von<br />
Ökonomie <strong>und</strong> Forschung interpretiert wird, könnte sich unserer Ansicht<br />
nach bei differenzierter Betrachtung als gesteigerte Interdependenz <strong>und</strong><br />
darauf reagierende reflexive Subsyste<strong>mb</strong>ildung, also als Fortsetzung der<br />
Systemdifferenzierung nach innen, erweisen. Die Frage der Dominanz eines<br />
Teilsystems ist jeweils historisch neu zu stellen <strong>und</strong> empirisch zu untersuchen.<br />
Die industrielle Orientierung moderner Technologie<strong>entwicklung</strong> läßt<br />
sich nicht anhand eines einzigen Rationalitätsmusters hinreichend rekonstruieren.<br />
In <strong>gesellschaftliche</strong> Orientierungskomplexe gehen empirische<br />
Mischungen von Rationalitätsmustern ein, die sich aus den historisch<br />
variierenden Interdependenzbeziehungen ergeben.<br />
Woran lassen sich diese Orientierungsweisen festmachen <strong>und</strong> wie kann<br />
man sich den Wirkungsmechanismus vorstellen?<br />
Auch in dieser Hinsicht ist es vorteilhaft, das Handeln der sozialen<br />
Akteure nicht als Oberflächenausdruck einer tieferen Logik herzuleiten,<br />
sondern die Beziehung zwischen Gesellschafts- <strong>und</strong> Handlungsebene kontingenter<br />
anzusetzen, d.h. auch analytisch radikaler Funktionsbereich <strong>und</strong><br />
soziale Einheit zu entkoppeln. Damit folgen wir der Einsicht, „daß keine<br />
der zentralen Funktionen des Gesellschaftssystems auf ein einheitliches<br />
Organisationssystem übertragen werden kann — <strong>und</strong> zwar heute weniger<br />
als zuvor." (Luhmann 1981, 15) Im <strong>München</strong>er Ansatz der unternehmerischen<br />
Autonomiestrategien wurde dieser Weg schon früh eingeschlagen.<br />
Unter Strategie wird dabei weder eine voluntaristische Entscheidung eines<br />
Akteurs noch ein durch eine Logik objektiv für die Handlungsebene vorgegebener<br />
Imperativ verstanden. Vom voluntaristischen Ansatz grenzt sich<br />
dieser Strategiebegriff ab, indem er sich auf für die Akteure objektive Erfordernisse<br />
<strong>und</strong> Problemkonstellationen in ihrer Umwelt bezieht. Vom<br />
objektivistischen Ansatz unterscheidet er sich durch die Annahme einer<br />
doppelten Kontingenz zwischen System- <strong>und</strong> Akteurebene, wie sie sich<br />
einmal im Verhältnis von Umwelt <strong>und</strong> Strategieformulierung <strong>und</strong> zum<br />
anderen im Verhältnis von Strategie <strong>und</strong> organisatorisch-technischer Implementierung<br />
zeigt (vgl. neuerdings Lutz 1983).<br />
Unter diesem Blickwinkel ist es z.B. auch verkürzt, die soziale Einheit<br />
Industrieunternehmen als rein ökonomische Organisation oder nur als Ort<br />
der Realisation der Kapitalverwertung zu sehen. Das moderne Unternehmen<br />
ist gleichzeitig Element im politischen Entscheidungssystem wie auch ein<br />
Ort der Forschung. Seine Besonderheit läßt sich nur aus der Verknüpfung<br />
der unterschiedlichen Erfordernisse <strong>und</strong> Rationalitätsmuster herleiten, die<br />
sich historisch als bestimmte Strategien herauskristallisiert haben.<br />
„Reflexiv" wollen wir solche Strategien nennen, die Anforderungen<br />
<strong>und</strong> Rationalitätsmuster der in der Umwelt liegenden Handlungssysteme<br />
mit ihrem eigenen Rationalitätsmuster verkoppeln, sie also nicht unterordnen,<br />
verändern oder auflösen. Als These ist festzuhalten:<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
These 4:<br />
Der Mechanismus der <strong>gesellschaftliche</strong>n Orientierung erfolgt nicht über die<br />
Durchsetzung konsistenter Rationalitätsmuster oder einer Logik der Handlungsimperative<br />
für Akteure, sondern über „reflexive Strategien", mit denen<br />
die Akteure unterschiedliche <strong>und</strong> z.T. inkonsistente Rationalitätsmuster<br />
ko<strong>mb</strong>inieren.<br />
Wir stellen unseren weiteren Überlegungen wieder eine historische Darstellung<br />
voran.<br />
„Klassische Industrie",<br />
(I. Stufe seit 1760)<br />
Fabrikanten <strong>und</strong> Maschinenerfindung<br />
Forschung <strong>und</strong> Industrie verlaufen weitgehend getrennt voneinander. Es gibt allerdings<br />
einzelne Kontakte zwischen Wissenschaftlern, Erfindern <strong>und</strong> Unternehmern in den wissenschaftlich-technischen<br />
Gesellschaften, z.B. der Lunar Society, der Manchester Literary<br />
and Philosophical Society (das Beispiel der Dampfmaschine: Black-Watt-Boulton).<br />
Die Vermittlung zwischen beiden Bereichen erfolgte wesentlich über die neuen Maschinen,<br />
die von experimentell orientierten Erfindern entwickelt <strong>und</strong> zur technischen Basis<br />
der „großen Industrie" wurden. (Maudsley, Nasmyth) Die Fabrikanten sind nur an der<br />
langfristigen <strong>und</strong> massenökonomischen Verwertung einer einmal getätigten Investition<br />
in die neue Maschinerie interessiert, erfahren jedoch nach einiger Zeit die aus der Erfindungsdynamik<br />
resultierenden Grenzen, wie das schnelle Veralten von Produktionsanlagen<br />
<strong>und</strong> die Verkürzung des Produktzyklus.<br />
„Innovative Industrie", Erfinderunternehmer <strong>und</strong> industrielle Gemeinschaftsforschung<br />
(II. Stufe seit 1860)<br />
Dieses Problem wird in der „innovativen Industrie" zum Bezugspunkt für die Herausbildung<br />
neuer Strategien. Ihr Interesse an fortlaufender Produkt- <strong>und</strong> Verfahrensinnovation<br />
führt zu häufigen, engeren <strong>und</strong> dauerhafteren Kontakten zwischen Forschern<br />
<strong>und</strong> Industrie. Das Drängen der Erfinder zum Patentgeschäft oder zur Firmengründung<br />
trifft sich mit der unternehmerischen Innovationsstrategie. Aus anfänglichen Beraterverträgen<br />
<strong>und</strong> Auftragsforschungen entstehen institutionalisierte Formen der Zusammenarbeit,<br />
wie die Geschäftspartnerschaft, bei der das technologische Wissen in das<br />
Unternehmen hineingeholt wird, oder die industrielle Gemeinschaftsforschung, bei der<br />
Industriebranchen durch Forschungsinstitutionen außerhalb der Unternehmen eine<br />
wissenschaftlich orientierte Lösung ihrer gemeinsamen Probleme dauerhaft organisieren.<br />
„Science-based Industries", Konzerne <strong>und</strong> „Industrieforschung"<br />
(III. Stufe seit 1890)<br />
Vor allem in der elektronischen <strong>und</strong> chemischen Industrie verlagert sich das Interesse<br />
von Einzelerfindungen <strong>und</strong> Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse für bestehende<br />
Produktionsprobleme auf die Monopolisierung von Marktchancen durch Systemerfindungen<br />
<strong>und</strong> Forschungsvorsprünge bei der Suche nach neuen Stoffen <strong>und</strong> Verfahren.<br />
Der Ausbau der kleinen Experimentierlabors zu großen industriellen Forschungsinstitutionen<br />
<strong>und</strong> die Beschäftigung einer großen Anzahl von Wissenschaftlern <strong>und</strong> Ingenieuren<br />
kennzeichnen dieses Stadium der Beziehung. Der Forschungs- <strong>und</strong> Entwicklungsprozeß<br />
wird ein funktional selbständiger Bestandteil des Großunternehmens;<br />
industriespezifische Gewichtungen <strong>und</strong> Bewertungen gehen in die kognitive Struktur<br />
der Forschung ein, die als eigenständige „Industrieforschung" neben der Hochschul<strong>und</strong><br />
Staatsforschung sich etabliert.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
korporatistische Akteure <strong>und</strong> wissenschaft<br />
„Wissenschaftlich-industrielle Komplexe",<br />
lich-reflexive Programmforschung<br />
(IV. Stufe seit 1945)<br />
Die wissenschaftlich-industriellen Komplexe entstanden aus den staatlich koordinierten<br />
Großprojekten (Manhattan, Apollo, Brüterprogramm, Krebsforschung), mit denen Grenzen<br />
einzelunternehmerischer Finanzkraft überw<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Probleme intersystemischer<br />
Abstimmung von Wissenschaft, Industrie, Militär <strong>und</strong> Politik gelöst wurden. Mit Hilfe<br />
des vor allem im militärisch-industriellen Komplex während des II. Weltkriegs erprobten<br />
korporatistischen Steuerungsmodells werden um aussichtsreiche Forschungsprogramme<br />
herum Wissenschaftszentren <strong>und</strong> innovative Industrien inklusive ihrer verdichteten<br />
Interaktion <strong>und</strong> günstigen Infrastruktur organisiert (Route 128 um Boston; Silicon<br />
Valley, Science Parcs, Gentechnologische Zentren, Wissenschaftsstädte). Die industrielle<br />
Entwicklung ist zunehmend von der wissenschaftlichen Forschung <strong>und</strong> Entwicklung<br />
abhängig; diese wiederum wird zunehmend von industriellen Prioritäten <strong>und</strong> korporatistischen<br />
Programmentscheidungen abhängig. Die Reflexion der wechselseitigen Interessen<br />
<strong>und</strong> Potentiale wird Bestandteil sowohl der industriellen als auch der wissenschaftlichen<br />
Produktionsstrategie.<br />
5. Kritik reduktionistischer Vergesellschaftungskonzepte<br />
Die skizzierte Entwicklung des Verhältnisses von Industrie <strong>und</strong> Forschung<br />
wird zwar äußerst kontrovers interpretiert; den unterschiedlichen Theorieansätzen<br />
ist jedoch gemeinsam, daß sie den Wandel auf die Vergesellschaftung<br />
durch nur eine vorherrschende Logik zurückzuführen suchen.<br />
Eine Logik der wissenschaftlich-technischen Entwicklung unterstellen<br />
Theoretiker, die eine Umformung oder Ablösung der Industrie durch moderne<br />
Technologie<strong>entwicklung</strong> <strong>und</strong> Verwissenschaftlichungsprozesse behaupten.<br />
Der prominente Postindustrialismus-Theoretiker Daniel Bell z.B.<br />
spricht von der Ablösung der industriellen Gesellschaft, die um die Achse<br />
Fabrikation <strong>und</strong> maschinelle Güterherstellung rganisiert ist, durch eine<br />
nachindustrielle Gesellschaft. Letztere werde durch „das Exponentialwachstum<br />
<strong>und</strong> die Ausdifferenzierung des Wissens, das Aufkommen einer neuen<br />
intellektuellen Technologie, die systematische Forschung durch entsprechende<br />
Gelder <strong>und</strong> all dies krönen <strong>und</strong> zusammenfassend, die Kodifizierung<br />
des theoretischen Wissens" (Bell 1979, 53) hervorgebracht.<br />
In schwächeren Varianten dieses technologischen Transformationsansatzes<br />
wird nur die zunehmende Abhängigkeit der industriellen <strong>und</strong> wirtschaftlichen<br />
Entwicklung von Forschung <strong>und</strong> technologischer Invention<br />
behauptet. In Anknüpfung an Schumpeters (1961) <strong>und</strong> Kondratieffs (1926)<br />
Arbeiten zu kurzen <strong>und</strong> langen Konjunkturzyklen kommt Gerhard Mensch,<br />
einer der interessantesten Vertreter der „technology-push"-These, zu der<br />
empirisch erhärteten Auffassung, daß lange Phasen wirtschaftlichen Aufschwungs<br />
allein durch die Umwandlung von wissenschaftlichen Entdeckungen<br />
<strong>und</strong> Erfindungen in Basisinnovationen <strong>und</strong> die sich daraus ergebende<br />
Dynamik von Innovationsschwärmen zustande kommen. Die nach der<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Verwertungslogik der Industrie bevorzugten Verbesserungs- <strong>und</strong> Scheininnovationen<br />
führten demgegenüber immer wieder in die Depression <strong>und</strong><br />
Stagnation (Mensch 1977, 66 ff.).<br />
Die konsequenteste Formulierung <strong>und</strong> die radikalste Version einer<br />
durch die Logik moderner Technologie<strong>entwicklung</strong> beherrschten Gesellschaft<br />
können wir bei Jacques Ellul finden. Er begreift moderne Technik<strong>entwicklung</strong><br />
— in Abgrenzung zur traditionellen Technik — als verselbständigten<br />
Automatismus von Technikwahlen, der sich ausschließlich am<br />
internen Rationalitätsmuster des „one best way", am Kalkül der technischen<br />
Effizienzsteigerung, orientiert. Zwar sind Konsumenten, Kapitalakkumulation,<br />
Forschungsbüros, Laboratorien <strong>und</strong> Produktionsstätten daran<br />
gleichsam mechanisch beteiligt, es ist jedoch die „kollektive, anonyme<br />
Forschung", welche die Technik mit dem Resultat der ständigen Selbst-<br />
Vermehrung" fortentwickelt (Ellul 1964, 85 f.). Der „Monismus", der<br />
Zwang zur Anschließbarkeit an andere Techniken <strong>und</strong> der „technische<br />
Universalismus" sorgen seiner Ansicht nach dafür, daß alle anderen geographischen<br />
Regionen <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong>n Handlungsbereiche dem technologischen<br />
Rationalitätsmuster unterworfen werden. „Today technique<br />
imposes itself, whatever the environment." (Ebda. 118). Aus seinen Bef<strong>und</strong>en,<br />
daß die technische Entwicklung weder von ökonomischen noch von<br />
politischen Entscheidungen konditioniert wird, daß sie weder moralische<br />
Grenzen noch geistige Werte akzeptiert, daß sie vor physikalischen <strong>und</strong> biologischen<br />
Gesetzen nicht haltmacht, sondern sie umgeht, öder in ihrem<br />
Sinne auf Kosten der natürlichen Umwelt nutzt, <strong>und</strong> daß sie als selbstvermehrender<br />
<strong>und</strong> selbst-kontrollierender Prozeß immer weniger auf<br />
menschliche Interventionen angewiesen ist, leitet Jacques Ellul seine<br />
These von der „Autonomie" moderner Technik<strong>entwicklung</strong> ab (ebda.<br />
133 ff.).<br />
Die hier nur kurz angerissenen Gr<strong>und</strong>gedanken einer technologischen<br />
Vergesellschaftungstheorie sollen ausreichen, auf eine wesentliche Stärke<br />
<strong>und</strong> zugleich Schwäche aufmerksam machen zu können. Auf der einen<br />
Seite verleiht die konsequente Behandlung technologischer Forschung <strong>und</strong><br />
Konstruktion als eigenständiges ausdifferenziertes System, das wegen seines<br />
Rationalitätsmusters „Effizienzkalkül" seine Leistungsfähigkeit selbstreferentiell<br />
<strong>und</strong> ohne äußere Stoppregeln grenzenlos steigern kann, diesem Ansatz<br />
eine hohe Geschlossenheit <strong>und</strong> Attraktivität, zumal viele empirisch<br />
beobachtbaren Phänomene sich ihr ohne Problem zuordnen lassen. Auf der<br />
anderen Seite ist diese Geschlossenheit weder logisch noch empirisch mit<br />
dem offenen Prinzip der Effizienz Steigerung vereinbar. Erstens ergibt eine<br />
Steigerung der Steigerung für sich allein keinen Sinn; sie ist kategorial<br />
immer auf eine Referenz angewiesen, z.B. die Steigerung der Produktionssteigerung;<br />
damit verliert sie jedoch ihren autonomen <strong>und</strong> geschlossenen<br />
Charakter. Zweitens mehren sich ständig die Belege dafür, daß es aus technologischer<br />
Sicht viele „best ways" gibt, aus denen dann je nach vorherrschender<br />
Referenz eine Variante ausgewählt wird.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Im Unterschied zur wissenschaftlichen Erkenntnis, die in der Regel auf<br />
eine eindeutige Lösung abzielt, ergibt sich aus dem Synthesecharakter der<br />
Technik<strong>entwicklung</strong> eine Vielfalt möglicher Konstruktionen. Im Unterschied<br />
zum ökonomischen System, das sich über das Medium Geld selbstreferentiell<br />
steuern kann, besitzt das ausdifferenzierte System der Technologie<strong>entwicklung</strong><br />
mit dem Prinzip der technischen Effizienz kein selbständiges<br />
Rationalitätsmuster <strong>und</strong> bleibt auf Referenzen angewiesen.<br />
Zu ganz anderen Einschätzungen gelangen die Theoretiker, welche die<br />
Vergesellschaftung auf die Logik ökonomischer Entwicklung zurückführen:<br />
Sie sehen statt der Verwissenschaftlichung <strong>und</strong> Entindustrialisierung eine<br />
zunehmende Subsumtion der Wissenschaft unter das Kapital, die sich von<br />
der anfänglichen ökonomischen Orientierung der Erfindung über die an<br />
Verwertungsimperativen ausgerichtete Forschung bis hin zur Industrialisierung<br />
der Wissenschaft steigert.<br />
So einleuchtend auf den ersten Blick die weiche These der „Demand"-<br />
Theoretiker unter den Innovationsökonomen ist, so begrenzt tauglich sind<br />
ihre Ergebnisse, um eine von der Logik des Kapitals determinierte Technologie<strong>entwicklung</strong><br />
empirisch zu erhärten: der Erfindungsfortschritt läßt sich<br />
nicht nur als Steigerung der Arbeits- <strong>und</strong> Kapitalersparnis rekonstruieren;<br />
die ökonomisch einträglichsten Technologie<strong>entwicklung</strong>en entstammen<br />
zum größten Teil nicht-ökonomisch induzierter Forschung <strong>und</strong> es vermehren<br />
sich die Fälle, in denen die Industrie gezwungen ist, kostenvermehrende<br />
Techniken einzuführen, z.B. Kontroll- oder Umweltschutztechnologien.<br />
In der industriesoziologischen Forschung neigen viele Wissenschaftler<br />
dazu, moderne Technologie<strong>entwicklung</strong> durch den Verwertungsprozeß des<br />
Kapitals bestimmt zu sehen. Insofern damit die technischen Verbesserungen<br />
<strong>und</strong> Erneuerungen gemeint sind, die den größten Anteil des betrieblichen<br />
Alltags bisher ausmachten, <strong>und</strong> insofern man sich auf den innerbetrieblichen<br />
Anwendungs- <strong>und</strong> Implementationsaspekt neuer Technologien beschränkt,<br />
mag diese These noch aufrechterhalten werden können. Sobald<br />
jedoch der von uns mit dem Begriff Forschung ausgezeichnete Prozeß<br />
moderner Technologie<strong>entwicklung</strong> angesprochen <strong>und</strong> der einzelbetriebliche<br />
Rahmen in Richtung auf das intersystemische Verhältnis von Industrie<br />
<strong>und</strong> Forschung überschritten wird, verändert sich der Charakter der Behauptung:<br />
sie wird zur „starken" These der reellen Subsumtion der Forschung<br />
unter das Kapital.<br />
Mit diesem Theorem hatte Marx schon den Übergang von der Manufaktur<br />
zur „großen Industrie" Ende des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>und</strong> in der ersten<br />
Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts erfaßt. Vertreter des Frankfurter Instituts für<br />
Sozialforschung griffen es anfangs dazu auf, „einen generellen Strukturwandel"<br />
der Lohnarbeit seit Ende des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts auf den Begriff zu bringen<br />
(Schmiede 1980, 473). Es wurde schließlich in den letzten Jahren zum<br />
„Subsumtions-Modell" ausgebaut, das dem Bedeutungsverlust der Arbeit<br />
<strong>und</strong> dem entsprechenden Bedeutungsgewinn von Technik <strong>und</strong> Wissenschaft<br />
für die kapitalistische Vergesellschaftung im gegenwärtigen 20. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
esser Rechnung tragen soll (Brandt/Papadimitriou 1983, 145 ff.). Logisch<br />
wird die mögliche „Unterwerfung von Wissenschaft <strong>und</strong> verwissenschaftlichter<br />
Technik unter Prinzipien der Kapitalverwertung" (ebda. 151) mit<br />
der These der „doppelseitigen Subsumtion des Konkreten unter das Abstrakt-Allgemeine",<br />
nicht nur des Gebrauchswerts unter den Wert in Form<br />
des Kapitals, sondern auch „der sinnlichen Erfahrung unter den wissenschaftlichen<br />
Verstand in Form des Schematismus" begründet (Schmiede<br />
1983, 60). Empirisch werden Prozesse der Industrialisierung der Forschung<br />
in den „science-based industries", Prozesse der Rationalisierung <strong>und</strong> Taylorisierung<br />
geistiger Arbeit <strong>und</strong> der „Annektierung der Biologie durch das<br />
Kapital" am Beispiel der Biotechnologie als Belege angeführt. Sie kommen<br />
schließlich zum Ergebnis, „daß mit fortschreitender Organisation des Wissenschaftsbetriebs<br />
der Prozeß wissenschaftlicher Erkenntnis selbst bis in<br />
seine Struktur hin der Steuerung durch Verwertungsimperative unterworfen<br />
wird" (Brandt/Papadimitriou 1983, 153 f.).<br />
Ähnlich wie die Verwissenschaftlichungs-These zieht der Subsumtions-<br />
Ansatz seine Stärken <strong>und</strong> Schwächen aus seiner Geschlossenheit, nur daß<br />
hier die Logik des Kapitals als geschlossenes <strong>und</strong> sich selbst steuerndes<br />
System begriffen wird. Ihr soll es gelingen, den „Prozeß wissenschaftlicher<br />
Reflexion" in einen „Prozeß algorithmischer Problemlösungen zu transformieren"<br />
(Ebda. 152). Es wird zwar eingestanden, daß der Vollzug der<br />
reellen Subsumtion durch Widerstände modifiziert werden kann, jedoch<br />
werden keine systematischen Grenzen dieser kapitalistischen Vergesellschaftungsform<br />
angeführt, z.B. die Unmöglichkeit, geistige Prozesse bei der analytischen<br />
Modellierung vollständig abzubilden, oder die Unmöglichkeit, bei<br />
hoher Systemkomplexität das Optimierungskalkül anzuwenden.<br />
Auch die Konzeptualisierung der Wissenschafts<strong>entwicklung</strong> als Prozessieren<br />
„reiner Verstandestätigkeit" (Schmiede 1983, 60) <strong>und</strong> der Technologie<strong>entwicklung</strong><br />
als „Unterwerfung unter eine abstrakte 'technologische' <strong>und</strong><br />
'ökonomische Rationalität'" (Schmiede 1980, 478) schenkt sich die analytisch<br />
relevante Frage, wie die Interdependenz zwischen Erkenntnis <strong>und</strong><br />
Ökonomie ohne Leistungsverlust organisierbar ist. Bei einer solchen reduktionistischen<br />
Begriffsstrategie, die sich allein durch die Annahme einer<br />
„Analogie" oder einer „strukturellen Affinität" (Ullrich 1982) von Kapitallogik<br />
<strong>und</strong> Wissenschaftlogik legitimiert, geraten die Interdependenzbeziehungen<br />
nicht mehr ins theoretische Blickfeld; <strong>und</strong> Fragen nach den empirischen<br />
Bedingungen gegenseitiger Begrenzung <strong>und</strong> auch gegenseitiger<br />
Leistungssteigerung von Forschung <strong>und</strong> Industrie bleiben ausgeblendet.<br />
Eine dritte Gruppe von Ansätzen läßt sich unter dem Stichwort „Vergesellschaftung<br />
durch die 'Logik' der Beherrschung" zusammenfassen. In<br />
ihren radikalen Varianten wird die moderne Technologie<strong>entwicklung</strong> als<br />
verselbständigte Form von Klassenherrschaft aufgefaßt. Ist die Technologie<br />
z.B. bei Herbert Marcuse aufgr<strong>und</strong> des „zuinnerst instrumentalistischen<br />
Charakters moderner wissenschaftlicher Rationalität nicht nur Mittel, sondern<br />
selbst eine Form sozialer Kontrolle <strong>und</strong> Herrschaft (Marcuse 1968,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
172), läßt sich bei Lewis Mumford die Technikgeschichte aus den Herrschaftsbedürfnissen<br />
der Mächtigen <strong>und</strong> den herrschenden Orientierungen<br />
von „Machtkulturen" (Mumford 1963 <strong>und</strong> 1978) herleiten.<br />
Im „labor-controV'-Ansatz von Harry Braverman <strong>und</strong> Richard Edwards<br />
wird eine machtsoziologische Interpretation kapitalistischer Vergesellschaftung<br />
gegeben. Sie rekonstruieren die technisch-wissenschaftliche<br />
Entwicklung der Produktion als kontinuierlichen Prozeß der Ausweitung<br />
der kapitalistischen Kontrolle über die Arbeitskräfte (Braverman 1977;<br />
Edwards 1981). Bezogen auf mögliche Technikwahlen hat Stephan Marglin<br />
zugespitzt formuliert, daß weder die technologische Effektivität noch die<br />
ökonomische Effizienz, sondern historische Herrschafts- <strong>und</strong> Kontrollinteressen<br />
für die Auswahl entscheidend sind (Marglin 1977). Wichtiger für<br />
unser Thema der Technikerzeugung ist die Studie von David Noble über<br />
die „science-based industries", in der er die „Verheiratung von Wissenschaft<br />
<strong>und</strong> Industrie" auch nach dem Modell der Ausdehnung der Kontrolle des<br />
Kapitals über die wissenschaftliche Entwicklung beschreibt, von der Kontrolle<br />
über das Produkt (Patenterwerb), über die Kontrolle des Forschungs<strong>und</strong><br />
Entwicklungsprozesses (Industrieforschung) bis hin zur Kontrolle der<br />
Infrastruktur (Wissenschaftliche Institutionen, Wissenschaftspolitik) (Noble<br />
1977).<br />
Allerdings sieht er auch einen umgekehrten Einflußprozeß auf das Kapital,<br />
das sich in seiner institutionalisierten Form verändert. Besonders auch<br />
in seiner Fallstudie zur Entwicklung der NC-Technik wird sein analytischer<br />
Bezug auf verschiedene „Logiken" <strong>und</strong> ihre historische Relationierung<br />
deutlich (Noble 1978).<br />
Die Kritik am Überziehen der Logik der Beherrschung wird weitgehend<br />
innerhalb dieser Ansätze selbst schon geleistet. Vor allem historische Studien,<br />
z.B. Craig Littlers Arbeit zur Entwicklung des Arbeitsprozesses im<br />
Kapitalismus (1982), Nobles Arbeit zur Entwicklung der Maschinentechnik<br />
(1984) <strong>und</strong> auch Lothar <strong>und</strong> Irmgard Hacks Arbeiten zur Großindustriellen<br />
Chemie- <strong>und</strong> Biotechnologieforschung (1985a <strong>und</strong> b), machen deutlich, daß<br />
es nicht sinnvoll ist, weiterhin die moderne Technologie<strong>entwicklung</strong> aus nur<br />
einer Logik erklären zu suchen. Damit kommen wir zu der anfangs von uns<br />
vorgeschlagenen Optik zurück.<br />
6. Der Wandel vom industriellen zum wissenschaftlich-reflexiven Strategietyp<br />
Wir gehen von der Existenz mehrerer „Logiken" nebeneinander aus, die als<br />
Ergebnis funktionaler Ausdifferenzierung von Rationalitätsmustern <strong>und</strong><br />
entsprechender Subsysteme angesehen werden.<br />
Organisationen wie Industrieunternehmen, Forschungs- <strong>und</strong> Entwicklungsbetriebe<br />
oder akademische Forschungsinstitute sind durch die beson-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
dere Art der Verknüpfung verschiedener Rationalitätsmuster charakterisiert.<br />
Reflexive Strategien der Akteure vermitteln zwischen ihnen. Die<br />
strategische Umwandlung externer Herausforderungen in interne Organisationsstrukturen<br />
schlägt sich in historisch-situativen Lernprozessen nieder<br />
(Vgl. Rammert/Projektgruppe Technikforschung 1985).<br />
Es entsteht zum Beispiel ein schiefes <strong>und</strong> zudem historisch falsches<br />
Bild, wenn der Taylorismus nur als „adäquate Form der Arbeitsorganisation"<br />
aus der Logik des Kapitals (vgl. für viele andere Mendner 1975) oder<br />
wenn er anschließend aus der Logik der Beherrschung <strong>und</strong> Kontrolle der<br />
Arbeitskraft hergeleitet wird (Braverman 1977). Taylorismus als eine reflexive<br />
Strategie begreifen heißt, ihn als historische Ko<strong>mb</strong>ination von Ökonomisierungszielen<br />
<strong>und</strong> Beherrschungsabsichten <strong>und</strong> als situativ herausgebildete<br />
Antwort der Unternehmen auf bestimmte ökonomische <strong>und</strong> politische<br />
Herausforderungen zu untersuchen. Nur so kann die mögliche Vielfalt strategischer<br />
Lösungsversuche (vgl. Littler/Salomon 1983, Wood 1982) erklärt<br />
<strong>und</strong> das Entstehen neuer Strategien in einigen Bereichen, wie das von Horst<br />
Kern <strong>und</strong> Michael Schuman referierte „neue Produktionskonzept" (1984)<br />
oder das von Michael Burawoy nachgezeichnete Konzept der Einbindung<br />
der Arbeiter durch strategisch gewährte Spielräume (Burawoy 1983) entdeckt<br />
werden.<br />
Wenden wir den reflexiven Strategiebegriff auf unsere Problemstellung,<br />
der Analyse der Vergesellschaftung moderner Technologie<strong>entwicklung</strong>, an,<br />
kommen wir auch hier zu anderen Einsichten <strong>und</strong> Ergebnissen als z.B. der<br />
Subsumtions-Ansatz. Dort wird die Entstehung der „science-based industries"<br />
fast ausschließlich als erweiterter Zugriff des Kapitals auf die Forschung<br />
gesehen. Dabei wird die relative Autonomie der Forschung als auf<br />
Dauer vernachlässigbare Widerständigkeit behandelt. Konzeptualisieren wir<br />
den Prozeß als Umorganisation eines Interdependenzverhältnisses zwischen<br />
Forschung <strong>und</strong> Ökonomie, so fällt uns die seit 1890 ansteigende Abhängigkeit<br />
der Unternehmen der elektrotechnischen <strong>und</strong> chemischen Industrie<br />
vom wissenschaftlich induzierten Prozeß der Technologie<strong>entwicklung</strong> auf.<br />
Die rasante Dynamik der Erfindungen, die gesteigerte Konkurrenz um die<br />
Patente <strong>und</strong> die mit der Innovationskonkurrenz beschleunigte Produktveraltung<br />
bedrohte auch die Handlungsfreiheit, vor allem die Berechenbarkeit<br />
<strong>und</strong> Sicherstellung des ökonomischen Erfolgs der Unternehmen. Die<br />
Herausbildung industrieeigener Forschungs- <strong>und</strong> Entwicklungsabteilungen<br />
kann daher auch als unternehmerische Strategie interpretiert werden, die<br />
aus der Wissenschaftsdynamik erwachsenden Einschränkungen seiner Autonomie<br />
zu begrenzen. Die Gründung eigener Industrieforschungslabors bedeutete<br />
nicht nur die organisatorische Kontrolle über einen beschränkten<br />
Ausschnitt des gesamten Forschungssystems, sondern auch die Sicherung<br />
des Anschlusses der Industrie an die Entwicklungen im Wissenschaftssystem,<br />
war also auch Ausdruck der strategisch organisierten Interdependenz.<br />
Ein zweiter wesentlicher Gesichtspunkt, der häufig übersehen oder unterschätzt<br />
wird, ist die Tatsache, daß mit der Hereinnahme der Forschung<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
in das Industrieunternehmen Probleme der Integration der verschiedenen<br />
Rationalitätsmuster entstehen: die Unterordnung des „stochastischen"<br />
Forschungsprozesses unter die strengen betriebswirtschaftlichen ökonomisierungsverfahren<br />
würde gerade die gewünschte Steigerung des Innovationspotentials<br />
verhindern. Die Unterwerfung des wissenschaftlich arbeitenden<br />
Forschungspersonals unter Methoden der bürokratisch-industriellen Kontrolle<br />
würde die erwartete Kreativität <strong>und</strong> wissenschaftliche Produktivität<br />
stark einschränken. Sollen weder die ökonomischen Ziele der industriellen<br />
Ökonomie gefährdet noch die innovative Kapazität der industriellen Forschung<br />
beeinträchtigt werden, müssen sich im Vergleich zur klassischen<br />
industriellen Strategie offenere <strong>und</strong> reflexivere Formen der Verknüpfung<br />
der beiden Rationalitätsmuster herausbilden. Diese reflexive Strategie gibt<br />
sich durch die Abkehr von der „Unterordnung" zur „unternehmerisch organisierten<br />
Autonomie", von der „direkten Einwirkung" zur „Orientierung"<br />
durch Struktur- <strong>und</strong> Umweltvorgaben <strong>und</strong> von der „hierarchischen Integration"<br />
zur projektbezogenen „Selbstorganisation" von Interdependenzbeziehungen<br />
zu erkennen (vgl. Rammert 1983).<br />
Als These halten wir fest:<br />
These 5:<br />
Die Herausbildung der „science-based industries" wird mit dem Begriff der<br />
„Industrialisierung der Wissenschaft" <strong>und</strong> der These der einseitigen Ausweitung<br />
der industriellen Kontrolle über den Forschungsprozeß nur unzureichend<br />
erfaßt. Die gleichzeitige „Verwissenschaftlichung der Industrie", die zunehmende<br />
Abhängigkeit des ökonomischen Erfolgs von der internen Innovationskapazität<br />
<strong>und</strong> vom Anschluß an die externen wissenschaftlich-technologischen<br />
Entwicklungstrends, verweisen auf die tendenzielle Ablösung des industriellen<br />
durch einen wissenschaftlich-reflexiven Strategietyp.<br />
Die Herausbildung korporatistisch organisierter wissenschaftlich-industrieller<br />
Komplexe in der Gegenwart, vom Manhattan-Projekt bis zur japanischen<br />
MITI-Politik, stellt eine qualitativ neue Stufe der Interdependenz von Industrie<br />
<strong>und</strong> Forschung dar, die über das Muster der „science-based industries"<br />
hinausgeht. Auf dieser Stufe erhöhter Komplexität wird das Versagen reduktionistischer<br />
Vergesellschaftungstheorien besonders offensichtlich:<br />
Die Verlängerung <strong>und</strong> zeitliche Phasendifferenzierung moderner Technik<strong>entwicklung</strong><br />
lassen es immer weniger zu, nur das Industrieunternehmen<br />
oder das Forschungsinstitut als bevorzugten sozialen Ort der Realisierung<br />
der entsprechenden Logik zu behandeln. Von der Gr<strong>und</strong>lagenforschung bis<br />
zur Implementation gibt es verschiedene Instanzen, in die jeweils unterschiedliche<br />
soziale Akteure eingreifen können. Herbert Kitschelt (1980),<br />
Joachim Radkau (1983) <strong>und</strong> Otto Keck (1984) haben diese Vielfalt von politischen<br />
Arenen, von Akteuren <strong>und</strong> ihren Rationalitätsmustern sowie ihrer<br />
sich fördernden oder begrenzenden Interdependenzen am Beispiel der Kernforschungspolitik,<br />
ihrer Geschichte <strong>und</strong> am Fall der Brutreaktor<strong>entwicklung</strong><br />
aufgezeigt.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Die Ausdehnung moderner Technologien über die Subsystemgrenzen<br />
hinaus — diese Tendenz wird meist als „Großtechnologie" angesprochen —<br />
vergrößert das Spektrum der betroffenen Bereiche sowie der mit ihr in Beziehung<br />
kommenden Akteure. Am Projekt der Breitbandverkabelung sind<br />
nicht nur unterschiedliche Anbieter-, Anwender- <strong>und</strong> Entscheider-Akteure<br />
beteiligt (Mettler-Meibom 1983), sie differenzieren sich noch weiter in<br />
profitierende <strong>und</strong> auskonkurrierte Industriefraktionen <strong>und</strong> in fördernde,<br />
reformierende oder boykottierende Politikfraktionen.<br />
Angesichts solcher Interessenvielfalt ist die Durchsetzung nur einer<br />
Logik nicht nur unwahrscheinlich, sondern führt geradezu den Mißerfolg<br />
herbei. Es scheinen sich vielmehr korporatistische Zwischengremien als<br />
<strong>gesellschaftliche</strong> Orientierungsinstanzen herauszubilden, in denen durch<br />
die Koordination der reflexiven Strategien zentraler Akteure der erhöhten<br />
Interdependenz Rechnung getragen wird.<br />
Als These fassen wir zusammen:<br />
These 6: Der zeitlich verlängerte <strong>und</strong> der grenzüberschreitende Charakter moderner<br />
Technologie<strong>entwicklung</strong> hat die Zahl der sozialen Instanzen <strong>und</strong> der sozialen<br />
Akteure so sehr vermehrt, daß die Steuerung von außen über eine Logik<br />
immer unwahrscheinlicher <strong>und</strong> durch eine „reflexiv koordinierte Selbststeuerung"<br />
abgelöst wird.<br />
Dieser Strategietyp muß sowohl die konfliktreiche Verflechtung der Rationalitätsmuster<br />
miteinander als auch die reflexive Antizipation der anderen<br />
Akteurstrategien einbeziehen können, um angesichts der gesteigerten Interdependenz<br />
<strong>und</strong> Kontingenz Technologie<strong>entwicklung</strong> orientieren zu können.<br />
Unsere Ausführungen lassen sich in der These resümieren:<br />
These 7:<br />
Moderne Technologie<strong>entwicklung</strong> kann nur dadurch industriell strategisch<br />
orientiert werden, daß ihrem Charakter als Forschung durch eine reflexiv<br />
organisierte Autonomie ihres Erzeugungsprozesses Rechnung getragen wird.<br />
Während bei der Funktionalisierung der Forschung ihre Leistung beschränkt<br />
würde, wird bei gelungener reflexiv organisierter Interdependenz gerade durch<br />
die wechselseitige Begrenzung der Handlungsspielräume eine gemeinsame<br />
Leistungssteigerung möglich: in diesem Fall die der ökonomischen Effizienz<br />
<strong>und</strong> der wissenschaftlichen Innovativität.<br />
LITERATUR<br />
Barnes, B., 1982: „The Science-Technology Relationship: A Model and A Query."<br />
Social Studies of Science, Vol 12.<br />
Bell, D.,: 1985: Die nachindustrielle Gesellschaft, (Erstveröff. 1973) Frankfurt/New<br />
York.<br />
Böhme, G., van den Daele, W., Krohn, W., 1978: „Die Verwissenschaftlichung von Technologie."<br />
In: G. Böhme et. al.: Die <strong>gesellschaftliche</strong> Orientierung des wissenschaftlichen<br />
Fortschritts, Frankfurt.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Brandt, G., Papadimitriou, Z., 1983: Der Beitrag der industriesoziologischen Forschung<br />
zur Entwicklung eines sozialwissenschaftlichen Technikbegriffs. Vortrag auf dem<br />
II. Technologie-Kolloquium, Frankfurt.<br />
Braverman, H., 1977: Die Arbeit im modernen Produktionsprozeß, Frankfurt/M.<br />
Brooks, H., 1965: „The Interaction of Science and Technology: Another View." In:<br />
The Impact of Science on Technology. Ed. A. Werner, O. Morse, A. Eichner,<br />
Colu<strong>mb</strong>ia UP, New York.<br />
Burawoy, M., 1983: Manufacturing Consent: Changes in the Labour Process <strong>und</strong>er<br />
Monopoly Capitalism, Chicago (Erstveröff. 1979).<br />
Edwards, R., 1981: Herrschaß im modernen Produktionsprozeß, Frankfurt/M.<br />
Ellul, J., 1964: The Technological Society, New York (La Technique ou l'enjeu du<br />
siecle, Paris 1954).<br />
Gehlen, A., 1957: Die Seele im technischen Zeitalter. Ha<strong>mb</strong>urg.<br />
Hack, L., 1984: Industrialisierung immaterieller Produktionsprozesse — Konzeptualisierung<br />
technologischer Entwicklungen im Kontext organisierter Industrieforschung.<br />
Vortragsmanuskript vom III. Technologie-Kolloquium, Frankfurt.<br />
Hack, L., Hack, L., 1985a: Die Wirklichkeit, die Wissen schafft, Frankfurt/M.<br />
Hack, L., 1985b: „Brauchen wir einen neuen akademisch-industriellen Komplex? Zur<br />
Konstruktion 'kritischer Massen' im Bereich der industriellen Mikrobiologie/Gentechnologie."<br />
In: Technik <strong>und</strong> Gesellschaft. Jahrbuch 3, hg. v. W. Rammert u.a.,<br />
Frankfurt.<br />
Henrich, D., 1982: „Denken <strong>und</strong> Forschung." In: Fluchtlinien. Frankfurt.<br />
Kern, H., Schumann, M., 1984: „Neue Produktionskonzepte haben Chancen — Erfahrungen<br />
<strong>und</strong> erste Bef<strong>und</strong>e der Folgestudie zu 'Industriearbeit <strong>und</strong> Arbeiterbewußtsein'."<br />
In: Soziale Welt, 1/2.<br />
Keck, O., 1984: Der Schnelle Brüter. Eine Fallstudie über Entscheidungsprozesse in der<br />
Großtechnik, Frankfurt.<br />
Kitschelt, H., 1980: Kernenergiepolitik. Arena eines <strong>gesellschaftliche</strong>n Konflikts,<br />
Frankfurt.<br />
Kondratieff, N.D., 1926: „Die langen Wellen der Konjunktur." In: Archiv für Sozialwiss.<br />
<strong>und</strong> Sozialpolitik, Jg. 56.<br />
Layton, E., 1977: „Technology and Science, or 'Vive La Petite Difference'." In:<br />
Littler, C, 1982: The Development of the Labour Process in Capitalist Societies,<br />
London.<br />
Luhmann, N., 1975: Soziologische Aufklärung 2, Opladen.<br />
Luhmann, N., 1981: Soziologische Aufklärung 3, Opladen.<br />
Lutz, B., 1983: „Technik <strong>und</strong> Arbeit." In: DFG (Hg.): Forschung in der BRD, Weinheim.<br />
Marcuse, H., 1968: Der eindimensionale Mensch, Neuwied (Erstveröff. 1964).<br />
Marglin, S., 1977: „Was tun die Vorgesetzten? Ursprünge <strong>und</strong> Funktionen der Hierarchie<br />
in der kapitalistischen Produktion." In: Technologie <strong>und</strong> Politik, H. 8, Reinbek.<br />
Mendner, J., 1975: Technologische Entwicklung <strong>und</strong> Arbeitsprozeß. Zur reellen Subsumtion<br />
der Arbeit unter das Kapital, Frankfurt.<br />
Mensch, G., 1977: Das technologische Patt. Innovationen überwinden die Depression,<br />
Frankfurt.<br />
Mettler-Meibom B., 1983: „Breitbandkommunikation auf dem Marsch durch die Institutionen."<br />
In: Technik <strong>und</strong> Gesellschaft. Jahrbuch 2, hg. v. W. Rammert u.a.,<br />
Frankfurt.<br />
Mumford, L., 1963: Technics and Civilization, New York (Erstveröff. 1934).<br />
Mumford, L., 1978: Der Mythos der Maschine, Frankfurt (Erstveröff. 1967).<br />
Noble, D., 1977: America by Design. Science, Technology and the Rise of Corporate<br />
Capitalism, New York.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Noble, D., 1978: „Social Choice in Machine Design." In: Politics and Society, 3/4.<br />
Noble, D., 1984: The Social Forces of Production, New York.<br />
Pasteur, L., 1922-1939: Oeuvres Completes, Vol. 107, Paris.<br />
Radkau, J., 1983: Aufstieg <strong>und</strong> Krise der deutschen Atomwirtschaß, Reinbek.<br />
Rammert, W., 1983: Soziale Dynamik der technischen Entwicklung, Opladen.<br />
Rammert, W./Projektgruppe Technikforschung 1985: Technik<strong>entwicklung</strong> im Unternehmen:<br />
Strategien, Innovationsverläufe <strong>und</strong> Ingenieurbewußtsein. Arbeitsberichte<br />
<strong>und</strong> Forschungsmaterialien der Fakultät für Soziologie Nr. 38, Bielefeld.<br />
Schmiede, R., 1980: „Rationalisierung <strong>und</strong> reelle Subsumtion." In: Leviathan 4, Jg. 8.<br />
Schmiede, R., 1983: „Abstrakte Arbeit <strong>und</strong> Automation." In: Leviathan 1, Jg. 11.<br />
Schuchardin, S.W., 1963: Die Gr<strong>und</strong>lagen der Geschichte der Technik. Versuch einer<br />
Ausarbeitung der theoretischen <strong>und</strong> methodologischen Probleme. Leipzig.<br />
Schumpeter, J., 1961: Konjunkturzyklen, Göttingen.<br />
Simon, A., 1969: The Science of the Artificial, Ca<strong>mb</strong>ridge, Mass.<br />
Ullrich, O., 1982: Technik <strong>und</strong> Herrschaß, Frankfurt.<br />
Weingart, P., 1982: „Strukturen technologischen Wandels. Zu einer soziologischen Analyse<br />
der Technik." In: Jokisch, R.(Hg.): Technik<strong>soziologie</strong>, Frankfurt.<br />
Weizsäcker, C.F.v., 1960: Zum Weltbild der Physik, Stuttgart 8. Aufl.<br />
Wood, S. (Hg.), 1982: The Degradation of Work? Skill, Deskilling and the Labour<br />
Process, London.<br />
Zilsel, E., 1976: Die sozialen Ursprünge der neuzeitlichen Wissenschaft. Frankfurt.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
GEWERKSCHAFTLICHE TECHNOLOGIEPOLITIK ZWISCHEN<br />
STATUSSICHERUNG UND ARBEITSGESTALTUNG*<br />
Eckart Hüdebrandt, Rüdiger Seltz<br />
Einleitung<br />
Es dürfte keinem Zweifel mehr unterliegen, daß die veränderte wirtschaftliche<br />
Situation in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland sowie der massive Einsatz<br />
von neuer Datentechnologie in den Betrieben die Arbeitssituation der<br />
Beschäftigten deutlich beeinflußt haben. Weniger wird diskutiert, welchen<br />
Einfluß diese Entwicklungen direkt <strong>und</strong> indirekt auf die Möglichkeiten <strong>und</strong><br />
Perspektiven von Gewerkschaftspolitik haben. Im Mittelpunkt stehen häufig<br />
die Auswirkungen einer breiten Technik-Anwendung <strong>und</strong> neuer Management-Strategien.<br />
Neuere Analysen des Rationalisierungsprozesses in der<br />
Industrie haben zu der Annahme geführt, daß sog. Neue Produktionskonzepte<br />
(Kern/Schumann 1984a) zunehmend die Strategie der Unternehmen<br />
bestimmen. Die Nutzung der Gestaltungsmöglichkeiten neuer Technologien<br />
zusammen mit einer umfassenden Nutzung des menschlichen Arbeitsvermögens<br />
führe zumindest in prosperierenden Teilbereichen der Industrie zu<br />
einer „Reprofessionalisierung" von Facharbeit, der Abschwächung von<br />
Herrschaft als Rationalisierungsziel <strong>und</strong> zu einer teilweisen Stärkung der<br />
Position der betrieblichen Interessenvertretung. Eine solche These hat natürlich<br />
für die zukünftigen Anforderungen an Gewerkschaftspolitik eine<br />
zentrale Bedeutung, da sie eine (neue) Gewährleistung von Gewerkschaftszielen<br />
— ohne deren Intervention — über eine zumindest partielle Interessenidentität<br />
nahelegt.<br />
Der folgende Beitrag bezieht sich an verschiedenen Stellen auf diese<br />
These, die sicher für eine längere Zeit die Auseinandersetzung bestimmen<br />
wird. Dazu werden in einem ersten Teil die neuen <strong>gesellschaftliche</strong>n Rahmenbedingungen<br />
von Gewerkschaftspolitik skizziert,<br />
im zweiten Teil einige wesentliche Aussagen der „Neuen Produktionskonzepte"<br />
diskutiert, <strong>und</strong><br />
im dritten Teil wird versucht, die veränderten <strong>gesellschaftliche</strong>n <strong>und</strong> betrieblichen<br />
Bedingungen zu einem Ansatz gewerkschaftlicher Gestaltungspolitik<br />
zusammenzuführen.<br />
Die empirischen Hinweise im Mittelteil basieren auf vorläufigen Ergebnissen des<br />
Forschungsprojekts „Politik <strong>und</strong> Kontrolle beim Einsatz computergesteuerter<br />
Produktionsplanung <strong>und</strong> -Steuerung", das von G. Dörr/E. Hildebrandt/R. Seltz<br />
am Wissenschaftszentrum Berlin/Schwerpunkt Arbeitspolitik durchgeführt wird.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Teil I: Rahmenbedingungen zukünftiger Gewerkschaftspolitik<br />
Eine steigende Anzahl von Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialwissenschaftlern geht von<br />
einer zunehmenden Segmentierung der Volkswirtschaft aus. Sie unterscheiden<br />
z.B. einen sog. funktionierenden Kernbereich (z.B. Chemieindustrie,<br />
Automobilindustrie, Elektronikindustrie), krisenbestimmte Branchen (z.B.<br />
Bergbau, Stahl <strong>und</strong> Werften), sowie den Bereich der Arbeitslosigkeit (sog.<br />
Schattenwirtschaft). Für eine solche Entwicklungstendenz gibt es insbesondere<br />
in anderen westlichen Industrienationen ausreichende Indikatoren.<br />
Bisher war die ökonomische Gr<strong>und</strong>lage der nationalen Gewerkschaftspolitik<br />
die Ausweitung der Industrialisierung auf weitere Wirtschaftsbereiche<br />
<strong>und</strong> Gruppen der Arbeitsbevölkerung, das Wachstum der Produktionseinheiten<br />
<strong>und</strong> die Homogenisierung von Arbeitsverhältnissen <strong>und</strong> -bedingungen.<br />
Sie ermöglicht eine Politik, die eine Verallgemeinerung <strong>und</strong> Angleichung<br />
von Arbeits- <strong>und</strong> Einkommensbedingungen auf der Gr<strong>und</strong>lage<br />
möglichst umfassender Organisierung verfolgte.<br />
Aus der Auseinander<strong>entwicklung</strong> von ökonomischen Strukturen (Segmentierung<br />
<strong>und</strong> Flexibilisierung) <strong>und</strong> dem Politikziel der Verallgemeinerung<br />
<strong>und</strong> Angleichung ergeben sich gravierende Gefährdungen gewachsener<br />
Gewerkschaftspolitik:<br />
— eine quantitative Schwächung der Organisationsmacht durch Verringerung<br />
des traditionellen Mitgliederpotentials;<br />
— eine zunehmende Durchbrechung des Politikziels der Angleichung<br />
durch eine Segmentierung der Wirtschaftsbereiche, des Arbeitsmarktes<br />
<strong>und</strong> der Arbeitsverhältnisse.<br />
Die mangelnde Anpassung der Gewerkschaftspolitik an diese neue Konstellation<br />
hat bereits zu einer faktischen Aushöhlung des Verallgemeinerungs<strong>und</strong><br />
Angleichungspostulats geführt: durch eine „Entgewerkschaftlichung"<br />
bestimmter Sektoren <strong>und</strong> durch die Konzentration von Politik auf traditionelle<br />
Kerngruppen der Beschäftigten.<br />
Die b<strong>und</strong>esdeutschen Gewerkschaften stehen also vor dem Problem,<br />
ob sie bei veränderten ökonomischen (<strong>und</strong> politischen) Gr<strong>und</strong>lagen entweder<br />
das Ziel der Verallgemeinerung <strong>und</strong> Angleichung aufrechterhalten<br />
<strong>und</strong> entsprechende Politiken entwickeln <strong>und</strong> vorrangig-propagieren sollen;<br />
oder aber mit einer Segmentierung der Gewerkschaftspolitik reagieren in<br />
dem Sinne, daß sie in den verschiedenen Segmenten organisieren <strong>und</strong> dort<br />
unterschiedliche Politiken (<strong>und</strong> wenn: welche?) verfolgen;<br />
oder aber sich auf einen funktionierenden Kernbereich beschränken, in<br />
dem Mindeststandards an Arbeitsverhältnissen (Arbeitsvertragsdauer, Arbeitszeit,<br />
Mindesteinkommen) <strong>und</strong> Arbeitsbedingungen (Tätigkeitsanforderungen,<br />
Arbeitsschutzmaßnahmen etc.) aufrechtzuerhalten oder sogar zu<br />
verbessern sind.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Sicherlich sind Tendenzen in alle drei Richtungen vorhanden. Besonders<br />
eine pragmatische Politik der Einzelgewerkschaften bei einem schwachen<br />
Dachverband sowie eine betriebszentrierte (Betriebsrats-)Politik, die am<br />
stärksten auf aktuelle Gefährdungen im eigenen Organisationsbereich reagieren,<br />
tendieren zur Segmentierung. Damit einher geht dann die Unmöglichkeit,<br />
eine über soziale Zugeständnisse <strong>und</strong> Korrekturen hinausgehende<br />
Politik zu konzipieren <strong>und</strong> durchzusetzen. Gewerkschaftliche Politik wird<br />
zum Reflex der Sektoren- bzw. Unternehmens<strong>entwicklung</strong>. Demgegenüber<br />
wäre Bedingung einer übergreifenden Politik, daß der Dachverband DGB im<br />
Sinne perspektivischer Denkanstöße, Strategievorschläge, Koordination<br />
<strong>und</strong> Hilfestellung gestärkt wird.<br />
Das Problem läßt sich also in einer Weise bestimmen, daß das Ziel der<br />
Verallgemeinerung <strong>und</strong> Angleichung auf veränderter historischer Gr<strong>und</strong>lage<br />
neu formuliert <strong>und</strong> nur mit einer neu konzipierten Politik angestrebt werden<br />
kann. Dazu gehört, daß<br />
erstens die Gewerkschaften im funktionierenden Kernbereich der Wirtschaft<br />
so stark <strong>und</strong> zudem bereit sind, Umverteilungsforderungen aufzustellen<br />
<strong>und</strong> durchzusetzen, die der Segmentierung entgegenwirken;<br />
zweitens die Gewerkschaften sich in den ,,nicht-funktionierenden Randbereichen"<br />
darauf orientieren, zumindest vorübergehend auch abweichende<br />
Arbeitsverhältnisse zu organisieren, um damit auch dort Gegenkräfte gegen<br />
die Segmentierung aufzubauen, <strong>und</strong> es<br />
drittens gelingt, die Produkt- <strong>und</strong> Produktionspolitik im funktionierenden<br />
Kernbereich so zu beeinflussen (zu gestalten), daß die fortschreitende<br />
Produktion von Arbeitslosigkeit <strong>und</strong> unterwertigen Arbeitsverhältnissen<br />
gestoppt oder sogar umgekehrt wird. Denn der funktionierende Kernbereich<br />
ist qua Definition der Bereich, in dem die Produktionstechnologien<br />
<strong>und</strong> Produkte hergestellt werden, die Fertigungsverfahren, Dienstleistungen<br />
<strong>und</strong> damit Arbeitsbeziehungen, Tätigkeiten <strong>und</strong> Arbeitssituationen strukturieren.<br />
Die Produktions- <strong>und</strong> Produktpolitik der Unternehmen hat ja im<br />
Zusammenwirken mit dem Konsumverhalten der Bevölkerung zu einer<br />
Vernutzung <strong>und</strong> Schädigung natürlicher Ressourcen geführt, die sich zu<br />
einer sich immer bedrohlicher abzeichnenden ökologischen Schranke<br />
traditioneller Industriepolitik verdichtet hat. Diese ökologische Schranke<br />
wird damit zugleich Schranke für traditionelle Gewerkschaftspolitik (vgl.<br />
die Entgegensetzung von Umweltschutz <strong>und</strong> Arbeitsplatzsicherung).<br />
Alle drei Bedingungen stellen gegenüber der Wachstumsphase der 60er<br />
<strong>und</strong> 70er Jahre neuartige Anforderungen an Gewerkschaftspolitik in dem<br />
Sinne, daß in einer sektorbezogenen Politik zumindest die Perspektive einer<br />
sektorübergreifenden Angleichung materiell enthalten sein müßte.<br />
Traditionelle Gewerkschaftsforderungen beruhen auf den materiellen<br />
Interessen der Mitglieder, d.h. erfahrbaren, sichtbaren Mängeln der eigenen<br />
Arbeitssituation (unzureichendes verfügbares Einkommen, Arbeitsbelastungen,<br />
Dequalifizierung etc.) <strong>und</strong> zielen auf direkte persönliche Verbesserungen.<br />
Den o.g. Politiken dagegen fehlt diese persönliche Unmittelbarkeit,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
indem sie nur indirekte, zeitlich versetzte <strong>und</strong> noch nicht einmal genau zu<br />
kalkulierende Effekte für die Gewerkschaftsmitglieder erbringen. Noch gravierender,<br />
sie können als Umverteilungspolitik innerhalb der Arbeitsbevölkerung<br />
sogar zu einem Abzug vom möglichen Forderungsvolumen im funktionierenden<br />
Kernbereich zugunsten der anderen Bereiche führen — also<br />
nicht Besitzstandswahrung <strong>und</strong> -mehrung, sondern gesellschaftspolitische<br />
Umverteilung im Interesse der Gesamtorganisation. Diese Problematik hat<br />
sich erstmals bei den vergangenen Verhandlungen um Arbeitszeitverkürzung<br />
voll entfaltet <strong>und</strong> dürfte — neben den Auswirkungen der Krise — eine Ursache<br />
dafür sein, daß „die Basis in den Betrieben zurückweicht".<br />
Mit diesen einleitenden Bemerkungen sollte im wesentlichen darauf hingewiesen<br />
werden, daß sowohl die Gewerkschaften wie auch — allerdings in<br />
anderer Weise — die Unternehmen unter dem Einfluß starker <strong>und</strong> veränderter<br />
globaler Entwicklungen stehen, die die Gestaltungsautonomie nach<br />
außen weitgehend einschränken <strong>und</strong> die sowohl eine veränderte Gewerkschaftspolitik<br />
wie auch neue Managementkonzepte erfordern. Es erscheint<br />
uns daher in jedem Fall als verkürzt <strong>und</strong> wenig perspektivisch, die Anforderungen<br />
<strong>und</strong> Möglichkeiten für Gewerkschaftspolitik maßgeblich auf Branchen-<br />
oder Betriebsebene bzw. aus neuen Rationalisierungsstrategien der<br />
Unternehmen abzuleiten. Deren Situation ist viel außengeleiteter <strong>und</strong> unsicherer,<br />
als z.B. die Darstellungen über Rationalisierungsstrategien erkennbar<br />
werden lassen.<br />
Teil II: Flexible Automatisierung — „Neue Produktionskonzepte"<br />
am Beispiel des Maschinenbaus<br />
Aus dem ersten Teil können wir die These mit herübernehmen, daß die Gestaltungsautonomie<br />
der Unternehmen durch neue Markt<strong>entwicklung</strong>en,<br />
schnelle technologische Interventionsschübe, politische Konstellationen<br />
<strong>und</strong> soziale Entwicklungen erstens stark eingegrenzt <strong>und</strong> zweitens in der<br />
Perspektive stark verunsichert ist.<br />
Da die Möglichkeiten, die sich verändernden Anforderungen zu beeinflussen<br />
bzw. zu neutralisieren i.d.R. gering sind, konzentrieren sich die<br />
Unternehmen auf die interne Anpassung an externe Anforderungen.<br />
Bei den „Neuen Produktionskonzepten" sehen wir die Tendenz, daß<br />
sich die Marktanforderungen im funktionierenden Kernbereich relativ<br />
bruchlos in geschlossene Managementstrategien umzusetzen scheinen, sich<br />
als solche im Betrieb implementieren lassen <strong>und</strong> auch Interessen der Produktionsarbeiter<br />
positiv aufnehmen. Wir wollen diese Thesen an einem<br />
spezifischen Ausschnitt des Bereichs überprüfen, für den solche „Neuen<br />
Produktionskonzepte" angenommen werden. Nach unseren Erfahrungen<br />
bezüglich der Einführung von Produktionsplanungs- <strong>und</strong> -steuerungssystemen<br />
im Maschinenbau — ein Sektor des Kernbereichs mit hohem, traditio-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
nellem Bestand an Produktionsintelligenz — dürfte der derzeitige Stand eher<br />
dadurch gekennzeichnet sein, daß konsistente <strong>und</strong> alternative Konzepte in<br />
der Betriebsrealität kaum existieren, also Konzepte, die z.B. eine Klassifizierung<br />
in einerseits eindeutig zentral-deterministische <strong>und</strong> andererseits<br />
dezentral-offene Systeme zulassen. Solche Konzepte sind eher als Orientierung<br />
oder Philosophie bei einzelnen Vertretern der Unternehmensleitungen<br />
präsent. Dazu trägt die Erkenntnis bei, daß erst die betriebsspezifische<br />
Anpassung <strong>und</strong> Auslegung über die Funktionalität <strong>und</strong> Effektivität<br />
der Systeme entscheidet. Unsere These ist, daß unter veränderten externen<br />
Anforderungen eine betriebspolitische Ausdifferenzierung von Technikpotentialen<br />
stattfindet. Das bedeutet, daß es sich bei der computergestützten<br />
Modernisierung von Planung <strong>und</strong> Steuerung, oder allgemeiner gesprochen,<br />
den neuen Produktionskonzepten, weniger um eine schlanke innerbetriebliche<br />
Realisierung von aufgeklärten Managementvorstellungen handelt,<br />
sondern auch um das Resultat innerbetrieblicher (realer oder antizipierter)<br />
Konflikte, Aushandlungen, Kompromiß findungen <strong>und</strong> Regelungen.<br />
Produktionskonzepte sind demnach Resultat funktionaler <strong>und</strong> betriebspolitischer<br />
Anforderungen im Rahmen der betrieblichen Gesamtarbeit.<br />
D.h., über „Konkreta der Produktionskonzepte" (Kern/Schumann) wird<br />
auf verschiedenen betrieblichen Ebenen unter der Beteiligung verschiedener<br />
betrieblicher Gruppen gerungen.<br />
Da der Bezugspunkt betrieblicher Reorganisation die betriebliche Gesamtarbeit<br />
ist, muß es außerdem neben dem Bezug auf neue Facharbeit<br />
weitere „Produktionskonzepte" für die anderen relevanten Gruppierungen<br />
im Betrieb (Ingenieure etc.) geben. Die Frage besteht dann gerade darin,<br />
ob sich im Betrieb unter diesen beiden Bedingungen (Produktionskonzepte<br />
als betriebspolitisches Resultat, Bezug auf Gesamtarbeit) solche „fortschrittlichen"<br />
Produktionskonzepte für eine betriebliche Gruppe (z.B.<br />
Facharbeiter in der Werkstatt) überhaupt durchsetzen bzw. welche Modifikation<br />
stattfindet.<br />
Die Gr<strong>und</strong>tendenz von Managementkonzepten wird sicher nach wie vor<br />
von „tayloristischen Vorstellungen" geprägt, also klarer Ablauforganisation<br />
<strong>und</strong> Aufgabenzuweisung, Vorgabe <strong>und</strong> Kontrolle von Eckpunkten der Fertigung,<br />
Transparenz über die Werkstatt <strong>und</strong> zunehmend stärker auch über<br />
die produktionsvorbereitenden Bereiche (Arbeitsvorbereitung, Konstruktion<br />
usw.).<br />
Darin ist eine Negativvorstellung menschlicher Tätigkeit impliziert, die<br />
sich als Arbeitseinsparung sowie Steuerung <strong>und</strong> Kontrolle von Tätigkeiten<br />
charakterisieren läßt. Die Gegenvorstellung, daß der „Mensch im Mittelpunkt"<br />
stehe, ist zunächst eine soziale Attitüde, die erst in einem späteren<br />
Stadium, bei der Feinplanung der Systeme, reale arbeitspolitische Gestaltungskraft<br />
erhalten könnte.<br />
Wir wollen uns daher im folgenden mit zwei Faktoren beschäftigen,<br />
die eine neue Dynamik in die Arbeitsgestaltung bei informationstechnologischen<br />
Rationalisierungen hineinbringen <strong>und</strong> für gewerkschaftliche Ansätze<br />
zur Gestaltungspolitik relevant sind:<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
1. dem Charakter betrieblicher Einführungs- <strong>und</strong> Anpassungsprozesse<br />
von Informationssystemen;<br />
2. der Abhängigkeit von menschlichem Wissen, Erfahrung <strong>und</strong> Kreativität<br />
bei flexibler Fertigung <strong>und</strong> deren Kontrolle.<br />
Wir konzentrieren uns folglich auf das moderne, technologiegeprägte<br />
Segment.<br />
1. Der Charakter betrieblicher Einführungs- <strong>und</strong> Anpassungsprozesse von<br />
Informationssystemen<br />
Die betrieblichen Einführungsprozesse erhalten daraus ihre Bedeutung, daß<br />
neue computergestützte Produktionsplanungs- <strong>und</strong> Steuerungssysteme sowie<br />
parallel neue Maschinensteuerungstechnologien auf die spezifischen Marktbedingungen,<br />
das Produktsortiment, die Ablauforganisation, die Fertigungsstrukturen<br />
<strong>und</strong> natürlich auf bereits vorhandene, bereichs- <strong>und</strong> funktionsspezifische<br />
Informations- <strong>und</strong> Kommunikationssysteme abzustimmen sind.<br />
Da diese Systeme das Potential zu einer erheblichen Reorganisation der fertigungsbezogenen<br />
Planungs-, Steuerungs- <strong>und</strong> Kontrollfunktionen enthalten,<br />
berühren sie den Status <strong>und</strong> die Tätigkeit verschiedener Abteilungen,<br />
ihre Kooperationsbeziehungen <strong>und</strong> die betriebliche Binnenkommunikation.<br />
Da diese Systeme bestehende Datenbestände <strong>und</strong> Informationsflüsse aufgreifen,<br />
sind sie auf den Wissens- <strong>und</strong> Informationstransfer <strong>und</strong> auf die<br />
laufende Mitarbeit dieser Abteilungen <strong>und</strong> Systeme angewiesen.<br />
Unter diesen Bedingungen haben wir u.a. folgende Probleme <strong>und</strong> Prozesse<br />
beobachtet:<br />
(1) Unternehmen mittlerer Betriebsgröße verfügen i.d.R. kaum über Erfahrungen,<br />
die neuen marktmäßigen <strong>und</strong> technologiebezogenen Anforderungen<br />
nach innen umzusetzen <strong>und</strong> die Unternehmensplanung auf eine neue Basis<br />
zu stellen. Es gibt i.d.R. kein auf oberer Ebene institutionalisiertes <strong>und</strong> professionelles<br />
Projektmanagement. Bei der Einführung neuer Technologien<br />
gibt es im Gegenteil einige strukturelle Hemmnisse im Organisationsaufbau<br />
der Unternehmen. Solche sind z.B. ein dominierendes Hauptabteilungsdenken<br />
(„Fürstentümer"), es sind unterschiedliche Interessenlagen nach betrieblichen<br />
Funktionen (z.B. die Interessendifferenz zwischen Konstruktion<br />
<strong>und</strong> Vertrieb) <strong>und</strong> die oft defizitäre Organisation von Innovationsprozessen.<br />
Daher werden z.B. neue PPS-Systeme bei der Einführung im Betrieb von<br />
ausgesprochenen Protagonisten der mittleren Managementebene (Fachabteilungen)<br />
getragen <strong>und</strong> d.h. ohne aktive Beteiligung von Facharbeitergruppen,<br />
wie das bei den „Neuen Produktionskonzepten" erscheint.<br />
Von der Stellung dieser Protagonisten, ihrer Durchsetzungsfähigkeit<br />
im Betrieb, der Möglichkeit zur Koalitionsbildung <strong>und</strong> letztlich von der betrieblichen<br />
Organisationsstruktur hängt es entscheidend ab, ob, wie schnell<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
<strong>und</strong> mit welchen Einschränkungen das Projekt im Betrieb angenommen<br />
wird.<br />
(2) Die Projekt-, Grob- <strong>und</strong> Feinplanung wird zunehmend in zeitlich befristeten<br />
Teams, häufiger unter Hinzuziehung von externen Syste<strong>mb</strong>eratern<br />
organisiert. Es werden aus den berührten Abteilungen Systemgruppen gebildet,<br />
die die zukünftigen Funktions-Kreisläufe des Systems widerspiegeln.<br />
In der Feinplanung bildet eine solche Systemgruppe bereits die Folie eines<br />
zukünftigen Arbeitszusammenhangs, der bisherige, rigidere Formen der<br />
horizontalen <strong>und</strong> vertikalen Arbeitsteilung partiell auflöst. Im Planungsprozeß<br />
selbst findet also Wissenstransfer von den beteiligten Mitarbeitern<br />
in das System wie auch Vermittlung von Systemwissen an die Mitarbeiter<br />
statt. Es findet darüber hinaus auch eine Aushandlung von funktionalen,<br />
positioneilen <strong>und</strong> sozialen Interessen statt. Die Aushandlung insbesondere<br />
der sozialen Interessen <strong>und</strong> ihre Bedeutung für die Systemeinführung <strong>und</strong><br />
Systemauslegung sind im Betrieb gr<strong>und</strong>sätzlich de thematisiert <strong>und</strong> sozialwissenschaftlich<br />
bisher wenig erforscht. Da der Entwurf <strong>und</strong> die strategische<br />
Planung solcher Systemkonzeptionen in kleinen Gruppen auf mittlerer<br />
<strong>und</strong> oberer Managementebene stattfindet <strong>und</strong> der Betriebsrat i.d.R. als<br />
anerkannter „Vertreter sozialer Interessen" davon ausgeschlossen ist, gibt es<br />
dabei auch keine Instanz, Kompetenz <strong>und</strong> Honorierung für das Einbringen<br />
sozialer Positionen.<br />
Wir vertreten die These, daß die gewachsenen Statuspositionen betrieblicher<br />
Gruppen gerade im traditionellen Maschinenbau das Veränderungspotential<br />
entscheidend beeinflussen. Entscheidungen werden maßgeblich nicht durch<br />
Rationalität <strong>und</strong> Überzeugung (rationales Entscheidungsmodell), sondern<br />
durch Blockieren, Verweigern, Verschleppen <strong>und</strong> Verlagern bestimmt (politisches<br />
Entscheidungsmodell, non-decision).<br />
In diesem 'Blockieren' drückt sich aber nicht nur ein diffuser „Skeptizismus"<br />
oder „Inflexibilität" aus, sondern auch das Interesse an der Erhaltung<br />
gewachsener <strong>und</strong> bewährter Schutzfunktionen, die von der angestrebten<br />
Reorganisation in Frage gestellt werden können. Die Abwägung des Nutzens<br />
der Managementkonzepte für den einzelnen gegenüber den bewährten,<br />
personenbezogenen Schutzmechanismen ist für die meisten betrieblichen<br />
Gruppen weder soweit geklärt noch so eindeutig, wie das in der Perspektive<br />
der fortschrittlichen Produktionskonzepte aufscheint. Wenn dieser soziale<br />
Aushandlungsprozeß negiert wird, bzw. in ihm kein Kompromiß gef<strong>und</strong>en<br />
wird, führt das zur Ineffektivität des Systems, zu Unzufriedenheit <strong>und</strong> z.B.<br />
zum Auseinanderfallen von offiziellen Plandaten <strong>und</strong> realem Arbeitsprozeß.<br />
D.h., daß das am Anfang stehende Managementkonzept sich in beiden Fällen<br />
nicht ungebrochen realisieren läßt.<br />
Wichtig für unseren Zusammenhang ist auf jeden Fall, daß mit diesen Aushandlungsprozessen<br />
auf mittlerer Politikebene ein Partizipationsfeld sich<br />
konturiert, das bisher noch von keiner der beteiligten Gruppen im Betrieb<br />
systematisch genutzt wird.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
(3) Diesem Beharrungsvermögen des Betriebs als Organisation stehen allerdings<br />
Mechanismen gegenüber, die die Realisierung der Projekte fördern<br />
<strong>und</strong> stabilisieren. Mit der Teilnahme an einer Planungsgruppe, an Schulungskursen,<br />
am Probelauf, <strong>und</strong> letztlich auch durch die faktische Arbeit mit dem<br />
System, wird ein neues Kriterium der Personalselektion etabliert: die Technikakzeptanz.<br />
Die Arbeit mit der neuen Technik wird zur definitiven Scheidelinie<br />
zwischen unterschiedlichen Karrieren. Die „Einsteiger in die neue<br />
Technik" festigen ihre Position bezüglich Arbeitsplatz, Einkommen <strong>und</strong><br />
Qualifikation auf absehbare Zeit. Bezüglich Qualifikation muß damit erstmal<br />
nicht mehr gemeint sein als die Bereitschaft <strong>und</strong> die Entwicklung der<br />
Fähigkeit, die neuen Technologien zu benutzen. Der „Verweigerer" —<br />
durchaus auf den verschiedenen Hierarchieebenen von der Werkstatt bis<br />
zum Abteilungsleiter — werden in die Randbelegschaft abgedrängt. Wir<br />
finden also auch eine Segmentationslinie innerhalb der Betriebe, die auf<br />
Technikakzeptanz abstellt <strong>und</strong> teilweise quer zu den bekannten Segmentationslinien<br />
verläuft. Auffällig ist allerdings die Parallele zwischen Technikakzeptanz<br />
<strong>und</strong> Altersstufe, d.h. der generationsmäßigen Segmentation.<br />
Diese Scheidelinie stellt wahrscheinlich — wenn sich nicht doch noch wirklich<br />
alternative Produktionskonzepte entwickeln — ein Ubergangsphänomen<br />
dar, bis die informationstechnologische Durchdringung der Betriebe abgeschlossen<br />
ist. Sie begründet aber auf absehbare Zeit die Dynamik innerbetrieblicher<br />
Politikprozesse zumindest im Maschinenbau <strong>und</strong> ermöglicht erst<br />
die Herausbildung eines „empirisch-unideologischen Produktionskonzeptes"<br />
wie es z.B. Kern/Schumann für den Maschinenbau (<strong>und</strong> für ein eng umrissenes<br />
Segment von Facharbeit in der Fertigung!) beschrieben haben. Weiterhin<br />
bedeutsam ist, daß sich nicht die ganze Gruppe der traditionellen<br />
Facharbeiter, die das Rückgrat von Gewerkschaftspolitik im Betrieb bilden,<br />
auf der technologieorientierten Seite finden. Die Segmentationslinie geht<br />
quer durch den Facharbeiterstamm <strong>und</strong> führt neue Status- <strong>und</strong> Interessengruppen<br />
zusammen.<br />
Ein zweiter Mechanismus der Überwindung des betrieblichen Beharrungsvermögens<br />
beruht darauf, daß die Beteiligung am Einführungsprozeß dazu<br />
führt, daß von dieser Gruppe — selbst wenn die eigene Position sich nicht<br />
durchgesetzt hat — die konkrete Einführung unterstützt <strong>und</strong> gegenüber den<br />
anderen Beschäftigten legitimiert wird. Wenn qualifizierte <strong>und</strong> betroffene<br />
Mitarbeiter an Entwurf <strong>und</strong> Ausgestaltung beteiligt waren <strong>und</strong> das System<br />
bzw. bestimmte Systemkomponenten vertreten, hat natürlich eine nachträgliche<br />
Kritik anderer Betroffener kaum Durchsetzungschancen. Gleiches<br />
gilt — <strong>und</strong> hier wird es gewerkschaftspolitisch bedeutsam — für die Intervention<br />
der Betriebsräte. Ihr bisheriges Verhandlungsmonopol, allgemeinverbindliche<br />
Regelungen zum betrieblichen Einsatz neuer Technologien<br />
mit der Unternehmensleitung zu vereinbaren, wird dadurch faktisch<br />
ausgehöhlt. Neben dem traditionellen <strong>und</strong> institutionalisierten Verhandlungsfeld<br />
der Sozialpartner entsteht ein zweites, syste<strong>mb</strong>ezogenes Politikfeld.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Zusammenfassend läßt sich also der gegenwärtige Einführungsprozeß<br />
von Informationstechnologie im Industriebetrieb nach unseren Erfahrungen<br />
<strong>und</strong> im Unterschied zu den Analysen der Neuen Produktionskonzepte<br />
als eine betriebspolitische Ausdifferenzierung von Technikpotentialen charakterisieren,<br />
d.h., daß betriebsspezifische Lösungen auftreten, deren<br />
Effizienz in verschiedener Hinsicht noch gar nicht ausgetragen ist. Das<br />
bedeutet gleichzeitig, daß die Rationalisierungsstrategien der Unternehmensleitungen<br />
nicht einfach mit (Fach-)Arbeiterinteressen zusammenfallen,<br />
sondern zumindest teilweise in einem Aushandlungs- <strong>und</strong> Kompromißfindungsprozeß<br />
ermittelt werden, der sich bezüglich sozialer Interessen/Position<br />
i.d.R. „stumm" vollzieht. Vermutlich liegt darin eine Ursache<br />
für das beobachtbare <strong>und</strong> zunehmende Ungleichgewicht zwischen dem<br />
Niveau technisch-betriebswirtschaftlicher Optimierung <strong>und</strong> dem passiven<br />
Mitschleppen sozialer Dimensionen.<br />
2. Abhängigkeit von menschlichen Fähigkeiten <strong>und</strong> die Kontrolle von<br />
Tätigkeit, Kommunikation <strong>und</strong> Verhalten<br />
Die Situation in den fertigungsnahen Bereichen ist durch eine relative<br />
Verringerung des Personalbestands gekennzeichnet, die durch den Einsatz<br />
teilautomatisierter Fertigungstechnologien (NC-Maschinen, Bearbeitungszentren,<br />
erste flexible Fertigungssysteme mit Palettenwechsel <strong>und</strong> automatischem<br />
Werkzeugwechsel) <strong>und</strong> auch durch Fremdvergabe von Aufträgen,<br />
die kostenmäßig nicht im eigenen Unternehmen zu fertigen sind, ermöglicht<br />
wird. Ein Resultat ist, daß die relative Bedeutung der Lohnkosten in der<br />
Fertigung abnimmt.<br />
Zweitens ist die Situation gekennzeichnet durch die 'Herauslösung' der<br />
Produktionsarbeiter aus den unmittelbaren Fertigungsfunktionen <strong>und</strong> die<br />
Zunahme systemsteuernder, -bedienender <strong>und</strong> -überwachender Aufgaben.<br />
Damit ist zumindest für die Gruppe der „Einsteiger" eine Zusatzqualifizierung<br />
in der Bedienung neuer Technologien <strong>und</strong> im Verständnis von<br />
Systemzusammenhängen verb<strong>und</strong>en (Arbeitssystem, Steuerungssystem).<br />
Ihr Beitrag zur Leistungsfähigkeit des Systems besteht weniger in einer unmittelbaren,<br />
maximalen Fertigungstätigkeit, sondern in der Gewährleistung<br />
des programmierten Fertigungsablaufs (Zuarbeit, Überwachung, Intervention<br />
bei Störungen). Ein Resultat ist, daß die klassische Leistungslohnform<br />
Akkord stark an Bedeutung verliert <strong>und</strong> Übergänge zu Prämien- <strong>und</strong> Zeitlohnformen<br />
zu beobachten sind.<br />
Wenn die Produktionsarbeiter zunehmend quasi „neben den stofflichen<br />
Fertigungsfluß treten", werden traditionelle Einbindungen abgeschwächt,<br />
die Produktionsarbeiter konturieren sich stärker als Personen, deren Einbindung<br />
im Betrieb neu organisiert werden muß. Hierbei — <strong>und</strong> dies hat viel<br />
mit Kontrolle zu tun — können wir folgende Mechanismen beobachten:<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
— Die wichtigste diesbezüghche Veränderung scheint uns die Transformation<br />
der maschinellen Taktbindung in eine Art „informatorische Taktbindung"<br />
zu sein. Mit den Fertigungssteuerungs- <strong>und</strong> Kontrollsystemen wird<br />
sukzessive ein differenziertes Netzwerk von objektivierten Zeit- <strong>und</strong> Sachstrukturen<br />
im Sinne einer „vorwegnehmenden Optimierung" aufgebaut,<br />
das die Interventionsanforderungen der Produktionsarbeiter definiert <strong>und</strong><br />
automatisch auf ihre Einhaltung kontrolliert. Diese Taktbindung ist so<br />
stark formalisiert <strong>und</strong> transparent, daß auch von dieser Seite her traditionelle<br />
Leistungslohnanreize überflüssig werden.<br />
Diese neue Form der Einbindung von Beschäftigten in das betriebliche<br />
Informationssystem bedeutet mehr Transparenz über den Arbeitsablauf<br />
<strong>und</strong> damit (zwangsläufig) über die Tätigkeiten <strong>und</strong> das Verhalten von Personen.<br />
Diese Form der „abgeleiteten Kontrolle" dürfte bisher in der unternehmerischen<br />
Planung i.d.R. nur ein Nebeneffekt der flexiblen Automatisierung<br />
sein <strong>und</strong> wird nach unseren Erfahrungen bisher auch kaum offensiv<br />
genutzt. Die Gründe dafür liegen in ihrer Dysfunktionalität <strong>und</strong> in der<br />
Antizipation von betrieblichen Konflikten. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen,<br />
daß das vorhandene Kontrollpotential wesentlich umfassender<br />
<strong>und</strong> tiefgreifender als das traditioneller Kontrollsysteme einzuschätzen ist.<br />
— Ein weiterer Mechanismus ist der sukzessive Aufbau direkt personenbezogener<br />
Kontrollen durch neue Lohnabrechnungsverfahren, Zugangskontrollen,<br />
Zeiterfassungssysteme etc., die gerade die Relativierung von<br />
traditionellen Kontrollformen (individuelle Arbeitsleistung, Meisteraufsicht)<br />
reflektieren.<br />
— Ein dritter Mechanismus ist mit dem Motivations- <strong>und</strong> Integrationsaspekt<br />
der neuen Partizipationsform bereits angesprochen (Systemgruppen,<br />
Qualitätszirkel etc.). Sie reflektieren im wesentlichen den Tatbestand, daß<br />
die Einbindung in ein Netzwerk von Zeit- <strong>und</strong> Sachstrukturen gemessen an<br />
traditionellen Berufsbildern keine ausreichenden Möglichkeiten arbeitsinhaltlicher<br />
Identifikation bietet <strong>und</strong> die Innovationspotentiale der Systemanwender<br />
ungenutzt läßt.<br />
Zusammenfassend läßt sich also durchaus eine neue Ausrichtung im Einsatz<br />
von Arbeitskraft im technologieorientierten Segment feststellen. Die Notwendigkeit<br />
der aktiven Beteiligung der Systemanwender an der Auslegung,<br />
betrieblichen Anpassung <strong>und</strong> Feinsteuerung von Informationssystemen, die<br />
Notwendigkeit der permanenten menschlichen Intervention sowie das Zusammenwachsen<br />
verschiedener Arbeitsplätze zu integrierten Systemen<br />
eröffnen neue <strong>und</strong> qualifizierte Gestaltungsräume <strong>und</strong> Tätigkeitsfelder.<br />
Unsere These lautet, daß diese „neue Nutzung von Produktionsintelligenz"<br />
nicht im Widerspruch zu neuen informationstechnologischen Kontrollen<br />
von Leistung <strong>und</strong> Verhalten der Beschäftigten steht. Zentrale Kontrolle<br />
mittels Information einerseits <strong>und</strong> Handlungsfreiheit dezentraler<br />
Einheiten andererseits stehen nebeneinander bzw. genauer: sie ergänzen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
sich. Pointiert: im Gegensatz zu den „Neuen Produktionskonzepten" sehen<br />
wir keine Bedeutungsverminderung von Herrschaftssicherung als Rationalisierungsziel,<br />
sondern einen Formwandel von Kontrolle.<br />
Teil III: Einige Schlußfolgerungen in Richtung einer<br />
Gestaltungspolitik<br />
gewerkschaftlichen<br />
Wir haben in den vorangegangenen Teilen einige veränderte Rahmenbedingungen<br />
gewerkschaftlicher Politik skizziert <strong>und</strong> sind auf einige mehr betriebsbezogene<br />
Aspekte neuer Rationalisierungs- <strong>und</strong> Produktionskonzepte<br />
eingegangen. Ein zentrales <strong>und</strong> strukturelles Problem liegt nun in einer<br />
nicht nur additiven <strong>und</strong> formalen Verknüpfung beider Bereiche. Gewerkschaftliche<br />
Politik muß sich nach wie vor auf konkrete Arbeitserfahrungen<br />
<strong>und</strong> -interessen der Beschäftigten beziehen, gleichzeitig werden die Gr<strong>und</strong>lagen<br />
ihrer Politik von globalen Entwicklungen wie Massen- <strong>und</strong> Dauerarbeitslosigkeit,<br />
Sozialabbau, Segmentierung, vielfältigen ökologischen<br />
Schranken <strong>und</strong> Gefährdungen bestimmt. Beide Politikebenen werden bisher<br />
getrennt behandelt, also als Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialpolitik einerseits <strong>und</strong><br />
Tarif- <strong>und</strong> Betriebspolitik andererseits. Wir vertreten die Auffassung, daß<br />
die Trennung <strong>und</strong> die zunehmende Widersprüchlichkeit von Politik auf diesen<br />
verschiedenen Ebenen bei den Gewerkschaftsmitgliedern zu einem<br />
Gefühl der Unangemessenheit <strong>und</strong> UnVerhältnismäßigkeit geführt hat, das<br />
die Unterstützung traditioneller Forderungen wie auch neuer Versuche<br />
der Verknüpfung schwächt; also einerseits eine partikulare, betriebsbezogene<br />
Regelungspolitik, andererseits globale Problemlagen, die die Beschäftigten<br />
aber auch als Personen auch im Betrieb berühren. Die Kontroverse<br />
um die Beschäftigungswirkungen der Arbeitszeitverkürzung bzw. um den<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>n Gehalt der <strong>35</strong>-St<strong>und</strong>en-Wochen-Forderung sowie die<br />
Kontroverse um Arbeitsplatz Sicherung versus Umweltschutz sind prägnante<br />
Beispiele. Sie belegen, daß die Gewerkschaften ohne differenzierte <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Gestaltungspolitik sowohl substantiell an Einfluß wie auch an<br />
Glaubwürdigkeit auch in ihren traditionellen Organisationsbereichen verlieren<br />
dürften.<br />
Der zweite wichtige Aspekt war die innerbetriebliche Segmentierung. Es<br />
deutet sich an, daß die gewachsenen Formen der gewerkschaftlichen<br />
Besitzstandssicherungspolitik zunehmend nur für die schrumpfenden,<br />
konventionellen Betriebsbereiche angemessen sind. Und das heißt Bereiche,<br />
die zunehmend weniger facharbeiterspezifisch sind, <strong>und</strong> die kaum eine Bedeutung<br />
für die zukünftige Gestaltung von Produktionspolitik <strong>und</strong> Arbeitsbedingungen<br />
in den Unternehmen haben.<br />
Neue Perspektiven von Facharbeit dagegen entwickeln sich wesentlich im<br />
„modernen oder zentralen Segment", das durch den Einsatz neuer Produktions-,<br />
Transport- <strong>und</strong> Informationstechnologien geprägt ist, das quer durch<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
die arbeitsvorbereitenden, -begleitenden <strong>und</strong> produzierenden Bereiche verläuft,<br />
<strong>und</strong> für das wir eine relativ offene betriebliche Gestaltungssituation<br />
behauptet haben. Hier finden wir neue Gruppierungen <strong>und</strong> Tendenzen in<br />
der Arbeitssituation vor, die mit dem gewachsenen gewerkschaftlichen Interessenverständnis<br />
<strong>und</strong> Regelungsbestand kaum zu vereinbaren bzw. zu<br />
erfassen sind. Das sind z.B.<br />
— Tendenzen zum Drei-Schicht-Betrieb, gleichzeitig Flexibilisierung der<br />
individuellen Arbeitszeit;<br />
— Tendenzen zum Zeitlohn bei gleichzeitiger betriebspolitisch austarierter<br />
Leistungsdetermination <strong>und</strong> -kontrolle durch informatorische Steuerungs-<br />
<strong>und</strong> Durchsetzungssysteme;<br />
— Tendenzen zur Bildung von Arbeitssystemen <strong>und</strong> Systemgruppen mit<br />
teamförmiger Arbeit <strong>und</strong> gleichzeitiger Bindung von Kommunikation<br />
<strong>und</strong> Kooperation zwischen den Beschäftigten an Informationssysteme;<br />
— Tendenzen zur Beteiligung qualifizierter Beschäftigungsgruppen im<br />
Rahmen betrieblich-instrumenteller Organisationsmodelle, gleichzeitig<br />
die Einschränkung der gewerkschaftlichen Einwirkungsmöglichkeiten;<br />
— Tendenzen zur Entkopplung der Beschäftigten aus unmittelbaren Arbeitsvollzügen,<br />
gleichzeitig die Tendenz zur Verplanung, Steuerung <strong>und</strong><br />
Kontrolle mittels personenbezogener Informationssysteme.<br />
Die gewerkschaftliche Perspektive kann nun sicherlich nicht nur darin liegen,<br />
den entstandenen Regelungsbedarf durch neue, partialisierte Mindestnormen<br />
<strong>und</strong> Schutzbestimmungen auszufüllen, wie dies z.B. im Bereich des<br />
Datenschutzes schon weit fortgeschritten ist. Sie kann auch nicht darin liegen,<br />
Interessenpolitik quasi außerhalb der beschriebenen, globalen <strong>und</strong> betrieblichen<br />
Entwicklungen zu definieren, weil diese gefährlich bzw. a<strong>mb</strong>ivalent<br />
sind. Diese Gefahr ist bei der Rationalisierungsschutz- <strong>und</strong> Besitzstandssicherungspolitik<br />
deutlich geworden <strong>und</strong> hat dazu geführt, daß erstens die<br />
Gewerkschaftspolitik in diesem Bereich immer weniger realitätstüchtig<br />
wurde <strong>und</strong> zweitens immer mehr Real<strong>entwicklung</strong>en von den Gewerkschaften<br />
nicht als eigenes Problem zur Kenntnis genommen werden konnten<br />
bzw. einfach abgelehnt wurden: Teilzeit arbeit, flexible Arbeitszeit,<br />
Qualitätszirkel. Dies gilt auch für den Bereich innerbetrieblicher Beteiligungsformen,<br />
den wir abschließend noch einmal aufnehmen wollen.<br />
Die neuen Formen der unternehmerischen Einbindung (Einführungs-<br />
Teams, Systemgruppen; umfassendere Verantwortlichkeit der Konstruktion<br />
für die Vorstrukturierung von Fertigung <strong>und</strong> Montage etc.) sind sowohl<br />
Formen der Reorganisation des Arbeitsprozesses, die auf bestimmte Interessen<br />
der Beschäftigten eingehen, wie auch neue Formen der Beherrschung<br />
<strong>und</strong> der Ausschaltung gewerkschaftlicher Gegenmacht. Wenig überzeugend<br />
ist eine Sichtweise, die Aspekte der Privilegisierung <strong>und</strong> der Herrschaftssicherung<br />
in solchen Arbeitsformen zum alleinigen Maßstab macht, solche<br />
Arbeitsformen ablehnt <strong>und</strong> ihnen Forderungen nach Besitzstandssicherung<br />
<strong>und</strong> Mindestnormen von außen entgegensetzt. Damit ginge der Einfluß<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
auf diese Beschäftigtengruppen <strong>und</strong> auf die von ihnen getragenen Arbeitsprozesse<br />
verloren.<br />
Uns erscheint der aussichtsreichere Weg darin zu liegen, sich weder auf den<br />
alten Regelungsbestand noch auf aufgeklärte Managementkonzepte zu verlassen,<br />
sondern in diese modernen Produktionsbereiche gewerkschaftlich<br />
offensiv einzudringen, indem die neuen Arbeitsformen <strong>und</strong> -inhalte als Ausgangspunkte<br />
für eine betrieblich f<strong>und</strong>ierte, aber gesellschaftlich orientierte<br />
Gestaltungspolitik angenommen werden. Anknüpfungspunkte für eine solche<br />
Gestaltungspolitik sind im Vorangegangenen angedeutet worden <strong>und</strong><br />
wir wollen sie noch einmal zusammenfassen:<br />
Die betrieblichen Entwicklungs-, Einführungs- <strong>und</strong> Ausgestaltungsprozesse<br />
von computergestützter Produktion sind oder werden zunehmend<br />
Bestandteil von Arbeitsprozessen der qualifizierten, technologieorientierten<br />
Belegschaftsteile.<br />
— Diese Arbeitsprozesse beinhalten gleichzeitig die Gestaltung der zukünftigen<br />
Stellung der Systemanwender wie auch indirekt der traditionellen<br />
Restbelegschaft. Es muß folglich für diese Gruppen ein Verständnis entwickelt<br />
werden, daß ihre Gestaltungstätigkeit im Arbeitsprozeß gleichzeitig<br />
<strong>und</strong> prozeßimmanent gewerkschaftliche Interessenpolitik im Betrieb ist.<br />
— Diese beschriebenen Arbeitsprozesse sind gleichzeitig Formen betrieblicher<br />
Beteiligung, die größtenteils neben <strong>und</strong> in Konkurrenz zu institutionalisierten<br />
betrieblichen <strong>und</strong> gewerkschaftlichen Mitbestimmungsregelungen<br />
verlaufen. Insofern müßte das gewerkschaftliche Verständnis bezüglich<br />
des betrieblichen Politikfeldes <strong>und</strong> der Träger von Politik auf diese betrieblich-instrumentellen<br />
Beteiligungsprozesse ausgeweitet werden.<br />
— Schließlich werden in der betrieblichen Forschungs- <strong>und</strong> Entwicklungsarbeit<br />
im modernen Sektor, in der Produkt- <strong>und</strong> Marktpolitik die <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Folgen betrieblicher Entscheidungen vorgeprägt. Die Segmentierung<br />
der Volkswirtschaft <strong>und</strong> damit die Produktion von strukturell<br />
gewerkschaftsfeindlichen Bedingungen, die sozialen <strong>und</strong> ökologischen<br />
Folgen neuer Technologien werden hier vorentschieden.<br />
Wenn es gelingt, diese <strong>gesellschaftliche</strong>n Perspektiven in die Betriebe <strong>und</strong><br />
in die Arbeit der Produzenten zurückzuvermitteln', dann können sich<br />
den Beschäftigten ganz neue Kompetenzen <strong>und</strong> Gestaltungsfelder eröffnen,<br />
<strong>und</strong> dann wird die Situation überw<strong>und</strong>en, daß die Kritik an den Auswirkungen<br />
des Industriesystems — auch die gewerkschaftliche Kritik — nicht nur<br />
von außen <strong>und</strong> teilweise gegen die Interessen der dort Beschäftigten, <strong>und</strong><br />
damit halbherzig vorgetragen wird.<br />
Eine solche, hier erst angedeutete Gestaltungspolitik wäre dann auch<br />
eine angemessene Gr<strong>und</strong>lage, um die Beschäftigtengruppen des modernen<br />
Sektors (also Techniker, Ingenieure, Naturwissenschaftler) gewerkschaftlich<br />
stärker zu organisieren.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
LITERATUR<br />
Dörr/Hildebrandt/Seltz, „Kontrolle durch Informationstechnologien in Gesellschaft <strong>und</strong><br />
Betrieb", in: Jürgens/Naschold, Arbeitspolitik, Opladen 1984.<br />
Forschungsprojekt, Politik <strong>und</strong> Kontrolle bei computergestützter Produktionsplanung<br />
<strong>und</strong> -Steuerung, IIVG/dp84-219.<br />
M. Helfert, „Beteiligungsstrategien der Betriebe <strong>und</strong> Mitbestimmung am Arbeitsplatz",<br />
in: WSI-Mitteilungen 12/1983, S. 748 ff.<br />
E. Hildebrandt, „Aktuelle Tendenzen der Arbeitnehmerbeteiligung in der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland", in: Fricke/Schuchardt (Hg.), Beteiligung als Element gewerkschaftlicher<br />
Arbeitspolitik, Bonn 1984, S. 197 ff.<br />
Kem/Schumann, „Neue Produktionskonzepte haben Chancen", in: Soziale Welt,<br />
Heft 1/1984, S. 146 ff.<br />
Manske/Wobbe-Ohlenburg, „Alles unter Kontrolle? Betriebliche Widerstandspotentiale<br />
gegen Computereinsatz zur Leistungserfassung", in: Neue Medien <strong>und</strong> Technologien<br />
— wie damit umgehen? Berlin 1984, S. 66 ff.<br />
Walther Müller-Jentsch, „Klassen-Auseinander-Setzungen, Lesarten über die Arbeitskonflikte<br />
der siebziger Jahre <strong>und</strong> Mutmaßungen über die Zukunft der Gewerkschaften",<br />
in: Prokla, Heft 54, 1984, S. 10 ff.<br />
H. Schauer, „Gewerkschaftspolitik <strong>und</strong> Beteiligung", in: Fricke/Schuchardt (Hg.),<br />
Beteiligung als Element gewerkschaftlicher Arbeitspolitik, Bonn 1984, S. 227 ff.<br />
R. Seltz, Neue betriebliche Machtressourcen <strong>und</strong> Wandel des Kontrollsystems durch<br />
elektronische Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnologien, IIVG/dp84-202.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Themenbereich V:<br />
Theorien der <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Entwicklung der Moderne<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
EINLEITUNG<br />
Bernhard Giesen<br />
Das Thema dieses Soziologentages rahmt nicht nur Versuche zur empirischen<br />
Auslotung sozialer Wandlungstrends, sondern es begünstigt auch das<br />
— dem Empiriker eher verdächtigte — Augurengeschäft der Gesellschaftstheorie,<br />
die sich mit der Frage nach der strukturellen Kontinuität oder Diskontinuität<br />
der Moderne beschäftigt. Die große Gesellschaftstheorie der<br />
Klassiker war immer auch eine Theorie der Moderne, die die zwiespältige<br />
Zukunft dieser Gesellschaft im Auge hatte. Mit den gesellschaftstheoretischen<br />
Entwürfen <strong>und</strong> Diagnosen der Klassiker ist jedem Versuch zu sozialer<br />
Zeitdiagnose ein paradigmatischer Ausgangspunkt <strong>und</strong> Blickwinkel vorgegeben,<br />
dem empirische Analysen <strong>und</strong> Rezeptionen zeitgenössischer Prozesse<br />
sozialen Wandels nur schwerlich entrinnen können. Solche Analysen<br />
erhalten ihr besonderes Gewicht durch ein alltägliches Krisenbewußtsein,<br />
das das Ende des „Projektes der Moderne", zumindest aber einen Bruch<br />
seiner Kontinuität <strong>und</strong> ein Schwinden der daran geknüpften Hoffnungen<br />
anzukündigen scheinen. Damit rückt in den Mittelpunkt dieser Veranstaltung<br />
die Frage, ob die modernitätskritische Stoßrichtung neuer sozialer<br />
Bewegungen, die alltägliche Zukunftsangst <strong>und</strong> strukturelle Brüche auf dem<br />
Wege zur postmodernen Gesellschaft eine Revision oder Relativierung der<br />
klassischen Thesen zur Moderne erfordern oder ob sich alles dies im Rahmen<br />
eines weiterentwickelten <strong>und</strong> fortgeschriebenen Modernitätskonzepts<br />
einordnen <strong>und</strong> klären läßt. Daß die genannten <strong>gesellschaftliche</strong>n Entwicklungen<br />
die analytische Kapazität der Gesellschaftstheorie Webers oder<br />
Marxens herausfordern, darüber besteht kaum Zweifel. Ob die bei den<br />
Klassikern vorgesehenen Muster zur Diagnose von Geburtswehen <strong>und</strong> Krisen<br />
der modernen Gesellschaft hierzu ausreichen, oder ob die postmoderne<br />
Gesellschaft auch eine radikale Revision jener klassischen Annahmen über<br />
Rationalisierung, Differenzierung <strong>und</strong> Individualisierung erfordern, dies läßt<br />
sich durchaus in Frage stellen.<br />
Die erste Gruppe von Beiträgen zu dieser Veranstaltung geht von einer<br />
gewissen Kontinuität f<strong>und</strong>amentaler Prinzipien der Moderne aus <strong>und</strong> sieht<br />
keinen Anlaß <strong>und</strong> wohl auch keine Möglichkeit, außerhalb des Bezugsrahmens<br />
der Moderne einen soziologischen Standpunkt zur Analyse aktueller<br />
sozialer Entwicklungstendenzen zu finden. Der düsteren Krisenperspektive<br />
des Alltagsbewußtseins steht hier das Beharren auf der Kontinuität der Moderne<br />
gegenüber, die bei aller Widersprüchlichkeit <strong>und</strong> Verschiedenartigkeit<br />
doch keinen f<strong>und</strong>amentalen Bruch ihrer Dynamik zeigt. Dies wird vor allem<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
in den Beiträgen von Münch <strong>und</strong> Oevermann deutlich. Richard Münch versucht,<br />
vor dem Hintergr<strong>und</strong> der Weberschen Analyse des modernen Weltbeherrschungsmotivs<br />
unterschiedliche Entwicklungspfade der Moderne zu<br />
differenzieren <strong>und</strong> jene Bedingungen zu beschreiben, die zur Institutionalisierung<br />
des okzidentalen Aktivismus in unterschiedlichen nationalen Kulturen<br />
führen <strong>und</strong> damit auch den kulturellen Rahmen neuer sozialer Bewegungen<br />
abgeben. Ulrich Oevermann nimmt die Beziehung von Individualisierung<br />
<strong>und</strong> wissenschaftlicher Rationalisierung in modernen Gesellschaften<br />
zum Ausgangspunkt seiner Analyse, die an Adornos Dialektik der Aufklärung<br />
ausgerichtet ist <strong>und</strong> sich durchaus kritisch mit der „Selbsttechnokratisierung"<br />
von Identitätsbildung gerade bei jenen avancierten Gruppen unserer<br />
Gesellschaft beschäftigt, die die Formung <strong>und</strong> Bewahrung von Identität<br />
in den Mittelpunkt ihrer Lebenspraxis stellen. Thomas Luckmann wird<br />
dann im Rahmen evolutionstheoretischer Überlegungen die Kontinuität von<br />
religiösem Wissen auch in modernen Gesellschaften erläutern, einer Religiosität<br />
freilich, die aus den <strong>gesellschaftliche</strong>n Makrosystemen ausgewandert<br />
ist <strong>und</strong> sich auf den Alltag der Akteure zurückgezogen hat.<br />
Im zweiten Teil werden Analysen zu Wort kommen, die in aktuellen<br />
Entwicklungsprozessen der Moderne Anlaß genug sehen, die fortdauernde<br />
Verbindlichkeit klassischer Annahmen in Frage zu stellen; dabei werden<br />
Kontinuitätsbrüche <strong>und</strong> Krisen, die das Alltagsbewußtsein wahrnimmt,<br />
auch als empirisch-historische Argumente gegen die Fortschreibung dieser<br />
Annahmen genutzt. Johannes Berger nimmt die Kontrastierung von Schumpeters<br />
<strong>und</strong> Marxens Prognose über den Zusammenbruch des Kapitalismus<br />
zum Anlaß, nach nicht-ökonomischen Krisenmechanismen eines ökonomisch<br />
durchaus überlebenskräftigen Gesellschaftssystems zu fragen. Christian<br />
von Ferber stellt dann die Gleichsetzung von sozialer Differenzierung<br />
<strong>und</strong> Rationalitätsgewinn in Frage <strong>und</strong> kontrastiert dies mit Materialien zu<br />
Deprofessionalisierung <strong>und</strong> Laisierung. Der Beitrag von Georg Elwert<br />
schließlich sucht die Stabilitätsrisiken aufzuzeigen, die eine unbegrenzte<br />
ökonomisierung aller <strong>gesellschaftliche</strong>n Prozesse mit sich bringt. Sein<br />
Hinweis auf die Erosion der moralischen Gr<strong>und</strong>lage auch ökonomischen<br />
Handelns gewinnt wieder Anschluß an klassische Theoriegr<strong>und</strong>lagen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
WEGE DER MODERNE. ZWISCHEN TRADITION UND MODERNITÄT,<br />
PARTIKULARISMUS UND UNIVERSALISMUS, ROUTINE UND<br />
REVOLUTION, KONFORMITÄT UND ENTFREMDUNG<br />
Richard Münch<br />
Einleitung<br />
Max Weber hat nach der von ihm diagnostizierten Entzauberung der Welt<br />
durch die moderne Wissenschaft <strong>und</strong> der Zerstörung aller religiös-sinnhaften<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der modernen Welt nur eine düstere Zukunft der modernen Gesellschaften<br />
gesehen. Die Rationalisierung <strong>und</strong> Verselbständigung der <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Sphären des Kapitalismus, der Bürokratie <strong>und</strong> des Rechts<br />
schlägt in eine irrationale Herrschaft der sachlichen Eigengesetzlichkeiten<br />
über den Menschen um. Diese gewinnen eine nie zuvor erahnte Macht über<br />
den Menschen. Und eine allgemein verbindliche sinnhafte Steuerung auf der<br />
Basis allgemeiner Ideen <strong>und</strong> Werte ist auf dem entzauberten Boden der Moderne<br />
ausgeschlossen. Was bleibt, ist der unversöhnliche Kampf konträrer<br />
Wertorientierungen <strong>und</strong> Wertordnungen um die Vorherrschaft in der Gestaltung<br />
der Gesellschaft. Die mit dem Calvinismus erreichte innere Verbindung<br />
von Ethik <strong>und</strong> Welt ist unwiederbringlich verloren. Die innerweltliche<br />
Askese hat sich zu einem innerweltlichen Aktivismus der rein instrumentellen<br />
Weltbeherrschung gewandelt. 1<br />
Ich will hier aufzeigen, daß diese Einschätzung Webers über die allein<br />
mögliche Entwicklung der modernen Gesellschaften eine Deutung des Verhältnisses<br />
zwischen Ethik <strong>und</strong> Welt <strong>und</strong> der daraus folgenden Form des<br />
innerweltlichen Aktivismus zum Ausdruck bringt, die von den Möglichkeiten<br />
begrenzt wird, die in der deutschen Kultur durch den Lutherischen Protestantismus<br />
<strong>und</strong> durch seine Säkularisierung im deutschen Idealismus gesetzt<br />
worden sind. In anderen westlichen Gesellschaften haben sich ganz<br />
andere Formen des Verhältnisses zwischen Ethik <strong>und</strong> Welt <strong>und</strong> des innerweltlichen<br />
Aktivismus entwickelt, die als kultureller Code sowohl der Entwicklung<br />
bis zu Webers Lebenszeit als auch darüber hinaus bis heute zugr<strong>und</strong>e<br />
liegen. Dieser gesellschaftlich-kulturelle Code hat sich in den einzelnen<br />
Gesellschaften seit der Reformationszeit in einem Prozeß der Deutung,<br />
Anwendung <strong>und</strong> Säkularisierung der religiösen Ethik herausgebildet. Er<br />
hat dann einerseits als Tiefenstruktur die Möglichkeiten der weiteren kulturellen<br />
Entwicklung abgesteckt <strong>und</strong> ist andererseits durch die <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Entwicklung kontinuierlich verändert worden, ohne allerdings seine<br />
generelle Identität zu verlieren.<br />
Ich will die unterschiedlichen Verhältnisse zwischen Ethik <strong>und</strong> Welt<br />
<strong>und</strong> die unterschiedlichen Formen des innerweltlichen Aktivismus skizzie-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
en, die sich in England, in den Vereinigten Staaten, in Frankreich <strong>und</strong> in<br />
Deutschland herauskristallisiert <strong>und</strong> die kulturellen Grenzen der <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Entwicklung gezogen haben. Mein Ziel ist dabei, zu einer<br />
Relativierung der Position Webers über die mögliche Entwicklung der<br />
Kultur der modernen Gesellschaften zu gelangen. Aus den Schlagworten,<br />
mit denen man die Beziehungen zwischen Ethik <strong>und</strong> Welt <strong>und</strong> die Konzepte<br />
des innerweltlichen Aktivismus in den einzelnen Ländern auf den Begriff<br />
bringen könnte, habe ich für jedes Land eine Oszillation zwischen zwei<br />
entgegengesetzen Polen gewählt: England zwischen Tradition <strong>und</strong> Modernität,<br />
die Vereinigten Staaten von Amerika zwischen Partikularismus <strong>und</strong><br />
Universalismus, Frankreich zwischen Routine <strong>und</strong> Revolution, Deutschland<br />
zwischen Konformität <strong>und</strong> Entfremdung. Gewiß handelt es sich dabei um<br />
eine Selektion, aber wohl um die Selektion des markantesten Merkmals unter<br />
einer Mehrzahl von besonderen Merkmalen der einzelnen <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Kulturen. Um die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern<br />
möglichst scharf hervortreten zu lassen, stelle ich die unterscheidenden<br />
Merkmale besonders klar heraus <strong>und</strong> übertreibe dabei natürlich in idealtypischer<br />
Überzeichnung. Im einzelnen betrachte ich in jedem Land (1) (L)<br />
den Charakter der ethischen Ideen <strong>und</strong> ihr Verhältnis zu den <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Sphären, (2) (G) die Kräfte des Aktivismus, (3) (I) die Träger der<br />
Ethik <strong>und</strong> den Charakter ihrer Verbindlichkeit <strong>und</strong> schließlich (4) (A) die<br />
Kräfte <strong>und</strong> Formen des Wandels <strong>und</strong> der Erneuerung. Ich kann dabei allerdings<br />
nicht mehr bieten als eine Zusammenfassung der Ergebnisse einer umfangreichen<br />
vergleichenden Studie über die Entwicklung der Kultur der<br />
Moderne in den genannten Gesellschaften. Hier ist nicht mehr Platz als<br />
für ein paar Stichworte zu England, Amerika <strong>und</strong> Frankreich, um dann<br />
wenigstens auf die Entwicklung in Deutschland etwas genauer eingehen<br />
zu können. 2<br />
1. England: Zwischen Tradition <strong>und</strong> Modernität<br />
In England herrscht ein traditionalistisch begrenzter Aktivismus (G) vor,<br />
der in ein kulturelles Umfeld einer integrierten Opposition von Orthodoxie<br />
<strong>und</strong> Heterodoxie eingebettet ist (L), durch eine inklusive, aber<br />
dennoch ständisch differenzierte <strong>gesellschaftliche</strong> Gemeinschaft gesteuert<br />
(I) <strong>und</strong> durch eine loyale Opposition einem allmählichen Wandel unterworfen<br />
wird (A). Die Fusion von Tradition <strong>und</strong> Modernität kennzeichnet den<br />
innerweltlichen Aktivismus Englands. 3<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
2. Amerika: Zwischen Universalismus <strong>und</strong> Partikularismus<br />
In den Vereinigten Staaten hat sich ein innerweltlicher Aktivismus entwickelt,<br />
der in dem Auftrag Gottes an die ersten puritanischen Pilger wurzelt<br />
<strong>und</strong> in den Ideen der Revolution gegen England einen säkularen normativen<br />
Maßstab hat (L). Die Umsetzung des Auftrages geschieht in der zunehmenden<br />
Beherrschung der Wildnis (G). Der heilige Vertrag mit Gott sichert<br />
die Verbindlichkeit des Auftrags (I). Die Dynamik der Erneuerungsbewegungen<br />
sorgt für ständigen Wandel (A). Das Dilemma besteht hier in der<br />
Diskrepanz zwischen universellem Anspruch <strong>und</strong> partikularer Wirklichkeit.<br />
4<br />
3. Frankreich: Zwischen Routine <strong>und</strong> Revolution<br />
In Frankreich wird die Beziehung zwischen Ethik <strong>und</strong> Welt <strong>und</strong> der daraus<br />
folgende innerweltliche Aktivismus zunächst durch den kirchlichen Traditionalismus<br />
<strong>und</strong> die administrative Routine als Faktoren der Beharrung bestimmt<br />
(I). Der Aktivismus äußert sich im funktionalen Aktivismus der administrativen<br />
Elite (G). Der intellektuelle Radikalismus entwirft die großen<br />
Ideen gegen die bestehende Gesellschaft (L). Der Wandel kann sich nur in<br />
der großen <strong>gesellschaftliche</strong>n Krise vollziehen (A). Routine <strong>und</strong> Revolution<br />
sind die gegensätzlichen Kräfte, die in Frankreich den innerweltlichen Aktivismus<br />
gestalten/<br />
4. Deutschland: Zwischen Konformität <strong>und</strong> Entfremdung<br />
Das deutsche Modell der Beziehung zwischen Ethik <strong>und</strong> Welt <strong>und</strong> des<br />
daraus folgenden innerweltlichen Aktivismus wird durch folgende Faktoren<br />
gebildet: Innerlichkeit als Gr<strong>und</strong>lage einer persönlichen Identität, die sich<br />
nur außerhalb der Gesellschaft verwirklichen kann (L); der Machtstaat als<br />
treibende Kraft des innerweltlichen Aktivismus, <strong>und</strong> die eigengesetzliche<br />
Rationalisierung <strong>gesellschaftliche</strong>r Sphären (G); Konformität <strong>und</strong> Anpassung<br />
als orthodoxe Haltungen zu den bestehenden Ordnungen (I); Entfremdung<br />
<strong>und</strong> Rebellion als Reaktion auf die eigendynamische Entfaltung der<br />
versachlichten Sphären (A). Konformität <strong>und</strong> Entfremdung sind die vorherrschenden<br />
Haltungen, die in Deutschland den innerweltlichen Aktivismus<br />
formen. 6<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
4.1 Die Innerlichkeit<br />
Luthers Protestantismus hat in Deutschland keinen mit dem Puritanismus<br />
Neuenglands vergleichbaren selbstverantwortlichen Aktivismus hervorgebracht.<br />
An die Stelle der neuenglischen Verbindung des natürlichen bürgerlichen<br />
Aktivismus des selbstverantwortlich handelnden Individuums mit<br />
dem Auftrag Gottes zur Gestaltung der Welt nach seinen Anforderungen ist<br />
im Lutherischen Deutschland das Bündnis der protestantischen Kirche mit<br />
dem Staat getreten. Die beiden Formen des Protestantismus hatten völlig<br />
verschiedene Träger. 7<br />
Der Unterschied beginnt schon mit Luther <strong>und</strong> Calvin. Während Calvin<br />
als freier Bürger der Stadt Genf einen aktiven Einfluß auf die Gestaltung<br />
des politischen Gemeinwesens nahm <strong>und</strong> dieses als eine Theokratie den religiösen<br />
Ideen unterordnete, suchte der Wittenberger Mönch Luther Zuflucht<br />
bei seinem Landesherrn gegen die päpstliche Verfolgung. Luther<br />
mußte den Protestantismus den Machtinteressen der Landesfürsten unterordnen.<br />
Von dieser Konstellation ausgehend, hat der Lutherische Protestantismus<br />
nie eine Idee für die Formung des politischen Gemeinwesens entwickelt,<br />
wie das für den Calvinismus <strong>und</strong> für die von ihm beeinflußten<br />
puritanischen Glaubensgemeinschaften galt. Nach Luthers Lehre der zwei<br />
Reiche, der göttlichen Ordnung <strong>und</strong> der staatlichen Ordnung, ist die politische<br />
Herrschaft von Gott als notwendig eingesetzt worden, um die unvollkommene<br />
Welt der menschlichen Triebe <strong>und</strong> Konflikte durch den äußeren<br />
staatlichen Zwang in Ordnung zu halten. Eine Idee des selbständigen<br />
Bürgers als eine selbstverantwortlich handelnde Persönlichkeit <strong>und</strong> ein Verständnis<br />
des politischen Gemeinwesens als eine Vereinigung freier Bürger<br />
konnte in diesem Kontext nicht entstehen. Von einem aktiven Eingreifen<br />
des Individuums in die Welt konnte keine Rede sein.<br />
Nicht anders hat Luthers Berufsidee gewirkt. Sie bedeutete zwar ein<br />
Ausströmen der Anforderungen an ein gottgefälliges Leben aus dem Kloster<br />
in die Welt, hatte aber keine gestalterische Wirkung auf die Welt. Beruf war<br />
nicht die Berufung zu einer besonderen Aufgabe in der Gestaltung der Welt<br />
nach den ethischen Geboten Gottes, sondern die Berufung an einen Platz<br />
in einem traditionell festgelegten beruflichen Gefüge.<br />
Die Lutherische Auffassung des Menschen als Gefäß Gottes impliziert<br />
keine innerweltliche Askese als eine aktive Formung der Welt nach universellen<br />
ethischen Maßstäben, sondern einen innerweltlichen Mystizismus als<br />
eine Anpassung an die herrschenden Gegebenheiten in der Welt. Was immer<br />
in der Welt in den verschiedensten <strong>gesellschaftliche</strong>n Kontexten geschehen<br />
mag, welchen <strong>gesellschaftliche</strong>n Gesetzen der Lutheraner in seinem Handeln<br />
auch folgen mag, er weiß sich in seinem Vertrauen in Gott auf dem richtigen<br />
Weg zu Gott. Nicht das Handeln führt ihn zu Gott, sondern der richtige<br />
Glaube <strong>und</strong> das Vertrauen in Gott, das reine Gefühl des Erfülltseins von<br />
Gott.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Mit dem innerweltlichen Mystizismus des Lutherischen Protestantismus<br />
verbindet sich das Prinzip der Innerlichkeit als Persönlichkeitsideal, das<br />
auch unter den Bedingungen der Säkularisierung erhalten geblieben ist.<br />
Nach diesem Ideal verwirklicht sich das Individuum nicht in äußeren Werken,<br />
sondern in einer inneren Haltung <strong>und</strong> in einem inneren Gefühl.<br />
Innerlichkeit bedeutet Privatheit <strong>und</strong> Rückzug aus der Öffentlichkeit.<br />
Die Sphäre der Öffentlichkeit ist eine Sphäre der äußeren Welt, an der man<br />
teilnimmt <strong>und</strong> in der man seine Pflichten erfüllt, in der man sich aber nicht<br />
als Person aktiv engagiert <strong>und</strong> in der man nicht seine Identität findet. Alles<br />
<strong>gesellschaftliche</strong> Handeln ist reines Rollenhandeln, ohne jede Zugabe an<br />
Rollengestaltung aus der persönlichen Identität heraus. Es ist deshalb nicht<br />
überraschend, wenn auch heute noch die politische Teilnahme mehr als<br />
Pflicht <strong>und</strong> weniger als persönliches Engagement betrachtet wird. Diese<br />
weit in die kulturelle Tradition des protestantischen Deutschland zurückreichende<br />
Einstellung äußert sich heute noch in der großen Diskrepanz<br />
zwischen der hohen Beteiligung an Wahlen <strong>und</strong> der relativ geringen aktiven<br />
Teilnahme an politischen EntScheidungsprozessen zwischen den Wahlentscheidungen.<br />
Zur Wahl geht man aus Pflicht, Zeit in die aktive Teilnahme<br />
an politischen Entscheidungsprozessen investiert man aus persönlichem<br />
Engagement.<br />
4.2 Der Staat <strong>und</strong> die <strong>gesellschaftliche</strong> Rationalisierung<br />
Ohne die gestalterische Teilnahme des Lutherischen Protestantismus an<br />
der Entwicklung von Politik, Recht, Wirtschaft <strong>und</strong> Wissenschaft ist die<br />
Entfaltung des Aktivismus der Moderne anderen Kräften überlassen geblieben.<br />
Der Aktivismus ist in Deutschland vorwiegend aus der reinen Entwicklungsdynamik<br />
der <strong>gesellschaftliche</strong>n Sphären hervorgegangen. Diese Entwicklung<br />
hat in Deutschland relativ spät, dafür aber um so durchgreifender<br />
im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert eingesetzt. Die Entwicklung wurde dabei nicht — wie<br />
in England <strong>und</strong> noch mehr in Amerika — von einem selbstbewußten Bürgertum<br />
vorangetrieben, das religiöses Sendungsbewußtsein <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Veränderung miteinander verband. In Deutschland ist die Dynamik<br />
der <strong>gesellschaftliche</strong>n Entwicklung von Anfang an <strong>und</strong> bis heute vom Staat<br />
bestimmt worden. Die Selbstbehauptung im europäischen Konkurrenzkampf<br />
war es, die in Deutschland die Industrialisierung, die Ausbreitung<br />
der Wissenschaft <strong>und</strong> die Staatsbildung unter Führung Preußens wesentlich<br />
beeinflußt hat. Dementsprechend herrscht überall der Staat vor, wo man<br />
vor allem in Amerika private <strong>und</strong> gemeinschaftliche Unternehmung antrifft.<br />
Zuerst hat sich aus dem traditionellen Patrimonialismus der Landesherren<br />
zu Luthers Zeit ein Absolutismus herausentwickelt, der nach administrativer<br />
Modernisierung strebte, um sich gegen andere Gewalten innerhalb<br />
<strong>und</strong> außerhalb der eigenen Grenzen behaupten zu können. Die staat-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
liehe Bürokratie ist die erste Einrichtung der Moderne, mit der die Deutschen<br />
konfrontiert wurden <strong>und</strong> die bis heute das Markenzeichen des deutschen<br />
Staates geblieben ist. Der Staat hat dementsprechend auch die Führung<br />
in der rechtlichen, wissenschaftlichen <strong>und</strong> wirtschaftlichen Entwicklung<br />
übernommen. Die Rationalisierung des Rechts war das Resultat einer<br />
einheitlichen Kodifikation durch Juristen im Dienste des absolut herrschenden<br />
Landesherrn. Das Aufblühen der Wissenschaft ist durch die staatliche<br />
Neugründung der Berliner Universität im Jahre 1810 eingeleitet <strong>und</strong><br />
durch die weitere staatliche Investition in wissenschaftliche Hochschulen<br />
weitergetrieben worden. Die Industrialisierung erfolgte in erster Linie<br />
unter Initiative <strong>und</strong> Obhut des Staates <strong>und</strong> der großen Banken. Sie führte<br />
viel schneller zur Konzentration in Großunternehmen als in den anderen<br />
Industrieländern.<br />
Aus dieser materiellen Entwicklung der Gesellschaft konnte kein<br />
individualistischer <strong>und</strong> selbstverantwortlicher Aktivismus eines selbstbewußten<br />
Bürgertums wie in England <strong>und</strong> vor allem in Amerika hervorgehen.<br />
Die aktive Gestaltung der Welt ist hier eine Aufgabe der politischen Führung<br />
der großen Banken <strong>und</strong> Wirtschaftsunternehmen, eine Aufgabe der<br />
wenigen großen Männer, keine Aufgabe eines jeden Bürgers. Bismarck ist<br />
die Gestalt, in der sich der deutsche Aktivismus verkörpert. Aktivismus<br />
geht dabei eine enge Verbindung mit Realpolitik ein. Die Steigerung der<br />
staatlichen Macht nach innen <strong>und</strong> außen ist der letzte Gr<strong>und</strong> dieses machtpolitischen<br />
Aktivismus. Es ist ein Aktivismus, dem im Gegensatz zum<br />
angelsächsischen Aktivismus jede Verwurzelung in darüber hinausgreifenden<br />
Ideen abgeht. Wie Helmuth Plessner treffend formuliert hat, war<br />
Bismarcks Reich eine Großmacht ohne Staatsidee.* Dieses Fehlen einer<br />
ideellen Gr<strong>und</strong>lage bedeutete aber, daß es keinen kulturellen Maßstab gab,<br />
der die Machtpolitik hätte transzendieren können <strong>und</strong> der eine Formung<br />
des Aktivismus durch normative Ideale ermöglicht hätte.<br />
4.3 Konformität <strong>und</strong> Indifferenz<br />
Die Beziehung zwischen religiöser Innerlichkeit <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Äußerlichkeit im Lutherischen Protestantismus ist auch durch die Art<br />
seiner gemeinschaftlichen Organisation <strong>und</strong> durch die Eigenart seiner <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Sphären bestimmt worden.<br />
Aus der Fusion von Luthertum <strong>und</strong> preußischem Beamten- <strong>und</strong> Offiziersgeist<br />
ergaben sich prinzipiell zwei orthodoxe Möglichkeiten der Verknüpfung<br />
von persönlicher Identität <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong>m Rollenhandeln.<br />
Die Beamten- <strong>und</strong> Offiziersdisziplin konnte mit der persönlichen Identität<br />
zusammenfallen. Die religiöse Innerlichkeit löste sich hier in der Disziplin<br />
als persönlichem Handlungsprinzip auf. Der Protestant konnte sich aber<br />
auch nur äußerlich an die Dienstpflichten anpassen <strong>und</strong> im tiefsten Inneren<br />
sein Vertrauen auf Gott bewahren, das mit seinem äußeren Handeln gar<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
nichts zu tun hatte. Es waren diese orthodoxen Verknüpfungen von persönlicher<br />
Identität <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong>m Rollenhandeln, die nicht nur dem<br />
Kaiserreich gehorsame Untertanen beschert haben, sondern auch Hitler<br />
genügend willfährige Diener in der Ausführung des von oben verordneten<br />
Massenmordes an Juden <strong>und</strong> Regimegegnern.<br />
4.4 Entfremdung <strong>und</strong> Rebellion<br />
Die Verbindung zwischen persönlicher Identität <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong>m<br />
Rollenhandeln kannte jedoch nicht nur orthodoxe Lösungen. Mit der zunehmenden<br />
Entfaltung der Eigendynamik der <strong>gesellschaftliche</strong>n Sphären<br />
erschienen im Bezugsrahmen des Lutherischen Protestantismus die orthodoxen<br />
Lösungen für sensiblere Menschen zunehmend als problematisch.<br />
Heterodoxe Lösungen gewannen an Bedeutung. Von ihnen ging die Dynamik<br />
der sozialen Bewegungen aus, eine Dynamik, die Kräfte gegen den<br />
herrschenden kalten Aktivismus mobilisierte, dabei aber auch in fataler<br />
Weise mit dem Protest gegen den verselbständigten Aktivismus auch den<br />
Protest gegen die Moderne überhaupt verband. Für empfindliche Seelen,<br />
denen die Macht der äußeren Welt im Prozeß der Rationalisierung zunehmend<br />
Furcht einjagte, gab es nur den Rückzug aus der Welt in die tiefsten<br />
Winkel der Privatheit. Nur außerhalb der kalten Rationalität der Welt,<br />
in der Privatheit individueller Beziehungen oder in der Einheit mit der<br />
Natur konnte sich der Mensch noch selbst <strong>und</strong> Gott finden. Schließlich<br />
blieb für diejenigen, die sich mit dem Rückzug nicht bescheiden wollten,<br />
nur der Protest gegen den Rationalismus der <strong>gesellschaftliche</strong>n Sphären<br />
in Politik, Recht, Wirtschaft <strong>und</strong> Wissenschaft übrig.<br />
Immer hatten das protestantische Pfarrhaus als Hort der Lutherischen<br />
Innerlichkeit <strong>und</strong> das Lehrerkollegium als Hort des deutschen Idealismus<br />
einen wesentlichen Anteil an den deutschen Erneuerungsbewegungen<br />
durch alle Höhen <strong>und</strong> Tiefen hindurch. Beide, die Orthodoxie <strong>und</strong> die<br />
Heterodoxie hatten ihre feste protestantische Verankerung. Der Protestantismus<br />
hat stets genügend Diener des jeweiligen politischen Regimes <strong>und</strong><br />
auch stets genügend Protestierende gegen die Regimes geliefert.<br />
Diese Fatalität der Oszillation zwischen orthodoxer Ergänzung von<br />
Disziplin <strong>und</strong> Befehl <strong>und</strong> heterodoxer Rebellion gegen die verselbständigte<br />
Rationalität im besonderen <strong>und</strong> gegen die Modernität im allgemeinen hat<br />
mit dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus keineswegs ein Ende<br />
gef<strong>und</strong>en. Auch in der B<strong>und</strong>esrepublik ist bis heute die Logik dieses kulturellen<br />
Codes bei aller sonstigen Durchsetzung der Modernität spürbar.<br />
Dennoch ist die kultureile Situation in der B<strong>und</strong>esrepublik heute so weit<br />
verändert, daß die Ideen, die von den neuen Bewegungen aufgegriffen<br />
werden, auch in erheblichem Maße Neuinterpretationen des modernen<br />
Wertmusters bieten, das als kultureller Code der Moderne über die gegenwärtige<br />
Gesellschaft hinausweist. Von diesen Bewegungen wird heute der<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Materialismus der fünfziger Jahre abgelehnt, der im Besitz eines Autos, mit<br />
dem man überall hinfahren kann, wo man will, schon die Verwirklichung<br />
der Freiheit sah. Statt dessen sucht man neue, weitere Formen der Verwirklichung<br />
von Freiheit, so z.B. die Freiheit der Entscheidung am Arbeitsplatz<br />
oder die Freiheit der Entfaltung persönlicher Empfindungen. Das ist<br />
nichts anderes als eine konsequente Logik der Ausschöpfung des Interpretationspotentials<br />
des kulturellen Codes der Moderne, also ein Weg der fortschreitenden<br />
Moderne. Es ist auch kein radikaler Wertwandel, wie uns etwas<br />
kurzsichtige Sozialwissenschaftler weismachen wollen 9 , sondern ein Wandel<br />
der Interpretation ein <strong>und</strong> desselben kulturellen Codes der Moderne. Mit<br />
dieser Logik der fortschreitenden Moderne verknüpft sich jedoch in diesen<br />
Bewegungen die kulturelle Rückbindung an den spezifisch deutschen kulturellen<br />
Code <strong>und</strong> an die Logik, die in diesem Code für heterodoxe soziale<br />
Bewegungen vorgesehen ist: der Protest gegen die Moderne selbst.<br />
So vermischen sich in der B<strong>und</strong>esrepublik in den neuen sozialen Bewegungen<br />
vier Elemente miteinander: erstens eine Logik der zunehmenden<br />
interpretatorischen Ausschöpfung des kulturellen Codes der Moderne, ein<br />
Fortschritt der Moderne, zweitens ein Protest gegen die kalte Rationalität<br />
der <strong>gesellschaftliche</strong>n Sphären, die im Kaiserreich ihre fatalen Wurzeln hat,<br />
drittens ein Protest gegen die Orthodoxie des deutschen Konformismus<br />
<strong>und</strong> viertens — aus der Logik der protestantischen Innerlichkeit — ein<br />
Protest gegen die Moderne selbst. Daran ist zu erkennen: Der kulturelle<br />
Code der B<strong>und</strong>esrepublik kann zwar seine Verwandtschaft zur kulturellen<br />
Tradition Deutschlands nicht verheimlichen, aber ebensowenig kann man<br />
seine Annäherung an den kulturellen Code der Moderne leugnen. Weder<br />
die blinde Vereinnahmung der B<strong>und</strong>esrepublik für eine gelungene Modernität<br />
noch der ebenso blinde rückwärtsgewandte Fatalismus sind hier angemessene<br />
Positionen. Gefordert ist vielmehr ein wachsamer Optimismus.<br />
Schlußbetrachtung<br />
Niemand hat wohl den Gegensatz zwischen der religiösen Ethik <strong>und</strong> den<br />
verschiedenen Sphären der Welt, der Ökonomie, der Politik, der Kunst, der<br />
Erotik <strong>und</strong> der Wissenschaft, schärfer formuliert als Max Weber. Er bringt<br />
die charakteristische deutsche Spaltung zwischen religiöser Innerlichkeit<br />
<strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong>r Äußerlichkeit in besonders prägnanter Weise zum<br />
Ausdruck <strong>und</strong> trägt selbst wesentlich zur <strong>gesellschaftliche</strong>n Definition des<br />
Verhältnisses zwischen Ethik <strong>und</strong> Welt bei. Ethik gibt es für Weber unter<br />
den modernen Bedingungen nur noch im tiefsten Inneren der Persönlichkeit<br />
<strong>und</strong> in der Privatheit kleinster Gemeinschaften, keinesfalls aber als eine gesellschaftlich<br />
verbindliche Ethik. Jeder muß für sich den Dämon finden, der<br />
seines Lebens Fäden hält. In der Gesellschaft tobt der unversöhnliche<br />
Kampf der Wertordnungen; es ist ein Kampf wie zwischen Gott <strong>und</strong> Teufel;<br />
was des einen Gott ist, das ist des anderen Teufel. 10<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Max Webers Aussagen über die Entwicklung der modernen Gesellschaften<br />
müssen jedoch im Hinblick auf den geseUschaftlich-kulturellen Kontext<br />
relativiert werden in dem sie formuliert wurden. Dieser Kontext ist vom<br />
Lutherischen Protestantismus <strong>und</strong> seiner Säkularisierung im deutschen<br />
Idealismus definiert worden. Die hier betrachteten Gesellschaften haben<br />
ihre ganz spezifische Beziehung zwischen Ethik <strong>und</strong> Welt <strong>und</strong> ihre ganz<br />
spezifische Variante des innerweltlichen Aktivismus entwickelt. Wenn man<br />
die Eigenart der neuen sozialen Bewegungen richtig verstehen <strong>und</strong> erklären<br />
will, dann muß man dieser Tatsache weit mehr Rechnung tragen als dies in<br />
der Regel in den meist recht positivistisch verfahrenden soziologischen<br />
Untersuchungen getan wird. Die Bewegungen sind einerseits Teil einer<br />
die einzelnen Länder überspannenden Universalierung der modernen Kultur<br />
<strong>und</strong> reagieren auf eine ebenso überspannende Rationalisierung <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Sphären. Die Art <strong>und</strong> Weise, in der sie darauf reagieren, ist jedoch<br />
durch den gesellschaftlich-kulturellen Code der einzelnen Länder bestimmt.<br />
Die Kultur der Moderne erhält ihre innovative Kraft von den ganz unterschiedlichen<br />
Beiträgen der geschilderten <strong>gesellschaftliche</strong>n Varianten.<br />
Es ist deshalb gar nicht wünschenswert, daß sie sich vollkommen angleichen<br />
oder einer einzigen Variante annähern. Die Dynamik der Moderne lebt von<br />
der unauflöslichen Spannung zwischen der universellen Idee <strong>und</strong> ihrer partikularen<br />
Verwirklichung.<br />
ANMERKUNGEN<br />
1 M. Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religions<strong>soziologie</strong>, Bd. I, Tübingen (1920)<br />
1972, S. 1-16, 203-04, 237-75, 536-73; ders., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre,<br />
Tübingen (1922) 1973, S. 151-56, 505-08, 517, 539-40, 593-613;<br />
ders., Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft, Tübingen (1922) 1976, S. 348-67. Siehe dazu<br />
R. Münch, Theorie des Handelns, Frankfurt 1982, S. 487-501; ders., Die Struktur<br />
der Moderne, Frankfurt 1984.<br />
2 Eine umfassende Ausarbeitung der folgenden Skizze findet sich in R. Münch, Die<br />
Entwicklung der Moderne: England, Amerika, Frankreich <strong>und</strong> Deutschland, Frankfurt<br />
1986.<br />
3 Siehe dazu u.a. R. Rose, „England: The Traditionally Modern Political Culture",<br />
in: L.P. Pye <strong>und</strong> S. Verba (Hg.), Political Culture and Political Development,<br />
Princeton 1965, S. 83-129; B. Jessop, Traditionalism, Conservatism and British<br />
Political Culture, London 1974.<br />
4 Ich nenne nur: A. de Tocqueville, Über die Demokratie in Amerika. <strong>München</strong><br />
(18<strong>35</strong>/40) 1976; R. Bellah, The Broken Covenant: American Civil Religion in<br />
Time of Trial, New York 1975.<br />
5 Siehe z.B. A. de Tocqueville, Der alte Staat <strong>und</strong> die Revolution, Reinbek bei Ha<strong>mb</strong>urg<br />
(1856) 1969; M. Crozier, The Bureaucratic Phenomenon, Chicago 1964.<br />
6 Siehe u.a. H. Plessner, Die verspätete Nation, Stuttgart 1959; R. Dahrendorf,<br />
Gesellschaft <strong>und</strong> Demokratie in Deutschland, <strong>München</strong> 1971; F.K. Ringer, The<br />
Decline of the German Mandarins. The German Academic Community, 1890-1933,<br />
Ca<strong>mb</strong>ridge, Mass. 1969.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
7 Zur Interpretation von Luther vgl. A.E. Berger (Hg.) Luthers Werke, Leipzig <strong>und</strong><br />
Wien 1917; M. Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religions<strong>soziologie</strong>, Bd. I, op. cit.,<br />
S. 63-83.<br />
8 H. Plessner, Die verspätete Nation, op. cit., S. 39-46.<br />
9 R. Inglehart, The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among<br />
Western Publics, Princeton 1977.<br />
10 M. Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, op. cit., S. 153, 507, 603,<br />
613.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
VERSOZIALWISSENSCHAFTLICHUNG DER IDENTITÄTSFORMA<br />
TION UND DER VERWEIGERUNG VON LEBENSPRAXIS: EINE<br />
AKTUELLE VARIANTE DER DIALEKTIK DER AUFKLÄRUNG<br />
Ulrich Oevermann<br />
Vorbemerkung<br />
Während in der „empirischen Sozialforschung" der akademischen Soziologie<br />
ein subsumtionslogisches Vorgehen vorherrscht, in dem Datenmaterial<br />
aus der sozialen Realität von vornherein unter Gesichtspunkten allgemeiner,<br />
vorweg konstruierter Begriffe sortiert wird <strong>und</strong> man über empirische Verallgemeinerungen<br />
allmählich zu axiomatisierbaren Theorien fortzuschreiten<br />
hofft, bildet für eine Soziologie, die sich als hermeneutisch-rekonstruktive<br />
Erfahrungswissenschaft versteht, die Analyse der sequentiellen Strukturiertheit<br />
von textförmigen Protokollen, in der die Reproduktion der Struktur<br />
eines konkreten sozialen Gebildes als Ablauf sich manifestiert, das zentrale<br />
Geschäft. Diese auf materiale Strukturanalyse ausgehende soziologische<br />
Forschung behandelt natürliche, durch Forschungsinstrumente noch<br />
nicht zurechtgestutzte Protokolle solcher Abläufe als Erscheinungsformen<br />
der Reproduktion von Fallstrukturen, die ihrerseits allgemeinere <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Substrukturen <strong>und</strong> Typen in ihrem Reproduktions- <strong>und</strong> Transformationsprozeß<br />
ausschnitthaft zum Ausdruck bringen. Man hofft, „in<br />
the long run" über die Integration verschiedener Fallrekonstruktionen,<br />
in denen konkrete Strukturanalyse betrieben wird, zur Rekonstruktion<br />
der <strong>gesellschaftliche</strong>n Totalität einer Epoche oder eines historischen Typs<br />
zu gelangen <strong>und</strong> sich bei diesem Bemühen mit den anderen geistes- <strong>und</strong><br />
kulturwissenschaftlichen Disziplinen zu treffen.<br />
Für die Verwirklichung eines solchen Programms, das man auch als<br />
genetischen Strukturalismus oder als historische Strukturanalyse bezeichnen<br />
könnte, sind zeitdiagnostisch ausgerichtete Materialanalysen von<br />
großer Wichtigkeit, in denen man versucht, latenten Entwicklungstrends<br />
einer <strong>gesellschaftliche</strong>n Konstellation oder Lage auf die Spur zu kommen.<br />
Solche Forschungen werden gegenwärtig von der Soziologie im Vergleich<br />
zu sektoralen Problemfeld-Analysen, Surveys, Querschnittsumfragen <strong>und</strong><br />
eingegrenzte Hypothesen überprüfenden Befragungen zu wenig ernst genommen,<br />
während sie von der älteren Soziologie, die sich ihrer Verwandtschaft<br />
mit den historischen Disziplinen bewußter war, noch als zentraler<br />
Teil ihrer wirklichkeitswissenschaftlichen Aufgabenstellung betrachtet<br />
wurden. Dabei lassen sie sich im Vergleich zu jenem anderen Forschungstyp<br />
mit geringem Aufwand <strong>und</strong> auf der Gr<strong>und</strong>lage einer Vielfalt von Datentypen<br />
— Interviews, Zeitungsberichte, literarische Zeugnisse, Tagebücher,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Briefe, Reden, Verlautbarungen, usf. — gewinnbringend durchführen.<br />
Man wird vor allem versuchen, den nicht direkt abfragbaren, weil von den<br />
Befragten nicht leicht explizierbaren Konzepten der Erschließung von sozialer<br />
Realität <strong>und</strong> den Identitätsformationen nachzuspüren, die wie eine<br />
generative Formel, wie ein Deutungsmuster, die konkreten Urteile <strong>und</strong><br />
Handlungen gewissermaßen hinter der Bühne der konkreten Meinungen,<br />
Vorurteile <strong>und</strong> Überzeugungen auf Angemessenheit hin prüfen <strong>und</strong> strukturieren<br />
<strong>und</strong> ihrerseits, so sehr sie eine eigenständige Ebene der Strukturierung<br />
sozialer Realität ausmachen, in der Auseinandersetzung mit objektiven<br />
Handlungsproblemen <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong>n Bedingungen sich bilden.<br />
Die analytische Eingrenzung der Wirklichkeitsebene:<br />
Von besonderer Bedeutung sind dem zeitdiagnostisch auf das Material<br />
blickenden Soziologen solche Daten, die jeweils Trends in der Formation<br />
der sozial verbindlichen Normalitätsentwürfe von Persönlichkeitsstrukturen<br />
erkennen lassen. In der Vergangenheit sind typologische Vorschläge für die<br />
Rekonstruktion des herrschenden Sozialcharakters wie „die autoritäre<br />
Persönlichkeit", der „außengeleitete" <strong>und</strong> der „innengeleitete" Mensch<br />
in der einsamen Masse oder der „eindimensionale Mensch" der technokratischen<br />
Gesellschaft des Fachmenschentums von großem Einfluß gewesen.<br />
Allerdings waren bei diesen recht global argumentierenden Typologien<br />
die Ebenen der tatsächlichen psychischen Struktur, der in Deutungsmustern<br />
verdichteten <strong>gesellschaftliche</strong>n Entwürfe einer normalen Persönlichkeit,<br />
der Muster des diesen Typ jeweils hervorbringenden sozialisatorischen<br />
Milieus <strong>und</strong> der letzteres produzierenden objektiven <strong>gesellschaftliche</strong>n Bedingungen<br />
nicht klar genug voneinander getrennt.<br />
Für zeitdiagnostische Analysen sind die verinnerlichten Normalitätsentwürfe<br />
deshalb besonders wichtig, weil in ihnen sich, den jeweiligen kodifizierten<br />
sozialen Normen vorgelagert, der für die gegenwartstypischen<br />
Problemstellungen einer <strong>gesellschaftliche</strong>n Lage geeignete <strong>und</strong> geschätzte<br />
Habitus als eine zeitgeistgeb<strong>und</strong>ene latente Sinnlogik am ehesten fassen<br />
läßt. Wenn es gelingt, von diesen Habitusformationen auch nur einige typische<br />
Knotenpunkte zu identifizieren, erhält man sogleich Einblick in gesamtgesellschaftlich<br />
bedeutsame Entwicklungstrends, die als abfragbare<br />
Manifestationen sich erst später ausblühen. Damit soll nun keineswegs behauptet<br />
werden, daß es sich hierbei um autonome Entwicklungstendenzen<br />
der Gesellschaft handele, die ihrerseits nicht wiederum Reaktionen auf<br />
Transformationen des gesamt<strong>gesellschaftliche</strong>n Prinzips der Organisation<br />
der Produktivkräfte <strong>und</strong> der Produktionsverhältnisse darstellten. Vielmehr<br />
macht man sich nur zunutze, daß zum einen solche Habitusformationen<br />
seismographisch die objektiv erzwungenen Problemstellungen anzeigen <strong>und</strong><br />
ihrerseits bei der Erzeugung von Problemlösungsmustern eine eigenständige<br />
Strukturierungsbedeutsamkeit haben.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Normalitätsentwürfe für Persönlichkeitsstrukturen drücken vor allem<br />
die jeweils für den Zeitgeist spezifische Deutung des Verhältnisses von Individuum<br />
<strong>und</strong> Gesellschaft aus. Dieses Verhältnis stellt nicht nur begrifflich<br />
für die soziologische Strukturanalyse eine zentrale Dimension ihrer Betrachtung<br />
von Gesellschaft <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong>n Entwicklungen, in welchen<br />
Epochen <strong>und</strong> Kulturkreisen auch immer, dar, sondern bildet real eine<br />
für die Lebenspraxis selbst zentrale Dimension von Deutungsproblemen.<br />
Daß mit der Entfaltung der Geschichte zur Moderne hin eine beständige<br />
Ausdifferenzierung von Individuum <strong>und</strong> Gesellschaft für den einzelnen mit<br />
der Folge der Erhöhung von Individuierungs- <strong>und</strong> Autonomiechancen einerseits<br />
<strong>und</strong> der Zunahme von Problemdruck <strong>und</strong> Entfremdung andererseits<br />
verb<strong>und</strong>en ist, gehört zu den elementaren Topoi der Soziologie seit langem.<br />
Im folgenden soll ausschnitthaft einer spezifischen Ausformung von<br />
Identitätsentwürfen im Bezugsrahmen dieses Verhältnisses von Individuum<br />
<strong>und</strong> Gesellschaft nachgegangen werden, wie es sich in einer Vielzahl von<br />
Daten aus ganz verschiedenen Forschungsbereichen dem Betrachter aufgedrängt<br />
hat. Der dabei herauskristallisierbare, hier nicht mehr als den Status<br />
einer Heuristik beanspruchende Typ von Identitätsformation in der gegenwärtigen<br />
Generation von 20- bis 30-jährigen mit weiterführender Ausbildung<br />
vermag vielleicht auch den immer wieder aufgeworfenen Fragen nach<br />
dem Weg, die diese Generation als Träger zukünftiger <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Entscheidungen gehen wird, eine Antwort durchaus bescheidenen Umfangs<br />
vorzuschlagen.<br />
Die Heuristik der Analyse: Die strukturelle Dialektik von Lebenspraxis<br />
Ich werde bei dieser Betrachtung mit einem sehr einfachen, heuristischen<br />
Begriff von Lebenspraxis arbeiten, der sowohl auf die Lebensführung einzelner<br />
Personen, wie die von Gruppen <strong>und</strong> ganzen Gesellschaften sowie deren<br />
Repräsentanten angewendet werden kann. Eine Lebenspraxis entfaltet, sehr<br />
allgemein gesprochen, jede autonom handlungsfähige, <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Instanz, ob nun Person oder höher aggregiertes System. Lebenspraxis verstehe<br />
ich als eine widersprüchliche Einheit von Begründungs- <strong>und</strong> Entscheidungszwang.<br />
Wo Handlungssituationen gr<strong>und</strong>sätzlich offen sind, Alternativen<br />
offerieren <strong>und</strong> durch Entscheidungen strukturiert werden müssen<br />
— die komplementäre Seite der Medaille von Handlungsautonomie —, konstituiert<br />
sich zugleich der Zwang zur Begründung von zu treffenden Entscheidungen,<br />
denn die durch Entscheidungsalternativen freigesetzte Handlungsautonomie<br />
realisiert sich erst in dem Maße, in dem die getroffenen<br />
Entscheidungen als vernünftig sich rechtfertigen lassen. Widersprüchlich ist<br />
die lebenspraktische Einheit von Entscheidungs- <strong>und</strong> Begründungszwang<br />
deshalb, weil gr<strong>und</strong>sätzlich die Offenheit von Handlungssituationen, generell:<br />
die Zukunftsoffenheit von Geschichte, nicht durch Einrichtung ahisto-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
isch gültiger <strong>und</strong> deduktiv-nomologisch anwendbarer Entscheidungsprämissen<br />
aufgelöst werden kann, es sei denn im Grenzfall einer durchtechnokratisierten<br />
Gesellschaft. Auch in traditionellen Gesellschaften ändert die<br />
Geltung von Routinen, von Brauch, Sitte <strong>und</strong> dumpfer Gewohnheit gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
nichts daran, daß deren Begründungspotential für die Bewältigung<br />
von Entscheidungsproblemen der Lebenspraxis nicht ausreicht; andernfalls<br />
hätte es systematische historische Transformationen traditionaler Gesellschaften<br />
trivialerweise nicht geben können.<br />
Lebenspraxis ist also dadurch geprägt, daß beständig Entscheidungen<br />
mit Anspruch auf Vernünftigkeit getroffen werden müssen, obwohl zugleich<br />
deutlich ist, daß für die Aufhebung des mit dem Vernunftanspruch gesetzten<br />
Begründungszwanges ausreichende Rechtfertigungsargumente nicht<br />
immer zur Verfügung stehen. Lebenspraxis höbe sich selbst auf, wenn sie<br />
— in Anlehnung an das Modell der technologischen Anwendung von Wissenschaft<br />
— ein Defizit von Begründungsargumenten zum Anlaß nähme, die zu<br />
treffenden Entscheidungen zu vertagen. Bei genauerem Hinsehen trifft<br />
selbst dies nicht zu, denn für die Lebenspraxis gilt generell, daß sie bis auf<br />
den Grenzfall der Selbstauflösung durch Passivität — sich nicht nicht entscheiden<br />
kann, denn auch eine Nicht-Entscheidung ist lebenspraktisch eine<br />
Entscheidung, bildet allerdings den Grenzfall einer Entscheidung zur Aufgabe<br />
der Autonomie. Nicht-Entscheidung bedeutet lebenspraktisch gesehen<br />
die Einrichtung von Abhängigkeit, ebenso wie die Verleugnung der Verantwortlichkeit<br />
für Entscheidungsfolgen.<br />
Würden jeweils in einer Gesellschaft zur Verfügung stehende Begründungsargumente<br />
als für alle lebenspraktisch eintretenden Entscheidungssituationen<br />
ausreichend angesehen werden, dann wäre gewissermaßen das<br />
Ende der Geschichte erreicht. Daß Handlungssituationen gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
offen sind, <strong>und</strong> eingerichtete Begründungsargumente, auch wissenschaftlich<br />
validierte, immer nur für den allerdings rein quantitativ die überwiegende<br />
Mehrzahl bildenen Routinefall ausreichen, darin besteht gerade das Moment<br />
von Lebenspraxis als nicht hintergehbarer Quelle von materialer Rationalität.<br />
Was in der Gegenwart einer im Lichte des bestehenden Wissens <strong>und</strong> geltender<br />
Normen nicht zu begründenden Entscheidung sich zunächst mit Bezug<br />
auf diese historisch spezifische, rationale Begründungsbasis als irrational<br />
ausnimmt, erweist sich potentiell in der Zukunft als entfaltete materiale Rationalität;<br />
dann nämlich, wenn in rekonstruktiver Einstellung die Entscheidung<br />
als unter den gegebenen Situationsbedingungen von den eingetretenen<br />
Folgen her nachträglich zu begründende sich erweist. Diese Begründung<br />
trägt aber den Charakter der Nachträglichkeit nicht, weil sie in der Eile der<br />
Entscheidungssituation nur nicht schnell genug aufgef<strong>und</strong>en werden konnte,<br />
sondern weil — gr<strong>und</strong>sätzlich — die Rekonstruktion der Entscheidungssituation<br />
zugleich offenbart, warum das bis dahin geltende Wissen für eine<br />
vernünftige Entscheidung nicht ausreichte <strong>und</strong> inwiefern die getroffene Entscheidung<br />
faktisch — bezogen auf die vorausgehende Wissensbasis — eine Erfahrungserweiterung<br />
herbeigeführt hat. Mit diesem Argument ist zugleich<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
der Primat der lebenspraktischen Erfahrung vor der wissenschaftlichen Erkenntnis<br />
begründet; Erfahrungswissenschaft rekonstruiert immer nur, was<br />
die Lebenspraxis selbst in konkreten Entscheidungssituationen erfahrbar<br />
macht. Das methodisch kontrollierte wissenschaftliche Experiment ist<br />
nichts anderes als eine gedankenexperimentell konstruierte Simulation von<br />
Handlungssituationen <strong>und</strong> erfährt darin zugleich auch seine Grenze. Die<br />
Wirkung der inzwischen viel berufenen Verwissenschaftlichung des Alltags<br />
beruht, in diesem Lichte gesehen, genau darin, daß sie das Bewußtsein vom<br />
Primat der lebenspraktischen Erfahrung tendenziell auflöst <strong>und</strong> damit auch,<br />
in einer veränderten Form von Entfremdung innerhalb der Dialektik der<br />
Aufklärung, die lebenspraktische Handlungsautonomie selbst.<br />
Diese Auslegung von Lebenspraxis wird nicht nur in der gegenwärtigen<br />
Gesellschaft, sondern gerade auch in der Soziologie mit einem gewissen<br />
Mißtrauen betrachtet. Man erblickt darin gern Anzeichen für Irrationalismus<br />
<strong>und</strong> Dezisionismus. Nicht selten wird eingewandt, was schon gegen<br />
die „Geworfenheit" <strong>und</strong> die darin enthaltene Heroisierung des Individuums<br />
in seinem einsamen Entscheidungszwang (innerhalb des Existentialismus)<br />
vorgebracht wurde. Verwiesen wird dann auf die sozial institutionalisierten,<br />
Entscheidungen schon vorweg bestimmenden Handlungsorientierungen <strong>und</strong><br />
darauf, daß der normale Alltagsmensch die widersprüchliche Einheit von<br />
Entscheidungs- <strong>und</strong> Begründungszwang deshalb nicht als beunruhigend erfahre,<br />
weil selbstverständlich geltende Relevanzsysteme <strong>und</strong> Erwartungshorizonte<br />
schon immer einen hinreichenden Vorrat an akzeptablen Begründungen<br />
zur Verfügung stellten, ja von sich aus überhaupt erst die Entscheidungssituation<br />
erfahrbar machten.<br />
Einwände dieser Art verkennen den strukturalistischen Charakter der<br />
Argumentation, deren ich mich hier bediene <strong>und</strong> sehen nicht, daß solche<br />
wie selbstverständlich geltenden Orientierungen <strong>und</strong> Relevanzsysteme als<br />
Entscheidungsroutinen gerade in Reaktion auf die dialektische Struktur von<br />
Lebenspraxis eingerichtet worden sind, um das prinzipiell handlungsautonome<br />
Individuum zu entlasten, daß aber die gr<strong>und</strong>legende Struktur von<br />
Lebenspraxis als widersprüchlicher Einheit dadurch keineswegs aufgehoben<br />
ist, sondern die Konstitution von Routinen <strong>und</strong> Orientierungen als Formen<br />
eines praktikablen Umgangs mit ihr allererst erklärt. Der referierte Einwand<br />
verwechselt mithin Wesen <strong>und</strong> Erscheinung in der Strukturierung sozialer<br />
Realität.<br />
Vor allem aber verschütten Einwände dieser Art den Blick auf eine einfach<br />
zu fassende, zentrale Dimension des historischen Prozesses der <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Rationalisierung <strong>und</strong> ihrer Dialektik. Sieht man nämlich die<br />
widersprüchliche Einheit von Begründungs- <strong>und</strong> Entscheidungszwang als die<br />
strukturale Dialektik von Lebenspraxis überhaupt an, in der material sowohl<br />
das spezialisierte Denken wie die — als soziales Handeln gefaßte —<br />
wissenschaftliche Erkenntnis <strong>und</strong> professionalisierte Kunst als spezialisierte<br />
Formen der Kritik von lebenspraktisch geb<strong>und</strong>ener Alltagserfahrung letztlich<br />
f<strong>und</strong>iert sind, dann ist nicht nur die Entfaltung dieser Dialektik selbst<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
dem historischen Wandel unterworfen, sondern sie gibt für die historisch-<strong>gesellschaftliche</strong><br />
Entwicklung den Rahmen ab. Diese vollzieht sich unter diesem<br />
Blickwinkel als Entfaltung der jeweils institutionalisierten Umgangsweisen<br />
mit dem universellen Strukturproblem der gleichzeitigen Entscheidungs<strong>und</strong><br />
Begründungsverpflichtung. So gesehen kommt der Institutionalisierung<br />
wissenschaftlichen Handelns im 17. Jahrh<strong>und</strong>ert eine wesentliche Schubkraft<br />
im <strong>gesellschaftliche</strong>n Rationalisierungsprozeß zu, weil mit der kritischen<br />
Prüfung von Alltagsüberzeugungen nach expliziten Kriterien der<br />
Geltung auf der einen Seite die Standards, Ansprüche <strong>und</strong> Möglichkeiten<br />
rationaler Begründung explosionsartig gesteigert wurden, auf der anderen<br />
Seite aber auch angesichts der verschärften Kriterien rationaler Begründung<br />
die wie selbstverständlich geltenden Tradtitionen <strong>und</strong> Überzeugungen für<br />
die Rechtfertigung von lebenspraktischen Entscheidungen in den Strudel<br />
des Zweifels gerieten <strong>und</strong> entsprechend der Problemdruck für die Lebenspraxis<br />
stieg, anders gesprochen, das Individuum an Autonomie potentiell<br />
gewann, zugleich dafür aber auch den Preis höherer Inanspruchnahme <strong>und</strong><br />
Verantwortlichkeit zu entrichten hatte.<br />
Dies kann man sich am ehesten vergegenwärtigen, wenn man das Argument<br />
am Beispiel elementarer lebenspraktischer Entscheidungsprobleme<br />
durchspielt, die sich gr<strong>und</strong>sätzlich nicht auf technische Fragen oder auf<br />
Fragen der Geltung von Gesetzeshypothesen reduzieren lassen, sondern auf<br />
Fragen der Lebenspraxis selbst beziehen, bei denen die Dignität des Individuierungsentwurfs<br />
als Bestandteil individueller Handlungsautonomie selbst<br />
auf dem Spiel steht. Zu solchen Entscheidungsproblemen gehören ebenso<br />
elementare wie wissenschaftlich gr<strong>und</strong>sätzlich nicht beantwortbare Fragen<br />
wie: Soll ich eine bestimmte Person heiraten oder nicht? <strong>und</strong>: Soll ein Kind<br />
gezeugt werden oder nicht? Für den Menschen der primitiven oder traditionalen<br />
Gesellschaften sind dies höchstwahrscheinlich nicht wirklich bedrängende<br />
Fragen gewesen, die ihn in Entscheidungsnöte gebracht hätten. Ihre<br />
Beantwortung war quasi automatisch durch Sitte, Tradition <strong>und</strong> Konvention<br />
vorgegeben, so daß sie als belangvolle Entscheidungsprobleme nicht<br />
ins Bewußtsein traten. Gleichwohl mußte die tatsächlich getroffene Entscheidung<br />
gute Gründe in Anspruch nehmen können, wie die starke negative<br />
Sanktionierung von abweichenden Fällen gerade in diesen Gesellschaften<br />
zeigt. Aber die richtige Entscheidung war, den Einzelnen entlastend,<br />
schon in kollektiven Regeln vorgeprägt oder im Falle der Nachkommenschaft<br />
durch Begrenzung der Kontrollierbarkeit faktisch vorgegeben. Die<br />
strukturale Dialektik von Lebenspraxis drang gewissermaßen nicht bis ins<br />
individuelle Bewußtsein, das von ihr überfordert worden wäre, vor, sondern<br />
wurde auf der Ebene von Brauchtum, Sitte <strong>und</strong> den institutionalisierten<br />
Normen abgefangen. Aber sie war dennoch als universales Strukturproblem<br />
latent präsent. Anders gesprochen: Die Ausdifferenzierung des dialektischen<br />
Verhältnisses von Individuum <strong>und</strong> Gesellschaft war noch nicht so<br />
weit gediehen, daß die widersprüchliche Einheit von Entscheidungs- <strong>und</strong><br />
Begründungszwang zu einem Problem der Bewältigung individueller Autonomie<br />
hätte werden können.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
In dem Maße, in dem in den italienischen Stadtrepubliken die tradierten<br />
Legitimationsbestände für politische Herrschaft nicht mehr greifen, erwächst<br />
aus dem beständigen Kampf um die reale Macht der Politiker, der<br />
seine Entscheidungen ad hoc vor einer quasi-bürgerlichen Öffentlichkeit begründen<br />
muß <strong>und</strong> sich nicht mehr auf geltende Traditionen allein berufen<br />
kann. Und in dem Maße, in dem die zunächst auf einen sehr eingeschränkten<br />
Objektbereich sich beziehenden Erfahrungswissenschaften institutionalisiert<br />
werden <strong>und</strong> als solche die legitimatorisch bedeutsamen Weltbilder erschüttern,<br />
wird in der Neuzeit das entscheidungsautonome, einer universalen<br />
Ethik begründungsverpflichtete Subjekt der bürgerlichen Gesellschaft<br />
entlassen. Nun tritt aber zur Schließung der von Traditionen freigemachten<br />
Entscheidungsoffenheit nicht wissenschaftliche Erkenntnis oder im einzelnen<br />
inhaltlich durchgeführte Ethik an die Stelle der früheren, das Begründungsproblem<br />
von vornherein lösenden Wissens- <strong>und</strong> Argumentationsbestände.<br />
Diese im neuzeitlichen Denken immer wieder auftauchende technokratische<br />
Variante würde ja die einmal in der Form des autonomen Subjekts<br />
freigesetzte dialektische Struktur von Lebenspraxis sogleich wieder verschütten,<br />
<strong>und</strong> es ist sehr die Frage, ob das gr<strong>und</strong>sätzlich ohne Rest noch<br />
möglich ist. Auch logisch würde ja diese Variante letztlich auf die materiale<br />
Absurdität hinauslaufen, Lebenspraxis in wissenschaftliche Rationalität<br />
hermetisch abgedichtet aufgehen zu lassen, in jene Rationalität also, die<br />
ihrerseits ohne die Einbettung in die materiale Rationalität von Lebenspraxis<br />
gar nicht denkbar wäre.<br />
Die Auflösung des Traditionalismus bedeutet also nicht nur das Heraustreten<br />
einer wissenschaftlich in Regie genommenen Rationalisierung, sondern<br />
zugleich strukturell auch die Manifestation der latent schon immer der<br />
Chance nach vorliegenden Autonomie der Lebenspraxis, sei es als individuelle,<br />
familiäre oder gesamt<strong>gesellschaftliche</strong>. Die in ihr freigesetzte Dialektik<br />
von Entscheidungs- <strong>und</strong> Begründungszwang kann nun nicht einfach<br />
durch das historisch neue, wissenschaftlich verwaltete Repertoire von Begründungen<br />
ähnlich den vorausgehenden allzuständigen Traditionen stillgestellt<br />
werden, wie es die technokratische Ideologie sich vorstellt. Die Kernfragen<br />
der Lebenspraxis gehören vielmehr einer kategorialen Ordnung an,<br />
die sich einer wissenschaftlichen Problemlösung allein deshalb schon nicht<br />
erschließt, weil strukturell <strong>und</strong> handlungslogisch gesehen der Sinn lebenspraktischer<br />
Fragen sich nicht auf ihren propositionalen Gehalt in den Begriffen<br />
des Allgemeinen reduzieren läßt bzw. als solcher sich schon kategorial<br />
geändert hätte, wenn er losgelöst von der konkreten, besonderen Perspektivität<br />
der jeweiligen Lebenspraxis, aus der heraus diese Fragen sich<br />
sinnvoll entfaltet haben, betrachtet würde, wie es in der wissenschaftlichen<br />
Problemlösung notwendig der Fall sein müßte. Damit ist keineswegs behauptet,<br />
lebenspraktische Fragen ließen sich wissenschaftlich nicht als<br />
solche behandeln. Aber wo das in Not- <strong>und</strong> Grenzfällen geschieht, bedarf es<br />
zur Sicherung der Autonomie dieser Lebenspraxis besonderer Vorkehrungen,<br />
die in der Logik des dafür zuständigen professionalisierten Handelns<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
sozial ausgebildet vorliegen, hier aber nicht ausgebreitet werden können.<br />
Die Ausdifferenzierung von Wissenschaft als Handlungssystem ist also<br />
selbst in jene Dialektik von Individuum <strong>und</strong> Gesellschaft eingeb<strong>und</strong>en, die<br />
zur manifesten Ausdifferenzierung des autonomen Subjekts als Strukturgebilde<br />
führt.<br />
Dieses sieht sich vor die Verpflichtung rationaler Entscheidungsbegründung<br />
gestellt, in die zunehmend der Modus der wissenschaftlichen Rationalität<br />
<strong>und</strong> die Berücksichtigung ihrer Ergebnisse einwandert: Die mit der Befreiung<br />
von Traditionen verb<strong>und</strong>ene Erweiterung der expliziten rationalen<br />
Begründbarkeit steigert zugleich die Ansprüche an die Rationalität der Begründung<br />
von Entscheidungen. Dies ist unproblematisch bei technischen<br />
Fragen <strong>und</strong> Fragen der angemessenen Handlungsstrategie in Begriffen einer<br />
Mittel-Zweck-Rationalität. Aber diese Steigerung muß als Problemdruck, als<br />
belastend dort empf<strong>und</strong>en werden, wo elementare lebenspraktische Entscheidungen<br />
anstehen, die auf der einen Seite jedermann betreffen, insofern<br />
also als alltäglich <strong>und</strong> <strong>und</strong>ramatisch, für jedermann lösbar erscheinen, für<br />
die aber andererseits zum einen wissenschaftliche Lösungen prinzipiell,<br />
ohne Kategorienfehler zu begehen, nicht zur Verfügung stehen können, andererseits<br />
aber auch traditionale, vorwissenschaftliche Argumentationsbestände<br />
nicht mehr beigezogen werden können, da sie ja gerade durch die<br />
Institutionalisierung von Wissenschaft ein für alle Mal entwertet worden<br />
sind <strong>und</strong> auch durch Nostalgie, Regression oder die exotisierende Wertschätzung<br />
außereuropäischer Lebenswelten gültig nicht zurückgewonnen<br />
werden können.<br />
Das vorläufige Schema einer versozialwissenschaftlichten Identitätsformation<br />
Diese Steigerung des Problemdrucks, so meine zentrale These, prägt typische<br />
Identitätsformationen, die wir heute in der jüngeren Generation als<br />
eine spezifische Antwort auf die explizierte dialektische Struktur von Lebenspraxis<br />
antreffen. Bezogen auf die elementaren Fragen von Ehe <strong>und</strong><br />
Nachkommenschaft läßt sich das empirisch vielfach belegen. Der Boom an<br />
popularisierten sozialisationstheoretischen Schriften, an Lebens- <strong>und</strong> Erziehungsberatung<br />
in den Kirchen <strong>und</strong> Kommunen <strong>und</strong> in der Literatur ist<br />
nur ein Reflex auf die Verunsicherung, die subjektiv auf diese Problemdrucksteigerung<br />
eingetreten ist. Was subjektiv als Einlösen der Rationalitätsverpflichtung<br />
<strong>und</strong> der Verpflichtung zu aufgeklärtem Verhalten erscheint<br />
<strong>und</strong> sich in der Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse auf die eigene<br />
Lebenspraxis äußert, ist objektiv das genaue Gegenteil: die in Selbst-Technokratisierung<br />
sich vollziehende Flucht vor der bewußten Wahrnehmung<br />
einer lebenspraktischen Autonomie, deren Verpflichtung zu materialer Rationalität<br />
durch die bloße Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich nicht abgedeckt werden kann. Den Rückgang der Geburtenziffern<br />
in der B<strong>und</strong>esrepublik würde ich im wesentlichen auf diesen Pro-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
lemdruck zurückführen. Nicht Bequemlichkeit oder ökonomische Restriktionen<br />
verursachen ihn, wie häufig angeführt worden ist, sondern die Verunsicherung<br />
gegenüber einem elementaren lebenspraktischen Entscheidungsproblem,<br />
für dessen Vergegenwärtigung <strong>und</strong> Dramatisierung eine Versozialwissenschaftlichung<br />
des Alltags weitgehend verantwortlich ist, dessen<br />
Lösung aber von denselben Sozialwissenschaften der Sache nach nicht angeboten<br />
werden kann, wenn auch häufig genug suggeriert worden ist.<br />
In diesem Zusammenhang bildet die in den letzten Jahren besonders in<br />
den akademisch gebildeten Schichten häufig verneh<strong>mb</strong>are Argumentation,<br />
man könne doch im Angesicht der ökologischen <strong>und</strong> militärischen Bedrohungen<br />
der Zukunft es nicht verantworten, Kinder in die Welt zu setzen,<br />
eine interessante <strong>und</strong> instruktive Erscheinung. Die Vergegenwärtigung allgemeiner<br />
Zukunftsprobleme bei privaten Entscheidungen bedeutet zunächst<br />
einmal eine Steigerung der Begründungs- <strong>und</strong> Rationalitätsverpflichtung<br />
<strong>und</strong> wird subjektiv auch als solche empf<strong>und</strong>en <strong>und</strong> als Vermeidung einer<br />
dumpf über einen kommenden Schicksalhaftigkeit ausgegeben. Aber die<br />
moralische Figur, die daraus gemacht wird, verweist zugleich auf eine selbsttechnokratisierende<br />
Verweigerung der strukturellen Dialektik von Lebenspraxis<br />
auf Seiten einer <strong>gesellschaftliche</strong>n Gruppierung, die sich als Aufklärungsavantgarde<br />
zumeist empfindet. Denn faktisch läuft diese Begründung<br />
auf eine omnipotente, unerwachsene <strong>und</strong> selbst-entmündigende Verweigerung<br />
von Lebenspraxis insgesamt hinaus, nicht auf eine spezifische, besondere<br />
Rationalität für sich in Anspruch nehmende Entscheidung innerhalb<br />
der Lebenspraxis.<br />
Dies läßt sich leicht erkennen, wenn man die Implikationen des Beispielarguments<br />
gegen die Zeugung von Nachkommen sich klar macht. Selbst<br />
wenn die antizipierbaren Zukunftsprobleme eines würdigen Lebens als<br />
schier unlösbar erscheinen sollten, dann behält diese Erwartung doch immer<br />
den Charakter einer falsifizierbaren Prognose. Jede andere Interpretation<br />
liefe — lebenspraktisch gesehen — auf omnipotenten, die reale Entfaltung<br />
von Geschichte stillstellenden Dogmatismus hinaus. Im Unterschied zu<br />
naturwissenschaftlichen Gegenstandsbereichen können gesellschaftswissenschaftliche<br />
Prognosen nicht nur dadurch falsifiziert werden, daß sie bei<br />
invariant bleibender Struktur des Gegenstandes sich als tatsächlich falsch<br />
erweisen, sondern daß sie, obwohl für eine bestimmte historische Entwicklungsphase<br />
durchaus empirisch triftig, durch die reale historische Entwicklung<br />
im Gegenstandsbereich selbst widerlegt werden oder veralten. Zu dieser<br />
realen historischen Entwicklung bedarf es aber der Nachkommen, die<br />
sich der Offenheit einer zukünftigen <strong>gesellschaftliche</strong>n Praxis stellen <strong>und</strong><br />
problemlösend materiale Rationalität sachlich herstellen. Generalisierte<br />
man nun das besagte Argument gegen Nachkommen zu einer ethischen<br />
Maxime, deren Charakter es ja prinzipiell für sich in Anspruch nimmt, dann<br />
liefe dessen Handlungsfolge darauf hinaus, der zukünftigen Lebenspraxis<br />
das Personal zu entziehen <strong>und</strong> sie damit als solche abzuschaffen.<br />
Diese Diagnose gilt allerdings nur, wenn in einer Familie entsprechend<br />
argumentiert wird, ohne daß der abstrakten wissenschaftlichen Prognose als<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Begründungsargument in den konkreten Lebensumständen etwas entspräche.<br />
Ganz anders liegen die Dinge, wenn etwa mit Verweis auf die voraussehbare<br />
Inbetriebnahme eines Kernkraftwerkes in der Nachbarschaft <strong>und</strong><br />
den voraussehbaren Zwang, am Ort bleiben zu müssen, mit Verweis auf<br />
konkrete Bedingungen der eigenen Lebenspraxis also, eine Entscheidung<br />
gegen Nachkommen begründet wird. Im letzteren Fall läge eine Entscheidung<br />
vor, die innerhalb der Lebenspraxis in ihrer konkreten Ausformung<br />
vollzogen worden ist, im ersteren Falle eine durch Versozialwissenschaftlichung<br />
verbrämte Vermeidung der Lebenspraxis selbst.<br />
Diese Vermeidung von Lebenspraxis scheint im Kern hinter den viel<br />
berufenen <strong>und</strong> beschworenen, in der Regel kulturkritisch verkürzt interpretierten<br />
Formen von Leistungsverweigerung, Motivationsverlust <strong>und</strong> Aussteigertum<br />
zu stecken. Auch auf die zweite erwähnte elementare lebenspraktische<br />
Frage: Soll ich eine bestimmte Person heiraten oder nicht, werden<br />
ähnliche, Lebenspraxis vermeidende Antworten, im Bezugsrahmen dieser<br />
aktuellen selbst-technokratisierenden Identitätsformation gegeben. Die<br />
Verwendung des Wortes „Beziehung" verweist darauf. Wenn es heißt „ich<br />
komme gerade aus meiner Beziehung" oder „ich habe Beziehungsprobleme",<br />
dann kommt darin zum Ausdruck, daß man in der Betrachtung dieser<br />
Probleme eine Versozialwissenschaftlichung schon vorgenommen hat. Der<br />
besondere, individuierte Charakter der diffusen Beziehung zu einer bestimmten,<br />
unverwechselbaren <strong>und</strong> unvertretbaren Person ist darin schon<br />
aufgelöst, die Struktur einer Inti<strong>mb</strong>eziehung als solche also schon aufgegeben<br />
worden. Übrig bleibt nur noch das, was allein einer wissenschaftlichen<br />
Betrachtung des Problems zugänglich wäre: nämlich genau der allgemeine,<br />
strukturelle Charakter solcher Beziehungen, wie er sich unabhängig von den<br />
lebenspraktisch konkret gegebenen Personen formulieren läßt. Man glaubt<br />
offensichtlich, durch objektivierende wissenschaftliche Betrachtung aufgeklärt<br />
die lebenspraktischen Entscheidungsprobleme bewältigen zu können<br />
<strong>und</strong> bemerkt nicht, daß man sie als lebenspraktische durch Reduktion auf<br />
wissenschaftliche Problemlösung gerade umgeht.<br />
Ganz ähnliche Phänomene ließen sich für die Bewältigung von Erziehungsproblemen<br />
in der Familie anführen, aber auch für Fragen, die in den<br />
dramatischen Grenzbezirken der Lebensbewältigung, also im Hinblick auf<br />
Krankheit <strong>und</strong> Tod, entstehen.<br />
Die Explikation des Argumentes von der widersprüchlichen strukturellen<br />
Einheit der Lebenspraxis soll nun hier keinesfalls den Anschein einer<br />
quasi-evolutionstheoretischen Argumentation erwecken, sondern die Abbildungsfolie<br />
für Erscheinungen abgeben, die sich, bei allen sonstigen inhaltlichen<br />
Differenzen, in verschiedenen Bereichen der Identitätsformation der<br />
gut ausgebildeten, jüngeren, sich als Aufklärungsavantgarde verstehenden<br />
Generation der Gegenwart auf die Figur einer bestimmten Identitäts- oder<br />
Selbstbildinformation bringen lassen, die ihrerseits eine durch Versozialwissenschaftlichung<br />
der Alltagserfahrung wesentlich angeleitete Reaktion auf<br />
die strukturell bedingte Gegenwartsprägung der allgemeinen strukturel-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
len Dialektik von Entscheidungs- <strong>und</strong> Begründungszwang darstellt, <strong>und</strong> die<br />
die Paradoxie von subjektiver Avantgarde <strong>und</strong> objektiver Regression qua<br />
Autonomie-Verweigerung als etwas historisch Neues hat entstehen lassen.<br />
Bevor an exemplarischen Datenmaterialien diese Figur näher bestimmt<br />
<strong>und</strong> belegt werden kann, soll sie zusammenfassend allgemein bezeichnet<br />
werden. Es ist eine Identitätsfiguration, die eingespannt zu sehen ist in die<br />
historische Ausdifferenzierung des dialektischen Verhältnisses von Individuum<br />
<strong>und</strong> Gesellschaft. Man gewinnt den Eindruck, daß in der industriellen<br />
Gegenwartsgesellschaft dieser dialektische Bogen bis zum Zerreißen gespannt<br />
ist <strong>und</strong> zunehmend subjektiv nicht mehr in Spannung gehalten werden<br />
kann, weil unter dieser Dialektik das zur Autonomie verurteilte Subjekt<br />
sich überfordert fühlt. Es geht der widersprüchlichen Einheit von Begründungs-<br />
<strong>und</strong> Entscheidungszwang dadurch aus dem Wege, daß es einerseits<br />
die fortgeschrittensten Erkenntnisse für die Begründung der eigenen Lebensführung<br />
in Anspruch nimmt, andererseits aber damit gerade die Vermeidung<br />
von Entscheidungsverpflichtungen begründet, die sich aus dem Bezug zum<br />
öffentlichen Wohl der <strong>gesellschaftliche</strong>n Praxis ergeben, deren Mitglied man<br />
ist. Während auf der einen Seite fast grenzenlos die eigene Lebenspraxis<br />
unter den anspruchsvollen Rationalitätsanspruch der modernen Sozialwissenschaften<br />
gestellt <strong>und</strong> universalisiert wird, wird auf der anderen Seite im<br />
proportionalen Verhältnis dazu die Verbindung der eigenen Lebenspraxis<br />
zur <strong>gesellschaftliche</strong>n Praxis der Gegenwart aufgekündigt <strong>und</strong> jene partikularisiert.<br />
Auf diese Weise wird die widersprüchliche Einheit als solche zerrissen.<br />
Die versozialwissenschaftlichte, in einer Flut von wohlfeilen Paperbacks<br />
unter die Leute gebrachte Argumentation wird wörtlich, als Lebenshilfe,<br />
als die sie zumeist auch angepriesen ist, auf die eigene Lebenspraxis angewendet<br />
<strong>und</strong> die unauflöslichen Folgen dieses Kategorienfehlers, in dem die<br />
Komplexität <strong>und</strong> Zukunftsoffenheit des konkreten Lebens überspielt ist,<br />
werden in der Affirmation von weiterführenden Antworten, die sich zugleich<br />
in der Form der sozialwissenschaftlichen Terminologie kritisch geben<br />
können, verdrängt, indem deren praktischer Anwendungsbereich auf die<br />
insulierte soziale Existenz einer „Szene", einer „WG" einer „Arbeitsgemeinschaft"<br />
oder irgendeiner anderen primärgruppenhaften privaten Existenzform<br />
beschränkt wird. Dadurch sind die aus der <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Existenz der eigenen Lebenspraxis resultierenden Problemstellungen von<br />
vornherein entschärft. In dieser Zurichtung <strong>und</strong> Selektivität des Anwendungsbereichs<br />
der überlegenen Begründungsmoral können alle jene lebenspraktischen<br />
Entscheidungsprobleme, die, würden sie nicht verdrängt oder<br />
beiseitegeschoben, als im Rahmen der Moral nicht lösbar erkannt werden<br />
müßten, der umgebenden Gesellschaft angelastet werden. Wo die wörtlich<br />
genommene Begründungsmoral versagen <strong>und</strong> die lebenspraktisch in ihrem<br />
Namen vollzogene Entscheidung im Hinblick auf ihre Folge verantwortet<br />
werden müßte, steht zur Verdrängung dieses Folgeproblems die elitäre<br />
Abgrenzung zur umgebenden „unaufgeklärten" Gesellschaft zur Verfügung,<br />
deren Praxis man sich im Besitz der besseren Argumentation nur entziehen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
kann. Wo Zweifel an der eigenen Lebensführung aufkommen könnten, ist<br />
der mechanisch verwendbare Hinweis auf die „<strong>gesellschaftliche</strong> Bedingtheit"<br />
des eigenen Verhaltens schon bereitgestellt, in deren Namen Verantwortlichkeit<br />
beliebig aufgekündigt werden kann, ohne daß daraus ein moralischer<br />
Zweifel entstehen könnte. Denn die Konsistenz <strong>und</strong> Integrität der<br />
Moral wird ja zugleich hinreichend durch die beziehungsdynamische Virtuosität<br />
<strong>und</strong> überlegene Rücksichtnahme in der überschaubaren Binnenszene<br />
unter Beweis gestellt.<br />
Daraus resultiert das widersprüchliche Bild einer aufgeklärten Generation,<br />
die einerseits in der eigenen Binnenkultur von Inti<strong>mb</strong>eziehungen,<br />
Fre<strong>und</strong>schaften <strong>und</strong> Gesinnungsgemeinschaften in gesteigerter moralischer<br />
Sensibilität <strong>und</strong> Rücksichtnahme lebt, andererseits den zur eigenen Lebenspraxis<br />
konstitutiv gehörenden Gemeinwohlbezug zur eigenen Gesellschaft<br />
<strong>und</strong> die sich daraus ergebenden Rationalitätsverpflichtungen vergleichsweise<br />
leichthändig aufkündigen kann. Die auf der einen Seite gesteigert zum<br />
Ausdruck kommende Individuierung wird auf der anderen Seite durch<br />
Flucht <strong>und</strong> Verweigerung regressiv hintergangen.<br />
Diesem Riß im Spannungsverhältnis von Individuum <strong>und</strong> Gesellschaft<br />
korrespondiert ein Riß in der Präsentation des Subjekts selbst. Hier steht<br />
nämlich, so das zentrale Element in der hier vertretenen Typologie einer<br />
Identitätsformation der Gegenwart, einer gesteigert sensibilisierten, aber auf<br />
passive Rezeption regredierten Komponente des Selbst, das permanent „betroffen"<br />
ist, eine versozialwissenschaftlichte Selbstwahrnehmungskomponente<br />
unvermittelt gegenüber, die im begrifflichen Bezugsrahmen sozialwissenschaftiicher<br />
Theorien sich ganz kühl <strong>und</strong> distanziert über das Selbst<br />
beobachtend beugt, es als „betroffen" registriert <strong>und</strong> daraus seine theoriegeleiteten<br />
Schlüsse zieht. In diesem Auseinanderfallen der strukturellen Dialektik<br />
des autonomen Subjekts erscheint die Gesellschaft nicht mehr primär<br />
als das, woran man wesentlich über den sozialen Prozeß der eigenen Bildungsgeschichte<br />
Anteil hat <strong>und</strong> woran man über die praktische Übernahme<br />
der Verpflichtung zur Einlösung des so gebildeten Vermögens, nicht zuletzt<br />
in der Form der begründeten Kritik von Gesellschaft, weiterhin Anteil<br />
nimmt, sondern verdinglicht als etwas, was dem sensibilisierten Betroffenheits-Selbst<br />
gegenüber nur noch als Quelle von Betroffenheit erscheint.*<br />
* Diese Ausführungen sind die Einleitung zu einer Reihe von empirischen Fallanalysen<br />
auf der Datenbasis von verschrifteten qualitativen Tonband-Interviews. Diese Fälle<br />
bilden auf den Ebenen von Persönlichkeitsstruktur <strong>und</strong> sozialer Herkunft zwar deutliche<br />
Kontraste, weisen aber trotz aller Heterogenität gemeinsam die Zugehörigkeit<br />
zu dem Typ einer selbst-technokratisierend versozialwissenschaftlichten Identitätsformation<br />
mehr oder weniger deutlich auf. Aus Platzgründen kann hier keine der Fallanalysen<br />
exemplarisch abgedruckt werden. Bei der Einschätzung der empirischen<br />
Triftigkeit des vorgestellten Modells ist zu berücksichtigen, daß es letzlich erst „in der<br />
Sprache des Falles", d.h. im materialaufschließenden Nachweis, Gültigkeit beanspruchen<br />
kann. Aus solchen Materialanalysen ist es hervorgegangen, nicht aus von der<br />
Sachanalyse abgetrennten theoretischen Reflexionen. Dennoch handelt es sich um<br />
nicht mehr als ein heuristisches Modell, dessen Wert sich primär sowohl an der geeigneten<br />
Vorstrukturierung als auch an der Struktur generalisierenden Kraft von konkreten<br />
Fallrekonstruktionen zu erweisen hat.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
BEMERKUNGEN ZU GESELLSCHAFTSSTRUKTUR, BEWUSSTSEINSFO<br />
Thomas<br />
Luckmann<br />
Zuallererst eine kurze Erläuterung der im Titel verwendeten Begriffe:<br />
Unter „Gesellschaftsstruktur" verstehe ich ein System — oder die Annäherung<br />
an ein System — von Handlungsregulierungen, von Institutionen.<br />
Unter „Bewußtsein" verstehe ich das, was subjektive Erfahrungen konstituiert<br />
— also Bewußtseinsleistungen —, <strong>und</strong> das, was sich in subjektiven<br />
Erfahrungsverläufen konstituiert — also Bewußtseinsgegenstände. Die konkrete<br />
empirische Organisation der Bewußtseinsgegenstände <strong>und</strong> ihre Zuordnung<br />
zu einem Subjekt <strong>und</strong> die Prägung des Subjekts zur persönlichen<br />
Identität sind <strong>gesellschaftliche</strong> <strong>und</strong> daher geschichtliche Konstruktionen.<br />
Unter Religion verstehe ich jenen Kern der <strong>gesellschaftliche</strong>n Organisation<br />
des Bewußtseins, der sich ausdrücklich auf vor allem außeralltägliche<br />
Erfahrungstranszendenzen bezieht.<br />
Eine Bemerkung zu meinen Annahmen über das Verhältnis von Gesellschaftsstruktur<br />
<strong>und</strong> Bewußtsein. Daß das menschliche Leben <strong>und</strong> die individuelle<br />
Orientierung in der Welt 'mehr oder weniger' unmittelbar <strong>und</strong><br />
'mehr oder weniger' durchgängig von der Gesellschaftsstruktur bestimmt<br />
wird, ist eine allgemeine soziologische — <strong>und</strong> auch meine — Gr<strong>und</strong>annahme.<br />
Max Weber folgend, ziehe ich jedoch die Möglichkeit in Betracht, daß die<br />
Bestimmung der historischen Veränderungen im menschlichen Leben durch<br />
sozialstrukturelle Faktoren nicht unbegrenzt ist. Ich gehe also von der zusätzlichen<br />
Annahme aus, daß sowohl das Maß als auch die Unmittelbarkeit<br />
der strukturellen Determination des menschlichen Lebens selbst historischen<br />
Wandlungen unterworfen sind. Damit bin ich bei der Frage angelangt,<br />
die ich in meinem Beitrag angehen möchte. Was sind die <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Bedingungen der Religion — als Modell der Bewußtseinsorganisation — in<br />
modernen Industriegesellschaften?<br />
Es ist ratsam, zuerst zu fragen, ob an der Religion in der modernen<br />
Industriegesellschaft überhaupt etwas spezifisch neu ist. Kann man allgemeine<br />
Bedingungen für die religiöse Organisation des Bewußtseins in jeder Gesellschaft,<br />
einerlei, ob modern oder nicht, angeben?<br />
Die f<strong>und</strong>amentale Bedingung der Religion in allen Gesellschaften besteht<br />
im Verhältnis einer <strong>gesellschaftliche</strong>n Ordnung zu den Einzelorganismen<br />
der Gattung, die erst zu Personen werden, indem sie in der jeweiligen,<br />
historisch einzigartigen <strong>gesellschaftliche</strong>n Ordnung aufwachsen. Das Bestehen<br />
einer solchen Beziehung kann als anthropologische Konstante angesehen<br />
werden, die besondere Art dieser Beziehung variiert jedoch historisch,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
wenn auch innerhalb fester Grenzen. Diese sind vorgegeben, erstens, durch<br />
die gr<strong>und</strong>legenden Merkmale des menschlichen Bewußtseins <strong>und</strong>, zweitens,<br />
durch allgemeine Merkmale der menschlichen Gesellschaftsorganisation. Die<br />
elementaren Strukturen des menschlichen Bewußtseins <strong>und</strong> der <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Organisation haben sich phylogenetisch entwickelt <strong>und</strong> tragen noch<br />
immer deutliche Züge unserer Säugetier- <strong>und</strong> Primaten-Ahnenherrschaft.<br />
Die menschlichen Gesellschaftsstrukturen haben sich jedoch zu einem<br />
erheblichen Maß von den phylogenetischen Beschränkungen frei gemacht<br />
<strong>und</strong> stellen geschichtliche, nicht natürliche Strukturen dar; sie bestehen aus<br />
den zusammengesetzten Ergebnissen individuellen <strong>und</strong> kollektiven menschlichen<br />
Handelns, nicht aus genetisch vorprogrammiertem Verhalten. Da<br />
Handlungen durch das Bewußtsein motiviert <strong>und</strong> bestimmt werden, können<br />
<strong>gesellschaftliche</strong> Strukturen, als Handlungsfolgen, auch als eine „objektive"<br />
Ablagerung des „subjektiven" Bewußtseins angesehen werden. Aber da <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Strukturen in Handlungen nicht als solche intendiert werden,<br />
können diese „objektiven" Ablagerungen auch als Produkt der überindividuellen<br />
Ironie der Geschichte betrachtet werden. Wie dem auch immer sei,<br />
die gr<strong>und</strong>sätzliche <strong>gesellschaftliche</strong> Bedingung der Religion ist die Beziehung<br />
der Menschen zu den historischen Ergebnissen <strong>und</strong> Folgen menschlicher<br />
Handlungen. Ist es möglich, systematische Veränderungen dieser Beziehung<br />
zu erkennen?<br />
Der Übergang von primitiven <strong>und</strong> archaischen zu traditionalen (antiken<br />
<strong>und</strong> feudalen) Gesellschaften stellt gewiß eine solche gr<strong>und</strong>legende Veränderung<br />
dar. Diese wurde im allgemeinen von einer Verlagerung von Stammes-<br />
zu „universalistischen" Religionen begleitet. Die hier interessierende<br />
Veränderung ist jedoch diejenige von traditionalen zu modernen Gesellschaften<br />
<strong>und</strong> dann von frühneuzeitlichen zu industriell-bürokratischen Gesellschaften.<br />
Zu dieser Veränderung gehört die Subjektivierung der persönlichen<br />
Existenz <strong>und</strong> die Privatisierung der Religion <strong>und</strong> der Bewußtseinsorganisation.<br />
Um die Gründe für die Privatisierung des individuellen Lebens während<br />
der letzten Generationen verstehen zu können, müssen die sozialpsychologischen<br />
Folgen des allgemeinen sozialen Wandels, der in der Entstehung der<br />
modernen Industriegesellschaften mündete, in Betracht gezogen werden.<br />
Seit unseren soziologischen Großvätern <strong>und</strong> Vätern sind uns die Gr<strong>und</strong>züge<br />
dieser Entwicklung wohl bekannt, obwohl sie schon von ihnen sehr unterschiedlich<br />
gedeutet <strong>und</strong> bewertet wurden. Weniger gut erfaßt sind jedoch<br />
die Auswirkungen dieser strukturellen Veränderungen auf das Alltagsleben<br />
der Menschen. Zwar haben Marx' Begriff der Entfremdung, Durkheims<br />
Begriff der Anomie <strong>und</strong> der Webersche Begriff der Rationalisierung einiges<br />
Licht auf manche Folgen der strukturellen Veränderungen geworfen.<br />
Doch haften diesen Begriffen Mängel an, wenn man sie zur Erfassung der<br />
subjektiven Korrelate moderner Gesellschaftsstrukturen verwendet. Um diese<br />
zu erfassen, werde ich hauptsächlich von Gehlen borgen <strong>und</strong> beginne mit<br />
einer ersten Skizze, die kaum Unbekanntes enhält.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Die sozialstrukturellen Determinanten der typischen, spezifisch 'modernen'<br />
Bewußtseinsorganisation sind das Ergebnis der Differenzierung der Gesellschaftsstruktur<br />
<strong>und</strong> der funktionalen Spezialisierung der Institutionen in<br />
einem einzigartigen historischen Prozeß. Von den Anfängen des modernen<br />
Kapitalismus an hat die sich ausgrenzende Wirtschaft die Entwicklung<br />
angeführt, ohne dabei zunächst die institutionalisierte Religion als Kern<br />
der <strong>gesellschaftliche</strong>n Bewußtseinsorganisation abzulösen. Von besonderer<br />
Bedeutung ist hier natürlich die institutionelle Spezialisierung — <strong>und</strong> die<br />
damit verb<strong>und</strong>ene bürokratische Organisation der Religion.<br />
Die wichtigsten kulturellen Faktoren bei der Formung des individuellen<br />
Bewußtseins in der modernen Gesellschaft bestehen in der Abschwächung<br />
des inneren Zusammenhangs der Wirklichkeitskonstruktionen <strong>und</strong> der Ausbreitung<br />
des sogenannten „Pluralismus". Der letztere ist durch die Ersetzung<br />
eines hierarchischen Prinzips der Organisation der Kultur durch Marktprinzipien<br />
gekennzeichnet.<br />
Nach dieser vorgeschobenen groben Skizze zurück zum Ausgangspunkt.<br />
Die sozialen Bedingungen, die am engsten mit der Organisation des Bewußtseins<br />
in der Moderne verb<strong>und</strong>en sind, leiten sich vom hohen Grad der funktionalen<br />
Spezialisierung <strong>gesellschaftliche</strong>n Handelns in modernen Industriegesellschaften<br />
ab. Dies kontrastiert mit anderen Gr<strong>und</strong>typen <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Organisation.<br />
Die Institutionen des <strong>gesellschaftliche</strong>n Lebens sind in archaischen Gesellschaften<br />
nicht spezialisiert. Institutionalisierte Handlungen verschmelzen<br />
mit dem gesamten <strong>gesellschaftliche</strong>n Leben der Gemeinschaft, <strong>und</strong> sie erfüllen<br />
mehrere Funktionen zugleich, Ökonomische, verwandtschaftliche,<br />
politische <strong>und</strong> religiöse Funktionen bilden die verschiedenen Dimensionen<br />
sozialer Handlungen, die zwar nicht in ihrer Funktion, wohl aber ihrem<br />
Sinn nach für die Handelnden einheitlich sind. In den modernen Industriegesellschaften<br />
sind die Funktionen dagegen viel schärfer voneinander getrennt,<br />
<strong>und</strong> die funktionalen Subsysteme folgen ihren eigenen „zweckrationalen"<br />
Normen. Für Rollenhandeln in ihnen wird eine pragmatische<br />
Orientierung an (unbefragten) Zielen entwickelt <strong>und</strong> mit einer bürokratischen<br />
Organisation der Mittel verb<strong>und</strong>en. Die „zweckhaften Rationalitäten"<br />
des einen Bereichs decken sich nicht einfach mit den „zweckhaften<br />
Rationalitäten" eines anderen. Die Normen sind nicht von Bereich zu Bereich<br />
übertragbar, um eine durchgehende Lebensführung zu orientieren. Die<br />
Sinnsysteme der Institutionen sind auf anonyme Funktionen <strong>und</strong> nicht<br />
einmal entfernt auf Personen bezogen. Die Normen der nicht-religiösen<br />
Institutionsbereiche entbehren jeder übergreifenden religiösen Bedeutung.<br />
Die institutionelle Spezialisierung der Religion war Teil eines umfassenden<br />
sozialen Wandels <strong>und</strong> kam nicht unabhängig, etwa als Folge eines endogenen<br />
religiösen Prozesses, zustande. Man muß bedenken, daß eine religiöse<br />
„Logik" die beherrschende oder die wenigstens rhetorisch beherrschende<br />
„Logik" aller Institutionen in archaischen, traditionellen <strong>und</strong>, in abnehmendem<br />
Maße, früher moderner Gesellschaften bildete. In den modernen Indu-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Striegeseilschaften liegen die Dinge völlig anders. Die zunehmende Komplexität<br />
der Arbeitsteilung, die Produktion eines Überschusses über das<br />
Subsistenzminimum hinaus, das Anwachsen gemeinschafts- <strong>und</strong> stammesübergreifender<br />
politischer Organisationen, die Ausbildung differenzierter<br />
Berufsrollen <strong>und</strong> die Bildung potentiell oder tatsächlich miteinander in<br />
Konflikt stehender sozialer Klassen, all diese Entwicklungen waren mit der<br />
funktionalen Differenzierung verb<strong>und</strong>en, lange bevor moderne Industriegesellschaften<br />
auf der Bildfläche erschienen. Doch die „Logik" einer<br />
sakralen Wirklichkeit stützte <strong>und</strong> legitimierte noch weiterhin zugleich die<br />
gesamte Gesellschaftsordnung <strong>und</strong> die <strong>gesellschaftliche</strong> Organisation des<br />
Bewußtseins. Die sakrale „Logik" diente zudem — mehr oder weniger erfolgreich<br />
— dazu, den Sinn der unterschiedlichsten Handlungen miteinander<br />
zu verknüpfen: Handlungen, die sich in ihren „objektiven" Funktionen<br />
stark voneinander unterscheiden, waren für den einzelnen immer noch sinnvoll,<br />
<strong>und</strong> der Sinn des individuellen Lebens stand in Beziehung zu dem<br />
Leben der Gemeinschaft.<br />
In den modernen Industriegesellschaften sind die ökonomischen <strong>und</strong><br />
politischen Aspekte des Einzeldaseins unmittelbar mit den „großen" funktional<br />
spezialisierten Bereichen des <strong>gesellschaftliche</strong>n Lebens verb<strong>und</strong>en.<br />
Große Teile des Lebens eines Individuums, vor allem seine berufliche Existenz,<br />
werden von den „objektiven" Erfordernissen der institutionellen<br />
Funktion <strong>und</strong> bürokratischen Organisation bestimmt. Hochgradig spezialisierte<br />
ökonomische <strong>und</strong> politische Institutionen scheinen derart den Charakter<br />
einer „zweiten Natur" oder eines „eisernen Käfigs", eines „Systems"<br />
anzunehmen. *<br />
Die funktionale Spezialisierung der Institutionen, welche die Sozialstruktur<br />
moderner Industriegesellschaften charakterisiert, zieht typische<br />
subjektive Folgen nach sich. Anonym definierte Rollenverrichtungen setzen<br />
sich im Berufsleben der Mehrheit der Bevölkerung durch. Die Rollenverrichtungen<br />
sind gemäß der funktionalen „Logik" der institutionellen Bereiche<br />
bestimmt <strong>und</strong> deshalb austauschbar. Diese Logik in andere Lebensbereiche<br />
zu übertragen, ist kaum möglich, <strong>und</strong> nur wenigen Menschen gelingt<br />
es ohne weiteres, die „objektiv" bestimmten Aspekte ihres Alltagslebens in<br />
eine sinnvolle Ordnung in ihre Biographie einzugliedern.<br />
Anonyme Verrichtungen, die wesentliche Ausschnitte der Einzelexistenz<br />
ausmachen, sind für die modernen Gesellschaftsordnungen zentral.<br />
Aber sie verlieren oft ihre eigentliche Bedeutung für das Individuum. Rollenverrichtungen<br />
sind natürlich in allen Gesellschaften „funktional". Aber<br />
das außerordentlich hohe Maß an Anonymität, das viele, wenn nicht sogar<br />
alle funktional notwendigen sozialen Handlungen auszeichnet, kommt<br />
allein in modernen Industriegesellschaften vor. Dieser Tatbestand bildet die<br />
strukturelle Gr<strong>und</strong>lage für das, was an Religion <strong>und</strong> der Organisation des<br />
Bewußtseins in unserer Zeit eigentümlich modern ist.<br />
Die institutionelle Spezialisierung der Religion hat bestimmte strukturelle<br />
Voraussetzungen. Die Religion wird auf einen institutionellen Bereich<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
in solchen Gesellschaften eingeengt, die schon einen hohen Grad an struktureller<br />
Komplexität, ökonomischer <strong>und</strong> politischer Differenzierung erreicht<br />
haben. In diesen Gesellschaften können religiöse Normen <strong>und</strong> Orientierungen<br />
nicht so erfolgreich <strong>und</strong> allgemein vermittelt werden, wie mythisch-religiöse<br />
Weltsichten in archaischen Gesellschaften vermittelt werden<br />
konnten. In Gesellschaften, die ein bestimmtes Maß an struktureller Komplexität<br />
überschritten haben, kann eine bestimmte religiöse Wirklichkeitskonstruktion<br />
nicht mehr allgemeine Verbindlichkeit beanspruchen bzw.<br />
durchsetzen. Eine religiös homogene Gesellschaft mit einer verbindlichen<br />
Organisation des Bewußtseins bedarf einer hochgradig integrierten Gesellschaftsstruktur,<br />
die beinahe ausschließlich auf unmittelbare Sozialbeziehungen<br />
gegründet ist. Ihr Fortbestand setzt verhältnismäßig gleichartige<br />
Sozialisationsprozesse voraus.<br />
Während des größten Teils der Menschheitsgeschichte waren diese<br />
Bedingungen wenigstens annähernd erfüllt. Die gesamte Gesellschaftsstruktur<br />
stützte eine sakrale Wirklichkeit, während der sakrale Kosmos<br />
die gesamte Gesellschaftsstruktur legitimierte. Religiöse Repräsentationen<br />
durchdrangen in archaischen Gesellschaften die verschiedensten Institutionen,<br />
aber schon in etwas komplexeren Gesellschaften — in den frühen<br />
Hochkulturen wie schon in etwas „einfacheren" Stammeskönigtümern —<br />
entfaltete der sakrale Kern der Wirklichkeitskonstruktion eine starke<br />
Verbindung zu bestimmten Institutionen, besonders zur Herrschaftsorganisation.<br />
Die religiöse Institutionalisierung der Religion aber veränderte das<br />
Verhältnis von heiligem Kosmos <strong>und</strong> Sozialstruktur gr<strong>und</strong>legend. Eine besondere<br />
Art von Institution übernahm es, den sakralen Kern der Wirklichkeitskonstruktion<br />
aufrechtzuerhalten <strong>und</strong> zu vermitteln. Die Religion nahm<br />
einen klar bestimmten <strong>und</strong> begrenzten Raum der Sozialstruktur ein.<br />
Die institutionelle Spezialisierung der Religion war eine vorwiegend<br />
auf den Westen beschränkte Entwicklung. Sie entstand unter eigentümlichen<br />
Bedingungen. Während einer erstaunlich langen Vorphase der Entwicklung<br />
der modernen Industriegesellschaften war die institutionelle<br />
Spezialisierung der Religion mit etwas verknüpft, das einer allgemeinen<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>n Verbreitung der institutionell spezialisierten Religion<br />
verhältnismäßig nahe kam.<br />
Als das weströmische Reich zerfiel, hatte das Christentum schon<br />
einen hohen Grad an institutioneller Spezialisierung erreicht. Den Hintergr<strong>und</strong><br />
des Christentums bildeten der stark ausgesonderte sakrale Kosmos<br />
des Alten Israel, daneben eine noch nicht dagewesene Entmythologisierung<br />
<strong>und</strong> Entpersönlichung der Natur <strong>und</strong> eine beginnende Sakralisierung der<br />
individuellen — wenn nicht privatisierten — Beziehung zur Transzendenz.<br />
Dazu kam der hellenistische <strong>und</strong> spätrömische Pluralismus der Weltsichten.<br />
Religiöse Sondergemeinschaften sprossen aus dem Boden. Auch die politischen<br />
<strong>und</strong> ökonomischen Institutionen hatten eine beträchtliche funktionale<br />
Selbständigkeit erlangt. In der Nach-Konstantinischen Epoche wurde<br />
das Christentum nicht nur von herausragenden theologischen Experten, die<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
die Lehre systematisierten <strong>und</strong> das Ritual vereinheitlichten, gefestigt, sondern<br />
auch von fähigen Verwaltungsspezialisten. Darauf folgte eine Phase,<br />
die durch die Entdifferenzierung der Gesellschaftsordnung gekennzeichnet<br />
war. Während des ganzen Frühmittelalters entwickelte sich die Wirtschaft<br />
auf eine einfachere Organisationsebene zurück, <strong>und</strong> die Politik nahm zunächst<br />
wieder Stammescharakter an. Die organisatorische Basis des christlichen<br />
heiligen Kosmos blieb jedoch weiterhin institutionell spezialisiert.<br />
Kurzum: Religion behielt einen hohen Grad institutioneller Spezialisierung<br />
bei, während der politische <strong>und</strong> ökonomische Bereich seine funktionelle<br />
Autonomie noch nicht zurückgewonnen hatte. Diese einzigartige Ubergangssituation<br />
erklärt das strukturell sozusagen 'unwahrscheinliche' Schicksal<br />
des Christentums als einer institutionell spezialisierten <strong>und</strong> gesellschaftlich<br />
(beinahe) universalen Religion in den Gesellschaften des europäischen<br />
Mittelalters. In verschiedenen Säkularisierungstheorien wurde diese Konstellation<br />
übrigens als eine fast naturwüchsige Verbindung von Gesellschaft <strong>und</strong><br />
Religion verkannt.<br />
Das Gegenteil sollte langsam unter Beweis gestellt werden. Kompetenzstreitigkeiten<br />
(z.B. über Investitur, Wucher) zwischen Staat, Religion <strong>und</strong><br />
dem entstehenden Kapitalismus kennzeichnen die Übergangsphase vom Mittelalter<br />
zur Neuzeit. Die Verselbständigung der Macht im Staat <strong>und</strong> der<br />
Aufstieg absolutistischer Staaten mit zentralistischen Verwaltungsapparaten,<br />
das Wachstum der Städte, der Kontakt mit fremden Kulturen, besonders<br />
mit dem Islam, die „Wiederentdeckung" antiker Wissenssysteme während<br />
der Renaissance, die eigentümlich abendländische technologische Nähe<br />
<strong>und</strong> Anwendung der Wissenschaft, all das veränderte die Gr<strong>und</strong>strukturen<br />
der Gesellschaft. Eine der wichtigsten Folgen dieser Entwicklung war, daß<br />
die Religion zur „Ideologie" eines institutionellen Subsystems wurde. Die<br />
strukturelle Differenzierung führte dazu, daß die Kompetenz institutionalisierter<br />
Religion zunehmend auf den privaten Bereich eingegrenzt wurde.<br />
(Das eigentliche Aufkommen eines Begriffes, der unserem Verständnis von<br />
Privatheit entspricht, läßt sich natürlich erst auf die Moderne zurückdatieren.)<br />
Die Verbindung des heiligen Kosmos zum Alltag wurde entscheidend<br />
geschwächt. Die „säkularisierten" Teile der Gesellschaftsstruktur entwickelten<br />
pragmatische Normen, deren zweckrationaler Charakter die Ablösung<br />
dieser institutionellen Bereiche von den durch den traditionellen heiligen<br />
Kosmos verkörperten Werten rechtfertigte. Es entstanden zahlreiche, miteinander<br />
konkurrierende theoretisch-ideologische Systeme, jedes auf einer<br />
eigenen <strong>gesellschaftliche</strong>n Basis.<br />
Diese Entwicklung beschleunigte sich gegen Ende des 18. <strong>und</strong> im Laufe<br />
des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts. Während der traditionelle christliche heilige Kosmos<br />
aufhörte, weite Bereiche des Alltagslebens mit auch nur einigermaßen zusammenhängendem<br />
Sinn zu erfüllen, nahmen bestimmte Werte, die im politischen<br />
<strong>und</strong> ökonomischen Lebensbereich verwurzelt waren (genauer: dem<br />
sich zuspitzenden Klassenkonflikt dieser Zeit entstammten), den Charakter<br />
„sakraler" Themen an. Politische <strong>und</strong> ökonomische Ideologien wären Aus-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
druck zuerst der durchzusetzenden, später der zu verteidigenden Interessen<br />
des Bürgertums — meist in Verbindung mit dem aufkommenden Nationalismus.<br />
Später artikulierten sich die Hoffnungen des Proletariats als sakrale<br />
Themen — auch sie häufig mit nationalistischen Untertönen. Elemente dieser<br />
Ideologien verschmolzen mit den vorherrschenden religiösen Themen<br />
christlichen Ursprungs oder nahmen ihren Platz ein. Diese Entwicklung<br />
trug dazu bei, die ohnehin schon bestehende Tendenz zum kulturellen Pluralismus<br />
zu verstärken, eine Tendenz, deren Ursprung schon in den die institutionelle<br />
Spezialisierung begleitenden Kompetenz- <strong>und</strong> Abgrenzungsstreitigkeiten<br />
zu finden ist.<br />
Die Themen, welche sich auf die verschiedenen Ebenen der Transzendenz<br />
beziehen <strong>und</strong> als Balken im Gerüst der Bewußtseinsorganisation dienen,<br />
sind deshalb in den modernen Industriegesellschaften sehr vielgestaltig.<br />
Es kommen nicht nur Themen vor, die aus dem traditionellen christlichen<br />
Anliegen an jenseitigen Transzendenzen entsprangen, sondern auch solche,<br />
deren Ursprung in diesseitigen Transzendenzadressaten wie Rasse, Nation,<br />
klassenlose Gesellschaft etc. zu suchen ist. Im großen <strong>und</strong> ganzen ist es den<br />
spezialisierten Institutionen (Kirchen <strong>und</strong> Sekten) gelungen, das Monopol<br />
über die traditionellen religiösen Themen beizubehalten. Aber schon seit<br />
mehreren Generationen ist der traditionelle heilige Kosmos nicht mehr die<br />
einzige transzendente sy<strong>mb</strong>olische Wirklichkeit, die breiten Schichten der<br />
Bevölkerung gesellschaftlich vermittelt wird. Die traditionelle, institutionell<br />
spezialisierte Religion konkurriert mit Nationalismus, egalitärem Sozialismus<br />
<strong>und</strong> verschiedenen totalitären Ideologien — mit mehr oder weniger<br />
Erfolg. Auf diese Weise haben sich die Bedingungen, unter denen Modelle<br />
der Bewußtseinsorganisation produziert <strong>und</strong> verteilt werden, gr<strong>und</strong>legend<br />
geändert.<br />
Die strukturelle Konsistenz der Weltsicht, deren Funktion es ist, den<br />
sakralen Kern der Wirklichkeitskonstruktion glaubhaft mit den Routinen<br />
des Alltags zu verbinden, ist verhältnismäßig gering. Weltsichten konkurrieren<br />
untereinander über Massenmedien, Bücher, Wanderprediger, Priester<br />
<strong>und</strong> Gurus aus allen Ecken der Welt, <strong>und</strong> ausdrücklich religiöse Orientierungen<br />
konkurrieren mit Sozialisationsmodellen, die keine spezifisch religiösen<br />
Repräsentationen, wohl aber Orientierungen zu diesseitigen Transzendenzen<br />
enthalten.<br />
Daß aber der kulturelle Pluralismus <strong>und</strong> ein insgesamt loser innerer Zusammenhang<br />
von nicht-totalitären Modellen der Bewußtseinsorganisationen<br />
zu beherrschenden <strong>und</strong> beinahe durchgängigen Merkmalen des modernen<br />
Lebens wurden, ist nicht das einzige Ergebnis des sozialen Wandels. Strukturelle<br />
Veränderungen bestimmen das Verhältnis des typischen „modernen"<br />
Individuums zur <strong>gesellschaftliche</strong>n Ordnung auf viel unmittelbarere<br />
Weise <strong>und</strong> beeinflussen damit die Bewußtseinsorganisation des einzelnen.<br />
Die Werte <strong>und</strong> Orientierungen, die über das unmittelbar Gegebene<br />
hinausgehen <strong>und</strong> auf das Transzendente gerichtet sind, werden natürlich<br />
allerorten in sozialen Prozessen vermittelt, angefangen mit der Primärsozia-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
lisation des Kindes <strong>und</strong> fortgesetzt bis ins Erwachsenenalter. Aber auch hier<br />
gibt es Unterschiede. In den vormodernen Gesellschaften verstärkten sich<br />
solche Prozesse im allgemeinen gegenseitig. Somit hatte das, was ohnehin<br />
eine verhältnismäßig stimmige Wirklichkeitskonstruktion genannt werden<br />
kann, gute Aussichten, zu einem Gr<strong>und</strong>muster der Bewußtseinsorganisation<br />
zu werden <strong>und</strong> es auch zu bleiben. In modernen Industriegesellschaften<br />
werden Werte <strong>und</strong> Orientierungen in sehr unterschiedlichen <strong>und</strong> ungleichen<br />
sozialen Prozessen vermittelt. Schon in archaischen Gesellschaften variieren<br />
sie nach Geschlecht <strong>und</strong> Verwandt Schaftsstatus. In feudalen Gesellschaften<br />
waren schon die Modelle der Orientierung in der Welt durch die Theorie der<br />
feudalen Ordnung in unterschiedliche Versionen gegliedert <strong>und</strong> dementsprechend<br />
den verschiedenen Ständen vermittelt worden. In den neuzeitlichen<br />
Gesellschaften <strong>und</strong> den modernen Industriegesellschaften werden sie in<br />
strukturell, hauptsächlich ethnisch-national <strong>und</strong> klassenbedingt differenzierten<br />
Sozialisationsvarianten vermittelt. Aber moderne Industriegesellschaften<br />
zeichnen sich durch ein weiteres Merkmal aus: die Modelle der primären<br />
(familialen) Sozialisation werden nicht nachdrücklich <strong>und</strong> systematisch von<br />
einer gesamten Gesellschaftsordnung gestützt, wie es in anderen Gesellschaftstypen<br />
der Fall ist. Zwar ist das, was in der Primärsozialisation vermittelt<br />
wird, noch immer im wesentlichen durch ethnische Zugehörigkeit<br />
<strong>und</strong> Klassenlage der Familie bestimmt. Aber Faktoren wie soziale Mobilität,<br />
Migration, Verstädterung, vorwegnehmende Sozialisation, Pluralismus, Einfluß<br />
der Massenmedien u.a. schaffen eine Situation, in der selbst gr<strong>und</strong>legende<br />
Bestandteile der frühen Sozialisationsprozesse kaum nachhaltige Bestätigung<br />
in späteren sozialen Beziehungen finden.<br />
Ein bemerkenswerter Bruch zwischen der primären <strong>und</strong> der sek<strong>und</strong>ären<br />
Sozialisation ist die Folge der strukturellen Absonderung der Familie von<br />
Schule <strong>und</strong> Berufssystem. Keine Spielart der Weltsichten, kein spezifisch<br />
<strong>und</strong> traditionell religiöses Modell der Bewußtseinsorganisation, kein sonstiges<br />
Vorbild der Orientierung in der Wirklichkeit hat ein Monopol auf die<br />
sek<strong>und</strong>äre Sozialisation. Die Wahlmöglichkeiten zwischen einzelnen Bestandteilen<br />
der Modelle <strong>und</strong> die Möglichkeiten für „zufällige", individuelle<br />
synkretistische Neuverbindungen sind sehr viel größer als in anderen Gesellschaftstypen.<br />
Es sind die gleichen strukturellen Veränderungen, die zur Entstehung<br />
des kulturellen „Pluralismus" <strong>und</strong> zum Bruch zwischen primärer <strong>und</strong> sek<strong>und</strong>ärer<br />
Sozialisation führten. Der kulturelle „Pluralismus" <strong>und</strong> der Bruch<br />
zwischen den Sozialisationsprozessen begünstigen die subjektive Bricolage<br />
(religiöse Fleckerlteppichnäherei), wie man den Vorgang bezeichnen könnte,<br />
mittels dessen sich Menschen ihre Orientierung in den verschiedenen<br />
funktionell differenzierten Bereichen der Gesellschaftsstruktur schaffen.<br />
Trotz oberflächlicher Ähnlichkeiten läßt sich in traditionalen (z.B. hellenistischen)<br />
Formen des kulturellen Synkretismus nichts voll Vergleichbares<br />
zu solcher Bricolage finden. Frühere Synkretismen ließen sich im Zusammenprall<br />
unterschiedlicher kultureller Traditionen sozial verorten <strong>und</strong><br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
waren für gewöhnlich durch sozusagen „äußere" Bedingungen wie Eroberung,<br />
Wanderungen u.a. verursacht <strong>und</strong> typischerweise auf sozial Marginale<br />
beschränkt. Der moderne Synkretismus hat einen anderen, typischerweise<br />
nicht marginalen sozialen Ort: die privatisierte Sphäre des einzelnen, jener<br />
Teil seines Lebens, der für das Funktionieren der Gesellschaftsstruktur<br />
unerheblich ist.<br />
Auf eine polemisch vereinfachende Formel gebracht: In der modernen<br />
Gesellschaft spiegelt das Bewußtsein das Sein in einem (weit) geringeren<br />
Maße wider als jemals zuvor. Die Privatisierung der individuellen Existenz<br />
ist das Ergebnis eines umfassenden <strong>gesellschaftliche</strong>n Wandels. Eine merkwürdige<br />
Folge dieses Wandels ist aber, daß das Bewußtsein <strong>und</strong> die individuelle<br />
Orientierung in der Wirklichkeit weitaus schwächer gesellschaftlich<br />
geprägt werden.<br />
Die Privatisierung des individuellen Lebens in der modernen Gesellschaft<br />
ist mit den langfristigen Folgen der institutionellen Spezialisierung<br />
traditioneller Religionen verknüpft. Diese Folgen wurden allgemein unter<br />
dem Titel Säkularisierung zusammengefaßt. Sie können treffender als strukturell<br />
bestimmte Privatisierung der Religion gedeutet werden. Es geht nicht<br />
um den Schw<strong>und</strong> der Religion (oder des Christentums), weil ihre „Ideen"<br />
nicht mehr zum modernen Leben paßten oder weil sie mit Aufklärung <strong>und</strong><br />
Wissenschaft in Konflikt stünden. Die Privatisierung der Religion ist vielmehr<br />
ein Bestandteil der allgemeinen Privatisierung des individuellen Lebens.<br />
Diese strukturelle Privatisierung der Religion steht in einem „wahlverwandtschaftlichen"<br />
Verhältnis zu einer anderen, nämlich „inhaltlichen"<br />
Entwicklung der Bewußtseinsorganisation: zur Tendenz, Orientierungen,<br />
die weit über das unmittelbar Gegebene hinausgehen, von den „großen"<br />
Transzendenzen eines Jenseits auf die „mittleren" Transzendenzen des<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>n Lebens <strong>und</strong> zuweilen auf die „kleinen" Transzendenzen<br />
des Selbst zu verlagern. Traditionelle religiöse Orientierungen, d.h. Orientierungen<br />
auf eine jenseitige Wirklichkeit, sind zwar nicht verschw<strong>und</strong>en,<br />
doch ist ihre <strong>gesellschaftliche</strong> Verteilung gegenüber Orientierungswerten wie<br />
„Selbstverwirklichung" schmaler geworden. Die Kirchen sind zu Institutionen<br />
unter anderen Institutionen geworden, genau so, wie die traditionellen<br />
religiösen Orientierungen auf Gott hin mit anderen Orientierungen auf<br />
diesseitige Wirklichkeiten, wie Nation, soziale Klasse, Familie, im Wettstreit<br />
stehen.<br />
Das Wuchern verschiedener religiöser Bewegungen während der letzten<br />
Jahrzehnte hat gezeigt, daß der hohe Grad an Privatisierung des Daseins <strong>und</strong><br />
der Bewußtseinsorganisation, der die Industriegesellschaften des Westens<br />
kennzeichnet, nicht unbedingt ausschließt, daß sich Gemeinschaften unterhalb<br />
der institutionellen Ebene ausbilden können <strong>und</strong> Modelle der Bewußtseinsorganisation<br />
produzieren. Die innere Stimmigkeit dieser Modelle erscheint<br />
zunächst, wie bei allen Synkretismen, gering. Gewiß werden sich<br />
Experten der Kongruenzerhöhung finden, wenn sie nicht schon zur Hand<br />
sind. Die soziale Verbindlichkeit der Modelle ist, gesamtgesellschaftlich<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
gesehen, zwar minimal, aber innerhalb der Gemeinschaften, trotz ihrer eingebauten<br />
Labilität, um einiges höher als in der Privatsphäre rein subjektiver<br />
Beliebigkeit.<br />
ANMERKUNG<br />
Dieser Aufsatz ist eine überarbeitete Fassung von „Social Structure and Religion in<br />
Modern Industrial Society", in: Zdenko Roter u. Franc Rodé (Hsg), Science and Faith.<br />
Ljubljana<strong>und</strong> Rom 1984, S. 94-107.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
DER KAPITALISMUS - EIN UNVOLLENDBARES PROJEKT?<br />
Johannes Berger<br />
I.<br />
Die Frage nach den Grenzen der kapitalistischen Entwicklung ist fast so<br />
alt wie diese selbst. Sie heute wieder aufzugreifen, ist mehr denn je ein<br />
waghalsiges, ungeschütztes Unternehmen. Wer immer solche Fragen behandelt,<br />
scheint suggerieren zu müssen, er besitze einen Standpunkt, von dem<br />
er unverstellt das Ganze <strong>und</strong> seine Entwicklung in den Blick bekommen<br />
könnte. Der historische Materialismus nahm an (<strong>und</strong> konnte von seinen<br />
eigenen Voraussetzungen her gesehen annehmen), im Klassenstandpunkt<br />
des Proletariats solch einen ausgezeichneten Standpunkt zu besitzen. Diese<br />
Auffassung heute noch zu teilen, dagegen sprechen schon Erfahrungen mit<br />
der steigenden Komplexität moderner Gesellschaften, auf welche die Theorie<br />
dadurch reagiert, daß sie ihrerseits selbst komplexer angelegt wird.<br />
Die mit der Frage nach den Grenzen der kapitalistischen Entwicklung<br />
aufgeworfene Problematik wird dadurch gesteigert, daß großformatigen<br />
Fragen wie der nach der Zukunft des Kapitalismus eine unausrottbare Vielschichtigkeit<br />
eignet. Um mit dieser Vielschichtigkeit zurechtzukommen,<br />
empfiehlt es sich daher, z.B. die Frage nach der Stabilität von der nach der<br />
Vernünftigkeit eines Gesellschaftssystems abzuspalten. Um mich nicht mit<br />
zu vielen Problemen zu belasten, möchte ich mich im folgenden auf die Stabilitätsproblematik<br />
konzentrieren <strong>und</strong> auf die heute durch die Zweifel am<br />
Fortschritt erneut aufgeworfene Frage nach der „Vernunft in der Geschichte"<br />
nur am Rande zu sprechen kommen. Und um mit der Frage nach der<br />
Stabilität eines kapitalistischen Systems nicht ins Uferlose zu geraten,<br />
möchte ich die Antwort auf diese Frage in Anlehnung an ein literarisches<br />
Vorbild suchen.<br />
II.<br />
„Kann der Kapitalismus weiterleben?" Mit dieser an schicksalhafter Bedeutung<br />
schwerlich zu überbietenden Frage eröffnet Schumpeter den zweiten<br />
Teil seines Klassikers: „Kapitalismus, Sozialismus <strong>und</strong> Demokratie". Und er<br />
antwortet auf diese selbst gestellte Frage ohne Umschweife: „Nein, m.E.<br />
nicht" (Schumpeter 1950, S. 105). Wenn das Zeitalter des Kapitalismus<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
unausweichlich zu Ende geht, dann ist es folgerichtig, die Anschlußfrage<br />
zu stellen, was denn nach ihm komme, wodurch es denn abgelöst werde.<br />
Für Schumpeter war die Antwort hierauf wie fraglos vorgegeben: durch den<br />
Sozialismus. Mag sein, daß die Richtung dieser Anwort durch das Gewicht<br />
einer evolutionstheoretischen Tradition in der Gesellschaftstheorie, die in<br />
der Arbeiterbewegung auch praktische Gestalt angenommen hatte, vorgezeichnet<br />
war. Weil für Schumpeter die Ablösung des Kapitalismus durch<br />
den Sozialismus eine evolutionäre Regelmäßigkeit war, die zu bezweifeln<br />
keinen Sinn machte, konzentrierte er seine Ausführungen zum Sozialismus<br />
auf die Frage, ob dieser ein funktionsfähiges Wirtschaftssystem sei. So umstandslos<br />
Schumpeter die Frage nach der Überlebensfähigkeit des Kapitalismus<br />
verneinte, so ohne Zögern beantwortete er die Frage: „Kann der<br />
Sozialismus funktionieren?" mit einem „klaren Ja" (S. 367). Damit stellte<br />
er sich gegen Annahmen einer Funktionsunfähigkeit des Sozialismus als<br />
Wirtschaftsordnung, die auf Max Weber zurückgehen <strong>und</strong> deren locus<br />
classicus Mises' „Die Gemeinwirtschaft" (1932) bildet.<br />
Heute, mehr als vierzig Jahre später <strong>und</strong> vor dem Hintergr<strong>und</strong> der Erfahrung<br />
eines beispiellosen Aufschwungs der kapitalistischen Weltwirtschaft<br />
<strong>und</strong> der bekannten wirtschaftlichen Funktionsprobleme sozialistischer<br />
Länder werden viele, die Schumpeters Buch noch einmal zur Hand<br />
nehmen, Schwierigkeiten haben, seine Gedanken nachzuvollziehen. Ausgerechnet<br />
der Sozialismus soll funktionieren? Und ausgerechnet dem Kapitalismus,<br />
einem doch allem Anschein nach extrem lebensfähigen Gebilde, soll<br />
bescheinigt werden, daß seine Zeit abgelaufen sei? Verständlich wird letztere<br />
Behauptung nur, wenn man die Wendung der krisentheoretischen Gr<strong>und</strong>figur<br />
bei Schumpeter nicht verkennt, auf die er seine Überzeugung von der<br />
Begrenztheit des Kapitalismus als Gesellschaftsordnung stützt. Es ist auffällig,<br />
daß Schumpeter die Überlebensunfähigkeit des Kapitalismus nicht mit<br />
der immanenten Krisenanfälligkeit der kapitalistischen Wirtschaft begründet.<br />
In einem eigens Fragen der ökonomischen Funktionsfähigkeit gewidmeten<br />
Abschnitt weist Schumpeter vielmehr alle Annahmen, die stagnationstheoretisch<br />
mit Varianten des Gedankens der schwindenden Investitionschancen<br />
spielen, ausdrücklich zurück. Was kapitalistische Wirtschaften<br />
kennzeichnet, ist, daß sie auf Wachstum abgestellt sind. Kein anderes<br />
System zeichnet sich durch eine vergleichbare „Wachstumsrate der Erzeugung"<br />
aus.<br />
Woran der Kapitalismus zugr<strong>und</strong>e gehen wird, ist Schumpeter zufolge<br />
also ganz <strong>und</strong> gar nicht sein wirtschaftlicher Mißerfolg. Eine definitive<br />
Grenze für das Fortbestehen eines derartigen Wirtschaftssystems sieht er<br />
vielmehr ganz allgemein darin, daß „gerade sein Erfolg die sozialen Einrichtungen,<br />
die es schützen, untergräbt <strong>und</strong> unvermeidlich Bedingungen<br />
schafft, unter denen es nicht zu leben vermag <strong>und</strong> die nachdrücklich auf<br />
den Sozialismus als seinen gesetzlichen Erben deuten." (S. 106)<br />
Damit hat Schumpeter die Theorie der Selbstdestruktion kapitalistischer<br />
Systeme auf eine neue Gr<strong>und</strong>lage gestellt. Mich interessieren hier<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
nicht die Besonderheiten von Schumpeters Theorie der Endlichkeit kapitalistischer<br />
Systeme, sondern der allgemeine Gedanke, der sich aus seinen<br />
Ausführungen entnehmen läßt: Schumpeter tauscht eine Verschlechterungs<strong>und</strong><br />
Verdüsterungsperspektive aus gegen eine Annahme der Verbesserungs<strong>und</strong><br />
Steigerungsfähigkeit als Gr<strong>und</strong>lage der Krisentheorie. Demnach scheitert<br />
der Kapitalismus nicht an seinen Mißerfolgen, sondern an den Folgeproblemen<br />
seines Erfolgs; die'se Folgeprobleme müssen nicht im Wirtschaftssystem<br />
selbst, sondern im Verhältnis des Wirtschaftssystems zu seiner „Umwelt"<br />
im weitesten Sinne aufgesucht werden.<br />
Wenn ich mich heute noch einmal an Schumpeters Frage heranwage,<br />
so geschieht dies zunächst, weil nach Abschluß der größten Expansionsphase,<br />
welche die kapitalistischen Wirtschaften je erlebt haben, diese Frage<br />
einfach neu gestellt werden muß. Es ist ja nicht ohne Ironie, daß Schumpeter<br />
seine Prognose ausgerechnet am Vorabend eines noch nie dagewesenen<br />
Booms abgab. Das sollte uns zögernd machen, weitere Prognosen über<br />
die innere Überlebensunfähigkeit kapitalistischer Systeme aufzustellen.<br />
Neben dem äußeren Anlaß: der Erfahrung von Aufstieg <strong>und</strong> Niedergang des<br />
Nachkriegskapitalismus gibt es aber noch zwei weitere Gründe, Schumpeters<br />
Frage wieder aufzugreifen. Einmal, denke ich, muß diese Antwort<br />
aus dem Schema: Kapitalismus/Sozialismus herausspringen; ich will die Begründung<br />
hierfür im wesentlichen mit einer gesellschaftstheoretischen Argumentation<br />
liefern. Sodann möchte ich eine direkt entgegengesetzte Antwort<br />
auf die Frage nach den Überlebensmöglichkeiten kapitalistischer Systeme<br />
geben: trotz offen zutage tretender selbstdestruktiver Tendenzen an den<br />
Fronten der Motivzufuhr <strong>und</strong> der Erhaltung der natürlichen Umwelt können<br />
solche Systeme überleben. Der Unterschied zu Schumpeter liegt nicht<br />
darin, daß die Gewißheit des Untergangs jetzt mit der Gewißheit des Überlebens<br />
ausgetauscht wird, sondern daß die Fortexistenz kapitalistischer Gesellschaften<br />
als eine reale Möglichkeit betrachtet wird, die gerade durch<br />
„Selbsttransformation" garantiert wird. Eine solche Antwort impliziert<br />
nicht die Leugnung krisenhafter Tendenzen, ganz im Gegenteil. Ihr liegt<br />
aber ein Verständnis von Krisen zugr<strong>und</strong>e, das diese weder mit der Auflösung<br />
der bestehenden Ordnung in ein soziales Nichts („Zusammenbruch")<br />
noch mit der Vorstellung verbindet, an die Stelle der bestehenden trete eine<br />
völlig andere Ordnung, dem Bruch vergleichbar, den die „great transformation"<br />
im Übergang von vormodernen zu modernen Gesellschaften darstellt.<br />
Eine Antwort auf die Frage: kann der Kapitalismus weiterleben? möchte<br />
ich auf dem Wege einer Zerlegung dieser Frage in drei Teilfragen näherkommen:<br />
(a) was soll unter Kapitalismus verstanden werden?<br />
(b) worin besteht das Zentralproblem des Kapitalismus?<br />
(c) gibt es eine Lösung für dieses Zentralproblem oder muß der Kapitalismus<br />
an der Fortsetzung eines einmal eingeschlagenen Entwicklungspfades<br />
scheitern?<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Die abschließenden Überlegungen zur Selbsttransformation kapitalistischer<br />
Gesellschaften laufen darauf hinaus, zu plausibilisieren, daß ein solches Gesellschaftssystem<br />
Überlebensmöglichkeiten gerade dadurch steigert, daß es<br />
sich nicht „rein" verwirklicht, sondern mit systemfremden Elementen<br />
mischt.<br />
III.<br />
In der Tradition von Marx bis Weber wird das Zentrum des Kapitalismus im<br />
„Gegensatz von Kapital <strong>und</strong> Arbeit", der „Organisation von formell freier<br />
Arbeit" etc. erblickt. Ich möchte im folgenden nicht die Berechtigung solcher,<br />
das Kapital-Arbeitsverhältnis ins Zentrum stellender Analysen bestreiten,<br />
sondern dieses als die Schlüsselgröße eines umfassenderen Modernisierungsprozesses<br />
interpretieren, dessen abstrakte Gr<strong>und</strong>züge es jetzt zu vergegenwärtigen<br />
gilt.<br />
Bereits Marx hat diesen Modernisierungsprozeß als einen Freisetzungs-,<br />
Autonomisierungs- <strong>und</strong> Verselbständigungsprozeß beschrieben. Die auf ihn<br />
folgende Literatur hat wenig mehr getan, als die einzelnen Facetten dieses<br />
Freisetzungsprozesses hervorzuheben <strong>und</strong> auszuarbeiten. Was in der „great<br />
transformation" (Polanyi 1944) abläuft, ist im Gr<strong>und</strong>e genommen die Verselbständigung<br />
der Wirtschaft. In dieser Verselbständigung der Wirtschaft<br />
liegt das Zentrum der Modernisierung. Was dies heißt, möchte ich mit wenigen<br />
Stichworten umreißen.<br />
Es sind vor allem drei Eigenschaften, die die Entstehung des Kapitalismus<br />
als Freisetzungsprozeß der Wirtschaft auszeichnen:<br />
(a) funktionale Differenzierung (die Trennung des Ökonomischen vom<br />
Politischen),<br />
(b) erweiterte Reproduktion (ununterbrochene Akkumulation),<br />
(c) die Auflösung von vorgef<strong>und</strong>enen Weltbildern <strong>und</strong> Gemeinschaftsstrukturen.<br />
(a) Der Kapitalismus unterscheidet sich dadurch von allen vorangegangenen<br />
Formen der Produktion, daß in ihm ökonomische Funktionen ausdifferenziert<br />
werden. Die Abspaltung wirtschaftlicher Tätigkeiten von politischen<br />
bildet das Muster für die von der soziologischen Systemtheorie thematisierten<br />
Prozesse funktionaler Differenzierung. In der Tradition des Marxismus<br />
wird die Ausdifferenzierung der Wirtschaft unter dem Titel: Trennung der<br />
Bereiche von Politik <strong>und</strong> Ökonomie behandelt. Erst mit dieser Trennung<br />
gibt es so etwas wie die Wirtschaft; die Wirtschaft nicht verstanden als<br />
materielle Produktion, sondern als Sphäre des „Handels" (trade) oder des<br />
Gelderwerbs. Die sich herausbildende Gesellschaft des freien Erwerbs ist<br />
auch in dem Sinne frei, daß wirtschaftliche Tätigkeiten nicht mehr mit der<br />
Erledigung politischer Aufgaben vermengt werden, wie dies in traditionalen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Gesellschaften der Fall war. Die Wirtschaft kann sich jetzt ganz auf ihre<br />
wirtschaftlichen Aufgaben konzentrieren; d.h. z.B. für die Unternehmungen,<br />
daß „betriebsfremde Interessen" nicht mehr in die an „nachhaltiger<br />
Dauer-Rentabilität" orientierten Unternehmensentscheidungen hineinspielen<br />
sollen (Weber 1972, S. 79).<br />
(b) Was den rationalen Kapitalismus auszeichnet, ist nicht die Gewinnsucht<br />
an sich; diese hat es schon immer gegeben <strong>und</strong> sie trat in vorkapitalistischen<br />
Zeiten vermutlich in viel krasseren Formen auf (vgl. Weber). Nicht die Aneignung<br />
des Überschusses unterscheidet den Kapitalismus von traditionalen<br />
Wirtschaftsordnungen, sondern dessen Wiederanlage. Der „Beruf" des Kapitalisten<br />
ist es, den Surplus zu investieren. Der „Reichtum der Gesellschaften,<br />
in denen kapitalistische Warenproduktion herrscht" (Marx), basiert<br />
ganz <strong>und</strong> gar darauf, daß Kapitalbildung zustandekommt. Soll dieser Prozeß<br />
der Wiederanlage eines Surplus kontinuierlich <strong>und</strong> rational ablaufen,<br />
dann bedarf es der Lohnarbeit als seiner Voraussetzung. Marx hat den eingebauten<br />
Wachstumszwang kapitalistischer Systeme als einen sich selbst<br />
determinierenden Prozeß beschrieben. In den Kapiteln über die erweiterte<br />
Reproduktion im zweiten Band des 'Kapital' hat er alle die Gr<strong>und</strong>züge des<br />
Systems zusammengetragen, die es erlauben, die Wirtschaft der modernen<br />
Gesellschaft als „selbstreferentiell-geschlossenes System", das „die Elemente,<br />
aus denen es besteht, mit Hilfe der Elemente, aus denen es besteht, reproduziert"<br />
(Luhmann, 1984, S. 315 in Anlehnung an Maturana 1981) zu<br />
beschreiben. Ein solches System bezieht sich auf sich selbst: die Akkumulation<br />
geschieht um der Akkumulation willen, <strong>und</strong> es ist in sich geschlossen<br />
in dem Sinne, daß es die Elemente, aus denen es besteht, ständig selbst neu<br />
aufbaut. Der „Zwang zur Akkumulation" beschreibt also, um ein Wort der<br />
neuesten Theoriesprache zu verwenden, den Operationsmodus eines „autopoietischen<br />
Systems".<br />
(c) Was ich mit der „Auflösung von Vorgef<strong>und</strong>enem" meine, ist ein in sich<br />
vielfältiger <strong>und</strong> facettenreicher Prozeß. Er betrifft erstens jenen Sachverhalt,<br />
den Habermas die „Rationalisierung von Weltbildern" genannt hat.<br />
Dahinter verbirgt sich nichts anderes als die „Auflösung der Metaphysik"<br />
im Übergang von der alten zur neuen Welt. In diesem Prozeß differenzieren<br />
sich die kulturellen Wertsphären der Wissenschaft, der Kunst <strong>und</strong> der Moral<br />
(Habermas 1981). Seitdem gibt es nicht mehr ein einheitliches Glaubenssystem<br />
(belief-system), sondern viele solcher „belief-systems". Die alteuropäische<br />
Philosophie war an einen Weltzustand angepaßt, der sich durch<br />
„Geschlossenheit" auszeichnete. Lukács hat in seiner Theorie des Romans<br />
(1914) die vielleicht schönste Beschreibung für die geschlossene Welt der<br />
Antike <strong>und</strong> dann noch einmal des christlichen Mittelalters gef<strong>und</strong>en. Diese<br />
Geschlossenheit verschwindet mit dem Einbruch des Kapitalismus in die<br />
alte Welt. Der entstehende Kapitalismus bewirkt eine Öffnung dieser geschlossenen<br />
Welt in räumlicher <strong>und</strong> vor allem zeitlicher Hinsicht. Seitdem<br />
gibt es erst eine offene Zukunft <strong>und</strong> die Aufgabe der Wirtschaft besteht<br />
darin, diese Zukunft zu schließen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Sodann bricht der Kapitalismus in die vorgef<strong>und</strong>enen Formen gemeinschaftlichen<br />
Lebens ein. Die klassische Beschreibung hierfür findet sich in<br />
dem „Formenkapitel" der Gr<strong>und</strong>risse (1953). In diesem Kapitel entwirft<br />
Marx eine diskontinuierliche Perspektive der <strong>gesellschaftliche</strong>n Entwicklung,<br />
die radikal abweicht von dem evolutionstheoretischen Schema des<br />
Vorworts zur Kritik der politischen Ökonomie, das den Kapitalismus in<br />
einer kontinuierlichen Abfolge von Gesellschaftsformationen von der antiken<br />
Sklavenhaltergesellschaft bis zum Sozialismus sieht. In Wahrheit hat<br />
aber der Kapitalismus mit allen vorangegangenen Gesellschaftsformen viel<br />
weniger gemein als diese untereinander gemein haben (Giddens 1982,<br />
S. 77). Mit seiner Heraufkunft ist ein f<strong>und</strong>amentaler Bruch eingetreten. In<br />
seiner groß angelegten Untersuchung zur ,,Sozialgeschichte des Naturrechts"<br />
bezeichnet Breuer (1983) diesen Bruch im Anschluß an Lukács als<br />
Übergang von der „naturwüchsigen" zur „reinen" Vergesellschaftung. Mit<br />
dieser entscheidenden Umstellung der Vergesellschaftungsform werden alle<br />
Strukturen <strong>und</strong> Ereignisse kontingent. Da alles gesellschaftlich „gesetzt" ist,<br />
könnte es im Prinzip auch anders „gesetzt" sein.<br />
Mit dieser reinen Vergesellschaftung geht schließlich ein Differenzierungsprozeß<br />
einher, den ich nicht unter funktionale Differenzierung subsumieren<br />
möchte, sondern der auf das Auseinandertreten von „System <strong>und</strong><br />
Lebenswelt" (Habermas) hinausläuft. Der Kern dieses Vorgangs besteht in<br />
der Ablösung der Gesellschaft von ihren Handlungsgr<strong>und</strong>lagen 1 . Ich denke,<br />
daß die Auseinanderziehung systemischer <strong>und</strong> lebensweltlicher Aspekte als<br />
genau jener Vorgang zu verstehen ist, der in der ökonomischen Anthropologie<br />
(Polanyi) als Herauslösung des Kapitalismus aus normativen Kontexten<br />
beschrieben worden ist. Marktwirtschaften sind in ihrem Funktionieren<br />
nicht oder signifikant weniger als traditionale Gesellschaften von moralischen<br />
Handlungsgr<strong>und</strong>lagen abhängig. Dieser Sachverhalt ist von Marx bis<br />
v.Hayek als die „unpersönliche Ordnung" des Kapitalismus begriffen worden.<br />
Unter Gesichtspunkten der Moral zeichnet den Kapitalismus aus, daß<br />
er mit Minimalanforderungen auskommt. Streissler (1980) hat diesen Sachverhalt<br />
auf den Begriff gebracht: der Kapitalismus ist eine Wirtschaftsordnung,<br />
die selbst unter Teufeln funktionieren könnte.<br />
IV.<br />
Damit sind wir genügend vorbereitet, auch die Antwort auf die Frage nach<br />
dem Zentralproblem kapitalistischer Gesellschaften in einer neuen Richtung<br />
zu suchen, die von den krisentheoretischen Annahmen der politischen Ökonomie<br />
abweicht. Krisentheoretische Ansätze in der Tradition der politischen<br />
Ökonomie rechnen mit Problemen für den Kapitalismus, die im Prinzip<br />
seiner inneren Schwäche <strong>und</strong> Instabilität entspringen. Im Unterschied<br />
hierzu betont eine Theorie selbstdestruktiver Tendenzen der Form, wie sie<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ei Schumpeter vorgebildet ist, daß die entscheidenden Problemlagen des<br />
Kapitalismus nicht seiner inneren Schwäche, sondern seiner ungebrochenen,<br />
alles durchdringenden Stärke entspringen. In dieser Perspektive leiden die<br />
fortgeschrittenen kapitalistischen Länder an „Widersprüchen", die eben<br />
nicht aus ihrer Schwäche, sondern aus ihrer Stärke entstehen (vgl. Hirschmann<br />
1982, S. 678). In der gewandelten Sichtweise generiert ein kapitalistisches<br />
System Probleme primär durch seine Funktionstüchtigkeit <strong>und</strong> Zielerreichung,<br />
nicht durch Funktionsdefizite; kurz: durch Wachstum <strong>und</strong><br />
nicht durch Wachstumsstörungen.<br />
Eine solche Änderung der Blickrichtung der Krisenanalyse fußt auf Annahmen<br />
darüber, was in der „great transformation" prinzipiell passiert ist.<br />
Ich hatte argumentiert, daß der Kern der Entwicklung in einem Freisetzungs-<br />
<strong>und</strong> Verselbständigungsprozeß besteht. Das Resultat dieser Entwicklung<br />
ist in der ökonomischen Anthropologie mit dem Begriff der „dise<strong>mb</strong>eddedness"<br />
zusammengefaßt worden. Nur ein solcher Art freigesetztes,<br />
aus der Einbettung in vorgef<strong>und</strong>ene Strukturen herausgelöstes System vermag<br />
die Energien zu mobilisieren, alles Vorgef<strong>und</strong>ene, seien dies ältere<br />
Gemeinschaftsformen, Lebenswelten, Weltbilder, die natürliche Umwelt<br />
etc. zu durchdringen <strong>und</strong> aufzulösen.<br />
Mit dieser Änderung der Blickrichtung auf die Folgewirkungen der Umstellung<br />
der Wirtschaft auf „Eigengesetzlichkeit" sind aber die Problemlagen<br />
eines Vergesellschaftungsmodus, der, wie Marx sagt, „nicht irgendetwas<br />
Gewordenes zu bleiben sucht, sondern in der absoluten Bewegung des Werdens<br />
ist" (Marx 1953, S. 387) selbst nocht nicht benannt. Wie läßt sich begründen,<br />
daß ein Vergesellschaftungsmodus, der auf Freisetzung beruht,<br />
selbst-destruktive Tendenzen enthält?<br />
Wie Breuer (1983) gemeint hat, mündet ein System der reinen Vergesellschaftung,<br />
das keinen „vorhergegebenen Maßstab" (Marx, a.a.O.) mehr<br />
anerkennt, in letzter Konsequenz in der von Nietzsche prognostizierten<br />
„Entwertung aller Werte", dem Nihilismus. Unter Nihilismus soll dabei<br />
nicht die Negation der Moral verstanden werden, sondern der Sachverhalt,<br />
daß in modernen Gesellschaften der Tendenz nach alles kontingent gesetzt<br />
wird; feste Gr<strong>und</strong>lagen existieren nicht mehr als unverrückbare Vorgegebenheiten,<br />
sondern nur noch als „Setzungen" . „Alles Ständische <strong>und</strong> Stehende<br />
verdampft, alles Heilige wird entweiht, <strong>und</strong> die Menschen sind endlich<br />
2<br />
gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen<br />
Augen anzusehen" — so heißt es schon im „Kommunistischen Manifest".<br />
Theoretisch reflektiert ist diese Tendenz der <strong>gesellschaftliche</strong>n Entwicklung<br />
in Luhmannns Systemtheorie. Das Bewegliche gründet in ihr nicht<br />
auf dem Festen, sondern alles Feste auf dem Beweglichen, weil alles Gesellschaftliche<br />
eine „jederzeit änderbare Selektionsleistung aus stets präsent<br />
bleibenden Möglichkeiten" darstellt (vgl. Breuer 1983, S. 601 mit Bezug<br />
auf Luhmann 1972, S. 190). Die Sehnsucht nach der „Rückkehr zum<br />
menschlichen Maß" (so Schumacher) mutet von daher an wie eine hilflose<br />
Gebärde. „In einer Welt", so schließt Breuers Buch folgerichtig, „ in der<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
sich die Bewegung der Gesellschaft nur noch an sich selber bricht, kann es<br />
... keinen Punkt (mehr geben), von dem aus sich über Rationalität oder Irrationalität<br />
des Ganzen urteilen ließe" (S. 601).<br />
Das hieße dann, solche Gesells aften könnten keine „vernünftige Identität"<br />
(Habermas 1970) mehr ausbilden . Aber sind sie deswegen selbstdestruktiv?<br />
Um solche selbstdestruktiven Tendenzen aufzuspüren, müßte<br />
3<br />
man zeigen können, daß „freigesetzte" kapitalistische Wirtschaften in der<br />
Verfolgung ihres Expansionspfads ihre eigenen Gr<strong>und</strong>lagen, auf denen sie<br />
aufbauen, aufzehren. Diese Gr<strong>und</strong>lagen müssen unserer Voraussetzung zufolge<br />
nicht im System selbst, sondern im Verhältnis des Systems zu seiner<br />
natürlichen <strong>und</strong> sozialen Umwelt aufgesucht werden. Insofern das kapitalistische<br />
Wirtschaftssystem seine Grenze immer weiter in seine Umwelten<br />
hineinverschiebt — so lautet der ganz abstrakte Gr<strong>und</strong>gedanke — bedroht<br />
es wesentliche Bestandsvoraussetzungen dadurch, daß es seine eigenen<br />
Umwelten in einer Weise verändert, die seinem Funktionieren abträglich<br />
sind.<br />
Eine konkretisierende Auslegung hat dieser Gr<strong>und</strong>gedanke in einer<br />
Überlegung erhalten, die Parsons am Ende seines „Systems der modernen<br />
Gesellschaften" (1972) entwickelt. Die Krise der Moderne, so Parsons, wird<br />
ihr Zentrum nicht in der Wirtschaft, der Politik oder dem Wertesystem<br />
haben, sondern in der <strong>gesellschaftliche</strong>n Gemeinschaft. Gravierende Probleme<br />
entstehen aus der Fortsetzung des Rationalisierungsprozesses an der<br />
Grenze von „System <strong>und</strong> äußerer Umwelt" einerseits, an der Front der<br />
Motivationsgr<strong>und</strong>lagen andererseits. Der „instrumentale Aktivismus", so<br />
möchte ich Parsons Gedanken verdeutlichen, bildet den ethischen Kern des<br />
Kapitalismus. Er äußert sich in einem Rationalismus der Weltbeherrschung,<br />
der zu ständigen Eingriffen in die natürliche Umwelt führt. Gleichzeitig<br />
stellt dieser instrumentelle Aktivismus seine eigene Motivationszufuhr in<br />
Frage. Probleme entstehen dann einmal durch die ständige Grenzverschiebung<br />
von „Ökonomie <strong>und</strong> Ökologie" (Probleme zwischen System <strong>und</strong><br />
äußerer Umwelt) <strong>und</strong> zum anderen aus der Abschwächung jener Motive,<br />
die den „instrumentellen Aktivismus" getragen haben (Probleme zwischen<br />
System <strong>und</strong> innerer Umwelt).<br />
Beide Gefahrenzonen sind aus der wissenschaftlichen Literatur <strong>und</strong> der<br />
öffentlichen Diskussion hinreichend bekannt. Die Idee der Motivationskrise<br />
(Habermas) hat verschiedene Begründungen gef<strong>und</strong>en: Auflösung des bürgerlichen<br />
Sparideals durch die Konsumgesellschaft, Ausbreitung hedonistischer<br />
Orientierungen (Bell), autonomer Wertwandel (Inglehart), Schwächung<br />
der Wertverpflichtung durch das Dominantwerden marktkonformer<br />
Motive des Eigeninteresses etc. Insbesondere F. Hirsch ist in den „the depleting<br />
moral legacy" überschriebenen Abschnitten seines Buchs „Social<br />
Limits to Growth" (1976) dieser Idee nachgegangen, daß der Kapitalismus<br />
seine moralischen Gr<strong>und</strong>lagen auflöst. Ich möchte diese Analyse nicht wiederholen<br />
<strong>und</strong> stattdessen stellvertretend am Konflikt zwischen Ökonomie<br />
<strong>und</strong> Ökologie das Zentralproblem der „Bindungslosigkeit" <strong>und</strong> die mögli-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
chen Bearbeitungsformen dieses Zentralproblems verdeutlichen. Wenn das<br />
Gr<strong>und</strong>problem des Kapitalismus die Schrankenlosigkeit seines Verwertungstriebs<br />
ist, dann hängt die Fortsetzbarkeit des Kapitalismus als <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Projekts von der Beantwortung der Frage ab, ob ein solches System<br />
„gebändigt" oder „gezügelt" werden kann.<br />
V.<br />
Auch zu der Konfliktfront zwischen Ökonomie <strong>und</strong> Ökologie gibt es eine<br />
unübersehbare Literatur. Allerknappste Anmerkungen sollen daher genügen.<br />
In einem glänzenden Artikel über das Walsterben hat Gonigle (1980) den<br />
Konflikt zwischen Ökologie <strong>und</strong> Ökonomie auf den Begriff gebracht. Die<br />
großen Meeressäuger müssen immer noch sterben wegen der Ökonomisierung<br />
der Ökologie. Ökologie bedeutet weit mehr als „Umweltschutz". Sie<br />
ist eine von der Ökonomie radikal differierende Perspektive. Mit Ökonomie<br />
<strong>und</strong> Ökologie ist ein jeweils anderer Satz von Entscheidungsregeln gemeint.<br />
Ihr Unterschied läßt sich gut beschreiben durch die abweichenden<br />
Zeithorizonte, die sie jeweils implizieren. Obwohl ökonomische Entscheidungen<br />
als „Vorsorge für einen zukünftigen Bedarf" (Weber) auf die Zukunft<br />
orientiert sind, ist ihr Zeithorizont doch kurzfristig. Langzeitprobleme<br />
dieses an der unmittelbaren Zukunft orientierten Entscheidungstypus<br />
bleiben aus dem rationalen Kalkül des Investors ausgeklammert. Der Investor,<br />
blind gegenüber der Zukunft, verfolgt eine Strategie der Maximierung<br />
seiner Erträge. In einem derartig verselbständigten ökonomischen Kalkül<br />
kann es rational sein, den Ertrag aus der Ausbeutung natürlicher Ressourcen<br />
zu maximieren, auch wenn dies zu ihrer Zerstörung führt. Im Gegensatz<br />
hierzu wird in der ökologischen Perspektive anerkannt, daß die Erde für zukünftige<br />
Generationen bewahrt werden muß. Gegenwärtige Bedürfnisse<br />
müssen mit denen zukünftiger Generationen abgewogen werden. Fachökonomisch<br />
gesprochen: in intertemporaler <strong>und</strong> intergenerationaler Perspektive<br />
ist die Marktallokation pareto — suboptimal.<br />
Vorausgesetzt, das zentrale Problem der ökonomischen Entscheidungsweise<br />
ist die Zerstörung der Balance zwischen Ökologie <strong>und</strong> Ökonomie<br />
durch „Überexpansion", dann liegt es nahe, Lösungen dieses Problems in<br />
der „Reintegration" der Ökonomie zu suchen, also in der Einbindung der<br />
Ökonomie in Vorgegebenheiten, von denen sich befreit zu haben doch gerade<br />
das Wesen des rationalen Kapitalismus ausmacht. Gonigle sucht die<br />
Lösung von Problemen, die in der Ökonomisierung der Ökologie liegen, in<br />
einer Politik des ökologischen Übergangs, deren Ergebnis die Institutionalisierung<br />
einer anderen, eben der „ökologischen Entscheidungsweise" ist. Interessanterweise<br />
beschreibt er sie nicht als Auflösung der Ökonomie, sondern<br />
als Repräsentation von Ressourceninteressen in den Entscheidungen<br />
ökonomischer Akteure. Eine solche Öffnung eines Systems für die Sorgen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
seiner sozialen <strong>und</strong> natürlichen Umwelt darf nicht mit Entdifferenzierung<br />
vermengt werden. Entdifferenzierung läge vor, wenn z.B. die Wirtschaft<br />
andere als wirtschaftliche Funktionen z.B. Bildung, Rechtsprechung etc.<br />
ausübte. Hingegen wäre bei der Einbeziehung der Auswirkungen des Wirtschaftens<br />
in die wirtschaftlichen Entscheidungen nicht die funktionale Spezifizierung,<br />
sondern die Autonomisierung des Wirtschaftssystems betroffen.<br />
Das Vorbild für derartige Prozesse der „relativen Heteronomisierung" (Buß<br />
1983) bildet die Sozialpolitik. Heimann (1980) hat ihr Prinzip als Verwirklichung<br />
der sozialen Idee im Kapitalismus gegen den Kapitalismus<br />
beschrieben. Analog hierzu ließe sich von dem Programm der Verwirklichung<br />
der ökologischen Idee im Kapitalismus gegen den Kapitalismus<br />
sprechen. Seine Realisierung käme einer Transformation kapitalistischer Gesellschaftssysteme<br />
gleich, insofern der fortgesetzten Kommodifizierung, der<br />
Auflösung aller übrigen Lebenssphären <strong>und</strong> der Bedrohung der natürlichen<br />
Umwelt durch die ungebrochene Expansion des Wirtschaftssystems ein<br />
Ende gesetzt würde. Eine Relativierung der Wirtschaft hingegen hätte zum<br />
Ergebnis, daß Raum geschaffen würde dafür, die Sphäre der Geldwirtschaft<br />
mit den übrigen Lebensbereichen in ein neues Verhältnis zu setzen.<br />
Was bedeutet nun eine solche Relativierung für unsere Ausgangsfrage:<br />
kann der Kapitalismus weiterleben, <strong>und</strong>: auf welchem Weg ist eine als Relativierung<br />
beschreibbare Transformation kapitalistischer Systeme erreichbar?<br />
Das Gr<strong>und</strong>problem einer selbstbezüglichen, schrankenlosen Produktionsweise<br />
ist, wie sie „gezügelt" werden kann. Diese Zügelung kann entweder<br />
von außen oder von innen geschehen. Ein möglicher Ansatz zu einer solchen<br />
Selbstbeschränkung wird in der jüngeren, steuerungstheoretischen Literatur<br />
unter dem Titel der „Selbststeuerung" diskutiert. Die ältere Literatur<br />
hatte von Selbstbindung gesprochen. Selbstbindung unterscheidet sich<br />
von Fremdbindung sei es durch staatliche Politik, sei es durch soziale Bewegungen.<br />
Beide intervenieren in den Selbstlauf der Wirtschaft, entweder<br />
durch Implementation politischer Programme, oder durch Entzug der Folgebereitschaft<br />
<strong>und</strong> „Delegitimierung". Zur Selbstbindung hingegen kommt<br />
es durch „Rücksichtnahme". Luhmann hat diesen Steuerungsmodus 'Reflexion'<br />
genannt. Dessen Prinzip besteht darin, daß ein System gerade dadurch,<br />
daß es seine Differenz zur Umwelt thematisiert, Distanz zu sich<br />
selbst gewinnt. Die Durchsetzung solcher reflexiver Steuerungsformen<br />
würde keine neue R<strong>und</strong>e im Streit zwischen Privatisierung <strong>und</strong> Etatisierung<br />
bedeuten. Sie antwortet vielmehr auf das Gr<strong>und</strong>problem funktional differenzierter<br />
Systeme, die Reintegration der interdependenten Teile. Willke/<br />
Teubner (1984) haben den Gr<strong>und</strong>zug reflexiver Selbststeuerung im Anschluß<br />
an Luhmann so zusammengefaßt: „Die Leistungssteigerung der Teilsysteme<br />
durch Spezialisierung darf nicht voll ausgefahren, nicht maximiert<br />
werden, weil diese Rücksichtslosigkeit jedes einzelnen Teils dieses zur bedrohlichen<br />
Umwelt jedes anderen Teils machte" (S. 14). Damit antwortet<br />
Selbststeuerung auf einen Gesellschaftszustand, der durch die Freisetzung<br />
des Wirtschaftssystems geprägt ist. In dieser Selbstbezüglichkeit liegt der<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Gr<strong>und</strong> für die Funktionsfähigkeit <strong>und</strong> Umweltblindheit des Wirtschaftssystems<br />
zugleich beschlossen. In dem Maße, in dem es lernte, Abstand zu<br />
sich zu gewinnen <strong>und</strong> auch anderen als wirtschaftlichen Gesichtspunkten<br />
Geltung zu verschaffen, würden aber Funktionsunterbrecher in es eingebaut.<br />
An solchen „rationalen" Funktionsunterbrechungen <strong>und</strong> Rücksichtnahmen<br />
besteht jedoch, wie gerade die jüngsten Erfahrungen gelehrt haben,<br />
ein empfindlicher Mangel. Aber bedeutet „Eigengesetzlichkeit der Wirtschaft",<br />
daß sie nicht mehr lernen kann? Wie dem auch sei: kapitalistische<br />
Wirtschaften müssen mit der paradoxen Lage fertigwerden, daß gerade die<br />
Verfolgung von Wachstumszielen destabilisierende Effekte zeitigt, während<br />
Selbstbegrenzung die Überlebensfähigkeit solcher Systeme steigert.<br />
ANMERKUNGEN<br />
1 Mit der Unterscheidung von Gesellschaft <strong>und</strong> Interaktion thematisiert Luhmann<br />
(1984, S. 551 ff.) eine mit dem Auseinandertreten von System <strong>und</strong> Lebenswelt<br />
vergleichbare Differenzierung.<br />
2 Vgl. auch Luhmann 1984, S. 638: „Alle festen Gr<strong>und</strong>lagen müssen mithin aufgegeben,<br />
sie müssen als zureichender Konsens jeweils erarbeitet werden."<br />
3 Führt man den Rationalitätsbegriff „in das System als Bezugspunkt der Selbstbeobachtung<br />
ein", so Luhmann 1984, S. 647 „wird er auf eigentümliche Weise a<strong>mb</strong>ivalent:<br />
er dient dann als Gesichtspunkt der Kritik aller Selektionen <strong>und</strong> als Maß<br />
der eigenen Unwahrscheinlichkeit".<br />
LITERATUR<br />
Breuer, S., 1983: Sozialgeschichte des Naturrechts, Opladen.<br />
Buß, E., 1983: Markt <strong>und</strong> Gesellschaft Berlin.<br />
Giddens, A., 1981: A Contemporary Critique of Historical Materialism. London and<br />
Basingstoke.<br />
Gonigle, R.M., 1980: „The Economizing of Ecology: Why Big, Rare Whales Still Die".<br />
In: Ecology Law Quarterly. Vol. 9, S. 120 ff.<br />
Habermas, J., 1970: „Können komplexe Gesellschaften eine vernünftige Identität ausbilden?"<br />
In: Habermas, J., Henrich, D.: Zwei Reden aus Anlaß der Verleihung des<br />
Hegelpreises 1973 der Stadt Stuttgart an Jürgen Habermas. Frankfurt.<br />
Habermas, J., 1981: Theorie des kommunikativen Handelns. 2 Bände. Frankfurt 1981.<br />
Heimann, E., 1980: Soziale Theorie des Kapitalismus. Theorie der Sozialpolitik. Mit<br />
einem Vorwort von Bernhard Badura. Frankfurt.<br />
Hirsch, F., 1976: Social Limits to Growth. Ca<strong>mb</strong>ridge/Mass. u. London.<br />
Hirschmann, A., 1982: „Rival Interpretations of Market Society: Civilizing, Destructive,<br />
or Feeble?" In: Journal of Economic Literature, Vol. XX, S. 1463 ff.<br />
Lukács, G., 1971: Die Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer Versuch<br />
über die Formen der großen Epik. Neuwied.<br />
Luhmann, N., 1972: „Positives Recht <strong>und</strong> Ideologie." In: ders.: Soziologische Aufklärung.<br />
Ansätze zur Theorie sozialer Systeme. Bd. 1, 3. Auflage Opladen.<br />
Luhmann, N., 1984: „Die Wirtschaft der Gesellschaft als autopoietisches System."<br />
In: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 13, S. 308 ff.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Luhmann, N., 1984: Soziale Systeme. Gr<strong>und</strong>riß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt.<br />
Marx, K., 1953: Gr<strong>und</strong>risse der Kritik der politischen Ökonomie. Berlin.<br />
Marx, K., 1970: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Zweiter Band: Der Zirkulationsprozeß<br />
des Kapitals. Berlin (MEW Bd. 24).<br />
Maturana, H.R., 1981: „Autopoiesis". In: Zeleny, M. (Hrsg.): A Theory of Living Organization.<br />
New York, S. 21 ff.<br />
Mises, L. v., 1932: Die Gemeinwirtschaft. Untersuchungen über den Sozialismus. Jena.<br />
Parsons, T., 1972: Das System moderner Gesellschaften. <strong>München</strong>.<br />
Polanyi, K., 1967: The Great Transformation. The Political and Economic Origins of<br />
Our Time. Boston.<br />
Schumpeter, J., 1950: Kapitalismus, Sozialismus <strong>und</strong> Demokratie. Bern.<br />
Streissler, E., 1980: „Kritik des neoklassischen Gleichgewichtsansatzes als Rechtfertigung<br />
marktwirtschaftlicher Ordnungen." In: Streissler, E. Watkin, C., (Hrsg): Theorie<br />
marktwirtschaftlicher Ordnungen. Tübingen, S. 38 ff.<br />
Teubner, G., Willke, H., 1984: „Kontext <strong>und</strong> Autonomie: Gesellschaftliche Selbststeuerung<br />
durch reflexives Recht." In: Zeitschrift für Rechts<strong>soziologie</strong>. 6. Jg., S. 4 ff.<br />
Weber, M., 1972: Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft. Gr<strong>und</strong>riß der verstehenden Soziologie.<br />
Studienausgabe Tübingen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
MOBILISIERUNG DER LAIEN - DEPROFESSIONALISIERUNG<br />
DER HILFEN. EIN VERLUST AN GESELLSCHAFTLICHER<br />
RATIONALITÄT?<br />
Christian von Ferber<br />
Deprofessionalisierung <strong>und</strong> Laisierung ein sozialer Prozeß<br />
Wer heute als Soziologe für eine Entprofessionalisierung im Ges<strong>und</strong>heits<strong>und</strong><br />
Sozialsektor eintritt, muß sich nicht nur mit den <strong>gesellschaftliche</strong>n Folgen<br />
eines solchen Prozesses auseinandersetzen, sondern auch festgefügte<br />
soziologische Lehrmeinungen argumentativ überwinden. Im Unterschied<br />
zur Situation vor einem Jahrzehnt sind Mobilisierung der Laien <strong>und</strong> Deprofessionalisierung<br />
der Hilfen heute eine Tatsache. Allerdings hatte der Ausbau<br />
öffentlicher persönlicher Dienstleistungen im Bildungs-, Ges<strong>und</strong>heits<strong>und</strong><br />
Sozialbereich, von Soziologen, Bildungs-, Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sozialpolitikern!<br />
nachdrücklich gefordert , nicht nur — wie jeder politisch induzierte<br />
1<br />
soziale Wandel — Widerstand erzeugt, sondern sehr bald auch zu selbstkritischen<br />
Überlegungen geführt, ob denn Bildung, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> soziale<br />
Hilfen in der Tat durch professionelle Dienstleistungen im erwarteten Umfang<br />
produziert werden.<br />
Gemessen an ihrem Einfluß auf die öffentliche Diskussion kam die wirkungsvollste<br />
Erschütterung des Glaubens an den <strong>gesellschaftliche</strong>n Wert<br />
professioneller Dienstleistungen von einem Außenseiter, von Ivan Illich, der<br />
sich selbst als „Sozialphilosophen" etikettiert. Seine radikalen antiprofessionellen<br />
Ideen: „Entschulung der Gesellschaft", „Nemesis der Medizin<br />
— von den Grenzen des Ges<strong>und</strong>heitswesens" haben in der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
in der ersten Hälfte der siebziger Jahre eine breite Resonanz gef<strong>und</strong>en. Obwohl<br />
Illich seine Arbeiten zunächst auf englisch publiziert hat , haben sie<br />
2<br />
in der B<strong>und</strong>esrepublik eine unvergleichlich größere Durchschlagskraft gehabt<br />
als in den Vereinigten Staaten. Illich's Ideen wurden hier zu einer Zeit<br />
aufgenommen, als in der Soziologie die Theorie der Profession in den Arbeiten<br />
von Daheim, Hesse <strong>und</strong> Hartmann einen Reifezustand erreicht hatte,<br />
der sie zum gesicherten Bestand soziologischer Lehrveranstaltungen werden<br />
ließ . Wir können also für die erste Hälfte der siebziger Jahre ein Nebeneinander<br />
von soziologischer Theorie der Profession <strong>und</strong> radikaler Infrage<br />
3<br />
stellung von Professionalisierung konstatieren.<br />
Die zunächst rein intellektuelle Diskussion über die Deprofessionalisierung<br />
<strong>und</strong> Mobilisierung der Laien erweiterte sich im Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong><br />
Sozialbereich zu einem sozialen Prozeß. In den Selbsthilfegruppen, die in<br />
der Ges<strong>und</strong>heitsbewegung auch die Kontinuität einer ges<strong>und</strong>heitspolitischen<br />
Öffentlichkeit gewonnen haben — besonders bekannt geworden sind<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
die „Ges<strong>und</strong>heitstage", die sich offen als Konkurrenz zur professionellen<br />
Öffentlichkeitsarbeit der Ärztetage konstituierten —, ward die Mobilisierung<br />
der Laien Alltagspraxis, gewinnt die Deprofessionalisierung der Hilfen konkrete<br />
Gestalt 4 .<br />
Warum im Bildungsbereich, in dem die öffentliche Diskussion über Deprofessionalisierung<br />
begonnen hat — erinnert sei an die Unterstützung <strong>und</strong><br />
Weiterführung von Illich's „Entschulung der Gesellschaft" durch Hartmut<br />
von Hentig s — eine Laienbewegung letztlich ausgeblieben ist, kann hier<br />
dahingestellt bleiben. Die skizzierte Entwicklung im Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong><br />
Sozialbereich rechtfertigt es, von Deprofessionalisierung der Hilfen <strong>und</strong> Mobilisierung<br />
der Laien als einem <strong>gesellschaftliche</strong>n Prozeß zu sprechen. Dieser<br />
Prozeß zeichnet sich durch die folgenden Merkmale aus.<br />
1. Die gr<strong>und</strong>legenden Wertorientierungen professionellen Handelns büßen<br />
ihre legitimierende Funktion ein. Professionelles Handeln orientiert sich<br />
an wissenschaftlichen Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> beruht auf der Anwendung des technischen<br />
Fortschritts. Wissenschaftlich-methodischer Fortschritt <strong>und</strong> technische<br />
Potenzierung werden mit einer Steigerung professioneller Handlungschancen<br />
gleichgesetzt. Dieses Gleichsetzen der Qualität professionellen<br />
Handelns mit der Anwendung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts<br />
löst sich auf. Es kommt zur Abwendung von der kulturellen Tradition der<br />
Profession <strong>und</strong> zur Suche nach alternativen Identifikationen für die Qualität<br />
professionellen Handelns.<br />
2. Die Bedürfnisse, denen die professionelle Arbeit dienen soll, beanspruchen<br />
Geltung als eine Instanz der sozialen Kontrolle <strong>und</strong> der Bewertung<br />
professioneller Dienstleistungen. Sie wollen Prioritäten setzen. Die Gleichsetzung<br />
einer Ausweitung des professionellen Dienstleistungsangebots mit<br />
einem steigenden Niveau der Befriedigung ges<strong>und</strong>heitlicher <strong>und</strong> sozialer<br />
Bedürfnisse verliert ihre Glaubwürdigkeit. Anbieter- <strong>und</strong> Nachfrageorientierung<br />
kommen in der Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sozialpolitik nicht länger zur Dekkung<br />
6 .<br />
3. Die Profession spaltet sich, es kommt zur Bildung rivalisierender Eliten<br />
mit divergierenden professionspolitischen Zielsetzungen.<br />
4. Die miteinander rivalisierenden Eliten der Profession suchen die Laien<br />
zu mobilisieren, um die Legitimation ihres Führungsanspruches zu erhalten<br />
<strong>und</strong> zu verbessern.<br />
5. Die Laien organisieren Leistungen in Tätigkeitsfeldern, die von den Professionen<br />
beansprucht werden. Sie legitimieren ihre Aktivitäten in einer die<br />
Profession zweifach diskreditierenden Weise. Sie begründen ihre Initiativen<br />
mit den Defiziten professioneller Versorgung, Selbsthilfegruppen werden<br />
dort tätig, wo die professionelle Versorgung versagt, <strong>und</strong> sie bringen ein<br />
alternatives Prinzip der Leistungserbringung zum Tragen: Selbst- bzw. gegenseitig<br />
erbrachte Leistungen als Alternative zu beruflich-entgeltlichen<br />
Dienstleistungen .<br />
7<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
6. Die Machtbalance zwischen Staat <strong>und</strong> professioneller Autonomie wandelt<br />
sich. Das Tätigkeitsfeld der Profession ist durch staatliche Mittel, also<br />
durch Beteiligung an der politischen Herrschaft gesichert bei voller Autonomie<br />
der Professionen in der Bestimmung der Inhalte ihrer Tätigkeit. Die<br />
Ausleihe von Mitteln staatlicher Herrschaft an autonom handelnde Professionen<br />
ist zweifach legitimiert: durch die Bindung professionellen Handelns<br />
an die wissenschaftliche Rationalität <strong>und</strong> durch die Klientenorientierung<br />
professionellen Handelns. Beide Legitimationen werden brüchig, weil die<br />
Identifikation der Qualität professionellen Handelns mit dem wissenschaftlich-technischen<br />
Fortschritt nicht länger gelingt <strong>und</strong> weil die Laien selbst<br />
die Klientenorientierung professionellen Handelns überzeugend in Frage<br />
stellen.<br />
Soziologie der Profession <strong>und</strong> Theorien postindustrieller Gesellschaften<br />
Die genannten Merkmale der Deprofessionalisierung der Hilfen <strong>und</strong> der<br />
Mobilisierung der Laien im Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sozialbereich zwingen zu<br />
einer Revision soziologisch begründeter <strong>gesellschaftliche</strong>r Reformerwartungen.<br />
Gehörte es doch zum gesicherten Bestand der Modernisierungstheorien<br />
für die nachindustrielle Phase <strong>gesellschaftliche</strong>r Entwicklung, den<br />
Professionen eine Schlüsselrolle zuzuweisen . Um hier nur kurz an einiges<br />
8<br />
zu erinnern: Professionen in der Gestalt der wissenschaftlich-technischen<br />
Intelligenz, als Avantgarde des <strong>gesellschaftliche</strong>n Fortschritts, als Basis für<br />
die Ausbreitung fortschrittlicher politischer Ideen, als Werkzeug für die Befriedigung<br />
wesentlicher postindustrieller Bedürfnisse nach Bildung, nach<br />
Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> nach sozialer Unterstützung.<br />
Die strategische Einbeziehung der Professionen in makro-soziologische<br />
Überlegungen zur Weiter<strong>entwicklung</strong> der Gesellschaft verleiht den Theorien<br />
der Profession ein größeres Gewicht, als ihnen im Rahmen bereichsspezifischer<br />
Theorienbildung, der Berufs<strong>soziologie</strong> zukommt. Dabei hat — wenn<br />
ich recht sehe — nie eine intensive gegenseitige Bezugnahme zwischen den<br />
makro-soziologischen Theorien zur postindustriellen Gesellschaft <strong>und</strong> den<br />
bereichsspezifischen Theorien zur Profession stattgef<strong>und</strong>en, aus naheliegenden<br />
Gründen. Denn es gibt keine Reibungsflächen, in denen einander widersprechende<br />
Aussagen aufeinanderstoßen. Im Gegenteil, beide Theoriefelder<br />
ergänzen einander im gesellschaftspolitisch Erwünschten.<br />
Eine wichtige makro-soziologische Aussage betrifft die Ausweitung des<br />
öffentlichen, im engeren Sinne des sozialstaatlichen Dienstleistungssektors:<br />
mehr Wissenschaft, mehr wissenschaftlich ausgebildete Berufe, mehr Bildung,<br />
mehr Ges<strong>und</strong>heit, mehr soziale Unterstützung. In diesem Bild einer<br />
nachindustriellen Phase <strong>gesellschaftliche</strong>r Entwicklung, in dem sich beschreibende<br />
mit wertenden Charakterzügen mischen, erfüllen die Professionen,<br />
also Berufe, deren Identität durch formale wissenschaftliche Schulung<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
<strong>und</strong> durch die Vermittlung <strong>und</strong> Anwendung wissenschaftlichen Wissens<br />
hergestellt wird, eine unersetzliche Funktion. Bereits durch ihre Existenz<br />
kennzeichnen sie die <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklungsphase (postindustriell =<br />
Dienstleistungsgesellschaft). Ihre eigene Dynamik konvergiert mit der gesamt<strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Dynamik, die Professionen sind das Werkzeug für<br />
das Erreichen eines neuen <strong>gesellschaftliche</strong>n Aggregatzustandes. In die Konturen<br />
eines solchen Schemas fügen sich die wesentlichen Bestandteile der<br />
Theorie der Profession unschwer ein.<br />
1. Professionelle Arbeit ist die qualifizierteste Form <strong>gesellschaftliche</strong>r<br />
Arbeit. Wenn der Anteil der Professionellen unter den Beschäftigten zunimmt,<br />
wird das Qualifikationsniveau der Arbeit in der Gesellschaft erhöht.<br />
2. Professionelle Arbeit erreicht das höchste Niveau der Autonomie in<br />
der <strong>gesellschaftliche</strong>n Arbeit. Die Zunahme professioneller Arbeit erhöht<br />
daher die Chance der Selbstbestimmung <strong>und</strong> der Selbstverwirklichung in<br />
der <strong>gesellschaftliche</strong>n Arbeit.<br />
3. Professionelle Arbeit orientiert sich an wissenschaftlicher Erkenntnis,<br />
sie verkörpert daher ein Höchstmaß an <strong>gesellschaftliche</strong>r Rationalität.<br />
Professionelle Arbeit ist mit fortschreitender wissenschaftlicher Erkenntnis<br />
offen für den sozialen Wandel. Die Ausbreitung professioneller Arbeit erhöht<br />
das Niveau <strong>gesellschaftliche</strong>r Rationalität <strong>und</strong> gibt dem sozialen Wandel<br />
eine größere Durchsetzungschance.<br />
4. Professionelle Arbeit verkörpert in mehrfacher Hinsicht selbstreflexives<br />
soziales Handeln: es bewertet sich selbst, denn es trägt seine eigenen Maßstäbe<br />
in sich, es verantwortet sich selbst, das ist der wesentliche Inhalt der<br />
professionellen Autonomie, es steuert seine eigene Dynamik. Ihr selbstreflexiver<br />
Charakter gibt der professionellen Arbeit Anteil an der <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Evolution.<br />
5. Professionelle Arbeit dient Bedürfnissen, deren Befriedigung im Fokus<br />
gesamt<strong>gesellschaftliche</strong>r Ziele liegen: Bildung, Ges<strong>und</strong>heit, soziale Unterstützung.<br />
6. Professionelle Arbeit potenziert sich in <strong>gesellschaftliche</strong>n Teilsystemen:<br />
im Wissenschafts- <strong>und</strong> Hochschulsystem, im Bildungssystem, im Medizinsystem,<br />
im Sozialleistungssystem. Die genannten Systeme zeichnen sich dadurch<br />
aus, daß sie öffentlich finanziert, wichtige gesellschaftspolitische<br />
Bedürfnisse befriedigen <strong>und</strong> für eine gesellschaftspolitische Planung zur Disposition<br />
stehen. Wissenschafts-, Hochschul-, Bildungs-, Ges<strong>und</strong>heits-, sozialpolitische<br />
Planung bilden den bevorzugten Gegenstand einer „aktiven Professionalisierung"<br />
der Soziologie 9 .<br />
Deprofessionalisierung der Hilfen <strong>und</strong> Mobilisierung der Laien lösen das<br />
harmonische Bild auf, zu dem sich makro-soziologische Aussagen zur<br />
diagnostizierten <strong>und</strong> gesellschaftspolitisch emünschten Weiter<strong>entwicklung</strong><br />
der Gesellschaft mit den bereichsspezifischen Aussagen zur Stellung der<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Professionen in der <strong>gesellschaftliche</strong>n Arbeit zusammenfügen. In dem Maße,<br />
wie theoretisch die <strong>gesellschaftliche</strong> Forschrittlichkeit der Professionen bestritten<br />
wird, praktisch sich Gegenbewegungen bilden, die Deprofessionalisierung<br />
fordern <strong>und</strong> auf die Selbsthilfe an Stelle von professioneller Hilfe<br />
bauen, geraten soziologische Theoriebestände ins Wanken, die Glaubenssätze<br />
der Gesellschaftspolitik ausmachen. Gerade gegenüber den diagnostischen<br />
Aussagen zur <strong>gesellschaftliche</strong>n Entwicklung, in denen die Soziologie<br />
Gesellschaftspolitik begründet, zumindest legitimiert, stellen sich ernsthafte<br />
Zweifel ein. Ich werde mich hier auf drei gesellschaftspolitisch besonders<br />
wirksame Theorien beschränken:<br />
— die soziologischen Theorien zur Sozialpolitik,<br />
— Theorien zur Organisation des Wissens, zu seinem Erwerb <strong>und</strong> zu seiner<br />
Verteilung <strong>und</strong><br />
— Theorien pluralistischer Machtgleichgewichte.<br />
Dabei wird es vor allem um die Erörterung implizierter theoretischer Annahmen<br />
gehen. Für die Sozialpolitik geraten zwei Annahmen ins Wanken,<br />
die sog. Dienstleistungsstrategie <strong>und</strong> die sozialpolitische Planung, letztere<br />
insbesondere in ihrem Anspruch Bedarf zu planen.<br />
Die sozialpolitische Dienstleistungsstrategie im Sog der<br />
Deprofessionalisierung<br />
Als Dienstleistungsstrategie können wir Badura <strong>und</strong> Groß folgend die Aktionsrichtung<br />
der Sozial- <strong>und</strong> Gesellschaftspolitik bezeichnen, die über per<br />
10<br />
sönliche Dienstleistungen, die als öffentliche oder soziale Güter angeboten<br />
werden, Bedürfnisse nach Bildung, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> sozialer Hilfe befriedigt.<br />
Die Dienstleistungen ergänzen wirksam die historisch vorangegangenen<br />
sozialpolitischen Aktionsrichtungen, die sich als Rechtsgestaltung <strong>und</strong> als<br />
Einkommensumverteilung kennzeichnen lassen. Die sozialpolitische Dienstleistungsstrategie<br />
beruht auf zwei soziologischen Annahmen:<br />
a) Die Ausweitung der persönlichen Dienstleistungen, die Erleichterung<br />
der Zugänglichkeit für die Bevölkerung sowie die Erhöhung der Akzeptanz<br />
des Dienstleistungsangebots in der Bevölkerung decken alle wesentlichen<br />
Bedürfnisse nach Bildung, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> sozialer Hilfe ab. Die Dienstleistungsstrategie<br />
vollendet den Wohlfahrtsstaat, sie schließt das System<br />
sozialer Sicherheit ab. Defizite in der Befriedigung der Bedürfnisse sind<br />
Mängel in der Quantität oder Qualität der Dienstleistungen, nicht dagegen<br />
strukturelle Mängel der Dienstleistungsstrategie selbst 11 .<br />
b) Das Eigeninteresse der Dienstleistungsberufe deckt sich mit dem Interesse<br />
der Leistungsempfänger. Diese Annahme deutet eine gr<strong>und</strong>legende<br />
soziologisch-theoretische Aussage zum Beruf in bemerkenswerter Weise um.<br />
Berufe sind eine Form der Spezifikation von Arbeitsleistungen, die zur<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Gr<strong>und</strong>lage einer dauerhaften Erwerbschance gemacht werden — so wirtschaftsoziologisch<br />
Max Weber . Für die professionellen Dienstleistungen<br />
12<br />
dagegen wird ihre „Gesellschaftsorientierung" führend — so soziologischtheoretisch<br />
Talcott Parsons <strong>und</strong> die ihm hierin folgende Theorie der Profession.<br />
Die Ausdifferenzierung von Arbeitsleistungen zu Berufen, zu Pro<br />
13<br />
fessionen zumal, die eine hohe <strong>gesellschaftliche</strong> Autonomie verkörpern<br />
<strong>und</strong> deren Leistungen anderen Menschen unmittelbar dienen, also persönliche<br />
Dienstleistungen sind, vermag im wesentlichen die Bedürfnisse der<br />
Leistungsempfänger abzudecken, weil die Professionen aufgr<strong>und</strong> ihrer<br />
Expertenfunktionen diese Bedürfnisse besser kennen als Laien <strong>und</strong> klientenorientiert<br />
„selbstlos" handeln. Zu Recht hat Illich diese soziologische Annahme<br />
der Gleichsetzung von professionellen Anbieterinteressen mit Klienteninteressen<br />
als Trugschluß bezeichnet <strong>und</strong> als „radikales Monopol" kritisiert<br />
.<br />
14<br />
Den beiden Annahmen der Dienstleistungsstrategie setzen die Deprofessionalisierung<br />
<strong>und</strong> die Mobilisierung der Laien die Forderung entgegen, die Unabhängigkeit<br />
der Bedürfnisse gegenüber der bedarfsbestimmenden Interpretation<br />
der Professionen zu wahren. Sie decken die Grenzen der Dienstleistungsstrategie<br />
auf. Sie arbeiten die Divergenz von professionellen Anbieterinteressen<br />
<strong>und</strong> Interessen der Klienten heraus. Die Klienten beginnen ihre<br />
Bedürfnisse außerhalb des professionellen Dienstleitungsangebots selber im<br />
Wege der Selbsthilfe abzudecken.<br />
Sozialpolitische Planung <strong>und</strong> Mobilisierung der Laien<br />
Durchaus entsprechend evolutionstheoretischen Annahmen hat die Dienstleistungsstrategie<br />
zu einer Selbstthematisierung geführt. Gesellschaftspolitisch<br />
gesehen ist die Dienstleistungsstrategie ein selbstreflexiver Prozeß .<br />
15<br />
Denn sie bildet Gegenstand der Planung, für die im Dienstleistungsangebot<br />
eigene Institutionen eingerichtet <strong>und</strong> unterhalten werden: Bildungs- <strong>und</strong><br />
Hochschulplanung, Krankenhausbedarfsplanung, Kassenarztbedarfsplanung,<br />
Altenplanung, Planung von Sozialstationen usw. In den Planungen erfüllt<br />
sich zugleich die alte sozialistische <strong>und</strong> soziologische Hoffnung, daß die <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Entwicklung nicht dem Selbstlauf oder dem Wirken anonymer<br />
Mechanismen überantwortet, sondern daß die Steuerung der <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Entwicklung zum Gegenstand bewußten, rationalen Handelns<br />
werden soll. Die öffentliche Finanzierung der Dienstleistungen, ihre Angebotsformen<br />
als öffentliche <strong>und</strong> soziale Güter, geben solchen Erwartungen<br />
die materielle Gr<strong>und</strong>lage. Sie können sich in der planvollen Befriedigung<br />
wichtiger <strong>gesellschaftliche</strong>r Bedürfnisse verwirklichen.<br />
Der Anspruch der sozialpolitischen Planungen geht dahin, nicht nur das<br />
Angebot geordnet auf den Weg zu bringen <strong>und</strong> es gleichmäßig zu verteilen,<br />
sondern den Bedarf selbst zu planen. Da für den Bedarf jedoch keine ange-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
otsunabhängigen Kriterien bestehen, gehen in die genannten sozial- <strong>und</strong><br />
gesellschaftspolitischen Planungen die Parameter des Angebots ein. Sozial<strong>und</strong><br />
gesellschaftspolitische Planung ist zweifellos ein selbstreflexiver Prozeß,<br />
der das Dienstleistungsangebot wohl mit sich selbst, aber nicht mit den Bedürfnissen<br />
der Klienten vermittelt 16 .<br />
Die Deprofessionalisierung <strong>und</strong> die Mobilisierung der Laien haben unmittelbar<br />
keine Chance, die sozial- <strong>und</strong> gesellschaftspolitischen Planungsprozesse<br />
zu beeinflussen. Erst die Verknappung öffentlicher Ressourcen<br />
macht ein Bündnis zwischen den finanzierenden Instanzen <strong>und</strong> den Basisbewegungen<br />
der Klienten möglich, um die professionellen Anbieterinteressen<br />
in den Planungsprozessen zu beschneiden 17 .<br />
Die Durchsetzungsfähigkeit von Klienteninteressen gegenüber den Planungsinteressen<br />
setzt allerdings eine Verschiebung der Gleichgewichte pluralistischer<br />
Machtverteilung voraus. Diese wird jedoch vorhersehbar nur<br />
dann zu einer besseren Befriedigung von Klientenbedürfnissen führen, wenn<br />
es den Basisbewegungen gelingt, eine organisatorische Gr<strong>und</strong>lage für ihr<br />
Machtpotential aufzubauen. Andernfalls führt die Deprofessionalisierung<br />
<strong>und</strong> die Mobilisierung der Laien lediglich zu einer Verschlechterung des<br />
professionellen Dienstleistungsangebots <strong>und</strong> zu einer dementsprechenden<br />
Entlastung öffentlicher Haushalte.<br />
Theorien der Organisation des Wissens, des Wissenserwerbs<br />
Die Professionen sind ein beliebtes soziologisches Paradigma für die Steuerung<br />
der <strong>gesellschaftliche</strong>n Entwicklung durch Prozesse formaler Sozialisation.<br />
Folgen wir der klassischen Definition beruflicher, speziell professioneller<br />
Sozialisation von Robert K. Merton , dann können wir die Elemente<br />
19<br />
einer soziologischen Theorie des Wissens <strong>und</strong> des Wissenserwerbs in der hier<br />
bebotenen Kürze prägnant herausheben.<br />
„Professionelle Sozialisation als soziologischer Begriff bezeichnet die sozialen<br />
Prozesse, in denen Personen selektiv die Werte <strong>und</strong> Einstellungen, die<br />
Interessen, Fähigkeiten <strong>und</strong> Fertigkeiten, sowie das Wissen erwerben, das<br />
zur Kultur — oder sagen wir es Merton interpretierend prononcierter — das<br />
zum gesellschaftlich fungierenden Wissen des Personenkreises gehört, zu<br />
dem die sich sozialisierenden Personen gehören oder in den sie als Mitglieder<br />
aufgenommen werden wollen."<br />
Merton bringt in dieser Definition eine für unsere Überlegungen wichtige<br />
soziologische Annahme auf den Begriff. Professionen sind definiert<br />
durch die andere ausschließende Verfügung über gesellschaftlich fungierendes<br />
Wissen — der von Merton verwendete Ausdruck „culture" ist schwierig<br />
seinem gemeinten Sinne nach ins Deutsche zu übertragen. Der privilegierte,<br />
vor allem der die Klienten ausschließende Besitz gesellschaftlich fungierenden<br />
Wissens bildet die Gr<strong>und</strong>lage für die Schlüsselstellung der Professionen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Sie wird durch Zuschreibungen von Prestige, also durch Meinungsbildungsprozesse,<br />
in hohem Grade gestützt <strong>und</strong> verstärkt. Wissenschaftliches Wissen,<br />
wie es an den Ausbildungsstätten der Professionen, den Hochschulen, produziert,<br />
vermittelt <strong>und</strong> weiterentwickelt wird, gilt nicht nur in Laienkreisen<br />
als ein „Höchstmaß an erreichbarer <strong>gesellschaftliche</strong>r Rationalität" — das<br />
Höchstmaß <strong>gesellschaftliche</strong>r Rationalität verkörpert für Max Weber das<br />
„wissenschaftliche Denken" 20 . Wissenschaftliche Einrichtungen <strong>und</strong> die Berufe,<br />
die an diesen Einrichtungen durch ihre Sozialisation teilhaben, entwickeln<br />
sich zu <strong>gesellschaftliche</strong>n Referenzzentren. Ihnen kommt ein Prestigemonopol<br />
zugute, über „gesicherte Erkenntnisse", zumindest über den<br />
neuesten Erkenntnisstand, zu verfügen. Dies hat eine selten richtig eingeschätzte<br />
Haltung zur Folge.<br />
In den Situationen des praktischen Alltagslebens spielt sich die Vermutung<br />
ein: Es gibt ein Wissen, das der Alltagserfahrung, dem common sense<br />
der Bürger, in jedem Falle überlegen ist. Über dieses Wissen verfügen die Personen,<br />
die es im Wege formaler Sozialisation erworben haben: die Experten.<br />
Wir können diese Situation als die geistige, die wissensmäßige Dependenz<br />
der Laien von den Professionen bezeichnen 21 . Sie bleibt auch in der<br />
Laienbewegung erhalten 22 . Die wissensmäßige Dependenz führt folgerichtig<br />
zu einer Entwertung anderer Formen des Wissenserwerbs neben der formalen<br />
Sozialisation. Denn der Laie, der nicht-professionelle Bürger lernt in<br />
anderer Weise. Er lernt wie wir sagen autodidaktisch. Autodidaktisches Lernen<br />
ist situationsbezogen, entwickelt sich aus spezifischen Anlässen, ist erfahrungsgeb<strong>und</strong>en<br />
<strong>und</strong> bedürfniskontrolliert. Vor allem aber bleibt es an<br />
einen zufällig zusammengekommenen Personenkreis geb<strong>und</strong>en. Dem autodidaktischen<br />
Lernen fehlt die <strong>gesellschaftliche</strong> Unterstützung, die dem professionellen<br />
Lernen in überwältigender Fülle zuteil wird. Die Bildungsanstrengungen<br />
postindustrieller Gesellschaften konzentrieren sich auf die professionellen<br />
Lernprozesse <strong>und</strong> auf die professionell sozialisierten Personenkreise.<br />
Denn nur diese lassen sich nach Bildungsplan „produzieren". Sie beschränken<br />
sich auf das <strong>gesellschaftliche</strong> Wissen, das in dieser Form aufbereitet,<br />
aufbewahrt, weiterentwickelt <strong>und</strong> vermittelt werden kann.<br />
Die Forderung der Laienbewegung, die geistige, wissensmäßige Dependenz<br />
aufzubrechen, also das professionelle Wissen beratend <strong>und</strong> dienend,<br />
nicht autoritativ einzubringen <strong>und</strong> autodidaktischen Lernprozessen mehr<br />
materielle Unterstützung, mehr <strong>gesellschaftliche</strong> Anerkennung zu geben,<br />
muß ernst genommen werden. Ernsthafte Schritte in eine Gleichberechtigung<br />
alltagsweltlicher Wissensgewinnung würden allerdings zur Folge haben,<br />
daß professionelle Dominanz ihre eigene Konkurrenz, ja, ihre Alternative<br />
fördert <strong>und</strong> unterstützt. Eine, in der Tat, unsoziologische Annahme, wenn<br />
wir nicht Veränderungen im Machtgleichgewicht ins Auge fassen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Pluralistisches Machtgleichgewicht <strong>und</strong> professionelle Autonomie<br />
Makrosoziologisch gesehen, ist die Theorie der Profession Bestandteil einer<br />
pluralistischen Machttheorie. Sie beruht auf einem Gleichgewicht zwischen<br />
staatlicher Einflußnahme <strong>und</strong> professioneller Autonomie. Es gibt zu denken,<br />
daß dieser Zusammenhang bisher nur aus einer soziologischen Denkrichtung<br />
in die Diskussion eingebracht worden ist, ohne daß dieser Vorstoß<br />
eine i.e. S. wissenschaftliche Erörterung ausgelöst hat. Helmut Schelsky<br />
<strong>und</strong> Horst Baier haben prononciert die These herausgearbeitet, daß<br />
23<br />
ein Bündnis zwischen staatlichem Herrschaftsapparat <strong>und</strong> einer Laien- <strong>und</strong><br />
Basisbewegung, das die professionelle Autonomie gleichsam in die Zange<br />
nehmen würde, ein Abgleiten in eine wohlfahrtsstaatliche Diktatur zur Folge<br />
haben werde. Beide sehen in der Autonomie der Professionen eine Garantie<br />
für persönliche Freiheit in <strong>und</strong> gegenüber dem Staat. Professionelle<br />
Autonomie setzt dem Staat Grenzen <strong>und</strong> bewahrt die Massendemokratie<br />
vor dem Abgleiten in eine sozialstaatliche Diktatur bürokratischer Eliten.<br />
Um die Tragweite dieser These abschätzen zu können, ist es erforderlich,<br />
einige Bemerkungen zur Struktur der Machtbalance voranzuschicken,<br />
die sich zwischen dem Wohlfahrtsstaat <strong>und</strong> den in diesem Sektor operierenden<br />
Professionen eingespielt hat. Die gesellschafts- <strong>und</strong> sozialpolitische<br />
Dienstleistungsstrategie hat eine Aufteilung von Einflußzonen zur materiellen<br />
Voraussetzung. Die Finanzierung über Zwangsabgaben (Steuern <strong>und</strong><br />
Sozialbeiträge) <strong>und</strong> die gesetzliche Normierung eines Handlungsspielraumes<br />
durch staatliche oder staatlich beauftragte Instanzen ist abgetrennt von der<br />
Erbringung der Dienstleistungen, diese selbst bleibt der professionellen<br />
Autonomie weitgehend überlassen. Die Aufteilung der Einflußsphären wird<br />
selbst dann nicht verlassen, wenn die Steuerungsinstrumente nicht mehr in<br />
der Lage sind, die Dynamik ausreichend zu beherrschen.<br />
Das Machtgleichgewi cht zwischen Staat <strong>und</strong> Professionen beruht auf<br />
einer gegenseitigen Inanspruchnahme <strong>und</strong> auf gegenseitigen Vorteilen. Professionelle<br />
Dienstleistungen, in der Angebotsform öffentlicher Güter,<br />
nutzen staatliche Herrschafts- <strong>und</strong> Organisationsmittel, wie Eingriffe in die<br />
Einkommensverteilung <strong>und</strong> gesetzliche Verbürgungen des Dienstleistungssystems.<br />
In die Theorie der Professionen ist jedoch die Inanspruchnahme<br />
staatlicher Herrschaftsmittel allenfalls am Rande eingegangen. Selbst Autoren,<br />
wie Freidson („Dominanz der Experten") haben die politischen<br />
24<br />
Machtgr<strong>und</strong>lagen der Professionen nicht als Element in ihre Theorie einbezogen.<br />
Umgekehrt gewinnt der Staat in der Autonomie der Professionen<br />
ein Selbststeuerungspotential, das er durch eigene Leitungs- <strong>und</strong> Lenkungsinstrumente<br />
kaum in vergleichbarer Qualität produzieren könnte. Er macht<br />
sich in der Durchsetzung der Dienstleistungsstrategie abhängig von dem professionellen<br />
Selbstinteresse, entlastet sich aber weitgehend von der Feinsteuerung<br />
des Dienstleistungsangebots.<br />
Die schon sy<strong>mb</strong>iotisch zu nennende Machtbalance droht aus dem<br />
Gleichgewicht zu geraten, wenn die implizit unterstellte Identität von An-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ieter- <strong>und</strong> Klienteninteressen sich als brüchig erweist. Die Dienstleistungsstrategie<br />
läßt sich dann nicht länger als gesellschaftspolitische Selbstdarstellung<br />
des Staates gegenüber den Bürgern nutzen. Ausweitung professioneller<br />
Dienstleistungen im Wissenschafts-, Bildungs-, Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sozialbereich<br />
vermag zur Mobilisierung von Wählerstimmen, zum positiven Bild<br />
vom Regierungsmehrheiten in der öffentlichen Meinung nichts mehr beizutragen,<br />
zumal wenn zu diesem Zweck Sozialabgaben <strong>und</strong> Steuern erhöht,<br />
die Bürger zum Konsumverzicht auf anderen Gebieten aufgefordert werden.<br />
Es ist daher kein Zufall, daß Deprofessionalisierung <strong>und</strong> Mobilisierung der<br />
Laien parallel zur Finanzkrise der Sozial- <strong>und</strong> öffentüchen Haushalte die<br />
Diskussion beeinflussen.<br />
Allerdings wird man bei einer realistischen Betrachtungsweise zugeben<br />
müssen, daß die Laienbewegung bisher jedenfalls eher zu einer Verschärfung<br />
des Krisenbewußtseins als zu einer tatsächlichen Veränderung der Machtbalance<br />
beigetragen hat. Eine Veränderung der Machtbalance ist nach meiner<br />
Einschätzung nur dann zu erwarten, wenn die Laienbewegung zum Bestandteil<br />
einer breiteren Politisierung in der Bevölkerung wird, die das Gefüge<br />
der parteien- <strong>und</strong> verbändestaatlichen Demokratie verändert sowie im<br />
Zuge einer solchen politischen Bewegung den Basisgruppen zu einer Institutionalisierung<br />
im Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sozialbereich verhilft .<br />
25<br />
Eine größere Wahrscheinlichkeit hat dagegen die Entwicklung für sich,<br />
bei der es zu einer Verschärfung in der Auseinandersetzung zwischen konfligierenden<br />
professionellen Eliten kommt. Die Mobilisierung der Laien<br />
diente dann der Durchsetzung <strong>und</strong> Machtsicherung neuer professioneller<br />
Eliten. Ein solcher Prozeß wird durch die Expansion im tertiären Bildungsbereich,<br />
also durch die Zunahme von professionellen Berufsanfängern bei<br />
gleichzeitiger Rigidität der Organisation professioneller Leistungen stark<br />
gefördert . Die hierdurch eingeleitete Selbstauflösung einer überkommenen<br />
professionellen Struktur begünstigt eine Verstärkung des staatlichen<br />
26<br />
Einflusses <strong>und</strong> bringt den Sozialabbau im öffentlichen Dienstleistungsangebot<br />
voran. Betroffen wären hiervon nicht allein die Professionen, sondern<br />
gleichermaßen die Verbände <strong>und</strong> Körperschaften, bei denen die Finanzierung<br />
des Sozialleistungsbereichs liegt, also die Sozialversicherungs- <strong>und</strong> die<br />
freigemeinnützigen Verbände. Verlierer bei einer solchen Machtverschiebung<br />
wären aber in jedem Falle die Klienten, die Laien .<br />
27<br />
Als Fazit unserer Überlegungen schält sich heraus,<br />
1. Der Laienbewegung fehlt eine ausreichende organisatorische <strong>und</strong> politische<br />
Basis, um die professionelle Dominanz wirksam zurückzudrängen <strong>und</strong><br />
die gesellschaftspolitische Planung zu beeinflussen.<br />
2. Die Laienbewegung ist stark genug, um die <strong>gesellschaftliche</strong> Legitimation<br />
der Professionen zu erschüttern. Sie verstärkt die durch die Bildungs<strong>und</strong><br />
Hochschulreform ausgelösten Wandlungsprozesse.<br />
3. Die umfassende Rolle des Selbsthilfeprinzips wird neue Formen des<br />
Wissenserwerbs (neben formaler Sozialisation autodidaktisches Lernen) <strong>und</strong><br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
der Wissensverteilung (Austausch situationsbezogenen <strong>und</strong> erfahrungsgeb<strong>und</strong>enen<br />
Wissens) institutionalisieren. Daher bedeutet Laisierung <strong>und</strong> Entprofessionalisierung<br />
letztlich einen Zugewinn an <strong>gesellschaftliche</strong>r Rationalität!<br />
ANMERK<br />
UN GEN<br />
1 R. Dahrendorf, Bildung ist Bürgerrecht, Zeitbücher 1965.<br />
Sozialpolitik <strong>und</strong> persönliche Existenz. Festgabe für Hans Achinger, hg. von A.<br />
Blind, Chr. v. Ferber, H.-J. Krupp<br />
Ges<strong>und</strong>heitsbericht, hgg. vom B<strong>und</strong>esminister für Jugend, Familie <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit,<br />
Stuttgart 1971.<br />
2 Ivan Illich, Entschulung der Gesellschaft. Entwurf eines demokratischen Bildungssystems,<br />
1973 in (Original Open Forum Series [Caldor & Boyars], London 1971:<br />
Deschooling Society).<br />
— , 1975 Die Enteignung der Ges<strong>und</strong>heit, Reinbek 1975 (Medical Nemeris 1975).<br />
— , Entmündigung durch Experten, Reinbek 1979.<br />
3 Hansjürgen Daheim, Der Beruf in der modernen Gesellschaft: Versuch einer soziologischen<br />
Theorie beruflichen Handelns. Köln/Berlin 1967, 2. Aufl. 1970.<br />
— , „Berufs<strong>soziologie</strong>". In: R. König (Hg.), Handbuch der empirischen Sozialforschung<br />
K&. 8. Stuttgart (Enke) 1977, S. 1-100.<br />
Hans Albrecht Hesse, Berufe im Wandel, Stuttgart (Enke) 1968.<br />
Heinz Hartmann, „Arbeit, Beruf, Profession". In: Soziale Welt, 19. Jg. 1968, S. 197<br />
-212.<br />
Thomas Luckmann <strong>und</strong> Walter Michael Sprondel (Hg.), Berufs<strong>soziologie</strong>. Köln<br />
1972.<br />
4 Ilona Kickbusch u. Alf Trojan (Hg.), Gemeinsam sind wir stärker. Frankfurt 1981.<br />
Monika Dobler, Volker Enkerts, Christoph Kranich, Alf Trojan (Hg.), Wünsche, Wissen,<br />
Widerstand. Ha<strong>mb</strong>urg 1984.<br />
Ges<strong>und</strong> sein 2000. Berlin 1984.<br />
Ulf Fink, „Neue Wege in der Sozial- <strong>und</strong> Gesellschaftspolitik. Selbsthilfe, Nachbarschaftshilfe,<br />
freie <strong>und</strong> lokale Initiativen." In: Soziale Arbeit, 33. Jg. 1984, S. 377<br />
-382.<br />
5 Hartmut von Hentig, Die Wiederherstellung der Politik. Stuttgart 1973.<br />
6 Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft, Staatlicher Eingriff <strong>und</strong> Selbstregulierungspotentiale<br />
im Ges<strong>und</strong>heitswesen. 2.-4. Juni 1982, Ulm.<br />
Chr. v. Ferber, „Wie ist eine klientenorientierte Ges<strong>und</strong>heitspolitik möglich?" Teilabdruck<br />
in Frankfurter R<strong>und</strong>schau, 7. August 1982 „Woran das Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
wirklich krankt"; ders., „Ges<strong>und</strong>heitspolitik in der B<strong>und</strong>esrepublik". In: Gegenwartsk<strong>und</strong>e,<br />
Gesellschaft, Staat, Erziehung, 19. Jg. SH 4, 1983, S. 113-125.<br />
Symposium Strukturreform der Gesetzlichen Krankenversicherung. B<strong>und</strong>esminister<br />
für Arbeit <strong>und</strong> Sozialforschung (Hg.) Forschungsberichte Band 90, Bonn 1983.<br />
7 Bernhard Badura <strong>und</strong> Chr. von Ferber (Hg.), Selbsthilfe <strong>und</strong> Selbstorganisation im<br />
Ges<strong>und</strong>heitswesen. <strong>München</strong> 1981.<br />
— (Hg.), Laienpotential, Patientenaktivierung <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsselbsthilfe, <strong>München</strong><br />
1983.<br />
Forschungsverb<strong>und</strong> Laienpotential, Patientenaktivierung <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsselbsthilfe<br />
(Hg.), Ges<strong>und</strong>heitsselbsthilfe <strong>und</strong> professionelle Dienste. Soziologische Gr<strong>und</strong>lagen<br />
einer bürger-orientierten Ges<strong>und</strong>heitspolitik. Integrierter Abschlußbericht. Düsseldorf<br />
(als Manuskript vervielfältigt) 1984.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
8 Daniel Bell, The Coming of post-industrial society. London 1974, Chap. 3, The<br />
dimensions of knowledge and technology: The new class structure of post-industrial<br />
society, S. 165-265.<br />
Radovan Richta <strong>und</strong> Kollektiv. Technischer Fortschritt <strong>und</strong> industrielle Gesellschaft.<br />
Nördlingen 1972.<br />
9 Universität Bielefeld, „Studienreform an der Fakultät für Soziologie". Schriften<br />
zum Aufbau einer Universität, Bd. 5, Bielefeld 1973.<br />
10 Bernhard Badura <strong>und</strong> Peter Gross, „Sozialpolitik <strong>und</strong> soziale Dienste. Entwurf einer<br />
Theorie personenbezogener Dienstleistungen." In: Chr. von Ferber <strong>und</strong> F.X. Kaufmann<br />
(Hg.), „Soziologie <strong>und</strong> Sozialpolitik". Sonderheft 19/1977. Kölner Zeitschrift<br />
für Soziologie <strong>und</strong> Sozialpolitik, S. 361 ff.<br />
11 Erwin Jahn u.a., „Die Ges<strong>und</strong>heitssicherung in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland.<br />
Analyse <strong>und</strong> Vorschläge zur Reform." WST-Studie Nr. 20. Köln 1971.<br />
12 Max Weber, Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft. Studienausgabe. Tübingen 1976, S. 80.<br />
13 Talcott Parsons, „Die akademischen Berufe <strong>und</strong> die Sozialstruktur (1983)". In:<br />
D. Rüschemeyer (Hg.), T. Parsons, Beiträge zur soziologischen Theorie. Neuwied<br />
3. Aufl. 1977, S. 160-179.<br />
14 Ivan Illich, Selbstbegrenzung. Eine politische Kritik der Technik. Reinbek 1975,<br />
S. 100.<br />
15 Niklas Luhmann, „Politische Planung". In: Ders., Politische Planung. Aufsätze zur<br />
Soziologie von Politik <strong>und</strong> Verwaltung. Opladen 1971.<br />
16 WIdO-Schriftenreihe Bd. 1. Kassenärztliche Bedarfsplanung. Wissenschaftliches Institut<br />
der Ortskrankenkassen, Bonn-Bad Godesberg 1978.<br />
Christiane Brühne, „Die Krankenhausbedarfsplanung in den Ländern der B<strong>und</strong>esrepublik.<br />
Sozialwissenschaftliche Begleitforschung zu „DOMINIG". BPT-Bericht<br />
6/78 <strong>München</strong> GSF Bereich Projektträgerschaft 1978.<br />
17 vgl. Ulf Fink (Anm. 4).<br />
18 vgl. Daniel Bell (Anm. 8).<br />
Ralf Dahrendorf (Anm. 1).<br />
19 Robert K. Merton, The student-physician. Harvard University Press 1957, Appendix<br />
A: Socialization a terminological note.<br />
20 Max Weber. Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft, Tübingen 1976, S. 32.<br />
21 Eliot Freidson. Dominanz der Experten. <strong>München</strong>, Berlin, Wien 1975.<br />
22 Forschungsverband Laienpotential, Patientenaktivierung <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsselbsthilfe<br />
(Anm. 7) S. 134 ff.<br />
23 Horst Baier, Medizin im Sozialstaat. Stuttgart (Enke) 1978. Ders., „Im Dienst des<br />
Leviathan — Ivan Illich herrschafts-soziologisch weitergedacht". In: Rainer Flöhl<br />
(Hg.),Maßlose Medizin? Heidelberg 1979, S. 7-31.<br />
24 Vgl. Anm. 21. Kritisch zu Freidson: Deborah A. Stone, Controlling the medical<br />
profession: Doctors and patients in West Germany. Ph. D. thesis Duke University,<br />
Durham, North Carolina 1976.<br />
25 Die Ges<strong>und</strong>heitsbewegung hat im Oktober 1984 ein gemeinsames ges<strong>und</strong>heitspolitisches<br />
Programm mit den Grünen vorgestellt. Vgl. Monika Dobler u.a. Anm. 4.<br />
26 WIdO-Schriftenreihe 2, „Das Ärzteangebot bis zum Jahr 2000". Wissenschaftliches<br />
Institut der Ortskrankenkassen, Bonn 1978.<br />
WIdO-Materialien 2, Personal<strong>entwicklung</strong> im Ges<strong>und</strong>heitswesen in Vergangenheit<br />
<strong>und</strong> Zukunft. Hgg. vom Wissenschaftlichen Institut der Ortskrankenkassen. Bonn<br />
1978.<br />
Ulrich Geißler, „Die zukünftige Entwicklung des Angebots an Ges<strong>und</strong>heitsberufen."<br />
In: Kosten <strong>und</strong> Effizienz im Ges<strong>und</strong>heitswesen. <strong>München</strong> 1985.<br />
27 Aus gewerkschaftlicher Sicht vgl. Gerhard Bäcker, „Entprofessionalisierung <strong>und</strong><br />
Laisierung sozialer Dienste — richtungsweisende Perspektive oder konservativer<br />
Rückzug?" WSI-Mitteilungen 32. Jg., 1979, S. 526-537.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
MÄRKTE, KÄUFLICHKEIT UND MORALÖKONOMIE<br />
Georg Elwert<br />
Die Ausdehnung der Märkte schien von Montesquieu bis zu den Strategen<br />
der Weltbank das bestimmende Merkmal von Entwicklung zu sein. Modernisierungstheorien<br />
<strong>und</strong> neomarxistische Theorien akzentuierten die Entwicklung<br />
der modernen Marktwirtschaften als eine Ausdehnung der Warenform<br />
(eine Kommodifizierung ), d.h. als eine fortschreitende Umwandlung<br />
1<br />
von Austauschbeziehungen in Warenbeziehungen.<br />
Sind demgegenüber all jene von Luther bis zu den Kritikern der Medizin-Wirtschaft<br />
, die bestimmte Expansionen des Warenprinzips zurückdrehen<br />
wollen, rückschrittlich? Sind es nur Begleitphänomene der historischen<br />
2<br />
Entwicklung?<br />
Die Darstellungen der Entwicklung der Marktgesellschaften, die nur die<br />
Expansion der Waren hervorheben, bringen uns nur die halbe Wahrheit.<br />
Die Ausdehnung des Warenverkehrs ist unbestreitbar. Sie ist jedoch, nach<br />
meiner These, nur dann dauerhaft, wenn ihr eine Einschränkung des Warenprinzips<br />
entspricht, wenn nicht alles käuflich werden kann. Nur dort, wo<br />
der Markt eingebettet ist, ist die Unverbrüchlichkeit des Versprochenen<br />
(Max Weber) gewährleistet.<br />
Diese Einbettung heißt zweierlei: Einmal impliziert sie eine systemische<br />
Differenzierung von Markt gegen Gesellschaft, <strong>und</strong> zum anderen muß eine<br />
andere Austauschform — ich nenne sie hier Moralökonomie — den Raum<br />
füllen (bei diesem Begriff lehne ich mich an James Scott <strong>und</strong> Edward P.<br />
Thompson an). Die Moralökonomie muß jenen Raum füllen, der zwar ausgegrenzt<br />
ist, in welchem aber immer noch potentiell der Tausch von Geld<br />
3<br />
gegen Leistung oder Gut, also der Warentausch, eindringen könnte. Meines<br />
Erachtens ist der Kapitalismus dort, wo er langfristig erfolgreich war, durch<br />
,,e<strong>mb</strong>eddedness" <strong>und</strong> nicht durch „dis-e<strong>mb</strong>eddedness", wie Polanyi meint,<br />
gekennzeichnet. Die weitgehende ,,dis-e<strong>mb</strong>eddedness", die uneingeschränkte<br />
Warenexpansion, führt nicht zu entfalteten Industriegesellschaf<br />
4<br />
ten, sie führt zur generalisierten Käuflichkeit, zur Venalität. In der Käuflichkeit,<br />
wie ich sie — sehr weit — definiere, werden nicht nur Güter des<br />
täglichen Bedarfs zu Waren; Liebe wird zur Prostitution, Recht zu Korruption,<br />
Gottes Gnade wird als „magic charm" oder als Ablaß käuflich.<br />
In dem Maße, in dem jedoch vertrauenstiftende Institutionen — Recht,<br />
Fre<strong>und</strong>schaft, religiös-moralische Kontrolle — auf einem Markt dem je<br />
Meistbietenden zu Diensten sind, unbeständig werden, in dem Maße kann<br />
das Marktversprechen nicht mehr garantiert werden. Statt den Vertrag zu<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
erfüllen, kann man Erzwingungsinstanzen bestechen. Und des schlechten<br />
Gewissens entledigt man sich durch Geldzahlungen an Gottes Vertreter.<br />
Das Wirtschaftssystem unterminiert sich selbst; die Modernisierung hat eine<br />
Sackgasse erreicht. Fernhandel ist nur noch innerhalb kleiner ethnischer<br />
oder religiöser Gemeinschaften, wie der Haussa, Juden, Auslands-Chinesen<br />
oder ähnlicher, möglich, die über ihre Mitglieder eine wirksame soziale Kontrolle<br />
ausüben können.<br />
In diesen Situationen treten charakteristischerweise soziale Bewegungen<br />
mit politisch-moralischer oder religiös-moralischer Programmatik auf, die<br />
die Käuflichkeit zurückdrängen wollen — bisweilen auch abschaffen möchten.<br />
Sie können unter bestimmten Bedingungen jene zweite Modernisierung<br />
bewirken, die — oft gegen ihre Intentionen — den Markt in der Gesellschaft<br />
stabilisiert: durch Eindämmung der Warenökonomie <strong>und</strong> Einbettung in eine<br />
Moralökonomie.<br />
Diese Moralökonomie hat eine eigentümliche Struktur. Nur zu Anfang<br />
etwa als „civisme" oder „virtues civiques" (Bürgertugenden) thematisiert,<br />
wird sie später in die Selbstverständlichkeit des Alltäglichen versenkt. Diese<br />
bestimmende Austauschform der generalisierten Reziprozität erinnert an<br />
Stammesgesellschaften. Und doch unterscheidet sie sich davon, wie ich<br />
später später ausführen werde.<br />
Soweit die Gr<strong>und</strong>struktur meiner Argumentation.<br />
Kerne dieser Argumentation finden sich bei mehreren älteren Autoren,<br />
bisweilen unverhofft, weil eingebaut/verbaut in Entwicklungstheorien, die<br />
linear-expansive Modelle zu entwerfen suchen. Darauf will ich jedoch erst<br />
zum Schluß zurückkommen.<br />
Eine Argumentation dieser Art zu belegen, erfordert mehrstufige historische<br />
<strong>und</strong> begriffliche Analysen in Kulturen sehr unterschiedlicher Tradition.<br />
Der Beleg kann nicht Sache eines Vortrags sein. Wohl aber kann man<br />
versuchen, ein Argument vorzustellen, an Beispielen plausibel zu machen.<br />
Ich beginne mit dem am wenigsten Vertrauten, der Venalität, der generalisierten<br />
Käuflichkeit, um an Ausschnitten historischer Entwicklungen<br />
einzelne der vorgenannten Elemente in einer Sequenz vorstellen zu können.<br />
Damit soll aber nicht suggeriert werden, daß entfaltete Marktwirtschaften<br />
immer auf einer Sequenz von erster Modernisierung/Expansion des Warenprinzips<br />
<strong>und</strong> zweiter Modernisierung/Eindämmung <strong>und</strong> Einbettung des<br />
Warenprinzips aufbauen müssen; beides kann auch konkomitant sein.<br />
Im heutigen Westafrika scheint der Warentausch nicht sehr entwickelt<br />
zu sein. Ein Großteil der Landwirtschaft dient noch der Subsistenzproduktion.<br />
Und doch hat die Geldwirtschaft — meist dort, wo wir sie nicht vermuten<br />
— die Gesellschaft tiefgreifend transformiert.<br />
Der Staat, die Religion <strong>und</strong> zum Teil die Familie sind weitgehend warenökonomisch<br />
transformiert. Die Korruption ist Normalität. Wir dürfen<br />
hier Korruption nicht als ein Verbrechen (mit kriminologischer Brille) betrachten.<br />
Posten <strong>und</strong> Dienstleistungen — auch das Recht — sind käuflich. 5<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Es sind nicht Gaben, um deretwillen man sie erhält, sondern richtige ausgehandelte<br />
Preise. Aus der oralen Tradition wissen wir, daß dies keine traditionellen<br />
Bräuche sind. Für Indien <strong>und</strong> Burma hat Myrdal gezeigt, wie das<br />
6<br />
Anwachsen der Korruption auf die Expansion der Warenökonomie folgte.<br />
Auch die Hilfe <strong>und</strong> Gnade der Götter sind käuflich — sogar in einem<br />
sehr extremen Maße. Es gibt keine Handlung eines „vodun-no" (Vodun-<br />
Priesters), die nicht käuflich ist. Sogar die Wissensweitergabe hat ihren<br />
Preis. Zum Teil ist die transzendentale Wirksamkeit der Rituale gerade an<br />
einen Geldpreis geb<strong>und</strong>en.<br />
Ähnliches gilt für die Familie. Der Brautpreis löste den Frauentausch<br />
ab. Nur auf erhebliche Geldtransfers gegründete Ehen sind legitim. Käufliche<br />
Liebe findet sich sogar schon in Dörfern.<br />
Venalität hat kein festes Bild. Extremformen, wie im heutigen Nigeria,<br />
wo Straßenräuber in Gegenwart der Opfer mit den Polizisten Korruptionssummen<br />
aushandeln, sind selten. Und doch sind solche Extreme zu nennen,<br />
weil sie eine erschreckende Version der Utopie mancher „public choice"-<br />
Theoretiker darstellen, die Gesellschaft in freie Käuflichkeit auflösen<br />
wollen.<br />
Ich könnte hierzu nun Parallelen aus dem Iran unter dem Schah <strong>und</strong> aus<br />
Khomeinis Agitation heranziehen, will mich aber doch auf ein uns näherstehendes<br />
Gebiet beschränken: Deutschland beim Ausbruch der großen<br />
Reformationsbewegung im 16. Jahrh<strong>und</strong>ert.<br />
Der Geldumlauf war gering verglichen mit dem des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts.<br />
Große Teile der Landwirtschaft waren noch durch die Subsistenzproduktion<br />
dominiert (sog. Naturalwirtschaft). Auch diese partielle Beibehaltung<br />
von Subsistenzproduktion bei gleichzeitiger warenökonomischer Transformation<br />
finden wir in heutigen Entwicklungsländern. Andererseits hatte<br />
jedoch auch die Wirtschaft insgesamt einen Aufschwung erlebt. Und in<br />
diesem Aufschwung kam es zu analogen warenökonomischen Transformationen<br />
wie in heutigen Entwicklungsländern.<br />
Nicht nur agrarische <strong>und</strong> handwerkliche Güter wurden zu Waren, sondern<br />
auch Produktionsmittel, mit der für die zeitgenössischen Beobachter<br />
erschröcklichen Konsequenz, daß jemand Haus, Hof <strong>und</strong> Werkstatt verlieren<br />
konnte. Die allmähliche Durchsetzung des römischen gegen das germanische<br />
Recht — nach Luther eine keine h<strong>und</strong>ert Jahre alte Tendenz <strong>und</strong> von<br />
den aufrührerischen Bauern in den „12 Artikeln" als aktuelles Geschehen<br />
angeklagt — ist Ausdruck dieser Transformation.<br />
Ich will nun nicht behaupten, daß der Ablaß, die Einführung des römischen<br />
Rechts, der Verlust von Haus <strong>und</strong> Hof durch Kreditschulden, die Umorientierung<br />
von Bauern von der Gebrauchswertproduktion hin zur Marktproduktion<br />
u.a. erst Phänomene des ausgehenden 15. Jahrh<strong>und</strong>erts seien.<br />
Im Gegenteil: Diese warenökonomischen Transformationen sind zum Teil<br />
schon weitaus früher zu finden <strong>und</strong> haben schon mehrere Auf- <strong>und</strong> Abschwünge<br />
durchlebt. Entscheidend für meine Betrachtung ist jedoch, daß sie<br />
den Zeitgenossen der damaligen Jahrh<strong>und</strong>ertwende als ein rezentes Phäno-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
men erschienen. Erst in der historischen Verdichtung dieser verschiedenen<br />
Phänomene mit verwandter Wurzel <strong>und</strong> erst nach den ersten Thematisierungen<br />
dieser Phänomene als <strong>gesellschaftliche</strong> Probleme wurden sie den Menschen<br />
bewußt <strong>und</strong> wurden nun in einer Verkürzung der historischen Realität<br />
als aktuelle Phänomene überpointiert. Ihnen wurde ein relativ idyllisches<br />
Gestern gegenübergestellt.<br />
Im politischen <strong>und</strong> rechtlichen Leben herrschte ebenfalls Käuflichkeit.<br />
Nicht nur die kirchlich-weltlichen Positionen, wie z.B. Kurfürstentümer,<br />
waren käuflich (als Simoney beklagt), sondern auch die Wahlen bis hinauf<br />
zum Kaiser waren von Schacher (Bestechung würden wir heute sagen) begleitet.<br />
Das Recht muß man immer häufiger „kaufen oder mit Geld niederdrücken"<br />
(so Luther in der Schrift an den christlichen Adel deutscher<br />
Nation), wie es z.B. auch die Bauern des armen Konradt schon 1514 beklagten.<br />
7<br />
Nicht zuletzt war auch die Gnade Gottes mit dem Ablaßwesen käuflich<br />
geworden. Die reformatorische Bewegung richtete sich gegen all diese Phänomene<br />
(nicht nur gegen das Ablaßwesen). Ohne Zweifel bestand bei Luther<br />
<strong>und</strong> manchen anderen ein anti-warenökonomischer Impetus schlechthin,<br />
wie auch in Luthers Schrift von Kaufhandlung <strong>und</strong> Wucher (1524)<br />
deutlich wurde. Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> werden auch seine anti-jüdischen<br />
Schriften verständlich, die eigentlich Anti-Wucher-Schriften sind. In seiner<br />
Wirtschaftsutopie hatten nur bäuerliche Märkte Platz. Diese Tendenz konnte<br />
ich nicht nur bei Luther finden, sondern auch bei Humanisten, Schwärmern,<br />
Täufern, kurz im ganzen reformatorischen Spektrum.<br />
Der Kampf gegen den Ablaß war theologisch gesehen gewiß nicht der<br />
zentrale Punkt bei Luther. Wohl aber war er soziologisch/wirkungsgeschichtlich<br />
gesehen der stärkste Punkt. Dies können wir am ehesten anhand<br />
der Flugschriften <strong>und</strong> der mit Versen unterlegten Holzschnittbücher — der<br />
„comic Strips" der damaligen Zeit — belegen (s. etwa Osianders „Eyn w<strong>und</strong>erliche<br />
Weyssagung von dem Babstu<strong>mb</strong>" (1527) mit Holzschnitten von<br />
Schön <strong>und</strong> Versen des damals populärsten Dichters Hans Sachs oder Hans<br />
Sachs' „Wittenbergisch Nachtigal").<br />
Die Kritik am Ablaßwesen, am neuen Recht, an der Politik des Stimmenkaufs,<br />
an der Käuflichkeit des Rechts, an der Prostitution <strong>und</strong> am<br />
Luxuskonsum formten ein Amalgam, das die Agitation des gesamten reformatorischen<br />
Spektrums bestimmte. Interessanterweise erhoben hier die<br />
katholischen Kritiker der Reformation auch keine Einwände. Die „erste<br />
Modernisierung", die expandierende Warenökonomie, drohte, alles zur Ware<br />
zu machen. Projektionsfläche dieser Ängste (<strong>und</strong> des umgelenkten Selbsthasses)<br />
waren die Türken <strong>und</strong> die Juden. Ihnen unterstellte man, sogar den<br />
Papst bestochen zu haben oder gar Menschenfleisch zu kaufen.<br />
Hinter der Expansion des Warentausches stand jedoch keine Verschwörung<br />
<strong>und</strong> nicht einmal ausschließlich die Interessen der Mächtigen <strong>und</strong> Reichen.<br />
Der Warentausch hat einen entscheidenden strukturellen Vorteil: Die<br />
Gebrauchswerte der einzelnen Güter <strong>und</strong> Leistungen sind nicht nur unter-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
schiedlich, sondern haben auch unterschiedliche Relevanz für den einzelnen.<br />
In einer Gebrauchswertökonomie unterhegen sie Bewertungs- <strong>und</strong><br />
Vergleichsmechanismen, die flexibel <strong>und</strong> begrenzt sind. Rasche Anpassungen<br />
an Produktsysteme sind schwierig. Lange Austauschketten sind nur mit<br />
erheblichem Aufwand möglich. In einer Marktökonomie hingegen werden<br />
alle Qualitäten auf eine einzige quantitative Struktur reduziert: auf den<br />
Preis. Die Freiheit des Zugangs zu jedem Gut unter der einzigen Bedingung<br />
der Zahlungskräftigkeit einerseits <strong>und</strong> die Simplizität der Bewertung des<br />
Gutes beim Tauschakt (nämlich nur durch den Preis) bedeuten eine erhebliche<br />
strukturelle Vereinfachung, eine Reduktion von Komplexität. Die<br />
Struktur des Warentausches macht die Verpflichtungen <strong>und</strong> Bande, die an<br />
die früheren Formen des Austausches geknüpft waren, obsolet. Das freie<br />
Zugangsrecht anonymer Personen tritt an die Stelle. Die Ablösung dieser<br />
Bande ist nicht widerspruchsfrei. Manche, die von den Verpflichtungen<br />
profitierten, sperren sich dagegen. Andere aber begrüßen die Warenökonomie<br />
als Befreiung: „Geld statt Verpflichtungen" war eine Parole von<br />
rebellischen Jugendlichen in einem westafrikanischen Dorf, die ich 1968<br />
kennenlernte. Meine Vorstellungen eines revolutionären antikapitalistischen<br />
Zurück zu Gemeinschaft <strong>und</strong> Solidarität wurden schwer erschüttert.<br />
Die höhere strukturelle Einfachheit des Warentausches <strong>und</strong> die Ablösung<br />
von auf Austausch bezogenen Verpflichtungen unterminiert jene <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Institutionen, die den Markt eindämmen könnten. Sie ermöglicht<br />
der Warenökonomie eine gleitende sozialstrukturelle Expansion,<br />
bei welcher der Kommodifikation der Arbeit zur Lohnarbeit eine besondere<br />
Bedeutung zukommt.<br />
Nicht nur Güter des täglichen Bedarfs <strong>und</strong> Produktionsmittel werden<br />
zu Waren; Liebe, Recht <strong>und</strong> Gottes Gnade werden zu Korruption, Prostitution<br />
<strong>und</strong> Ablaß (ohne damit unbedingt negativ gewertet zu werden). In<br />
den von Käuflichkeit dominierten Gesellschaftsformen liegen hier Zentren<br />
des Wirtschaftens. Die Macht „liegt nicht beim Kapital", vielmehr fließt<br />
das Geld zur Macht. Die vorgängige Machtverteilung bestimmt die Zentren<br />
der venalen Akkumulation — eine Akkumulation im Brautpreissystem, im<br />
Simonie- <strong>und</strong> Ablaßwesen, im politischen Bestechungswesen usw. Nicht<br />
Akkumulation in Produktionsmitteln, sondern venale Akkumulation strukturiert<br />
das Wirtschaftsleben. Mobutus Zaire ist nicht die Ausnahme, sondern<br />
charakteristisch für viele Situationen in der Dritten Welt.<br />
In dem Maße, in dem jedoch vertrauenstiftende Institutionen — Recht<br />
ebenso wie Fre<strong>und</strong>schaft oder religiös-moralische Kontrolle — selbst unbeständig<br />
werden, auf dem Markt dem je Meistbietenden zu Diensten sind,<br />
in dem Maße kann das Marktversprechen nicht mehr garantiert werden.<br />
Statt den Vertrag zu erfüllen, kann man Erzwingungsinstanzen bestechen;<br />
<strong>und</strong> schlechten Gewissens entledigt man sich durch Geldgaben an Gottes<br />
Institution. Nicht nur die reichen Händler <strong>und</strong> Produzenten, sondern auch<br />
die Armen empfinden Instabilität unter der Dominanz der Käuflichkeit<br />
als Leiden. Wenn alle persönlichen Beziehungen je nach Geldgebot fluk-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
tuieren, wenn der Ehepartner zum Besserbietenden wechseln mag, dann ist<br />
es kein Trost, daß man auf demselben Markt mitbieten kann.<br />
Wenn auch die Venalität für den Kaufkräftigen manche <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Institution berechenbar macht — ein nicht zu unterschätzender Gewinn<br />
in Krisengesellschaften —, so nimmt sie ihnen doch zugleich den Charakter<br />
fester Größen, entkleidet sie der Legitimität, entheiligt sie. Dies bereitet<br />
mit den Boden für mannigfache soziale Bewegungen.<br />
Es wäre nun verlockend, diese Bewegungen detailliert zu schildern,<br />
denn in den soziologischen Destillationen historischer Studien kommt ihre<br />
Botschaft nur sehr verkürzt zum Ausdruck. Durch die historischen Traditionen<br />
oder durch journalistische Praxis gefiltert, erreichen uns nur einzelne<br />
Schlagwörter aus den Amalgamen der zugr<strong>und</strong>eliegenden Motivationen. Die<br />
Bewegung, die einen Martin Luther zur Prominenz erhob, hatte mehr als<br />
nur das Ablaßwesen zu kritisieren. Khomeini im Iran ritt auf einer Bewegung,<br />
die mehr ein Zurück zur „umma" (Gemeinde) des „ursprünglichen"<br />
Islam wollte. Die westafrikanischen Putschführer <strong>und</strong> „revolutionären" Präsidenten<br />
von Dahomey/Bénin über Ghana <strong>und</strong> Nigeria zu Obervolta/Burkina<br />
Faso wurden durch mehr als nur durch die Kritik von Korruption <strong>und</strong><br />
eine Beschwörung der Nation populär.<br />
Immer wieder finden wir eine Verbindung von Kritik der Käuflichkeit<br />
in verschiedenen Formen mit einer Beschwörung einer zu bildenden Gemeinschaft.<br />
Ich will diese Darstellung jedoch abkürzen, um die spezifische<br />
8<br />
Leistung mancher Bewegungen dieses Typs, nämlich die Einbettung der<br />
Warenökonomie schildern zu können.<br />
Deklariertes Ziel der Bewegungen ist es, die Warentausch-Beziehungen<br />
hinter eine bestimmte oder unbestimmte Grenze zurückzudrängen <strong>und</strong><br />
gleichzeitig eine Gemeinschaft zu schaffen, die auf anderem als dem Markttausch<br />
beruht. Diese Gemeinschaft kann als Stamm, als Nation oder als Gemeinschaft<br />
der Gläubigen vorgestellt werden. Ein Beispiel aus der frühen<br />
Neuzeit Deutschlands: Die Schaffung einer Sprachgemeinschaft aus untereinander<br />
unverständlichen Dialekten war ein politisches Projekt, das den<br />
„gemein mann" in die <strong>gesellschaftliche</strong> Arena ziehen sollte. Klar, deutlich,<br />
9<br />
öffentlich sollte die Kommunikation über Macht <strong>und</strong> Moral werden. In<br />
10<br />
nur 40 Jahren gelang es, eine Gemeinsprache zu schaffen. Diese Sprachgemeinschaft<br />
war Modell für ein postuliertes „Teutschland" quer zu den etablierten<br />
Fürstentümern. Eine Gemeinschaft wurde erträumt, innerhalb derer<br />
man von anonymen anderen Leistungen unter Ausschluß der Geldbeziehung<br />
erwarten konnte.<br />
Soziale Bewegungen religiöser oder nationalistischer Form müssen mehr<br />
als nur diese Motive aufweisen, wenn sie Erfolg haben sollen. Antikäuflichkeitsmotive<br />
sind jedoch ein außerordentlich nachhaltiger Faktor von Mobilisierung<br />
<strong>und</strong> Zusammenhalt für solche Bewegungen. Die Verbindung der<br />
Kritik der Käuflichkeit mit der Beschwörung der Gemeinschaft spricht soziale<br />
Gruppen quer zu den Klassengrenzen an. Wenn das Vertrauen bricht,<br />
hoffen die Händler auf eine Moralität, welche die Marktversprechen wieder<br />
stabilisieren könnte. Die entwurzelten Armen, die in den Markt gezogen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
wurden, keine Stabilität durch Subsistenzproduktion mehr haben, erhoffen<br />
von der Gemeinschaft Stabilität <strong>und</strong> geregelten Zugang zu Liebe, Recht<br />
11<br />
<strong>und</strong> Gottes Gnade. Die Interessen dieser <strong>und</strong> anderer Gruppen überlappen;<br />
<strong>und</strong> das macht die Stärke der Bewegungen aus, die sich darauf stützen.<br />
Aus einer venalen Gesellschaft muß nicht zwangsläufig eine entfaltete<br />
Marktgesellschaft werden, sie kann auch in einer Zyklizität verharren, in<br />
welcher die Zunahme von Reichtum die Venalität vergrößert, bis es durch<br />
Selbst-Unterminierung zum Zusammenbruch kommt, <strong>und</strong> dann das gleiche<br />
Muster wieder beginnt. So erleben wir es etwa in Nigeria.<br />
Die Gesellschaften, die — wie Venedig — Markt- <strong>und</strong> Moralökonomie<br />
zugleich entwickeln, oder diejenigen, die — wie Frankreich <strong>und</strong> Deutschland<br />
— Seqenzen von Kommodifikation <strong>und</strong> Zurückdrängen des Warenprinzips<br />
erlebten, erreichten auf beiden Wegen eine systemische Differenzierung,<br />
die den Gebrauch des Geldes in bestimmten <strong>gesellschaftliche</strong>n Bereichen<br />
ausschloß, ihn illegitim machte.In diesen Bereichen gibt es aber weiterhin<br />
Güter <strong>und</strong> Dienstleistungen. Sie werden nunmehr nach einem Prinzip<br />
vermittelt, welches die Wirtschaftsanthropologie generalisierte Reziprozität<br />
nennt (wir folgen darin Polanyi <strong>und</strong> Sahlins ).<br />
12<br />
Generalisierte Reziprozität ist eine Gabe oder Leistung, welche ohne<br />
konkrete Erwartung einer Gegengabe gegeben wird, in Erfüllung eines<br />
moralischen Anspruchs. Auf lange Sicht kann man selbst wieder Empfänger<br />
einer solchen Leistung werden — daher der Ausdruck Reziprozität. Es gibt<br />
jedoch keinerlei Aufrechnung.<br />
Daß man Verletzten hilft, daß man Abfall in Papierkörbe wirft, daß<br />
man Zugtüren selbst schließt, all das gehört für uns zu den Selbstverständlichkeiten<br />
des Alltags, wird nicht eigens als ökonomische Leistung erfaßt.<br />
Auch, daß ein Richter beim Entscheiden abwägt <strong>und</strong> nicht nach Bestechungsangeboten<br />
entscheidet, nehmen wir als normal an. Jedoch läßt sich<br />
nur das Entscheiden entlohnen <strong>und</strong> erzwingen. Die Mühe des Abwägens ist<br />
eine Leistung, die zu den „virtues civiques" zählt.<br />
Oft wird dies als traditioneller Stammesbrauch eingeführt. In den von<br />
mir untersuchten Fällen handelt es sich jedoch um eine strukturelle Innovation.<br />
(Auch dort, wo die Agitation nativistisch ist, ein Zurück zur „Gemeinschaft"<br />
der tribalen Epoche beschworen wird, wird eine strukturelle<br />
13<br />
Innovation geschaffen). Denn nicht nur bekannte <strong>und</strong> als Mit-Stammesglieder<br />
kontrollierbare Personen sollen diese Leistungen erbringen, sondern<br />
fremde, anonyme Personen, denen gegenüber keinerlei Aufrechnung möglich<br />
wäre. Dies muß Ängste vor einem Verströmen der Leistungen wecken.<br />
Die Definition von Grenzen der Gesellschaft ist dadurch erfordert . Diese<br />
14<br />
Grenzen — etwa der Begriff der teutschen Nation im 16. Jahrh<strong>und</strong>ert —<br />
müssen weder nah sein noch klar definiert sein; wesentlich ist der Eindruck<br />
der geschlossenen Gestalt, den sie erzeugen. Der Struktur des anonymen<br />
Marktes für die Warenökonomie entspricht die Anonymität der Nation als<br />
Raum der Moralökonomie.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Traktate über die Nächstenliebe im frühen 16. Jahrh<strong>und</strong>ert — etwa der<br />
von Carlstadt — zeigen die immensen Probleme, die bestanden, wollte<br />
16<br />
man Leistungen im Rahmen der Moralökonomie, <strong>und</strong> seien es nur alltägliche<br />
Fre<strong>und</strong>lichkeiten, schildern. „Nicht für Gold, nicht für Prestige, nicht<br />
für spätere Gaben sollst du es tun", wird mit verschiedenen Formulierungen<br />
insistiert, um ex negativo das Geforderte klarzumachen.<br />
Dieser abgegrenzte Bereich von Leistungen unter Ausschluß des Marktes,<br />
den die französische Aufklärung als „virtues civiques" thematisierte,<br />
fand seine erste Thematisierung in den Städten der spätmittelalterlichen<br />
Toskana, in denen die Ideologie des „(il) commune" entstand. Im schon zu<br />
seiner Zeit berühmten Fresko der Stadthalle von Siena vom ,,buon" <strong>und</strong><br />
„mal guverno" wie in den Stadt-Verfassungen wurde das Erwünschte anschaulich<br />
dargestellt. Die Straßen sauber zu halten — auch wenn nach dem<br />
marktökonomischen Eigeninteresse irrational — gehörte dazu. Der Handelskapitalismus<br />
dieser Stadtstaaten blieb in diesen Dokumenten fast unerwähnt.<br />
Die Betonung der Bürgertugenden muß hier keine Verschleierung<br />
sein, denn die „commune" ist die Referenzstruktur für die generalisierte<br />
Reziprozität, die das Marktgeschehen einbettete.<br />
Jener Bereich von Austausch von Leistungen <strong>und</strong> Gütern, der weder<br />
durch staatliche noch durch Markt-Distribution bestimmt ist, verändert<br />
sich in seinem gerichteten Prozeß. In Schüben nimmt die Bedeutung der<br />
beschränkten Reziprozität, z.B. innerhalb von Verwandtschaftsbanden, ab,<br />
wird zugleich der monetäre Austausch illegitim, während die — anonyme —<br />
generalisierte Reziprozität zunimmt. Gegenüber dem Markt, in welchem<br />
der Zugang zu Gebrauchswerten an die eiserne Bedingung des Geldes geknüpft<br />
ist, erscheint so die Moralökonomie als möglicher Rückzugsraum.<br />
Wie jedem System ökonomischer Leistungen, so muß auch der Moralökonomie<br />
ein System sozialer Kontrolle entsprechen. Die staatliche Kontrolle<br />
spielt hier eine unbezweifelbare Rolle — doch dies ist vor allem eine<br />
sy<strong>mb</strong>olische: Standards zu definieren <strong>und</strong> Abweichungen als sanktionierbar<br />
zu erklären. Das gestreute Auftreten der meisten Handlungen erlaubt kaum<br />
effektive Sanktionen. Wichtiger ist die Zuweisung von Ansehen <strong>und</strong> Schande<br />
— ein Sanktionskomplex, der uns nur für vorindustrielle Gesellschaften<br />
wesentlich zu sein scheint. Die Angst, sich zu blamieren, „daß über einen<br />
geredet wird", ist wesentlich für die Einhaltung der ungeschriebenen Regeln.<br />
Der effektive Einsatz der Lehrenden in einer Fakultät zum Beispiel<br />
läßt sich nicht aus Furcht vor den Sanktionen des Beamtengesetzes erklären.<br />
Das, was als Engagement unbezahlt <strong>und</strong> unbezahlbar zur formalen<br />
Erledigung von Arbeit hinzukommt (eben nicht nur 'Dienst nach Vorschrift'<br />
ist), ist diesem formalen Sanktionssystem geschuldet.<br />
Weiter noch: Die moralischen Forderungen sind als internalisierte<br />
Zwänge (N. Elias ) in unser Denken hineingenommen. Dies gibt der Familie<br />
als Sozialisationsinstanz eine zusätzliche Aufgabe, wie nicht zuletzt an<br />
16<br />
Martin Luthers Familienschriften deutlich wird.<br />
Ehre <strong>und</strong> Schande setzen eine — virtuelle — Kommunikationsgemeinschaft<br />
als Projektionsfläche für ihre Wertungen voraus. Wenn diese in Par-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
zellen abgeschottet ist oder stark hierarchisiert ist, kann sie diese Leistungen<br />
nicht erfüllen.<br />
Jedoch auch dort, wo das Geld angeschlossen ist, kann die Moralökonomie<br />
zerstört werden: Willkür kann Verpflichtungen ablösen. Ungezügelte<br />
Gewalt erschlägt jede moralische Norm. Das, was im Iran mit dem Abdanken<br />
des Schahs an Abschaffung von Korruption, an Aufbau von Verläßlichkeit,<br />
an Schaffung einer neuen „umma" (Gemeinschaft der Gläubigen)<br />
zu wachsen schien, wurde unter Khomeini durch Einsatz von Willkür rasch<br />
liquidiert.<br />
Der zivilisatorische Prozeß im Sinne von Elias, der der Gewalt Zügel anlegt,<br />
ist nicht zu trennen vom Aufbau jenes unseren Alltag konstituierenden<br />
Systems des Austauschs von Gütern <strong>und</strong> Leistungen, das die Marktwirtschaft<br />
einbettet.<br />
Für sich genommen finden sich Kerne dieser Argumentation bereits in<br />
zwei alten Diskussionssträngen . Montesquieu diagnostizierte eine Konkomitanz<br />
von Marktexpansion <strong>und</strong> zivilisatorischem Schub. Er sprach von der<br />
17<br />
,,douceur" des Marktes. Durkheim nahm dies auf, akzentuierte aber nur<br />
einen der möglichen Zusammenhänge. Das Geschehen der formalen Wirtschaft<br />
erzwingt die Moralisierung. Bei Max Weber ist eher die andere Seite<br />
angesprochen. Daß der Roland (Sy<strong>mb</strong>ol des Rechts im Mittelalter) über<br />
den Markt wacht, ist Vorbedingung des Marktgeschehens. Der andere<br />
Strang führt von Sir Walpole über das Kommunistische Manifest bis zu<br />
Fred Hirsch. Das Marktgeschehen erodiert die Gesellschaft, zersetzt alle<br />
moralischen Bindungen. Jeder dieser Diskussionsstränge kann sich auf Evidenzen,<br />
kann sich auf Empirisches berufen. Dies muß so sein, denn beides,<br />
die Zersetzung durch Expansion des Warenprinzips wie die Einbettung<br />
in Moralökonomie <strong>und</strong> die Stützung durch zivilisatorisch gezügelte Staatsmacht<br />
(konkomitant zum Wachstum des Marktes), beides ist Ausdruck<br />
eines fluktuierenden Systems.<br />
Die funktionale Differenzierung von Wirtschaft gegen Gesellschaft<br />
(genauer: Sphäre der Warenökonomie gegen Sphäre der generalisierten<br />
Reziprozität) ist zwar produktiv, insofern sie einen neuen Systemtyp<br />
schafft, sie ist aber nicht absolut stabil. Das, was käuflich ist, könnte zu<br />
Teilen auch Gegenstand von Eigenproduktion <strong>und</strong> generalisierter Reziprozität<br />
sein. Das, was wir aus Gefälligkeit leisten, könnte auch käuflich sein.<br />
Da die beiden Verteilungssysteme in Teilbereichen konkurrieren könnten,<br />
ist die Grenzziehung zwischen ihnen nie vollständig plausibel (<strong>und</strong> hier liegt<br />
ein Problem, das sich praktisch nie dauerhaft lösen läßt; ein Problem auch<br />
für jede Prognose). Es gibt infolgedessen regelhaft Bewegungen zur Ausdehnung<br />
des Warentausch-Prinzips wie Bewegungen zur Zurückweisung<br />
dieser Expansion, zur Eindämmung des Warenprinzips oder gar zur Abschaffung<br />
der Warenökonomie. Die Oszillation zwischen diesen beiden<br />
Systemtypen erscheint so als eine Oszillation innerhalb eines bestimmten<br />
Gesellschaftstyps. Die Korruption von Ministern ebenso wie f<strong>und</strong>amentalistische<br />
Bewegungen (wie etwa bei den Grünen) erscheinen als Ausdruck<br />
der Fluktuation eines Systems — des Systems Marktgesellschaft.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Daß solche Fluktuationen das System nicht unterminieren können,<br />
ist damit nicht gesagt. Und damit wären wir bei der skeptischen Frage<br />
nach dem Ende der Moderne, nach der Vollendbarkeit des Kapitalismus,<br />
die unsere heutige Diskussion einleitete.<br />
Zusammenfassung<br />
Der Anschein von Kontinuität ist oft trügerisch. Nach der Meßlatte der<br />
Ökonomen — dem Bruttosozialprodukt — entwickeln sich manche Länder<br />
der Dritten Welt kontinuierlich. Der Soziologe sieht hier eher eine Sackgasse<br />
der Entwicklung, nämlich die Entwicklung der Venalität, <strong>und</strong> damit<br />
die Unterminierung des Marktvertrauens. Der Soziologe erwartet eher die<br />
Krise, den Konjunkturabbruch, als normales zyklisches Phänomen.<br />
In der europäischen Geschichte entstanden nicht überall entfaltete<br />
Marktgesellschaften in einer gradlinigen Entwicklung. Anti-Markt-Bewegungen<br />
zeitigten bisweilen das paradoxe Ergebnis, daß erst sie die für die Expansion<br />
der Märkte notwendige Einbettung schufen.<br />
Heute — <strong>und</strong> das brauche ich im Vortrag wohl nicht breitzutreten —<br />
empfinden viele die Monetarisierung von Hilfe <strong>und</strong> Rat in Lebenskrisen,<br />
von Liebe, Kaufehen durch Importe, politische Korruption <strong>und</strong> neue Religionen<br />
auf Geschäftsbasis als einen zusammenhängenden Schub von Kornmodifizierung,<br />
als Verlust von Rückzugsräumen. Daß dies eine reale Bedrohung<br />
des Lebenszusammenhangs der modernen europäischen Gesellschaft<br />
sein kann, kann die Soziologie bestätigen. Angesichts der Größenordnung<br />
der Phänomene, angesichts der bewegten Geldmengen, der internationalen<br />
Interdependenzen, kann ein Ausgang dieses Schubs oder ein Erfolg seiner<br />
Gegenbewegungen nur schwer prognostiziert werden. Die Frage nach der<br />
Unvollendbarkeit unserer Gesellschaftsform bleibt bestehen.<br />
ANMERKUNGEN<br />
1 Zur Ausdehnung der Warenform <strong>und</strong> zum Begriff der Kommodifizierung siehe zusammenfassend:<br />
Wallerstein, l.; Historical Capitalism, London 1983.<br />
2 Siehe hierzu die Ausführungen von Chr. von Ferber im heutigen Vortrag.<br />
3 Den Begriff „moral economy" schuf E.P. Thompson 1963 in dem Aufsatz ,,The<br />
Moral Economy of the English Crowd in the 18th Century", in: Past and Present,<br />
No. 50, 1971: 76-136. James Scott veränderte 1976 den Begriff in „The Moral<br />
Economy of the Peasant", New Haven.<br />
4 In dem vorigen Vortrag nahm Johannes Berger diesen Polanyischen Begriff aus<br />
„The Great Trasformation" (Boston 1968) positiv auf. Wenn ich ihm auch in diesem<br />
Punkt nicht folgen kann, so versuche ich doch, seine Fragestellung <strong>und</strong> die<br />
darauf folgenden Ausdifferenzierungen positiv aufzunehmen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
5 Besser als in einem alten Arbeitspapier, in welchem ich meine Afghanistan-Erfahrungen<br />
auswertete, führte — zu diesem kritisch — Diana Wong diese Gedanken<br />
in einer Bielefelder Diplomarbeit („The Relation between the Peasantry and the<br />
State in Bénin", 1977) <strong>und</strong> in einem Aufsatz über „Bauern, Bürokratie <strong>und</strong> Korruption"<br />
(in: Elwert, G./Fett, R. (Hrsg.), Afrika zwischen Subsistenzökonomie <strong>und</strong><br />
Imperialismus, Frankfurt 1982) aus.<br />
6 Siehe hierzu Myrdal, G., Asian Drama, New York 1968 <strong>und</strong> die dort verwendete<br />
Literatur.<br />
7 Siehe Franz, G., Der deutsche Bauernkrieg, Aktenband, Darmstadt 1968.<br />
8 Anderson, B., Imagined Communities, London 1983.<br />
9 Giesecke, M., Schriftspracherwerb <strong>und</strong> Erstlesedidaktik in der Zeit des „gemeinteutsch",<br />
Ms., Kassel 1977.<br />
10 Hoelscher, L., Artikel „Öffentlichkeit" in: Ritter/Gründer (Hrsg.), Historisches<br />
Wörterbuch der Philosophie, 1984.<br />
11 Elwert, G./Evers, H.-D./Wilkens, W., „Die Suche nach Sicherheit — Ko<strong>mb</strong>inierte<br />
Produktionsformen im sogenannten informellen Sektor", in: Zeitschrift für Soziologie<br />
12/84, 1983: 281-296.<br />
12 Polanyi, K., Dahomey and the Slave Trade, Seattle 1966.<br />
Sahlins, M., Stone Age Economics, Chicago 1972.<br />
13 Mühlmann, E., Chiliasmus <strong>und</strong> Nativismus, Berlin 1961.<br />
14 Siehe Luhmann, N., Soziologische Aufklärung 2. Formen des Helfens im Wandel<br />
<strong>gesellschaftliche</strong>r Bedingungen, Opladen 1975: 134-149. Zu dem Argument, daß<br />
Vertrauen nur außerhalb des Marktes konstituiert werden kann, vgl. ders., Vertrauen,<br />
Stuttgart 1968: 41; zur Informalität der sozialen Kontrolle vgl. ebd.: 34.<br />
15 Botenstein von Carolstadt, A., „Von den zweyen höchsten gebotten der lieb Gottes<br />
<strong>und</strong> des nechsten", in: Hertzsch, E. (Hrsg.), Carlstadts Schriften aus den Jahren<br />
1523-25, Teil 1 Halle (Saale) 1956.<br />
16 Elias, N., Über den Prozeß der Zivilisation, 2 Bde., Bern 1969.<br />
2<br />
17 Hirschmann, A., „Rival Interpretations of Market Society", in: Journal of Economic<br />
Literature, Vol XX, 1982: 1463-1484.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Theorien der <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Entwicklung zur Moderne<br />
EINLEITUNG<br />
Klaus Eder<br />
Die Rede von Theorien der <strong>gesellschaftliche</strong>n Entwicklung zur Moderne ist<br />
interpretationsbedürftig. Denn sie suggeriert den Unterschied zwischen<br />
einer Verlaufslogik der Modernisierung <strong>und</strong> einer Ursachenanalyse dieser<br />
Modernisierung. Diese Trennung dürften nicht alle akzeptieren. Wer die<br />
Moderne als „unvollendetes Projekt" definiert, dem ist jede Theorie der <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Entwicklung der Moderne auch eine Theorie der <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Entwicklung zur Moderne. Nur der, der weiß, was man unter<br />
Moderne verstehen soll, kann sich ohne weitere Skrupel auf das Feld evolutionstheoretischer<br />
Verallgemeinerungen <strong>und</strong> auf die Ursachensuche begeben<br />
.<br />
1<br />
Solche Skrupel haben inzwischen viele befallen. Die klassische Theorie<br />
der Modernisierung ist vor allem von zwei Seiten unter Beschuß geraten:<br />
von Seiten derer, die ihr einen eurozentrischen, nationalstaatlich<br />
verengten Blick auf die Realität vorwerfen; <strong>und</strong> von Seiten derer, die dem<br />
empiristischen Begriff der Modernität den Begriff der Moderne als einer<br />
regulativen Idee entgegensetzen. Beide Angriffe haben die Modernisierungstheorie<br />
nicht unbeschädigt gelassen. Sie haben erstens zu einer stärkeren<br />
Historisierung <strong>und</strong> zweitens zu einer Problematisierung des Begriffs der<br />
Moderne selbst geführt.<br />
Die Historisierung der Modernisierungstheorie sensibilisiert für den partikularen<br />
Fall. Das hat zunächst zu Typologisierungen (<strong>und</strong> Topologisierungen)<br />
geführt: zur Analyse von territorialen Strukturen in den Prozessen der<br />
Staaten- <strong>und</strong> Nationenbildung <strong>und</strong> zur Analyse von Formen interner Konsolidierung<br />
dieser Einheiten durch die Regelung von Teilnahme- <strong>und</strong> Teilhaberechten.<br />
Diese Historisierung hat zwei inhaltliche Effekte auf die Modernisierungstheorie<br />
gehabt: (a) sie hat das Moment zwischenstaatlicher<br />
Ungleichheit in das Erklärungsprogramm eingeführt <strong>und</strong> (b) sie hat den<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Klassencharakter des entstehenden Nationalstaates, die differentielle Betroffenheit<br />
sozialer Gruppen durch Staats- <strong>und</strong> Nationenbildung wieder ins<br />
Blickfeld gerückt. Das hat darüber hinaus innerhalb der Theorie der Modernisierung<br />
zu einer weniger „geradlinigen" Konzeptualisierung des Modernisierungsprozesses<br />
geführt. Die Folgen zeigen sich vor allem an der Diskussion<br />
eines Schlüsselkonzepts einer Theorie der Modernisierung, nämlich<br />
dem Konzept der Rationalisierung 2 .<br />
Mit der Problematisierung des Begriffs Moderne bzw. Modernisierung<br />
werden die Gr<strong>und</strong>annahmen der Modernisierungstheorie als solcher infragegestellt.<br />
Diese Kritik artikuliert sich — mehr oder weniger verschlüsselt —<br />
in der ästhetischen Kritik der Moderne. Sie sensibilisiert für die kulturellen<br />
Voraussetzungen von Modernität. Der Rekurs auf die kulturkritische<br />
Reflexion (<strong>und</strong> Zweifel an) der Moderne bietet sich deshalb als Schlüssel<br />
zu einer Rekonstruktion dessen, was kulturelle Modernität bedeutet, an.<br />
Diese Kritik macht einen affirmativen Begriff von Modernität schwierig.<br />
Denn man kann dann nicht mehr davon ausgehen, daß eine spezielle institutionelle<br />
Verkörperung dieser kulturellen Modernität (etwa das angloamerikanische<br />
politische System) ein Modellfall von Modernisierung sein<br />
könnte. Die so argumentierende alte Modernisierungstheorie ist der Versuch<br />
gewesen, einen bestimmten Entwicklungspfad festzuschreiben, eine hochselektive<br />
Form von Modernität als Inbegriff kultureller Modernität auszugeben.<br />
Erst der Blick auf die vor aller institutioneller Verkörperung gegebene<br />
kulturelle Form vermag die Gr<strong>und</strong>lagen von Modernität <strong>und</strong> die den<br />
Modernisierungsprozeß in seiner Richtung bestimmende kulturelle Dynamik<br />
zu erfassen 3 .<br />
Doch darf die Kritik des affirmativen Modernitätsbegriffs nicht den sozialen<br />
Ort vergessen machen, von dem aus diese Kritik gedacht <strong>und</strong> an den<br />
"diese Kritik gerichtet wird. Sie muß sich vielmehr in ein Verfahren soziologischer<br />
Objektivierung einlassen. Denn in der Art <strong>und</strong> Weise, wie die kulturelle<br />
Dynamik der Moderne von sozialen Klassen oder nationalen Gesellschaften<br />
„übersetzt" wird, reproduziert sich zugleich die objektive Struktur<br />
sozialer Ungleichheit, die mit der Modernisierung nicht verschwindet. Vielleicht<br />
besteht „Modernität" in der objektiven Differenz der Erfahrung von<br />
Modernität. Diese Differenz <strong>und</strong> ihre soziale Konstitution zu klären, das<br />
wäre dann der Gegenstand einer Modernisierungstheorie, die über die Klärung<br />
ihrer eigenen kulturellen Voraussetzungen hinausgehen will.<br />
ANMERKUNGEN<br />
1 Zwei Referate konnten aus Raumgründen nicht zum Abdruck gelangen. Das Referat<br />
von van Liere (Groningen) beschäftigte sich mit dem Prozeß der Durchsetzung des<br />
modernen Staates, der unter Rückgriff auf ein Set nutzentheoretischer Annahmen<br />
<strong>und</strong> mit Hilfe eines historisch-komparativen Ansatzes erklärt werden sollte. Das Referat<br />
von Gleichmann (Hannover) beschäftigte sich mit einer Rekonstruktion der<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
theoretischen <strong>und</strong> methodologischen Gr<strong>und</strong>lagen der Entwicklungstheorie von Norbert<br />
Elias mit dem Ziel, die Modernisierungstheorie in einer allgemeinen sozialen<br />
Evolutionstheorie zu begründen.<br />
2 ,Vgl. hierzu die Beiträge von Döbert <strong>und</strong> Haferkamp.<br />
3 Vgl. hierzu die Beiträge von Brose <strong>und</strong> Lohmann.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
FORMALE RATIONALITÄT ALS KERN DER WEBERSCHEN MODER<br />
NISIERUNGSTHEORIE<br />
Rainer Döbert<br />
Ziel der folgenden Ausführungen ist es, die Bedeutung des in der Weber-<br />
Forschung weitgehend vernachlässigten Konzepts der formalen Rationalität<br />
für die Architektonik der Weberschen Soziologie herauszuarbeiten. Der Argumentationsgang<br />
gliedert sich in drei Schritte. Im ersten Teil wird der Begriff<br />
der formalen Rationalität bestimmt. Im zweiten Teil wird am Weberschen<br />
Frühwerk demonstriert, daß für sein Denken zunächst der Begriff<br />
der materialen Zweckrationalität ausschlaggebend war. Im dritten Teil<br />
schließlich sollen einige der theoretischen Motive aufgeführt werden, die<br />
dazu führen mußten, daß sich Phänomene formaler Rationalisierung in der<br />
Weberschen Soziologie zunehmend in den Vordergr<strong>und</strong> schoben.<br />
Teil I: Zum Begriff der formalen Rationalität<br />
Will man Weber nicht Red<strong>und</strong>anz der Begriffsbildung unterstellen, so ist der<br />
Begriff der formalen Rationalität so zu bestimmen, daß er nicht mit Zweckrationalität<br />
zusammenfällt. Außerdem ist sicherzustellen, daß die von Weber<br />
mit dem Terminus 'formal rational' belegten Phänomene nicht rein enumerativ<br />
bloß aufgelistet, sondern erzeugt werden können. Diese Desiderate<br />
sind m.E. in der Literatur nicht erfüllt. Es ist hier nicht der Ort, darauf<br />
näher einzugehen. Insgesamt hat die Weber-Literatur zum Konzept der formalen<br />
Rationalität eher wenig zu sagen.<br />
Um das Konzept der formalen Rationalität zu erhellen, wird es sinnvoll<br />
sein, sich zunächst dem Begriffspaar 'formal-material zuzuwenden. Dieses<br />
liegt der Unterscheidung von formaler <strong>und</strong> materialer Rationalität voraus.<br />
Es durchzieht die gesamte Webersche Soziologie <strong>und</strong> ist wohl von Weber<br />
der juristischen Literatur entnommen worden. Es gibt formale <strong>und</strong> materiale<br />
Preistheorie, charismatische Herrschaft ist formal Offenbarung, material<br />
aber immer: „Es steht geschrieben, ich aber sage Euch ..." etc.<br />
Was ist gemeint? Schluchter geht sehr zu Recht von der Wortbedeutung<br />
aus, um die formale <strong>und</strong> materiale Rationalität des Rechtssystems begrifflich<br />
zu fassen. 'Formal' leitet sich von Form ab <strong>und</strong> auf die Form des Denkens<br />
oder Handelns beziehen wir uns mit einer Wie-Frage. 'Material' hat<br />
dann mit dem Inhalt von Denken oder Handeln zu tun <strong>und</strong> auf den Inhalt<br />
beziehen wir uns typischerweise mit einer Was-Frage. 1<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Es dürfte offensichtlich sein, daß wir dieses Fragenpaar auf jedes beliebige<br />
Denk- oder Handlungsmuster anwenden können — also auch auf<br />
zweckrationales Handeln. Demnach könnte Handeln in formaler <strong>und</strong> in<br />
materialer Hinsicht zweckrational sein.<br />
Für den Begriff der materialen Zweckrationalität gibt es bei Weber<br />
einen unzweideutigen Beleg. In der Wirtschafts<strong>soziologie</strong> spricht Weber<br />
2<br />
davon, daß man an ein 'formal noch so rationales Wirtschaften' „ethische,<br />
politische, utilitarische, hedonische, ständische, egalitäre oder irgendwelche<br />
anderen Forderungen stellt <strong>und</strong> daran die Ergebnisse des ... Wirtschaftens<br />
wertrational oder material zweckrational bemißt." Hier geht es um die<br />
Bewertung der Handlungsergebnisse, also um die Frage, was mit dem Vollzug<br />
einer Handlung denn nun tatsächlich erreicht wurde. Wenn die Handlungsziele<br />
geltungsfreie Interessen, frei von jedem Wertbezug sind, dann ist<br />
Handeln, sofern es diese Zwecke erreicht, material zweckrational. Auch die<br />
formale Seite von zweckrationalem Handeln im Bereich der Ökonomie<br />
scheint in der zitierten Passage ganz unzweideutig bestimmt zu sein, nämlich<br />
als Rechenhaftigkeit <strong>und</strong> Rechenhaftigkeit läßt sich ja auch problemlos<br />
auf die Wie-Frage beziehen. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung<br />
sich zu vergegenwärtigen, daß die Wie-Frage hier — ohne daß Weber<br />
dies deutlich machen würde — rekursiv angewendet wird. Wirtschaftliches<br />
Handeln hat es ja schon vor Erfindung der Wirtschaftsrechnung gegeben<br />
<strong>und</strong> auch dabei muß das zweckrationale Wirtschaftshandeln einen formalen<br />
Aspekt aufgewiesen haben. Er besteht in der mit Zweckrationalität als solcher<br />
gegebenen Wahl der zur Erreichung des Zwecks subjektiv oder objektiv<br />
erforderlichen Mittel (wie erreiche ich den Zweck). Man müßte hier, um terminologisch<br />
genau zu sein, von 'formaler Zweckrationalität' sprechen, die<br />
in Verbindung mit materialer Zweckrationalität das rein zweckrationale<br />
Handeln oder „absolute Zweckrationalität" konstituiert. Daß Weber zumindest<br />
implizit die entsprechende Unterscheidung im Auge hatte, geht aus<br />
einer Bemerkung über Handeln, bei dem die Zwecke wertrational beeinflußt<br />
sind, hervor. „Dann ist das Handeln nur in seinen Mitteln zweckrational " 3<br />
impliziert, daß reine Zweckrationalität in der angedeuteten Weise „zusammengesetzt"<br />
ist. Formale Rationalität (im Unterschied zu formaler Zweckrationalität)<br />
im Sinne von Rechenhaftigkeit kommt jedoch erst ins Spiel,<br />
wenn ich die Form-Materie-Unterscheidung rekursiv auf die durch das<br />
Kausalitätskriterium seligierten Mittel anwende. Ich frage nun, was fällt<br />
überhaupt in den Bereich kausalwirksamer Handlungen <strong>und</strong> wie erreichen<br />
diese alternativen Mittel ihr Ziel. Sie sollen möglichst effizient <strong>und</strong> 'sicher'<br />
wirken <strong>und</strong> erst die Anwendung dieser Zusatzkriterien grenzt die Mittelauswahl<br />
endgültig ein. Effizienzkalkulationen lassen sich aber ohne 'Rechenhaftigkeit'<br />
nicht präzise durchführen <strong>und</strong> daher ist die Wirtschaftsrechnung<br />
von Weber zu Recht als Inbegriff der formalen Rationalität der Ökonomie<br />
ausgezeichnet worden. Daß es sich um eine rekursive Anwendung der Form-<br />
Materie-Unterscheidung handelt, ergibt sich auch unmittelbar aus den formaler<br />
Rationalität zugeordneten Handlungsmotiven. Interessen an Progno-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
stizierbarkeit, maschinenmäßigem Funktionieren, Berechenbarkeit, Stabilität<br />
etc. sind notwendige Metainteressen der Handelnden; sie setzen Primärinteressen<br />
voraus, die sicher, berechenbar, effizient verfolgt werden.<br />
Diese hier am Beispiel des ökonomischen Handelns analysierte Struktur<br />
von formaler Rationalität läßt sich auf andere Handlungsbereiche <strong>und</strong> auf<br />
die Organisation von Orientierungssystemen (z.B. formale Rationalität des<br />
Rechtssystems) übertragen. Sie impliziert keine Reduktion auf Zweckrationalität,<br />
da ja Zweckrationalität gerade umgekehrt durch Anwendung der<br />
Unterscheidung von formal-material generiert wurde. Die analytische Unabhängigkeit<br />
des Begriffs der formalen Rationalität von dem der Zweckrationalität<br />
ist essentiell, da anders notwendige begriffliche Unterscheidungen<br />
einplaniert werden. Beispielsweise verkörpert das Naturrecht als Inbegriff<br />
von Wertrationalität auch formale Rationalität, da es logifiziert, systematisiert<br />
ist <strong>und</strong> Sätze 'kontrolliert' ableitbar macht. Weber mußte daraus keinesfalls<br />
schließen, daß sich alles Handeln auf instrumentelles Handeln reduziert,<br />
da er mit formaler Rationalität eine Metaebene der Organisation<br />
von Denken <strong>und</strong> Handeln anvisiert hat, die eben bereichsübergreifend wirksam<br />
ist.<br />
Teil II: Die früheste Form der Weberschen Entwicklungstheorie<br />
Es soll im folgenden gezeigt werden, daß das Konzept der formalen Rationalität<br />
im Weberschen Denken zunächst von untergeordneter Bedeutung<br />
war, dann aber, mit der Entwicklung seines Denkens, zunehmend an Bedeutung<br />
gewinnen mußte. Die Veränderungen hängen damit zusammen, daß<br />
Weber sich von einem eher ungebrochenen zu einem eher skeptischen,<br />
vorsichtigen Evolutionstheoretiker entwickelt hat.<br />
Entgegen gängigen Stilisierungen haben evolutionstheoretische Momente<br />
sich im Weberschen Denken nicht allmählich durchgesetzt, sondern<br />
Weber hat, wie seine früheste Veröffentlichung „Zur Geschichte der Handlungsgesellschaften<br />
im Mittelalter" zeigt, als Evolutionstheoretiker begonnen<br />
<strong>und</strong> dabei ganz einfach Ansätze seines Lehrers Goldschmid fortgeführt.<br />
In der erwähnten Untersuchung geht es Weber darum zu klären, wie<br />
sich aus dem gemeinsamen Haushalt <strong>und</strong> der Gemeinschaft des Erwerbslebens<br />
die moderne Offene Handelsgesellschaft mit dem Status eines<br />
Rechtssubjekts, mit beschränkter Solidarhaftung der Gesellschafter <strong>und</strong> mit<br />
einem Sondervermögen entwickeln konnte. Das zentrale Argument läßt<br />
sich in etwa folgender Passage entnehmen: „Dagegen mußten ... Schwierigkeiten<br />
entstehen, als mit wachsender Bedeutung des Kredits die Schuldverbindlichkeiten<br />
des einzelnen einen Charakter gewannen, welcher die Haftbarmachung<br />
der Genossen für dieselben lediglich auf der Gr<strong>und</strong>lage des gemeinsamen<br />
Haushalts häufig unbillig erscheinen ließ. Andererseits war<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
gerade die unmittelbare Haftung geeignet, die Gemeinschaft im Geschäftsleben,<br />
als Kreditbasis, aktionsfähig zu machen ... Für alle Fälle, in welchen<br />
das Interesse des Kredits der Gemeinschaft überwog, mußte also die Haftung<br />
festgehalten werden." Wie löste die Rechts<strong>entwicklung</strong> dies legislatorische<br />
Problem? Das zur Erklärung herangezogene Modell ist — ohne daß<br />
4<br />
dieser Terminus schon verwendet würde — ganz einfach das Modell zweckrationalen<br />
Handelns. Veränderte Handlungsbedingungen haben dazu geführt,<br />
daß die überkommenen Formen des sozialen Verkehrs „unangemessen"<br />
werden. Damit steht das Rechtssystem vor dem Problem, schrittweise<br />
die Rechtstechniken zu entwickeln, die die neuen Handelsgewohnheiten<br />
in sichere Bahnen lenken können. Das Modell stellt ganz auf „materiale<br />
Zweckrationalität" ab. Denn der Rechtszweck bestimmt den gesamten Entwicklungsgang.<br />
Er besteht in der Lösung des gegebenen Handlungsproblems<br />
<strong>und</strong> aufgr<strong>und</strong> des Handlungsdruckes wird die Rechts<strong>entwicklung</strong> sich notwendigerweise<br />
so vollziehen, daß entsprechende rechtstechnische Mittel<br />
hervorgebracht werden. Für formale Rationalität war in diesem Modell<br />
eigentlich kaum Raum <strong>und</strong> es überrascht daher nicht, daß Weber über<br />
die römischen Juristen der damaligen Zeit einigermaßen abfällig urteilt. 5<br />
Nun wurde Weber aber immer deutlicher, daß die Identifizierung einer<br />
gegebenen Problemlage noch längst nicht garantiert, daß auch die entsprechenden<br />
„problemlösenden" sozialen Arrangements institutionalisiert werden<br />
können. Das <strong>entwicklung</strong>stheoretische Modell mußte also als übervereinfachend<br />
verworfen <strong>und</strong> entsprechend korrigiert werden. Dabei gewann<br />
formale Rationalität an Bedeutung.<br />
Teil III: Systematische Gründe für den Bedeutungszuwachs von 'formaler<br />
Rationalität' im Weberschen Werk<br />
Webers <strong>entwicklung</strong>stheoretisches Modell stellte zunächst ganz auf das Moment<br />
der Notwendigkeit ab, enthielt also — übersetzt in eine neuere Terminologie<br />
— lediglich ein Stadienmodell der Entwicklung. Die Stadienmodelle<br />
erlauben es uns, die jeweils früheren Entwicklungsformen als notwendige<br />
Voraussetzungen für die späteren <strong>und</strong> die späteren als „angemessenere",<br />
„zweckrationalere" Reaktionen auf gegebene funktionale Imperative zu<br />
begreifen. Es muß sich aber überhaupt nichts enwickeln, da das entsprechende<br />
System aufgr<strong>und</strong> seiner internen Struktur oder der ihm zur Verfügung<br />
stehenden Ressourcen daran gehindert sein kann, überhaupt neue <strong>und</strong><br />
angemessene Problemlösungen zu erzeugen, durchzusetzen <strong>und</strong> zu speichern.<br />
Ob sich Entwicklung vollzieht hängt auch von Zufälligkeiten ab. Diese<br />
Zufallskomponente, die heute in allen evolutionstheoretischen Ansätzen<br />
enthalten ist, läßt sich thematisieren als Gegensatz von Evolution <strong>und</strong> Geschichte.<br />
Weber führt die Unterscheidung im Objektivitätsaufsatz streng<br />
durch. Er hat keinerlei Einwände gegen die Verwendung von Stadienmo-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
dellen, solange man sich stets gegenwärtig hält, daß idealtypische Entwicklungskonstruktionen<br />
<strong>und</strong> Geschichte zwei streng zu scheidende Dinge<br />
sind ..." 6<br />
Die komplexere evolutionstheoretische Variante, die Weber nun unter<br />
Einbeziehung der Zufälligkeiten von Geschichte entwickelt, ist so spezifiziert,<br />
daß auf planvolle Vorausschau zweckrational handelnder Subjekte<br />
verzichtet werden kann. Soziale Institutionen können sich in weit abliegenden<br />
Feldern sozialen Handelns entwickeln <strong>und</strong> erst später zu neuen institutionellen<br />
Arrangements ko<strong>mb</strong>iniert werden; sie können von neuen Trägergruppen<br />
mit gänzlich anderer Zielsetzung „übernommen" werden, <strong>und</strong><br />
dabei ihre Bedeutung ins Gegenteil verkehren. Diese 'Zufälligkeiten' lassen<br />
sich nicht im Modell zweckrationalen Handelns auffangen, sondern erfordern<br />
ein Modell der unbewußten Auslese von sozialen Institutionen. Ein<br />
solches Modell bleibt aber unspezifiziert, wenn es nicht durch Annahmen<br />
über das Speichern von Innovationen ergänzt wird. Genau hierin liegt der<br />
theoretische Stellenwert des zweiten „Standbeins" moderner Entwicklungstheorien,<br />
der Entwicklungsmechanismen nämlich. Diese müssen so angelegt<br />
sein, daß verständlich wird, wie die zufälligen historischen Schwankungen<br />
zu akkumulativen Lernprozessen verdichtet werden können. Meine These<br />
ist nun, daß der Begriff der formalen Rationalität in der Weberschen Soziologie<br />
nicht zuletzt deshalb von zentraler Bedeutung ist, weil ohne ihn der<br />
in Rationalisierungsschüben zum Ausdruck kommende <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Lernprozeß unverstanden bliebe, da das Speichern von Innovationen ohne<br />
ihn nicht gefaßt werden kann. 7<br />
Dafür gibt es mehrere Gründe. Einerseits betrifft die formale Rationalität<br />
das „Wie" der Organisation von Denken <strong>und</strong> Handeln. Stil <strong>und</strong> Form<br />
sind jedoch, da sie in der Regel nicht thematisch sind, gegen Wandel viel resistenter<br />
als Inhalte <strong>und</strong> werden beibehalten, wenn Inhalte sich ändern. Andererseits<br />
sind die formal rationalisierten Denk- <strong>und</strong> Handlungsmuster prestigereicher<br />
<strong>und</strong> — das ist ja der Sinn von formaler Rationalität — leichter<br />
reproduzierbar als ihre nicht-rationalisierten Konkurrenten. Dadurch genießen<br />
formal rationalisierte Handlungsstrukturen einen Selektionsvorteil<br />
im Auslesekampf der Institutionen.<br />
Auch die Differenzierungsthematik, an der keine Evolutionstheorie<br />
vorbeikommt, läßt sich ohne Rekurs auf formale Rationalität nicht behandeln.<br />
In letzter Instanz ruht die Webersche Differenzierungstheorie auf der<br />
Unversöhnlichkeit der konkurrierenden Sachordnungen. Deren Unversöhnlichkeit<br />
erzwingt Differenzierungsprozesse. Sie kann jedoch nur transparent<br />
werden, wenn jede Sachordnung für sich genommen in ihren Funktionsgesetzmäßigkeiten<br />
systematisch analysiert <strong>und</strong> zu Ende gedacht wird; das<br />
aber heißt ja nichts anderes, als daß erst bei formaler Rationalisierung jeder<br />
Sachordnung die Inkompatibilität, die Differenzierungen auslöst, zutage<br />
treten kann. Auch von daher mußte Weber deshalb immer wieder auf formale<br />
Rationalität stoßen.<br />
Die systematische Bedeutung von formaler Rationalität läßt sich auch<br />
beleuchten, wenn man überlegt, wie sich denn die anderen Komponenten<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
des gesamten Rationalitätskomplexes für eine <strong>entwicklung</strong>stheoretische<br />
Konstruktion nutzbar machen ließen. Ich muß mich hier mit Andeutungen<br />
begnügen: objektive Richtigkeitsrationalität würde den gesamten Entwicklungsgang<br />
einfach dichotomisieren. Denn wahr ist die moderne Wissenschaft,<br />
<strong>und</strong> alles was davor lag, ist gleich falsch. Dieser Umstand strahlt unmittelbar<br />
auf das Konzept des objektiv richtigen zweckrationalen Handelns<br />
aus, da dies ja durch Wahrheit der Kausalhypothesen definiert ist. Bei materialer<br />
<strong>und</strong> Wertrationalität kann Entwicklung einfach nur in Systematisierung<br />
<strong>und</strong> Logifizierung der letzten Wertgesichtspunkte bestehen. Das aber<br />
ist eben die Essenz von formaler Rationalität. Bleibt die subjektive Zweckrationalität.<br />
Der magisch Handelnde verhält sich subjektiv nicht weniger<br />
oder anders zweckrational als der moderne Techniker. Entwicklung kann<br />
hier nur auf einer Metaebene liegen, also formale Rationalität tangieren. Genauso<br />
argumentiert Weber in seinem Wertfreiheitsaufsatz beim Vergleich<br />
von Magie <strong>und</strong> Physik. 8<br />
Weber war ein sensibler Beobachter seiner Zeit <strong>und</strong> daher konnte ihm<br />
das Problem der Entfremdung, das so typisch zu sein scheint gerade für moderne<br />
Gesellschaften, nicht entgehen. Entfremdung hat natürlich einerseits<br />
entschieden etwas mit der mangelnden Transparenz des heutigen Institutionsgefüges<br />
zu tun. Aber darin liegt nur eine Komponente der Weberschen<br />
Entfremdungstheorie, die der Ergänzung durch das Konzept der formalen<br />
Rationalität bedarf. Denn für sich allein genommen muß mangelnde Transparenz<br />
ja überhaupt keine entfremdenden Implikationen haben, solange das<br />
Institutionensystem nur so funktioniert, daß wir unsere Zwecke ungestört<br />
verfolgen können. Warum werden die modernen Institutionen als Arrangements<br />
erfahren, in denen der Einzelne sich mit seinen Zielsetzungen nicht<br />
ungebrochen aufgehoben fühlen kann? Dies läßt sich erst begreifen, wenn<br />
man die mangelnde Transparenz durch das Konzept der formalen Rationalität<br />
ergänzt. Denn formale Rationalisierung läuft ja darauf hinaus, daß alles<br />
Handeln einem weiteren Kriterium unterworfen wird: es sollen nicht nur<br />
Primärziele erreicht werden, sondern diese sollen dauerhaft, sicher, effizient<br />
etc. erreicht werden. Wo aber zwei Kriterien wirksam sind, kann es auch zu<br />
Konflikten zwischen der Erfüllung dieser Kriterien kommen; können die<br />
Primärziele also beispielsweise zugunsten der mit formaler Rationalität verb<strong>und</strong>enen<br />
notwendigen Metamotive des Handelns beiseite geschoben werden<br />
(Rentabilität versus optimale Güterversorgung z.B.). Da die Handelnden<br />
aber auch diese Metamotive nicht einfach ignorieren können, ohne pragmatische<br />
Paradoxien zu erzeugen (man kann nicht Z wollen, ohne auch zu<br />
wollen, daß es für die Erlangung von Z eine gewisse Sicherheit gibt), lassen<br />
sich in Konfliktfällen die Institutionen nicht ohne weiteres so u<strong>mb</strong>auen,<br />
daß Primärziele eindeutig die Oberhand gewinnen. Das „stahlharte Gehäuse"<br />
ist, so betrachtet, eher als goldener Käfig zu fassen, aus dem wir nicht<br />
herauswollen können, da sonst unsere notwendigen Metamotive verletzt<br />
würden.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Abschließend ein letzter Hinweis: es ist ja wiederholt bemerkt worden,<br />
daß die Anwendung von dichotomisierenden Begriffen wie Mikro- <strong>und</strong><br />
Makro<strong>soziologie</strong> oder System- <strong>und</strong> Handlungsebene auf die Webersche<br />
Soziologie wenig hilfreich ist. Ich glaube, daß sich zeigen läßt, daß Weber<br />
zwischen unterschiedlichen Aggregationsniveaus von Handlungen unter<br />
anderem deshalb flexibel zu vermitteln vermochte, weil er das Konzept<br />
des Einverständnishandelns mit Prozessen formaler Rationalisierung verbinden<br />
konnte. Formal rationalisiert werden sämtliche Denk- <strong>und</strong> Handlungsbereiche,<br />
aber auch die Persönlichkeit selbst. Damit hat Weber mit formaler<br />
Rationalität den Fall der Interrelation von Mikro- <strong>und</strong> Makrorationalität<br />
identifiziert, bei dem die Rationalitätskriterien der beiden Ebenen konkordant<br />
sind. Die Organisationen haben ein notwendiges Interesse daran, daß<br />
ihre Mitglieder <strong>und</strong> Abnehmer in ihrem Verhalten berechenbar sind, <strong>und</strong><br />
umgekehrt haben die Individuen ein Interesse daran, daß auch die Organisationen<br />
'maschinenmäßig' funktionieren. Wächst nun die formale Rationalität<br />
von Individuen <strong>und</strong> sozialen Systemen, so kommen „Einverständnisse"<br />
leichter zustande. Denn nun erhöht sich die für Einverständnishandeln<br />
konstitutive objektive Wahrscheinlichkeit: „daß ... (andere die eigenen)<br />
Erwartungen trotz des Fehlens einer Vereinbarung als sinnhaft 'gültig'<br />
für ihr Verhalten praktisch behandeln werden." 9<br />
Zusammenfassend läßt sich vielleicht festhalten: nicht Zweckrationalität,<br />
sondern formale Rationalität ist Dreh- <strong>und</strong> Angelpunkt der Weberschen<br />
Soziologie, die von Anbeginn an Evolutionstheorie war <strong>und</strong> die sich als<br />
solche nicht ohne Rekurs auf formale Rationalisierung konstruieren ließ.<br />
ANMERKUNGEN<br />
1 W. Schluchter, Die Entwicklung des okzidentalen Rationalismus, Tübingen 1979,<br />
S. 130 f.<br />
2 M. Weber, Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft, Tbg. 1956, S. 45.<br />
3 Anm. 2, S. 13.<br />
4 M. Weber, Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter, Tbg. 1889,<br />
S. 66.<br />
5 Vgl. Anm. 4, S. 151, 155.<br />
6 Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tbg. 1951, S. 204.<br />
7 Für dieses wie die folgenden Argumente ist relativ gleichgültig, ob Weber die Zusammenhänge<br />
im einzelnen präsent waren. Wenn meine Überlegungen triftig sind,<br />
mußte Weber bei der Analyse von Entwicklungsprozessen immer wieder auf ein Anwachsen<br />
von formaler Rationalität stoßen. Dies war der Fall, <strong>und</strong> das genügt für die<br />
Zwecke dieses Aufsatzes.<br />
8 M. Weber, Ges. Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Anm. 6, S. 512. Diese Passage<br />
allein sollte eigentlich genügen, den Leser davon zu überzeugen, daß man mit bloßer<br />
Zweckrationalität bei Weber nicht sehr weit kommen kann.<br />
9 Max Weber, Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie, [Anm. 6] S. 456.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
RATIONALISIERUNG UND ENTHIERARCHISIERUNG.<br />
ZUR KRITIK DER WEBERSCHEN ÄGYPTISIERUNGSTHESE<br />
Hans<br />
Haferkamp<br />
Max Weber hat bekanntlich die Zukunft moderner Gesellschaften düster<br />
ausgemalt: Die in Gang gekommene formale Rationalisierung endet in der<br />
vollkommenen Durchrationalisierung aller Lebensbereiche. Die formal rationale<br />
Verwendung von Menschen wird in diesem Prozeß durch die Bürokratie<br />
gewährleistet. Disziplin, Befehl <strong>und</strong> Gehorsam, kurz: Leben in einer<br />
Hierarchie ist eines der hervorstechenden Merkmale der Bürokratie. Die<br />
Bürokratisierung führt daher zu einem Endzustand. Ich zitiere: „Im Verein<br />
mit der toten Maschine ist sie an der Arbeit, das Gehäuse jener Hörigkeit<br />
der Zukunft herzustellen, in welche vielleicht dereinst die Menschen sich,<br />
wie die Fellachen im altägyptischen Staat, ohnmächtig zu fügen gezwungen<br />
sein werden, wenn ihnen eine rein technisch gute <strong>und</strong> das heißt: eine rationale<br />
Beamtenverwaltung <strong>und</strong> -Versorgung der letzte <strong>und</strong> einzige Wert ist,<br />
der über die Art <strong>und</strong> Leitung ihrer Angelegenheiten entscheiden soll"<br />
(Weber 1958, S. 320).<br />
Ich überlese nicht: Weber hat in seine Prognose eine Voraussetzung eingebaut:<br />
Verwaltung <strong>und</strong> Versorgung sei der letzte <strong>und</strong> einzige Wert der<br />
Menschen. Aber welche Bedeutung hat diese Bedingung? Welche andere<br />
mögliche Entwicklung sieht Weber <strong>und</strong> welche Auswirkungen hätte sie? Die<br />
alternative Entwicklung setzt mit einem leitenden Geist ein, mit dem um<br />
eigene Macht kämpfenden, Eigenverantwortung für seine Entscheidungen<br />
tragenden Politiker oder Unternehmer. Von ihm erwartet Weber eine Ausrichtung<br />
der Bürokratie auf andere Ziele <strong>und</strong> Werte als den reibungslosen<br />
Selbstlauf des bürokratischen Systems <strong>und</strong> die optimale Versorgung der<br />
Betreuten. Als solche Ziele führt er die nationale Größe <strong>und</strong> das Bestehen<br />
der Nation beim Griff zur Weltmacht an.<br />
Was auf den ersten Blick wie ein Ausweg aus dem Gehäuse der Hörigkeit<br />
aussieht, erweist sich nun bei näherem Hinsehen nur als ein Weg in<br />
einen Käfig mit anderer Zielsetzung. Entweder herrscht der cäsaristische<br />
Führer mit Hilfe der effizienten, auf Erfüllung seiner Zielsetzung ausgerichteten<br />
Bürokratie über die Massen, oder die Bürokratie herrscht mit einem<br />
Versorgungsprogramm in allen Lebensbereichen unter der Titularherrschaft<br />
unfähiger Mitglieder an ihrer Spitze. Die Bilanz für die Masse der Beherrschten<br />
ist die gleiche: Sie werden zukünftig in einem stahlharten Gehäuse mit<br />
immer stärkerer Kontrolle <strong>und</strong> immer weniger Handlungsfreiheiten leben<br />
müssen. Die Hierarchisierung bleibt unentrinnbar, ist unwiderruflich ihr<br />
Schicksal.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Ich nenne diese zusammenhängenden Prognosen der Rationalisierung,<br />
Bürokratisierung <strong>und</strong> Hierarchisierung die Ägyptisierungsthese. Sie beschreibt<br />
nach Weber den Trend zur <strong>und</strong> die Gr<strong>und</strong>tendenz der Moderne. Sie<br />
ist seit Jahrzehnten ein zentrales Interpretationsmuster der Soziologie.<br />
Ich meine, Webers Ägyptisierungsthese enthält ebensoviel falsche wie<br />
zutreffende Aussagen <strong>und</strong> die Anschlußtheorien in Soziologie <strong>und</strong> Politikwissenschaften<br />
sind in wesentlichen Teilen falsch. Richtig ist der Teil, der<br />
sich auf Bürokratisierung bezieht. Ob Weber mit seiner Prognose zunehmender<br />
formaler Rationalisierung uneingeschränkt recht hatte, ist schon sehr<br />
fraglich. Vor allem ist aber falsch — jedenfalls in ihrer Allgemeinheit — die<br />
Hierarchisierungsprognose, der düstere Schlußpunkt der Ägyptisierungsthese,<br />
der im Mittelpunkt meines Vortrages steht. Dazu möchte ich zunächst<br />
Gegenthesen formulieren <strong>und</strong> dann ihre Triftigkeit im Vergleich zu<br />
Webers Hierarchisierungsvorhersage abklären.<br />
In vielen Lebensbereichen erleben die Akteure heute eine Ersetzung von<br />
Herrschaft durch Verhandlung, einfach weil alte Regeln <strong>und</strong> Positionen zusammenbrechen<br />
<strong>und</strong> neue nicht mehr von oben gesetzt werden können, da<br />
sich unten Beteiligungsverlangen unüberhörbar zu Wort meldet, <strong>und</strong> diese<br />
Tendenz des Auftretens von Verhandlungen beschleunigt sich. Der Zustand,<br />
auf den sich diese Entwicklung hinbewegt, ist nicht das Gehäuse jener Hörigkeit,<br />
es ist vielmehr eine Situation, in der mit Akteuren, mit Beherrschten<br />
verhandelt werden muß <strong>und</strong> in der Akteure ganz allgemein soziales<br />
Handeln aushandeln. Natürlich ist Hierarchie noch nicht abgestorben, sie<br />
existiert, <strong>und</strong> so beobachten wir ein Nebeneinander von Herrschaft <strong>und</strong><br />
Verhandlung. Man findet auf der einen Seite häufig Leitung <strong>und</strong> Stab mit<br />
einem Potential negativer Sanktionen, die jedoch selten in Gang gesetzt<br />
werden, <strong>und</strong> auf der anderen Seite Abteilungen von Mitarbeitern, von denen<br />
selbständiges Vorgehen erwartet wird, <strong>und</strong> Beherrschte, die Protest<br />
<strong>und</strong> ab <strong>und</strong> zu auch Zustimmung artikulieren. Im Verhältnis von Spitze<br />
zu Apparat wie Beherrschten arbeiten Mächtige dann mit Bitten <strong>und</strong> Wünschen,<br />
mit Überzeugung <strong>und</strong> Verhandlung.<br />
Daß dies die zentrale Tendenz in Industriebetrieben, öffentlicher Verwaltung<br />
<strong>und</strong> Politik, im Erziehungs- <strong>und</strong> Bildungssystem ist, habe ich 1983<br />
an anderer Stelle beschrieben. Wegen der Kürze der Zeit verzichte ich hier<br />
auf weitere Deskription <strong>und</strong> verweise nur noch auf Daten <strong>und</strong> Analysen von<br />
Dahrendorf (1979) über die Veränderung von Lebenschancen, von Mayntz<br />
zum Zusammenhang von Folgebereitschaft <strong>und</strong> Mitbestimmung, von Fine<br />
über ,,Negotiated Orders and Organizational Cultures". Ich meine auch, daß<br />
Ergebnisse von Kern <strong>und</strong> Schumann über neue Konturen des Sozialcharakters<br />
von Arbeitern so interpretiert werden können, <strong>und</strong> erinnere schließlich<br />
an Untersuchungen von Alber über die Entwicklung zum Wohlfahrtsstaat<br />
<strong>und</strong> von Korpi über die Rolle der ,,working class in welfare capitalism". Ich<br />
bin der Auffassung, daß die folgende erste Bilanz nicht willkürlich ist:<br />
— der Herrschaftsanspruch der Bürokratie wird im Wirtschaftsbereich, in<br />
der öffentlichen Verwaltung <strong>und</strong> anderen Handlungszusammenhängen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
stark eingeschränkt oder aufgegeben,<br />
— Bürokratien werden auch von innen, von den Angehörigen des Apparates,<br />
ausgehöhlt; statt Folgebereitschaft entsteht Eigenmächtigkeit,<br />
— auf Partizipation zielende soziale Bewegungen fordern mit Unterstützung<br />
der Mehrheit der Beherrschten Hierarchien erfolgreich heraus.<br />
Jedenfalls in der Industrie, der öffentlichen Verwaltung <strong>und</strong> dem Erziehungssystem<br />
findet nicht Ägyptisierung, sondern Enthierarchisierung statt.<br />
Aber es gibt andere Lebensbereiche: das Militär, die multinationalen<br />
Wirtschaftskonzerne, die Strafjustiz <strong>und</strong> die Einrichtungen der Psychiatrie,<br />
Altersheime <strong>und</strong> Intensivstationen. Auch hier kann der deskriptive Teil nur<br />
in Kürze dargeboten werden. Dies ist für das Militär besonders mißlich, da<br />
Verweise schwerer fallen, weil das Militär zu den soziologisch stark unterbelichteten<br />
Organisationen gehört. Lesen wir die eingangs zitierten Sätze<br />
Webers mit Blick auf das Militär noch einmal, so bekommen die Worte<br />
einen neuen Sinn: Das Gehäuse jener Hörigkeit, auf das die Menschen zugehen,<br />
wäre der atomare Käfig <strong>und</strong> die unentrinnbare Bürokratie, die zum<br />
Schicksal des Jahrh<strong>und</strong>erts wird, die Militärbürokratie.<br />
Vergegenwärtigen wir uns Größe, Waffenarsenale, Einsatzpläne <strong>und</strong><br />
durchgeführte Einsätze des Militärs moderner Gesellschaften, so ist es nicht<br />
zu viel zu sagen: Von einer Handvoll Militärführer <strong>und</strong> Militärpolitiker hängen<br />
im Konfliktfall ganze Gesellschaften von nicht kämpfenden Schutzbefohlenen<br />
oder Gegnern, aber auch eigene Offiziere <strong>und</strong> Soldaten ab. Das ist<br />
nicht zu überbietende Hierarchisierung.<br />
Dieser Bef<strong>und</strong> ist erneut festzuhalten, wenn man einzelne Gruppen von<br />
Abhängigen betrachtet. Der Einfluß der Militärs auf Politiker wird allgemein<br />
als hoch eingeschätzt. Militärführer geben ihre Feindbilder an Politiker weiter,<br />
so daß zum Teil absurde Vorstellungen vom Kontrahenten, von seiner<br />
Stärke, seinen Absichten <strong>und</strong> Möglichkeiten existieren. Für den ehemaligen<br />
Staatssekretär von Bülow ist es kein W<strong>und</strong>er, daß Politiker zu verheerenden<br />
Schlußfolgerungen kommen, „wenn in Ost <strong>und</strong> West die Politiker mit den<br />
Militärs in einem Käfig sitzen".<br />
Militärführer bestehen auch erfolgreich auf Hierarchie gegenüber Offizieren<br />
<strong>und</strong> Soldaten. Es hat zwar spätestens seit 1918 auch im Militär einen<br />
Abbau von Herrschaft gegeben, so daß von „kooperativen Führungsstilen"<br />
gesprochen wird, aber anders als in der Industrie <strong>und</strong> Verwaltung ist daraus<br />
eine „Krise der Hierarchie" nicht entstanden. Die Befugnis zu allgemeinen<br />
Befehlen von oben <strong>und</strong> die Kompetenz zu detaillierten Befehlen innerhalb<br />
von Einheiten ist aber unbestritten. Ein Äquivalent zu überbetrieblicher<br />
Mitbestimmung oder zum Einfluß auf die Gestaltung des Arbeitsplatzes<br />
fehlt. Ein Ausbleiben ernsthafter Versuche der Soldaten, gr<strong>und</strong>legende<br />
Änderungen in dieser Organisation zu erreichen, belegt eine andauernde<br />
Akzeptanz von Hierarchie im Militär.<br />
Im Verhältnis zu den Schutzbefohlenen findet man, beispielsweise in<br />
der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland, generelle Zustimmung zur Militärpolitik<br />
<strong>und</strong> zu den Streitkräften. Sie äußert sich in den Zustimmungsquoten von<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
70 bis 90 % bei Meinungsumfragen. Nur sehr begrenzt kann von einer Delegitimierung<br />
des Militärs in der B<strong>und</strong>esrepublik gesprochen werden. Sie<br />
zeigt sich in Protesten <strong>und</strong> Aktivitäten von Minderheiten von Schutzbefohlenen.<br />
Zu anderen genannten Organisationen muß ein kurzer Verweis genügen:<br />
Rene König hat 1979 die Rolle multinationaler Konzerne untersucht. Danach<br />
kann von einer Enthierarchisierung hier keinesfalls die Rede sein.<br />
Es gibt also auch eine Reihe von Organisationen, die sich (noch?) auf<br />
der von Weber vorhergesagten Linie entwickeln. Hier laufen in der Tat Prozesse<br />
der Ägyptisierung von Handlungszusammenhängen ab. Ihre wesentlichen<br />
Merkmale gegenüber den durch Enthierarchisierung gekennzeichneten<br />
Organisationen sind:<br />
— Der Apparat akzeptiert Führung <strong>und</strong> führt aus. Verhandlungen finden<br />
nicht statt.<br />
— Die Mehrheit der Beherrschten zeigt keine Unterstützung oder Sympathien<br />
für Aktionen von opponierenden Minderheiten.<br />
In der Bilanz scheint sich allerdings in der Mehrzahl der <strong>gesellschaftliche</strong>n<br />
Handlungszusammenhänge die Tendenz zur Enthierarchisierung<br />
durchzusetzen.<br />
Wie sind die unterschiedlichen Entwicklungen in den verschiedenen<br />
Handlungszusammenhängen zu erklären? Zwei hervorstechende Trends in<br />
der Entwicklung zur Moderne sind ursächlich:<br />
1. ein Trend zur Leistungsangleichung,<br />
2. ein Trend zum Individualismus.<br />
Selbstverständlich treten Abweichungen, auch als Muster von den Trends<br />
auf, <strong>und</strong> es gibt Unebenheiten in den Trends, aber die generellen Trendlinien<br />
sind unübersehbar. Ich möchte hier nur einen Trend, die Leistungsangleichung,<br />
besprechen.<br />
Zunehmende formale Rationalisierung nicht nur von Herrschaft, sondern<br />
auch von allen anderen Handlungszusammenhängen, führte zu einer<br />
Leistungssteigerung, zu besseren Ergebnissen. Denn formale Rationalität<br />
führt zu immer effizienterer Planung, Anlage <strong>und</strong> Durchführung von Prozessen<br />
der Arbeit, Verwaltung, Sozialisation, Sinnstiftung, Verteidigung oder<br />
Verwahrung. Voraussetzung ist allerdings oben <strong>und</strong> unten die Bereitschaft<br />
<strong>und</strong> Fähigkeit zu <strong>und</strong> die Erbringung von Leistungen.<br />
Für die Akteure oben wie unten hatte das eine in ihren Folgen nicht bedachte<br />
Konsequenz: Wer mehr leistet, der wird auch wichtiger; wer wichtig<br />
ist, den hört man auch an, dessen Vorschläge, Wünsche, Verlangen werden<br />
beachtet, <strong>und</strong> damit haben diese Akteure auch Einfluß. Kurz: „Wer die<br />
Arbeit tut, hat den Einfluß", wie Weber einmal bemerkte.<br />
Das gilt in mehrfacher Hinsicht. Einmal von oben: Wer überhaupt Situationen<br />
anbietet, in denen Leistungen von anderen erbracht werden können,<br />
hat schon Einfluß. So hat Dahrendorf (1982, S. 26) recht, wenn er für moderne<br />
Gesellschaften meint, daß „Arbeit (<strong>und</strong> das heißt: Arbeitsplatzangebot,<br />
H.H.) zumindest auch ein Herrschaftsinstrument ist. Wenn sie ausgeht,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
verlieren die Herren der Arbeitsgesellschaft das F<strong>und</strong>ament ihrer Macht".<br />
Unten, am Fuße der Herrschaftspyramide, wurden die Beherrschten in<br />
Westeuropa, nachdem einmal Großorganisationen entstanden waren, die<br />
in Konkurrenz produzierten, immer unentbehrlicher. Die hier verfolgte<br />
These lautet nun, daß der durch Rationalisierungsprozesse ausgelöste technische<br />
Wandel zwar zu einer beispiellosen Leistungssteigerung führte, die<br />
aber ihre Träger in unterschiedlichen Herrschaftslagen fand. In Industrie,<br />
Politik, öffentlicher Verwaltung, Erziehung <strong>und</strong> Bildung nahm die Bedeutung<br />
der Leistungen oben in einem langen Prozeß, dessen Geschwindigkeit<br />
sich beschleunigt hat, permanent ab. Dagegen nahm die Relevanz der Leistungen<br />
unten, also von jenen Akteuren, die anfangs einfach in dieses System<br />
hineingeschoben wurden, deren Leistung früher nur in der Verausgabung<br />
von Körperkraft ohne viel Sinn für den Akteur bestand, immer mehr<br />
zu. Das ist die Gr<strong>und</strong>lage dafür, daß sich Herrschaft in diesen Lebensbereichen<br />
immer mehr wegbewegt vom manipulierten Konsens oder von der<br />
durchgesetzten, aber bestrittenen Definition der Situation hin zur Machtangleichung.<br />
Wie ist es aber zu erklären, daß wir bei der Analyse des Militärs zu<br />
einem anderen Ergebnis kommen? Auch das Militär hat eine zentrale <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Leistung zu erbringen: die Sicherheit vor Angriffen von außen.<br />
Die Formel „Produktion von Sicherheit" wird zwar von Intellektuellen oft<br />
belächelt <strong>und</strong> verspottet, da sie zum abrufbaren Selbstverständnis jedes<br />
Fähnrichs geworden ist, aber zutreffend ist sie für die Beherrschten dennoch.<br />
Produktion von Sicherheit wird von den Beherrschten als real erlebt<br />
in einer Gesellschaft, in der immer irgendwo Krieg ist. Die Bedrohung wird<br />
zunächst einmal von der Mehrheit der Akteure als von anderen Armeen<br />
als der eigenen ausgehend erlebt. Solange das so ist, solange gibt es keine<br />
„Unvereinbarkeit von militärischer Gewalt <strong>und</strong> entwickelter Gesellschaft",<br />
solange ist ein nachhaltiger Delegitimierungsprozeß der „Sicherheitspolitik<br />
oder der Streitkräfte" unwahrscheinlich.<br />
Sicherlich, das Unwahrscheinliche könnte eintreten, wenn Nuklearwaffen<br />
nicht als Sicherheit stiftend angesehen werden, sondern in eine doppelte<br />
Beziehung zum Überlebensproblem „Sicherheit vor Angriffen von außen"<br />
gebracht werden. Nuklearwaffen haben paradoxe Effekte. Sie geben als Abschreckungswaffen<br />
Sicherheit vor Angriffen, aber ihr Besitz fordert möglicherweise<br />
im Konfliktfall auch ihre Anwendung durch den Gegner heraus<br />
mit furchtbaren zerstörerischen Konsequenzen. Dadurch schaffen sie neue<br />
Unsicherheit. Darin liegt ein Potential für Delegitimierung <strong>und</strong> Funktionsverlust<br />
des Militärs mit weitreichenden Folgen für Enthierarchisierungsverläufe.<br />
Dieser Prozeß ist aber noch nicht im Gang.<br />
Militärorganisationen erfahren Legitimität um so mehr, als sie erfolgreich<br />
die territorialen Grenzen ihrer Gesellschaft verteidigen, d.h. Kriege<br />
verhindern oder gewinnen. Sieht man die westlichen Gesellschaften im Zusammenhang,<br />
so hat die Militärelite mit der atomaren Abschreckung zwar<br />
nur — auch in den Auswirkungen auf die eigenen „geschützten" Gesellschaf-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ten — schreckliche Konzepte zu offerieren, diese haben aber immerhin<br />
seit bald vierzig Jahren den Frieden erhalten. An dieser Tatsache kommt<br />
keine Analyse des modernen Militärs <strong>und</strong> seiner Machtgr<strong>und</strong>lagen in westlichen<br />
Gesellschaften vorbei.<br />
Die Herrschaft der Militärführer über die Soldaten ist ebenfalls bedeutend<br />
<strong>und</strong> mit der Herrschaft von Betriebsleitern <strong>und</strong> Behördenvorgesetzten<br />
nicht zu vergleichen, obwohl nicht übersehen werden darf, daß Soldaten<br />
heute nicht mehr so abhängig sind wie vor h<strong>und</strong>ert oder mehr Jahren. Technisierung<br />
der Armee, die Effizienz von Führungsstrukturen, die Beteiligung<br />
der Soldaten an der Erfüllung von Gruppenaufträgen haben ihre Auswirkung<br />
auch im Militär in Enthierarchisierungsprozessen. Sie sind aber nicht<br />
mit den Prozessen des Machtwandels in Industrie <strong>und</strong> öffentlicher Verwaltung<br />
zu vergleichen, <strong>und</strong> sie werden zum Teil durch neue Hierarchisierung<br />
aufgr<strong>und</strong> von Nuklearbewaffnung ausgeglichen. Denn in einer Armee, die<br />
die äußere Sicherheit mit Kernwaffen zu gewährleisten versucht, für deren<br />
Einsatzbereitschaft eine im Verhältnis zu anderen Armeeteilen kleine Gruppe<br />
von Akteuren erforderlich ist, ist die Leistung der Masse der Soldaten<br />
der Infanterie, Marine <strong>und</strong> Luftwaffe für die Lösung des Sicherheitsproblems<br />
geringer einzuschätzen. Ihre Leistung ist auch nicht mit der anderer<br />
moderner Beherrschter, z.B. von Fabrikarbeitern, zu vergleichen, wenn man<br />
berücksichtigt, daß in Armeen von Wehrpflichtigen Soldaten nie Experten<br />
in ihrer Position werden, wie dies Industriearbeiter sind. Daher finden wir<br />
die Machtkonzentration an der Spitze <strong>und</strong> die Machtlosigkeit der Masse der<br />
Soldaten.<br />
Für die Einflußlosigkeit der Minderheit von Schutzbefohlenen, die in<br />
sozialen Bewegungen gegen die modernen Armeen in westlichen Gesellschaften<br />
antreten, sind die nicht überzeugenden Antworten auf die Frage<br />
nach der Sicherheit vor Angriffen von außen maßgebend.<br />
Ich fasse zusammen: Die unterschiedlichen Leistungsdifferenzen zwischen<br />
den Handlungszusammenhängen der Wirtschaft, der öffentlichen Verwaltung<br />
<strong>und</strong> des Militärs, die wir hier insbesondere betrachtet haben, erklären<br />
daher den unterschiedlichen Grad der Enthierarchisierung. Denn, so<br />
lautet unsere These, die formale Rationalisierung der Lösung von Überlebensproblemen<br />
führt stets zu Hierarchisierung der Akteure eines Handlungszusammenhangs<br />
einerseits <strong>und</strong> zur differentiellen Leistungssteigerung<br />
„oben" <strong>und</strong> „unten" andererseits. Da in der Moderne Herrschaft wesentlich<br />
auf Leistungen gründet, verändern die Leistungsrelationen permanent Herrschaftsverhältnisse.<br />
Wo Machtansprüche nicht mehr von Leistungen gedeckt<br />
werden, kann sich alte, anerkannte Macht nicht lange halten, kann sich<br />
neue Macht der Masse der Beherrschten nicht entwickeln. Wo zur Lösung<br />
von Problemen des Überlebens <strong>und</strong> Besserlebens die erforderlichen Leistungen<br />
unten auf breiter Basis erbracht werden, da ist auch die Gefahr der<br />
Ägyptisierung, der Entwicklung zur formierten Gesellschaft, ganz unwahrscheinlich.<br />
Wo aber die Akteure unten keine bedeutenden Leistungen erbringen<br />
können oder gar jede Partizipation verweigern, da ist Ägyptisierung<br />
reale Gefahr.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
LITERATUR<br />
Alber, Jens, Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat. Analysen zur Entwicklung der<br />
Sozialversicherung in Westeuropa, Frankfurt 1982.<br />
Dahrendorf, Ralf, Lebenschancen. Anläufe zur sozialen <strong>und</strong> politischen Theorie, Frankfurt<br />
1979.<br />
— , „Wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht". In: J. Matthes (Hrsg.), Krise der<br />
Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des 21. Deutschen Soziologentages in Ba<strong>mb</strong>erg<br />
1982, Frankfurt 1983, S. 25-37.<br />
Fine, Gary Alan, „Negotiated Orders and Organizational Cultures", Ann. Rev. Sociol.,<br />
Bd. 10, 1984, S. 239-262.<br />
Haferkamp, Hans, Soziologie der Herrschaft. Analyse von Struktur, Entwicklung <strong>und</strong><br />
Zustand von Herrschaftszusammenhängen, Opladen 1983.<br />
Kern, Horst <strong>und</strong> Michael Schumann, „Arbeit <strong>und</strong> Sozialcharakter: Alte <strong>und</strong> neue Konturen".<br />
In: J. Matthes (Hrsg.), Krise der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des<br />
21. Deutschen Soziologentages in Ba<strong>mb</strong>erg 1982, Frankfurt 1983, S. <strong>35</strong>3-365.<br />
König, Rene, „Gesellschaftliches Bewußtsein <strong>und</strong> Soziologie", KZFSS, Sonderheft 21/<br />
1979, S. <strong>35</strong>8-370.<br />
Korpi, Walter, The working class in welfare capitalism. Work, unions and politics in<br />
Sweden, London, Henley <strong>und</strong> Boston 1978.<br />
Mayntz, Renate, „Regulative Politik in der Krise?", In: J. Matthes (Hrsg.), Sozialer Wandel<br />
in Westeuropa. Verhandlungen des 19. Deutschen Soziologentages in Berlin<br />
1979, Frankfurt 1979, S. 55-81.<br />
Weber, Max, Gesammelte politische Schriften, Tübingen 1958.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
DIE MODERNISIERUNG DER ZEIT UND DIE ZEIT NACH DER<br />
MODERNE*<br />
Hanns-Georg Brose<br />
Die Entwicklung zur Moderne <strong>und</strong> in der Moderne soll an der Entwicklung<br />
des modernen Zeitbewußtseins <strong>und</strong> der temporalen Struktur von Lebensläufen<br />
<strong>und</strong> Biographien rekonstruiert werden. Mit Bezug auf die ästhetische<br />
Moderne hat Habermas deren Zeitbewußtsein als ein konstitutives Moment<br />
von Modernität überhaupt gekennzeichnet: „Das neue Zeitbewußtsein,<br />
bringt nicht nur die Erfahrung einer mobilisierten Gesellschaft, einer akzelerierten<br />
Geschichte, eines diskontinuierlichen Alltags zum Ausdruck. In<br />
der Aufwertung des Transitorischen, des Flüchtigen, des Ephemeren, in der<br />
Feier des Dynamismus spricht sich ... die Sehnsucht nach einer unbefleckten,<br />
innehaltenden Gegenwart aus." (Habermas 1980; 447) Der hier angedeutete<br />
Widerspruch zwischen Innovation <strong>und</strong> Verfall, Neuartigem <strong>und</strong><br />
Überdauerndem sowie seine Aufhebung <strong>und</strong> Behandlung in der modernen<br />
Zeiterfahrung könnte ein Leitfaden für das Verständnis von Entwicklungen<br />
in der Moderne sein <strong>und</strong> zur Klärung der Frage beitragen, ob die Moderne<br />
sich gegenwärtig zur Post-Moderne wandelt. Habermas' Kennzeichnung des<br />
modernen Zeitbewußtseins knüpft an die entsprechenden Bestimmungen<br />
bei Baudelaire an, der die „Modernität" als das „Vorübergehende, das Entschwindende,<br />
das Zufällige" gekennzeichnet hatte, deren andere Hälfte<br />
das „Ewige <strong>und</strong> Unabänderliche" sei (1863; 286). Jauß (1970) hat diese<br />
Bestimmung von Modernität als das „Ewige im Vorübergehenden", als den<br />
definitiven Bruch mit einer ästhetischen Tradition bezeichnet, in der die<br />
Qualifikation als „modern" sich immer noch auf das bezogen hatte, wogegen<br />
sie sich absetzte, nämlich die Antike bzw. ihre jeweiligen Renaissancen.<br />
Vorbereitet wurde diese Wendung Baudelaires durch Stendhal, der Romantik<br />
<strong>und</strong> Modernität in eins setzt <strong>und</strong> neu bestimmt: „Romantisch ist jetzt<br />
nicht mehr der Reiz dessen, was das Gegenwärtige transzendiert, zum Wirklichen<br />
<strong>und</strong> Alltäglichen den Spannungspol des Fernen <strong>und</strong> Gewesenen bildet,<br />
sondern das Aktuelle, gerade jetzt Schöne, das als Vergangenes seinen<br />
unmittelbaren Reiz einbüßen muß <strong>und</strong> dann nur noch historisch zu interessieren<br />
vermag" (Jauß 1970; 52).<br />
* Der Titel verspricht mehr, als der Beitrag wegen seiner gebotenen Kürze hier einlösen<br />
kann. Ich habe ihn dennoch so beibehalten, weil er die Intention des gesamten<br />
Beitrags, von dem hier nur der erste Teil verkürzt wiedergegeben ist, andeutet.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Vergleichbar allenfalls mit dem eminenten Selbstbewußtsein der Denker<br />
der Renaissance wird hier der Beginn einer neuen Epoche umrissen, die sich<br />
dadurch definiert, daß der Faden zwischen der Vergangenheit <strong>und</strong> der Gegenwart<br />
durchschnitten wird. Der Untergang des Ancien regime wird ästhetisch,<br />
programmatisch umgemünzt. Zur Verdeutlichung seines Modernitätsbegriffes,<br />
der das Flüchtige <strong>und</strong> dadurch sich Bewahrende meint, greift<br />
Baudelaire auf das Beispiel der Mode zurück. Sie bringt, als jeweils „letzter<br />
Schrei" der Zeitgenossen deren Flucht nach vorne zum Ausdruck, deren<br />
abenteuerliche Ungewißheit allenfalls dadurch abgefangen wird, daß dieser<br />
dann doch nicht der 'dernier cri' gewesen ist, der die Kraft des innovatorischen<br />
Impulses trägt. Explosion sei eine der Invarianten der Moderne,<br />
heißt es dann später bei Adorno. Walter Benjamin hat Baudelaires Bestimmung<br />
der Moderne auf dessen Erfahrungen in der Großstadt Paris bezogen<br />
<strong>und</strong> sie in dem Begriff der schockförmigen Wahrnehmung zusammengezogen.<br />
Über Simmel bis zu Adorno ist dies ein Fluchtpunkt der Bestimmung<br />
von Modernität geblieben. Die Figuren des Spielers, des Abenteurers, des<br />
Dandy, <strong>und</strong> schließlich des Flaneur kennzeichnen unterschiedliche subjektive<br />
Reaktionsformen auf diese Erfahrung von Reizüberflutung, Beschleunigung<br />
<strong>und</strong> Zufälligkeit. Der Dandy verband „die blitzschnelle Reaktion mit<br />
entspanntem, ja schlaffen Gebaren <strong>und</strong> Mienenspiel". (Benjamin 1980;<br />
600) Eine andere Reaktionsform kennzeichnet den Flaneur. Er protestiert<br />
gegen die Betriebsamkeit. „Um 1840 gehörte es vorübergehend zum guten<br />
Ton, Schildkröten in den Passagen spazieren zu führen. Der Flaneur ließe<br />
sich gern sein Tempo von ihnen vorschreiben. Wäre es nach ihm gegangen,<br />
so hätte der Fortschritt diesen pas lernen müssen. Aber nicht er behielt das<br />
letzte Wort, sondern Taylor, der das 'Nieder mit der Flanerie' zur Parole<br />
machte" (ebd. 556 f.) Diese Formen der Stilisierung von Subjektivität als<br />
Reaktionsform auf die Erfahrung von Moderne haben sich, obwohl, wie<br />
Benjamin andeutet, sie durch die industrielle Entwicklung verdrängt wurden,<br />
als Bezugspunkte für Subjektivitätsformationen erhalten. Gerade in<br />
jüngster Zeit werden sie häufig wehmütig zitiert oder auf zynische Weise, so<br />
in der entsprechenden Abhandlung von Oswald Wiener (1982), neu gestylt.<br />
Was als Zeitbewußtsein der Moderne bezeichnet wurde, bedeutet zweierlei:<br />
zum einen, so bei Stendhal <strong>und</strong> Baudelaire, definiert es ein epochales<br />
Selbstbewußtsein, das sich radikal gegen die bisherige Geschichte abgrenzt.<br />
Dazu mußte aber die Zeit selbst, als Dimension von Erfahrung <strong>und</strong> Selbstbewußtsein<br />
gewissermaßen freigelegt <strong>und</strong> gegen die Sach- <strong>und</strong> Sozialdimension<br />
differenzierbar werden. Dies läßt sich — wiederum im Bereich der<br />
Kunst — nachzeichnen an der Herausbildung einer linearen Erzählperspektive,<br />
in der, wie in der eschatologischen Zeitauffassung des Christentums, Anfang<br />
<strong>und</strong> Ende „beschlossen" sind; dem Aufbrechen dieser geschlossenen<br />
Form <strong>und</strong> der Einführung verschiedener Erzählebenen, an der Lugowski<br />
(1976) erste Formen des Auftretens von Individualität im Übergang vom<br />
höfischen <strong>und</strong> Ritterroman zum frühbürgerlichen Roman festmacht. Seine<br />
entsprechenden Analysen aus dem Bereich der Autobiographik stützen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
diesen Bef<strong>und</strong>, der für das frühe 16. Jh. gilt, ab. Die lineare Erzählperspektive<br />
mit geschlossener Zukunft (Rammstedt 1975) wird zu einer — immer<br />
noch linearen — Entwicklung mit offener Zukunft. An der Entwicklung der<br />
narrativen Figur läßt sich, das ist die zugr<strong>und</strong>eliegende methodische Annahme,<br />
die Entwicklung des Zeitbewußtseins rekonstruieren. Diese Entwicklung<br />
führt über die Ausdifferenzierung von Gleichzeitigkeit (so bei Kleist)<br />
<strong>und</strong> die Infragestellung von Zukunft <strong>und</strong> Finalität, schließlich auch (so bei<br />
L. Sterne) zur Öffnung der Vergangenheit als Dispositionsraum für erzählerische<br />
Linienführung. Herkunft, als individuelle, wird problematisiert,<br />
rätselhaft (so bereits bei Grimmelshausen). Damit werden aber, wenn Anfang<br />
<strong>und</strong> Ende der Geschichte — hier als Erzählung verstanden — ungewiß<br />
sind, die Relevanzen ganz auf die Gegenwart konzentriert, deren modale<br />
Aktualität zwar unbestreitbar ist, die aber den Charakter des Flüchtigen<br />
nicht leugnen kann. Hier greift dann die Entwicklungssemantik, die den<br />
Protagonisten (das bürgerliche Individuum) zumindest mit der Gewißheit<br />
ausstattet, daß er sich entwickeln könne. Auch diese Gewißheit ist in dieser<br />
Form veraltet, wie wir wissen, was sich in der Entwicklung des Romans<br />
nachzeichnen läßt. Die Gewißheit schrumpft nun auf einen Augenblick, in<br />
dem wie in einem riesigen blow-up die Relevanzlinien zusammengezogen<br />
werden <strong>und</strong> sich reproduzieren. Dies läßt sich an den Klassikern des modernen<br />
Romans, Joyce, Musil <strong>und</strong> V. Woolf sehr gut zeigen (vgl. Auerbach<br />
1946, 508/9). Ich habe diese Entwicklungslinie am Beispiel des Romans<br />
über den Zeitpunkt, der durch den Beginn der ästhetischen Moderne bei<br />
Baudelaire gekennzeichnet war, verlängert, um die anfangs benannte Widersprüchlichkeit<br />
moderner Zeiterfahrung: Selbstgewißheit durch Permanenz<br />
der Veränderung, als ein durchgängiges Thema der Entwicklung zur Moderne<br />
<strong>und</strong> in der Moderne zu fixieren. In der Geschichte des Romans deutet<br />
sich an, daß dieser Impuls, wenn er nicht bereits verbraucht oder erlahmt<br />
ist, sich doch zu verheddern scheint. Was an der Entwicklung des Romans<br />
angedeutet wurde, läßt sich an der Entwicklung der Zeitsemantik in der<br />
Philosophie <strong>und</strong> in der Sozialgeschichte ebenfalls aufweisen. Im Mittelalter<br />
scheint — grob vereinfachend ausgedrückt — eine Kompromißbildung stattgef<strong>und</strong>en<br />
zu haben zwischen dem eschatologischen linearen Zeitbegriff der<br />
christlich-religiösen Eliten <strong>und</strong> der zyklischen Zeit, in der vorchristliche<br />
Zeitvorstellungen <strong>und</strong> die Rhythmik der bäuerlichen Produktionsweise verschmolzen<br />
(Hohn 1981). Eine Ausdifferenzierung von Gegenwart <strong>und</strong> Zukunft<br />
gab es nicht; „Zeit" indizierte kein Werden oder Vergehen, sie war<br />
von Gott gegeben (Poulet 1952). Noch vor der Reformation läßt sich bei<br />
den Denkern der Renaissance (Blumenberg 1975) ein deutlicher Umschlag<br />
feststellen. Die Zeit Gottes, die von der Kirche verwaltet wurde <strong>und</strong> in<br />
Ordensregeln <strong>und</strong> dem christlichen Kalender ihre soziale Beispielwirkung<br />
entfaltete, wurde von den neuen Mächten, den Städten <strong>und</strong> Kaufleuten in<br />
Griff genommen. Le Goff (1960) hat diesen Übergang sehr eindringlich beschrieben.<br />
Die protestantische Ethik ist ein weiterer, nach Weber entscheidender,<br />
aber keineswegs der einzige Wegbereiter dieser Entwicklung. Neben<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
der religiösen Motivation, durch Askese, Fleiß <strong>und</strong> Sparsamkeit — eben<br />
auch mit der Zeit — sich des gr<strong>und</strong>sätzlich ungewissen Gnadenstandes zu<br />
vergewissern (Habermas 1981; 308) belegen Lehrlings- <strong>und</strong> Kaufmannsalmanache,<br />
aus einer Zeit lange vor Benjamin Franklin den minuziösen Umgang<br />
mit der Zeit, der möglicherweise eher als säkulare Variante einer optimalen<br />
Verwaltung der — nun nicht mehr von Gott gegebenen — Zeit nach<br />
dem Vorbild der Kirche zu verstehen ist. Dagegen begründet die in der protestantischen<br />
Ethik wurzelnde Bemühung um Vergewisserung aber auch<br />
eine spezifische <strong>und</strong> folgenreiche neue Triebökonomie. Die innerweltliche<br />
Askese entwickelte sich in der „Einführung des Zwecks in den Wunsch, wodurch<br />
sinnliches Begehren normativ finalisiert <strong>und</strong> Zeit in die Antithetik<br />
von Automatismus <strong>und</strong> Autonomie hineingespannt wird. ... die wahre Wirklichkeit<br />
der Begierde, so verkündet die Apologie ihrer Negation, besteht in<br />
der Unterwerfung ihrer Gegenwart unter das Gesetz ihrer zukünftigen Vergangenheit."<br />
(Kimmerle 1983; 43) Das ist ein wesentlicher Punkt: Gegenwart<br />
wird finalisiert <strong>und</strong> der in der Gegenwart erlangte Erfolg wird entwertet.<br />
Die Finalisierung auf eine ungewisse Zukunft kann ihr Ziel — im Leben<br />
— nie erreichen. Ad infinitum wird die Notwendigkeit der Vergewisserung<br />
<strong>und</strong> Versagung reproduziert. Gegenwart muß immer wieder neu hergestellt<br />
werden, als Ausdruck der Selbsterhaltung <strong>und</strong> Selbstbehauptung.<br />
„Internalisierung der creatio contunia" nennt das Blumenberg (1976; 185).<br />
Die Übertragung dieser Logik auf das Muster der industriellen Produktion<br />
<strong>und</strong> die damit einhergehenden Formen der Zurichtung von Subjektivität<br />
sind, insbesondere von Thompson (1967), vielfach beschrieben worden.<br />
Allerdings bleibt die Frage, wie ein solches Programm überhaupt auf die<br />
Dauer durchgehalten werden konnte. Meine These ist, daß dies nur geht,<br />
wenn die Unruhestiftung, die aus dieser Verhaltensorientierung resultiert,<br />
gleichsam eingeb<strong>und</strong>en wird durch eine Kontinuitätssemantik, die die permanente<br />
Notwendigkeit der Bewältigung von Kontingenz abfedert. Dies<br />
will ich kurz erläutern an der Entwicklung temporaler Gliederungen von Lebenslauf<br />
<strong>und</strong> Biographie. Kohli hat kürzlich die These vertreten, daß der<br />
Modernisierungsprozeß „ein Übergang von einem Muster der Zufälligkeit<br />
der Lebensereignisse zu einem des vorhersagbaren Lebenslauf" sei (Kohli<br />
1983; 1<strong>35</strong>). Seine These stützt er auf Bef<strong>und</strong>e (u.a. von Imhof 1981), die<br />
die Verlängerung des durchschnittlichen Lebensalters belegen, was insbesondere<br />
auf einen drastischen Rückgang der vorzeitigen Sterblichkeit seit<br />
dem 17. Jh. zurückzuführen sei. Zwar ist die Lebenserwartung auch infolge<br />
der Verbesserung der medizinischen Kenntnisse insgesamt gestiegen, aber<br />
das macht nur einen geringen Teil dieses Effekts aus. Entscheidend ist, daß<br />
die Sterblichkeit sich in den höheren Altersjahren konzentriert, was mit dazu<br />
beiträgt, daß der Tod aus dem Alltag verdrängt wird. Darüber ist bereits<br />
viel geschrieben worden. Als eine Folge dieser Entwicklung wird u.a. gesehen,<br />
daß „wir uns benehmen, als ob wir unsterblich wären" (Imhof). Dies<br />
ist übrigens eines der Phänomene, die den sog. „narzißtischen" Sozialcharakter<br />
zu kennzeichnen scheinen. Das bedeutet nicht nur: Jugendlichkeits-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
kult, sondern auch: Vermeidung von lebensgeschichtlichen Entwicklungen,<br />
die Älter-Werden unwiderlegbar dokumentieren <strong>und</strong> zur Folge haben (z.B.<br />
Verantwortung für Kinder). Aber die Veränderung der Mortalität <strong>und</strong> der<br />
Lebenserwartung — hier nicht als epidemiologischer Begriff verwandt —<br />
ist nur ein von Kohli in Anspruch genommener Beleg. Ein weiterer ist die<br />
Ausdifferenzierung von Altersphasen als Folge der Institutionalisierung<br />
von Lohnarbeit; die Bedeutungszunahme des chronologischen Alters als<br />
Mittel der Askription; Verringerung der Altersdifferenz bei der Erstheirat;<br />
schließlich sozial-versicherungsrechtliche Regelungen, die an das chronologische<br />
Alter geb<strong>und</strong>en sind <strong>und</strong> außerdem die Zukunftsungewißheit für<br />
das Alter mildern. All das habe zu einer Standardisierung der Sequenzialisierung<br />
von Lebensereignissen geführt bzw. zur „Institutionalisierung des<br />
Lebenslaufs als Ablaufprogramm <strong>und</strong> mehr noch als langfristige perspektivische<br />
Orientierung für die Lebensführung". (Kohli 1983; 143) Man wird<br />
diese These mit Blick auf die enormen DeStabilisierungen, Wanderungsprozesse<br />
<strong>und</strong> sozialen Umschichtungen infolge des Industrialisierungsprozesses<br />
<strong>und</strong> insbesondere für unterschiedliche Milieus <strong>und</strong> Klassen diskutieren, in<br />
jedem Fall differenzieren müssen. Ganz von der Hand zu weisen ist sie<br />
nicht, wenn man sie auf die letzten dreißig Jahre in der BRD bezieht. Aber<br />
gerade wenn man diesen Zeitraum als Bezugspunkt wählt, dann lassen sich<br />
seit Mitte der 70er Jahre Entwicklungen erkennen, die sich dem hier<br />
skizzierten Modernitätsschema (Ko<strong>mb</strong>ination von permanenter <strong>und</strong> beschleunigter<br />
Innovation mit begleitender Kontinuitätssemantik (z.B. 'Fortschritt'<br />
<strong>und</strong> 'Anschlußregelungen') nicht mehr fügen. Hierfür lassen sich Belege<br />
aus dem Bereich der Ästhetik <strong>und</strong> der Kulturindustrie beibringen, in<br />
denen eine neue Zeitsemantik erkennbar wird, die weniger durch Akzeleration<br />
<strong>und</strong> Veränderung als durch Reflexivität <strong>und</strong> Dehnung gekennzeichnet<br />
ist. Ähnliches gilt für den Bereich Ökonomie <strong>und</strong> Planung. Gerade hat<br />
Lutz (1984) auf den Zerfall einer täuschenden Kontinuitätssemantik aufmerksam<br />
gemacht. In anderem Zusammenhang habe ich die Entwicklung<br />
neuer sozialer Zeitstrukturen untersucht, die durch die Simultanrepräsentation<br />
von Dauer <strong>und</strong> Diskontinuität charakterisiert sind. Sie weichen von<br />
der bisher dominierenden Linearität der Zeitstrukturen ab. (Brose 1982)<br />
Komplementär dazu lassen sich Tendenzen zur DeStandardisierung <strong>und</strong><br />
Entregelung von Lebensläufen <strong>und</strong> Biographien feststellen, die in der Zeitdimension<br />
als Desynchronisation <strong>und</strong> Suspension beschrieben werden können.<br />
(Brose 1984) Die letztgenannten Aspekte können in diesem Kurzbeitrag<br />
nur genannt werden.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
LITERATUR<br />
Auerbach, E., 1946, Mimesis, Bern 4 1967.<br />
Baudelaire, Ch., 1863, „Der Maler des modernen Lebens", in: Ders., Gesammelte Schriften,<br />
Bd. 4. (Dt. Ausgabe; Übers. M. Bruns) Reprogr. Nachdruck, Kempten o.J.,<br />
S. 265-328.<br />
Benjamin, W., 1980, Gesammelte Schriften, Bd. 1.2, Frankfurt.<br />
Blumenberg, H., 1957, Die Genesis der Kopernikanischen Welt, Frankfurt.<br />
— , 1976, „Selbsterhaltung <strong>und</strong> Beharrung. Zur Konstitution der neuzeitlichen Rationalität",<br />
in: Ebeling, H. (Hrsg.), Subjektivität <strong>und</strong> Selbsterhaltung, Frankfurt,<br />
S. 144-207.<br />
Brose, H.-G., 1982, „Die Vermittlung von sozialen <strong>und</strong> biographischen Zeitstrukturen",<br />
in: KZfSS Sonderheft 24, S. 385-407.<br />
— , 1984, „Arbeit auf Zeit — Biographie auf Zeit", in: Kohli, M./Robert, G. (Hrsg.),<br />
Biographie <strong>und</strong> soziale Wirklichkeit, Stuttgart, S. 192-216.<br />
Habermas, J., 1980, „Die Moderne — ein unvollendetes Projekt", in: Ders., Kleine Politische<br />
Schriften, Frankfurt 1981, S. 444-464.<br />
— , 1981, Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 1, Frankfurt.<br />
Hohn, H.-W., 1981, „Zyklizität <strong>und</strong> Heilsgeschichte, Religiöse Zeiterfahrung des europäischen<br />
Mittelalters", in: Ästhetik <strong>und</strong> Kommunikation, Heft 45/46, S. 91-106.<br />
Imhof, A.E., 1981, Die gewonnenen Jahre, <strong>München</strong>.<br />
Jauß, H.R., 1970, „Literarische Tradition <strong>und</strong> gegenwärtiges Bewußtsein der Modernität",<br />
in: Ders., Literaturgeschichte als Provokation, Frankfurt, S. 11-66.<br />
Kohli, M., 1983, „Thesen zur Geschichte des Lebenslaufs als sozialer Insititution", in:<br />
C. Conrad/H.-J. v. Kondratowitz (Hrsg.), Gerontologie <strong>und</strong> Sozialge schichte, Berlin,<br />
Deutsches Zentrum für Altersfragen, S. 133-147.<br />
Kimmerle, G., 1983, „Der Tod des antizipierenden Bewußtseins", in: Konkursbuch 11,<br />
Tübingen, S. 37-64.<br />
LeGoff, J., 1960, Au Moyen Age: „Temps de l'Eglise et temps du marchand", in:<br />
Annales (ESC) 15, S. 417-433.<br />
Lugowski, C, 1932, Die Form der Individualität im Roman, Frankfurt 1976.<br />
Lutz, B., 1984, Der kurze Traum immerwährender Prosperität, Frankfurt/New York.<br />
Poulet, G., 1952, Etudes surle temps humain, Bd. 1, Paris 1976.<br />
Rammstedt, O., 1975, „Alltagsbewußtsein von Zeit", in: KZfSS 27, S. 47-63.<br />
Thompson, E.P., 1967, „Time, Work-Discipline, And Industrial Capitalism", in: Past<br />
and Present, 38, S. 5 7-97.<br />
Wiener, O., 1982, „Eine Art Einzige", in: V. v.d. Heyden-Rynsch (Hrsg.), Riten der<br />
Selbstauflösung, <strong>München</strong>, S. <strong>35</strong>-78.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
DIE ZÖGERNDE BEGRÜSSUNG DER MODERNE.<br />
ZU GEORG SIMMELS DIAGNOSE MODERNER LEBENSSTILE.<br />
Georg<br />
Lohmann<br />
Georg Simmeis Verhältnis zur Moderne ist zwiespältig. Auf der einen Seite<br />
analysiert er die Auflösung des Traditionalen als den Entstehungsprozeß<br />
der Moderne <strong>und</strong> zeigt die positiven Chancen der <strong>gesellschaftliche</strong>n Rationalisierung,<br />
der Kultivierung <strong>und</strong> des individuellen Freiheitsgewinnes auf.<br />
Auf der anderen Seite beschreibt er eben diesen Entstehungsprozeß der<br />
Moderne so, daß der durch ihn geformte moderne Lebensstil bis zum Zerreißen<br />
der individuellen Seele expansiv ist, bis zur Tragik sich selbst entfremdend<br />
<strong>und</strong> bis zur tödlichen Indifferenz vom Verlust des Lebenssinnes<br />
bedroht ist. Besondere Aktualität erhält Simmel dadurch, daß er ein sehr<br />
reflektiertes Bewußtsein davon hat, daß sich die A<strong>mb</strong>ivalenz der Moderne<br />
weder unter Rückgriff auf vormoderne Annahmen noch durch die Betonung<br />
von einem Aspekt der Moderne begreifen oder gar auflösen läßt. Bevor<br />
Simmel alle Zeitphänomene unmittelbar auf das spontane, schöpferische<br />
<strong>und</strong> fließende Leben bezog, hatte er in der Analyse der modernen<br />
Lebensstile einen Diagnoseansatz gef<strong>und</strong>en, der auch heute noch Beachtung<br />
verdient.<br />
Der Begriff des „Lebensstiles" markiert den Brennpunkt, auf den, in<br />
1<br />
der Sprache Simmeis, die individuelle Seele, die <strong>gesellschaftliche</strong>n Wechselwirkungen<br />
<strong>und</strong> die subjektive wie objektive Kultur ausstrahlen. Zu diesen<br />
differenzierten Bereichen der Moderne: Gesellschaft, Kultur, Persönlichkeit<br />
steht ein „Lebensstil" in dem für Simmel charakteristischen Zugleich von<br />
Distanz <strong>und</strong> Beziehung. Damit bestimmt Simmel die Stilisierungen des<br />
Lebens — anders als nach ihm Weber (vgl. M. Weber 1976, S. 537) — als<br />
spezifisch modern, als Reaktion auf die Entwicklungen <strong>und</strong> Veränderungen<br />
der Moderne. Dabei zentriert er in einem gewissen Sinne freilich seine Analyse<br />
in der Perspektive der beteiligten <strong>und</strong> betroffenen Menschen; er fragt<br />
nach dem erlebten Sinn <strong>und</strong> Wert dieser Veränderungen. Er behält, trotz<br />
aller betonten Deskriptivität, eine normative Einstellung gegenüber der Moderne<br />
bei, allerdings, ohne dabei mit einem normativen Maßstab zu operieren.<br />
Ist es nur eine Reminiszenz, die ihn zögern läßt?<br />
Ich möchte an dieser Stelle keine Bewertung von Simmeis Diagnoseansatz<br />
versuchen, sondern zunächst nur dessen Struktur verdeutlichen.<br />
Voraussetzung für Simmeis Analyse moderner Lebensstile ist sein allgemeines<br />
<strong>und</strong> formales Schema der Moderne, das wie ein Gr<strong>und</strong>ton alle seine<br />
Einzeluntersuchungen einfärbt . Die Moderne ist danach charakterisiert<br />
2<br />
a) durch Prozesse der Entsubstanzialisierung,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
) durch die Folgen des Verlustes von Endzwecken <strong>und</strong> kulminiert<br />
c) in einen dadurch entstehenden prinzipiellen Relationismus.<br />
Simmel wendet sich gegen die „skeptische Lockerung aller Festigkeiten"<br />
(Simmel in: Landmann 1958, S. 9); mit der programmatischen Forderung<br />
nach einer „neuen Festigkeit" (ebd.; vgl. Simmel 1900, S. 65) innerhalb<br />
eines prinzipiellen Relativismus kündigt sich die Reserve an, die Simmel<br />
dem sich durchsetzenden Prozeß der Moderne entgegenbringt. Dabei orientiert<br />
er sich an zwei Vorstellungen „konkreter Unendlichkeit" (Simmel<br />
1900, S. 85): Für die extensive Unendlichkeit einer unabgeschlossenen Entwicklungsreihe<br />
stehen der Darwinismus <strong>und</strong> Nietzsches Deutung des Entwicklungsgedankens<br />
ein (vgl. Simmel 1907, S. 3); für die intensive Unendlichkeit,<br />
die „immanente Grenzenlosigkeit", ist paradigmatisch eine Deutung<br />
des Kunstwerkes, das seine „innere Wahrheit" in der Wechselwirkung<br />
seiner Elemente untereinander realisiert (s. Simmel 1900, S. 72 f; kritisch<br />
dazu Adorno 1974, S. 559). Simmeis paradoxe Annahme ist, daß sich gerade<br />
wegen der Unbegrenztheit dieser Schemata die Frage nach dem Lebenssinn<br />
beruhigt <strong>und</strong> sich so etwas wie eine relative Stabilität einstellt, die bei<br />
eintretender Problematisierung die Möglichkeit hätte, weiterzumachen <strong>und</strong><br />
eben darin ihre Sicherheit findet.<br />
Simmel dekomponiert die Problemstellung (vgl. Luhmann 1981,<br />
S. 253f); es ist ein wechselseitiges Abgrenzen <strong>und</strong> Aufeinander-Angewiesensein<br />
von heterogenen Komponenten, durch deren Wechselwirkungen sich<br />
eine „beharrende Einheit" soll ergeben können (vgl. Simmel 1900, S. 71<br />
ff.). Überträgt man diese formalen Überlegungen auf das hier anvisierte<br />
Problem, so ist zu fragen, wie ein moderner Lebensstil als die Vernetzung<br />
der Einwirkungen <strong>und</strong> Distanzierungen der Komponenten Gesellschaft,<br />
Kultur <strong>und</strong> Seele noch so etwas wie eine „neue Festigkeit" ausbilden kann,<br />
die sich formal als unabgeschlossene Entwicklung oder als interne Komplexierung<br />
müßte kennzeichnen lassen. Ich kann darauf hier nur exemplarisch<br />
eingehen.<br />
Das Soziale konstituiert sich für Simmel aus den Wechselwirkungen der<br />
Individuen, die zugleich noch etwas anderes als soziale „Rollenträger sind<br />
(Simmel 1908a, in: Simmel 1983, S. 275ff). Dadurch gewinnt ein Individuum<br />
eine relative Freiheit dem Sozialen gegenüber. Das ermöglicht gr<strong>und</strong>sätzliche<br />
Distanz gegenüber allen sozialen Anforderungen, die sich mit der<br />
Modernität der Gesellschaft auf paradoxe Weise steigert. Die Zunahme der<br />
Arbeitsteilung <strong>und</strong> sozialen Differenzierung <strong>und</strong> die Entwicklung der Geldwirtschaft<br />
erhöhen auf der einen Seite die Abhängigkeit des Individuums<br />
vom funktionalen Ganzen der Gesellschaft. Sie reißen es aber auch in den<br />
„Schnittpunkt" mehrerer konfligierender Kreise oder funktionaler Imperative<br />
(vgl. Simmel 1893, S. 385). Dieser Zunahme von Abhängigkeiten <strong>und</strong><br />
Konflikten von <strong>und</strong> mit dem <strong>gesellschaftliche</strong>n Ganzen steht eine immer<br />
größere Unabhängigkeit <strong>und</strong> Indifferenz zu einzelnen, bestimmten Leistungen,<br />
Dingen <strong>und</strong> Personen gegenüber. Simmel deutet sie als Zunahme individueller<br />
Freiheit, die auf ihre Weise für die „Vielheit unserer Abhängigkei-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ten" entschädigt (Simmel 1900, S. 314). Freiheit nämlich ist für Simmel<br />
„Wechsel der Verpflichtung" (a.a.O., S. 297). Sie ist zunächst Freiheit von<br />
etwas, ohne daß bestimmt ist, wozu die Freiheit führt (a.a.O., S. 444 ff). In<br />
dieser Konstellation ist die sich so forcierende Individualisierung charakterisiert<br />
durch „fortwährende Befreiungsprozesse" (ebd.) <strong>und</strong> gleichzeitig<br />
durch Anstrengungen, der resultierenden Gleichgültigkeit, Langeweile, inneren<br />
Unruhe <strong>und</strong> Entwertung konkreter Inhalte entgegenzuwirken, sich also<br />
neu zu binden.<br />
Aus dieser „tiefe(n) Sehnsucht, den Dingen eine neue Bedeutsamkeit<br />
... zu verleihen", erklärt Simmel „das Suchen nach neuen Stilen, nach Stil<br />
überhaupt" (a.a.O., S. 449). Die Stilisierungen der Lebensweisen sind Ausdruck<br />
einer Selbsterfahrung der Moderne. Zunächst mildern sie den „bis<br />
zum U<strong>mb</strong>rechen zugespitzten" Subjektivismus des modernen Individuums,<br />
weil sie den Lebensäußerungen <strong>und</strong> der Lebensumwelt eine Form von Allgemeinheit<br />
geben (vgl. Simmel 1908b, S. 314). Insbesondere aber sind sie<br />
eine „Verhüllung des Persönlichen" (ebd.), die eine „Schranke <strong>und</strong> Distanzierung"<br />
(Simmel 1900, S. 537) gegen andere <strong>und</strong> anderes errichten.<br />
Der Wert, der einem bestimmten Stil zugeschrieben wird, hängt ab von<br />
der Distanzierung, die er repräsentiert, d.h. nach Simmeis Werttheorie von<br />
den Mühen <strong>und</strong> Opfern, die zur Überwindung des Abstandes nötig wären<br />
(vgl. Simmel 1900, S. 3ff). Simmel löst also das Problem, dem modernen<br />
Leben eine „neue Festigkeit", d.h. Wert <strong>und</strong> Sinn zu ermöglichen, indem er<br />
via seiner Werttheorie an Nietzsches „Pathos der Distanz" anknüpft (s. hierzu<br />
K. Lichtblau 1984, S. 231 ff) <strong>und</strong> in dem Modus der Stilisierung den Lösungsweg<br />
angibt.<br />
Die Distanzierung macht das Nahe fern <strong>und</strong> bringt das Ferne nah (Simmel<br />
1900, S. 534f), ihr Sinn ist die Annäherung (a.a.O., S. 24); die Intention<br />
geht auf Intensität der Beziehung. Obwohl Simmel selber sieht, daß<br />
sich diese Abzweckung des stilhaften Lebens häufiger negativ als positiv in<br />
der Ausgestaltung der Freiheit äußert, hofft er doch, daß der moderne<br />
Mensch durch eine immer weitergehende Stilisierung, durch die rasche Abfolge<br />
von Stilen, paradigmatisch in der Mode (vgl. Simmel 1911, S. 26ff),<br />
<strong>und</strong> durch die Verfeinerung seiner Unterschiedsempfindlichkeit die ätzende<br />
Vergleichgültigung kompensieren kann. Darin liegt sicherlich eine klassenspezifische<br />
Auffassung, die das „Ideal der Vornehmheit" <strong>und</strong> Distanziertheit<br />
für die gebildeten Schichten gegenüber den stillosen Massen der<br />
Arbeiter reklamiert (s. S. Hübner-Funk 1984, S. 195; vgl. auch P. Bourdieu<br />
1982). Es ist dabei aber fraglich, ob Simmel den Optimismus teilt, den er<br />
Nietzsche zuschreibt, daß nämlich die modische <strong>und</strong> beschleunigte Abfolge<br />
moderner Lebensstile als eine Entwicklung zu deuten ist, die „in dem Überw<strong>und</strong>enwerden<br />
jeder Stufe durch eine vollere <strong>und</strong> entfaltetere ... (ihren)<br />
Eigenwert besitzt" (Simmel 1907, S. 5). Die Alternative wäre in Schopenhauers<br />
Diktum zu sehen, daß das moderne Leben nur ein „Pendel zwischen<br />
Schmerz <strong>und</strong> Langeweile" ist <strong>und</strong> die angestrebte Stilisierung des Lebens<br />
nur ein Quietiv gegen seine Gleichgültigkeit <strong>und</strong> Leere.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Eine weitere Lösungsmöglichkeit ist Kultivierung. Die Kultur aber folgt<br />
nach Simmel einem bestimmten Entwicklungsmuster, das den modernen<br />
Lebensstilen vorgegeben ist. Aus der naturgegebenen Energie der Seele entspringt<br />
ein doppelgleisiger Kulturprozeß: einmal als Produktion kultureller<br />
Objekte, zum anderen als Aneignung dieser objektiven Kultur durch den<br />
subjektiven Geist, als subjektive Kultur (vgl. Simmel 1900, S. 502ff <strong>und</strong><br />
Simmel 1911, S. 183ff). Weil der moderne Kulturprozeß nicht ohne Arbeitsteilung<br />
funktioniert, scheren Tempo, Umfang <strong>und</strong> Eigensinn der objektiven<br />
<strong>und</strong> subjektiven Kultur immer mehr auseinander, es kommt zur<br />
selbstverursachten „Tragödie der Kultur".<br />
Darauf reagiert der moderne Lebensstil u.a. mit Ästhetisierung. Auf<br />
die nicht bedeutungslose, aber „im tiefsten Gr<strong>und</strong>e auch nicht bedeutungsvoll^)"<br />
moderne Kulturwelt reagiert die (inhaltliche) Orientierung am<br />
Künstler. Die Faszination des Künstlerlebens, der Geniekult, die romantische<br />
Suche nach dem authentischen Selbst, alles das sind Facetten einer<br />
Ästhetisierung der Lebensstile, die sich letztlich am expressionistischen Bildungsideal<br />
orientieren. In dieser Linie Hegt auch Simmeis Versuch, durch<br />
ein „individuelles Gesetz" ein authentisches Leben zurückzugewinnen. Eine<br />
andere (mehr formal) angelegte Reaktionsweise ist die mehr oder weniger<br />
vollständige „Ästhetisierung der Lebensgestaltung" (Tenbruck 1958,<br />
S. 590). Die Leistung einer ästhetischen Lebenshaltung liegt nach Simmel<br />
darin, daß sie durch Interesselosigkeit an der inhaltlichen Vielfalt <strong>und</strong> gegenüber<br />
der realen Existenz der Kulturobjekte Distanz wahrt, die aber eben<br />
dadurch selektive Bezugnahmen ermöglicht <strong>und</strong> sich ggf. durch den Genuß<br />
der bloßen Form befriedigt (vgl. Simmel 1900, S. 22ff u. <strong>35</strong>2f; s. a. Hübner-<br />
Funk 1984).<br />
Diese Ästhetisierung kann sich in Blasiertheit <strong>und</strong> Reserviertheit äußern<br />
(vglt Simmel 1900, S. 264ff <strong>und</strong> Simmel 1957, S. 252f). Simmel vergleicht<br />
einen solchen ästhetischen Lebenstypus mit dem des Geizhalses, der Befriedigung<br />
aus der „vollbesessenen Potentialität, die niemals an ihre Aktualisierung<br />
denkt" (ebd.) gewinnt. Es ist die Möglichkeit sich zu kultivieren, die<br />
die ästhetische Freude aufkommen läßt, mithin ist der Lebensstil geprägt<br />
von den Mitteln, die das versprechen. Simmel schätzte die Kultur der Dinge,<br />
insbesondere das stilisierende Kunsthandwerk (vgl. Simmel 1908b), sehr<br />
hoch ein, sie sind ihm „notwendige Vorbedingung für ästhetische Genußfähigkeit"<br />
(Hübner-Funk 1984, S. 190). Aber er sieht auch die Gefahr, daß<br />
die ehrerbietige „Tragödie der Kultur" in die Kommödie von, wie wir heute<br />
sagen können, „Schöner Wohnen" abgleitet. Er läßt offen, ob die Ästhetisierung<br />
des Lebensstiles diese Tragödie kompensieren kann. Er zögert, die<br />
Seele noch „Herr im eigenen (kulturellen) Haus" (Simmel 1900, S. 529) zu<br />
nennen.<br />
Die Seele besitzt für Simmel keine substantielle Einheit (Simmel 1900,<br />
S. 84); sie ist nur durch sy<strong>mb</strong>olische Deutung zugänglich. Sie steht aber<br />
für die hartnäckige Sehnsucht nach Einheit <strong>und</strong> Versprechen auf Lebenssinn<br />
ein (a.a.O., S. 527ff <strong>und</strong> Simmel 1911, S. 184). Die kulturelle Über-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Produktion <strong>und</strong> die „laute ... Pracht des naturwissenschaftlich-technischen<br />
Zeitalters" betäuben nach Simmel diese Sehnsucht, aber sie machen<br />
sie nicht wirkungsloser.<br />
In den Gestaltungen der Lebensstile schlägt sich dies in der typischen<br />
Nervosität des modernen Menschen nieder. Seine „Hast <strong>und</strong> Aufgeregtheit"<br />
zeigt den „Mangel an Definitivem im Zentrum der Seele" an <strong>und</strong> treibt „dazu,<br />
in immer neuen Anregungen, Sensationen, äußeren Aktivitäten eine<br />
momentane Befriedigung zu suchen" (Simmel 1900, S. 551). Der Kult des<br />
Gegenwärtigen, des nur flüchtig Präsenten (s. hierzu D.P. Frisby 1984) ist<br />
hiervon ebenso Ausdruck wie die Großstadt der Ort ist, an dem diese „Steigerung<br />
des Nervenlebens" (Simmel 1957, S. 228) sich ausleben kann, wo<br />
Rhythmus <strong>und</strong> Tempo der modernen Lebensstile fluktuieren (Simmel<br />
1900, S. 552ff). Geradezu als eine Definition der Moderne bestimmt Simmel<br />
den „Psychologismus, das Erleben <strong>und</strong> Deuten der Welt gemäß den Reaktionen<br />
unseres Inneren <strong>und</strong> eigentlich als Innenwelt" (Simmel 1911,<br />
S. 152). Die moderne Auflösung der Einheitlichkeit <strong>und</strong> Substanzialität<br />
der äußeren wie der inneren Welt ist aber ohne eine „psychologische Distanzierung<br />
einfach unerträglich"; der moderne, sensible <strong>und</strong> nervöse Großstadtmensch<br />
würde schier verzweifeln, wenn nicht der äußeren Distanzierung<br />
auch eine Distanz nach innen entsprechen würde. Auch hier hat Simmel<br />
eine doppelte Interpretation: Einmal deutet er sie als einen Läuterungsprozeß,<br />
der auf einen Punkt „produktiver Indifferenz" zielt, an dem spontan<br />
Kreativität freigesetzt wird (s. hierzu Böhringer 1984). Zum anderen<br />
empfiehlt Simmel den Nicht-Künstlern in der Moderne, — in einer sehr bemerkenswerten<br />
Tagebuchnotiz — es mit Oberflächlichkeit zu versuchen<br />
(s. Simmel 1923, S. 15). — Nach dieser gerafften Skizze bleibt es für Simmel<br />
offen, ob durch die spezifisch modernen Stilisierungen des Lebens eine<br />
„neue Festigkeit" etabliert werden kann. Daß die Begrüßung der Moderne<br />
nur zögernd ausfiel <strong>und</strong> eine Verdammung nicht zu haben war, sollte die<br />
Aussagekraft der Analyse von Lebensstilen für eine Diagnose der Moderne<br />
nicht schmälern.<br />
ANMERKUNGEN<br />
1 Simmel ist wohl der erste, der den kunsttheoretischen Stil-Begriff zum kulturphilosophischen<br />
Lebensstil-Begriff abwandelt. H. Lüdtke 1984 hat den kuriosen Umweg<br />
beschrieben, durch den, via einer Übersetzung von Webers Begriff der „Lebensführung"<br />
als „style of life", der Begriff fälschlich als weberianischer in die dt. Soziologie<br />
(<strong>und</strong> das Hist. Wörterbuch der Philosophie) rückübersetzt wurde.<br />
2 Anders als im Vortrag muß ich dieses formale Schema hier unerläutert lassen.<br />
Es läßt sich auch an der mehr inhaltlich orientierten Studie von D.P. Frisby 1984<br />
verdeutlichen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
LITERATUR<br />
T.W. Adorno 1974, „Henkel, Krug <strong>und</strong> frühe Erfahrung", in: ders., Ges. Sehr. Bd. 11,<br />
Ffm.<br />
H. Böhringer 1984, „Die 'Philosophie des Geldes' als ästhetische Theorie. Stichworte<br />
zur Aktualität Georg Simmeis für die moderne bildende Kunst", in: Dahme/Rammstedt<br />
1984.<br />
P. Bourdieu 1982, Die feinen Unterschiede, Ffm.<br />
Dahme/Rammstedt 1984, (Hrsg.), Georg Simmel <strong>und</strong> die Moderne. Neue Interpretationen<br />
<strong>und</strong> Materialien, Ffm.<br />
D.P. Frisby 1984, „Georg Simmeis Theorie der Moderne", in Dahme/Rammstedt 1984.<br />
S. Hübner-Funk 1984, „Die ästhetische Konstituierung <strong>gesellschaftliche</strong>r Erkenntnis am<br />
Beispiel der 'Philosophie des Geldes'", in: Dahme/Rammstedt 1984.<br />
K. Lichtblau 1984, „Das 'Pathos der Distanz'. Präliminarien zur Nietzsche-Rezeption bei<br />
Georg Simmel", in: Dahme/Rammstedt 1984.<br />
H. Lüdtke 1984, Methodische <strong>und</strong> theoretische Probleme bei der Untersuchung von Lebensstilen,<br />
paper auf den 22. dt. Soziologentag, Dortm<strong>und</strong> (MS).<br />
N. Luhmann 1981, Gesellschaftsstruktur <strong>und</strong> Semantik, 2. Bd., Ffm.<br />
G. Simmel 1893, Einleitung in die Moralwissenschaft. Eine Kritik der ethischen Gr<strong>und</strong>begriffe,<br />
2 Bde. Berlin.<br />
ders. 1900, Philosophie des Geldes, 7. Aufl., Berlin 1977.<br />
ders. 1907, Schopenhauer <strong>und</strong> Nietzsche. Ein Vortragszyklus, Leipzig.<br />
ders. 1908a, „Exkurs über das Problem: Wie ist die Gesellschaft möglich?" in: ders.<br />
1983, Schriften zur Soziologie. Eine Auswahl. Hrg. v. Dahme/Rammstedt, Ffm.<br />
ders. 1908b, „Das Problem des Stiles", in: Die Kunst, Dekorative Kunst, 11. Jg., 7,<br />
S. 307-316.<br />
ders. 1911, Philosophische Kultur. Neuauflage mit einem Nachwort von J. Habermas,<br />
Berlin 1983.<br />
ders. 1923, Fragmente <strong>und</strong> Aufsätze aus dem Nachlaß <strong>und</strong> Veröffentlichungen der letzten<br />
Jahre. Hrg. v. G. Kantorowicz, <strong>München</strong>.<br />
ders. 195 7, Brücke <strong>und</strong> Tür, Essays des Philosophen zur Geschichte, Religion, Kunst <strong>und</strong><br />
Gesellschaft, hrg. v. M. Landmann, Stuttgart.<br />
ders. 1968, Das individuelle Gesetz. Philosophische Exkurse. Hrg. v. M. Landmann, Ffm.<br />
F. Tenbruck 1958, „Georg Simmel", in: KZfS., 10, S. 587-614.<br />
M. Weber 1976, Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft, Studienausgabe, Tübingen.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Wissen - Orientierung - Handlung*<br />
SUBJEKTIVES ERLEBNIS UND DAS INSTITUT DER KONVERSION<br />
Walter M.<br />
Sprondel<br />
Man kann heute häufig beobachten, daß zur Kennzeichnung von Ereignissen,<br />
Handlungsverläufen oder sozialen Gebilden Ausdrücke an Beliebtheit<br />
gewinnen, die der Sprache der „Religion" entstammen. Dies geschieht sowohl<br />
im vorwissenschaftlichen Sprachgebrauch als auch in den Sozialwissenschaften.<br />
Die Motive dazu sind natürlich ganz unterschiedlich. Eine solche<br />
Verwendung von Religionsausdrücken kann in der Absicht geschehen,<br />
dem Bezeichneten eine besondere, höhere Bedeutung beizumessen, es aus<br />
dem Bereich des lediglich Profanen herauszuheben, so etwa, wenn eine<br />
bloße Meinung ein Bekenntnis genannt wird. Dahinter kann aber ebenso<br />
die Absicht stehen, das Bezeichnete dadurch verächtlich zu machen, daß es<br />
— mit religiösen Begriffen charakterisiert — aus dem Bereich der modernen<br />
„rationalen Welt" ausgeschieden <strong>und</strong> in die letzten Schlupfwinkel der Irrationalität<br />
verbannt wird.<br />
Ich verweise auf diesen allseits bekannten Sachverhalt, um auf ein Problem<br />
der empirischen religionssoziologischen Forschung aufmerksam zu<br />
machen. Auf der a<strong>mb</strong>ivalenten Haltung zum Vorgang der Säkularisierung<br />
beruhen die Irritationen bei der Verwendung von Begriffen, die ihren Sinngehalt<br />
aus einer Weltdeutung <strong>und</strong> aus einem ihr entsprechenden Bewußtsein<br />
bezogen, das so nicht länger als universell geltend anzunehmen ist. Kurz gesagt:<br />
entweder hat die Religion zusammen mit ihren historischen Gestalten<br />
Von der Veranstaltung, die von der Sektion Sprach<strong>soziologie</strong> im Rahmen dieses<br />
Themenbereichs organisiert wurde, können nur die beiden folgenden Beiträge von<br />
Sprondel <strong>und</strong> Fischer abgedruckt werden. Hans-Georg Soeffner war bedauerlicherweise<br />
daran verhindert, den Text seines Vortrages, der ursprünglich an dieser Stelle<br />
gleichfalls erscheinen sollte, rechtzeitig fertigzustellen. Er wird nun unter dem Titel:<br />
„E<strong>mb</strong>lematische <strong>und</strong> sy<strong>mb</strong>olische Formen der Orientierung" im Sammelband<br />
Sozialstruktur <strong>und</strong> soziale Typik im Campus Verlag 1985 veröffentlicht werden.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
im Prozeß der Modernisierung an Bedeutung eingebüßt <strong>und</strong> überlebt nur<br />
noch als vormoderner Restbestand. Dann wird die Religions<strong>soziologie</strong> zu<br />
einer historischen Disziplin <strong>und</strong> beschäftigt sich — soweit sie Gegenwartswissenschaft<br />
ist — mit peripheren Phänomenen 1 . Oder die Religion hat mit<br />
<strong>und</strong> nach der Säkularisierung neue Gestalt angenommen. Dann ist die theoretische<br />
Frage nach dem Begriff der Religion aufgeworfen — ebenso wie die<br />
empirische, wo sie zu finden ist <strong>und</strong> in welcher Gestalt sie beobachtbar<br />
wird.<br />
Wir haben es hier ganz offenbar mit einer Forschungssituation zu tun,<br />
die sich von der der religionssoziologischen Klassiker deutlich unterscheidet.<br />
Max Weber etwa konnte sich auf die im engeren Sinne soziologisch interessanten<br />
Fragen deshalb relativ umstandslos konzentrieren, weil er von<br />
einem plausiblen Vorverständnis von Religion ausging <strong>und</strong> ausgehen konnte:<br />
den bekannten Weltreligionen. Also galt es, deren „Welterrichtungs- <strong>und</strong><br />
Welterhaltungsleistungen" (Peter L. Berger) zu analysieren, diese in den je<br />
gegebenen Rahmen sozialer Differenzierung einzustellen, um so die Konsequenzen<br />
für das Handeln zu ermitteln. Die historisch bestimmten Gestalten<br />
des Religiösen beherrschen zweifellos nicht mehr in gleichem Maße die<br />
Weltdeutung der Bewohner moderner Gesellschaften. Längst ist klar, daß<br />
wir mit Synkretismus, Privatisierung, Konkurrenz <strong>und</strong> Variabilität der Weltdeutungen<br />
zu rechnen haben. Danach ist die Unbestimmtheit <strong>und</strong> Unsichtbarkeit<br />
der Religion eines ihrer wichtigsten faßbaren Charakteristika.<br />
Die theoretische Religions<strong>soziologie</strong> hat auf diese Lage mit dem Versuch<br />
reagiert, einen Religionsbegriff zu begründen, der sich von den spezifischen<br />
Fassungen der Hochreligionen löst, diese vielmehr als soziale Realisierungsformen<br />
von Religion begreifen läßt. Die dabei unumgängliche Abstraktheit<br />
der Begriffe hat freilich zu zwei gleichermaßen unbefriedigenden<br />
Konsequenzen geführt. Sie hat einerseits zweifellos die empirische Forschung<br />
gelähmt: Wenn man nicht mehr weiß, wo hinzuschauen ist, dann<br />
bewegt man sich bei begrifflichen Verfeinerungen <strong>und</strong> theoretischen Synopsen<br />
auf sicherem Gelände. Sie hat aber auch andererseits zu einer gewissen<br />
Inflationierung des religionssoziologischen Vokabulars geführt, so<br />
daß nicht selten zweifelhaft bleibt, ob auf diese Weise überhaupt ein Gewinn<br />
— <strong>und</strong> gegebenenfalls welcher — damit zu erzielen ist.<br />
Was ist in einer solchen Lage zu tun? Ich möchte auf diese Frage keine<br />
im strengen Sinne theoretische Antwort versuchen. Vielmehr möchte ich<br />
Vorschläge aufgreifen, die bereits mehr oder weniger erfolgreich gemacht<br />
worden sind, <strong>und</strong> diese Überlegungen am Beispiel von „Konversionen"<br />
durchspielen.<br />
Es scheint mir nämlich angesichts der geschilderten Lage unausweichlich,<br />
forschungspragmatisch motivierte Entscheidungen zu treffen über religionssoziologisch<br />
interessante Gegenstände <strong>und</strong> dabei das Risiko des Irrtums<br />
oder Fehlversuchs auf sich zu nehmen. Natürlich ist damit nicht das<br />
Stochern mit langer Stange im Nebel gemeint; immerhin liegt eine erhebliche<br />
Literatur vor, auf die sich das notwendige Vorverständnis ausreichend<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
stützen kann. Interessante Untersuchungen sind auch dadurch gelungen,<br />
daß die im vorwissenschaftlichen Sprachgebrauch häufige Bezeichung von<br />
Ereignissen im Religionsvokabular zu Forschungshypothesen umgeformt<br />
wurde. So sind Beichten, Kreuzzüge, Missionen, Priester, Propheten, Klöster<br />
<strong>und</strong> Sekten untersucht worden. Über den Erfolg solcher Unternehmen wird<br />
letztlich entscheiden, ob <strong>und</strong> wie es gelingt, solche Terme begrifflich befriedigend<br />
zu klären <strong>und</strong> durch ihre Verwendung bei der empirischen Analyse<br />
von Sachverhalten einen spezifischen Erkenntnisgewinn zu erzielen.<br />
Einen solchen Versuch möchte ich im Folgenden mit dem Vorgang der<br />
Konversion unternehmen. Die Absicht ist, damit einen spezifischen, von<br />
anderen unterscheidbaren Typus des Zugangs zu bestimmten Vergemeinschaftungen<br />
zu gewinnen, der diesen auch dann als sinnadäquat zugerechnet<br />
werden kann, wenn sie nicht zu den bekannten Typen religiöser Gemeinschaften<br />
i.e.S. (Kirche, Sekte etc.) zugehören, also eher Weltanschauungsgruppen<br />
im landläufigen Sinne darstellen.<br />
Unter den modernen Bedingungen von Glaubensspaltungen, religiöser<br />
Konkurrenz <strong>und</strong> der Ausbildung spezialisierter Rollen <strong>und</strong> Organisationen<br />
sind Vorkehrungen zur Abwehr von Konversionen aus dem eigenen Lager<br />
ebenso verbreitet, wie solche zur Herbeiführung von Konversionen aus den<br />
anderen Lagern. In jüngster Zeit hat das sozialwissenschaftliche Interesse<br />
an solchen Vorgängen bei der Beschäftigung mit den „Neuen religiösen<br />
Bewegungen" erheblich zugenommen <strong>und</strong> eine beträchtliche Literatur hervorgebracht.<br />
Das Folgende beutet diese in vielfältiger Weise aus. 2<br />
Ich werde mich dabei auf den Vorgang selbst konzentrieren, insbesondere<br />
als einen Mechanismus zur Steuerung <strong>und</strong> Regulierung von Interaktionen.<br />
Infolgedessen werde ich die in der empirischen Literatur vorherrschende<br />
<strong>und</strong> wichtige Ejage ganz ausklammern, warum ein Individuum konvertiert.<br />
Es ist nicht die Rede von Personen, Persönlichkeitstypen, auch nicht<br />
von Lebenssituationen, auf die Menschen manchmal, häuf ig.oder typischerweise<br />
mit Konversionen reagieren. Insofern alle diese Momente für das Auslösen<br />
der hier untersuchten Vorgänge bedeutsam sind, setze ich sie schlicht<br />
voraus.<br />
Es ist vielleicht zweckmäßig, mit einer Art definitorischer Bestimmung<br />
zu beginnen, um dann in erläuternden Anmerkungen die Implikationen<br />
herauszuarbeiten.<br />
1. Wissenssoziologisch gesehen, beziehen sich Konversionen (zunächst:<br />
mit Blick auf den Konvertiten) auf radikale Veränderungen der „Struktur"<br />
subjektiver Weltsichten. Sie sind radikal in dem Sinne, daß sie jene Elemente<br />
dieser Weltsicht betreffen, die alle anderen Inhalte in einer (zumeist:<br />
hierarchischen) Struktur der Relevanz ordnen, die also in der Luckmannschen<br />
Theoriesprache das „System of ultimate significance" bilden 3 .<br />
Vollzogene Konversion bedeutet also nicht den theoretisch wie praktisch<br />
kaum vorstellbaren vollständigen Austausch der Inhalte von Realitätsauffassungen,<br />
sondern die Neustrukturierung von alten <strong>und</strong> neuen Inhalten.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Wir wissen, daß auch die schlichte Kenntnisnahme von neuen Inhalten zuweilen<br />
zu U<strong>mb</strong>auten im subjektiven Wissensvorrat führt. Sofern dabei aber<br />
die allgemeinen ordnungsstiftenden Dimensionen unberührt bleiben, wird<br />
man vielleicht von „Lernen", allenfalls von „neuen Erfahrungen", nicht<br />
aber von Konversionen sprechen.<br />
Zur Verdeutlichung: Nahezu alle Berichte von Konvertiten folgen dem<br />
Muster: „Bisher glaubte ich, jetzt endlich weiß ich!" Solche Neustrukturierung<br />
betrifft nicht nur, aber wesentlich die Art der Kausalattribuierung für<br />
Ereignisse im Leben des Konvertiten. Prinzipiell können solche Änderungen<br />
offenbar in zwei entgegengesetzten Richtungen verlaufen: von individualistischen<br />
Zuschreibungen zu kollektivistischen, oder umgekehrt. Im ersten<br />
Fall lautet dann die Formulierung: „Bisher glaubte ich, daß ich selbst immer<br />
alles falsch mache, jetzt weiß ich, daß an meiner Lage die Verhältnisse<br />
schuld sind!" Diese Art der Strukturänderung subjektiver Weltsichten findet<br />
man besonders häufig bei Übertritten zu Gruppen mit weltanschaulich<br />
begründeter politischer Zielsetzung. Die umgekehrte Version, also die Auffassung,<br />
daß die wie immer gefaßten Lebensprobleme eigener falscher Einsicht<br />
<strong>und</strong> eigenem Fehlverhalten zuzuschreiben sind, wurde immer wieder<br />
bei den Neulingen der „Neuen religiösen Bewegungen" beschrieben, ebenso<br />
ist sie für Lebensreformer der Jahrh<strong>und</strong>ertwende <strong>und</strong> danach typisch. 4<br />
2. Mit dieser ersten Festlegung hängt aufs engste zusammen, daß Konversionen<br />
die Existenz einer mehr oder weniger ausgearbeiteten Weltanschauungstheorie<br />
voraussetzen, wie auch eine wahrneh<strong>mb</strong>are Vergemeinschaftung,<br />
die Träger dieser Weltsicht ist. Wenn man so will: Religionsstifter<br />
sind keine Konvertiten, <strong>und</strong> zu den idiosynkratischen Ansichten eines einsamen<br />
Eremiten konvertiert man nicht. Man muß die Existenz einer solchen<br />
Theorie deshalb voraussetzen, weil es sich bei Konvertiten immer um bereits<br />
mehr oder weniger erfolgreich sozialisierte Subjekte handelt, die — per<br />
Implikation — bereits eine Weltsicht internalisiert haben, die ihrerseits auf<br />
sozialen Interaktionszusammenhängen zu ihrer Plausibilisierung aufruht.<br />
(Auch Kinder konvertieren nicht, sie werden möglicherweise „verführt".)<br />
Infolgedessen ist ein erheblicher Artikulationsaufwand zur Begründung der<br />
Wandlung notwendig, sich selbst, den früheren, nicht zuletzt aber auch den<br />
neuen Glaubensgenossen gegenüber.<br />
3. Es sind also die hier gemeinten Gruppen etwas näher zu kennzeichnen.<br />
Was heißt mit anderen Worten — Weltanschauungsgruppen? Dabei steht an<br />
dieser Stelle nicht so sehr ihre organisatorische Struktur in Rede, die überdies<br />
erheblich variiert, wie eine jüngst erschienene, vergleichende Studie<br />
noch einmal schön demonstriert 5 . Vielmehr geht es mir um den Kern, das<br />
Ziel dieser Gruppen selbst <strong>und</strong> um einige sich daraus ergebende Probleme,<br />
auf die u.a. die spezifische Art des Zugangs zu ihnen in Form von Konversionen<br />
sinnhaft (funktional) bezogen ist.<br />
Hierher gehört natürlich in erster Linie das angestrebte „Heilsziel", also<br />
das, was den Anhängern in Aussicht gestellt wird. Mir scheint in der Tat,<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
daß sich dies allgemein formulieren läßt. Gruppen der hier gemeinten Art,<br />
von den neuen religiösen Bewegungen — seien sie nun östlicher oder sonstiger<br />
Provenienz — über die historische Lebensreform der Jahrh<strong>und</strong>ertwende,<br />
bis zu ihren aktuellen Nachfahren: Sie alle verheißen „Einheit", die Erlösung<br />
aus der Zerrissenheit, die Aufhebung der zersplitterten Lebenswelt, die<br />
Ordnung in der Zersplitterung. Dieser durchgängigen Verheißung entspricht<br />
offenbar das am häufigsten genannte, dauerhafteste Motiv bei den Anhängern<br />
auf das genaueste: Es ist die Suche nach dem einen Sinn, der den Teilen<br />
der äußeren <strong>und</strong> inneren Welt ihren angemessenen Platz in einem „Ganzen"<br />
zuweist. Unterschiede zwischen den Gruppen beziehen sich weitgehend<br />
auf die Mittel, auf die diagnostizierten Ursachen der „Sinnferne" <strong>und</strong><br />
infolgedessen auf ihre Überwindung <strong>und</strong> deren Begründung. Soweit dies<br />
zutrifft, haben wir hier offensichtlich das vor uns, was in der theoretischen<br />
Literatur die „Kosmisierung" (Berger), „heiliger Kosmos" (Luckmann)<br />
oder „conceptions of a general order of existence" (Geertz) genannt wird,<br />
mithin den konstituierenden Kernbestand von Religion.<br />
Freilich: diese Ordnung ist zunächst eine theoretische, verheißene. Ihre<br />
objektive, für jedermann erfahrbare Realisierung ist nur vorstellbar, wenn<br />
genügend viele, tendenziell natürlich alle Menschen den empfohlenen Heilsweg<br />
beschreiten. Nun ist dies ein Ziel, dessen Erreichen höchst unwahrscheinlich<br />
ist, als Erfolgskriterium also zu riskant, wenn nicht gänzlich unbrauchbar.<br />
Dieses Ziel wird daher überall ersetzt durch das „individuelle<br />
Erlebnis" der Ordnung der Welt, insbesondere der Einheit der Person, eine<br />
Verschiebung, die jener ähnelt, welche die puritanischen Sekten aufgr<strong>und</strong><br />
der „unbrauchbaren" harten Prädestinationslehre vornahmen. Auf diese<br />
6<br />
Weise wird die Zerrissenheit der Welt zwar nicht als solche beseitigt, aber<br />
für den, der dieses Erlebnis der Einheit in sich zu erzeugen weiß, verliert<br />
die fortbestehende Zerrissenheit der Welt ihre Schrecken, insofern sie auf<br />
die fehlende Einsicht anderer zurückgeführt werden kann.<br />
Daraus ergibt sich eine Problemlage, auf die die fraglichen Gruppen reagieren<br />
müssen. Erfahrungsgemäß sind nämlich Erfolgsbeweise für die dauerhafte<br />
Legitimation einer Lehre unerläßlich. Angesichts des prinzipiell freiwilligen,<br />
d.h.: selbst zu verantwortenden Beitritts der Mitglieder <strong>und</strong> angesichts<br />
der erheblichen Konkurrenz dieser Gruppen untereinander genügt offenbar<br />
der exemplarische Erfolgsbeweis durch religiöse Virtuosen, etwa des<br />
Kernpersonals, nicht. Unter diesen Bedingungen ist eine stabile Loyalitätssicherung<br />
ein Dauerproblem, das dadurch noch verstärkt wird, daß der Erfolgsbeweis<br />
in das individuelle Erleben der Mitglieder verlegt werden muß,<br />
also in eine höchst unzuverlässige Instanz. Die Beschreibungen hier in Frage<br />
stehender Gruppen bieten zahllose Belege für die lähmende Wirkung einer<br />
Konzeption, in der dem individuellen Erleben der Rang einer nicht hintergehbaren<br />
Instanz zugesprochen wird. Eine solche prekäre Lage läßt sich nur<br />
dann einigermaßen unter Kontrolle bringen, wenn es gelingt, das Erleben<br />
selbst zu objektivieren <strong>und</strong> in entsprechenden Verfahrensabläufen („Riten")<br />
zu institutionalisieren.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Die skizzierte Problematik hat weit darüber hinausreichende Implikationen,<br />
die hier zu entfalten unmöglich ist. Es kommt mir an dieser Stelle<br />
nur darauf an, deutlich zu machen, daß die überall zu beobachtenden Arrangements<br />
zur Kontrolle des individuellen Erlebens nicht unbedingt zynisch<br />
inszenierte Taktik sind, sondern auf schwer hintergehbare Probleme<br />
solcher Gruppen verweisen: an erwartbare, insofern objektivierte Erlebnisse<br />
<strong>und</strong> zugleich an ja nur individuell ratifizierbare Erlebnisse appellieren zu<br />
können.<br />
Erst damit scheint ausreichend argumentativ vorbereitet, worum es hier<br />
geht: die Untersuchung des typischen Arrangements des Zugangs zu Weltanschauungsgruppen<br />
in Form von Konversionen als eines aus strukturellen<br />
Gründen hervorgehenden Kontrollmechanismus individuellen Erlebens.<br />
4. Aus strukturellen Gründen als funktional behauptete Mechanismen müssen<br />
zunächst in ihrem typologisch verdichteten Ablauf analysiert werden.<br />
Dazu finden sich in der einschlägigen Literatur mehrere Konversionsmodelle,<br />
die — da sie an Einzelfällen abgelesen sind — mehr oder weniger voneinander<br />
abweichen. Bei ihrem Vergleich drängt sich der Eindruck auf, daß<br />
es dabei auch nicht so sehr auf ganz bestimmte Ereignisse <strong>und</strong> deren exakte<br />
Reihenfolge ankommt. Daher will ich diese Modelle hier auch gar nicht erst<br />
referieren, so brauchbar sie unter Umständen für bestimmte Zwecke sein<br />
können. Stattdessen will ich sogleich auf das Urmodell der Konversion zu<br />
7<br />
sprechen kommen, mit dessen wesentlichen Aspekten übrigens die modernen<br />
Modelle durchaus übereinstimmen. Dieses Urmodell ist natürlich die<br />
Bekehrung des Saulus zum Paulus; es findet sich im 9. Kapitel der Apostelgeschichte<br />
des NT. Eine wirkliche Analyse der Apostelgeschichte kann hier<br />
natürlich nicht einmal in Umrissen versucht werden, so faszinierend deren<br />
Lektüre bei der Untersuchung typischer Problemlagen eines sich neu etablierenden<br />
Bekenntnisses ist. Ich werde daher nur drei mir wesentlich erscheinende<br />
Aspekte hervorheben, die in diesem Modell auf einzigartige<br />
Weise miteinander verwoben sind.<br />
Ich setze als bekannt voraus, daß Saulus eine Art Kopfjäger auf Christusanhänger<br />
im Dienst des Jerusalemer Tempels war <strong>und</strong> daß in der Geschichte<br />
beschrieben wird, auf welche Weise er zu einem der erfolgreichsten<br />
Prediger für die christliche Gemeinde wurde.<br />
Die drei genannten Aspekte der Geschichte, die hier interessieren, weil<br />
sie in offenbar klassischer Weise die Konversationssituation ausdrücken,<br />
sind diese:<br />
— eine emotionale, ja existentielle Erschütterung, in diesem Fall auf typisch<br />
biblische Weise herbeigeführt durch Lichtblitz, Stimmen, Erblindung;<br />
— die Deutung dieser Erschütterung als direkte Berufung durch Gott selbst<br />
in das Apostelamt durch einen Mittler, der bereits der christlichen Gemeinde<br />
zugehört;<br />
— <strong>und</strong> schließlich die Überwindung des Mißtrauens gegen den Konvertiten<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
in der christlichen Gemeinde, d.h. also die Schaffung einer tragfähigen<br />
Basis für Interaktionen in der Gemeinde, wozu nicht zuletzt auch die<br />
Neubestimmung des Verhältnisses zu seinen ehemaligen Auftraggebern<br />
gehört.<br />
Worauf es mir ankommt, ist dies:<br />
Die außeralltäglich erzeugte Erregung <strong>und</strong> Erschütterung ist der Auslöser,<br />
der Anlaß, der zur inneren Wandlung <strong>und</strong> dem Überdenken des Lebens<br />
— heute würden wir wohl sagen: zur biographischen Rekonstruktion —<br />
„zwingt". Aber erst nachdem sie bereits in Termen der neuen Lehre interpretiert<br />
ist, also unter Kontrolle gebracht ist, „fiel es ihm wie Schuppen von<br />
den Augen" <strong>und</strong> Paulus wird im Wortsinn wieder sehend. Das bedeutet, daß<br />
das bisherige Leben in seiner Kontinuität mit dem neuen Ereignis verknüpft<br />
ist. Die Probleme beginnen für ihn, als er der neuen Lehre entsprechend zu<br />
handeln, in diesem Fall zu predigen beginnt: Die Interaktionsmöglichkeiten<br />
mit den Bewohnern der alten Welt, den jüdischen Funktionären, sind<br />
radikal abgeschnitten, sie trachten ihm nach dem Leben. In der neuen Gemeinde<br />
kann er nicht ohne weiteres Zuflucht finden, sie zweifelt an der<br />
Glaubwürdigkeit <strong>und</strong> Ernsthaftigkeit seiner Wandlung. Wieder ist es ein Vermittler,<br />
der die Brüder überzeugt, <strong>und</strong> zwar unter ausdrücklichem Hinweis<br />
auf die erfahrene Erschütterung durch Blitz <strong>und</strong> Donner. Erst dadurch<br />
findet er einen neuen Verkehrskreis, erst jetzt nimmt er den neuen Namen<br />
Paulus an.<br />
Festzuhalten wäre danach: das durch Interpretation in Termen der<br />
neuen Lehre unter Kontrolle gebrachte <strong>und</strong> insofern sozial wirksam gewordene<br />
„innere Erlebnis" einerseits, <strong>und</strong> die Beendung der Handlungsmöglichkeit<br />
in der alten Welt wie die Eröffnung der Handlungsmöglichkeit in der<br />
neuen Gemeinde eben durch dieses so kontrollierte Erlebnis.<br />
Mir scheinen damit die in soziologischer Perspektive entscheidenden<br />
Merkmale von Konversationsvorgängen bezeichnet. Das Folgende will dies<br />
nur durch einige Bemerkungen in anderer Terminologie ergänzen <strong>und</strong> erläutern.<br />
5. Die Veränderung der Struktur subjektiver Weltsichten ist immer auch<br />
begleitet von der Änderung der sozialen Verkehrskreise, der signifikanten<br />
Anderen, die zur Bestätigung, Festigung <strong>und</strong> Plausibilisierung von Weltsichten<br />
unerläßlich sind. Gerade bei Veränderungen der strukturbildenden Relevanzen<br />
im subjektiven Wissen entsteht eine erhöhte Nachfrage an Glaubwürdigkeit<br />
<strong>und</strong> Ernsthaftigkeit, die ihrerseits nicht einfach darstellbar ist. Die<br />
Interaktionsmöglichkeiten zwischen signifikanten <strong>und</strong> sonstigen Anderen<br />
<strong>und</strong> dem Konvertiten hängen wesentlich davon ab, ob die beanspruchte<br />
Wandlung als ernsthaft, glaubwürdig <strong>und</strong> dauerhaft zu unterstellen ist, oder<br />
als vorübergehende Laune, oder gar — unter bestimmten Umständen — als<br />
eine aus strategischen Gründen, etwa der Ausforschung, nur vorgetäuschte.<br />
Dieses Darstellungsproblem besteht für den Konvertiten in mindestens dreifacher<br />
Hinsicht: Es besteht gegenüber dem eigenen Selbst, es besteht gegen-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
über den früheren signifikanten Anderen <strong>und</strong> es besteht gegenüber den<br />
neuen signifikanten Anderen.<br />
An dieser Stelle haben nun auch die immer wieder berichteten emotionalen<br />
Erschütterungen bei Konversionen ihren funktionalen Sinn: Durch sie<br />
verliert nämlich die Wandlung den Charakter kalter Berechnung oder freier<br />
Entscheidung, die prinzipiell auch anders hätte ausfallen können. Sie besiegeln<br />
für den Konvertiten den Bruch mit der Vergangenheit als eine unausweichliche<br />
Notwendigkeit. Ein durch „innere Gewalt" erzwungener Abbruch<br />
der Beziehungen ist für die früheren Interaktionspartner ein zwar<br />
nicht immer zu billigender, zumindest aber verständlicher Gr<strong>und</strong> für die<br />
Veränderung. Und für die Mitglieder der neuen Gemeinschaft kann der<br />
8<br />
emotionale Schock als Beweis dafür gelten, daß dem Konvertiten zu trauen<br />
ist, daß sich die notwendigen noch ausstehenden Maßnahmen der Belehrung<br />
<strong>und</strong> Festigung der neuen Weltsicht lohnen.<br />
Das Durchlaufen des Vorgangs der Konversion hat also für den Konvertiten<br />
<strong>und</strong> seine Interaktionspartner vor allem den Sinn, die prekäre Ernsthaftigkeit<br />
<strong>und</strong> Glaubwürdigkeit seines Sinneswandels verläßlich zum Ausdruck<br />
zu bringen. Der Vorgang als solcher bedeutet daher auch nicht die bereits<br />
vollzogene Übernahme der neuen Weltsicht. Insoweit ist die zu Beginn<br />
referierte Festlegung zu modifizieren. Die Konversion ist aber der als verläßlich<br />
geltende Gr<strong>und</strong>, auf dem die Interaktionen errichtet werden können,<br />
die aus einem Konvertiten ein Vollmitglied der neuen Gemeinschaft<br />
werden lassen können.<br />
6. Und schließlich: was soll heißen, daß ein typisierter Vorgang mit angebbaren<br />
Funktionen als institutionalisiert gelten kann?<br />
Bei näherem Hinsehen zeigt sich, daß man es als allgemein verbreitetes<br />
Wissen auffassen muß, daß man zu Weltanschauungsgemeinschaften der beschriebenen<br />
Art einen angemessenen <strong>und</strong> verständlichen Zugang nur auf die<br />
Art der Konversionen finden kann. Dieses Wissen gehört zum allgemeinen<br />
Wissensvorrat auf ähnliche Weise, wie man weiß, was man im Falle von<br />
Krankheiten zu tun hat. Tiefgreifende Veränderungen der operativen Relevanzsysteme<br />
— das weiß man — „erfordern" Konversionen, <strong>und</strong> jedermann<br />
weiß, daß Konversionen tiefgreifende <strong>und</strong> nur schwer reversible Wandlungen<br />
darstellen, <strong>und</strong> schließlich weiß man auch, daß es völlig unangemessen<br />
wäre, weniger bedeutsame Bewußtseinsänderungen als Konversionen zum<br />
Ausdruck zu bringen.<br />
Dieses allgemeine Wissen umfaßt in der Regel nicht die Kenntnis der<br />
Einzelheiten des Vorganges: diese mögen selbst für den Konvertiten zu Beginn<br />
des Prozesses im Dunkeln liegen. Was dieser Vorgang im einzelnen bedeutet,<br />
wissen aber die Lehrer der neuen Weltsicht oder diejenigen alten<br />
Mitglieder der Gemeinschaft, die den Prozeß selbst durchlaufen haben.<br />
Auch diese erwarten vom Neuling einen glaubwürdigen „Beweis" seiner<br />
wirklichen Überzeugung. Er wird erbracht im Durchlaufen eines Prozesses<br />
der genannten Art. Ein wesentlicher Aspekt der Initiation besteht gerade<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
darin, die Zugehörigkeit zur neuen Weltsicht als das Ergebnis einer Konversion<br />
zu interpretieren. In diesem Sinne ist der Zugang zu Weltanschauungsgruppen<br />
als Konversion institutionalisiert. Wie es als selbstverständlich gilt,<br />
einem Sportverein durch schlichtes Ausfüllen eines Formulars <strong>und</strong> Zahlung<br />
einer Gebühr beizutreten, so gilt es als angemessen <strong>und</strong> ist daher auch für<br />
andere verstehbar, zu einer Weltsicht <strong>und</strong> der sie tragenden Gemeinschaft<br />
in Form einer als Konversion erlebten Wandlung Zugang zu finden.<br />
In dieser Perspektive löst sich eine Schwierigkeit jener zahlreichen, in<br />
der Literatur beschriebenen Konversionsmodelle, die diese aus dem Zusammenwirken<br />
verschiedener situativer <strong>und</strong> personaler Faktoren hervorgehen<br />
lassen. Deren empirische Variation erweist sich immer wieder als unüberwindliches<br />
Hindernis bei dem Versuch der Formulierung generalisierter<br />
Faktorenmodelle. Versteht man aber den zuvor geschilderten Ablauf als<br />
typologische Verdichtung, als angemessene Institutionalisierung des Zugangs<br />
zu Weltanschauungsgruppen, wird verständlich, warum die Schilderungen<br />
der Mitglieder dieser Gruppen über ihren Zugang so konstant <strong>und</strong><br />
gleichförmig mit dem Typus der Konversion folgen, gleichviel wie groß die<br />
Variation der sonst ins Spiel kommenden Faktoren sein mag. Man darf sich<br />
hier nicht durch den die Spontaneität betonenden Sprachstil täuschen lassen:<br />
Diese Schilderungen folgen einem institutionalisierten Muster, das sich<br />
typologisch <strong>und</strong> in seiner funktionalen Bedeutung nachzeichnen läßt, auch<br />
dann, wenn die Konvertiten ihre Wandlung als hochindividualisierten, inneren<br />
Vorgang erleben <strong>und</strong> schildern.<br />
Damit breche ich hier diese Skizze ab, um noch einmal auf meinen anfangs<br />
formulierten Vorschlag zurückzukommen, in der empirischen religionssoziologischen<br />
Forschung am Beginn pragmatische Entscheidungen zu treffen.<br />
Die Schlußfolgerung ist nun simpel: Folgt man der theoretischen Religions<strong>soziologie</strong>,<br />
wie ich es hier tue, bezeichnet also die Ordnungsdimension von<br />
Weltsichten (sowohl in ihrer objektivierten Version als auch in ihrer subjektiven<br />
Repräsentanz) als F<strong>und</strong>amentalform der Religion, <strong>und</strong> lassen sich<br />
Konversionen als typische Zugangsformen zu Gemeinschaften nachweisen,<br />
hat man Religionsphänomene vor sich. Zugegeben: damit fängt die Sache<br />
dann erst richtig an. Aber sie fängt mit ausgewiesenen Gründen an, <strong>und</strong> das<br />
ist mehr, als heute in der Forschung gang <strong>und</strong> gäbe ist.<br />
ANMERKUNGEN<br />
1 Peter Berger and Thomas Luckmann: „Sociology of Religion and Sociology of<br />
Knowledge.", Sociology and Social Research 47 (1963), p. 417-427.<br />
2 Vgl. etwa James T. Richardson (Ed.): „Conversion and Commitment in Contemporary<br />
Religion." American Behavioral Scientist 20 (1977), Special Issue No. 6; Max<br />
Heirich: „Change of Heart. A Test of some widely held Theories about Religious<br />
Conversion", Amer. Journ. Sociol. 83 (1977), pp. 653-677; David A. Snow and<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Richard Machalek: „The Convert as a Social Type", in: Randall Collins (Ed.):<br />
Sociological Theory, 1983. San Francisco (Jossey-Bass) 1983, pp. 259-289.<br />
3 Thomas Luckmann: The Invisible Religion. The Problem of Religion in Modern<br />
Society. New York (MacMillan) 1967.<br />
4 Vgl. die ausführlichen Interviewzitate bei Snow <strong>und</strong> Machalek, op. cit. Die Zeitschriften<br />
der verschiedenen Gruppen der deutschen Lebensreform, sind voll von derartigen<br />
Schilderungen.<br />
5 Kenneth Jones: Ideological Groups. Similarities of Structure and Organization.<br />
Aldershot (Gower) 1984.<br />
6 Max Weber: „Die protestantische Ethik <strong>und</strong> der Geist des Kapitalismus", in: Gesammelte<br />
Aufsätze zur Religions<strong>soziologie</strong>, Bd. 1. Tübingen (J.C.B. Mohr) 1920.<br />
7 Vgl. die in Anm. 2 angeführte Literatur.<br />
8 Dem entspricht, daß die in den sog. Anti-Cult-Movements aktiv werdenden Eltern<br />
von jugendlichen Konvertiten gerade diese innere Gewalt bestreiten <strong>und</strong> die Anwendung<br />
von „äußerer Gewalt" durch die neuen Sekten bei ihrer Mitgliederrekrutierung<br />
behaupten. Vgl. dazu Bert Hardin <strong>und</strong> Günther Kehrer: „Some Social Factors<br />
Affecting the Rejection of New Belief Systems", in: Eileen Barker (Ed.): New Religious<br />
Movements. A Perspective for Understanding Society. New York (Mellen)<br />
1982.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
SOZIALE UND BIOGRAPHISCHE KONSTITUTION CHRONISCHER<br />
KRANKHEIT<br />
Wolfram<br />
Fischer<br />
I. Sozio-biographische Erweiterung des „relationalen Krankheitsmodells" 1<br />
Die Rekonstruktion einiger sozialer <strong>und</strong> biographischer Konstitutionselemente<br />
chronischer Krankheiten, die ich hier in diesem Beitrag anziele, geht<br />
von Voraussetzungen aus, die mittlerweile Allgemeingut medizin-soziologischer<br />
<strong>und</strong> sozial-epidemiologischer Forschung sind, die sich andererseits<br />
weder ges<strong>und</strong>heitspolitisch noch (schul-)medizinisch auch nur annähernd<br />
durchgesetzt haben. Es geht allgemein darum, daß eine rein somatische Auffassung<br />
von Krankheit mit der ihr entsprechenden naturwissenschaftlichen<br />
biomedizinischen Pathologie <strong>und</strong> Heilkunst zu kurz faßt. Auf den drei<br />
Ebenen der Ges<strong>und</strong>erhaltung, der Krankheits<strong>entwicklung</strong> <strong>und</strong> der Krankheitsbewältigung<br />
spielen soziale <strong>und</strong> psychische Faktoren eine erhebliche<br />
Rolle. Nicht nur für die Prävention oder die Rehabilitation — letztere<br />
nimmt per definitionem innerhalb chronischer Krankheiten einen großen<br />
Raum ein — haben soziale Bedingungen eine große Bedeutung, sondern<br />
auch als Elemente der Krankheitsentstehung. Soziogenetische Erklärungen<br />
erweitern oder bestreiten medizinisch-pathogenetische Modelle, zu mikrobiologischen<br />
„Stressoren" treten quasi gleichberechtigt soziale Stressoren. 2<br />
Die ziemlich umfangreichen empirischen Untersuchungen der sozial-epidemiologischen<br />
Forschung haben unabweisbare Belege geliefert, die hier nicht<br />
zu präsentieren sind oder wiederholt zu werden brauchen.<br />
In einem „relationalen Krankheitsmodell" versuchte der Medizinhistoriker<br />
Karl Rothschuh eine Krankheitsdefinition zu entwickeln, die diesen<br />
Gegebenheiten Rechnung trägt. Das Modell erscheint mir als Orientierungshintergr<strong>und</strong><br />
für die eigenen spezielleren Überlegungen nützlich, weswegen<br />
ich es kurz skizziere. Rothschuh konstruiert ein Interaktions-Dreieck aus<br />
den Größen „Patient" — „Arzt" — „Gesellschaß", in dessen Mitte „Krankheit"<br />
steht.<br />
Patient<br />
Versorgungsorganisationen<br />
Gesellschaft<br />
Uni-Medizin<br />
Arzt<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Wichtig ist dabei, daß Krankheit ein perspektivischer Begriff bleibt, sie ist<br />
also etwas anderes für den Patienten als für den Arzt <strong>und</strong> wiederum verschieden<br />
aus <strong>gesellschaftliche</strong>m Blickwinkel. Der Patient erleidet Einschränkungen<br />
seines Wohlbefindens <strong>und</strong> seiner üblichen Handlungskapazität. Was<br />
dabei letzlich in seiner „Laiendefinition" als Krankheit angesehen wird, unterliegt<br />
einem gewissen Interpretationsspielraum, der noch im Vor-Patienten-Stadium<br />
in gemeinsamen alltagsweltlichen prä-diagnostischen Bemühungen<br />
unter Familienmitgliedern, Bekannten oder Arbeitskollegen durchschritten<br />
wird. Wird in einem solchen Feststellungsprozeß „Krankheit" als<br />
Ursache der erfahrenen Einschränkungen angenommen, geht in modernen<br />
Gesellschaften die weitere diagnostische <strong>und</strong> therapeutische Legitimität an<br />
den Arzt. Aus dessen Perspektive ist Krankheit Resultat somatischer Fehlfunktionen,<br />
nach bio-physischen Merkmalen diagnostizierbar <strong>und</strong> je nachdem<br />
durch therapeutische Interventionen kontrollier- oder heilbar. Es ist<br />
wichtig, sich klarzumachen, daß in den zivilisierten Gesellschaften, die ein<br />
medizinisches Handlungs- <strong>und</strong> Wissenssystem professionell ausgebildet haben,<br />
die primäre Definitionslegitimität über Krankheit beim Arzt, bzw. in<br />
den zwischen Arzt <strong>und</strong> Patient stehenden Institutionen der Krankenpflege<br />
(z.B. Krankenhaus, medizinische Praxis) liegt. Die Gesellschaft — besser <strong>gesellschaftliche</strong><br />
Organisationen — haben hier dem Arzt ein weitreichendes<br />
Mandat zugebilligt, um das der „subjektiv-vermeintliche" Kranke nicht<br />
herumkommt, wenn er öffentlich als Kranker anerkannt werden will <strong>und</strong><br />
bestimmte Privilegien (wie etwa Arbeitsbefreiung, Berentung oder Leistungen<br />
aus Organisationen der Krankenversorgung) in Anspruch nehmen will.<br />
Schließlich hat jede Gesellschaft spezifische Vorstellungen davon entwikkelt,<br />
welche sozialen Fehlleistungen mit dem Begriff Krankheit belegt werden<br />
können, die durchaus nicht mit der Krankheitsdefinition des Patienten<br />
oder des Arztes übereinstimmen müssen. Daß z.B. Alkoholismus oder bestimmte<br />
psychische Probleme als Krankheiten eingestuft <strong>und</strong> angegangen<br />
werden können, hat sich in verschiedenen <strong>gesellschaftliche</strong>n Bereichen<br />
unterschiedlich schnell bzw. langsam durchgesetzt.<br />
Diese wenigen Bemerkungen sollen genügen, um das relationale Krankheitsmodell<br />
vorzustellen. Es ist komplexer als ein rein somatisches Modell<br />
<strong>und</strong> wird somit der Sache gerechter. Andererseits läßt es viele Wünsche bei<br />
der Suche nach differenzierten Beschreibungskategorien offen. Der Eck-<br />
Begriff „Gesellschaft" ist zu diffus <strong>und</strong> muß jeweils gefüllt werden. Das<br />
Definiendum „Krankheit" wirkt so zu statisch, eine Auffächerung in ein<br />
Schichtenmodell mit „Ges<strong>und</strong>erhaltung", „Krankheits<strong>entwicklung</strong>" <strong>und</strong><br />
„Krankheitsbewältigung" als zu definierenden Zentralbegriffen würde dem<br />
Prozeßcharakter des Krankengeschehens gerechter <strong>und</strong> zu Variationen in<br />
den Eck-Begriffen führen. Dies soll hier nicht durchexerziert werden.<br />
Die Erweiterungen des Modells in den folgenden Ausführungen beinhalten<br />
soziale <strong>und</strong> biographische Faktoren chronischer Krankheiten, stellen<br />
also Ausdifferenzierungen der Patienten- <strong>und</strong> Gesellschaftsperspektive dar.<br />
Wie sich sogleich zeigen wird, kennzeichnen „sozial" <strong>und</strong> „biographisch"<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
keine scharf getrennten Merkmalsklassen, so als gäbe es Biographisches unabhängig<br />
von Sozialem. Etwas treffender wäre von „sozio-biographischen"<br />
Faktoren zu sprechen, wenn damit nicht ein neues Sozio-Kompositum geschaffen<br />
würde, deren wir allemal zuviel haben (die Biologie mit dem Soziostempel<br />
ist der gräßlichste Sproß dieser imperialistischen Heiratspolitik).<br />
Unter „chronischen Krankheiten" verstehe ich Krankheiten, „die entweder<br />
Ergebnis eines länger andauernden Prozesses degenerativer Veränderung<br />
somatischer oder psychischer Zustände sind oder die dauernde somatische<br />
oder psychische Schäden oder Behinderungen zur Folge haben"<br />
(Badura). 3<br />
II. Chronische Krankheit: Verletzung der sozialen Leiblichkeit <strong>und</strong> Re-<br />
Normalisierungsverfahren<br />
Jede Krankheit — ganz gleich, ob akut oder chronisch — beeinträchtigt in<br />
jeweils spezifischer Weise die Handlungskapazität des Kranken <strong>und</strong> reduziert<br />
somit auch seine Interaktionskapazität, m.a.W. der Kranke <strong>und</strong> seine<br />
soziale Umwelt sind von der Krankheit betroffen. Ich bezeichne diesen<br />
Verlust an Normalität, den beide Seiten in unterschiedlicher Weise zunächst<br />
erfahren, als Verletzung der sozialen Leiblichkeit. Dieser Begriff zielt also<br />
auf den Kranken, faßt aber nicht dessen individuelle Körperlichkeit, sondern<br />
seine Leiblichkeit als eine irreduzible soziale Größe. Die Verletzung<br />
der sozialen Leiblichkeit impliziert mehr als nur den vordergründigen Verlust<br />
einzelner Handlungspotentiale, sondern sie erstreckt sich auf die ganze<br />
„ Welt der natürlichen Einstellung"*, die „Alltagswelt" mit ihren stillschweigenden<br />
Normalitätsannahmen, bzw. „Idealisierungen". Die Unterbrechung<br />
alltäglicher Routinen führt zu deren Thematisierung in der Form von Problemartikulationen,<br />
das gesamte bislang implizite Lebenskonzept wird als<br />
Biographie thematisch. Daß die Verletzung der sozialen Leiblichkeit eine<br />
Bedrohung der Alltagswelt impliziert, wird u.a. deutlich, wenn relativ<br />
harmlose Akuterkrankungen bereits bei den Kranken Krisenphänomene<br />
hervorrufen.<br />
Es sind vor allem die Verletzungen von drei alltagsweltlichen Idealisierungstypen,<br />
die mir wichtig erscheinen. s<br />
1. Die Verletzung der Kooperationsidealisierung. Als eigentliche soziale<br />
Idealisierung umfaßt sie die Erwartung von verläßlicher Partizipation in<br />
Interaktionssituationen. Aufgr<strong>und</strong> der eingeschränkten Interaktionskapazität<br />
zerbricht diese Idealisierung. Dies äußert sich auch in Interaktions- <strong>und</strong><br />
Kommunikationsstörungen, die nicht einfach durch spezifische körperliche<br />
Funktionsverluste der jeweiligen Krankheit zu erklären sind.<br />
2. Die Verletzung der Idealisierung körperlicher Autonomie. Hier ist die<br />
Vorstellung durchbrochen, daß mein eigener Körper alleine aus sich selbst<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
lebt. Die als Intimitätsverletzungen registrierten Eingriffe in die Körpersphäre<br />
durch medizinisches Personal, Einnahme von Medikamenten, Durchführung<br />
von therapeutischen Aktivitäten am Körper oder die Integration<br />
von medizinischen Artefakten in den Körper, kurz das „Hineinregieren" in<br />
sozial-leibliche Lebensgewohnheiten durch diagnostische <strong>und</strong> therapeutische<br />
Maßnahmen beinhalten die Aufhebung dieser alltagsweltlichen Idealisierung.<br />
3. Die Verletzung der Kontinuitätsidealisierung. Die stillschweigende Erwartung,<br />
daß das Leben so weitergeht wie bisher („<strong>und</strong>-so-weiter-Idealisierung")<br />
hat sich nicht bewährt. Damit ist „Terminalität" thematisiert, Begrenzung<br />
<strong>und</strong> Diskontinuität real, wo bislang ein offener Horizont unterstellt<br />
wurde. Da es sich bei dieser Idealisierung um eine temporale Größe<br />
handelt, sind mit ihr auch biographische, lebenszeitlich bislang gültige Fahrpläne<br />
infragegestellt. Mit der Aufhebung der Kontinuitätsidealisierung ist<br />
die offene lebensgeschichtliche Zukunft bedroht, der lebenszeitliche<br />
„Infinitätsindex" außer Kraft gesetzt. Dies wird für chronische Erkrankungen<br />
zu einem besonderen Problem wegen der Irreversibilität der Krankheit<br />
(also auch dann, wenn die chronische Erkrankung als nichtterminal gilt).<br />
In Anlehnung an die Terminologie der Sozial-Epidemiologie lassen sich die<br />
drei genannten Verletzungen von Idealisierungen der Alltagswelt als „soziale<br />
Basis-Stressoren" bezeichnen, die nicht nur einfach krankheitsbegleitend,<br />
sondern auch krankheitsgenerierend angesehen werden müssen. (Was sich<br />
auch durch die Beobachtung erhärten läßt, daß z.B. ein sozialer Verlust zu<br />
ähnlichen Verletzungen der Alltagsweltstruktur <strong>und</strong> schließlich somatischen<br />
Beschwerden, sprich „Krankheit" führen kann.) Es sollte zumindest im<br />
Ansatz bei der Skizze der drei sozialen Basis-Stressoren deutlich geworden<br />
sein, daß sie sich jeweils ausdifferenzieren lassen in soziale <strong>und</strong> biographisch<br />
restringierende Merkmalsbündel. Welche konkreten Ausprägungen sie annehmen,<br />
hängt einmal von der Art der Krankheit ab, zum anderen von biographischen<br />
<strong>und</strong> sozialen Stressoren <strong>und</strong> Anti-Stressoren, also Ressourcen,<br />
bzw. Support-Faktoren.<br />
Wenn die Krankheitsentstehung auf diese Weise adäquat als Verletzung<br />
der sozialen Leiblichkeit gefaßt werden kann, dann besteht die Krankheitsbewältigung<br />
darin, soziale Leiblichkeit wieder herzustellen. Bei Akutkrankheiten<br />
können die Kooperationserwartungen temporär stark minimalisiert<br />
werden. Soweit die Eigenaktivitäten des Patienten mit therapeutischen Interventionen<br />
konfligieren, ist eine gewisse Passivität sogar erwünscht (gelingt<br />
eine Rückstellung im Krankenhaus zu verstärkter Kooperation <strong>und</strong><br />
Eigenverantwortung nicht, spricht man von „Hospitalisierungsschäden").<br />
Andererseits erfordern eine große Zahl von therapeutischen Maßnahmen<br />
Kooperation (Pillen muß man z.B. auch wirklich einnehmen), <strong>und</strong> Kooperationswilligkeit<br />
muß durch entsprechende Anreize wieder aufgebaut werden.<br />
Weiter wird die Durchbrechung der Idealisierung der Körperautonomie<br />
dadurch wiederhergestellt, daß der Patient erfährt (<strong>und</strong> ihm dies vom Arzt<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
estätigt wird), daß die ,,Selbstheilungskräfte" unterstützend wirken,<br />
Schmerzen verschwinden, Energie zurückkehrt, der Körper eine gute Resistenz<br />
zeigt, etc. Die Kontinuitätsunterbrechungen können bei Akuterkrankungen<br />
wegen der Kurzfristigkeit der Krankheit überbrückt werden.<br />
Für die hier besonders interessierenden chronischen Krankheiten ergibt<br />
sich eine verschärfte Situation. Bei Akuterkrankungen kann der Re-Normalisierungsbedarf<br />
zum Teil dadurch minimiert werden, daß angenommen<br />
werden kann, daß „die Sache bald vorbei ist", <strong>und</strong> „bald wieder alles im<br />
Lot" ist. Dieses Überbrückungsverfahen durch „Warten" <strong>und</strong> temporäre<br />
Substitution sozialer Aufgaben des Kranken funktioniert wegen ihrer<br />
Dauerhaftigkeit bei der chronischen Krankheit gerade nicht. Ähnliches gilt<br />
für die Kooperationsidealisierung. Der Kooperationsbedarf ist bei der chronischen<br />
Krankheit sowohl im Bereich der Therapie als auch im nicht-therapeutischen<br />
Lebensfeld besonders hoch, die Kooperationsfähigkeit erscheint<br />
demgegenüber permanent begrenzt. Schließlich ist die Idealisierung der<br />
Körperautonomie kaum wiederherzustellen, wenn eine stetige Therapie <strong>und</strong><br />
angepaßte Lebensweise dem Kranken klarmachen, wie hinfällig seine körperliche<br />
Balance ist. Die Re-Normalisierung der sozialen Leiblichkeit bei der<br />
chronischen Krankheit steckt in der paradoxen Situation, Idealisierungen<br />
wiederherstellen zu müssen, ohne den Gr<strong>und</strong> ihres Verlustes aufheben zu<br />
können. Die bei der Krankeitsentstehung als restriktiv erlebten Faktoren<br />
können nicht nur nicht aufgehoben werden, sondern es ist bei allen chronischen<br />
Krankheiten damit zu rechnen, daß sie sich verschärfen <strong>und</strong> weitere<br />
Einschränkungen hinzutreten.<br />
Die Krankheitsbewältigung bei chronischen Krankheiten steht im Bereich<br />
der alltagsweltlichen Idealisierungen somit offenbar vor der Alternative,<br />
eine Alltagswelt zu konstituieren, die eben ohne die vorgängig verletzten<br />
Idealisierungen auskommt oder Reparaturstrategien einzusetzen, die<br />
funktionierenden Ersatz schaffen <strong>und</strong> somit wieder ein „normales Leben"<br />
ermöglichen. Darüber gleich noch etwas mehr.<br />
Angesichts dieser Überlegungen zur Krankheitsentstehung <strong>und</strong> Krankheitsbewältigung<br />
sind unter sozio-biographischen Konstitutiva chronischer<br />
Krankheit sowohl restriktive als auch unterstützende Faktoren, also sowohl<br />
soziale <strong>und</strong> biographische Stressoren als auch Anti-Stressoren (Schutzfaktoren)<br />
zu verstehen. Ich versuche jetzt allgemein einige dieser Konstitutiva<br />
darzustellen, ohne auf empirische Einzeluntersuchungen oder spezifische<br />
chronische Krankheiten eingehen zu können.<br />
III. Biographische Konstitutiva<br />
Biographien sind Orientierungssysteme, in denen gesellschaftlich konstruierte<br />
Handlungsketten <strong>und</strong> individuelle Erfahrungstypen verknüpft werden.<br />
Sie bieten dem „Biographieträger" die Möglichkeit, über sozial präformierte<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Handlungsfahrpläne <strong>und</strong> eigene bereits gemachte Erfahrungen in einem relativ<br />
konsistenten Gesamtsystem zu verfügen <strong>und</strong> gleichzeitig Kontingenzen<br />
im Blick auf weitere Orientierung zu verarbeiten. Ich unterscheide drei analytische<br />
Ebenen der Biographie-Erzeugung : a) Die Ebene heteronomer<br />
6<br />
biographischer Produktion; b) die Ebene der autonomen Konstitution;<br />
c) die Ebene der biographischen Gesamtkonstruktion.<br />
Bei der heteronomen biographischen Produktion geht es um sozial<br />
präformierte biographiebezogene Handlungsabläufe, in denen bestimmte<br />
Sequenzen (mit entsprechenden Markierungen) vorgegeben werden, in die<br />
der einzelne einzuspuren hat. Berufskarrieren, familienzyklische Abläufe<br />
<strong>und</strong> auch Krankheitsverläufe aus medizinischer Perspektive gehören hierher.<br />
Bei der autonomen Konstitution sind kontingente Erfahrungen <strong>und</strong> Ereignisse<br />
im Leben des einzelnen angesprochen. Dies ist der Bereich der variierenden<br />
Verarbeitung heteronom vorgegebener Muster, sei es durch Veränderungen<br />
der Vorgaben, sei es durch unique Ko<strong>mb</strong>ination einzelner<br />
Karriere stränge <strong>und</strong> -demente. In der biographischen Gesamtkonstruktion<br />
werden die vorigen beiden Ebenen zusammengesehen. Erzählte Lebensgeschichten<br />
können als Manifestierungen der biographischen Gesamtkonstruktion<br />
angesehen werden <strong>und</strong> haben von daher ein besonderes forschungspraktisches<br />
Interesse.<br />
Das Schema liegt quer zu einer dichotomen Trennung von „biographisch"<br />
<strong>und</strong> „sozial", dies bitte ich zu berücksichtigen bei den folgenden<br />
Ausführungen; die Gliederung des Vortrages vereinfacht hier die Sache <strong>und</strong><br />
auch ständige Querverweise innerhalb der folgenden beiden Abschnitte<br />
wären zu lästig geworden. Ich versuche in diesem Abschnitt biographische<br />
Konstitutiva aus der Ebene der Gesamtkonstruktion zu skizzieren, befasse<br />
mich im Abschnitt IV. mit der heteronomen biographischen Produktion<br />
<strong>und</strong> anderen sozialen Faktoren.<br />
Das erste <strong>und</strong> möglicherweise biographisch einschneidendste Merkmal<br />
chronischer Krankheiten ist Chronizität selber. Für den Kranken ist die restringierende<br />
Gr<strong>und</strong>bedingung permanent, lebenslänglich. Mit der ersten<br />
Diagnose seiner Krankheit ist der Patient also vor die Aufgabe gestellt, den<br />
alten Lebensentwurf so zu modifizieren, daß für ihn ein Leben mit der<br />
Krankheit antizipierbar wird. Ganz gleich, welche chronische Krankheit er<br />
sich zugezogen hat, die Kontinuitätsidealisierung ist zerbrochen, d.h. die<br />
vergangene, offene Zukunft ist zunächst bedroht. Die Frage, ob ein Leben<br />
als Kranker permanent überhaupt möglich ist, ist zunächst noch nicht entschieden.<br />
Welche Antwort dann möglich ist, hängt m.E. in erster Linie davon<br />
ab, ob es sich um eine terminale oder eine nicht-terminale Krankheit<br />
handelt. Obgleich in beiden Fällen eine offene Zukunft durch eine „ausgedehnte<br />
Gegenwart" ersetzt erscheint (Ich weiß, daß ich diese Krankheit<br />
immer haben werde.), bleibt bei der terminalen Krankheit der Infinitätsindex<br />
dauerhaft durchgestrichen. Die offene Zukunft ist prinzipiell verloren,<br />
auch wenn der Patient noch mehrere Lebensjahre vor sich sieht. Ich<br />
habe in dieser Situation empirisch zwei Reparaturstrategien zur Wiederherstellung<br />
der Kontinuitätsidealisierung festgestellt. 7<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Zum einen versuchen solche Patienten durch temporale Modifikationen<br />
die Verletzung der Lebenszeitstruktur zu kompensieren. Kurz gesagt bedeutet<br />
dies, daß die Patienten in der Vergangenheit leben oder sich in einer<br />
punktuellen Gegenwart situieren („Ich genieße das Heute") oder sich ganz<br />
auf eine bessere Zukunft konzentrieren. Zum anderen versuchen sie durch<br />
„Einklammern" so zu leben, „als ob" weiter nichts wäre, d.h. bestimmte<br />
Themen werden dethematisiert (Kapazitätsverluste, Umstände der Therapie<br />
oder der Tod).<br />
Bei nicht-terminalen chronischen Krankheiten macht sich der Patient<br />
nach einer Weile klar, daß er möglicherweise nun doch die gleiche Lebenserwartung<br />
hat, als wenn er ges<strong>und</strong> geblieben wäre. Damit verliert die Lebenszeitperspektive<br />
ihre Problematik, statt dessen steht die Alltagsbewältigung<br />
im Mittelpunkt. „Gelebte Gegenwart" mit der Krankheit impliziert<br />
immer einen Unsicherheitsfaktor. Medizinische <strong>und</strong> psycho-soziale Krisen<br />
lösen Zeiten relativ balancierten Lebens ab, oft ohne sich anzukündigen.<br />
Die Durchbrechung von Alltagsroutinen erfordert ein biographisches Krisenmanagement,<br />
„Routinisierung" von Krisen wird bei häufigerem Auftreten<br />
zur Aufgabe.<br />
Um die Symptom<strong>entwicklung</strong> möglichst zu kontrollieren, muß der<br />
Kranke zunächst einmal ein genaues Sympto<strong>mb</strong>eobachtungsvermögen entwickeln,<br />
das es ihm erlaubt, seine gesamte Lebensführung in einer Weise zu<br />
gestalten, daß er durch eigenes Verhalten die Krankheits<strong>entwicklung</strong> möglichst<br />
günstig beeinflußt. Wichtiger als die Befolgung von einzelnen Verhaltensmaßnahmen<br />
erscheint generell die Akzeptanz der eingeschränkten<br />
Lebensbedingungen <strong>und</strong> die Wiedergewinnung einer neuen Genußfähigkeit.<br />
Das heißt, die gelingende biographische Integration der Krankheit ist gleichzeitig<br />
einer der besten Schutzfaktoren der Krankheitsbewältigung. Diese<br />
Integrationsleistung ist nicht etwas, das nur einmal geleistet zu werden<br />
brauchte, um dann immer wieder verläßliche Orientierung zu bieten, bei<br />
den einschneidenden Restriktionen ist sie ständig, vor allem in Krisen, zu<br />
erbringen. Anselm Strauss versucht diesen Leistungsaspekt dadurch zu verdeutlichen,<br />
daß er von „Trauer- <strong>und</strong> Identitätsarbeit" spricht, die ein permanentes<br />
Erfordernis biographischer Konstitution ist. Daß die Patienten<br />
dies nicht alleine bewerkstelligen können, sondern es dazu auch eines abgestuften<br />
sozialen Netzwerks bedarf, versteht sich — ich werde darauf im<br />
nächsten Abschnitt zurückkommen.<br />
Ein letztes biographisches Konstitutivum sei noch erwähnt. Eine Leistung<br />
der biographischen Gesamtkonstruktion ist die Verknüpfung verschiedener<br />
präformierter biographischer Stränge. Diese „ Verknüpfungsarbeit"<br />
(in Anlehnung an Strauss' „articulation work" innerhalb der trajectory )<br />
8<br />
stellt an den chronisch Kranken besondere Anforderungen, weil sie Entscheidungen<br />
über wechselseitige Einflüsse von biographischen Strängen, vor<br />
allem hinsichtlich der Krankheit, erfordert. Wo es gelingt, etwa die positive<br />
Wirkung des familiären oder beruflichen biographischen Stranges auf die<br />
Krankheits-„trajectory" richtig abzuschätzen, konstituiert der Kranke einen<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Schutzfaktor. Das gleiche gilt auch umgekehrt: die adäquate Einschätzung<br />
restriktiver Wirkungen der trajectory auf andere biographische Stränge bewahrt<br />
vor Überanstrengungen <strong>und</strong> Enttäuschungen. Es versteht sich von<br />
selbst, daß hier nicht beliebige Wahlmöglichkeiten unterstellt werden. Es<br />
gehört ja gerade zum Charakter präformierter biographischer Elemente,<br />
daß sie nicht beliebig durchlebt werden können. (Wer in der Phase der<br />
Familiengründung von der Krankheit betroffen wird, hat andere Wahlmöglichkeiten<br />
als jemand, der in der postfamilialen Phase seines Lebenszyklus<br />
chronisch krank wird.) Dennoch gibt es für alle Situierungen innerhalb von<br />
biographischen Strängen „Freiheitsgrade", die festgestellt <strong>und</strong> gelebt werden<br />
können. Gelingt die Verknüpfungsarbeit schlecht, ergeben sich zusätzliche<br />
biographische Stressoren für den Krankheitsverlauf (e.g. familiäre oder<br />
berufliche Probleme bis hin zur Auflösung der entsprechenden biographischen<br />
Stränge).<br />
IV. Soziale Konstitutiva<br />
Hier ist zunächst noch einmal die heteronome biographische Produktion<br />
aufzugreifen. Präformierte familiale <strong>und</strong> berufliche biographische Muster<br />
spielen eine erhebliche Rolle als soziale Stressoren <strong>und</strong> auch Schutzfaktoren<br />
der chronischen Krankheit. Es kann zu den gesicherten Ergebnissen der<br />
sozial-epidemiologischen Forschung gerechnet werden, daß Vertraute<br />
(„confidants") aus dem familiären Interaktionsfeld zu den Anti-Stressoren<br />
in der Krankheitsentstehung <strong>und</strong> Krankheitsbewältigung gerechnet werden<br />
können. Analog ist der Verlust zentraler familiärer Bezugspersonen — sei es<br />
durch Trennung, sei es durch Tod — ein eindeutiger Begünstigungsfaktor für<br />
chronische Erkrankungen.<br />
Daß berufliche Belastungen, vor allem permanenter Art, zu den prominenten<br />
Ursachen etwa von Herz-Kreislaufstörungen zu rechnen sind, ist bekannt.<br />
Umgekehrt stellt die befriedigende soziale Einbindung in einen beruflichen<br />
Kontext einen Schutzfaktor dar, was ersichtlich ist an einer<br />
Krankheitszunahme nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben. Dies sind<br />
jedoch nur ganz grobe Hinweise. Im einzelnen spielen die jeweiligen Situierungen<br />
des Kranken innerhalb bestimmter heteronom produzierter biographischer<br />
Abschnitte eine große Rolle für die Krankheitsentstehung <strong>und</strong><br />
Krankheitsbewältigung. Sie erscheinen mir in jedem Fall wichtiger als die<br />
bloße Altersangabe, die für sich genommen wenig Aussagekraft für die Bestimmung<br />
von Stressoren oder Anti-Stressoren hat. Dem kann hier im einzelnen<br />
nicht nachgegangen werden.<br />
Die meisten sozialen Konstitutiva chronischer Krankheit sind sicherlich<br />
dem Feld der medizinischen Versorgung zuzurechnen. M.a.W., was es heißt,<br />
chronisch krank zu sein, wird zu einem erheblichen Maße durch die jeweils<br />
aktualisierbare medizinische Leistung bestimmt. Die „soziale Welt des chro-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
iisch Kranken" ist stark, wenn auch nicht ausschließlich bestimmt durch<br />
die „soziale Welt der Medizin". Dies erscheint möglicherweise so selbstverständlich,<br />
daß die Problematik des Perspektivenwechsels, die hier impliziert<br />
ist, nicht wahrgenommen wird. Die Transformation des „Kranken"<br />
in den „Patienten" läßt andere handlungsleitende Motive dominant werden,<br />
die von den Interessen <strong>und</strong> Bedürfnissen des Kranken sehr stark abweichen<br />
können. Überspitzt gesagt: Was für den Arzt oder die wissenschaftliche<br />
Medizin gut <strong>und</strong> wichtig ist, ist nicht unbedingt gut <strong>und</strong> wichtig für den<br />
Kranken. Die soziale Welt der Medizin (oder des Arztes) ist von anderen Relevanzen<br />
geleitet, anderen Rollenträgern bevölkert, anderen Handlungsproblemen<br />
<strong>und</strong> Konflikten bestimmt als die soziale Welt des Kranken. Die<br />
mittlerweile recht breite populäre <strong>und</strong> publizierte Kritik an den „Halbgöttern<br />
in Weiß" ist ein Reflex auf diese Perspektivenverschiebung; die Forderung<br />
nach einer alternativen Medizin <strong>und</strong> das Entstehen von Selbsthilfegruppen<br />
im Ges<strong>und</strong>heitsbereich stehen für den Versuch, die Interessen des<br />
Kranken wieder in den Handlungsfokus zu bringen.<br />
Was heißt dies nun im einzelnen für den chronisch Kranken? Ich muß<br />
mich auf ein paar Punkte beschränken.<br />
a) Der chronisch Kranke wird in einem medizinischen System prozessiert,<br />
das nicht auf Lanzeiterkrankungen eingestellt ist. Medizinerausbildung <strong>und</strong><br />
die Organisation von Krankenpflegeanstalten sind auf ein Normalmodell<br />
von Akutkrankheit ausgerichtet. Die besonderen medizinischen, vor allem<br />
9<br />
aber psycho-sozialen Bedürfnisse chronisch Kranker werden nur äußerst<br />
zögernd in Rechnung gestellt.<br />
b) Chronische Krankheiten implizieren eine große Anzahl sehr verschiedener<br />
medizinischer <strong>und</strong> sozialpflegerischer Hilfsleistungen. Daraus ergeben<br />
sich Koordinationsaufgaben <strong>und</strong> -probleme 10 diagnostischer <strong>und</strong> therapeutischer<br />
Maßnahmen in ganz verschiedenen Ausprägungen (z.B. auf welcher<br />
Station im Krankenhaus wird der Kranke untergebracht; koordiniert der<br />
Arzt oder die Stationsschwester die Arbeit am Patienten; welcher Facharzt<br />
hat die Entscheidungsautorität: der Kardiologe, der Chirurg, der Psychiater/<br />
Psychologe, der Internist, etc.; welche medizin-technischen Möglichkeiten<br />
stehen zur Verfügung; welche diagnostischen Prozeduren sind möglich bzw.<br />
zumutbar; welche Rehabilitationsangebote können gemacht werden?).<br />
c) Die Beispiele implizieren bereits die Frage nach den personellen, technischen<br />
<strong>und</strong> finanziellen Ressourcen auf der Seite der dem Patienten zur Verfügung<br />
stehenden medizinischen Versorgungseinrichtungen. Diese variieren<br />
erheblich <strong>und</strong> bestimmen so den sozialen Rahmen chronischen Krankseins.<br />
d) Chronische Krankheiten implizieren eine große Anzahl verschiedener<br />
Arten medizinischer Arbeit, die jedoch im konkreten Fall in sehr unterschiedlicher<br />
Weise tatsächlich erbracht, bzw. befriedigend koordiniert werden<br />
können. Ich liste hier lediglich auf" :<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Maschinenarbeit<br />
Informations- <strong>und</strong> Dokumentationsarbeit<br />
Koordinations- <strong>und</strong> Verbindungsarbeit<br />
Sicherheitsarbeit<br />
Mut- <strong>und</strong> Trostarbeit<br />
Gefühlsarbeit<br />
Fehlerarbeit, etc.<br />
Damit genug zu den sozialen Konstitutiva chronischer Krankheit aus dem<br />
Bereich der medizinischen Versorgung. Ein letztes Feld sozialer Konstitutiva<br />
ist das soziale Netzwerk oder das Feld sozialer Unterstützungen. (Es<br />
überschneidet sich z.T. mit dem Bereich heteronomer biographischer Produktion.)<br />
Die sozialepidemiologische Forschung hat die große Unterstützungsleistung<br />
eines abgestuften sozialen Netzwerkes von „confidants",<br />
engen Beziehungen, lockeren Bekanntschaften oder formellen Beziehungen<br />
am Ende der Skala gut belegt. Die emotionale Unterstützung, das Ansehen<br />
<strong>und</strong> die Wertschätzung, die dem Kranken hier zuteil werden, sowie die gegenseitigen<br />
Verpflichtungen im Netzwerk sind wesentliche Schutzfaktoren.<br />
Wo sie entfallen — etwa gerade bei langfristigen Hospitalisierungen von<br />
chronisch Kranken — entstehen soziale Stressoren. Die soziale Bewegung<br />
der medizinischen Selbsthilfegruppen manifestiert die Bedeutung der<br />
11<br />
Eigenaktivität <strong>und</strong> Selbstverantwortung für die Krankheitsbewältigung.<br />
Die gegenwärtige Ges<strong>und</strong>heitspolitik <strong>und</strong> die medizinische Profession sind<br />
immer noch in einer Überschätzung der rein bio-medizinischen Forschung<br />
<strong>und</strong> ihrer Anwendung in der a<strong>mb</strong>ulanten <strong>und</strong> stationären Behandlung chronisch<br />
Kranker befangen. Die Bedeutung der Eigenleistung der Kranken<br />
13<br />
<strong>und</strong> ihrer sozialen Netzwerke für die Krankheitsbewältigung (sowie für die<br />
Ges<strong>und</strong>erhaltung <strong>und</strong> Krankheitsentstehung) wird ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> medizinpolitisch<br />
immer noch unterschätzt.<br />
ANMERKUNGEN<br />
1 vgl. K.E. Rothschuh (Hg), Was ist Krankheit? Erscheinung, Erklärung, Sinngebung,<br />
Darmstadt 1975, S. 414-416.<br />
2 vgl. E.M. Waltz, „Soziale Faktoren bei der Entstehung <strong>und</strong> Bewältigung von Krankheit<br />
— ein Uberblick über die empirische Literatur", in: B. Badura (Hg), Soziale Unterstützung<br />
<strong>und</strong> chronische Krankheit. Zum Stand sozialepidemiologischer Forschung,<br />
Frankfurt 1981, S. 40-119.<br />
3 Anm. 2, S. 7.<br />
4 vgl. E. Husserl, Ideen I, GW III, 1, Den Haag 1976, S. 60f.<br />
5 vgl. W. Fischer, Time and Chronic Illness, Berkeley 1982, S. 244ff.<br />
6 vgl. W. Fischer, „Biographische Methode", in: H. Haft/H. Kordes (Hg), Methoden<br />
der Erziehungs- <strong>und</strong> Bildungsforschung. Enzyklopädie Erziehungswissenschaft,<br />
Bd. 2, Stuttgart 1984, S. 478.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
7 vgl. W. Fischer, „Alltagszeit <strong>und</strong> Lebenszeit von chronisch Kranken", in: ZSE 2<br />
(1982), S. 14ff.<br />
8 vgl. A. Strauss, Social Organization of Medical Work, Chicago 1985, S. 15lff.<br />
9 vgl. A. Strauss, Chronic Illness and the Quality of Life, St. Louis 1975, S. 3ff.<br />
10 vgl. A. Strauss, Anm. 8, Chicago 1985.<br />
11 Anm. 8, passim <strong>und</strong> bes. 238ff.<br />
12 vgl. B. Badura/Chr. v.Ferber (Hg), Selbsthilfe <strong>und</strong> Selbstorganisation im Ges<strong>und</strong>heitswesen.<br />
Die Bedeutung nichtprofessioneller Sozialsysteme für Krankheitsbewältigung.<br />
Soziologie <strong>und</strong> Sozialpolitik Bd. 1, <strong>München</strong> 1981; <strong>und</strong> Chr. v.Ferber/<br />
B. Badura (Hg), Laienpotential, Patientenaktivierung <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsselbsthilfe.<br />
Soziologie <strong>und</strong> Sozialpolitik Bd. 3, <strong>München</strong> 1983.<br />
13 vgl. Anm. 12, Badura 1981, S. 8.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Entwicklung <strong>und</strong> Diskontinuität<br />
EINLEITUNG<br />
Georg Elwert<br />
Die Modernisierungstheorie ging von einem kontinuierlichen Wachstumsprozeß<br />
aus. Die groben Indikatoren, wie zum Beispiel Bevölkerungswachstum,<br />
sprachen dafür. Die Ethnographie vorindustrieller Gesellschaften<br />
schien klar die Differenzen zu den entwickelten Gesellschaften zu zeigen:<br />
geringe Komplexität, vor-rationales Denken <strong>und</strong> Wirtschaften <strong>und</strong> geringe<br />
Leistungsmotivation. Damit schienen die Bedingungen der Entwicklung klar<br />
zu sein. Es galt, die Mentalitäten zu ändern, die Selbstversorgungswirtschaft<br />
zu verdrängen <strong>und</strong> durch neue Institutionen die Komplexität zu steigern.<br />
Die hierauf gründenden Entwicklungstheorien des West- wie des Ostblocks<br />
scheiterten jedoch in der Entwicklungspraxis der armen Länder.<br />
Ausgehend von empirischer Forschung in der Dritten Welt <strong>und</strong> ebenso<br />
von historischen Forschungen <strong>und</strong> wirtschaftssoziologischen Forschungen<br />
zur industriellen Entwicklung wurde nun gefragt, ob die Formen des Wirtschaftens<br />
in der Dritten Welt <strong>und</strong> in bestimmten Bereichen der europäischen<br />
Geschichte nicht einer eigenen Rationalität — der Sicherheitsrationalität<br />
— unterliegen, ob geringe Leistungsmotivation <strong>und</strong> vor-rationales<br />
Denken nicht Forschungsartefakte seien, die Formen des passiven Widerstands<br />
falsch interpretierten. Eine Neuinterpretation der europäischen Industrialisierungsgeschichte<br />
ergibt, daß der sog. Dualismus traditionaler <strong>und</strong><br />
moderner Sektoren keineswegs nur die unter-entwickelten Länder auszeichnet,<br />
sondern auch ein Strukturmuster europäischer Entwicklung ist.<br />
So wurden die Umrisse eines Bündels neuer Entwicklungstheorien deutlich.<br />
Sie heben hervor, daß Komplexität nicht kontinuierlich zunimmt,<br />
sondern daß umfassende Reduktionsprozesse zu strukturellen Vereinfachungen,<br />
wie dem Ware-Geld-Prinzip, der modernen Verwaltung <strong>und</strong> der<br />
schriftlichen Kommunikation führen <strong>und</strong> damit erst den Aufbau neuer<br />
Komplexität ermöglichen. Nicht nur „kapitalistische Entwicklung" als<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ökonomischer Motor, sondern ebenso Widerstände dagegen führen zu<br />
strukturellen Innovationen. Die Erkenntnis strukturell gegründeter Diskontinuitäten<br />
löst den teleologischen Forschrittsoptimismus ab. Die Evolution<br />
von Gesellschaften kann stoppen, sie ist nicht notwendigerweise ein<br />
auto-poietischer Prozeß. Nichts beleuchtet das deutlicher als das Problem,<br />
ob die zwischennationale Machtbalance heute noch eine Friedensfähigkeit<br />
gewährleisten kann.<br />
In der Diskussion wurde der Beitrag von Burkart Lutz über „Wirtschaftsdualismus<br />
<strong>und</strong> diskontinuierliche Entwicklung als generelle Strukturmuster"<br />
besonders ausführlich diskutiert. Lutz zog Begriffe wie Dualismus,<br />
die gerade auf die Unter<strong>entwicklung</strong> der Dritten Welt gemünzt waren, zur<br />
Erklärung der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands heran. Es schien<br />
uns nicht sinnvoll, diesen Beitrag, der aus der Arbeit an dem gerade fertiggestellten<br />
Buch „Der kurze Traum immerwährender Prosperität — Eine<br />
Neuinterpretation der industriell-kapitalistischen Entwicklung im Europa<br />
des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts" berichtete, auf 5 Seiten zusammenzufassen. Dieser<br />
Verzicht fiel uns dadurch besonders leicht, daß sich aus den gemeinsamen<br />
Fluchtpunkten dieses <strong>und</strong> anderer Beiträge eine weitere Publikation ergibt.<br />
In den Beiträgen von Gerd Spittler, Hans-Dieter Evers, Tilman Schiel ebenso<br />
wie in der lebhaften Diskussion zwischen Burkart Lutz <strong>und</strong> Dieter<br />
Senghaas, <strong>und</strong> vorher schon in dem Beitrag von Georg Elwert im Vormittagsplenum,<br />
wurde ein Thema angesprochen, das später in der Sektion<br />
Entwicklungs<strong>soziologie</strong> anhand der Beiträge von Ulrich Menzel, Peter Waldmann<br />
<strong>und</strong> Helmut Asche ausführlicher diskutiert werden sollte: Welches<br />
sind die Bedingungen des Übergangs zur Industrienation, wie lassen sich<br />
Konstellationen des Verharrens in — scheinbaren? — Übergangspositionen<br />
analysieren, inwieweit können wir überhaupt noch einen unilineare Entwicklung<br />
suggerierenden Begriff des Schwellenlandes beibehalten? In dem<br />
Band mit dem Titel „Auf der Schwelle der Entwicklung" werden die genannten<br />
Beiträge in ausführlicher Form nachzulesen sein. Von daher ist es<br />
wohl zu vertreten, daß hier nur um drei Viertel gekürzte Fassungen (ohne<br />
die empirischen Belege) der Vorträge dieser Diskussionsveranstaltung abgedruckt<br />
werden.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
VOLKSZÄHLUNG UND BÜROKRATISCHE HERRSCHAFT<br />
IN BAUERNSTAATEN<br />
Gerd Spittler<br />
Die Diskussion über die Volkszählung hat seit langer Zeit wieder den Blick<br />
darauf gelenkt, daß Volkszählungen keine neutralen technischen Erhebungen<br />
sind, sondern daß sie auch eine große Bedeutung als Kontrollinstrument<br />
haben können. Diese Diskussion hat freilich eher sy<strong>mb</strong>olischen Charakter.<br />
Im Kontext der vielfältigen Sammlung <strong>und</strong> Speicherung von Informationen<br />
kommt der Volkszählung in Industriegesellschaften keine besondere Bedeutung<br />
zu. In Bauernstaaten dagegen kann sich eine bürokratische Herrschaft<br />
zunächst nur mit Hilfe solcher Volkszählungen etablieren. Diese sind ein<br />
unerläßliches Instrument der Durchsetzung ihres Herrschaftsanspruches,<br />
sowohl gegenüber der Bevölkerung wie gegenüber konkurrierenden Machthabern.<br />
Wenn ich im folgenden europäische Bauernstaaten des 18. mit afrikanischen<br />
Bauernstaaten des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts vergleiche, dann soll das nicht<br />
heißen, daß zwischen ihnen keine Unterschiede bestehen. Ich übersehe<br />
nicht, daß die zeitliche Differenz <strong>und</strong> die koloniale <strong>und</strong> neokoloniale Abhängigkeit<br />
ihr eigenes Gewicht besitzen. Dennoch erscheint es mir gerechtfertigt<br />
<strong>und</strong> sinnvoll, für bestimmte Teilbereiche Vergleiche vorzunehmen.<br />
Hier geht es vor allem darum, zu zeigen, wie eine staatliche Bürokratie mit<br />
den Problemen fertig wird, die sich aus einer Bauerngesellschaft ergeben.<br />
Merkwürdigerweise bestand die Hauptaktivität der Kolonialbeamten in<br />
Französisch Westafrika in einer sehr simplen Tätigkeit: Sie verbrachten ihre<br />
Arbeitszeit vor allem damit, die Leute in ihrem Distrikt zu zählen <strong>und</strong> ihre<br />
Namen aufzuschreiben. In der Regel delegierten sie diese Aufgabe nicht an<br />
Untergebene, sondern führten sie selbst durch. Sie ritten wochen- <strong>und</strong><br />
monatelang auf einem Pferd durch die Dörfer, versammelten die Einwohner<br />
<strong>und</strong> zählten sie. Nur in seltenen Fällen kamen sie soweit, daß sie den Namen<br />
jedes einzelnen aufschreiben konnten.<br />
Es handelte sich hier keineswegs um einen einmaligen Zensus, sondern<br />
um einen Prozeß, der die ganze Kolonialzeit über andauerte. Es war eine<br />
wahre Sisyphusarbeit. Denn trotz aller Anstrengungen gelang es der Kolonialverwaltung<br />
nicht, eine zuverlässige Volkszählung zustandezubringen.<br />
Der Zensus wurde zunächst als sogenannter numerischer Zensus (recensement<br />
numerique) durchgeführt. Im einfachsten Fall zählt man die Zahl der<br />
Hütten <strong>und</strong> multiplizierte dies mit der vermuteten Anzahl von Hüttenbewohnern.<br />
Oder man versammelte die Familienvorstände <strong>und</strong> addierte aufgr<strong>und</strong><br />
ihrer Angaben alle Familienmitglieder. Bestenfalls trieb man die ge-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
samten Einwohner <strong>und</strong> das Vieh eines Dorfes auf einem Platz zusammen<br />
<strong>und</strong> zählte dann ab. Das Ziel war aber nicht ein numerischer, sondern ein<br />
nominativer Zensus (recensement nominatif). Man wollte jeden Einwohner<br />
namentlich erfassen <strong>und</strong> in eine Liste eintragen. Obwohl dieses Ziel seit<br />
Anfang des Jahrh<strong>und</strong>erts bestand, scheiterte seine Realisierung jahrzehntelang<br />
<strong>und</strong> wurde erst gegen Ende der Kolonialzeit in den 50er Jahren ansatzweise<br />
verwirklicht.<br />
Warum ist ein Zensus so wichtig? Französisch Westafrika war ein überwiegend<br />
von Bauern bevölkertes Land. Die Kolonialverwaltung wollte vor<br />
allem drei Dinge von den Bauern: Steuern für die Finanzierung des kolonialen<br />
Budgets, Rekruten für die koloniale Armee <strong>und</strong> Arbeiter für einen<br />
Zwangsarbeitsdienst (prestations). Für alle drei war ein nominativer Zensus<br />
von zentraler Bedeutung. Die korrekte Eintreibung der für alle Erwachsenen<br />
festgesetzten Kopfsteuer setzte voraus, daß jeder Erwachsene in einer Liste<br />
namentlich eingetragen war.<br />
Die Zahl der Individuen war freilich zu groß, als daß die Kolonialregierung<br />
sich hätte mit jedem einzelnen beschäftigen können. Die zahlenmäßige<br />
Zusammenfassung der Einwohner FWA's in Tabellen war eine<br />
Voraussetzung dafür, daß diese Listen auf höherer Ebene als Entscheidungsgr<strong>und</strong>lage<br />
dienen konnten. In einer Situation, in der die Kolonialverwaltung<br />
fast nichts über die bäuerliche Bevölkerung wußte, waren die Bevölkerungstabellen<br />
von unschätzbarem Wert. Auf ihrer Basis wurden Quoten für Steuerzahlungen,<br />
Armeerekrutierungen <strong>und</strong> Arbeitsdienst festgelegt. Darüber<br />
hinaus waren die Bevölkerungszahlen der wichtigste Indikator für ökonomische<br />
<strong>und</strong> politische Veränderungen.<br />
Wie funktioniert nun eine Verwaltung, wenn ein solcher nominativer<br />
Zensus nicht zur Verfügung steht? An die Stelle einer bürokratischen treten<br />
dann eine intermediäre <strong>und</strong> eine despotische Verwaltung. Der Unterschied<br />
läßt sich zunächst an der Art des Abgabensystems deutlich machen. Für eine<br />
Bürokratie ist als Abgabe die Steuer typisch, bei der genau geregelt wird,<br />
welche Kategorie von Personen Steuern in welcher Höhe bezahlen muß.<br />
Dagegen tritt in einem intermediären System als Abgabe der Tribut. Für ein<br />
Bevölkerungskollektiv, z.B. ein Dorf, wird eine globale Summe festgelegt,<br />
für deren Ablieferung ein Mittelsmann verantwortlich ist. Wie dieser Tribut<br />
auf die einzelnen Mitglieder des Kollektivs verteilt wird, liegt außerhalb<br />
der Einflußmöglichkeit der Zentralinstanz. Bei einer despotischen Herrschaft<br />
ist die Abgabe weder eine Steuer noch ein Tribut, sondern eine<br />
Beute: Man greift sich das, was man gerade bekommen kann.<br />
Warum ist intermediäre Verwaltung in Bauernstaaten so verbreitet? Sie<br />
entspricht der Struktur von Bauerngesellschaften eher als eine Bürokratie.<br />
Sie basiert nicht auf der Zentralisierung von Ressourcen <strong>und</strong> deren Verteilung<br />
von oben, sondern auf deren lokaler Verfügung. Sie löst das Informationsproblem,<br />
da sie auf weniger Informationen angewiesen ist. Die mündliche<br />
Kommunikation <strong>und</strong> die Speicherung von Informationen im Gedächtnis<br />
sind einer oralen Kultur adäquater als die auf Schriftlichkeit fixierte<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Bürokratie. Aus der Sicht der Zentralinstanz sind allerdings viele dieser Vorteile<br />
eher Nachteile, da sie die Kontrolle durch die Zentralinstanz abschwächen.<br />
Ein Mittelsmann, der durch keine kontrollierte Ausbildung geprägt<br />
wird, der ein Informationsmonopol über den von ihm verwalteten Bezirk<br />
besitzt, der nicht versetzt werden kann, <strong>und</strong> der keine Laufbahn vor sich<br />
hat, kann kaum von oben kontrolliert werden. In FWA waren die Dorf<strong>und</strong><br />
Kantonshäuptlinge solche Mittelsmänner.<br />
Liest man die Berichte der Kolonialbeamten, dann gewinnt man zunächst<br />
den Eindruck einer bürokratisch voll erfaßten Welt. In den Berichten<br />
finden sich genaue Zahlen über die Einwohner, über den Bestand an Rindern,<br />
Schafen, Ziegen, über die Erntemengen an Gr<strong>und</strong>nahrungsmitteln<br />
wie Hirse, Reis, Maniok usw. In Wirklichkeit waren diese Zahlen Erfindungen,<br />
bestenfalls Schätzungen. Sie waren oft überhöht, weil die Kolonialbeamten<br />
die Tendenz hatten, jährliche Steigerungsraten zu melden, um ihre<br />
Vorgesetzten zu beeindrucken.<br />
Die Kolonialbürokratie bewegte sich weitgehend in einer fiktiven Welt.<br />
Das führte manchmal zu Katastrophen, weil z.B. Dürren <strong>und</strong> Hungersnöte<br />
nicht richtig eingeschätzt wurden. Aber andererseits verlieh es der Bürokratie<br />
nach innen <strong>und</strong> außen eine Stabilität, die ihr langfristig den Sieg<br />
sicherte.<br />
Welchen praktischen Nutzen hatten Listen <strong>und</strong> Tabellen? Ich will dies<br />
am Beispiel der militärischen Rekrutierung zeigen, die im Militärstaat<br />
Preußen von zentraler Bedeutung war. Zu Beginn des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts gab<br />
es zwei Methoden der inländischen Rekrutierung. Das erste war ein Quotenverfahren.<br />
Jeder Kreis mußte ein bestimmtes Mindestkontingent liefern.<br />
Wie er das zustandebrachte, blieb ihm überlassen. Die Zahl der Soldaten,<br />
die auf diese Weise aufgebracht werden konnten, erwies sich aber als zu<br />
gering. Man mußte daher auch auf die Werbung zurückgreifen. Werbung war<br />
freilich ein euphemistischer Begriff, denn es handelte sich hier oft genug<br />
um Raub, bei dem auch Blutvergießen nicht ausblieb. Vor allem bei der<br />
Jagd nach „langen Kerls" war den Werbern jedes Mittel recht. Die Bauernsöhne<br />
ergriffen bisweilen die Flucht ins Ausland; manchmal wanderten die<br />
Bewohner ganzer Dörfer aus. Wer reich genug war, versuchte, sich durch<br />
eine Lösesumme freizukaufen; die Armen griffen zum Mittel der Selbstverstümmelung.<br />
Gelegentlich leisteten sie auch zusammen mit ihrem Herrn<br />
bewaffneten Widerstand gegen die Rekrutierung.<br />
Diese Methoden der Soldatenrekrutierung sind typisch beim Fehlen<br />
einer bürokratischen Regelung. Zuerst versucht man es im Rahmen intermediärer<br />
Herrschaft mit einem Quotenverfahren. Da die gelieferten Kontingente<br />
nicht ausreichen, wird die intermediäre Herrschaft durch eine<br />
despotische ergänzt.<br />
Als Folge dieses despotischen Rekrutierungssystems war ein Niedergang<br />
der bäuerlichen Landwirtschaft nahezu unvermeidlich. 1733 stellte daher<br />
Friedrich Wilhelm I. die Rekrutierung durch das Kantonsystem auf eine<br />
völlig neue Gr<strong>und</strong>lage. Von nun an war die Rekrutierung im Prinzip büro-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
kratisch geregelt. Wie funktionierte dieses System? Ganz Preußen wurde<br />
in Kantone aufgeteilt, die je einer Kompanie (später einem Regiment)<br />
exklusiv zur Aushebung von Soldaten zugeteilt wurden. Alle Jungen wurden<br />
noch vor ihrer Rekrutierung „enrolliert". Jeder pflichtige Knabe wurde<br />
in die vom Pfarrer geführte <strong>und</strong> dem Regiment mitgeteilte Liste eingetragen.<br />
Im Zusammenhang mit unserer Fragestellung ist es wichtig, daß das<br />
Kantonsystem für sein Funktionieren bürokratische Basisinformationen<br />
voraussetzte. Die militärische Bürokratie mußte Kenntnisse über die Bevölkerungszahl<br />
aller Ortschaften haben, damit sie Kantone mit gleicher Bevölkerungszahl<br />
einteilen konnte. Sie mußte überdies, <strong>und</strong> das war ungleich<br />
schwieriger, über ein Geburtenregister verfügen, damit sie die 10-jährigen<br />
Knaben, die für die Enrollierung vorgesehen waren, identifizieren konnte.<br />
Bei der Durchsetzung staatlicher Herrschaft gegenüber den intermediären<br />
Lokalgewalten war das Kantonsystem eine wichtige Etappe. Alle Enrollierten,<br />
d.h. alle Männer, auch wenn sie nicht in der Armee waren, unterstanden<br />
jetzt in mehreren Bereichen nicht den Anweisungen ihres Guts- <strong>und</strong><br />
Gr<strong>und</strong>herrn, sondern dem Kompaniechef. Dieser erteilte die Heiratserlaubnis,<br />
dieser entschied darüber, wo sich der Enrollierte ansässig machen<br />
konnte. Die Enrollierten unterstanden dem Militärgericht. Die Bauern<br />
wurden hier direkte Untertanen des Staates.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
STRATEGISCHE GRUPPEN, KLASSENBILDUNG UND<br />
GESELLSCHAFTLICHE ENTWICKLUNGEN<br />
Hans-Dieter Evers, Tilman Schiel<br />
Was unterscheidet das Konzept strategischer Gruppen vom originären Marxschen<br />
Klassenkonzept?<br />
Geschichte ist nicht nur als Abfolge von Kämpfen existierender Klassen zu<br />
begreifen: Gerade in Phasen rascher einschneidender Veränderung ist dies<br />
auch ein Prozeß des Zerfalls bestehender Klassen <strong>und</strong> der gleichzeitigen<br />
Selbstschöpfung neuer Klassen. Dies geschieht durch das strategische Handeln<br />
von Gruppen, die weniger von einem Ist-Zustand ausgehen als einen<br />
noch nicht bestehenden Zustand anstreben.<br />
Bürokratie als Handlungsfeld strategischer Gruppen<br />
Das Ende des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts sah neben der territorialen Ausdehnung<br />
europäischer Kolonialreiche auch ein ungeheures Wachstum des kolonialen<br />
Sozialprodukts bei gleichzeitig zunehmender regionaler <strong>und</strong> sozialer<br />
Differenzierung. Im Kampf um die Verteilung des steigenden Sozialprodukts<br />
war die koloniale Bürokratie in nicht geringem Maße beteiligt.<br />
Die „Bürokratie" in Ländern der Dritten Welt ist eine sehr komplexe<br />
<strong>und</strong> von der unsrigen Verwaltung sehr verschiedene <strong>gesellschaftliche</strong> Erscheinung.<br />
Wir sind der Ansicht, daß es sich im strikten Sinne dabei nicht<br />
um eine Bürokratie handelt, da die Unterschiede zur Bürokratie als einer<br />
ganz spezifischen Form institutionalisierter Verwaltung im entwickelten<br />
Kapitalismus f<strong>und</strong>amental sind. Dies zeigt sich auch in der Debatte um den<br />
„bürokratischen Kapitalismus".<br />
•<br />
Man geht sicherlich von falschen Voraussetzungen aus, wenn man die<br />
heutigen Staaten der „Dritten Welt" als eine Hegelianische „Vernunftinstanz<br />
der bürgerlichen Gesellschaft" betrachtet oder in ihnen den Ausfluß<br />
Max Weberschen rationalen Handelns zum Wohle der Allgemeinheit vermutet.<br />
Die Bürokratie ist aber auch keineswegs einfach das Instrument einer<br />
herrschenden Klasse, wie von marxistischen Analytikern leichtfertig behauptet<br />
wird.<br />
Das strategische Handeln von Gruppen innerhalb der Bürokratie bzw.<br />
der vom Staat „bereitgestellten" Apparate zur Machtausübung kann anhand<br />
von Umstürzen, Staatsstreichen <strong>und</strong> Revolten besonders eindringlich vor<br />
Augen geführt werden:<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Allgemein betrachtet, gab es zumindest zwei größere Bürokratisierungsschübe;<br />
der erste fand gegen Ende des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts mit der Konsolidierung<br />
der Kolonialverwaltung bzw. der Einführung eines „modernen"<br />
Staatswesens statt. Der zweite Schub läßt sich nach wesentlichen politischen<br />
Ereignissen feststellen: z.B. der thailändischen Revolution von 1932,<br />
die zur Einführung der konstitutionellen Monarchie führte, der Unabhängigkeit<br />
Indonesiens mit dem Ende der 300-jährigen holländischen Kolonialherrschaft<br />
1945-47 <strong>und</strong> der malaysischen Unabhängigkeit zehn Jahre später.<br />
Daraus wird deutlich, daß ein erfolgreicher Unabhängigkeitskampf<br />
oder eine Revolution für bestimmte Gruppen im Verwaltungsapparat selbst<br />
ganz erhebliche positive Folgen hatte. Stellen in der Bürokratie wurden<br />
durchweg als Belohnung für die Unterstützung der neuen revolutionären<br />
Regierung vergeben, d.h. eine Umverteilung des Staatshaushalts von Infrastruktur<br />
<strong>und</strong> Entwicklungsmaßnahmen auf Beamtengehälter fand statt.<br />
Beispiel<br />
Thailand:<br />
Die sog. Revolution von 1932 in Thailand, die anstelle der absoluten Monarchie<br />
eine konstitutionelle setzte, war ganz klar das Resultat strategischen<br />
Handelns innerhalb der Bürokratie. Trotz der Modernisierung der Verwaltung<br />
unter dem Innenminister Prinz Damrong Ende des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
waren die führenden Positionen (die natürlich auch die einträchtigsten<br />
waren) immer noch dem Sakdina-Adel vorbehalten. Andererseits war der<br />
nichtadelige Teil der Bürokratie, der durch die Modernisierung geschaffen<br />
<strong>und</strong> stark ausgeweitet worden war, in den 20er Jahren von einem<br />
Schrumpfungsprozeß bedroht <strong>und</strong> zu Beginn der 30er Jahre zusätzlich<br />
durch starke Schwankungen verunsichert. Dieser Teil der Bürokratie revoltierte<br />
daher gegen seinen Schöpfer, die absolute Monarchie: die Träger<br />
dieser „Revolution" ohne Unterstützung des Volkes waren höhere Beamte<br />
<strong>und</strong> Offiziere.<br />
Diese Gruppen konnten dadurch nicht nur die Bedrohung durch Stellenabbau<br />
verhindern, sondern zugleich zusätzliche wichtige Positionen einnehmen.<br />
Die Politik danach zeigt dies eindeutig. Nicht nur steigt die Zahl<br />
der vom Staat Beschäftigten deutlich an, auch die Wirtschaftspolitik ändert<br />
sich. Sie verfolgt nun den Aufbau einer staatlichen bzw. staatlich kontrollierten<br />
Industrie. Dadurch sollten die Staatsrevenuen verbessert werden<br />
<strong>und</strong> das private (nicht selten in chinesischen Händen befindliche) Unternehmertum,<br />
das vorher eng mit dem Sakdina-Adel kooperierte, sollte<br />
unter Druck gesetzt werden. Es folgt eine Periode staatlich gelenkter Industrialisierung,<br />
die Periode des sog. „bürokratischen Kapitalismus". Diese<br />
Periode erlebt eine Neustrukturierung der Bürokratie in einer Weise, die es<br />
einer Gruppe von „Parvenues" erlaubt, einträgliche Positionen in der Wirtschaft<br />
einzunehmen bzw. Kontrolle über die Wirtschaft auszuüben.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Ein Vergleich strategischen Handelns einer bestimmten Gruppe im Zentrum<br />
der Bürokratie, nämlich der Ministerialbürokratie <strong>und</strong> der Armeeführung<br />
in Thailand, Malaysia <strong>und</strong> Indonesien zeigen deutlich, wie nach einer<br />
„gleichen" strukturellen Ausgangslage doch gr<strong>und</strong>verschiedene Strategien<br />
verfolgt wurden. Die Thai-Bürokraten (ursprünglich organisiert in der sog.<br />
Volkspartei) verschafften sich Zugang zu privaten Einkünften, indem sie<br />
sich in Abstimmung mit chinesischen Unternehmern zu stillen Teilhabern<br />
thailändischer Firmen machen ließen.<br />
In Malaysia griffen höhere Beamte selbst zur Tat:<br />
Als sich herausstellte, daß ein Eindringen in die chinesische Geschäftswelt<br />
aufgr<strong>und</strong> deren numerischer Stärke nicht möglich war, wurden Staatsunternehmen<br />
gegründet (z.B. die staatliche Bank Bumiputra, die Handelsgesellschaft<br />
Mara, die Ölgesellschaft Petronas <strong>und</strong> viele andere). In diesen Unternehmen,<br />
die parallel <strong>und</strong> in Konkurrenz zum privaten Sektor arbeiteten,<br />
wurden Direktorenposten <strong>und</strong> Aufsichtsräte vornehmlich mit malaysischen<br />
Beamten <strong>und</strong> Politikern besetzt.<br />
In Indonesien wurden nach 1956 zunächst ähnliche Strategien verfolgt.<br />
Nach 1965 sind jedoch Beamte <strong>und</strong> vor allem Offiziere neben ihrer<br />
Tätigkeit in der Bürokratie auch ins Privatgeschäft eingestiegen <strong>und</strong> haben<br />
sich als Unternehmer oder Großgr<strong>und</strong>besitzer betätigt. Dabei allerdings<br />
setzten sie chinesische Großkaufleute als „Berater" (indonesisch: cukong)<br />
ein. Diese Nutzung recht heterogener Einkommensquellen, beispielsweise<br />
die private Nutzung „öffentlicher" Institutionen, als Basis <strong>und</strong> Bedingung<br />
für den privilegierten Einstieg in die Privatwirtschaft <strong>und</strong> zur vorteilhaften<br />
Erlangung von Gr<strong>und</strong>besitz in kominierter Form nennen wir den Prozeß<br />
der „Hybridisierung" strategischer Gruppen.<br />
Nicht der Besitz an Produktionsmitteln oder ein irgendwie gearteter<br />
ökonomischer Zustand ist für die Konstitution strategischer Gruppen ausschlaggebend.<br />
Vielmehr zeigt unsere Analyse, daß strategische Gruppen<br />
nicht durch eine eindeutig bestim<strong>mb</strong>are soziale Lage gekennzeichnet sind.<br />
Sie werden vielmehr durch ein gemeinsames Interesse konstituiert, durch<br />
entsprechendes strategisches Handeln eine solche Lage erst zu schaffen<br />
<strong>und</strong> abzusichern.<br />
Hybridisierung strategischer Gruppen:<br />
Die Mitglieder strategischer Gruppen befinden sich nicht in einer eindeutigen<br />
sozialen Lage. Um eine einmal errungene Position abzusichern<br />
bzw. die eigene Lage zu verbessern <strong>und</strong> weiter auszubauen, haben strategische<br />
Gruppen die Tendenz, auf andere Bereiche überzugreifen. Diese fast<br />
zwangsläufige <strong>und</strong> oft gegen ursprüngliche Intentionen verlaufende Entwicklung<br />
berührt die Interessen anderer strategischer Gruppen. Dies kann<br />
sowohl zu Konflikten als auch zur Interessenkonvergenz <strong>und</strong> zur Koalition<br />
führen. Das Beispiel der Ministerialbürokraten in Thailand, Malaysia <strong>und</strong><br />
Indonesien zeigt sowohl Fälle von Parallelität (schwache Hybridisierung)<br />
wie solche von Sy<strong>mb</strong>iose. Letzteres heißt aber, daß die Hybridisierung in<br />
die Entstehung einer neuen Klasse umschlagen kann. Hybridisierung läutet<br />
also möglicherweise den Bildungsprozeß einer neuen Klasse ein.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Klassenbildung:<br />
Die vielen Autoren bekannte, aber selten erklärte „Heterogenität" strategischer<br />
Gruppen führt dazu, daß eine Klassenanalyse im herkömmlichen<br />
Sinne, <strong>und</strong> zwar im marxistischen wie auch im traditional-soziologischen<br />
Sinne, schlicht unmöglich ist. Der von uns vorgeschlagene Ansatz hebt auf<br />
den Klassenbildungsprozeß ab, statt auf bereits bestehende <strong>und</strong> a priori<br />
postulierte Klassenstrukturen fixiert zu sein. Ob <strong>und</strong> wann sich der Klassenbildungsprozeß<br />
in einer eindeutig erkennbaren Klassenstruktur niederschlägt,<br />
wird sich erst im Laufe einer langfristigen Entwicklung zeigen. Die<br />
Vielfalt strategischer Gruppenprozesse läßt jedoch allein schon wegen der<br />
tendenziellen Hybridisierung vielfältige Möglichkeiten der Klassenbildung<br />
plausibel erschienen. Jedenfalls ist es unseres Erachtens nach unzulässig,<br />
generell die Bildung einer sog. „Staatsklasse" zu postulieren.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
ENTWICKLUNG, HEGEMONIEKRISE UND FRIEDENSFÄHIGKEIT IN<br />
DER GEGENWART<br />
Dieter Senghaas<br />
Bis zur Industriellen Revolution gab es in der Neuzeit mehrere, wenngleich<br />
brüchige Vormachtstellungen führender Mächte als Ergebnis erfolgreich erkämpfter<br />
Positionen an den Nahtstellen des weltweiten Fernhandels. Seit<br />
der Industrieilen Revolution ist Hegemoniebildung nur noch auf der Gr<strong>und</strong>lage<br />
einer jeweils überlegenen Nationalökonomie vorstellbar. Drei Faktoren<br />
begründen seitdem eine weltwirtschaftliche Spitzenstellung <strong>und</strong> den sich<br />
aus ihr ergebenden Verdrängungswettbewerb:<br />
— Die hohe Produktivität im landwirtschaftlichen, industriellen <strong>und</strong><br />
Dienstleistungssektor;<br />
— technologische Innovationen, die Leitsektoren begründen <strong>und</strong> von denen<br />
weitreichende Ausstrahlungskräfte auf die übrige Weltwirtschaft<br />
ausgehen;<br />
— schließlich organisatorische <strong>und</strong> institutionelle Innovationen, die eine<br />
Anpassung überkommener Institutionen an neue sozio-ökonomische<br />
Gegebenheiten erleichtern.<br />
Werden solche Faktoren durch eine zivilisatorische Ausstrahlungskraft der<br />
betreffenden Gesellschaft ergänzt, gewinnt eine ökonomische Vormachtstellung<br />
zusätzlichen kulturellen Flankenschutz. Noch bis vor 10-15 Jahren<br />
hatte das Bild des „American way of life" eben diese Funktion.<br />
Eine wachsende Diskrepanz zwischen dem überkommenen institutionellen<br />
Rahmen des internationalen Systems <strong>und</strong> neuen Machtlagen führt zur<br />
Krise des internationalen Systems: zur „Krise des Weltwirtschaftssystems",<br />
zur „Krise der internationalen Kommunikationsordnung", zur „Krise der<br />
Allianzen", usf. — Das Ergebnis ist eine um sich greifende Verunsicherung.<br />
Daß der Begriff der Sicherheitspolitik eine weit über die militärische Dimension<br />
hinausgehende Bedeutung gewinnt, überrascht nicht. An die Stelle<br />
einer tendenziellen ökonomischen Selbstregulierung tritt bewußte politische,<br />
im Grenzfall militärische Intervention als Mittel der Konfliktregulierung.<br />
Diese wird unausweichlich, wenn der relative Verfall einer Hegemonialposition<br />
<strong>und</strong> die Herausforderung durch nachrückende junge Hegemonialaspiranten<br />
mit einer weltwirtschaftlichen Schrumpfphase zusammenfällt<br />
<strong>und</strong> an die Stelle von Internationalismus <strong>und</strong> Kosmopolitismus Protektionismus<br />
<strong>und</strong> Nationalismus treten. Dann ist nicht mehr Interdependenz<br />
gefragt, sondern Geopolitik <strong>und</strong> Merkantilismus. Beide sind unübersehbare<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Indizien für eine verfallende Hegemonialordnung in einer weltwirtschaftlichen<br />
Abschwungphase.<br />
Wie verarbeiten die USA die Hegemoniekrise?<br />
Während der ganzen siebziger Jahre hat es nicht nur in der Publizistik, sondern<br />
auch in der Politik verschiedener Administrationen (Nixon, Ford,<br />
Carter) in den USA Ansätze zu neuen weltpolitischen Strategien gegeben.<br />
Im einzelnen waren ihre Akzente durchaus unterschiedlich, allen jedoch lag<br />
die Absicht zugr<strong>und</strong>e, den „emerging complexities" der internationalen Gesellschaft<br />
mit einer „Politik der Interdependenz" konstruktiv zu begegnen.<br />
Zerbröckelt "nach <strong>und</strong> nach die politische Kontrolle über weite Bereiche<br />
der internationalen Gesellschaft <strong>und</strong> dokumentieren dramatische Ereignisse<br />
die eigene relative Schwäche, werden überdies solche Ereignisse als Ergebnis<br />
einer durchaus vermeidbaren eigenen Willensschwäche interpretiert, dann<br />
droht die Versuchung, mit Kraftakten Ordnung schaffen zu wollen. In den<br />
USA ist mit dem ,Reaganism" die „Philosophie" der emerging complexities<br />
<strong>und</strong> der Interdependenz zu Grabe getragen worden <strong>und</strong> die geopolitische<br />
Option zum Durchbruch gekommen.<br />
Die Probleme, denen sich die USA in der Welt ausgesetzt sehen, sind<br />
nicht nur, ja nicht einmal zuallererst, das Ergebnis selbstverschuldeter<br />
Schwäche, sondern eine Folge veränderter Kräfteverhältnisse.<br />
Die Probleme einer nur militärischen Weltmacht<br />
Daß die Sowjetunion inzwischen eine Weltmachtposition einnimmt, ist unbezweifelbar.<br />
Doch sie verdankt diese Stellung nicht den klassischen Merkmalen<br />
einer klassischen Hegemonialmacht der Neuzeit. Trotz aller bemerkenswerten<br />
Aufbauleistungen nach 1917 zeichnet sich die sowjetische Ökonomie<br />
immer noch nicht durch eine Entwicklungsdynamik aus, die die weitere<br />
Entwicklungsrichtung der Weltwirtschaft mitbestimmen könnte. Im<br />
Gegenteil, mit Hilfe von Technologietransfer werden technologische Innovationen<br />
importiert; die politisch motivierte Verhinderung institutioneller<br />
Innovationen führt zu einer Art Sklerotisierung der Gesellschaft, die eine<br />
wachsende Kluft zwischen Produktivkraftentfaltung <strong>und</strong> Produktionsverhältnissen<br />
entstehen läßt.<br />
Der weltpolitische Status der Sowjetunion verdankt sich nur dem inzwischen<br />
erreichten Militärpotential. Wie in alten Weltreichen (China, Mogul,<br />
Osmanen usf.) wird die eigene Gesellschaft durch einen bürokratischen<br />
Apparat zusammengehalten, dessen Rückgrat Sicherheitsorgane <strong>und</strong> Militär<br />
sind. Das hat erhebliche Folgen. So sind vielfältige Möglichkeiten ökonomi-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
scher Selbststeuerung, die marktwirtschaftlich organisierte Konkurrenzökonomien<br />
kennzeichnen, nicht vorhanden.<br />
Das geht, wie die geschichtliche Erfahrung zeigt, lediglich solange gut,<br />
wie brachliegende Ressourcen extensiv mobilisierbar sind. Werden Ressourcen<br />
jedoch knapp <strong>und</strong> ist ein Übergang aus der extensiven Wachstumsphase<br />
in eine intensive überfällig, zeichnet sich eine Systemkrise ab.<br />
Ohne das heute verfügbare Militärpotential, das die Gr<strong>und</strong>lage <strong>und</strong> das<br />
Rückgrat des Weltmachtstatus' ausmacht, wäre die Sowjetunion als Herausforderer<br />
der USA zwar immer noch eine große Industriemacht, aber weltwirtschaftlich<br />
gesehen, genaugenommen, weniger als ein Schwellenland.<br />
Denn ein Schwellenland ist definiert durch Teilindustrialisierungsprozesse,<br />
die in einzelnen Sparten der Konsumgüterindustrie <strong>und</strong> des Maschinenbaus<br />
zu einer durchschlagenden Konkurrenzfähigkeit auf den Märkten alternder<br />
Industriegesellschaften führen. Davon kann heute, außerhalb politisch motivierter<br />
Handelsabkommen, kaum die Rede sein. Mit konkurrenzfähigen<br />
Ökonomien spielen sich die Beziehungen daher eher auf der Ebene klassischer<br />
Nord-Süd-Geschäfte ab: Rohstoffe werden gegen hochverarbeitete<br />
Fertiggüter, Maschinen <strong>und</strong> Technologie getauscht.<br />
Solange die Sowjetunion den Status einer Weltmacht anstrebt, <strong>und</strong> die<br />
einmal erreichte Position für erhaltenswert hält, ja sie auszubauen bestrebt<br />
ist, sind ihr deutlich Grenzen hinsichtlich der Verminderung ihres Militär<strong>und</strong><br />
Rüstungspotentials gesetzt. Erst der Aufbau dichter Außenwirtschaftsbeziehungen<br />
könnte hier Kompensationsmöglichkeiten schaffen; aber für<br />
einen solchen Aufbau fehlen fast alle Voraussetzungen.<br />
Gewöhnlich wird Planökonomien eine hohe administrative Flexibilität<br />
hinsichtlich ihrer Fähigkeit zugeschrieben, eine Rüstungswirtschaft auf<br />
Zivilgüterproduktion umzulenken. Auch hier sind Zweifel angebracht. Versuche<br />
der Investitionsumlenkung aus dem Schwerindustrie- <strong>und</strong> Investitionsgüterbereich<br />
in andere Sektoren, obgleich mehrfach an höchster politischer<br />
Stelle beschlossen, sind bisher im großen <strong>und</strong> ganzen gescheitert. Sie<br />
weisen auf das inzwischen erhebliche Eigengewicht der Apparate hin.<br />
Die Herrschaftsform <strong>und</strong> die von ihr geprägte Gesellschaft <strong>und</strong> Ökonomie<br />
lassen ebenso wie die militärische Eindimensionalität des Weltmachtstatus'<br />
eine eher geringe Beeinflußbarkeit der Sowjetunion von außen als<br />
wahrscheinlich erscheinen. Wenn eine Beeinflussung im Sinne einer Stärkung<br />
von Reformkräften erreicht werden soll, dann ist sie nur über eine<br />
nicht-bedrohliche Politik des Westens erreichbar. Aber selbst unter solchen<br />
heute nicht bestehenden Vorzeichen ist ihr Erfolg keineswegs sicher. Erfolg<br />
oder Mißerfolg hängen wesentlich davon ab, ob sich verdichtende Beziehungen<br />
zwischen Ost <strong>und</strong> West vor Ort politisch verkraftet werden können.<br />
Diese Problematik betrifft insbesondere Osteuropa <strong>und</strong> die Beziehungen<br />
zwischen Ost- <strong>und</strong> Westeuropa.<br />
Die Entspannungspolitik der siebziger Jahre bot der Sowjetunion Chancen,<br />
ihr Verhältnis zu Osteuropa zu normalisieren; sie hätte damit erhebliche<br />
politische Impulse auslösen können. Diese Chancen blieben ungenutzt;<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
vielmehr sollte mit untauglichen Mitteln ein brüchig gewordener Status quo<br />
noch einmal gesichert werden. Auch daran ist die Entspannungspolitik gescheitert.<br />
Man muß diesen Zusammenhang im Auge behalten, wenn Entspannungspolitik<br />
wiederbelebt werden soll. Es ist keineswegs sicher, daß<br />
eine solche Politik des Westens, die zu begrüßen wäre, nicht von der Sowjetunion<br />
als eine erhebliche gesellschaftspolitische Provokation empf<strong>und</strong>en<br />
würde, da sie in Osteuropa unter gegebenen Bedingungen absehbare destabilisierende<br />
Wirkungen hätte.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Die Autoren<br />
Günter Albrecht, Professor für Soziologie <strong>und</strong> Soziologie der Sozialarbeit, seit 1971 an<br />
der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld, Arbeitsschwerpunkte Theorie <strong>und</strong><br />
Empirie sozialer Probleme, Soziologie abweichenden Verhaltens <strong>und</strong> sozialer Kontrolle.<br />
Laszlo Alex, Dr. rer. pol., Hauptabteilungsleiter seit 1977 beim B<strong>und</strong>esinstitut für Berufsbildung,<br />
für den Bereich Strukturforschung, Planung <strong>und</strong> Statistik, davor mehrere<br />
Jahre im B<strong>und</strong>esministerium für Bildung <strong>und</strong> Wissenschaft tätig. Die Arbeitsmarkt- <strong>und</strong><br />
Berufsbildungsforschung ist seit 1968 sein hauptsächliches Arbeitsgebiet.<br />
Gotthard Bechmann, Studium der Rechtswissenschaft, Politikwissenschaft <strong>und</strong> der<br />
Soziologie, Arbeitsschwerpunkte: Planungs-, Technik- <strong>und</strong> Wissenschafts<strong>soziologie</strong>;<br />
Risikoforschung; Wertwandelforschung. Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Kernforschungszentrum<br />
Karlsruhe.<br />
Ursula Beer, Dr. phil., Studium der Politikwiss., Soziologie <strong>und</strong> Volkswirtschaft in<br />
Frankfurt, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bielefeld, Fakultät für<br />
Soziologie, im Bereich Wirtschafts<strong>soziologie</strong>/Sozialökonomie, Schwerpunkt: Frauenarbeit<br />
in Familie <strong>und</strong> Beruf.<br />
Johannes Berger ist Professor an der Soziologischen Fakultät der Universität Bielefeld.<br />
Buchveröffentlichungen: Krise <strong>und</strong> Kapitalismus bei Marx (zusammen mit V. Bader<br />
<strong>und</strong> H. Ganßmann), 2 Bände, 197'5; Einführung in die Gesellschaftstheorie (m. V. Bader<br />
u.a.), 1980, Campus Verlag.<br />
Fritz Böhle, Dr. rer. pol., Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. <strong>München</strong>.<br />
Arbeitsschwerpunkte: Zusammenhänge zwischen Entwicklungen industrieller Arbeit,<br />
sozialen Risiken <strong>und</strong> Sozialpolitik, Arbeitsschutzpolitik, Arbeits- <strong>und</strong> Berufsbildungsrecht<br />
sowie Interessenvertretung. Veröffentlichungen u.a.: Industrielle Arbeit <strong>und</strong><br />
Soziale Sicherheit (mit Norbert Altmann) 1972; Arbeitnehmerpolitik <strong>und</strong> betriebliche<br />
Strategien (mit Manfred Deiß) 1980; Verbesserung von Arbeitsbedingungen <strong>und</strong> Arbeitsmarktpolitik<br />
(mit Manfred Deiß u.a.) 1982.<br />
Hanns-Georg Brose, Dr. phil., Hochschulassistent am Institut für Soziologie der Philipps<br />
Universität Marburg. Arbeitsgebiete: Industrie- <strong>und</strong> Arbeits<strong>soziologie</strong>; Biographieforschung;<br />
Laufendes Forschungsvorhaben: Die Vermittlung sozialer <strong>und</strong> biographischer<br />
Zeitstrukturen. Publikationen: Die Erfahrung der Arbeit, Opladen 1983; (Hrsg.) Berufsbiographien<br />
im Wandel, Opladen 1985 (i. Druck); (zusammen mit L. Hack u.a., Leistung<br />
<strong>und</strong> Herrschaft, Frankfurt/N.Y., 1979).<br />
Rainer Döbert, Privatdozent an der FU Berlin. Arbeiten zur Evolution von Religion <strong>und</strong><br />
über handlungstheoretische Sozialisationstheorie.<br />
Klaus Düll, Dr. rer. pol., geb. 1936, <strong>ISF</strong> <strong>München</strong>. Arbeitsschwerpunkte: Betriebliche<br />
Arbeitskräftepolitik, technischer Wandel, Interessenvertretung der Arbeitnehmer, allgemeine<br />
industriesoziologische Probleme. Buchveröffentlichungen: Industrie<strong>soziologie</strong> in<br />
Frankreich, 1975; öffentliche Dienstleistungen <strong>und</strong> technischer Fortschritt, 1976 (zusammen<br />
mit D. Sauer, I. Schneller, N. Altmann); Grenzen neuer Arbeitsformen, 1982<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
(zusammen mit N. Altmann, P. Binkelmann, H. Stück); Industrie arbeit in Frankreich<br />
— Krisen <strong>und</strong> Entwicklungstendenzen Hrsg.), 1984.<br />
Klaus Eder war von 1971-1983 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut<br />
für Sozialwissenschaften. Seit 1983 ist er Mitglied der Münchner Projektgruppe für<br />
Sozialforschung e.V. <strong>und</strong> seit 1984 zugleich Privatdozent für Soziologie an der Universität<br />
Düsseldorf. Wichtige Veröffentlichungen: Die Entstehung staatlich organisierter Gesellschaften.<br />
Ein Beitrag zu einer Theorie sozialer Evolution. Frankfurt 197'6; Geschichte<br />
als Lernprozeß? Zur Pathogenese politischer Modernität in Deutschland. Frankfurt<br />
1985.<br />
Georg Elwert, geboren 1947, studierte Ethnologie <strong>und</strong> Soziologie an den Universitäten<br />
Mainz <strong>und</strong> Heidelberg. Promotion in Heidelberg 1973. Er führte zahlreiche Feldforschungen<br />
vor allem in Westafrika durch. Er lehrte an den Universitäten Zürich, Heidelberg<br />
<strong>und</strong> Bielefeld. Habilitation 1980 in Bielefeld in Soziologie <strong>und</strong> Sozialanthropologie.<br />
Als Heisenberg-Stipendiat arbeitete er in Bielefeld, an der Ecole des Hautes Etudes en<br />
Sciences Sociales in Paris <strong>und</strong> an der Yale University in den USA. Seit 1982 lehrt er als<br />
Professor für Soziologie an der Universität Bielefeld. 1985 erhielt er einen Ruf an die<br />
Freie Universität Berlin für das Fach Ethnologie.<br />
Adalbert Evers, Dr., arbeitet am Institut für Ausbildung <strong>und</strong> Forschung auf dem Gebiet<br />
der sozialen Wohlfahrt in Wien; Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der Sozialpolitik<br />
unter besonderer Berücksichtigung internationaler Vergleiche auf der lokalen Ebene;<br />
neuere Veröffentlichungen u.a.: Was heißt hier eigentlich sozial? (zus. mit Opielka, M.)<br />
in: Opielka, M. (Hg.): Die ökosoziale Frage, Frankfurt; zus. mit Wintersberger, H./<br />
Nowotny, H. (Hg.) 1985: Can there be a new welfare State? London; Kommunale Wohnungspolitik<br />
als Sozialpolitik, in: Krüger, J./Pankoke, E. (Hg.) 1985: Kommunale Sozialpolitik,<br />
<strong>München</strong> / zus. mit Blanke, B./Wollmann, H. (Hg.): Die zweite Stadt. Unkonventionelle<br />
Formen des Umgangs mit Arbeit <strong>und</strong> Diensten in der Kommunalpolitik.<br />
Opladen (ersch. Anfang 1986).<br />
Hans-Dieter Evers ist Professor an der Fakultät für Soziologie <strong>und</strong> Vorsitzender des Forschungsschwerpunkts<br />
Entwicklungs<strong>soziologie</strong> der Universität Bielefeld. Von 1968-1971<br />
war er Professor für Soziologie an der Yale University <strong>und</strong> von 1971-1974 Professor<br />
für Soziologie an der Universität Singapore. Seine Forschungsinteressen liegen auf<br />
dem Gebiet der Entwicklungs<strong>soziologie</strong>, in den Problemen der Klassenbildung <strong>und</strong><br />
Marktsystemen. Zu seinen Publikationen gehören u.a.: Kulturwandel in Ceylon. Baden-<br />
Baden: Lutzeyer Verlag, 1969; Monks, Priests and Peasants — A Study of Buddhism and<br />
Social Structure in Central Ceylon. Leiden: E.J. Brill, 1972; Households and the World<br />
Economy. Beverly Hills: Sage Publications, 1985 (hg. mit J. Smith <strong>und</strong> I. Wallerstein).<br />
Christian von Ferber (geb. 1926) o. Prof. für Medizinische Soziologie an der Medizinischen<br />
Fakultät der Universität Düsseldorf, Arbeitsschwerpunkte: Medizinische Soziologie,<br />
Sozialpolitik. Veröffentlichung u.a.: Soziologie für Mediziner 1975; Mitherausgeber<br />
Handbuch für Sozialmedizin, 3 Bde. 1975-1977.<br />
Wolfram Fischer, Priv.-Doz., Dr. phil., geb. 1946, Heisenberg-Stipendiat der DFG an<br />
der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld; Lehrgebiet: allgemeine Soziologie.<br />
Arbeitsschwerpunkte: phänomenologische Soziologie, qualitative Methoden, Biographieforschung,<br />
medizinische Soziologie, Religions<strong>soziologie</strong>. Habilitationsschrift: Time and<br />
Chronic Illness. A Study on the Social Constitution of Time, Berkeley 1982 (Selbstverlag).<br />
Friedhelm Gehrmann, Prof. Dr., Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Fachhochschule<br />
des B<strong>und</strong>es für öffentliche Verwaltung. — Vorsitzender der Sektion „Soziale<br />
Indikatoren" der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. — Veröffentlichungen u.a.: zusammen<br />
mit Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny (Hg.), Ansprüche an die Arbeit, Campus<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Verlag 1984; F.G. (Hg.), Von der Anspruchs- zur Verzichtgesellschaft? (erscheint im<br />
Herbst 1985 im Campus Verlag).<br />
Bernhard Giesen, geb. 1948, seit 1982 Professor für Soziologie am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften<br />
der Justus-Liebig-Universität Gießen, Nachfolge Helge Pross;<br />
1979-1983 Vorsitzender der Sektion Soziologische Theorien der Deutschen Gesellschaft<br />
für Soziologie. Wichtigste Veröffentlichungen: Die Mikro<strong>soziologie</strong>; Die Wissenschaftstheorie;<br />
Theorie, Handeln <strong>und</strong> Geschichte; eine Reihe von Aufsätzen zur<br />
soziologischen Theorie, Evolutionstheorie <strong>und</strong> zu Anwendungsproblemen der Wissenschaft.<br />
Heinz Griesbach, Dr. rer. pol., geb. 1934, Stellvertreter des wissenschaftlichen Leiters<br />
der Agrarsozialen Gesellschaft Göttingen (ASG). Seit 1969 wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
der Hochschul-Informations-System G<strong>mb</strong>H (HIS), Hannover, seit 1976 als Leiter der<br />
Abteilung „Empirische Untersuchungen, Baunutzungsplanung, Technische Versorgung".<br />
Zahlreiche Veröffentlichungen zu agrarwissenschaftlichen Themen sowie zum Verhalten<br />
von Studienberechtigten beim Ubergang von der Schule in weiterführende Ausbildungen<br />
<strong>und</strong> Erwerbstätigkeit, zum Studienverlauf <strong>und</strong> Studienverhalten von Studenten, zum<br />
Ubergang von Hochschulabsolventen ins Beschäftigungssystem.<br />
Hans Haferkamp, geb. 1939, seit 1974 Professor der Soziologie der Universität Bremen.<br />
Forschungsschwerpunkte: Theoretische Soziologie, Interaktionsforschung, Herrschafts<strong>soziologie</strong>,<br />
Soziologie der Devianz <strong>und</strong> sozialen Kontrolle. Publikationen: Soziologie als<br />
Handlungstheorie (1976 ), Kriminalität ist normal (1972), Die Struktur elementarer<br />
3<br />
sozialer Prozesse (1973), Kriminelle Karrieren. Handlungstheorie, Teilnehmende Beobachtung<br />
<strong>und</strong> Soziologie krimineller Prozesse (1975), Herrschaft <strong>und</strong> Strafrecht (1980),<br />
Soziologie der Herrschaft (1983). Arbeitet an einem Buch über soziologische Handlungstheorie.<br />
Ulf Herlyn, Prof. für Planungsbezogene Soziologie an der Universität Hannover, von<br />
1980 bis 1982 Vorsitzender der Sektion für Stadt- <strong>und</strong> Regional<strong>soziologie</strong> in der DGS;<br />
Arbeitsschwerpunkte: Stadt- <strong>und</strong> Regional<strong>soziologie</strong>, Wohnforschung. Veröffentlichungen<br />
u.a.: Wohnverhältnisse in der B<strong>und</strong>esrepublik, 2. Auflage, Frankfurt 1983 (zusammen<br />
mit Ingrid Herlyn); Großstadtstrukturen <strong>und</strong> ungleiche Lebensbedingungen, Frankfurt<br />
1980; Stadt im Wandel, Frankfurt 1982 (zusammen mit U. Schweitzer, W. Tessin<br />
<strong>und</strong> B. Lettko); außerdem weitere Aufsätze <strong>und</strong> Beiträge.<br />
Eckart Hildebrandt ist im Wissenschaftszentrum<br />
Vergleichende Gesellschaftsforschung tätig.<br />
Berlin im Internationalen Institut für<br />
Rainer Hohlfeld, Dr., geb. 1942 in Berlin, Studium der Biologie <strong>und</strong> Wissenschaftsphilosophie<br />
in Berlin, Freiburg, Tübingen <strong>und</strong> Köln, 1973 Promotion in Bakteriengenetik<br />
am Institut für Genetik der Universität Köln, 1974 bis 1980 wiss. Mitarbeiter des<br />
Max-Planck-Instituts zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlichtechnischen<br />
Welt in Starnberg. Seit 1980 Mitarbeiter des Instituts für Gesellschaft <strong>und</strong><br />
Wissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg.<br />
Christel Hopf, geb. 1942, Dr. phil., Tätigkeit am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung<br />
in Berlin, Privatdozentin am Soziologischen Institut der Freien Universität Berlin.<br />
Schwerpunkte der Tätigkeit: Erziehungs<strong>soziologie</strong>, Organisations<strong>soziologie</strong>, Methoden<br />
der empirischen Sozialforschung. Wichtigste Veröffentlichungen: zusammen mit<br />
Elmar Weingarten, 1979: Qualitative Sozialforschung; zusammen mit Knut Nevermann<br />
<strong>und</strong> Ingo Richter, 1980: Schulaufsicht <strong>und</strong> Schule; zusammen mit Knut Nevermann <strong>und</strong><br />
Ingrid Schmidt, 1985: Wie kamen die Nationalsozialisten an die Macht? Eine empirische<br />
Analyse von Deutungen im Unterricht.<br />
Martin Irle, geb. 1927, Studium der Psychologie <strong>und</strong> Soziologie an der Universität Göttingen.<br />
Dipl.-Psych. 1952, Dr. rer. nat. 1955, Habilitation 1962, seit 1964 o. Professor<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
für Sozialpsychologie an der Universität Mannheim. 1968-1983 Sprecher des SFB 24<br />
„Sozialwissenschaftliche Entscheidungsforschung". Interessenschwerpunkte: Integration<br />
kognitiver Gleichgewichts- in kognitive Lerntheorien, Beziehungen 'nomologischer'<br />
sozialpsychologischer Theorien zu Sozialtechnologien, Programm-Evaluation.<br />
Bernward Joerges ist Wissenschaftler am Internationalen Institut für Umwelt <strong>und</strong> Gesellschaft<br />
des Wisschenschaftszentrums Berlin <strong>und</strong> Professor für Soziologie an der Technischen<br />
Universität Berlin. Hauptarbeitsgebiete: Verbraucherforschung, Umweltforschung,<br />
Wissenschafts- <strong>und</strong> Technik<strong>soziologie</strong>.<br />
Dieter Keim, Prof. an der Universität Ba<strong>mb</strong>erg im Fachgebiet Sozialplanung.<br />
Horst Kern, Prof. Dr. disc. pol., Professor für Soziologie an der Universität Göttingen.<br />
Arbeitsschwerpunkte: Industrie<strong>soziologie</strong>, empirische Sozialforschung, Geschichte der<br />
Soziologie, Kultur<strong>soziologie</strong>. Veröffentlichungen (Auswahl): Industriearbeit <strong>und</strong> Arbeiterbewußtsein<br />
(mit M. Schumann), Frankfurt/M. 1970 (Studienausgabe 1977, 2. Aufl.<br />
1985); Der soziale Prozeß bei technischen Umstellungen (mit M. Schumann), Frankfurt/M.<br />
1972; Produktion <strong>und</strong> Qualifikation (gemeinsam mit M. Baethge u.a.), Frankfurt/M.<br />
1974; Kampf um Arbeitsbedingungen, Frankfurt/M. 1979; Empirische Sozialforschung:<br />
Ursprünge, Ansätze, Entwicklungslinien, <strong>München</strong> 1982; Das Ende der Arbeitsteilung?<br />
Rationalisierung in der industriellen Produktion: Bestandsaufnahme,<br />
Trendbestimmung (mit M. Schumann), <strong>München</strong> 1984, 2. Aufl. 1985.<br />
Helmut Klages, Prof. Dr., Inhaber des Lehrstuhls für Soziologie, insbesondere Organisations-<br />
<strong>und</strong> Verwaltungs<strong>soziologie</strong>, zugleich Mitglied des Forschungsinstituts für öffentliche<br />
Verwaltung. Letzte Buchveröffentlichungen: gemeinsam mit W. Herbert: Wertorientierung<br />
<strong>und</strong> Staatsbezug, Frankfurt/New York: Campus Verlag 1983, 170 S. Wertorientierungen<br />
im Wandel, Frankfurt/New York: Campus Verlag 1984, 183 S. (u.a.).<br />
Reinhard Koselleck, Jahrgang 1923, seit 1973 Professor für Theorie der Geschichte an<br />
der Universität Bielefeld.<br />
Thomas Krämer-Badoni ist Professor am Studiengang Sozialwissenschaft der Universität<br />
Bremen.<br />
Wolfgang Krohn, Jahrgang 1941, studierte Philosophie, Sozialwissenschaft <strong>und</strong> Wissenschaftsgeschichte<br />
in Ha<strong>mb</strong>urg, Göttingen <strong>und</strong> Marburg. 1969 wissenschaftlicher Assistent<br />
am Philosophischen Seminar der Universität Ha<strong>mb</strong>urg; 1971-1980 Mitarbeiter des<br />
Max-Planck-Instituts zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen<br />
Welt in Starnberg <strong>und</strong> Lehrbeauftragter der Universität <strong>München</strong>; seit 1981 Mitarbeiter<br />
des Universitätsschwerpunkts Wissenschaftsforschung der Universität Bielefeld.<br />
Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Wissenschaftsgeschichte, Wissenschafts<strong>soziologie</strong><br />
<strong>und</strong> dem Grenzgebiet von Wissenschaft <strong>und</strong> Ethik.<br />
Manfred Küchler, als Professor am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität<br />
Frankfurt derzeit beurlaubt, war von 1981-1985 zunächst als einer der wissenschaftlichen<br />
Leiter, dann als geschäftsführender Direktor beim Zentrum für Umfragen, Methoden<br />
<strong>und</strong> Analysen (ZUMA) in Mannheim tätig. Seit Anfang 1985 ist er Professor an den<br />
Departments für Soziologie <strong>und</strong> für Politische Wissenschaft der Florida State University<br />
in Tallahassee, USA.<br />
Paolo Leon, Professor für Gr<strong>und</strong>lagen der Ökonomie am Institut für Architektur der<br />
Universität von Venedig.<br />
Georg Lohmann, Jahrgang 1948, von 1978 bis 1983 wissenschaftlicher Assistent für Philosophie<br />
an der PH <strong>und</strong> FU Berlin. Forschungsschwerpunkt ist die Sozialphilosophie.<br />
Aufsätze zu Marx, Lukács <strong>und</strong> Horkheimer; zusammen mit Emil Angehrn Hrsg. von<br />
„Ethik <strong>und</strong> Marx", Königstein/Taunus 1985.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Thomas Luckmann, geb. 1927 in Jesenice (Jugoslawien). Studium der Soziologie, Philosophie,<br />
Germanistik <strong>und</strong> Psychologie in Innsbruck, Wien <strong>und</strong> New York. 1956 Ph.D.<br />
an der New School for Social Research. Lehrte u.a. an der New School for Social<br />
Research, an den Universitäten Frankfurt, Freiburg <strong>und</strong> Harvard, seit 1970 Professor für<br />
Soziologie an der Universität Konstanz. Hauptsächliche Veröffentlichungen (ohne Zeitschriftenartikel<br />
u.a.): Die <strong>gesellschaftliche</strong> Konstruktion der Wirklichkeit (mit Peter<br />
Berger, 1969), The Invisible Religion (1970), Strukturen der Lebenswelt I (mit Alfred<br />
Schütz, 1973), Sociology of Language (1975), Lebenswelt <strong>und</strong> Gesellschaft (1980),<br />
Strukturen der Lebenswelt II (mit Alfred Schütz, 1984).<br />
Kurt Lüscher, Professor an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Konstanz.<br />
Burkart Lutz, Prof. Dr. phil., geb. 1925. Nach dem Abitur (1943) durch Wehrdienst,<br />
Kriegsgefangenschaft <strong>und</strong> Berufstätigkeit mehrfach unterbrochenes Studium (Mathematik,<br />
Geschichte, Volkswirtschaft <strong>und</strong> Soziologie); Promotion 1959. Seit 1950 wissenschaftliche<br />
Tätigkeit als Übersetzer (Georges Friedmann <strong>und</strong> Jean Fourastié), verantwortlicher<br />
Mitarbeiter der industriesoziologischen Untersuchungsstelle des WWI der Gewerkschaften<br />
(1951-54) <strong>und</strong> freier Mitarbeiter von Unternehmen, Verbänden, internationalen<br />
Behörden <strong>und</strong> Forschungsinstituten (1954-1965). Seit 1965 geschäftsführender<br />
Direktor des Instituts für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. in <strong>München</strong>; seit 1967<br />
Honorarprofessor der Universität <strong>München</strong>. Seit 1983 Vors. der Deutschen Gesellschaft<br />
für Soziologie.<br />
Renate Mayntz, geb. in Berlin, Studium in den USA (B.A.) <strong>und</strong> an der FU Berlin (Dr.<br />
phil.); dort auch Habilitation. Erste Forschungstätigkeiten im UNESCO-Institut für<br />
Sozialwissenschaften Köln, später als DFG-Stipendiat <strong>und</strong> Rockefeller Fellow in den<br />
USA. 1965 Ordinarius für Soziologie an der Freien Universität Berlin, 1971 an der<br />
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. Ausländische Lehrtätigkeiten:<br />
Colu<strong>mb</strong>ia University, New York, New School for Social Research, New York, University<br />
of Edinburgh, FLASCO, Santiago de Chile, Stanford University. Seit 1973 o. Professorin<br />
an der Universität zu Köln <strong>und</strong> Direktor des Instituts für angewandte Sozialforschung.<br />
1985 Direktorin des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln, Veröffentlichungen<br />
in den Bereichen: Organisations- <strong>und</strong> Verwaltungs<strong>soziologie</strong>, Politik<strong>entwicklung</strong><br />
<strong>und</strong> Politikimplementation.<br />
Heiner Meulemann, Dr. phil., Privatdozent für Soziologie, Mitarbeiter am Zentralarchiv<br />
für empirische Sozialforschung. Arbeitsschwerpunkte: Bildungs<strong>soziologie</strong>, sozialer Wandel,<br />
Methoden der empirischen Sozialforschung. Arbeitet gegenwärtig an einer Wiederbefragung<br />
erstmals im 16. Lebensjahr befragter Gymnasiasten nach 14 Jahren 1984, in<br />
der der berufliche <strong>und</strong> private Lebensweg erhoben wurde. Veröffentlichungen: Soziale<br />
Herkunft <strong>und</strong> Schullaufbahn. Arbeitsbuch zur empirischen Sozialforschung. Frankfurt<br />
1979; Soziale Realität im Interview (gemeinsam mit K.H. Reuband als Herausgeber).<br />
Frankfurt 1984; Bildung <strong>und</strong> Lebensplanung. Frankfurt 1985; Säkularisierung <strong>und</strong> Politik.<br />
Politische Vierteljahresschrift 1985.<br />
Richard Münch, geb. 1945, ist Professor für Sozialwissenschaft an der Universität Düsseldorf.<br />
Seine Arbeitsschwerpunkte bilden die soziologische Theorie, die historisch-vergleichende<br />
Soziologie <strong>und</strong> die politische Soziologie. Seine neuesten Veröffentlichungen<br />
sind: Theorie des Handelns, Frankfurt 1982; Soziologie der Politik, Opladen 1982; Die<br />
Struktur der Moderne, Frankfurt 1984; kurz vor der Veröffentlichung steht: Die Entwicklung<br />
der Moderne, Frankfurt 1986.<br />
Rosemarie Nave-Herz, Prof. Dr., geb. 19<strong>35</strong> in Berlin; Studium der Wirtschaftswissenschaften,<br />
Soziologie, Pädagogik <strong>und</strong> Germanistik in Köln; Dipl.-Hdl., schulpraktische<br />
Ausbildung <strong>und</strong> Unterrichtstätigkeiten an kaufmännischen Berufs- <strong>und</strong> Berufsfachschulen;<br />
1963 Promotion im Fach Soziologie an der Universität Köln.<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
Friedhelm Neidhardt, Prof., Forschungsinstitut für Soziologie der Universität zu Köln<br />
— Arbeitsschwerpunkt: Allgemeine Soziologie, Familie, Gruppe, soziale Bewegungen,<br />
Wissenschaft.<br />
Hartmut Neuendorff, geb. 1940, Professor für Soziologie, insbesondere Arbeits<strong>soziologie</strong><br />
an der Universität Dortm<strong>und</strong> — Arbeitsschwerpunkte: Arbeiterbewußtsein, Arbeitsmarkt,<br />
Technik <strong>und</strong> Zukunft der Arbeit, Deutungsmusteranalyse, Theorie der Gegenwartsgesellschaft.<br />
Ulrich Oevermann ist Professor für Soziologie an der Universität Frankfurt.<br />
Eckart Pankoke, Professor für Soziologie, Universität — Gesamthochschule Essen, Arbeitsgruppe<br />
für Verwaltungs- <strong>und</strong> Wirtschafts<strong>soziologie</strong>. 1980-1984 Sprecher der Sektion<br />
„Sozialpolitik" in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Lehr <strong>und</strong> Forschungsschwerpunkte:<br />
Sozialgeschichte <strong>und</strong> Soziologiegeschichte; Sozialpolitik <strong>und</strong> Sozialverwaltung;<br />
Werner Rammert, Dr. rer. soc, Fak. f. Soziologie der Universität Bielefeld, seit 1984 Geschäftsführung<br />
<strong>und</strong> Redaktion der „Zeitschrift für Soziologie", seit 1981 Herausgeber<br />
der Jahrbücher „Technik <strong>und</strong> Gesellschaft ". Forschungstätigkeiten: Wissenschafts- <strong>und</strong><br />
Technik<strong>soziologie</strong> am USP Wissenschaftsforschung in Bielefeld <strong>und</strong> an der Northwestern<br />
University bei Chicago (1973-1975); Industrie<strong>soziologie</strong> am Soziologischen Forschungsinstitut<br />
(SOFI) in Göttingen (1975-1978); seit 1978 Organisations<strong>soziologie</strong> <strong>und</strong> sozialwissenschaftliche<br />
Technikforschung am FSP „Zukunft der Arbeit" in Bielefeld. Wichtigste<br />
Veröffentlichungen: Technik, Technologie <strong>und</strong> technische Intelligenz in Geschichte<br />
<strong>und</strong> Gesellschaß. Bielefeld 1975 f 1981 ); Einführung in die Arbeits- <strong>und</strong> Industrie<strong>soziologie</strong><br />
(mit Littek <strong>und</strong> Wachtier). Frankfurt 1982 (1983 ); Soziale Dynamik der techni<br />
2<br />
2<br />
schen Entwicklung. Opladen 1983.<br />
Barbara Riedmüller, geb. 1945, Dr. phil., Studium der Soziologie, Psychologie <strong>und</strong> Pädagogik<br />
in <strong>München</strong>. 1976 Promotion über Evolution <strong>und</strong> Krise, 1983 Habilitation ander<br />
Freien Universität Berlin. Sie ist Mitglied der Münchner Projektgruppe für Sozialforschung<br />
<strong>und</strong> lehrt als Professorin an der Universität der B<strong>und</strong>eswehr in <strong>München</strong>; seit<br />
1982 Mitherausgeberin der Zeitschrift Leviathan. Sie ist Mitglied der Sektion Frauenforschung<br />
sowie der Sektion Sozialpolitik in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie.<br />
Veröffentlichungen schwerpunktmäßig in dem Bereich Sozialpolitik.<br />
Rolf Rosenbrock, Dr. rer., Dipl.-Kfm., geb. 1945, arbeitet seit 1977 im Wissenschaftszentrum<br />
Berlin (Schwerpunkt Arbeitspolitik), zahlreiche Buch- <strong>und</strong> Zeitschriftenveröffentlichungen<br />
in den Bereichen Ges<strong>und</strong>heitspolitik <strong>und</strong> Arbeitspolitik.<br />
Fritz Sack, Prof. Dr., Universität Ha<strong>mb</strong>urg. Seit 1984 Professur für Kriminologie am<br />
Aufbau- <strong>und</strong> Kontaktstudium Kriminologie der Universität Ha<strong>mb</strong>urg. Publikationen:<br />
Monographien, Aufsätze <strong>und</strong> Reader auf dem Gebiet des abweichenden Verhaltens, sozialer<br />
Bewegungen <strong>und</strong> der Rechts<strong>soziologie</strong>.<br />
Tilman Schiel ist ein wissenschaftlicher Angestellter im Forschungsschwerpunkt Entwicklungs<strong>soziologie</strong>,<br />
Universität Bielefeld. Er beschäftigt sich mit historisch-soziologischen<br />
Entwicklungen Indonesiens.<br />
Gert Schmidt, Hochschullehrer für Soziologie (Schwerpunkt Arbeit) an der Fakultät für<br />
Soziologie an der Universität Bielefeld. Veröffentlichungen in Industrie<strong>soziologie</strong> <strong>und</strong><br />
allgemeiner Soziologie. Gesellschaftliche Entwicklung <strong>und</strong> Industrie<strong>soziologie</strong> in den<br />
USA, Frankfurt 1974; Materialien zur Industrie<strong>soziologie</strong>, in: KZfSS, 24, hg. mit HJ.<br />
Braczyk <strong>und</strong> J. v.d.Knesebeck, Opladen 1982; „Industrie<strong>soziologie</strong>" in: Handbuch der<br />
Empirischen Sozialforschung, Bd. 8, hg. von R. König, Stuttgart 1977; „Technik <strong>und</strong><br />
kapitalistischer Betrieb. Max Webers Konzept der industriellen Entwicklung <strong>und</strong> das Rationalisierungsproblem<br />
in der neueren Industrie Soziologie" in: Max Weber <strong>und</strong> die Ra-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
tionalisierung sozialen Handelns, hg. von W.M. Sprondel <strong>und</strong> K. Seyfarth, Stuttgart<br />
1984. Vorsitzender der Sektion Industrie<strong>soziologie</strong> in der Deutschen Gesellschaft für<br />
Soziologie.<br />
Rudi Schmidt, Dr. rer. pol., wisschenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie<br />
der Universität Erlangen. Beteiligt an mehreren Forschungsprojekten aus dem Bereich<br />
der Industrie- <strong>und</strong> Betriebs<strong>soziologie</strong>: zum Arbeiter- <strong>und</strong> Angestelltenbewußtsein, zu<br />
den Auswirkungen industrieller Rationalisierungsmaßnahmen; gegenwärtig mit einem<br />
Projekt befaßt, in dem die Probleme der innerbetrieblichen Umsetzung des Manteltarifvertrags<br />
zur 38-1/2-St<strong>und</strong>en-Woche in der Metallindustrie untersucht werden. Veröffentlichungen<br />
aus diesen Bereichen.<br />
Wolfgang Schulenberg, Dr. phil., gest. 1985, war Professor für Soziologie an der Universität<br />
Oldenburg, Institut für Soziologie. Arbeitsbereiche: Allgemeine Soziologie, Bildungs<strong>soziologie</strong>,<br />
Kulturpolitik.<br />
Michael Schumann, Prof. Dr. disc. pol., Direktor des Soziologischen Forschungsinstituts<br />
Göttingen (SOFI), Professor für Soziologie an den Universitäten Bremen <strong>und</strong> Göttingen.<br />
Arbeitsschwerpunkt: Industrie<strong>soziologie</strong>. Veröffentlichungen (Auswahl): Industriearbeit<br />
<strong>und</strong> Arbeiterbewußtsein (mit H. Kern), Frankfurt 1970 (Studienausgabe 1977, 2. Aufl.<br />
1985); Am Beispiel der Septe<strong>mb</strong>erstreiks — Anfang der Rekonstruktionsperiode der Arbeiterklasse?,<br />
Frankfurt/M. 1971 (mit F. Gerlach u.a.); Produktion <strong>und</strong> Qualifikation<br />
(mit M. Baethge u.a.), Frankfurt 1974; Sozialpolitik <strong>und</strong> Arbeiterinteresse, Frankfurt/M.<br />
1976 (mit M. Baethge u.a.); Rationalisierung, Krise, Arbeiter, Frankfurt/M. 1982<br />
(mit E. Einemann u.a.); Der soziale Prozeß bei technischen Umstellungen (mit H. Kern),<br />
Frankfurt/M. 1972; Das Ende der Arbeitsteilung? Rationalisierung in der industriellen<br />
Produktion: Bestandsaufnahme, Trendbestimmung (mit H. Kern), <strong>München</strong> 1984, 2.<br />
Aufl. 1985.<br />
Rüdiger Seltz arbeitet im Wissenschaftszentrum Berlin im Internationalen Institut für<br />
Vergleichende Gesellschaftsforschung.<br />
Dieter Senghaas, Dr. phil., Professor für Sozialwissenschaft mit den Schwerpunkten<br />
Internationale Politik <strong>und</strong> Internationale Gesellschaft im Fachbereich 8 (Soziologie)<br />
der Universität Bremen. Die ausführliche Version des Beitrags erschien in International<br />
(Wien), Nr. 1/1985; die Probleme einer nur militärischen Weltmacht (SU) wurden ausführlich<br />
in einem Beitrag in Friedensanalysen, Bd. 20, Frankfurt 1985 (edition suhrkamp<br />
1196) behandelt.<br />
Gerd Spittler, Professor für Soziologie an der Universität Freiburg. Arbeitsgebiete:<br />
Rechts<strong>soziologie</strong>, Politik <strong>und</strong> Verwaltung in Bauernstaaten, Wirtschaft von Bauern <strong>und</strong><br />
Nomaden. Publikationen: Norm <strong>und</strong> Sanktion (1967); Abstraktes Wissen als Herrschaftsbasis.<br />
Zur Entstehungsgeschichte bürokratischer Herrschaft im Bauernstaat<br />
Preußen (1980); Herrschaft über Bauern. Die Ausbreitung staatlicher Herrschaft <strong>und</strong><br />
einer islamisch-urbanen Kultur in Gobir (1978); Verwaltung in einem afrikanischen<br />
Bauernstaat. Das koloniale Französisch-Westafrika 1919-1939 (1981).<br />
Walter Sprondel, o. Prof. für Soziologie in Tübingen, Arbeitsgebiete: Wissens-, Religions<strong>und</strong><br />
Kultur<strong>soziologie</strong>. Veröffentlichungen: Berufs<strong>soziologie</strong>, 1972 (mit Th. Luckmann).<br />
— M. Merleau Ponty <strong>und</strong> das Problem der Struktur in den Sozialwissenschaften, 1976. —<br />
A. Schütz <strong>und</strong> die Idee des Alltags, 1979 (beide mit R. Grathoff). — M. Weber <strong>und</strong> die<br />
Rationalisierung des sozialen Handelns, 1981. — Religion <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung,<br />
1973 (beide mit C. Seyfarth).<br />
Ulrich Teichler, Geschäftsführender Direktor des Wissenschaftlichen Zentrums für Berufs-<br />
<strong>und</strong> Hochschulforschung <strong>und</strong> Professor an der Gesamthochschule Kassel. Geb.<br />
1942, Studium der Soziologie an der Freien Universität Berlin, Promotion über Bildungsexpansion<br />
<strong>und</strong> Statusdistribution in Japan. Autor bzw. Mitautor u.a. von: Hoch-<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776
schulexpansion <strong>und</strong> Bedarf der Gesellschaft (197'6), Der Arbeitsmarkt für Hochschulabsolventen<br />
(1981), Hochschulzertifikate in der betrieblichen Einstellungspraxis (1984);<br />
Herausgeber bzw. Mitherausgeber u.a. von Hochschule <strong>und</strong> Beruf (1979), Berufstätigkeit<br />
von Hochschulabsolventen (1983), Forschungsgegenstand Hochschule (1984).<br />
Helgard Ulshoefer, geb. 1945; Studium der Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialwiss. in Ha<strong>mb</strong>urg,<br />
Tübingen, <strong>München</strong>, Münster; seit 1966 in Berlin Referentin für Sozialpädagogik am<br />
Pädagogischen Zentrum; Arbeitsschwerpunkte: Situation berufstätiger Mütter <strong>und</strong> ihrer<br />
Kinder; Bildungsbeteiligung von Mädchen (Forschungsprojekte), zur Zeit: Mehr Chancen<br />
für Mädchen in der beruflichen Erstausbildung.<br />
Georg Vobruba, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wissenschaftszentrum Berlin/IIMV.<br />
Lehrbeauftragter für Soziologie an den Universitäten Frankfurt <strong>und</strong> Klagenfurt. Veröffentlichungen<br />
u.a.: Politik mit dem Wohlfahrtsstaat (1983); „Wir sitzten alle in einem<br />
Boot". Gemeinschaftsrhetorik in der Krise (Hg., 1983).<br />
Immanuel Wallerstein lehrt am University Center at Binghamton, State University of<br />
New York.<br />
Marianne Weg, Diplom-Ökonomin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Landesinstitut<br />
Sozialforschungsstelle, Dortm<strong>und</strong>, Mitglied des Fachausschusses „Status der Frau" der<br />
Deutschen UNESCO-Kommission, Arbeitsschwerpunkte: Institutionen <strong>und</strong> Konzepte<br />
der Frauenpolitik; Arbeitsmarkt- <strong>und</strong> Sozialpolitik; Mitarbeit in der „MEMORANDUM-<br />
Gruppe Alternativen der Wirtschaftspolitik"; Mitarbeit am 6. Jugendbericht „Verbesserung<br />
der Chancengleichheit von Mädchen".<br />
Ansgar Weymann, Prof. für Soziologie an der Universität Bremen.<br />
Wolfgang Zapf, geb. 1937, Studium in Frankfurt, Ha<strong>mb</strong>urg, Köln <strong>und</strong> Tübingen; Habilitation<br />
in Konstanz; Professor für Soziologie in Frankfurt 1968, in Mannheim seit 1972.<br />
Zahlreiche Veröffentlichungen zur Eliteforschung, zu Sozialem Wandel <strong>und</strong> Modernisierung,<br />
zur Sozialindikatorenforschung <strong>und</strong> Gesellschaftspolitik, u.a. Wandlungen der<br />
deutschen Elite, <strong>München</strong> 1965; Theorien des sozialen Wandels, Köln 1969, 1979 ;<br />
4<br />
Sozialberichterstattung, Göttingen 1976; Lebensbedingungen in der B<strong>und</strong>esrepublik,<br />
Frankfurt 1977; Probleme der Modernisierungspolitik, Meisenheim 1977; Lebensqualität<br />
in der B<strong>und</strong>esrepublik, Frankfurt 1984.<br />
Walther Ch. Zimmerli, Prof. Dr. phil. habil., geb. 1945 in Zürich, ist seit 1982 Leiter des<br />
Seminars B für Philosophie an der Technischen Universität Braunschweig. Seit 1984 zusätzlich<br />
Vorsitzender des Bereichs „Mensch <strong>und</strong> Technik" beim VDI (Verein Deutscher<br />
Ingenieure). Hauptforschungsgebiete: Philosophie der Wissenschaften <strong>und</strong> Technologie,<br />
Sozialphilosophie, Ethik, Ästhetik, Geschichte der modernen Philosophie, bes. der Aufklärung,<br />
des Deutschen Idealismus <strong>und</strong> der Gegenwart. Letzte Buchveröffentlichungen:<br />
(Hg.) Kommunikation — Codewort für Zwischen-Menschlichkeit (Basel/Stuttgart 1978);<br />
(Mithg.) Die 'wahren' Bedürfnisse (Basel/Stuttgart 1978); (Hg.) Kernenergie — wozu?<br />
Bedürfnis oder Bedrohung (Basel/Stuttgart 1978); (Ko-Autor) Jugend ohne Orientierung<br />
(<strong>München</strong>/Wien/Baltimore 1981, 2. Aufl. Weinheim/Basel 1983).<br />
Lutz (1984): Soziologie <strong>und</strong> <strong>gesellschaftliche</strong> Entwicklung.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100776