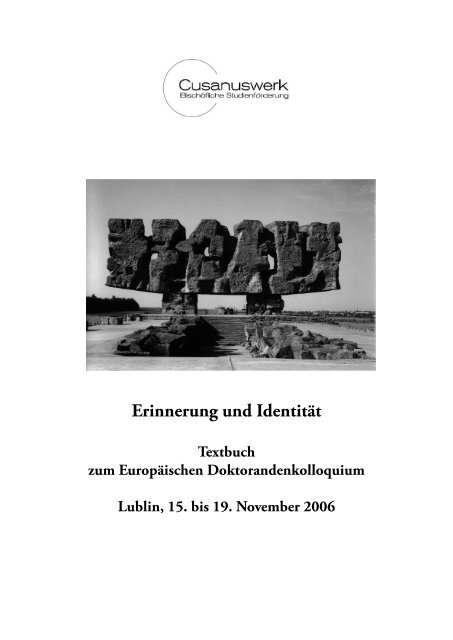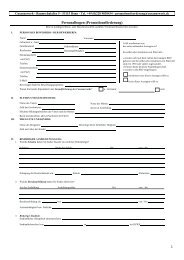Textbuch als PDF (2,6 MB) - Cusanuswerk
Textbuch als PDF (2,6 MB) - Cusanuswerk
Textbuch als PDF (2,6 MB) - Cusanuswerk
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Erinnerung und Identität<br />
<strong>Textbuch</strong><br />
zum Europäischen Doktorandenkolloquium<br />
Lublin, 15. bis 19. November 2006
<strong>Cusanuswerk</strong><br />
Bischöfliche Studienförderung<br />
Erinnerung und Identität<br />
<strong>Textbuch</strong><br />
zum Europäischen Doktorandenkolloquium<br />
Lublin, 15. bis 19. November 2006
Impressum<br />
Herausgeber<br />
<strong>Cusanuswerk</strong><br />
Bischöfliche Studienförderung e.V.<br />
Baumschulallee 5<br />
D - 53115 Bonn<br />
www.cusanuswerk.de<br />
Redaktion<br />
Dr. Stefan Raueiser, Bonn, und Benedikt Hegner, Hamburg<br />
unter Mitarbeit von Sven Keller, Augsburg, und Judith E. Luig, Berlin<br />
Druck<br />
ColognePrintCompany, Köln<br />
Dank<br />
Im Jahr 2006 begeht die Bischöfliche Studienförderung <strong>Cusanuswerk</strong> ihr 50jähriges Bestehen.<br />
Dies ist nicht nur Anlass zur Rückschau, sondern auch Herausforderung: Der Blick auf<br />
Erfahrungen aus fünf Jahrzehnten cusanischer Förderung verknüpft sich mit Perspektiven<br />
für die zukünftige Bildungsarbeit.<br />
Während sich Stipendiaten bei ihren individuell organisierten Auslandsstudien, Sprachkursen,<br />
Praktika oder Famulaturen vorwiegend für Aufenthalte in westeuropäischen Ländern<br />
entschieden haben und weiterhin entscheiden, führen die Europa gewidmeten Bildungsveranstaltungen<br />
des <strong>Cusanuswerk</strong>s vorrangig in Länder des ehemaligen Ostblocks,<br />
um die Transformationsprozesse vor Ort kennen zu lernen, und um Begegnungen mit akademischen,<br />
politischen wie kirchlichen Eliten auch an historisch sensiblen Orten zu ermöglichen.<br />
Nach Europäischen Kolloquien in Warschau (1993), Krakau (1995: „Nation und<br />
Gedächtnis“) und Lviv/Lemberg (1999: „Am Rande? Die Ukraine zwischen Rückbesinnung<br />
und Neubeginn“), unternimmt das im Deutsch-Polnischen Jahr/Rok Polsko-Niemiecki<br />
2005/06 stattfindende Doktorandenkolloquium in Lublin den Versuch, national ausgesprochen<br />
unterschiedlich ausgeprägte Memorialkulturen mit Konzeptionen gemeinsamer<br />
anamnetischer Vergegenwärtigung in Europa ins Gespräch zu bringen.<br />
Besonderer Dank gilt Katharina Wildermuth, DAAD-Lektorin am Instytut Germanistyki<br />
der Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej (UMCS), ohne die unsere Programmgestaltung<br />
in Lublin nicht möglich wäre. Danken möchten wir aber auch allen Autorinnen<br />
und Autoren der zu diesem <strong>Textbuch</strong> vereinigten Beiträge. Die Essays dokumentieren<br />
das Engagement von Cusanerinnen und Cusanern, sich mit historisch brisanten wie aktuell<br />
wirkmächtigen Fragen des europäischen Einigungsprozesses auseinanderzusetzen.<br />
(Kolloquiums)Teilnehmer wie (Text)Beiträge freuen sich auf begegnungsreiche wie diskussionsintensive<br />
Tage in Lublin.<br />
Titelbild<br />
Ehrenmal des Kampfes und Martyriums (Wiktor Tołkin, 1969).
Inhalt<br />
Kapitel I<br />
Erinnerung und Identität<br />
Dr. Stefan Raueiser<br />
Kennst du Polen? oder: Ich weiß ungefähr, wo Warschau liegt 10<br />
Katharina Wildermuth<br />
„Wir leben nicht zwischen den Welten, sondern in ihrer Mitte.“ (Karl Dedecius)<br />
Als DAAD-Lektorin in Lublin 19<br />
Dr. Simone Bell-D’Avis<br />
Am Anfang war das Wort, das erinnerte Wort 23<br />
Kondrad Schuller<br />
Ich glaube, weil ich lebe 26<br />
Kapitel II<br />
Lubliner Geschichte – Cusanische Schlaglichter<br />
Daniel Legutke<br />
Die Union von Lublin 1569 – Sonderweg polnischer Geschichte? 32<br />
Ruth Jung<br />
Zwischen Szeroka- und Krawiecka-Straße:<br />
Erinnerung an 500 Jahre jüdisches Leben in Lublin 35<br />
Sven Keller<br />
Der Distrikt Lublin während des Zweiten Weltkrieges und die Vernichtung der<br />
polnischen Juden 39<br />
Johannes R. Becher<br />
Kinderschuhe aus Lublin 45<br />
Bernward Winter<br />
Das „Lubliner Komitee“: Polnische Keimzelle des kommunistischen Staates oder<br />
„Marionettentheater“ Stalins? 50<br />
Gregor Scheffler<br />
Wettstreit der Universitäten. Die katholische Universität Jana Pawla II (KUL) und die<br />
Maria Curie-Sklodowska Universität (UMCS) in Lublin 55<br />
Sara Stroux<br />
„Lublin heute“ – Vermutungen über eine Stadt 59
Kapitel III<br />
Identität und Erinnerung – Cusanische Standpunke<br />
Elisabeth Suntrup<br />
Deutsch-Polnische Begegnungen:<br />
Lauter Klippen, Hürden, Stolpersteine? 64<br />
María Teresa Quirós-Fernández<br />
Wer nicht erinnern will, muss wiederholen? 69<br />
Agnieszka Gryz-Männig<br />
Wypędzeni ze Wschodu. Niemcy i Polacy pamiętają inaczej.<br />
Vertrieben aus dem Osten. Deutsche und Polen erinnern (sich) anders. 73<br />
Julia Bürger<br />
Liegt die Mitte ostwärts? – Deutsche und Polen in Europa 79<br />
Judith Wellen<br />
Polnische Großstadt in Deutschland untergetaucht!<br />
Eine Spurensuche auf den Fährten einer „unsichtbaren“ Migrantengruppe 84<br />
Kapitel IV<br />
Polnische Persönlichkeiten – Cusanische Perspektiven<br />
Heiner Tschochohei<br />
Leszek Balcerowicz – Pole durch und durch oder ökonomischer Metropolit? 90<br />
Olaf Schweisthal<br />
Nikolaus Kopernikus 94<br />
Jorma Daniel Lünenbürger<br />
Juliusz Zarębski – ein Kosmopolit im Schatten Chopins 97<br />
Koralia Sekler<br />
Janusz Korczak – der polnische Pestalozzi 101<br />
Melitta Naumann-Godó<br />
Marie Sklodowska-Curie<br />
Ein Leben für die Wissenschaft 106<br />
Magdalena Hoffmann<br />
Lech Wałęsa – Vom Helden der Demokratisierung zum<br />
Exzentriker der Demokratie 110
Judith E. Luig<br />
„Diese Menschen – das ist Polen“ 115<br />
Anne Kraume<br />
Joseph Conrad (d .i. Józef Teodor Konrad Korzeniowski)<br />
und das „Herz der Finsternis“ 120<br />
Clemens Bohrer<br />
Schwierigkeiten bei der Missionierung des Weltraums<br />
Anstöße für die Theologie in der Science-Fiction-Literatur<br />
von Stanislaw Lem 124<br />
Mechthild Barth<br />
Wer ist Maciek? 127<br />
Maria Karger<br />
Witold Gombrowicz und der Antiroman 130<br />
Monika Mann<br />
„Wie leben?“ – Zur Bedeutung und Ethik des Erinnerns bei<br />
Cesław Miłosz und Wisława Symborska 134<br />
Stefanie Manthey<br />
Cinématographie engagée – Polnisches Kino 140<br />
Julian Hanich<br />
Teuflische Einbildungen. Der polnische Regisseur<br />
Roman Polanski und die Imagination des Bösen 147<br />
Michael Lentze<br />
Klaus Kinski 151<br />
Sebastian Maly<br />
Dramatische Theologie in Innsbruck – der europäische Theologe Jozéf Niewiadomski 153<br />
Gabriela Biesiadecka<br />
Happy Birthday – Karl Dedecius zum 85. Geburtstag<br />
Karl Dedecius – Wszystkiego najlepszego z okazji 85-tych urodzin 158<br />
Programm 162
Kapitel I<br />
Erinnerung und Identität
Kennst du Polen?<br />
oder: Ich weiß ungefähr, wo Warschau liegt<br />
von Dr. Stefan Raueiser<br />
„Kennst du Polen?“ fragte sie. „Warst du schon mal hier?“<br />
Sie drehte sich eine Zigarette, und er goß ihnen Wasser<br />
nach, schüttelte den Kopf.<br />
„Ich weiß ungefähr, wo Warschau liegt.“<br />
„Es ist komisch“, sagte Lucilla. „Jeder unserer Leute lernt<br />
in der Schule alles über Deutschland: Geographie, Geschichte,<br />
Kultur. Aber für die meisten Deutschen sind wir<br />
ein weißer Fleck im Kopf. Sie fahren über die Grenze,<br />
kaufen unser billiges Benzin, den Wodka und die Zigaretten<br />
auf, vögeln unsere billigen Nutten und reißen sich die<br />
besten Grundstücke für ihre Flutlichtfarmen unter den<br />
Nagel - aber sie kennen unser Land nicht. Wie kommt<br />
das?“<br />
DeLoo zog die Mundwinkel herab. Mit den Fingern<br />
fischte er die Reste des Salats aus der Schüssel. „Vermutlich<br />
liegt es zu nah.“<br />
Ralf Rothmann, Hitze (Roman, Suhrkamp 2003)<br />
Vielleicht besteht eine der überraschendsten<br />
Erfahrungen deutscher Studierender<br />
in ihren ersten Begegnungen mit<br />
polnischen Kommilitonen darin, dass das so<br />
nahe liegende Nachbarland das fremdeste,<br />
das für viele unbekannte, wirkliche „terra<br />
incognita“ ist. Die Bischöfliche Studienförderung<br />
schickt sich mit dem Europäischen<br />
Doktorandenkolloquium in Lublin daher<br />
an, Stipendiatinnen und Stipendiaten Begegnungen<br />
in der Mitte Europas zu ermöglichen,<br />
um den in Deutschland und Polen<br />
höchst unterschiedlichen Stellenwert von<br />
„Erinnerung und Identität“ im Umgang mit<br />
der eigentlich gemeinsamen, in Wirklichkeit<br />
jedoch <strong>als</strong> trennend erlebten europäischen<br />
Nachbarschaftsgeschichte zu thematisieren.<br />
Auch wenn „Europa“ kein originär<br />
christliches Projekt ist, so haben junge Katholiken<br />
allen Grund, sich um diesen Aspekt<br />
europäischer Memorialkultur zu kümmern,<br />
gehören sie doch einer Kirche an, die<br />
sich auf der einen Seite <strong>als</strong> Einheit über alle<br />
nationale Grenzen hinweg versteht, die aber<br />
gleichzeitig ausgesprochen eng mit den diversen<br />
nation<strong>als</strong>taatlichen Geschichten wie<br />
Kulturen in Europa verwoben ist.<br />
10
„Wir halten es für unsere Pflicht“, formulierten<br />
europäischer Laienvertreter aus<br />
Ost und West, die Anfang Oktober vergangenen<br />
Jahres unter der Ägide des Zentralkomitees<br />
der deutschen Katholiken<br />
(ZdK) und der Semaines Sociales de France<br />
zu einem Gedankenaustausch über die Perspektiven<br />
Europas nach dem Scheitern des<br />
Verfassungsvertrags in der Nähe der slowakischen<br />
Hauptstadt Bratislava zusammengekommen<br />
waren, „konstruktive Ideen zu<br />
entwickeln, die dazu beitragen, dass Europa<br />
die Aufgaben wahrnimmt, die seiner Berufung<br />
entsprechen: wirtschaftlichen Fortschritt,<br />
sozialen Zusammenhalt und Schutz<br />
der Umwelt auf dem gesamten Kontinent<br />
voranzubringen, Gerechtigkeit und Solidarität<br />
zu fördern, und - auf europäischer<br />
wie internationaler Ebene - sich um die Festigung<br />
des Friedens und der Gerechtigkeit<br />
im aktuellen Kontext der Globalisierung<br />
zu bemühen“ (vgl. www.zdk.de/pressemeldungen/meldung.php?id=310&page=4).<br />
Welche Perspektiven verbinden cusanische<br />
Stipendiaten<br />
in ihrer Examensphase<br />
oder<br />
Promotion mit der<br />
Idee Europas? Wie<br />
lassen sich die fundamentalen<br />
Sorgen<br />
um „die Würde<br />
der Person, die<br />
Zukunft der Familie,<br />
Gerechtigkeit<br />
und Solidarität,<br />
die Sicherung des<br />
Friedens und die<br />
menschenwürdige Gestaltung der Globalisierung“<br />
(ebd.) mit den derzeitigen euroskeptischen<br />
Besorgnissen der nation<strong>als</strong>taatlichen<br />
Öffentlichkeiten versöhnen und ein<br />
Klima des gegenseitigen Vertrauens (wieder)<br />
herstellen?<br />
Historische Versöhnung<br />
Die Begegnung cusanischer Stipendiaten<br />
mit polnischen Kommilitonen in Lublin<br />
findet Mitte November 2006 statt - und<br />
damit nicht nur zum Ende des Deutsch-<br />
Polnischen Jahres/Rok Polsko-Niemiecki<br />
2005/06, sondern auch 41 Jahre nach dem<br />
historischen Briefwechsel zwischen dem<br />
polnischen und dem deutschen Episkopat.<br />
Luden die polnischen Bischöfe doch<br />
am 18. November 1965, kurz vor Ende des<br />
Zweiten Vatikanischen Konzils, ihre deutschen<br />
Amtskollegen zur Tausend-Jahr-Feier<br />
der Christianisierung Polens mit wahrhaft<br />
historisch zu nennenden Worten ein:<br />
„In diesem allerchristlichsten und zugleich<br />
sehr menschlichen Geist strecken wir unsere<br />
Hände zu Ihnen hin in den Bänken<br />
des zu Ende gehenden Konzils, gewähren<br />
Vergebung und bitten um Vergebung“. Die<br />
polnischen Bischöfe - unter ihnen der lange<br />
Zeit in Lublin residierende polnische Kardinal-Primas<br />
Stefan Wyszyński und der damalige<br />
Krakauer Erzbischof Karol Wojtyła<br />
- gedachten mit dieser Formulierung nicht<br />
nur des Leidens der Polen durch die deutsche<br />
Okkupation während des Zweiten<br />
Weltkriegs, sondern thematisierten damit<br />
auch erstm<strong>als</strong> öffentlich die Schuld von Polen<br />
an deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen<br />
nach dem Krieg. Für viele Polen war<br />
dies ein psychischer<br />
Schock: Warum<br />
sollten die Opfer<br />
die Täter um Vergebung<br />
bitten?<br />
Die deutschen<br />
Bischöfe (der alten<br />
Bundesrepublik wie<br />
damaligen DDR)<br />
griffen in ihrem<br />
Antwortschreiben<br />
Wiktor Tołkin, Ehrenmal des Kampfes und Martyriums,<br />
zwei Wochen später<br />
- weil der Kölner<br />
1969<br />
Erzbischof, Joseph Kardinal Frings, zu diesem<br />
Zeitpunkt bereits vom Konzil abgereist<br />
war, lag der Brief eine Woche lang unbeachtet<br />
in Rom, so dass die Antwort nach Auskunft<br />
des Hildesheimer Altbischofs Josef<br />
Homeyer später innerhalb weniger Stunden<br />
formuliert werden musste - die dargebotenen<br />
Hände „mit brüderlicher Ehrfurcht“<br />
auf („Furchtbares ist von Deutschen und<br />
im Namen des deutschen Volkes dem polnischen<br />
Volk angetan worden. [...] So bitten<br />
auch wir zu vergessen, ja wir bitten zu<br />
verzeihen“), doch blieb der Notenwechsel<br />
zwanzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg<br />
politisch hoch brisant: Die kommu-<br />
11
nistische Regierung in Polen warf der kath.<br />
Kirche „Vaterlandsverrat“ vor, die Bischöfe<br />
der DDR mussten sich vor dem SED-Regime<br />
rechtfertigen und aus der Bevölkerung<br />
in der Bundesrepublik erschollen zahlreiche<br />
kritische Stimmen. Im vergangenen Jahr<br />
äußerten beide Bischofskonferenzen in ihrer<br />
gemeinsamen Erklärung zum 40. Jahrestag<br />
dieses denkwürdigen Briefwechsels<br />
ihre Besorgnis, dass im Zuge der „Erinnerung<br />
an die finstersten Stunden unserer gemeinsamen<br />
Geschichte“ erneut der „Ungeist<br />
des Aufrechnens“ Einzug halten könnte.<br />
ihre Meinung äußern“ (Dorota Simonides,<br />
Wie es den Polen mit den Deutschen geht?<br />
in: zur debatte 1/2006, 33f). Die volle Achtung<br />
des polnischen Kirche errang dagegen<br />
die bereits am 1. Oktober 1965 von evangelischer<br />
Seite veröffentlichte Erklärung „Die<br />
Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des<br />
deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn“,<br />
die sog. Ostdenkschrift der EKD, sowie<br />
das ein paar Monate später in der Akademie<br />
in Bensberg verfasste (und von Joseph<br />
Ratzinger mit unterzeichnete) „Memorandum<br />
der deutschen Katholiken in der Frage<br />
der deutsch-polnischen Verhältnisse“: „Diese<br />
zwei Dokumente wurden in Polen <strong>als</strong> die<br />
wahre Meinung der deutschen Christen betrachtet<br />
und bewirkten eine wesentliche Intensivierung<br />
der deutsch-polnischen Kontakte“<br />
(Dorota Simonides, aaO.).<br />
Aktuelle Konfliktfelder<br />
Andrzej Pagowski, Wir wollen<br />
in der Union leben, 2003<br />
Quelle: http://www.posterpage.<br />
ch/exhib/ex152pag/ex152pag.<br />
htm<br />
Deutsche und Polen dürften ihre geistigen<br />
und materiellen Kräfte jedoch niem<strong>als</strong> wieder<br />
gegeneinander richten, sondern seien<br />
aufgerufen, „sie zum Wohle aller in das zusammenwachsende<br />
Europa einzubringen<br />
und dessen christliche Identität zu stärken“.<br />
Es gehe darum, „unseren Kontinent im<br />
christlichen Sinne auch für die künftigen<br />
Generationen <strong>als</strong> Lebensort zu gestalten, der<br />
die unveräußerliche Würde und die wahre<br />
Freiheit der Menschen achtet und gewährleistet“<br />
(vgl. „40 Jahre deutsch-polnische<br />
Versöhnungsschreiben“, in: Herder Korrespondenz<br />
59 (11/2005), 549-551).<br />
Von polnischer Seite hören wir, dass die<br />
späte Antwort des deutschen Episkopats<br />
nicht wenige katholische Kreise enttäuschte,<br />
weil die Kommunikationsstruktur <strong>als</strong> asymmetrisch<br />
empfunden wurde: „Die polnischen<br />
Bischöfe riskierten mit ihrem Brief<br />
die Freiheit oder sogar ihr Leben, .. die deutschen<br />
Bischöfe dagegen walteten in demokratischen<br />
Verhältnissen und konnten frei<br />
Gerade die im polnischen Wahlkampf<br />
2005 geäußerten abwartenden Aussagen gegenüber<br />
Deutschland wie auch zur Europäischen<br />
Union haben gezeigt, dass die in<br />
den letzten Jahren nicht immer einfachen<br />
deutsch-polnischen Beziehungen mit den<br />
Regierungswechseln in Warschau wie Berlin<br />
wiederum vor neuen Herausforderungen<br />
stehen. Neben dem jüngst veröffentlichten<br />
Geständnis des Danziger Ehrenbürgers<br />
Günter Grass, Mitglied der Waffen-SS gewesen<br />
zu sein, und der aktuellen Ausstellung<br />
„Erzwungene Wege“ im Berliner Kronprinzenpalais,<br />
heißen die Reizthemen vor<br />
allem „Zentrum gegen Vertreibungen“ und<br />
Einforderung von Reparationsleistungen<br />
durch die sog. „Preußische Treuhand“. Ins<br />
Stocken geraten ist darüber auch die von der<br />
ehemaligen Kulturstaatsministerin Christina<br />
Weiss favorisierte und von den Kultusministern<br />
Deutschlands, Polens, der Slowakei<br />
und Ungarns beschlossene Idee des<br />
grenzüberschreitenden Zusammenschlusses<br />
wissenschaftlicher Einrichtungen, Institutionen<br />
und Museen zu einem „Europäischen<br />
Netzwerk Erinnerung und Solidarität“,<br />
um sich dem Thema Vertreibung im<br />
(mittel)europäischen Maßstab zu stellen.<br />
Der Vorschlag von Kulturstaatsminister<br />
Bernd Neumann, die im Bonner Haus der<br />
Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-<br />
12
land (HdG) konzipierte, aktuell im Deutschen<br />
Historischen Museum (DHM)<br />
gezeigte und anschließend in das Zeitgenössische<br />
Forum Leipzig auf Wanderschaft<br />
geschickte Ausstellung „Flucht, Vertreibung,<br />
Integration“ in Kooperation mit den<br />
im „Europäischen Netzwerk“ engagierten<br />
Ländern zu ergänzen und zum „Herzstück<br />
einer künftigen Dauerausstellung“ in Berlin<br />
zu machen, zeigt einen neuen - vielleicht<br />
verbindenden - Weg auf, liegt doch das<br />
Schwergewicht der Bonner Schau auf der in<br />
Deutschland weithin geglückten Geschichte<br />
der Integration von Flüchtlingen - während<br />
die von der „Stiftung Zentrum gegen<br />
Vertreibungen“ initiierte Schau „Erzwungene<br />
Wege“ die Vertreibung Deutscher aus<br />
dem heutigen Polen, dem Baltikum und der<br />
Tschechoslowakei neben dreizehn anderen<br />
Beispielen von ethnischen Vertreibungen<br />
aus der europäischen Geschichte darstellt.<br />
Ob sich beide Unternehmungen zu einem<br />
Ganzen zusammenfügen lassen, um die bereits<br />
heute ausdifferenzierte Berliner Gedenkstättenlandschaft<br />
(neben dem zentralen<br />
Holocaust-Mahnmal, der „Topographie<br />
des Terrors“, der Wannsee-Villa, der Gedenkstätte<br />
Deutscher Widerstand und der<br />
Neuen Wache) um einen Raum für die Erinnerung<br />
an das Schicksal der Vertriebenen<br />
zu erweitern, bleibt allerdingsabzuwarten.<br />
Grundsätzlich fällt auf, dass sich deutsche<br />
wie polnische Regierungspolitiker bei<br />
offiziellen Anlässen geradezu rituell versichern,<br />
dass das Verhältnis beider Staaten<br />
ausgezeichnet sei - doch klingt dies oftm<strong>als</strong><br />
eher nach Beschwörung, denn nach einer<br />
realitätsnahen Beschreibung der deutschpolnischen<br />
Beziehungen, und dies, obwohl<br />
es aktuell keine Verstimmung zwischen den<br />
Regierungen gibt, auch wenn Berlin und<br />
Warschau in der Vergangenheit in manchen<br />
Angelegenheiten unterschiedlicher Auffassungen<br />
waren (wie z.B. in Bezug auf den<br />
Irak-Krieg, die europäische Verfassung oder<br />
das EU-Budget). Gegeneinander stehen<br />
heute vor allem private, öffentliche wie veröffentlichte<br />
Meinungen - und immer geht<br />
es dabei um die Erinnerung an die jüngste<br />
Vergangenheit, dreht sich die Debatte um<br />
die Frage, wer (nicht zuletzt finanzielle) Ansprüche<br />
aus der Geschichte herleiten kann,<br />
und ob die Deutschen die Geschichte des<br />
Zweiten Weltkriegs neu schreiben wollten,<br />
damit unkenntlich werde, wer Täter und<br />
wer Opfer gewesen sei. Wie anders ist es<br />
zu erklären, dass auf das (in Deutschland<br />
ohne politische Unterstützung agierende)<br />
Unternehmen eines privaten Vereins mit<br />
dem hochtrabenden Namen „Preußische<br />
Treuhand“, Wiedergutmachungs-Ansprüche<br />
deutscher Vertriebener geltend machen<br />
zu wollen, eine hochoffizielle polnische Parlamentsresolution<br />
antwortet, die sich dafür<br />
einsetzt, Deutschland gegenüber angeblich<br />
noch ausstehende Reparationsleistungen<br />
einzufordern?<br />
Gerade die polnischen Zwillingsbrüder<br />
Kaczynski - Lech <strong>als</strong> Präsident Polens und<br />
Jarosław <strong>als</strong> Vorsitzender der national-konservativen<br />
Partei „Recht und Gerechtigkeit“<br />
(PiS) und derzeitiger Ministerpräsident -<br />
haben in der Vergangenheit mit ebenso populistischen<br />
wie deutlich nationalen Tönen<br />
à la „Polen zuerst“ die diplomatische Bühne<br />
irritiert und verfolgen offenbar das Projekt<br />
einer „moralischen Erneuerung“ ihres<br />
Landes, was vor allem vom umstrittenen<br />
(und mittlerweile auch vom Vatikan getadelten)<br />
Sender Radio Maryja unterstützt<br />
wird. Der polnische Publizist Jarosław Makowski<br />
spricht in diesem Zusammenhang<br />
von einem „soften Fundamentalismus,<br />
der verbunden mit dem ‚Traum von einer<br />
moralischen Revolution‘, einem ‚Kreuzzug‘<br />
gleich, eine neue, vierte Republik, katholisch<br />
und geläutert, auferstehen lassen<br />
möchte“ (Ulrike Kind, Der Kurs der Zwillinge.<br />
Polen nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen,<br />
in: Herder Korrespondenz<br />
60 (2/2006), 102 - 106).<br />
Ein christliches Europa?<br />
Ein weiteres europapolitisches Konfliktfeld<br />
in den deutsch-polnischen Beziehungen<br />
eröffnet die Diskussion um eine<br />
Europäische Verfassung: Während sich<br />
Berlin für eine Neubelebung des in zwei<br />
Gründungsstaaten der EU durch das Volk<br />
abgelehnten Vertragswerks einsetzt, haben<br />
führende polnische Politiker bereits den<br />
endgültigen Tod dieses Dokuments erklärt<br />
- unterschiedliche Positionierungen,<br />
die sich auch in divergierenden Einschät-<br />
13
zungen in Bezug auf die Präambel ausfalten<br />
lassen: Während der Verfassungsvertrag<br />
bewusst auf einen Gottesbezug verzichtet<br />
und lediglich das „kulturelle, religiöse und<br />
humanistische Erbe“ Europas in seiner Präambel<br />
anspricht, ohne das Christentum <strong>als</strong><br />
entscheidenden Bestandteil dieses Erbes<br />
ausdrücklich zu nennen, hat „der polnische<br />
Papst“ Johannes Paul II. Europa unermüdlich<br />
an seine christlichen Wurzeln erinnert<br />
und dazu aufgerufen, den Geist des Evangeliums<br />
auf dem „alten“ Kontinent lebendig<br />
zu halten. Auch sein deutscher Nachfolger<br />
hat nicht nur mit seiner Namenswahl - die<br />
mit Benedikt von Nursia, den Vater des<br />
westlichen Mönchtums und „Patron Europas“,<br />
an eine der prägendsten Gestalten für<br />
die Herausbildung des christlichen Abendlandes<br />
erinnert - vor den Gefährdungen<br />
eines von seinen christlichen Wurzeln abgeschnittenen,<br />
in seiner kulturell-religiösen<br />
Identität beschädigten Europas gewarnt.<br />
Nach der jüngsten Audienz der (protestantischen)<br />
Bundeskanzlerin in Castel Gandolfo<br />
scheint eine Annäherung zwischen<br />
deutschen, polnischen wie vatikanischen<br />
Positionen jedochnicht mehr gänzlich ausgeschlossen<br />
zu sein.<br />
Auch wenn die katholische Christenheit<br />
in Europa keinen geschlossenen Block<br />
darstellt (in Deutschland hat das Christentum<br />
traditionell eine konfessionelle Doppelstruktur,<br />
während der Katholizismus in Polen<br />
stark durch die Verbindung zur Nation<br />
charakterisiert ist) und es eine konfessionsübergreifend<br />
christliche Position zu Europa<br />
nicht gibt, so dass die europäische Dimension<br />
des gemeinsamen Christ- wie Kirche-<br />
Seins beim „Durchschnittsgläubigen“ (viel<br />
zu) wenig im Blick ist, so lassen sich doch<br />
einige Charakteristika christlichen Engagements<br />
für Europa herausstreichen: Weil<br />
christliche Kreise im Westen während des<br />
Kalten Krieges stets Kontakte mit den Kirchen<br />
im östlichen Teil Europas gepflegt haben,<br />
scheinen sie jetzt geradezu prädestiniert<br />
zu sein, Ressentiments gegen die 2004 erfolgte<br />
Erweiterung der Europäischen Union<br />
entgegenzutreten, und dafür zu werben,<br />
die neuen Mitgliedsstaaten nicht <strong>als</strong> lästige<br />
Konkurrenten, sondern <strong>als</strong> kulturelle Bereicherung<br />
wahrzunehmen (vgl. dazu auch<br />
die „Einladung zur Reflexion“ über „Das<br />
Werden der Europäischen Union und die<br />
Verantwortung der Katholiken“ der Kommission<br />
der Bischofskonferenzen der Europäischen<br />
Gemeinschaft, COMECE, vom 9.<br />
Mai 2005). Der Ausbau der ökumenischen<br />
Zusammenarbeit ist eine gerade wegen der<br />
nationalen Prägung vieler Kirchen schwierige,<br />
aber auf europäischer Ebene überaus<br />
wichtige Aufgabe der Zukunft. Und<br />
schließlich: Christen sind aus ihrem Glauben<br />
heraus in besonderer Weise dazu aufgefordert,<br />
für Freiheit, Gleichheit, Solidarität<br />
- und somit für die (gerade auch europaweite)<br />
Achtung der Grundrechte - einzutreten,<br />
so wie auch der Entwurf für den Verfassungsvertrag<br />
die Charta der Grundrechte<br />
enthält, die mit dem Bekenntnis zur Unantastbarkeit<br />
der Würde des Menschen beginnt<br />
und das Recht auf Gedankens-, Gewissens-<br />
und Religionsfreiheit garantiert.<br />
Wie Christen konkret politisch agieren,<br />
hängt jedoch vor allem von der jeweiligen<br />
politischen Konstellation ihres Landes ab,<br />
denn aus dem Evangelium lässt sich „keine<br />
Blaupause für ein christlich inspiriertes<br />
Europa ableiten, und auch der Rückgriff auf<br />
die Geschichte des Christentums in Europa<br />
liefert kein Modell, an dem man sich heute<br />
orientieren könnte“ (Ulrich Ruh, Europa<br />
und die Christen, in: Herder Korrespondenz<br />
59 (7/2005), 325-327).<br />
Zur kirchlichen Situation<br />
Für die katholische Kirche in Polen bedeutete<br />
der Tod von Papst Johannes Paul II.<br />
im April 2005 einen epochalen Einschnitt,<br />
versetzte das ganze Land zunächst in einen<br />
Ausnahmezustand. War man bislang daran<br />
gewöhnt, in Rom über eine Führungsfigur<br />
von unbestrittener Autorität zu verfügen,<br />
die sich - wie beispielsweise 2003 beim Referendum<br />
über den Beitritt zur Europäischen<br />
Union - immer wieder auch in innerpolnische<br />
Auseinandersetzungen einmischte,<br />
fühlt sich die katholische Kirche nach dem<br />
Tod des „größten Polen aller Zeiten“ geradezu<br />
verwaist. Vor allem junge und jetzt studierende<br />
Gläubige empfanden dies auch <strong>als</strong><br />
eine persönliche Zäsur in ihrem Leben.<br />
Auch in der jetzigen politischen wie<br />
kirchlichen Situation, da keiner der pol-<br />
14
nischen Bischöfe über die Autorität einer<br />
geistlichen Führungsfigur auf nationaler<br />
Ebene zu verfügen scheint, sehnen sich viele<br />
nach einem klaren Wort „von außen“. Doch<br />
während die einen davon ausgehen, dass<br />
man im heutigen Polen „kaum mehr von<br />
einem einheitlichen Katholizismus sprechen“<br />
kann (Ulrike Kind, aaO.), sehen andere<br />
Beobachter eine Quelle der Hoffnung<br />
für die Annahme, dass Polen „allzeit gläubig“<br />
bleibt und nicht der Säkularisierung<br />
anheimfällt („Polonia semper fidelis“), in<br />
der „Generation JPII“. Diese sei zwar Teil<br />
der „vaterlosen Gesellschaft“, habe ihren<br />
In jedem Fall bleibt die religiös-nationale<br />
Mischung Polens ein ebenso bemerkenswertes<br />
wie spannungsreiches Phänomen,<br />
zumal sich derzeit sowohl der<br />
Präsident <strong>als</strong> auch die Regierung <strong>als</strong> „unbedingt<br />
katholisch“ verstehen und auch ihre<br />
Politik <strong>als</strong> solche verstanden wissen wollen<br />
- was sich nicht nur darin äußert, dass der<br />
mittlerweile zurückgetretene Ministerpräsident<br />
Kazimierz Marcinkiewicz seine Silvesteransprache<br />
über Radio Maryja verkündete,<br />
den ausgesprochen populären Sender<br />
des Redemptoristenpaters Tadeusz Rydzyk,<br />
dessen - mitunter sogar antisemitischen<br />
- Ausfälle den Episkopat zu sprengen drohen.<br />
Jarosław Makowski: „Wie soll man einen<br />
Ordensbruder bändigen, der der ungekrönte<br />
Vorsitzende der polnischen Kirche<br />
ist?“ (Ulrike Kind, aaO.).<br />
Erinnerung und Identität<br />
Glaubt man den Meinungsumfragen,<br />
bleibt das eigentliche Schlüsselereignis des<br />
20. Jahrhunderts für Polen eine radikale<br />
Opfer-Erfahrung: der Ausbruch des Zweiten<br />
Weltkriegs - „gefolgt von dem Eintritt<br />
in die Europäische Union, der Wahl von<br />
Karol Wojtyła zum Papst, dem 8. Mai 1945,<br />
der Wiedererlangung der Unabhängigkeit<br />
1918 und dem Fall des Kommunismus“<br />
(Włodzimierz Borodziej, Geschichte, Geschichtsbewusstsein<br />
und die Folgen für das<br />
Verhältnis zwischen Polen und Deutschen,<br />
in: zur debatte 1/2006, 34f).<br />
Andrzej Pagowski, Anatevka (Fiddler on the Roof),<br />
2002 . Quelle: http://www.posterpage.ch/exhib/ex152pag/<br />
ex152pag.htm<br />
geistigen Halt jedoch in der Figur des „Heiligen<br />
Vaters“ gefunden, so dass sie sich nicht<br />
kritiklos „der weit verbreiteten Selbstzufriedenheit<br />
der polnischen Kirche“ ergebe - was<br />
dafür spreche, dass die kath. Kirche Polens<br />
„in vorbildlicher Weise“ dem Evangelium<br />
treu bleiben werde (Zbigniew Nosowski,<br />
Quellen der Zuversicht. Die katholische<br />
Kirche in Polen nach Johannes Paul II., in<br />
Herder Korrespondenz 58 (9/2005), 460 -<br />
464).<br />
Zwar zeigten bereits Veröffentlichungen<br />
des antikommunistischen Untergrunds in<br />
den achtziger Jahren, dass Polen keineswegs<br />
nur unschuldiges Opfer totalitärer Gewalt<br />
gewesen ist, die blutige Unterdrückung der<br />
Ukrainer im Vor- wie im Nachkriegspolen,<br />
die Vertreibung der Deutschen und der<br />
selbst nach dem Krieg noch aufflammende<br />
Antisemitismus wurden jedoch erst nach<br />
1989 breit diskutiert. Einen erinnerungspolitischen<br />
Wendepunkt mit dem Hinterfragen<br />
nationaler Selbstbilder (wie jenes vom<br />
ewig unschuldigen Opfer) markiert die im<br />
Jahre 2000 begonnene und <strong>als</strong> ausgesprochen<br />
schmerzlich empfundene Debatte um<br />
das Pogrom von Jedwabne im Juli 1941. Wegen<br />
des großen Echos - auch im Ausland<br />
- fürchteten selbst Persönlichkeiten, die für<br />
eine schonungslose Aufarbeitung der eigenen<br />
Geschichte eintraten, dass in Vergessenheit<br />
geraten könnte, dass Polen zu dieser<br />
15
Zeit ein - von Deutschen - besetztes Land<br />
war.<br />
Die zeitliche Koinzidenz der Debatten<br />
um Jedwabne mit der um das „Zentrum<br />
gegen Vertreibungen“ sowie der mit beiden<br />
verbundene rasante Perspektivwechsel zwischen<br />
Opfer und Täter rief bei vielen Polen<br />
jedoch auch Schutz- und Abwehrreflexe<br />
hervor. Vor diesem Hintergrund steht denn<br />
auch der Verdacht der Geschichtsrevision im<br />
Raum, wenn in Deutschland die privaten<br />
Erzählungen über Bombenopfer, Vertriebene<br />
und einzelne Soldatenschicksale in den<br />
öffentlichen Diskurs treten - so wie es Ralf<br />
Rothmann in seinem Nach-Wende-Roman<br />
„Hitze“ in einem Dialog der (polnischen)<br />
Protagonistin Lucilla mit ihrem (deutschen)<br />
Liebhaber DeLoo verdichtet:<br />
„‘Apropos. Mein Vater ist mal hiergewesen.<br />
Als Soldat. Er konnte sogar ein bißchen<br />
die Sprache, liebte polnische Gedichte.‘ ‚Ach<br />
Gott‘, sagte sie durch den Rauch. ‚Ein schöngeistiger<br />
Nazi?‘ DeLoo beugte sich vor, wischte<br />
ihr etwas Tabak vom Schoß. ‚Er war Soldat,<br />
kein Nazi. Er ist hier verwundet worden.‘<br />
Sie grunzte leise. ‚Unschuldig, klar. Wie alle.‘<br />
‚Nein. Schuldig führte er sich schon. Aber das<br />
hatte andere Gründe, eher persönliche“.<br />
Ist es angesichts dieser Gemengelage überhaupt<br />
denkbar, dass Deutsche und Polen zu<br />
einem verbindenden historischen Gedenken<br />
finden? Werden sich die durch unterschiedliche<br />
Erfahrungen und Erinnerungen so verschieden<br />
geprägten historischen Identitäten<br />
nicht immer wieder trennend zwischen Polen<br />
und Deutsche stellen, ganz gleich wie die<br />
Konstellationen zwischen Gastgebern und<br />
Gästen auch beschaffen sein mögen? Mit Johannes<br />
Paul II. gefragt: „Wo liegt die Wasserscheide<br />
zwischen Generationen, die nicht<br />
genug bezahlt haben, und Generationen, die<br />
zu viel bezahlt haben? Wir, auf welcher Seite<br />
stehen wir?“ (Erinnerung und Identität. Gespräche<br />
an der Schwelle zwischen den Jahrtausenden,<br />
Augsburg 2005, 100).<br />
Der Osteuropa-Korrespondent der Süddeutschen<br />
Zeitung macht darauf aufmerksam,<br />
dass wir es bei dem Streit zwischen<br />
Deutschen und Polen mit zwei Anliegen zu<br />
tun bekommen, von denen jede Seite sagt,<br />
wie moralisch berechtigt das ihre ist. „Die<br />
Vertriebenen und ihre Unterstützer sagen,<br />
wir wollen gewürdigt sehen, dass wir, diejenigen,<br />
die aus den Gebieten östlich von<br />
Oder und Neiße vertrieben worden sind, einen<br />
höheren Preis für den Krieg gezahlt haben,<br />
den natürlich alle Deutschen in ihrer<br />
Gesamtheit zu verantworten haben, <strong>als</strong> diejenigen,<br />
die nach dem Krieg das Glück hatten,<br />
in der britischen oder amerikanischen,<br />
<strong>als</strong>o in den Westzonen zu sein. Von polnischer<br />
Seite sagt man nun, und das ist genauso<br />
ein berechtigtes Anliegen: Wir waren<br />
im Krieg die Opfer. Es ist richtig, dass es<br />
die Vertreibung gab. Es ist auch richtig, dass<br />
es nach dem Krieg die Verdrängungspolitik<br />
Warschaus gab, die sicherlich auch den Tod<br />
vieler Betroffener in Kauf genommen hat.<br />
Aber es war keine Vernichtungspolitik wie<br />
die deutsche Politik während des Krieges in<br />
Polen. .. Wir haben das Problem, dass die<br />
polnische Argumentation bzw. die Hauptargumente<br />
auf deutscher Seite entweder nicht<br />
verstanden oder nicht akzeptiert werden“<br />
(Thomas Urban, Neue politische Aufbrüche<br />
in Polen, in: zur debatte 1/2006, 36f).<br />
Polen kennen lernen<br />
Mehr <strong>als</strong> sechs Jahrzehnte nach<br />
Kriegsende, 15 Jahre nach Inkrafttreten des<br />
deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags<br />
und im dritten Jahr engster Nachbarschaft<br />
innerhalb der Europäischen Union unternimmt<br />
das Europäische Doktorandenkolloquium<br />
„Erinnerung und Identität“ den<br />
Versuch, national ausgesprochen unterschiedlich<br />
geprägte Memorialkulturen mit<br />
Konzeptionen gemeinsamer anamnetischer<br />
Vergegenwärtigung in das Gespräch zwischen<br />
deutschen und polnischen Studierenden<br />
wie Promovierenden zu bringen.<br />
Für die deutschen Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer bedeutet eine solche Bildungsveranstaltung,<br />
sich dem polnischen<br />
Geschichts- wie Selbstverständnis zu stellen.<br />
Die (deutsche) Koordinatorin für die<br />
deutsch-polnische Zusammenarbeit empfiehlt<br />
dazu, „den polnischen Sinn für Freiheit<br />
und Würde - traditionsreiche europäische<br />
Werte! - aus der polnischen Geschichte<br />
16
heraus zu verstehen und entsprechend zu<br />
achten“ (Gesine Schwan, Wie es den Deutschen<br />
mit den Polen geht: Polen oder Die<br />
Freiheit im Herzen Europas, in: zur debatte<br />
1/2006, 30 - 32). Die (polnische) Senatorin<br />
und ehemalige Professorin für Ethnologie<br />
an der Universität Breslau, Dorota Simonides,<br />
nennt historische Gründe, die dabei<br />
wiederholt zu Missverständnissen führen:<br />
Die Frage privaten Vermögens im Zuge der<br />
in Jalta und Potsdam beschlossenen Westverschiebung<br />
Polens <strong>als</strong> Ausgleich für die<br />
polnischen Gebiete, welche an die ehemalige<br />
UdSSR abgetreten werden mussten<br />
(„Hubert Hupka und Herbert Czaja wurden<br />
zum personifizierten Mythos der Bedrohung<br />
des Lebensraumes des polnischen<br />
Volkes, vor allen Dingen bei den in den<br />
neuen Westgebieten angesiedelten Polen,<br />
welche aus den von der Sowjetunion annektierten<br />
polnischen Ostgebieten vertreiben<br />
wurden. Seit dieser Zeit wurde der BdV<br />
zum Vorbild des Volksfeindes“), sowie die<br />
geschichtlich bedingte Angst vor einer Sonderbehandlung<br />
Russlands durch Deutschland<br />
und Frankreich über die Kopfe der<br />
übrigen EU-Mitglieder hinweg: „Diese historischen<br />
Fakten sind so stark in unserem<br />
Bewusstsein verankert, dass sie bei jedem<br />
Geschehen, welches an das imperiale Gehabe<br />
Russlands erinnert, erneut hervorgerufen<br />
werden“ (Dorota Simonides, aaO.).<br />
Stattfinden wird unser gemeinsamer<br />
Lernversuch in Lublin, der größten polnischen<br />
Stadt östlich der Weichsel, rund 150<br />
km südöstlich von Warschau gelegen. Seit<br />
dem 12. Jh. kreuzen sich hier die Handelswege<br />
zwischen Zentralpolen und Lemberg<br />
(heute: Lviv), so dass die Stadt bereits früh<br />
zum Treffpunkt verschiedener Kulturen,<br />
Religionen und Nationen wurde, bevor hier<br />
1569 die „Lubliner Union“ <strong>als</strong> Zusammenschluss<br />
Polens und Litauens zum mächtigsten<br />
Staat Ostmitteleuropas beschlossen<br />
wurde. Nachdem sich 1316 die ersten Juden<br />
niedergelassen hatten, entwickelte sich<br />
Lublin zu einem der bedeutendsten Zentren<br />
jüdischer Kultur in Europa und wurde - bis<br />
zur Shoah - wegen seiner berühmten Talmudschulen<br />
„jüdisches Oxford“, <strong>als</strong> Zentrum<br />
des Chassidismus auch „polnisches<br />
Jerusalem“ genannt. Im südlichen Stadtteil<br />
Majdanek befand sich während des Zweiten<br />
Weltkriegs das nach Auschwitz größte<br />
nation<strong>als</strong>ozialistische Konzentrations- und<br />
Vernichtungslager in Europa.<br />
Seit 1795 zu Österreich, ab 1809 zum Napoleonischen<br />
Fürstentum Warschau gehörig<br />
und ab 1815 <strong>als</strong> Königreich Polen unter<br />
russischer Kuratel stehend, entwickelte sich<br />
Lublin nach dem Zweiten Weltkrieg zur<br />
Keimzelle des kommunistischen Staates:<br />
Hier entfaltete das „Komitee der nationalen<br />
Befreiung“ die Grundlinien der neuen Gesellschaftsordnung.<br />
Heute beherbergt die<br />
Stadt fünf Hochschulen. Deren älteste ist<br />
die 1918 gegründete Katholische Universität<br />
Lublin (KUL), die zwischen 1944 und 1989<br />
einzige unabhängige Universität in Mittelund<br />
Osteuropa. Hier lehrte Karol Wojtyła<br />
Ethik und Philosophie, wurde Josef Kardinal<br />
Ratzinger ehrenhalber promoviert.<br />
Die zweite der Lubliner Hochschulen ist<br />
die Maria Curie-Skłodowska Universität<br />
(UMCS), die seit 1944 besteht. An ihr sind<br />
die meisten Lubliner Studenten immatrikuliert.<br />
Die am dortigen Instytut Germanistyki<br />
unterrichtende DAAD-Lektorin<br />
Katharina Wildermuth hat die Programmplanung<br />
mit verantwortet, und konnte<br />
dank Unterstützung des Deutschen Akademischen<br />
Austauschdienstes die polnischen<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres<br />
Europäischen Kolloquiums einladen.<br />
Nach dreiwöchigen Auslandsakademien<br />
der Bischöflichen Studienförderung, die in<br />
verschiedenen Orten Polens zu Zeiten des<br />
„Kalten Krieges“ (nämlich 1975, 1984 und<br />
1988) stattgefunden haben, thematisierte<br />
bereits unsere vierzehntägige Auslandsakademie<br />
„Polen und Deutsche in Europa“<br />
im September 2004 (und damit im Jahr des<br />
Beitritts Polens zur EU) die trennenden Erinnerungen<br />
an eine gemeinsame Geschichte<br />
in Wrocław/Breslau und Kreisau, Krakau<br />
und Auschwitz, Tschenstochau und<br />
Warschau. Nach der Durchtrennung des<br />
„Eisernen Vorhangs“ fanden Europäische<br />
Kolloquien des <strong>Cusanuswerk</strong>s in Warschau<br />
(1993), Krakau (1995: „Nation und Gedächtnis“)<br />
und Lviv/Lemberg (1999: „Am Rande?<br />
Die Ukraine zwischen Rückbesinnung<br />
und Neubeginn“) statt. Nun unternimmt<br />
das am Ende des Deutsch-Polnischen Jahres/Rok<br />
Polsko-Niemiecki 2005/06 stehen-<br />
17
de Doktorandenkolloquium in Lublin den<br />
Versuch, national ausgesprochen unterschiedlich<br />
geprägte Memorialkulturen mit<br />
Konzeptionen gemeinsamer anamnetischer<br />
Vergegenwärtigung in Europa ins Gespräch<br />
zu bringen, denn aller Verwestlichung und<br />
Nivellierung im größeren Europa zum Trotz<br />
leben die EU-Bürger/West noch immer in<br />
einer anderen Welt <strong>als</strong> die EU-Bürger/Ost:<br />
„Die unsichtbare Grenze wird nicht nur<br />
durch das wirtschaftliche Gefälle markiert,<br />
sondern mehr noch von tief eingebrannten<br />
historischen Erfahrungen, die das Lebensgefühl<br />
nachhaltig prägen. Die Toleranz, auf<br />
die sich der hedonistische Westen so viel einbildet,<br />
hat sich entfalten können in Gesellschaften,<br />
die keine anderen Sorgen hatten,<br />
<strong>als</strong> den steigenden Wohlstand zu verteilen<br />
und immer noch mehr Demokratie zu wagen.<br />
Im anderen Teil Europas haben Jahrzehnte<br />
blutiger Unterdrückung und Fremdherrschaft<br />
etwas anderes hervorgebracht: die<br />
Sehnsucht nach Selbstbestimmung, nach<br />
nationaler Identität, nach Herrschaft im eigenen<br />
Haus“ (so der Kommentar von Stefan<br />
Dietrich zur Rede des polnischen Staatspräsidenten<br />
Lech Kaczýnski in der Humboldt-<br />
Universität zu Berlin, in: F.A.Z., 10.03.06,<br />
1).<br />
Cusanische Literatur<br />
Burkhard Olschowsky, Anforderungen<br />
an europäische Eliten - Das Beispiel der<br />
deutsch-polnischen Beziehungen, in: Josef<br />
Wohlmuth/Claudia Lücking-Michel (Hg.),<br />
Inspirationen. Beiträge zu Wissenschaft,<br />
Kunst, Gesellschaft und Spiritualität (=<br />
Festschrift 50 Jahre <strong>Cusanuswerk</strong>), Paderborn:<br />
Schöningh 2006, 231 - 243.<br />
Polen und Deutsche in Europa. Polacy i<br />
Niemcy w Europie. <strong>Textbuch</strong> zur Auslandsakademie<br />
des <strong>Cusanuswerk</strong>s, 19. September<br />
bis 2. Oktober 2004: Kreisau - Wrocław/<br />
Breslau - Kraków/Krakau - Auschwitz -<br />
Warszawa/Warschau, Bonn 2004.<br />
Im 50. Jubiläumsjahr des <strong>Cusanuswerk</strong>s<br />
führt das Europäische Doktorandenkolloquium<br />
im November<br />
2006 in Deutschlands großes wie<br />
unbekanntes, in jedem Fall sehr nahe liegendes<br />
Nachbarland, um in Auseinander<br />
setzung mit der schmerzlichen Vergangenheit<br />
und angesichts einer von manchen<br />
Misstönen gestimmten Gegenwart nach<br />
Trennendem wie Gemeinsamen in „Erinnerung<br />
und Identität“ von Polen und Deutschen<br />
zu suchen, denn „wir werden die Auseinandersetzungen<br />
mit der Vergangenheit<br />
nie vollständig hinter uns gelassen haben;<br />
Deutsche und Polen müssen sich ihnen immer<br />
wieder stellen - damit sie einander bei<br />
anderen Themen nicht sprachlos gegenüberstehen“<br />
(Włodzimierz Borodziej, aaO.). Es<br />
reicht nicht aus, nur ungefähr zu wissen, wo<br />
Warschau liegt.<br />
18
„Wir leben nicht zwischen den Welten, sondern<br />
in ihrer Mitte“ (Karl Dedecius).<br />
Als DAAD-Lektorin in Lublin<br />
von Katharina Wildermuth<br />
Verstehen und Verständigung im deutsch-polnischen Dialog setzen voraus, dass<br />
wir uns unserer Identität(en) bewusst werden. Einige persönliche Eindrücke und<br />
Gedanken in Vorbereitung auf das Europäische Doktorandenkolloquium.<br />
Seit Oktober 2005 arbeite ich <strong>als</strong> Lektorin<br />
des Deutschen Akademischen Austauschdienstes<br />
(DAAD) am Institut für Germanistik<br />
der Maria Curie-Skłodowska-Universität<br />
in Lublin. Zu meinen Hauptaufgaben<br />
gehören die Vermittlung deutscher Sprache<br />
und Landeskunde im Rahmen von sprachpraktischen<br />
Übungen, Information über<br />
die deutsche Hochschullandschaft, die Beratung<br />
Studierender, Forschender und Lehrender<br />
zu Fördermöglichkeiten für einen<br />
akademischen Aufenthalt in Deutschland<br />
und die Abnahme von Sprachprüfungen.<br />
Weiterhin betreue ich eine kleine, durch<br />
Spenden des Goethe-Instituts finanzierte<br />
Bibliothek, den DAAD-Lektorenhandapparat,<br />
und engagiere mich in Projektarbeit.<br />
Bei der Vorbereitung dieses Beitrags habe<br />
ich mir die Frage gestellt, was unser Kolloquiums-Thema<br />
„Erinnerung und Identität“<br />
eigentlich für mich <strong>als</strong> deutsche Lektorin<br />
im polnischen Lublin bedeutet. In einem<br />
Artikel stieß ich auf das im Titel genannte<br />
Zitat von Karl Dedecius, den Marion Gräfin<br />
Dönhoff einmal einen „Mittler zwischen<br />
schwierigen Nachbarn“ genannt und der in<br />
diesem Jahr seinen 85. Geburtstag gefeiert<br />
hat. Seine Idee der „Mitte“ zwischen den<br />
Welten möchte ich im Folgenden an einigen<br />
Aspekten meines Lebens und meiner Arbeit<br />
hier spiegeln, um daraus schließlich ganz<br />
persönliche Schlussfolgerungen für unsere<br />
Begegnung im November zu ziehen.<br />
„Ab durch die Mitte“ – Unterricht<br />
Ich unterrichte die so genannten „Kompositionsübungen“<br />
(sprachpraktische Übungen<br />
zur Textproduktion) im 2. und die<br />
„Diskursiv-rezeptiven Übungen“ (Vertiefung<br />
hauptsächlich mündlicher Diskursfähigkeit)<br />
im 4. Studienjahr des insgesamt<br />
fünfjährigen Magisterstudiengangs Germanistik.<br />
Die Konzeption und Gestaltung<br />
dieser Seminare liegt vollständig in meiner<br />
Verantwortung, ebenso die Formulierung<br />
der Leistungsanforderungen.<br />
Jede/r, die/der schon einmal <strong>als</strong> Referent/<br />
in oder Lehrer/in vor einer Gruppe gestanden<br />
und dabei bestimmte (Lern-)Ziele verfolgt<br />
hat, kennt die Situationen, in denen<br />
die eigene Planung plötzlich nicht mit dem<br />
Verhalten der Lernenden zusammenpasst.<br />
Offenbar treffen unterschiedliche Vorstellungen<br />
von der Umsetzung des Themas zusammen,<br />
Anforderungen sind zu hoch oder<br />
19
zu niedrig gesetzt, die Methodik spricht die<br />
Teilnehmer/innen nicht an, verwirrt, langweilt<br />
oder verärgert sie unter Umständen<br />
gar oder das Thema bzw. die Fragestellung<br />
der Stunde ist f<strong>als</strong>ch gewählt. – Wie auch<br />
immer: Die Kommunikation funktioniert<br />
nicht.<br />
Wenn ich diese Momente im Kontext<br />
meines Unterrichtens vor Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmern aus anderen Ländern und<br />
Kulturkreisen reflektiere, erscheinen sie mir<br />
inzwischen häufig <strong>als</strong> Konfrontation meiner<br />
eigenen (Lern-)Biografie mit der meiner<br />
Studierenden. Mein Anspruch, z.B. an<br />
die Art und Weise der Auseinandersetzung<br />
mit einem Thema, erwächst nicht nur aus<br />
dem, was mir in meinem Studium <strong>als</strong> moderne<br />
Didaktik nahe gebracht wurde, sondern<br />
auch aus der durch die Kultur und Geschichte<br />
meines Heimatlandes geprägten<br />
Art und Weise, wie ich selbst gelernt habe.<br />
Und dies umschließt nicht nur Schule und<br />
Studium, sondern meine Wahrnehmung<br />
des gesamtgesellschaftlichen Diskurses in<br />
Deutschland und meine Beteiligung daran.<br />
Dasselbe gilt entsprechend für die Lernenden.<br />
In der Zusammenarbeit mit den polnischen<br />
Studierenden zeigt sich dies z.B.<br />
konkret an unseren unterschiedlichen Rollenbildern<br />
von Lehrer/in und Studenten:<br />
Während ich mich im universitären Kontext<br />
eher <strong>als</strong> Moderatorin von Lernprozessen<br />
und Beraterin der Lernenden verstehe,<br />
sehen die Kursteilnehmer/innen in mir<br />
eher die deutlich übergeordnete Autorität,<br />
von der sie die 100prozentige Vorgabe aller<br />
Lerninhalte sowie deren „Abprüfen“ erwarten<br />
– so, wie sie es aus ihrem bisherigen<br />
Lernalltag hauptsächlich kennen. Die Aktivität<br />
liegt dabei, das lässt sich erahnen,<br />
hauptsächlich auf meiner Seite. Umgekehrt<br />
erwarte ich von den Studierenden Selbstständigkeit<br />
und Eigenverantwortung, die<br />
sich in einer entsprechenden Mitgestaltung<br />
des Unterrichts, im Einbringen eigener<br />
Ideen und auch in Fragen und Kritik äußern<br />
sollten, während sie sich selbst häufig<br />
in der passiven Rolle der Schüler sehen, die<br />
klare und genau umrissene Arbeitsaufträge<br />
erfüllen, jedoch keine individuellen und<br />
kreativen Eigenleistungen erbringen oder<br />
größere inhaltliche oder methodische Zusammenhänge<br />
mitdenken müssen.<br />
Dass diese gegensätzlichen Rollenbilder<br />
den Boden für die oben beschriebenen<br />
„kommunikativen Brüche“ bereiten, ist<br />
schnell zu sehen. – Wie <strong>als</strong>o damit umgehen?<br />
Um allein die sprachlichen Lernziele<br />
meines Unterrichts zu erreichen, muss ich<br />
mich ein Stück weit auf die Erwartungshaltung<br />
der Studierenden zubewegen. Regelmäßige<br />
Prüfungen, gezieltes Einfordern<br />
von Beiträgen und Ähnliches gehören inzwischen<br />
zur „Grundausstattung“. Gleichzeitig<br />
jedoch formuliere ich sehr klar, wie<br />
ich mir unsere Zusammenarbeit vorstelle<br />
und setze dies nach Möglichkeit in einer<br />
entsprechenden Unterrichtsmethodik (z.B.<br />
durch kleine Projekte) und Umgangsweise<br />
mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern<br />
um.<br />
Wo dies möglich und nötig ist, thematisiere<br />
ich auch meine Beobachtung und<br />
Interpretation dieser kommunikativen Abläufe<br />
und diskutiere sie mit den Studierenden,<br />
was für die meisten eine völlig neue<br />
Erfahrung und für mich jedes Mal ein Dazulernen<br />
bedeutet. Oft können scheinbar<br />
festgefahrene Konflikte dabei gelöst und<br />
neue Wege der Zusammenarbeit – gemeinsam<br />
– gefunden werden.<br />
Das Thema „Mitte finden“ wird dabei<br />
für alle Beteiligten greifbar.<br />
„Wegweiser sein“ – Beratung<br />
In meine Sprechstunden zur Stipendienberatung<br />
kommen sowohl Studierende<br />
und Graduierte der Germanistik <strong>als</strong> auch<br />
anderer Fachbereiche der UMCS. Leider<br />
sind meine Polnischkenntnisse noch lange<br />
nicht ausreichend, um diese Gespräche<br />
auf Polnisch führen zu können. Daher bin<br />
ich darauf angewiesen, dass die Interessenten<br />
ausreichende Deutsch- oder Englischkenntnisse<br />
mitbringen – was allerdings<br />
auch Voraussetzung für ein DAAD-Stipendium<br />
an einer deutschen Hochschule oder<br />
Forschungseinrichtung ist.<br />
Ich informiere und berate jedoch nicht<br />
nur mit Bezug auf DAAD-Programme,<br />
20
sondern versuche immer ein aktuelles und<br />
breites Spektrum an Ausschreibungen unterschiedlichster<br />
Anbieter parat zu haben,<br />
um möglichst individuelle Lösungen zu<br />
finden. Dies erfordert eine permanente Recherche<br />
und vor allem ein offenes Ohr für<br />
die Wünsche und Vorstellungen der Kandidaten,<br />
die mit ihren jeweiligen Voraussetzungen<br />
in Einklang gebracht werden müssen.<br />
Ist die Entscheidung für ein bestimmtes<br />
Programm gefallen, ist häufig auch meine<br />
Unterstützung bei der Zusammenstellung<br />
der Bewerbungsunterlagen gefragt. Oft<br />
muss ich noch Sprachprüfungen durchführen<br />
und entsprechende Zeugnisse bzw. Gutachten<br />
ausstellen.<br />
Anders <strong>als</strong> im Unterricht sehe ich mich<br />
hier in erster Linie <strong>als</strong> „Dienstleister“ – allerdings<br />
für eine Sache, die mir gleichzeitig ein<br />
persönliches Anliegen ist: Indem ich einen<br />
jungen Menschen dabei unterstütze, seinen<br />
bzw. ihren Wunsch nach Deutschland zu<br />
gehen oder an einer internationalen Begegnung<br />
teilzunehmen in die Tat umzusetzen,<br />
erschließe ich ihm oder ihr neue Kommunikations-<br />
und Erfahrungsräume. Ich kann im<br />
besten Fall dazu beitragen, dass er/sie durch<br />
diesen Schritt seinen/ihren Blick schärft für<br />
das Eigene wie für das Andere und dadurch<br />
bereichert wird.<br />
„Mitten im Leben“ – privater Alltag<br />
Die Entscheidung für das Lektorat in<br />
Lublin bedeutete natürlich nicht nur eine<br />
berufliche Herausforderung, sondern eine<br />
ebenso große Veränderung meines privaten<br />
Alltags. Dabei habe ich das große Glück,<br />
diese Erfahrung gemeinsam mit meiner Familie<br />
machen zu können. Folgende Eindrücke<br />
empfinde ich <strong>als</strong> besonders wichtig:<br />
Das Eintauchen in die Lebenswirklichkeit<br />
einer anderen – wenn natürlich auch<br />
immer noch europäischen – Gesellschaft<br />
lässt uns unser eigenes Land aus einer Außenperspektive<br />
wahrnehmen. Probleme und<br />
Konflikte, Ziele und Wünsche werden neu<br />
beleuchtet, das Anspruchsdenken kritisch<br />
reflektiert. Hier in Lublin leben wir natürlich<br />
in einer zivilisierten Großstadt mit allen<br />
Bequemlichkeiten und dem vollen Spektrum<br />
an Konsumangeboten (die allerdings,<br />
nebenbei bemerkt, nur von den wenigsten<br />
voll ausgeschöpft werden können). Doch<br />
schon wenige Kilometer außerhalb der Stadt<br />
begegnen uns Pferdefuhrwerke auf den<br />
Straßen, manches kleine Dorf ist nur über<br />
Schotterpisten zu erreichen, mancher Hof<br />
wird lediglich über einen Ziehbrunnen mit<br />
frischem Wasser versorgt.<br />
Stammtischparolen gegen polnische<br />
(„Billig-“) Arbeitskräfte waren mir natürlich<br />
schon vor unserem Leben hier zuwider,<br />
ein wirklich tiefes Verständnis für die Hintergründe<br />
und Motivationen der Menschen,<br />
die auf diese Art und Weise nicht selten ihren<br />
Lebensunterhalt bestreiten, ja Bewunderung<br />
für ihre Flexibilität und Einsatzbereitschaft<br />
habe ich erst hier entwickelt.<br />
Auf Grund unserer sprachlichen Schwierigkeiten<br />
machen wir täglich die Erfahrung<br />
von Fremdheit und Hilflosigkeit. Im Kontakt<br />
mit Leuten auf der Straße, beim Bäcker,<br />
Arzt oder im Bus fallen wir sofort <strong>als</strong><br />
Ausländer auf – und damit <strong>als</strong> Exoten in einer<br />
Region, die kaum Kontakt und Erfahrung<br />
mit Ausländern hat (schon gar nicht<br />
aus Westeuropa).<br />
Gleichzeitig begegnen wir hier jedoch<br />
einer Offenheit und Hilfsbereitschaft, die<br />
uns von Anfang an hat spüren lassen, dass<br />
wir von den Menschen vorbehaltlos an- und<br />
aufgenommen werden. Kollegen und Nachbarn<br />
unterstützen uns bei dem Aufbau unserer<br />
privaten „Infrastruktur“ – seien es die<br />
zahlreichen Ämtergänge, Einrichtung von<br />
Bankkonto, Internet- und Telefonanschluss,<br />
die Suche nach einer geeigneten Kinderbetreuung<br />
oder einfach nur der Tipp, wo man<br />
das beste Obst oder den Sand für den Sandkasten<br />
kaufen kann.<br />
Manches befremdet uns auch: militärische<br />
Paraden zu den diversen Nationalfeiertagen<br />
oder die in allen polnischen Städten<br />
an denselben Plätzen anzutreffenden Denkmäler<br />
zentraler Figuren der polnischen Geschichte.<br />
Aber auch die Diskrepanz zwischen<br />
einem sich rasant entwickelnden Kapitalismus<br />
mit seinen Auswüchsen von Konsumdenken<br />
und Karrierebewusstsein und einem<br />
oftm<strong>als</strong> strengen und konservativen Katholizismus,<br />
der sowohl generationenübergrei-<br />
21
fend die Moralvorstellungen <strong>als</strong> auch das<br />
allgemeine Nationalgefühl tief prägt.<br />
Wir sind <strong>als</strong> Deutsche in einer Gesellschaft<br />
sozialisiert worden, in der man sich<br />
aus historischer Schuld heraus schwer tat<br />
und tut eine „nationale Identität“ zu formulieren<br />
oder einem Nationalbewusstsein<br />
öffentlich Ausdruck zu verleihen. In Polen<br />
dagegen ist man stolz auf die eigene Geschichte<br />
und sieht sich <strong>als</strong> Einzelne/r viel<br />
stärker dieser nationalen Gemeinschaft verbunden<br />
und zugehörig.<br />
Durch unser Leben und Arbeiten mitten<br />
unter den Menschen hier sind wir zugleich<br />
Über-Mittler unserer Erfahrungen<br />
und Eindrücke an unsere Familien und<br />
Freunde in Deutschland. Manchmal, wenn<br />
diese den Weg zu uns hierher finden und<br />
manches lang gehegte Vorurteil durch eigene<br />
Anschauung und Begegnung aufgebrochen<br />
werden kann, dürfen wir auch Ver-<br />
Mittler sein.<br />
„Mittendrin?“ – Deutsch-polnische<br />
Beziehungen<br />
Deutsch-polnische Beziehungen lassen<br />
sich nicht allein theoretisch reflektieren.<br />
Von der Wirklichkeit bilden die Statements<br />
der Politiker, gesellschaftliche (Groß-)Ereignisse,<br />
Teilnehmer-Statistiken von Veranstaltern<br />
oder die regelmäßig veröffentlichten<br />
Vergleichsstudien nur einen Teil<br />
ab. Um sie in ihrem ganzen Umfang zu erfahren,<br />
müssen wir sozusagen Wege in die<br />
„deutsch-polnische Mitte“ suchen.<br />
Die „Mitte“, von der Dedecius spricht,<br />
verstehe ich <strong>als</strong> ein Erkennen des „Eigenen“<br />
durch das „Andere“, <strong>als</strong> eine Bereicherung<br />
durch Gemeinsames und Trennendes.<br />
Sich der eigenen Identität bewusst<br />
zu werden heißt auch Aspekte nationaler<br />
Identität, die in Deutschland lange verdrängt<br />
wurden, zu erkennen und zuzulassen.<br />
Dies geschieht jedoch zumeist erst<br />
in der Begegnung und Auseinandersetzung<br />
mit Menschen anderer Nationen.<br />
uns einmal mehr die Brisanz und Aktualität<br />
von Ereignissen, die manchmal längst<br />
vergangen scheinen und nicht selten <strong>als</strong> abgeschlossen<br />
betrachtet werden wollen. Sie<br />
durchdringen unsere Welten, reißen Gräben<br />
auf, trennen.<br />
Unsere nationalen Identitäten, die deutsche<br />
wie die polnische, sind von der Zeit<br />
des Nation<strong>als</strong>ozialismus und den damit zusammenhängenden<br />
Vertreibungen geprägt.<br />
Wenn wir Wege in die Mitte suchen wollen,<br />
müssen wir uns unseren Erinnerungen<br />
stellen, diese zur Sprache und damit in unsere<br />
Mitte bringen.<br />
„Mittendrin!“ – Das Europäische Doktorandenkolloquium<br />
Das Kolloquium „Erinnerung und Identität“<br />
möchte hierzu einen Beitrag leisten.<br />
Dabei sehe ich eine zweifache Herausforderung<br />
an uns alle:<br />
Zum einen setzen wir uns mit einem sensiblen<br />
gesellschaftspolitischen Thema auseinander,<br />
das in möglichst unterschiedlichen<br />
Facetten an ebenso verschiedenen Orten<br />
beleuchtet werden soll. Dabei werden wir<br />
selbst <strong>als</strong> Teil einer Gesellschaft mit ihrem<br />
jeweiligen kollektiven Gedächtnis angesprochen,<br />
Aspekte unserer (unter anderem<br />
nationalen) Identität werden sichtbar und<br />
wir müssen uns ihnen stellen.<br />
Zum anderen liegen aus meiner Sicht in<br />
der persönlichen Begegnung mit den anderen<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmern die<br />
Aufgabe und zugleich die Chance, durch<br />
Zuhören, Fragen und eigenes Erzählen,<br />
durch gemeinsames Erleben und Diskutieren<br />
die „Mitte“ auszuloten, von der Dedecius<br />
spricht. Wie erlebe ich die anderen, wie<br />
werde ich selbst wahrgenommen vor dem<br />
Hintergrund meines Deutsch- bzw. Polnisch-Seins?<br />
Wie viel von dem, was meine<br />
Identität ausmacht, gehört auch zur Identität<br />
meines Gegenübers?<br />
Ich wünsche uns allen bereichernde Begegnungen<br />
in der Mitte Europas!<br />
Die aktuellen Konflikte auf der offiziellen<br />
deutsch-polnischen Bühne zeigen<br />
22
Am Anfang war das Wort, das erinnerte Wort<br />
von Dr. Simone Bell-D’Avis<br />
Eine geistliche Einstimmung zum europäischen Doktorandenkolloquium Lublin<br />
„Erinnerung und Identität“ anhand von Lk 23,50 – 24,12<br />
Die zugrunde gelegte Erzählung beginnt<br />
am Todestag Jesu, am Vorabend des<br />
Sabbats und erstreckt sich bis zu den ersten<br />
Gesprächen über seine Auferstehung am ersten<br />
Tag nach dem Sabbat. Selten wird die<br />
Erzählung in der exegetischen Literatur <strong>als</strong><br />
ein Text aufgefasst, stattdessen ist oftm<strong>als</strong><br />
von zwei Teilen die Rede, von der „Grablegung“<br />
und von „Ostern“. Ganz im Sinne<br />
unserer Reise, die einen Konnex zwischen<br />
Erinnerung und Identität gegeben sieht,<br />
soll im Folgenden die gewählte biblische<br />
Erzählung <strong>als</strong> eine zusammenhängende<br />
Geschichte betrachtet werden, in der Erinnerung<br />
nach den Vorgaben frühjüdischer<br />
Mnemotechnik den Zugang zum Verständnis<br />
des Auferstehensglaubens bildet.<br />
Rekapituliert man die Erzählung entlang<br />
ihrer Gliederungsmerkmale, tritt ihre<br />
chronologische Struktur hervor. Die Handlung<br />
spielt „vor“, „während“ und „nach“<br />
dem Sabbat. In einer ersten Episode wird<br />
von der Grablegung Jesu erzählt. Einen besonderen<br />
Charakter haben innerhalb dieser<br />
ersten Episode die Sätze, die davon berichten,<br />
dass jegliche Aktivität zur Ruhe<br />
kommt, auch die Totenpflege; niemand<br />
läuft von hier nach dort, Orte und Tätigkeiten<br />
spielen keine Rolle. Eine zweite Episode<br />
umfaßt die Verse Lk 24,1-8. Mit der sich<br />
der Sabbatruhe anschließenden Zeitenwende<br />
(24,1) geht eine qualitative Veränderung<br />
einher: Der Leib des „Herrn“ Jesus ist nicht<br />
mehr zu finden. Dabei sind die Frauen doch<br />
zum Grab gekommen, um die Tätigkeit, die<br />
sie mit dem Aufleuchten des Sabbat unterbrochen<br />
hatten, fortzusetzen: die Totenpflege.<br />
Das Zeichen der Zeit, den weggewälzten<br />
Stein, können sie zu diesem Zeitpunkt noch<br />
nicht „lesen“, dazu fehlen ihnen „die Worte“.<br />
Sie fallen in Ratlosigkeit. Sie brauchen Hilfe<br />
von außen, um den Weg zu dem Raum, der<br />
Erkenntnis bringt, zu finden. Zwei Männer<br />
treten auf in strahlendem Gewand - die<br />
Frauen befällt heilige Scheu, sie blicken zur<br />
Erde. Es scheint <strong>als</strong> sei im Morgengrauen<br />
eine Senkrechte vom Himmel - dem Ort<br />
der aufleuchtenden Sterne - zum Dunkel des<br />
Erdbodens gefällt. Diese Senkrechte erfährt<br />
eine horizontale Verschränkung mit der Tradition<br />
Israels, wenn die Männer in Lk 24,5<br />
zu den Frauen zu sprechen beginnen und ihnen<br />
die zur Erkenntnis der Auferweckung<br />
nötigen „Worte“ in Erinnerung rufen.<br />
Diese Worte, die Worte Jesu und die<br />
Worte der Schriften Israels, werden im Text<br />
ausdrücklich rekapituliert (24,7). Im Zentrum<br />
des Todes, im Grab, wird innerhalb der<br />
Redesequenz der Ort bedeutsam, in dem die<br />
Erinnerung an Jesus und seine Worte lebendig<br />
ist: das Herz der Frauen, „die mitgekommen<br />
waren aus Galiläa mit ihm“ (23,55).<br />
Mit der Rückkehr der Frauen vom Grab<br />
scheint das augenscheinlich im Grab gefundene<br />
Wissen - die Erinnerung an die Worte<br />
Jesu - nichts mehr zu taugen, wovon die dritte<br />
Episode erzählt. Die Frauen „verkünden“<br />
23
(24,9) und „sagen“ (24,10b) den Jüngern<br />
„dies alles“ (24,9) bzw. „dieses“ - auf aktualisierende<br />
Wiederholung, auf Erzählung,<br />
wird aber verzichtet. Den Jüngern bleibt<br />
nichts anderes übrig, <strong>als</strong> das so Verkündete,<br />
„diese Worte“ (24,11) für leere Worte,<br />
für Geschwätz zu halten. Auch Petrus, der<br />
die Depression mit Aktivität - er rennt zum<br />
Grab - durchbricht, bleibt nur das Staunen<br />
(24,12) und das Fortgehen; auf der Suche<br />
nach den wahren Worten?<br />
Innerhalb der Erzählung begegnen uns<br />
bedeutungsreiche Anspielungen sowohl<br />
bezüglich des Motivs der Worte, wie auch<br />
bezüglich der mit den Komponenten Vergegenwärtigung<br />
und Wiederholung gebildeten<br />
Erinnerungsstruktur. Dort, wo in<br />
Lk 23,50-24,12 die Worte Jesu ausdrücklich<br />
wiederholt und vergegenwärtigt werden,<br />
ermöglicht dieses kommunikative<br />
Gedächtnis einen Erkenntnisakt (24,8);<br />
„to ‚remember‘ can hardly mean to recall<br />
something which had been forgotten, but<br />
rather to repeat sayings to oneself, and to<br />
allow them once more to have their effect<br />
on the soul.“ <br />
Innerhalb der dritten Episode der Erzählung<br />
findet eine solche Verdichtung<br />
nicht statt. Zwar heißt es, die Frauen berichteten<br />
und verkündeten „dies alles“<br />
bzw. „dieses“ (24,9f), womit eine im Denken<br />
Israels bekannte Identifikationsformel<br />
verwendet wird, doch wird auf eine ausführliche<br />
Schilderung, eine vergegenwärtigende<br />
Erzählung all dessen verzichtet. Das<br />
hat zur Folge, dass im Text selbst auch die<br />
Worte Jesu nicht noch einmal ausdrücklich<br />
wiederholt werden, mit deren Explikation<br />
die Frauen selbst sich erinnern konnten.<br />
Die Vermutung drängt sich auf, dass<br />
innerhalb des Berichtes der Frauen be-<br />
Vgl. dazu: Assmann, Jan (1992), Das kulturelle<br />
Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische<br />
Identität in frühen Hochkulturen, München, S.<br />
48-66.<br />
Dahl, N. A., (1947) : Anamnesis. Mémoire et<br />
Commémoration dans le christianisme primitif,<br />
in: Studia Theol. 1, S. 69-75, hier: 70; zitiert<br />
nach: Gerhardsson, Birger, Memory and<br />
Manuscript: Oral Tradition and Written Transmission<br />
in Rabbinic Judaism and Early Christianity,<br />
(ASNU 22), Lund 1964 2 , S. 228.<br />
stimmte Komponenten fehlen, so dass das<br />
Erinnerungsvermögen der Jünger nicht<br />
ausreichend aktiviert werden kann. Dass<br />
„diese Worte“ dann <strong>als</strong> „Geschwätz“, <strong>als</strong> leeres<br />
Gerede erscheinen müssen (24,11), liegt<br />
in der Dynamik der für die Apostel noch<br />
unvollständigen Identifikation. Gelingt allerdings<br />
innerhalb einer Kommunikation<br />
diese Identifikation (24,5b-7), dann haben<br />
die Worte Jesu eine eminente Bedeutung:<br />
Sie bestätigen sein Wissen um sich selbst<br />
und teilen dieses Wissen mit. Leer ist dann<br />
nur das Grab. Jesu Abwesenheit besteht<br />
dann „only ‚among the dead‘ [...The] words<br />
of Jesus himself provide the interpretive key<br />
to his absence among the dead.” Den Weg<br />
zu dieser Erkenntnis finden die Frauen einzig<br />
“through the maze of memory.” <br />
Die Mnemotechnik, der die zitierten<br />
Worte Jesu in Lk 24,5b-7 folgen, gleicht<br />
zum einen strukturell (Vergegenwärtigung<br />
und Wiederholung), zum anderen bezüglich<br />
ihres Mediums (Worte) und letztlich<br />
in ihrer inhaltlichen Option (Leben versus<br />
Tod) der Weise der im Deuteronomium zugrunde<br />
gelegten Exodusmemoria. Denn im<br />
Deuteronomium, der identity card Israels,<br />
wird denjenigen, die die Exodusmemoria<br />
wahren und auf die Worte JHWHs hören,<br />
Zukunft in Aussicht gestellt: „Hört, und<br />
ihr werdet leben“ (Dtn 4,1) verheißt der<br />
Gott Israels dort.<br />
Pointiert man die Oppositionen im vorliegenden<br />
Text ausdrücklich, dann lassen<br />
sich zwei Weisen des Vergangenheitsbezugs<br />
herausarbeiten: F<strong>als</strong>ch verstandener Totenkult<br />
auf der einen Seite und Erinnerung<br />
in der biblisch vermittelten Aneignungsweise<br />
von Vergegenwärtigung und Wiederholung<br />
auf der anderen Seite. In der Erinnerung<br />
an die in Galiläa von Jesus gesagten<br />
Worte hängt die Fähigkeit, ihn <strong>als</strong> Lebenden<br />
wahrzunehmen, den der Gott Israels,<br />
gemäß den Worten der Schrift, auferweckt<br />
hat - Riten des Todes erübrigen sich gegenüber<br />
einem Lebenden. Diese Feststellung<br />
soll die Treue Joseph von Arimathäas ebenso<br />
wenig wie die der Frauen abwerten: Es<br />
Johnson, Luke Timothy (1992): The not so<br />
empty tomb, Lk 24,1-11, in: Interpretation 46,<br />
1992, S. 57-61, hier: 60.<br />
Ebd.<br />
24
galt, den toten Jesus zu bestatten. Erst in der<br />
Fixierung auf den Zustand des Todes liegt<br />
der nur noch durch angeleitete Erinnerung<br />
zu behebende Fehlschluss.<br />
Die vorliegende Erzählung vermittelt das<br />
Wissen um die Auferweckung Jesu in den<br />
Kategorien frühjüdischer Mnemotechnik.<br />
Trotzdem hat sich das christliche Bekenntnis<br />
zur Auferweckung Jesu in der zweitausendjährigen<br />
Kirchen-, Theologie-, Frömmigkeits-<br />
und Kulturgeschichte weniger <strong>als</strong><br />
ein Weg zum Gott Israels <strong>als</strong> vielmehr weg<br />
von ihm erwiesen. Dass dadurch dem Christentum<br />
die Exodusdimensionen des eigenen<br />
Bekenntnisses verschlossen bleiben,<br />
mag ein innerchristliches Defizit sein, das<br />
sich in den Befreiungskämpfen von Minderheiten<br />
immer wieder artikuliert. Die um<br />
die Profilierung einer eigenen christlichen<br />
Identität bemühte Abgrenzung gegenüber<br />
dem Judentum aber ist alles andere <strong>als</strong> ein<br />
innerchristliches Problem - nicht erst wegen,<br />
aber erst recht nach der Shoah.<br />
Es gibt für ihn nicht nur eine Revolution,<br />
die die Dinge von morgen ändert, für künftige<br />
Generationen, sondern auch eine Revolution,<br />
die über den Sinn der Toten und<br />
ihrer Hoffnungen neu entscheidet [...]. Auferweckung,<br />
die über das Gedächtnis des<br />
Leidens vermittelt ist, heißt: Es gibt einen<br />
unabgegoltenen Sinn der Toten, der bereits<br />
Besiegten und Vergessenen. Das Sinnpotential<br />
der Geschichte hängt nicht nur an den<br />
Überlebenden, an den Erfolgreichen und<br />
Durchgekommenen! ‚Sinn‘ ist eben keine<br />
den Siegern reservierte Kategorie! <br />
Wenn das europäische Doktorandenkolloquium<br />
in Lublin dem Grauen der Shoah<br />
in Majdanek eingedenk wird und die Spuren<br />
der Geschichte in der Gegenwart zu verstehen<br />
sucht, dann dürfen die Begegnungen<br />
in Lublin von Vergegenwärtigung und Wiederholung<br />
geprägt sein – so schmerzhaft<br />
Vergegenwärtigung und Wiederholung<br />
auch sein können.<br />
Ermutigt sein dürfen wir zu einer solchermaßen<br />
erinnerungsgeleiteten Aneignung<br />
des Vergangenen durch die selbst erinnerungsgeleitete<br />
Vermittlung unseres eigenen<br />
Glaubens. Jeglichen triumphalistischen<br />
christlichen Glauben mahnt die Erinnerungsstruktur<br />
seines „Grunddatums“, dass es gar<br />
kein wirkliches Verständnis der Auferweckung<br />
gibt, „das nicht über das Gedächtnis<br />
des Leidens entfaltet werden müßte [...] Ein<br />
solcher Auferweckungsglaube drückt sich<br />
[...] darin aus, dass er - ‚kontrafaktisch‘ -<br />
dazu befreit, auf die Leiden und Hoffnungen<br />
der Vergangenheit zu achten und sich der<br />
Herausforderung der Toten zu stellen.<br />
Vgl.: Concilium. Internationale Zeitschrift<br />
für Theologie, Heft 1 (23. Jg.), 1987: Exodus,<br />
ein Paradigma mit bleibender Wirkung.<br />
Metz, Johann Baptist<br />
(19844): Glaube in Geschichte<br />
und Gesellschaft,<br />
Mainz, S. 99.<br />
25
Ich glaube, weil ich lebe<br />
von Konrad Schuller<br />
Kein Land Europas ist katholischer <strong>als</strong> Polen. Doch nun ist an die Stelle des<br />
patriotischen Gottvertrauens ein nationaler Klerikalismus getreten.<br />
Toruñ und Wadowice: Zwischen einer<br />
schroffen gotischen Festung im Norden Polens<br />
und einem freundlichen Marktflecken<br />
mit Zwiebeltürmen und hellen Bürgerhäusern<br />
im Süden oszilliert die Religiosität dieser<br />
Nation. In Wadowice wurde vor 86 Jahren<br />
Karol Wojtyla geboren, der Mann, der<br />
<strong>als</strong> Johannes Paul II. für die Überwindung<br />
des Kommunismus ebenso stand wie für<br />
die europäische Öffnung seines Landes und<br />
den Dialog zwischen Christen und Juden.<br />
In Toruñ, dem früheren Thorn, dagegen<br />
hat Radio Maryja, der einflußreichste katholische<br />
Sender Europas, seinen Sitz. Unter<br />
der Führung des Redemptoristenpaters<br />
Tadeusz Rydzyk warnt er vor den mutmaßlichen<br />
Machenschaften deutscher und jüdischer<br />
Dunkelmänner, die Polen mit Hilfe<br />
der Europäischen Union versklaven wollen,<br />
bejaht das Verbot von Paraden Homosexueller<br />
und führt Beschwerde darüber, daß Juden<br />
unter dem Mantel von Eigentumserstattung<br />
„Lösegeld” von Polen kassierten. Als<br />
im Herbst die Partei der Brüder Kaczynski<br />
an die Macht kam, ist Radio Maryja zum<br />
Haussender der Regierung geworden.<br />
Kein Land Europas ist katholischer <strong>als</strong><br />
Polen. Nicht nur, daß nach einer Umfrage<br />
85 Prozent sich <strong>als</strong> „religiös” beschreiben;<br />
die Geschichte dieses Staates, seine generationenlange<br />
Austilgung ebenso wie die<br />
Wiederkehr, ist untrennbar mit der Kirche<br />
verbunden. In der Zeit der Teilung war die<br />
Schwarze Madonna von Tschenstochau,<br />
„Königin Polens” seit ihrer symbolischen<br />
Vermählung mit König Jan III. Kazimierz,<br />
der Fluchtpunkt der Nation. Später, in der<br />
Schlußphase des Kommunismus, legitimierte<br />
der Pole Johannes Paul II. mit dem<br />
biblischen Aufruf „Fürchtet Euch nicht!”<br />
den Widerstand der Gewerkschaft „Solidarität”.<br />
Lech Walesa heftete sich das Bildnis<br />
der Madonna ans Revers, und die „Solidarität”<br />
wuchs mitten in der Diktatur auf zehn<br />
Millionen Mitglieder. Der alte Mythos vom<br />
„Christus unter den Völkern”, die Erzählung<br />
vom gläubigen Polen, das durch Zerstückelung<br />
und Höllenfahrt zur Auferstehung<br />
strebt, fand in der Wende triumphale<br />
Bestätigung.<br />
Beide Seiten geben und nehmen. Wie<br />
der Papst Polens Widerstand gegen die sowjetische<br />
Fremdherrschaft stärkte und damit<br />
zuletzt die Feinde der Kirche besiegte,<br />
so konnte die Nation durch ihre Bindung an<br />
die Kirche den Kampf um ihre Freiheit gewinnen.<br />
Ihr Sieg bestätigte zuletzt die alte<br />
polnische Gleichung: Wer für den Glauben<br />
kämpft, kämpft für die Nation, und wer die<br />
Nation verteidigt, steht für den Glauben.<br />
Die Politik der Brüder Kaczynski und des<br />
Senders Radio Maryja ist der Versuch, diese<br />
Gleichung aus Zeiten der Diktatur in die<br />
offene Gesellschaft herüberzuretten. An die<br />
Stelle von Wojtylas patriotischem Gottvertrauen<br />
ist dabei jedoch eine rigidere Variante<br />
getreten, der nationale Klerikalismus von<br />
Thorn. Die „Generation Radio Maryja” mit<br />
26
ihren engen Verbindungen zur Regierungspartei<br />
der Kaczynskis ist dabei noch mehr<br />
<strong>als</strong> die Generation der „Solidarität” davon<br />
überzeugt, daß das Wohl der Nation nur im<br />
Licht der Glaubenswahrheit zu finden sei.<br />
Wie einst Walesa auf der Lenin-Werft leitet<br />
Ministerpräsident Marcinkiewicz seinen<br />
Auftrag vom Höchsten ab. „Ich lebe, weil<br />
ich glaube, und ich glaube, weil ich lebe”,<br />
hat er einmal gesagt.<br />
Diese neue Variante der altpolnischen<br />
Symbiose von Nation und Kirche ist parteipolitisch<br />
nutzbar. Der Aufstieg des Präsidenten<br />
Lech Kaczynski hat viel damit zu<br />
tun, daß er im April 2005 <strong>als</strong> Warschauer<br />
Bürgermeister die Trauerfeiern für Johannes<br />
Paul II. so zu organisieren verstand, daß<br />
er selbst <strong>als</strong> Verkörperung des nationalen<br />
Schmerzes erschien. Der jüngste Versuch,<br />
die Synergien des Glaubens zu nutzen, war<br />
sein mittlerweile ad acta gelegtes Projekt, in<br />
diesem Frühjahr in zeitlicher Nähe zum bevorstehenden<br />
Besuch von Wojtylas Nachfolger<br />
Benedikt XVI. vorgezogene Parlamentswahlen<br />
zu halten. Kaczynskis Stab<br />
versprach sich von der erwarteten Hochstimmung<br />
dieser Tage maximale Mobilisierung<br />
an den Urnen.<br />
Dreh- und Angelpunkt dieser Synthese<br />
ist Radio Maryja. Einerseits unterstützt der<br />
Sender die nationalkatholische Regierungspartei,<br />
andererseits greift diese erfolgreich<br />
auf den Ideenfundus von Thorn zurück.<br />
Ihre Skepsis gegen Europa, ihre Aversion<br />
gegen Homosexualität, ihr Antiliberalismus<br />
sowie ihr reizbares Nationalbewußtsein - all<br />
das hat hier seine Wurzeln. Radio Maryja<br />
wiederum hat Wettbewerbsvorteile. Die<br />
Brüder Kaczynski verschaffen Pater Rydzyk<br />
exklusive Termine bei politischen Schlüsselereignissen,<br />
und Marcinkiewicz‘ Minister<br />
sind regelmäßige Gäste in den Studios<br />
von Thorn.<br />
Die andere Seite der polnischen Kirche,<br />
die Europa zugewandte Kirche von Wadowice,<br />
hat zu dieser Entwicklung lange geschwiegen.<br />
Johannes Paul II. ließ Radio<br />
Maryja gewähren, weil er die seelsorgerische<br />
Bedeutung des Senders erkannte und weil<br />
er wußte, daß die Autorität seiner Person<br />
Rydzyks Ausfälle jederzeit in den Schatten<br />
stellen konnte. Seit seinem Tode aber sehen<br />
sich seine Freunde im Lande, sein früherer<br />
Sekretär Kardinal Dziwisz etwa oder Polens<br />
Primas Glemp, gezwungen, gegen<br />
Thorn in Stellung zu gehen. Benedikt XVI.<br />
steht dabei auf ihrer Seite. Im Herbst rief er<br />
„die katholischen Radio- und Fernsehsender”<br />
zunächst in allgemeinem Ton auf, die<br />
„Autonomie der politischen Sphäre” zu respektieren.<br />
Im März, nachdem sein Aufruf<br />
ungehört verhallt war, hat sein Nuntius in<br />
Polen die Ordensoberen von Pater Rydzyk<br />
unverblümt aufgefordert, zur Kontrolle von<br />
Radio Maryja „entschlossene und wirksame<br />
Maßnahmen” zu ergreifen.<br />
Mittlerweile ist der Konflikt offen entbrannt.<br />
Kardinal Dziwisz, der vor einem<br />
möglichen Mißbrauch der bevorstehenden<br />
Papstreise durch die Partei der Brüder Kaczynski<br />
gewarnt hatte, wird von der Präsidialkanzlei<br />
unverhohlen attackiert, und sogar<br />
Benedikt XVI. wird von den Unterstützern<br />
Radio Maryjas wegen seiner deutschen<br />
Herkunft ins Zwielicht gestellt. Der Streit<br />
ist bitter, denn wohl keiner Nation Europas<br />
ist die päpstliche Formel von der „Autonomie”<br />
der politischen Sphäre fremder <strong>als</strong> der<br />
polnischen, die ihr Überleben so oft gerade<br />
dem Gegenteil zu verdanken hatte, der<br />
Symbiose von Patriotismus und Religion.<br />
Der Abschied von der alten Gleichung<br />
fällt Polen um so schwerer, <strong>als</strong> er zugleich<br />
den Abschied von den besten Traditionen<br />
der „Solidarität” bedeutet, den Abschied<br />
von einer Epoche, in der man, inspiriert von<br />
Karol Wojtyla, politisch stark war, weil man<br />
im Glauben nicht schwankte. Immer mehr<br />
polnische Christen aber verstehen heute,<br />
daß die Demokratie andere Forderungen<br />
stellt <strong>als</strong> die Diktatur. Sie wissen, daß ein<br />
Glaube, der im Kommunismus aus Liebe<br />
zum Menschen politisch werden mußte,<br />
in der Demokratie aus genau demselben<br />
Grunde zur Zurückhaltung bestimmt sein<br />
kann. Einer der schärfsten Kritiker der Kirche<br />
von Thorn, der Lubliner Erzbischof Zycinski,<br />
hat es auf den Punkt gebracht: „Die<br />
Kirche verbindet sich mit keinem Führer<br />
und keiner Partei, denn Christus ist für alle<br />
gestorben.”<br />
27
Autor<br />
Konrad Schuller, geb. 1961 in Kornstadt/Siebenbürgen<br />
(heute Brasov/Rumänien), Studium<br />
der Geschichte und Volkswirtschaftslehre<br />
in München, lernte seinen Beruf an<br />
der Münchener Journalistenschule. Nach<br />
Stationen in Rumänien (für die Süddeutsche<br />
Zeitung), Rom (für die dpa) und London<br />
(<strong>als</strong> Redakteur des BBC-Worldservice),<br />
trat er 1992 in die Redaktion der Frankfurter<br />
Allgemeinen Zeitung ein. Derzeit Korrespondent<br />
der F.A.Z. in Warschau.<br />
Quelle<br />
F.A.Z. Journal Europa, 09.05.2006. Wir<br />
danken dem Autor für die freundliche Genehmigung<br />
zum Abdruck!<br />
28
Kapitel II<br />
Lubliner Geschichte –<br />
cusanische Schlaglichter<br />
31
Die Union von Lublin 1569 –<br />
Sonderweg polnischer Geschichte?<br />
von Daniel Legutke<br />
In der Lubliner Union schlossen sich das Königreich Polen und das Großfürstentum<br />
Litauen zu einem förmlichen Staatenbund zusammen. Polen wurde<br />
dadurch zum größten Flächenstaat Mittel- und Osteuropas. Als Adelsrepublik<br />
Der Adel Polens konnte sich im späten<br />
Mittelalter erfolgreich gegen eine zunehmende<br />
Bündelung von Machtbefugnissen<br />
beim Monarchen zur Wehr setzten. Dieser<br />
Kampf zwischen König und Ständen spielte<br />
sich verstärkt seit dem späten Mittelalter<br />
ähnlich in vielen Regionen Europas ab. Fürsten<br />
oder Könige benötigten zunehmend<br />
Geld für die Kriegsführung, reine Ritterheere<br />
erwiesen sich <strong>als</strong> nicht mehr effizient.<br />
Der Adel ließ sich die an den König abgeführten<br />
Steuern in der Regel mit weiträumigen<br />
Mitspracherechten vergelten. Wo es<br />
möglich war, erschloss sich die Krone daher<br />
alternative Finanzquellen. Dabei griffen die<br />
Zentralgewalten oft auf die Ressourcen finanziell<br />
erstarkender Städte zurück, erhöhten<br />
damit die Stadtbürger und umgingen<br />
den Adel.<br />
In Polen gab es keine flächendeckende<br />
städtische Struktur, so dass der Adel im Gegenzug<br />
für seine Beteiligung am Allgemeinen<br />
Aufgebot des Heeres den politischen<br />
Spielraum der Krone immer mehr einzuengen<br />
vermocht. Als im 15. Jahrhundert die<br />
Kriegführung technisiert wurde, musste<br />
das Steueraufkommen wiederum dramatisch<br />
erhöht werden. Damit waren die Anfänge<br />
der polnischen Adelsrepublik gelegt.<br />
Der Rat des Königs und die Versammlung<br />
der Adligen institutionalisierten sich gegen<br />
Ende des 15. Jahrhunderts im Sejm mit seinen<br />
zwei Kammern, der Landbotenkammer<br />
des Kleinadels und dem Senat der Magnaten.<br />
Der Sejm tagte in unregelmäßigen<br />
Abständen, zeitweise jährlich, dann wieder<br />
mit größeren Pausen, je nach der Anzahl<br />
und Dringlichkeit der Vorlagen. Für<br />
die Vorbereitung der Sejm-Voten und die<br />
Wahl der Abordnungen in den Sejm bildeten<br />
sich auf den unteren Ebenen der 21<br />
(im Jahr 1569) Wojewodschaften die Sejmiki,<br />
regionale Versammlungen, bei der hoher<br />
und niederer Adel gemeinsam tagten. Das<br />
Großfürstentum Litauen, in dem sich ähnliche<br />
Prozesse abspielten, kannte aber bis zur<br />
Mitte des 16. Jahrhunderts de facto nur den<br />
Senat, eine Landbotenkammer des Adels<br />
existierte nicht.<br />
Seit 1377 hatte Jogaila die Großfürstenwürde<br />
Litauens inne. Durch seine Heirat<br />
mit der Königstochter Jadwiga, der Erbin<br />
Polens, seine Taufe und anschließende<br />
Krönung <strong>als</strong> König von Polen im Jahr 1386<br />
wurden die Reiche Polen und Litauen erstm<strong>als</strong><br />
unter einem Herrscher vereint. Als<br />
Christ führte er den Namen Władisław II.<br />
Jagiełło. Die Großfürstenwürde der Jagiellonen<br />
war in Litauen erblich. In Polen wurden<br />
in den darauf folgenden zwei Jahrhunderten<br />
ebenfalls immer wieder Jagiellonen auf den<br />
Thron gewählt, ohne dass Polen formal auf-<br />
32
hörte, eine Wahlmonarchie zu sein. Beide<br />
jagiellonischen Staaten wurden im 15. Jahrhundert<br />
gleichermaßen vom expansiven<br />
Charakter des Ordensstaates im Norden<br />
und Westen, dem russischen Fürstentum<br />
im Osten, und den Tataren – später den Osmanen<br />
– im Südosten und Süden bedroht.<br />
Immer wieder lancierten die Krone und der<br />
Sejm Projekte, mit denen die beiden Reiche<br />
zu besserer Verteidigung enger aneinander<br />
gebunden werden sollten. Gemeinsame militärische<br />
Aktionen der personal vereinten<br />
Kronen versprachen und zeitigten größere<br />
Erfolge in dieser Gefahrenabwehr <strong>als</strong> die<br />
einzelnen Ritterheere.<br />
Allerdings widersetzten sich vor allem<br />
die litauischen Magnaten einer weiteren<br />
Annäherung beider Reiche. Sie gaben sich<br />
mit einer militärischen Unterstützung<br />
durch Polen zufrieden und fürchteten einen<br />
wachsenden Einfluss des Kleinadels,<br />
der in Litauen nur sehr rudimentär an Entscheidungen<br />
beteiligt wurde. In der zweiten<br />
Hälfte des 16. Jahrhunderts gewann die<br />
Einigungsbewegung dennoch an Kraft, <strong>als</strong><br />
die militärische Bedrohung der litauischen<br />
Reichsteile extrem zunahm und die Litauer<br />
stärker <strong>als</strong> je zuvor auf die polnische Unterstützung<br />
angewiesen waren. Die Reichstage<br />
seit der Mitte des 16. Jahrhunderts befassten<br />
sich alle mit dem Verhältnis beider<br />
Staaten zueinander. 1569 wurde die Union<br />
dann gegen den Widerstand der litauischen<br />
Magnaten auf dem Sejm zu Lublin durchgesetzt<br />
und dem Doppelstaat eine einheitliche<br />
Verfassung gegeben. Fortan sollte ein<br />
gemeinsamer Sejm eine gemeinsame Außen-<br />
und Verteidigungspolitik festlegen<br />
und eine gemeinsame Wahl des Königs und<br />
Großfürsten stattfinden.<br />
Nach dem Tod des letzten Jagiellonen<br />
nur drei Jahre nach dem Lubliner Unionssejm<br />
setzte die Phase polnisch-litauischer<br />
Wahlmonarchien ein. Der Adel nutzte die<br />
Phase des ersten Interims zu einer weiteren<br />
Beschränkung königlicher Prärogative in<br />
den Articuli Henriciani, so genannt nach<br />
dem ersten Wahlkönig Heinrich von Anjou.<br />
Fortan ging jede Neuwahl mit einer<br />
Beschwörung bzw. Neufassung der pacta<br />
conventa, der königlichen Wahlkapitulation,<br />
einher. Oft einigte man sich gerade deshalb<br />
auf einen ausländischen Kandidaten,<br />
weil man sich von ihm erhoffte, dass er über<br />
dem Streit verschiedener Interessengruppen<br />
zu stehen vermochte. Bei jeder Wahl waren<br />
alle Adligen zugelassen, zum ersten Wahltag<br />
fanden sich ca. 50.000 stimmberechtigte<br />
Adlige auf dem Wahlfeld bei Warschau<br />
ein.<br />
Vielfach wurde nach denen der polnischlitauischen<br />
Entwicklung vergleichbaren<br />
Prozessen in anderen europäischen Staaten<br />
Ausschau gehalten. Besonders erhellend ist<br />
der Blick auf die Niederlande, wo im 16.<br />
Jahrhundert erstaunlich ähnliche Prozesse<br />
abliefen, die das Verständnis der Entstehung<br />
und Funktionsweise der polnischen<br />
Republik erleichtern. 1579 hatten sich einzelne<br />
niederländische Provinzen in der<br />
Union von Utrecht zusammengeschlossen,<br />
in der sie sich ihrer hergebrachten Freiheitsrechte<br />
versicherten und gemeinsam zu ihrer<br />
Verteidigung gegen den Landesherrn Philipp<br />
II. von Spanien einstehen wollten. Im<br />
Plakaet van Verlatinge sagten sich diese Provinzen<br />
zwei Jahre später von ihrem Herren<br />
los und erklärten sich für unabhängig und<br />
frei. Zum Statthalter wurde Wilhelm von<br />
Oranien gewählt. Die Republik der Vereinigten<br />
Niederlande war entstanden. Dabei<br />
war anders <strong>als</strong> in Polen das Bürgertum aus<br />
dem Ringen um Steuerbewilligung und<br />
Zentralisierung <strong>als</strong> Sieger hervorgegangen.<br />
Jede der sieben beteiligten Provinzen entsandte<br />
Vertreter in die Gener<strong>als</strong>taaten, die<br />
gemeinsame Ständeversammlung. Sie sahen<br />
sich selbst <strong>als</strong> Zusammenschluss souveräner<br />
Territorien. Außen- und Sicherheitspolitik<br />
wurde der Union übertragen, alle anderen<br />
Themen verblieben den Provinzen zur Entscheidung.<br />
Die Parallelen sind augenfällig,<br />
die zeitliche Verschränkung mit den polnischen<br />
Ereignissen ist bemerkenswert.<br />
Zwar waren auf der einen Seite der Adel,<br />
auf der anderen das Bürgertum fortan mit<br />
der Führung der Geschicke des Landes<br />
betraut, die Anzahl der partizipierenden<br />
Personen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung<br />
wich aber nur geringfügig voneinander<br />
ab. Ca. 10 % der Bevölkerung gehörten<br />
in Polen dem Adel an und besaßen<br />
so Mitwirkungsrechte an der Politik. Höher<br />
ist der Partizipationsgrad in der Republik<br />
33
keinesfalls anzusetzen. In beiden Ländern<br />
lassen sich dagegen im 17. und vermehrt<br />
im 18. Jahrhundert Abschottungstendenzen<br />
ausmachen, durch die sich der Kreis der<br />
wirklich einflussreichen Personen verengte.<br />
Eine abnehmende soziale Mobilität, eine<br />
zunehmende Oligarchisierung, die Aufspaltung<br />
der Stimmberechtigten in Patrone und<br />
Klientel, die Bildung von Interessengruppen<br />
etc. sollten aber nicht allzu schnell <strong>als</strong> Ausdruck<br />
zunehmender Funktionsunfähigkeit<br />
beider Staaten interpretiert werden. In Polen<br />
stieg schon im Laufe des 16. Jahrhundert der<br />
Wert umfassender Bildung innerhalb des<br />
Adels erheblich an, <strong>als</strong> das Rede- und Überzeugungsvermögen<br />
im Sejm an Bedeutung<br />
gewannen. Diese strengen Regeln folgende<br />
Redekunst erwarben sich Adlige an bedeutenden<br />
Universitäten im Ausland wie auch<br />
an der eigenen blühenden Krakauer Universität.<br />
In den Niederlanden wurde 1575 die<br />
Universität Leiden ebenfalls mit dem Ziel<br />
gegründet, fähige Staatsbeamte und Politiker<br />
hervorzubringen, die den komplexen<br />
Anforderungen einer partizipativen Regierungsform<br />
gewachsen waren. Eine weitere<br />
strukturelle Übereinkunft beider Ständestaaten<br />
lag in der von Zeitgenossen bewunderten<br />
oder verdammten religiösen Toleranz.<br />
Polen-Litauen war europaweit bekannt<br />
<strong>als</strong> Sammelbecken aller devianter Glaubensrichtungen<br />
des 16. Jahrhunderts. Dennoch<br />
kam der katholischen Kirche eine bevorrechtigte<br />
Stellung zu, nur deren Bischöfe<br />
hatten Sitz und Stimme im Senat. In den<br />
Niederlanden fungierte die calvinistische<br />
Kirche <strong>als</strong> einzige offiziell anerkannte Kirche,<br />
die aber keine Staatskirche war. Beide<br />
gingen in ihrer Toleranz jedoch weit über<br />
das Übliche hinaus.<br />
Beide Republiken traf schon der zeitgenössische<br />
Vorwurf ineffizienter Organisation<br />
und langsamer, von eigensüchtigen Interessen<br />
der jeweiligen Vertreter geprägter<br />
und gebremster Entscheidungsfindung. Die<br />
Berichte der Botschafter fremder Mächte<br />
sind voller Verweise und geprägt von grundsätzlichem<br />
Misstrauen gegenüber allen republikanischen<br />
Herrschaftsmodellen. Negativ<br />
war das sicher aus der Position des absolutistischen<br />
Machtstaates, anders stellte sich das<br />
allerdings aus der Sicht der Beteiligten dar.<br />
Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein<br />
wurden Erfolg und Misserfolg der Union<br />
aus der Perspektive der polnischen Teilungen<br />
und der Katastrophen des 20. Jahrhunderts<br />
bilanziert. Je nach Standort – polnisch oder<br />
litauisch, russisch oder deutsch – fielen die<br />
Wertungen unterschiedlich aus. Wichtig<br />
scheint mir jedoch: der polnische Ständestaat<br />
funktionierte, und zwar von ca. 1500<br />
bis 1795 fast 300 Jahre lang! Die Vorwürfe<br />
von Ineffizienz und Verteidigungsunfähigkeit<br />
treffen nur begrenzt zu. Sehr lange war<br />
Polen durchaus in der Lage, sich bei Konflikten<br />
abseitig zu halten oder sich seiner<br />
Gegner wirkungsvoll zu erwehren. Polen<br />
konnte allerdings keine expansive Außenpolitik<br />
führen. Und erst <strong>als</strong> alle umliegenden<br />
Staaten die Teilungen beschlossen hatten,<br />
war ihnen Polen ausgeliefert. Übrigens:<br />
Preußen stand noch im Siebenjährigen<br />
Krieg kurz vor dem gleichen Schicksal. Die<br />
russische Armee marschierte bereits Richtung<br />
Berlin und wurde nur vom in jenen<br />
Tagen zufällig auf den Thron gelangten und<br />
von Friedrich II. besessenen Zaren Peter III.<br />
gestoppt und gegen Österreich, den ehemaligen<br />
Verbündeten, gewendet.<br />
Bei näherer Betrachtung erweist sich,<br />
dass die polnische Republik sehr lange in<br />
der Lage war, den Erfordernissen eines<br />
(früh)neuzeitlichen Staates zu genügen. Nur<br />
wählte sie dazu eben nicht den Weg einer<br />
nationalen zentralen Monarchie, die sich<br />
im 19. Jahrhundert zum Leitmodell entwickelte<br />
und unser Bild vom erfolgreichen<br />
Staat bis weit in das 20. Jahrhundert bestimmen<br />
sollte. Mit seinem Weg stand Polen allerdings<br />
– theoretisch gesprochen – keineswegs<br />
am Rande europäischer Entwicklung,<br />
sondern ging einen Weg, den andere Staaten<br />
wie die Niederlande oder die Schweizer Eidgenossenschaft<br />
ebenfalls beschritten.<br />
34
Zwischen Szeroka- und Krawiecka-Straße:<br />
Erinnerung an 500 Jahre jüdisches Leben in<br />
Lublin<br />
von Ruth Jung<br />
Eine Straße, Grodska, führt mich abwärts. Kinder spielen herum. Es wird<br />
bunt, sehr lebhaft; ich bin in die Judenstadt geraten. Häuser sind gelb und rosa<br />
bemalt. Ein Tor biegt sich über die Straße grellrot; oben wohnen Menschen ...<br />
Ich sehe auch die Wohnung auf dem Torbogen, die Menschen, die zum Fenster<br />
hinaussehen, die Menschen in den Nachbarhäusern. Jammer über Jammer! Und<br />
da wagt man von der architektonischen Schönheit des Tores zu sprechen. (Alfred<br />
Döblin, Reise in Polen, 1925)<br />
Döblin, der Berliner, der seine Stadt nur<br />
selten und ungern verließ, wollte wissen, wer<br />
„die Juden“ seien – die, zu denen er doch gehörte,<br />
er, der Assimilierte, der Ungläubige,<br />
der Westjude. 1925 besuchte und beschrieb<br />
er ein fremdes Land, eine ihm fremde Welt.<br />
Die Essays seiner „Reise in Polen“ wurden<br />
wider Willen zum literarischen Denkmal<br />
des polnischen Judentums. Seine Skizzen<br />
Lubliner jüdischen Lebens zeigen allerdings<br />
eine fragmentierte,<br />
großenteils<br />
verarmte, somit sehr<br />
typische Gemeinde<br />
der 1920er Jahre, deren<br />
Lebensumstände<br />
und Ignoranz ihn,<br />
den säkularen Intellektuellen,<br />
geradezu<br />
deprimierten. Tatsächlich<br />
stimmen<br />
populäre und wissenschaftliche<br />
Darstellungen<br />
polnisch-jüdischer Geschichte darin<br />
überein, das Ende des 18. Jahrhunderts zum<br />
Ende einer Blütezeit zu erklären. Die bewegten<br />
Jahrzehnte zwischen 1795 und 1939<br />
finden demgegenüber weit weniger Beachtung.<br />
Zumal die Geschichte von Shoa und<br />
Weltkrieg alles in ihren Schatten zu stellen<br />
scheint.<br />
Was Zahlen sagen<br />
Titelseite des Lubliner Tugblat, Lublins jiddischer Tageszeitung<br />
(1918)<br />
Für Lublin bedeutete die systematische<br />
Ermordung der europäischen Juden das<br />
Ende einer etwa 500 Jahre alten Gemeinde,<br />
die mit zuletzt 45.000 Mitgliedern circa ein<br />
Drittel der Einwohner<br />
umfaßte. Die<br />
die Shoa überlebten<br />
und nach Lublin<br />
zurückkehrten oder<br />
zuwanderten, verließen<br />
Polen während<br />
der Nachkriegsjahre<br />
oder aber 1968<br />
wegen des anhaltenden,<br />
immer wieder<br />
gewalttätigen,<br />
mit Billigung oder<br />
sogar auf Initiative der Regierung propagierten<br />
Antisemitismus. So bleibt nur die<br />
Erinnerung, z. B. das 1997 gestartete Projekt<br />
des Lubliner Zentrums „Brama Grodzka“,<br />
das Architektur und Charakter von Alt-<br />
35
stadt und Judenviertel dokumentieren und<br />
präsentieren will.<br />
Dieses Judenviertel, die jüdische Bevölkerung<br />
der Stadt und des Bezirks Lublin,<br />
zählte schon im 15. Jahrhundert zu den<br />
größten in Polen und hatte eine kunsthistorisch<br />
bedeutende Synagoge vorzuweisen,<br />
die „Maharshal Shul“ von 1567. Obwohl die<br />
Juden mit einem Bevölkerungsanteil von<br />
ungefähr 10 Prozent die größte Minderheit<br />
Polens bildeten, gab es Landstriche, in denen<br />
sie keine Rolle spielten, während die Juden<br />
in Wilna, Posen, Lublin, Krakau und<br />
Lemberg mit 30 bis 50 Prozent der Einwohnerschaft<br />
das Leben der Stadt prägten. Die<br />
Shtetl, Kleinstädte mit überwiegend oder<br />
ausschließlich jüdischer Bevölkerung, entstanden<br />
erst im 18. und 19. Jahrhundert.<br />
Charakteristika jüdischen Lebens in Polen<br />
Die für Europa ungewöhnliche Größe<br />
der jüdischen Gemeinschaft in Polen erklärt<br />
sich aus der lange Zeit vergleichsweise<br />
judenfreundlichen Politik der polnischen<br />
Könige. Juden, die 1492 aus Südeuropa,<br />
blieb auch die jüdische Gemeinschaft Polens<br />
nicht von Ritualmordprozessen, Verfolgungen<br />
und Anfeindungen verschont<br />
– darunter das große Trauma des Ostjudentums<br />
schlechthin: 1648, der Aufstand und<br />
Raubzug des ukrainischen Kosaken-Hetman<br />
Chmielnicki, dessen Gewaltexzesse<br />
ein Viertel der jüdischen Bevölkerung das<br />
Leben kosteten.<br />
Lublin – Zentrale jüdischer Selbstverwaltung<br />
Trotzdem ermöglichte der vom Königshaus<br />
verbürgte Schutz der jüdischen<br />
Gemeinden und ihrer Autonomie einen<br />
wirtschaftlichen Aufstieg, der sich in vielen<br />
Lebensbereichen widerspiegelte. So<br />
entwickelte sich Lublin zu einer zentralen<br />
Markt- und Messestadt, in der sich, zunächst<br />
zufällig, die Vertreter der jüdischen<br />
Gemeinden der ganzen Region einfanden.<br />
Um die Steuererhebung zu vereinfachen,<br />
errichtete König Sigismund I (1506-1548)<br />
daraufhin vier jüdische Autonomie-Bezirke,<br />
<strong>als</strong> deren oberstes Verwaltungsorgan<br />
das Lubliner Treffen, der sogenannte „Vierländersejm“<br />
oder „Waad arba arazot“, institutionalisiert<br />
wurde. Diese Art Landtag mit<br />
Gericht regelte jedoch nicht nur die Steuerverwaltung,<br />
sondern praktisch alle Belange<br />
jüdischen Lebens und hatte seinen Sitz von<br />
1530 bis 1764 in Lublin. Heute schwer nachvollziehbar<br />
wurde gleichzeitig das städtische<br />
Privilegium de non tolerandis Judaeis<br />
aufrechterhalten, weshalb es Juden bis 1862<br />
verboten blieb, innerhalb der Stadtmauern<br />
eine Wohnung zu beziehen.<br />
Jeshiva Chachmej Lublin heute: zusammen mit dem<br />
Alten Friedhof letztes Zeugnis jüdischen Lebens im<br />
Stadtbild von Lublin<br />
Böhmen und Teilen des Deutschen Reiches<br />
vertrieben wurden, fanden hier Zuflucht,<br />
Auskommen und Rechtssicherheit. Sie ersetzten<br />
das in Polen unterentwickelte Stadtbürgertum,<br />
etablierten sich in Handwerk<br />
und Handel und reüssierten <strong>als</strong> Verwalter<br />
und Berater von Adel und Regierung. Juden<br />
übernahmen somit eine wirtschaftliche<br />
Schlüsselfunktion, die sie in Verbindung<br />
mit ihrer religiösen Andersartigkeit leicht<br />
angreifbar machte. Dementsprechend<br />
Lublin – Zentrum jüdischen Geisteslebens<br />
Im 16. Jahrhundert kam es außerdem zur<br />
Gründung mehrerer theologischer Hochschulen,<br />
die in der gesamten jüdischen Welt<br />
großes Ansehen genossen. An der Lubliner<br />
Jeshiva lehrte dam<strong>als</strong> Shalom Shashna<br />
(1500-1558), der „Doctor Judaeorum Lublinensium“,<br />
aus dessen Schule zwei der berühmtesten<br />
Rabbiner Polens hervorgingen:<br />
Moses Isserles, Mitverfasser einer der bedeutendsten<br />
Gesetzesauslegungen des Judentums<br />
(Shulchan Aruch), und Salomon<br />
Luria, der in der Auseinandersetzung mit<br />
36
anderen hermeneutischen Schulen für eine<br />
streng rationale und problemorientierte Auslegung<br />
rabbinischer Literatur stritt (Gegner<br />
des Pilpul). Trotzdem wird der Ehrentitel<br />
„Polnisches Jerusalem“ meist Wilna vorbehalten.<br />
Nach der Reformation, <strong>als</strong> die Konföderation<br />
von Warschau 1573 durch die Anerkennung<br />
der Glaubensfreiheit und der damit<br />
einhergehenden Pluralisierung religiösen Lebens<br />
die Lage der jüdischen Gemeinden zunächst<br />
erleichterte, provozierte die Gegenreformation<br />
einen polnischen Antijudaismus,<br />
wie es ihn bis dahin kaum gegeben hatte.<br />
In dieser Zeit sammelten sich in Lublin die<br />
sogenannten „Judaisierer“, protestantische<br />
und orthodoxe Priester und Gläubige, die<br />
die Trinität ablehnten, die Göttlichkeit Jesu<br />
bestritten, das Primat des Alten Testaments<br />
predigten und den Austausch mit jüdischen<br />
Autoritäten suchten. Die jüdischen Gemeinden<br />
standen dieser Bewegung zunächst<br />
wohlwollend gegenüber, begaben sich somit<br />
aber zwischen die Fronten von katholischer<br />
Obrigkeit und sektiererischen Gruppen,<br />
weshalb sie sich schon bald wieder von diesen<br />
distanzierten.<br />
200 Jahre später wurde die Lubliner Gemeinde<br />
von einer ganz anderen Kontroverse<br />
erschüttert. Diese hatte sich zwischen<br />
den Hamburger Rabbinern Emden und Eybeschütz<br />
entsponnen, wobei man letzteren<br />
verdächtigte, Sabbatianer, <strong>als</strong>o Anhänger<br />
des vermeintlichen Messias Sabbatai Zwi zu<br />
sein, messianische Erwartungen zu schüren<br />
und sich mit magischen Praktiken abzugeben.<br />
Der lange, ja erbitterte, mit gegenseitigen<br />
Bannungen einhergehende Konflikt<br />
– Krisensymptom jüdischer Gemeinde- und<br />
Glaubensautorität – spaltete viele Gemeinden<br />
in ganz Europa, wobei Lublin mehrfach<br />
die Seiten wechselte. Als Mitte des 19. Jahrhunderts<br />
die sogenannten Frankisten, eine<br />
der letzten sabbatianischen Bewegungen,<br />
nach Lublin kommen wollten, hatten sich<br />
die Lubliner sogar auf handgreifliche Auseinandersetzungen<br />
eingestellt und bewaffnet.<br />
Die Bedeutung Lublins <strong>als</strong> Zentrum jüdischer<br />
Gelehrsamkeit und Frömmigkeit<br />
läßt sich auch an den dort ansässigen Druckereien<br />
und ihren Erzeugnissen ablesen,<br />
darunter eine der ersten Ausgaben des jüdischen<br />
Gebetbuches (Machsor, 1550), des<br />
Pentateuch (1557) und Talmud (1559-1577).<br />
Verfolgt man das Verlagsspektrum über die<br />
Jahrhunderte, zeigt sich, daß Lublin ein Ort<br />
traditionell rabbinischer Studien blieb. Die<br />
großen Kontroversen um Chassidismus und<br />
Aufklärung spielten sich andernorts ab –<br />
auch wenn der Lubliner Rabbi Isaak Jakob,<br />
der „Seher von Lublin“, entscheidend dazu<br />
beitrug, den Chassidismus weit über Südpolen<br />
hinaus zu verbreiten.<br />
Nach dem Goldenen Zeitalter<br />
Zur Zeit der polnischen Teilungen, zu<br />
Beginn des 19. Jahrhunderts, hatte das jetzt<br />
zu Österreich gehörende Lublin seinen<br />
Rang im jüdischen Geistesleben eingebüßt.<br />
Stattdessen gewann die Stadt an Bedeutung<br />
für den polnisch-russischen Handel.<br />
Im jüdischen Viertel (1930er Jahre)<br />
Mit ihm etablierten sich einige jüdische Industrielle,<br />
vor allem in der Zigaretten- und<br />
Lederwarenproduktion, sowie eine jüdische<br />
Arbeiterbewegung. Die Juden Lublins organisierten<br />
sich wie andernorts auch in jüdischen<br />
Parteien und Verbänden, so in der<br />
orthodox-konservativen Agudat Jisroel, in<br />
der Folkspartei, im sozialistischen Bund,<br />
und in den zionistischen Arbeiterparteien<br />
säkularen oder religiösen Zuschnitts (Poalei<br />
und Mizrachi). Diesen Gruppierungen kamen<br />
gerade in der Zwischenkriegszeit, der<br />
37
Ein Wasserträger und<br />
„typischer“ Bewohner des<br />
verarmten jüdischen Viertels<br />
(1930er Jahre)<br />
Zeit der polnischen Unabhängigkeit, wichtige<br />
Funktionen zu. Während die Integrationskraft<br />
der Synagogengemeinde nachließ,<br />
übernahmen sie die Gestaltung des sozialen<br />
und kulturellen Lebens, vor allem in den<br />
Städten.<br />
Mitte des 19. Jahrhunderts hatte man begonnen,<br />
an jüdischen Schulen auch säkulare<br />
Fächer zu unterrichten, zum Teil auf<br />
Polnisch oder Russisch. Ende des 19. Jahrhunderts<br />
wurde die erste zionistisch inspirierte,<br />
hebräisch-sprachige Schule Lublins<br />
gegründet und ein Schulsystem für<br />
Mädchen eingeführt. Alle jüdischen Einrichtungen<br />
litten dabei immer wieder unter<br />
dem zunehmenden Antisemitismus des<br />
19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, in<br />
Lublin speziell unter den Übergriffen der<br />
Studenten der Katholischen Universität.<br />
Die 1930 eingeweihte orthodoxe Rabbinerhochschule<br />
„Jeshiva Chachmej Lublin“,<br />
für deren Gründung, Errichtung und Ausstattung<br />
Rabbi Meir Shapiro (1887-1933)<br />
Wohltäter in aller Welt gewinnen konnte,<br />
zählte zu den letzten großen Projekten der<br />
Lubliner Gemeinde und zu den modernsten<br />
Einrichtungen ihrer Art – dazu Döblin:<br />
Es schneit stärker. Trübe warten Verkäufer<br />
in den dunklen Läden, warten vor der Tür.<br />
Fast am Ende der Straße baut man die große<br />
jüdische Hochschule, die der Orthodoxen, eine<br />
Welt-Jeschiwe. Auf der einen Seite der Stadt<br />
steht die katholische Universität, hier diese.<br />
Tausend Menschen, Schüler und Lehrer, sollen<br />
darin unterkommen. Es ist die Provinz.<br />
Die Großstadt betreibt Politik, in der Provinz<br />
folgt die langsame Religion.<br />
Doch die Politik überrollte die „langsame<br />
Religion“ – 1939, kurz nach dem Einmarsch<br />
der Deutschen, mußte die Jeshiva geschlossen<br />
werden, Name und Tradition übertrug<br />
man nach dem Zweiten Weltkrieg auf die<br />
Rabbinerhochschule Detroit, das Gebäude<br />
zählt zu den wenigen Zeugnissen jüdischen<br />
Lebens im heutigen Stadtbild von Lublin.<br />
Belzec – Majdanek – Sobibor<br />
Mit dem Angriff Deutschlands auf Polen<br />
begann der Zweite Weltkrieg und die Auslöschung<br />
einer der größten, ältesten und<br />
vielfältigsten jüdischen Gemeinschaften<br />
Europas. In Lublin wie in anderen Orten<br />
bedeutete dies zuerst die Auflösung der<br />
Gemeinde (1/1940), dann die Errichtung<br />
eines Ghettos (3/1941). Da Stadt und Bezirk<br />
Lublin einen sehr hohen jüdischen Bevölkerungsanteil<br />
hatten, begann man sofort mit<br />
Deportationen. Bis April 1940 wurde noch<br />
darüber verhandelt, alle polnischen Juden<br />
in eine Art „Jüdisches Reservat Lublin“ zu<br />
sperren (vgl. Madagaskar-Plan für reichsdeutsche<br />
Juden!), doch ab 1941/1942 hatten<br />
Transporte in das Gebiet Lublin nur noch<br />
ein Ziel.<br />
Der Zauber(er) von Lublin<br />
Allen, die sich jenseits der Archive und<br />
historischen Abhandlungen auf die Suche<br />
nach den Menschen und Geschichten des<br />
jüdischen Lublin machen wollen, seien die<br />
Romane und Erzählungen von Isaac Bashevis<br />
Singer empfohlen. Da er selbst einige<br />
Jahre in der Kleinstadt Bilgoraj verbracht<br />
hatte, tauchen Lublin und die Shtetl der<br />
Umgebung immer wieder in seinen Werken<br />
auf, so im „Satan in Goraj“ und im „Zauberer<br />
von Lublin“. Singer, der zeitlebens auf<br />
Jiddisch schrieb, wurde 1978 der Literatur-<br />
Nobelpreis verliehen. Wie Alfred Döblin<br />
und Joseph Roth zeugt er mit seinen Werken<br />
von einer gewaltsam abgebrochenen<br />
Tradition, von einer unwiederbringlich zerstörten<br />
Welt.<br />
Literatur<br />
Döblin, Alfred: Reise in Polen, 1925<br />
Singer, Isaac Bashevis: Der Zauberer von<br />
Lublin, 1960<br />
Encyclopaedia Judaica, s. v. Lublin<br />
Haumann, Heiko: Geschichte der Ostjuden,<br />
München 1990<br />
Polonsky, Antony u. a. (Hg.): The Jews in<br />
Old Poland 1000-1795, London/New York<br />
1993<br />
Weinryb, Bernard D.: The Jews of Poland,<br />
A social and economic History of the Jewish<br />
Community in Poland 1100-1800,<br />
Philadelphia 1972<br />
38
Der Distrikt Lublin während des Zweiten<br />
Weltkrieges und die Vernichtung der<br />
polnischen Juden<br />
von Sven Keller<br />
Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges lebten in Polen rund 2 Millionen Juden.<br />
Nur zwei bis drei von Hundert dieser Menschen überlebten den Holocaust. Im<br />
Distrikt Lublin des Generalgouvernements befanden sich mit den Vernichtungslagern<br />
Belzec und Sobibor sowie dem Konzentrations- und Vernichtungslager<br />
Majdanek einige der wichtigsten Zentren des Massenmordes.<br />
In den frühen Morgenstunden des 1. September<br />
1945 überfiel das Deutsche Reich Polen.<br />
Die Armee des östlichen Nachbarn hatte<br />
der mit modernsten Waffen ausgestatteten<br />
Wehrmacht kaum etwas entgegenzusetzen,<br />
obwohl der deutsche Angriff die Polen nicht<br />
unvorbereitet traf. Am 28. September fiel<br />
Warschau, eine Woche später war der erste<br />
„Blitzkrieg“ beendet. Bereits am 17. September<br />
hatte auch die Rote Armee die polnische<br />
Ostgrenze überschritten: Schon vor Kriegsbeginn<br />
hatten die Diktatoren Hitler und<br />
Stalin die zukünftige Beute verteilt, und das<br />
deutsch-sowjetische Abkommen von Brest-<br />
Litowsk vom 8. Oktober 1939 besiegelte die<br />
vierte polnische Teilung. Die dort endgültig<br />
festgelegte Demarkationslinie, die fortan<br />
den deutschen vom sowjetischen Machtbereich<br />
trennte, verlief entlang der Flüsse Bug<br />
und San – und entsprach damit ziemlich genau<br />
der Grenze, die auch heute noch Polen<br />
von Weißrussland und der Ukraine trennt.<br />
Schnell hatte die polnische Bevölkerung<br />
zu spüren bekommen, dass das nation<strong>als</strong>ozialistische<br />
Deutschland keinen „normalen“<br />
Krieg führte: In einem rassischen Verdrängungs-<br />
und Vernichtungsfeldzug sollte die<br />
nation<strong>als</strong>taatliche Existenz Polens, ja sogar<br />
die Erinnerung daran ausgelöscht und<br />
die „lebendigen Kräfte“ des Landes beseitigt<br />
werden; diese Aufgabe fiel vor allem<br />
Der Überfall auf Polen 1939. Quelle: Horst Möller u.a. (Hrsg.), Die<br />
tödliche Utopie. Bilder, Texte, Dokumente, Daten zum Dritten Reich,<br />
München 1999, S. 434 f.<br />
den Einsatzgruppen der SS zu, die mit der<br />
Ausrottung „reichs- und deutschfeindlicher<br />
Elemente“ und der „polnischen Intelligenz“<br />
beauftragt waren; allein bis zum Frühjahr<br />
39
Odilo Globocnik<br />
1940 ermordeten sie zwischen 60.000 und<br />
80.000 Menschen. Mittelfristiges Ziel der<br />
Besatzungspolitik war es, unter zunächst<br />
größtmöglicher Ausplünderung der wirtschaftlichen<br />
Ressourcen neuen „Lebensraum“<br />
für das deutsche Volk zu „germanisieren“.<br />
Die zu dezimierende polnische<br />
Bevölkerung sollte ausgebeutet, auf ein<br />
Helotendasein herabgedrückt und im Stil<br />
eines korrupten, primitiv-despotischen Kolonialregimes<br />
beherrscht werden.<br />
Mit der geglückten Eroberung „neuen<br />
Lebensraums“ im Osten boten sich nun<br />
ganz neue Perspektiven und Möglichkeiten<br />
für die Verwirklichung der nation<strong>als</strong>ozialistischen<br />
Utopie, mithin für die rassische<br />
Neuordnung Deutschlands, bald Europas.<br />
Nach dem Ende der militärischen Operationen<br />
gliederten die deutschen Besatzer weite<br />
Teile West- und Zentralpolens <strong>als</strong> neue<br />
Reichsgaue Wartheland und Danzig-Westpreußen<br />
dem Reich ein. Die „rassisch minderwertigen“<br />
Polen wurden verdrängt und<br />
vertrieben, vor allem ins unter deutscher<br />
Zivilverwaltung stehende, aus dem größten<br />
Teil Zentralpolens gebildete Generalgouvernement.<br />
Binnen kürzester Zeit entwickelte<br />
sich das Generalgouvernement zum Experimentierfeld<br />
der rassistischen NS-Vernichtungspolitik,<br />
der – ohne dabei die Leiden<br />
der übrigen polnischen Bevölkerung gering<br />
zu schätzen – in besonderem Ausmaß die<br />
polnischen Juden zum Opfer fielen.<br />
Rund 2 Millionen polnische Juden gerieten<br />
mit der Eroberung des östlichen Nachbarn<br />
in den deutschen Herrschaftsbereich;<br />
damit hatte sich die Zahl der Juden, die<br />
dem nation<strong>als</strong>ozialistischen Zugriff ausgeliefert<br />
waren, schlagartig versechsfacht. Insbesondere<br />
der Distrikt Lublin, der zuvor im<br />
Herzen Polens gelegen hatte und nun an die<br />
äußerste Peripherie des deutschen Machtbereichs<br />
gerückt war, geriet schon früh in den<br />
Focus der bald einsetzenden Planungen einer<br />
„territorialen“ Endlösung der Judenfrage:<br />
Zwischen Weichsel und Bug sollte<br />
ein „Judenreservat“, wahlweise auch <strong>als</strong><br />
„Reichs-Ghetto“ oder „Naturschutzgebiet“<br />
tituliert, für die Juden aus dem Reich eingerichtet<br />
werden. Offen formuliertes Ziel war<br />
der indirekte Völkermord, denn das unwirtliche,<br />
sumpfige Gebiet – so das Kalkül<br />
– würde quasi von selbst zu einer starken<br />
Dezimierung der Juden führen. Über einige<br />
„Probedeportationen“, die Nisko am San<br />
zum Ziel hatten, kam der Plan jedoch nicht<br />
hinaus; er scheiterte an der Opposition der<br />
Zivilverwaltung des Generalgouvernements<br />
gegen ein Judenreservat auf ihrem Gebiet.<br />
Ersatzweise rückte in Berlin mit dem Westfeldzug<br />
der Plan in den Vordergrund, die<br />
europäischen Juden auf die französische Insel<br />
Madagaskar zu deportieren.<br />
Im Generalgouvernement verlagerte<br />
sich die Steuerung der Judenverfolgung<br />
damit auf die lokale Ebene, wo die Verantwortlichen<br />
vor Ort ein erhebliches Maß<br />
an Initiative bei der Lösung des „Judenproblems“<br />
entwickelten. Als die Deportation<br />
der Juden nach dem Scheitern auch<br />
des Madagaskar-Projekts auf unbestimmte<br />
Das Generalgouvernement<br />
Zeit aufgeschoben wurde, begann die Besatzungsverwaltung<br />
vor Ort, die Juden in<br />
Ghettos zu pferchen: Dies sollte sowohl die<br />
Ausbeutung ihrer Arbeitskraft rationalisieren<br />
<strong>als</strong> auch durch katastrophale Lebensbedingungen<br />
zu möglichst vielen Todesopfern<br />
führen. In der Stadt Lublin bestand ein abgegrenzter<br />
jüdischer Wohnbezirk seit dem<br />
März 1941; er war in direktem Zusammenhang<br />
mit dem beginnenden Aufmarsch der<br />
Wehrmacht für das Unternehmen Barbarossa<br />
errichtet worden.<br />
40
Der entscheidende Wandel hin zum direkten<br />
Massenmord an den Juden vollzog<br />
sich in Polen im Herbst 1941. Zu diesem<br />
Zeitpunkt war bereits absehbar, dass der<br />
zwischenzeitlich gefasste Plan, alle Juden<br />
des deutschen Herrschaftsbereichs in die<br />
Sowjetunion (etwa in die Pripjet-Sümpfe<br />
oder das Eismeer) zu deportieren, angesichts<br />
der Kriegslage Makulatur war. Gleichzeitig<br />
hatten die Einsatzgruppen in den besetzten<br />
Gebieten der Sowjetunion damit begonnen,<br />
systematisch die jüdische Bevölkerung – seit<br />
Juli 1941 nicht nur Männer, sondern ohne<br />
Unterschied auch Alte, Frauen und Kinder<br />
– zu ermorden. Angesichts dieser Lage bat<br />
der SS- und Polizeiführer (SSPF) des Distrikts<br />
Lublin, Odilo Globocnik, Himmler<br />
darum, nun auch selbst „radikale Maßnahmen“<br />
ergreifen zu dürfen, um die Juden<br />
loszuwerden: Auf Globocniks Initiative hin<br />
wurden in den ganz am Rande seines Distrikts<br />
gelegenen Dörfern Belzec und Sobibor<br />
Vernichtungslager eingerichtet.<br />
Bereits im Juli 1941 hatte Himmler den<br />
ehrgeizigen, durch seine Ausrottungsforderungen<br />
hervorgetretenen Globocnik damit<br />
beauftragt, in Lublin ein Konzentrationslager<br />
für 25.000 bis 50.000 Häftlinge einzurichten,<br />
die Zwangsarbeit für die SS verrichten<br />
sollten; im September des gleichen<br />
Jahres wurde mit der Errichtung eines ersten<br />
Lagers für 5.000 Häftlinge begonnen.<br />
Bis Sommer 1942 waren allerdings nur rund<br />
2.000 Häftlinge in dem neuen KL inhaftiert,<br />
in erster Linie russische Kriegsgefangene<br />
der Waffen-SS, und Himmlers „Planvorgabe“<br />
sollte nie erreicht werden.<br />
Das Lubliner Ghetto (Quelle: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Hoålocaust/Lublin1.html<br />
)<br />
Ab Mai/Juni 1942 liefen im gesamten Generalgouvernement<br />
die Vorbereitungen für<br />
eine Räumung der Ghettos an; dazu gehörte<br />
die Einteilung der jüdischen Menschen in<br />
drei Gruppen: „kriegswichtig“ – „arbeitsfähig“<br />
– „arbeitsunfähig“. Die Kompetenz<br />
für die Judenpolitik übertrug Himmler<br />
nun – wiederum auf Initiative Globocniks<br />
– endgültig an die SSPF und befahl bis<br />
zum Jahresende die Beseitigung aller nicht<br />
arbeitsfähigen Juden des Generalgouvernements.<br />
Ab dem 22. Juli wurde das Waraus:<br />
Marszalek 1981; http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartes/europe/europe/conflits/camp_conc_majdanek.jpg<br />
41
schauer Ghetto geräumt und die Insassen in<br />
dem eigens dafür errichteten Vernichtungslager<br />
Treblinka ermordet.<br />
Im Vernichtungslager Belzec im Distrikt<br />
Lublin hatten die Deutschen in einer Art<br />
„Testphase“ schon im März 1942 damit begonnen,<br />
erste Vergasungen vorzunehmen.<br />
Im Mai 1942 folgte Sobibor – die planmäßige<br />
Ermordung aller „nicht arbeitsfähigen“ Juden<br />
im Distrikt Lublin begann. Was folgte,<br />
war die Vernichtung der polnischen Juden<br />
überhaupt: In den sieben Wochen von Ende<br />
Juli bis Mitte September ereigneten sich die<br />
schlimmsten Massenmorde des Holocaust:<br />
Allein am 19. August beispielsweise, einem<br />
einzigen Tag, fanden über 25.000 Menschen<br />
den Tod – und fast täglich ereigneten<br />
sich in diesen Wochen derartige Massaker,<br />
bei denen die Opfer nach Tausenden und<br />
Zehntausenden zählten. Zum Jahreswechsel<br />
1942/43 lebten von ursprünglich 2 Millionen<br />
polnischen Juden noch etwa 300.000,<br />
doch auch im folgenden Jahr wurde die Auflösung<br />
der „jüdischen Wohnbezirke“ fortgesetzt.<br />
Im Warschauer Ghetto kam es im<br />
Frühjahr zum Aufstand, der blutig niedergeschlagen<br />
wurde. Bis Mitte Juni 1943 war<br />
Himmlers Vernichtungsbefehl ausgeführt:<br />
Binnen eines Jahres war das polnische Judentum<br />
beinahe ausgelöscht. Bestenfalls<br />
130.000 Juden hatten bisher überlebt, größtenteils<br />
in deutschen Zwangsarbeitslagern,<br />
der kleinere Rest in der Illegalität.<br />
Im Konzentrationslager Lublin/Majdanek<br />
– das seinen Beinamen dem Lubliner<br />
Stadtteil Majdan Tatarski verdankt – war<br />
die Zahl der Häftlinge seit Mitte 1942 auf<br />
über 10.000 angestiegen. Die Häftlinge waren<br />
nunmehr überwiegend Juden und Polen.<br />
Im Sommer 1942 wurden erstm<strong>als</strong> auch<br />
Frauen eingeliefert und ein Frauenlager errichtet.<br />
Im September oder Oktober begann<br />
die SS, auch in Majdanek Häftlinge durch<br />
Gas – Zyklon B – zu ermorden. Von den<br />
eintreffenden Transporten wurde nur ein<br />
vergleichsweise niedriger Anteil von rund<br />
einem Drittel zur Zwangsarbeit ins Lager<br />
eingewiesen – alle anderen wurden sofort<br />
für die Gaskammern selektiert.<br />
Anfang 1943 machte sich die SS daran,<br />
auch die letzten im Distrikt Lublin noch<br />
bestehenden Ghettos und Zwangsarbeitslager<br />
zu liquidieren. Erst die Katastrophe<br />
von Stalingrad brachte im Laufe des Jahres<br />
1943 ein gewisses, ökonomischen Zwängen<br />
geschuldetes Umdenken: Die noch vorhandenen<br />
jüdischen Arbeitslager sollten erhalten<br />
bleiben und in Außenlager des KL<br />
Lublin umgewandelt werden. Die Arbeitskraft<br />
der Häftlinge sollte nun vor der nach<br />
wie vor <strong>als</strong> letztlich unausweichlich angesehenen<br />
Tötung verstärkt ausgebeutet und<br />
in den Dienst der Rüstungswirtschaft und<br />
des Totalen Krieges gestellt werden. Ein<br />
abruptes Ende fand diese Zwischenphase<br />
der Geschichte des Judenmordes im Distrikt<br />
Lublin noch vor dem Jahreswechsel<br />
1943/44: Als es im Herbst 1943 zu verzweifelten<br />
Widerstandsaktionen in den noch<br />
„Aktion Erntefest“: Jüdische Häftlinge warten auf ihre<br />
Erschießung Quelle: Marszalek 1981<br />
bestehenden Ghettos des Generalgouvernements<br />
und schließlich sogar zu Häftlingsrevolten<br />
in den Vernichtungslagern Sobibor<br />
und Belzec kam, befahl Himmler die sofortige<br />
Ermordung aller noch lebenden Juden<br />
im östlichen Generalgouvernement, insbesondere<br />
im Distrikt Lublin.<br />
Himmlers Befehl wurde ausgeführt: In<br />
der „Aktion Erntefest“ ermordete die SS am<br />
3./4. November – abgesehen von wenigen<br />
Ausnahmen – die letzten noch lebenden<br />
Juden im Distrikt Lublin. In den drei Lagern<br />
Poniatowa, Trawniki und Majdanek<br />
wurden an diesen beiden Tagen zwischen<br />
40.000 und 43.000 Menschen – in Majdanek<br />
allein 17.000 bis 18.000, darunter die<br />
8.000 jüdischen Häftlinge des Lagers – Opfer<br />
einer der größten Massenerschießungen<br />
des Holocaust. Frühmorgens am 3. November<br />
wurden die jüdischen Häftlinge des Lagers<br />
separiert, Juden aus Lublin und anderen<br />
Lagern ins KL eingeliefert. In einer langen<br />
42
Schlange mussten sich die Juden zu extra<br />
ausgehobenen Gräben begeben; dort mussten<br />
sie sich ausziehen, um anschließend in<br />
kleinen Gruppen nackt in die Gräben gejagt<br />
zu werden: „Dort“, so das 1981 ergangene<br />
Urteil im Düsseldorfer Majdanek-Prozess,<br />
„mussten sie sich ‚dachziegelförmig’ […] mit<br />
dem Gesicht nach unten so hinlegen, dass<br />
sich jeweils das erste Opfer auf dem Boden<br />
und jedes nachfolgende mit dem Kopf auf<br />
dem Rücken des unter ihm liegenden Opfers<br />
befand.“ Etwa 100 auswärtige SS- und<br />
Polizeiangehörige, nicht wenige völlig betrunken,<br />
schossen den Liegenden ins Genick<br />
oder den Hinterkopf. „Nachdem die<br />
Sohle der Gräben mit Leichen gefüllt war,<br />
mussten die nächsten Opfer auf die Leichen<br />
steigen, eine weitere Schicht von Menschenleibern<br />
bilden und sich dann in der gleichen<br />
Weise erschießen lassen.“ Bis zum Anbruch<br />
der Dunkelheit wurde geschossen, übertönt<br />
von zwei Lautsprecherwagen, die leichte<br />
Unterhaltungsmusik spielten.<br />
Lediglich je dreihundert männliche und<br />
weibliche jüdische Häftlinge überlebten die<br />
„Aktion Erntefest“; sie wurden – vorerst –<br />
am Leben gelassen, um den Massenmord<br />
abzuwickeln; während erstere die Kleidung<br />
der Opfer sortierten, mussten letztere<br />
die Spuren beseitigen. In den folgenden<br />
Wochen wurden die nur notdürftig abgedeckten<br />
Gräben wieder geöffnet und die<br />
Leichen auf großen Rosten verbrannt. Ihre<br />
Asche wurde <strong>als</strong> Dünger auf den lagereigenen<br />
Feldern verwendet.<br />
Von nun an bis zur Räumung des Lagers<br />
im April 1945 diente das Lager (weiterhin)<br />
<strong>als</strong> Exekutionsstätte für polnische Zivilisten,<br />
wurde nun aber auch zu einem „Auffanglager“<br />
für kranke und entkräftete Häftlinge<br />
aus anderen Konzentrationslagern. Ob diese<br />
Häftlinge unmittelbar nach ihrer Ankunft<br />
ermordet wurden oder einfach sich selbst –<br />
und dem Tod – überlassen wurden, ist bisher<br />
nicht geklärt.<br />
Angesichts der näher rückenden Front<br />
räumte die SS in der ersten Aprilhälfte das<br />
Lager. Bis zum 19. des Monats wurden mehr<br />
<strong>als</strong> 12.000 Menschen vor allem nach Auschwitz<br />
und Groß-Rosen transportiert. Als die<br />
Rote Armee nach der Unterbrechung ihrer<br />
Offensive das Lager am 23. Juli endgültig<br />
befreite, fand sie noch 1.500 völlig entkräftete<br />
Häftlinge vor. Wie viele Häftlinge insgesamt<br />
in Majdanek den Tod fanden, ist<br />
noch nicht endgültig geklärt: Während unmittelbar<br />
nach Kriegsende genannte Zahlen<br />
von bis zu 360.000 definitiv zu hoch sind,<br />
ging die neuere Forschung bisher von etwa<br />
170.000 bis 200.000 Opfern aus, von denen<br />
mindestens 90.000 Juden gewesen seien.<br />
Rund 50.000 seien in den Gaskammern, der<br />
Rest infolge von Zwangsarbeit, Seuchen,<br />
Hunger und der alltäglichen Gewalt im Lager<br />
gestorben. Neueste Forschungen deuten<br />
allerdings darauf hin, dass die Zahl der Opfer<br />
deutlich niedriger gewesen sein könnte.<br />
Tomasz Kranz, Direktor des Forschungszentrums<br />
des Staatlichen Museums in<br />
Majdanek, korrigierte die auch von ihm<br />
selbst bisher vertretenen Zahlen in einem<br />
2005 erschienenen Aufsatz in den Zeszyty<br />
Majdanka (Hefte von Majdanek) deutlich<br />
nach unten. Er schätzt die Summe der Getöteten<br />
nun auf insgesamt 78.000 Menschen,<br />
davon 59.000 Juden und 19.000 Nichtjuden.<br />
Noch sind Kranz’ Ergebnisse, die auf<br />
der erstmaligen systematischen Auswertung<br />
aller vorhandenen Quellen beruhen, noch<br />
nicht diskutiert, und auch die Frage, wie<br />
viele Häftlinge insgesamt das Lager durchliefen,<br />
ist noch offen. Der Holocaust- und<br />
Polen-Experte Dieter Pohl vom Münchner<br />
Institut für Zeitgeschichte jedenfalls erklärte<br />
gegenüber dem Verfasser, Kranz‘ Zahlen<br />
seien zweifelsohne ab sofort <strong>als</strong> maßgebend<br />
zu betrachten.<br />
Von den 2 Millionen Juden, die 1939 in<br />
Polen lebten, haben nach seriösen, allerdings<br />
schwierig durchzuführenden Schätzungen<br />
wenige Zehntausend überlebt.<br />
Auswahlbibliographie<br />
Dieter Ambach: Thomas Köhler: Lublin-<br />
Majdanek. Das Konzentrations- und Vernichtungslager<br />
im Spiegel von Zeugenaussagen,<br />
Düsseldorf 2004.<br />
Martin Broszat: Nation<strong>als</strong>ozialistische Polenpolitik<br />
1939-1945, Stuttgart 1961 (noch<br />
immer grundlegend).<br />
Aus dem Totenbuch des KL<br />
Majdanek<br />
(Quelle: Marszalek 1981)<br />
43
Tomasz Kranz: Das KL Lublin – zwischen<br />
Planung und Realisierung, in: Ulrich<br />
Herbst, Karin Orth, Christoph Dieckmann<br />
(Hrsg.), Die nation<strong>als</strong>ozialistischen Konzentrationslager.<br />
Entwicklung und Struktur,<br />
Göttingen 1998, S. 363-389.<br />
Tomasz Kranz: Ewidencja zgonow i smiertelosc<br />
wiezniow KL Lublin, in: Zeszyty<br />
Majdanka [Hefte von Majdanek] 23 (2005),<br />
S. 7-53.<br />
Peter Longerich: Politik der Vernichtung.<br />
Eine Gesamtdarstellung der nation<strong>als</strong>ozialistischen<br />
Judenverfolgung, München/Zürich<br />
1998.<br />
Jozef Marszalek: Majdanek. Geschichte<br />
und Wirklichkeit des Vernichtungslagers,<br />
Warschau 1981.<br />
Dieter Pohl: Von der „Judenpolitik“ zum<br />
„Judenmord“. Der Distrikt Lublin des Generalgouvernements<br />
1939-1944, Frankfurt<br />
am Main u.a. 1993.<br />
44
Kinderschuhe aus Lublin<br />
von Johannes R. BEcher<br />
Von all den Zeugen, die geladen,<br />
Vergeß ich auch die Zeugen nicht,<br />
Als sie in Reihn den Saal betraten,<br />
Erhob sich schweigend das Gericht.<br />
Wir blickten auf die Kleinen nieder,<br />
Ein Zug zog paarweis durch den Saal.<br />
Es war, <strong>als</strong> tönten Kinderlieder,<br />
Ganz leise, fern, wie ein Choral.<br />
Es war ein langer bunter Reigen,<br />
Der durch den ganzen Saal sich schlang.<br />
Und immer tiefer ward das Schweigen<br />
Bei diesem Gang und Kindersang.<br />
Voran die kleinsten von den Kleinen,<br />
Sie lernten jetzt erst richtig gehen –<br />
Auch Schuhchen können lachen, weinen –.<br />
Ward je ein solcher Zug gesehn!<br />
Es tritt ein winzig Paar zur Seite,<br />
Um sich ein wenig auszuruhn,<br />
Und weiter zieht es in die Weite –<br />
Es war ein Zug von Kinderschuhn.<br />
Man sieht, wie sie den Füßchen passten –<br />
Sie haben niem<strong>als</strong> weh getan,<br />
Und Händchen spielten mit den Quasten.<br />
Das Kind zog gern die Schuhchen an.<br />
Ein Paar aus Samt, ein Paar aus Seiden,<br />
45
Und eines war bestickt sogar<br />
Mit Blumen, wie sie ziehn, die beiden<br />
Sind ein schmuckes Hochzeitspaar.<br />
Mit Bändchen, Schnallen und mit Spangen,<br />
Zwergenhafte Wesen, federleicht –<br />
Und viel’ sind viel zu lang gegangen,<br />
Und sind vom Regen durchgeweicht.<br />
Man sieht die Mutter auf den Armen<br />
Das Kind, vor einem Laden stehn:<br />
„Die Schuhchen, die, die weichen, warmen,<br />
Ach, Mutter, sind die Schuhchen schön!“<br />
„Wie soll ich nur die Schuhchen zahlen.<br />
Wo nehm das Geld ich dafür her...“<br />
Es naht ein Paar von Holzsandalen,<br />
Es ist schon müd und schleppt sich schwer.<br />
Es muß ein Strümpfchen mit sich schleifen,<br />
Das wundgescheuert ist am Knie...<br />
Was soll der Zug? Wer kann’s begreifen?<br />
Und diese ferne Melodie...<br />
Auch Schuhchen können weinen, lachen...<br />
Da fährt in einem leeren Schuh<br />
Ein Püppchen wie in einem Nachen<br />
Und winkt uns wie im Märchen zu.<br />
Hier geht ein Paar von einem Jungen,<br />
Das hat sich schon <strong>als</strong> Schuh gefühlt,<br />
Das ist gelaufen und gesprungen<br />
Und hat auch wohl schon Ball gespielt.<br />
Ein Stiefelchen hat sich verloren<br />
Und findet den Gefährten nicht,<br />
Vielleicht ist er am Weg erfroren –<br />
Ach, dam<strong>als</strong> fiel der Schnee so dicht...<br />
46
Zum Schluß ein Paar, ganz abgetragen,<br />
Das macht noch immer mit, wozu?<br />
Als hätte es noch was zu sagen,<br />
Ein Paar zerrissener Kinderschuh.<br />
Ihr heimatlosen, kinderlosen,<br />
Wer schickt euch? Wer zog euch aus?<br />
Wo sind die Füßchen, all die bloßen?<br />
Ließt ihr sie ohne Schuh’ zu Haus...?<br />
Der Richter kann die Frage deuten.<br />
Er nennt der toten Kinder Zahl...<br />
Ein Kinderchor. Ein Totenläuten.<br />
Die Zeugen gehen durch den Saal.<br />
Die Deutschen waren schon vertrieben,<br />
Da fand man diesen schlimmen Fund.<br />
Wo sind die Kinder nur geblieben?<br />
Die Schuhe tun die Wahrheit kund:<br />
Es war ein harter, dunkler Wagen.<br />
Wir fuhren mit der Eisenbahn.<br />
Und wie wir in dem Dunkel lagen,<br />
So kamen wir im Dunkel an.<br />
Es kamen aus den Läden allen<br />
Viel Schuhchen an in einem fort,<br />
Und manche stolpern schon und fallen,<br />
Bevor sie treffen ein am Ort.<br />
Die Mutter sagte: “Wieviel Wochen<br />
Wir hatten schon nichts Warmes mehr!<br />
Nun werd ich uns ein Süppchen kochen.“<br />
Ein Mann mit Hund ging nebenher:<br />
„Es wird sich schon ein Plätzchen finden“,<br />
So lachte er, „und warm ist’s auch,<br />
Hier braucht sich keiner abzuschinden...“<br />
Bis in den Himmel kroch ein Rauch.<br />
47
„Es wird euch nicht an Wärme fehlen,<br />
Wir heizen immer tüchtig ein.<br />
Ich kann Lublin nur warm empfehlen,<br />
Bei uns herrscht ewiger Sonnenschein.“<br />
Und es war eine deutsche Tante,<br />
Die uns im Lager von Lublin<br />
Empfing und „Engelspüppchen“ nannte,<br />
Um uns die Schuhchen auszuziehn,<br />
Und <strong>als</strong> wir fingen an zu weinen,<br />
Da sprach die Tante: „Sollt mal sehn,<br />
Gleich wird die Sonne prächtig scheinen,<br />
Und darum dürft ihr barfuß gehen...<br />
Stellt euch mal auf und lasst euch zählen,<br />
So, seid ihr auch hübsch unbeschuht?<br />
Es wird euch nicht an Wärme fehlen,<br />
Dafür sorgt unsere Sonnenglut...<br />
Was, weint ihr noch? ‚s ist eine Schande!<br />
Was tut euch denn, ihr Püppchen, weh?<br />
Ich bin die deutsche Märchentante!<br />
Die gute deutsche Puppenfee.<br />
’s ist Zeit, ihr Püppchen, angetreten!<br />
Was fällt euch ein denn, hinzuknien.<br />
Auf, lasst uns singen und nicht beten!<br />
Es scheint die Sonne in Lublin!“<br />
Es sang ein Lied die deutsche Tante.<br />
Strafft sich den Rock und geht voraus,<br />
Und dort, wo heiß die Sonne brannte,<br />
Zählt sie uns nochm<strong>als</strong> vor dem Haus.<br />
Zu hundert, nackt in einer Zelle,<br />
Ein letzter Kinderschrei erstickt...<br />
Dann wurden von der Sammelstelle<br />
Die Schuhchen in das Reich geschickt.<br />
48
Es schien sich das Geschäft zu lohnen,<br />
Das Todeslager von Lublin.<br />
Gefangenenzüge, Prozessionen.<br />
Und – eine deutsche Sonne schien...<br />
Wenn Tote einst <strong>als</strong> Rächer schreiten,<br />
Und über Deutschland hallt ihr Schritt,<br />
Und weithin sich die Schatten breiten-<br />
Dann ziehen auch die Schuhchen mit.<br />
Ein Zug von abertausend Zwergen,<br />
So ziehen sie dahin in Reihn,<br />
Und wo die Schergen sich verbergen,<br />
Dort treten sie unheimlich ein.<br />
Sie schleichen sich herauf die Stiegen,<br />
Sie treten in die Zimmer leis.<br />
Die Henker wie gefesselt liegen<br />
Und zittern vor dem Schuldbeweis.<br />
Es wird die Sonne brennend scheinen.<br />
Die Wahrheit tut sich allen kund.<br />
Es ist ein großes Kinderweinen,<br />
Ein Grabgesang aus Kindermund...<br />
Der Kindermord ist klar erwiesen.<br />
Die Zeugen all bekunden ihn.<br />
Und nie vergeß ich unter diesen<br />
Die Kinderschuhe aus Lublin.<br />
49
Das „Lubliner Komitee“:<br />
Polnische Keimzelle des kommunistischen<br />
Staates oder „Marionettentheater“ Stalins?<br />
von Bernward Winter<br />
Das „Polnische Komitee für die nationale Befreiung“, auch „Lubliner Komitee“<br />
genannt, steht für die Übernahme des politische Einflusses durch die Stalinisten<br />
im befreiten Polen am Ende des Zweiten Weltkriegs. Doch welche Rolle hat<br />
es dabei wirklich gespielt? Um sich einer Antwort dieser Frage am Ende dieses<br />
Essays zu nähern, wird zunächst die Situation Polens zwischen 1939 und 1944<br />
dargestellt und die Entstehung des Lubliner Komitees beschrieben.<br />
Die Situation Polens zwischen 1939 und<br />
1944<br />
Kurze Zeit nach dem deutschen Angriff<br />
am 1. September 1939 hörte Polen auf, <strong>als</strong><br />
eigenständiger territorialer Staat zu existieren:<br />
Der westliche Teil wurde bis zu einer<br />
Linie östlich von Ostrolenka, Lodz, Sosnowitz<br />
und Bielitz unter dem Namen „Eingegliederte<br />
Ostgebiete“ direkt an das deutsche<br />
Reich angeschlossen. Der mittlere Teil,<br />
ebenfalls von der Deutschen Wehrmacht<br />
besetzt, war <strong>als</strong> „Generalgouvernement“<br />
eine vom deutschen Reich abhängige Kolonie.<br />
Der östliche Teil war durch sowjetische<br />
Truppen besetzt, offiziell <strong>als</strong> „Schutz der<br />
ukrainischen und weißruthenischen Bevölkerung“,<br />
tatsächlich aber in Erfüllung des<br />
geheimen Zusatzprotokolls des Hitler-Stalin-Paktes,<br />
das Polen zwischen Deutschland<br />
und der Sowjetunion aufgeteilt hatte.<br />
Sowohl die deutschen <strong>als</strong> auch die sowjetischen<br />
Besatzer begannen sofort mit umfassenden<br />
„Säuberungsaktionen“, denen fast<br />
die gesamte geistige Elite Polens zum Opfer<br />
fiel, durch Deportationen oder Exekutionen.<br />
Außerdem waren im deutschen Einflussbereich<br />
die Juden völlig rechtlos und wurden<br />
in Ghettos zusammengepfercht oder umgebracht.<br />
Der polnische Staatspräsident Ignacy<br />
Mościcki und die Regierung waren bereits<br />
Mitte September 1939 nach Rumänien geflohen<br />
und dort interniert worden. Mościcki<br />
ernannte Władysław Raczkiewicz zu seinem<br />
Nachfolger, der in Frankreich eine neue Regierung<br />
bildete, die von Großbritannien,<br />
Frankreich und den Vereinigten Staaten <strong>als</strong><br />
rechtmäßige Exilregierung Polens anerkannt<br />
wurde. Dieser westlich orientierten Regierung<br />
gehörten alle Parteien bis auf die kommunistische<br />
an; sie wurde von Władysław<br />
Sikorski geleitet. Die Exilregierung stellte<br />
eine Armee aus Auslandspolen zusammen,<br />
die 84.000 Mann stark wurde und in Frankreich<br />
und Norwegen gegen das Deutsche<br />
Reich kämpfte. Wichtig dabei war neben<br />
der militärischen Schlagkraft vor allem die<br />
politische Bedeutung, wurde doch Polen auf<br />
diese Weise ermöglicht, <strong>als</strong> kriegsführende<br />
Macht weiterhin aktiv zu sein. Zugleich<br />
steuerte die Exilregierung einen polnischen<br />
Untergrundstaat, der, vom Generalgouvernement<br />
ausgehend, bis 1941 das gesamte<br />
unter deutscher Besatzung stehende Gebiet<br />
umfasste. Zu ihm gehörten unter anderem<br />
ein geheimes Schul- und Universitätssystem<br />
und eine Untergrundarmee, „Heimatarmee“<br />
(Armja Krajowa, AK) genannt. Nach<br />
50
der Kapitulation Frankreichs flüchteten die<br />
Exilregierung und ein Teil der polnischen<br />
Exilarmee nach Großbritannien.<br />
Nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion<br />
am 22. Juni 1941 wurden die beiden<br />
Besatzer Polens zu gegenseitigen Feinden.<br />
Die Westalliierten bemühten sich,<br />
zwischen der polnischen Exilregierung<br />
und der sowjetischen Führung zu vermitteln,<br />
um gemeinsam gegen das deutsche<br />
Reich zu kämpfen. Zwar kam es zu einem<br />
Abkommen, in dem die Sowjetunion die<br />
Exilregierung anerkannte und der Bildung<br />
einer Armee aus den in die Sowjetunion verschleppten<br />
Polen zustimmte; Stalin rückte<br />
aber nicht von dem Anspruch auf den Ostteil<br />
Polens bis zur so genannten Curzon-Linie<br />
(entspricht in etwa der heutigen Ostgrenze<br />
Polens) ab. Dadurch und durch die<br />
von deutschen Truppen gefundenen Gräber<br />
von Katyn, in denen von Sowjets ermordete<br />
polnische Offiziere lagen, verschlechterten<br />
sich die Beziehungen wieder. Die Forderung<br />
der Exilregierung nach Auskunft über<br />
Katyn führte im April 1943 zum völligen<br />
Bruch. Zur gleichen Zeit wuchs der von<br />
der Exilregierung organisierte Widerstand<br />
in Polen, die Heimatarmee (AK) hatte bis<br />
Ende 1943 etwa 350.000 Mitglieder.<br />
Das Lubliner Komitee<br />
Direkt nach dem Abbruch der Beziehungen<br />
zur Exilregierung Polens begann<br />
die sowjetische Führung, eine kommunistische<br />
Regierung in Polen vorzubereiten.<br />
Dies war für Stalin auch deshalb wichtig,<br />
da die Exilregierung die Westverschiebung<br />
ablehnte, auf die er sich bereits mit den<br />
Westmächten auf der Teheraner Konferenz<br />
informell geeinigt hatte. Stalin traute der<br />
kleinen Gruppe polnischer Kommunisten<br />
den Umbruch in Polen nicht zu. Deshalb<br />
wurde dieser in der Sowjetunion vorbereitet:<br />
Zunächst entstand in Moskau der kommunistische<br />
„Verband polnischer Patrioten“<br />
und die „Division Kściuszko“, die später bis<br />
400.000 Mann stark wurde. Beide standen<br />
in voller Abhängigkeit von der sowjetischen<br />
Führung.<br />
Die Niederlage in Stalingrad führte zum<br />
allmählichen Rückzug der deutschen Truppen.<br />
Im Juli 1944 überschritt die sowjetische<br />
Armee die Curzon-Linie und drang somit<br />
in den Bereich Polens ein, den Stalin offiziell<br />
nicht für sich beanspruchte. Am 21. Juni<br />
1944 wurde in Moskau das „Polnische Komitee<br />
für die nationale Befreiung“ (Polski<br />
Komitet Wyzwolenia Narodowego, PKWN)<br />
gegründet, dessen Mitglieder wenige Tage<br />
später in Chełm eintrafen, und, wiederum<br />
einige Tage danach, in Lublin ihre eigentliche<br />
Arbeit aufnahmen (daher der Name<br />
„Lubliner Komitee“). Trotz des Protestes<br />
der Exilregierung in London nahm dieses<br />
Komitee für sich in Anspruch, die rechtmäßige<br />
Vertretung Polens zu sein, obwohl<br />
keine der großen polnischen Parteien in<br />
ihm vertreten war. Es bestand überwiegend<br />
aus in der Sowjetunion geschulten Kommunisten<br />
und wurde vom Sozialisten Edward<br />
Osóbka-Morawski geleitet. Bereits am<br />
27. Juli 1944 wurde es von der Sowjetunion<br />
anerkannt und schloss direkt mit ihr einen<br />
Vertrag, in dem u. a. die Curzon-Linie<br />
<strong>als</strong> Ostgrenze anerkannt wurde. Mit dem<br />
Komitee zusammen nahm auch eine vom<br />
sowjetischen Geheimdienst trainierte task<br />
force ihre Arbeit auf, bestehend aus Sowjets<br />
mit typischen polnischen Namen und Uniformen<br />
hochrangiger polnischer Militärs.<br />
Im von der Roten Armee bereits befreiten<br />
Gebiet „säuberten“ sie zunächst die Heimatarmee<br />
(AK), beseitigten pro-westliche Politiker<br />
und Bürger und wurden in wichtige<br />
politische und administrative Ämter eingeschleust.<br />
Bis 1948 wurden dabei zehntausende<br />
Polen getötet, hunderttausende in die<br />
Sowjetunion deportiert oder inhaftiert.<br />
In Lublin veröffentlichte das PKWN<br />
ein Manifest („Lubliner Manifest“; siehe<br />
Abbildung 1), dass bereits in Moskau redigiert<br />
und gedruckt worden war. Darin wurde<br />
die Exilregierung <strong>als</strong> „ursupatorisch“,<br />
„betrügerisch“ und „vollkommen illegal“<br />
bezeichnet und für die Westverschiebung<br />
Polens mit folgenden Worten geworben:<br />
„Auf zum Kampf um die Freiheit Polens,<br />
um die Rückkehr des alten polnischen Pommern<br />
und des Oppelner Schlesien zum<br />
Mutterland, um Ostpreußen und einen<br />
breiten Zugang zum Meer, um polnische<br />
Grenzpfähle an der Oder…“. Darüber hinaus<br />
enthielt das Manifest lediglich einen<br />
Aufruf zu einer einzigen sozialistischen<br />
Abb. 1: Deckblatt des Lubliner<br />
Manifests, Juli 1944<br />
(Quelle: Wikipedia Polski: http://<br />
pl.wikipedia.org/wiki/ Manifest_PKWN)<br />
51
Abb. 2: Die Westverschiebung Polens am Ende des Zweiten Weltkriegs (Quelle: Rainer<br />
Fuhrmann, Polen. Geschichte – Politik – Wirtschaft, Hannover 1990, S. 183)<br />
Maßnahme: einer Bodenreform. Letztere<br />
diente nicht zuletzt dazu, bei der polnischen<br />
Bevölkerung um Unterstützung zu<br />
werben. Diese war nämlich nur zu einem<br />
Bruchteil kommunistisch eingestellt, unterstützte<br />
überwiegend die Exilregierung und<br />
ihre Vertretungen in Polen und stand der<br />
Sowjetunion skeptisch bis ablehnend gegenüber,<br />
vor allem aufgrund der Erlebnisse<br />
nach deren Einmarsch im östlichen Polen<br />
1939. Die exilregierungstreue Heimatarmee<br />
(AK) startete am 1. August 1944 einen bewaffneten<br />
Aufstand in Warschau, das noch<br />
von deutschen Truppen besetzt war, und<br />
zwar aus mehreren Gründen: Die deutsche<br />
Besatzungsmacht war durch die Rückzugsgefechte<br />
deutlich geschwächt und erschien<br />
mit den 50.000 Mann der AK besiegbar.<br />
Darüber hinaus lag die Rote Armee vor den<br />
Toren Warschaus, die AK konnte <strong>als</strong>o auf<br />
Unterstützung hoffen. Wichtiger war aber<br />
die politische Motivation: Die AK wollte<br />
Warschau selbst befreien und dann die sowjetischen<br />
Soldaten <strong>als</strong> Gäste, nicht aber <strong>als</strong><br />
Befreier empfangen. Außerdem hoffte man,<br />
auf diese Weise in Warschau die Exilregierung<br />
zu installieren und so dem PKWN<br />
etwas entgegensetzten zu können. Dieser<br />
Aufstand wurde aber weder mit der Exilregierung<br />
noch mit den Westalliierten oder<br />
der Sowjetunion abgestimmt. Der Exil-<br />
Ministerpräsident Stanisław Mikołajczyk,<br />
Nachfolger von Władysław Sikorski, der<br />
im Juli 1943 bei einem nicht restlos geklärten<br />
Flugzeugunglück ums Leben gekommen<br />
war, erfuhr von dem Aufstand, <strong>als</strong> er<br />
gerade in Moskau war. Die Westalliierten<br />
hatten den Druck auf die Exilregierung erhöht,<br />
zu einer Einigung mit der Sowjetunion<br />
zu kommen, da sie diese <strong>als</strong> strategischen<br />
Partner im Kampf gegen das Deutsche<br />
Reich brauchten. Stalin machte zwar keine<br />
Zugeständnisse, was die Ostgrenze Polens<br />
anging, versetzte Mikołajczyk aber in<br />
den Glauben, er sei nicht in erster Linie an<br />
einem kommunistischen Polen interessiert,<br />
sondern lediglich an einem demokratischen<br />
Polen mit freundschaftlichen Beziehungen<br />
zu Moskau. Die damit verbundene Hoffnung<br />
wurde enttäuscht, <strong>als</strong> deutlich wurde,<br />
dass Stalin den Warschauer Aufstand nicht<br />
unterstützte, ja sogar die Unterstützung aus<br />
der Luft durch die Westalliierten unmöglich<br />
machte, indem er ihnen keine Landeerlaubnis<br />
auf sowjetischen Flugplätzen gewährte.<br />
Der Aufstand hielt sich zwar über<br />
viele Wochen, musste dann aber aufgegeben<br />
werden. Offensichtlich hatte Stalin genau<br />
daran ein Interesse; es ersparte ihm z. B.<br />
die Säuberungsaktionen durch seine eigene<br />
Armee. Es gabt zumindest keinen anderen<br />
plausiblen Grund, den Aufstand in Warschau<br />
nicht mit den kampfbereiten Truppen<br />
vor der Stadt zu unterstützen. Der Plan der<br />
AK ging <strong>als</strong>o nicht auf:<br />
Die Rote Armee „befreite“ Warschau<br />
wenig später, das Lubliner Komitee wurde<br />
dorthin verlegt und benannte sich in „Provisorische<br />
Regierung“ um. Ministerpräsident<br />
wurde Osóbka-Morawski, sein Stellvertreter<br />
Władysław Gomułka. Auf der Konferenz<br />
von Jalta erkannten Churchill und Roosevelt<br />
die provisorische Regierung auf Drängen<br />
Stalins hin unter der Voraussetzung an,<br />
dass Mitglieder der Exilregierung integriert<br />
würden. Dies geschah später in sehr geringem<br />
Umfang. Außerdem wurden die Curzon-Linie<br />
<strong>als</strong> Ostgrenze und die Oder <strong>als</strong><br />
Westgrenze Polens und damit dessen Westverschiebung<br />
offiziell beschlossen (siehe Abbildung<br />
2).<br />
Die Bedeutung des Lubliner Komitees<br />
Man kann sicherlich sagen, dass das<br />
Lubliner Komitee zusammen mit der oben<br />
52
erwähnten task force dafür gesorgt hat,<br />
das Polen innerhalb weniger Jahre stalinistisch<br />
wurde. Doch muss man einige Aspekte<br />
bedenken, die den tatsächlichen Einfluss<br />
des PKWN infrage stellen: Offenbar<br />
hatte Stalin schon vor dem Ausbruch des<br />
Zweiten Weltkriegs geplant, Polen unter sowjetischen<br />
Einfluss zu stellen und zu „stalinisieren“.<br />
Dabei kam ihm die Besetzung<br />
Polens durch die Deutschen durchaus entgegen,<br />
da diese das taten, was er aus seiner<br />
Sicht, zumindest zum Teil, auch hätte tun<br />
müssen: die Eliminierung der intellektuellen<br />
und politischen Elite. Ihm war nämlich<br />
klar, dass Propaganda allein nicht ausreichen<br />
würde, Polen unter seinen Einfluss<br />
zu stellen. Dass er an keiner Zusammenarbeit<br />
mit der Exilregierung und deren Untergrundarmee<br />
AK interessiert war, zeigte sich<br />
spätestens bei seiner Weigerung, den Warschauer<br />
Aufstand zu unterstützen. Darüber<br />
hinaus hatte Stalin faktische, nämlich militärische<br />
Macht, nicht nur über Polen. Die<br />
Westalliierten waren bei ihrem Kampf gegen<br />
Hitler auf die Sowjetunion angewiesen,<br />
die Rote Armee war die einzige Macht, die<br />
Polen von der deutschen Herrschaft befreien<br />
konnte und es auch tat, dadurch aber automatisch<br />
Polen besetzte. Das PKWN war<br />
<strong>als</strong>o zu Beginn gar nicht darauf angewiesen,<br />
politisch legitimierte Macht zu besitzen,<br />
denn die zumindest einigermaßen legitimierte<br />
Exilregierung, die offenbar große<br />
Unterstützung in der Bevölkerung genoss,<br />
hatte keinerlei Möglichkeit, irgend etwas<br />
durchzusetzen, solange die Rote Armee das<br />
PKWN unterstützte und die Westalliierten<br />
die Auseinandersetzung mit Stalin scheuten.<br />
So fiel die Entscheidung über Polens<br />
Zukunft vermutlich weniger im Lubliner<br />
Komitee <strong>als</strong> auf der Konferenz in Teheran,<br />
bei der die Westmächte Stalin die Eingliederung<br />
des Ostteils Polens in die Sowjetunion<br />
zubilligten, ohne irgendwelche verbindlichen<br />
Regelungen für die politische<br />
Entwicklung des „restlichen“ Polens zu treffen.<br />
Aber gab es Alternativen? Wie immer<br />
kann man sagen, es hätte auch schlimmer<br />
kommen können: Es gab offenbar polnische<br />
Hardliner-Stalinisten, die sich wünschten,<br />
Polen würde die 17. Republik der Sowjetunion.<br />
Dass Stalin diesen Wunsch teilte, ist<br />
nicht belegt. Aber so könnte man meinen,<br />
dass mit dem PKWN trotz großer Abhängigkeit<br />
von der Sowjetunion ein Minimum<br />
polnischen Einflusses möglich war. Eine<br />
weitere Alternative wäre ein Bürgerkrieg<br />
gewesen, den es zwischen 1944 und 1948 in<br />
Ansätzen auch gegeben hat, der aber durch<br />
die militärische Übermacht der Roten Armee<br />
rasch unterdrückt wurde. So führte die<br />
vermeintlich Befreiung von der deutschen<br />
Besatzung direkt in die Herrschaft Stalins,<br />
wenn auch zunächst vermittelt über das<br />
Polnische Komitee für die nationale Befreiung.<br />
Die Keimzelle dabei lag allerdings<br />
eher in Moskau <strong>als</strong> in Lublin, auch wenn<br />
mancher westlicher Politiker das dam<strong>als</strong> offenbar<br />
anders einschätzte ...:<br />
„These are critical days, and it would be a great<br />
pity if time were wasted in indecision or in<br />
protracted negotiation. If the Polish Government<br />
had taken the advice we tendered them<br />
at the beginning of this year, the additional<br />
complication produced by the formation of the<br />
Polish National Committee of Liberation at<br />
Lublin would not have arisen and anything<br />
like a prolonged delay in the settlement can<br />
only have the effect of increasing the division<br />
between Poles in Poland...“<br />
Winston Churchill in einer Rede vor dem<br />
House of Commons, 27. Oktober 1944<br />
Literatur<br />
Friedrich, K.-P., Die Legitimierung ‚Volkspolens’<br />
durch den polnischen Opferstatus.<br />
Zur kommunistischen Machtübernahme<br />
in Polen am Ende des Zweiten Weltkriegs.<br />
In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung,<br />
52(1), 2003.<br />
Hoensch, J. K., Geschichte Polens. Stuttgart:<br />
Ulmer, 31998.<br />
Jaworski, R., Lübke, C. und Müller, M. G.,<br />
Eine kleine Geschichte Polens. Frankfurt a.<br />
M.: Suhrkamp, 2000.<br />
Kersten, K., The Establishment of Communist<br />
Rule in Poland, 1943-1948. Oxford:<br />
University of California Press, 1991.<br />
53
Krzemiński, A., Polen im 20. Jahrhundert.<br />
Ein historischer Essay. München: Beck,<br />
1993.<br />
Meyer, E., Grundzüge der Geschichte Polens.<br />
Darmstadt: Wiss. Buchges., 31990.<br />
Rhode, G., Polen von der Wiederherstellung<br />
der Unabhängigkeit bis zur Ära der Volksrepublik<br />
1918-1970. In: Schieder, T. (Hrsg.),<br />
Handbuch der europäischen Geschichte.<br />
Band 7.2, Stuttgart: Klett-Cotta, 31996.<br />
Roos, H., Geschichte der Polnischen Nation<br />
1918-1978. Von der Staatsgründung im Ersten<br />
Weltkrieg bis zur Gegenwart. Stuttgart:<br />
Kohlhammer, 31979.<br />
54
Wettstreit der Universitäten.<br />
Die katholische Universität Jana Pawla II<br />
(KUL) und die Maria Curie-Sklodowska Universität<br />
(UMCS) in Lublin<br />
von Gregor Scheffler<br />
Worin besteht ein Wettstreit zweier Universitäten, woran ist er fest zu machen<br />
und wo wird er greifbar? Wie ist er entstanden und wo führt er hin? Die Perspektive<br />
auf diese Fragestellungen hat sich im Lauf der Geschichte mehrfach gewandelt.<br />
Es bietet sich daher zunächst der Blick in die Entstehungszeiten beider<br />
Universitäten an, die zu Beginn und in der Mitte des 20. Jahrhunderts lagen.<br />
Die Katholische Universität Lublin wurde<br />
im Jahre 1918 <strong>als</strong> Universität Lublin vom<br />
ehemaligen Leiter des in Sankt Petersburg<br />
im Zuge der bolschewistischen Revolution<br />
geschlossenen Priesterseminars gegründet.<br />
Unter den beiden Mottos „Deo et Patriae“<br />
– Für Gott und Vaterland und „Veritas in<br />
Caritate“ – Wahrheit in Liebe sollte sie zu<br />
einer modernen Bildungs- und Forschungseinrichtung<br />
werden, die Glaube und Wissenschaft<br />
ausgewogen miteinander vereint.<br />
In den vom Staat überlassenen ehemaligen<br />
Klostergebäuden wurde zunächst an vier<br />
Fakultäten gelehrt und geforscht: Theologie,<br />
Kirchenrecht und Moralwissenschaft,<br />
Rechts- und Gesellschaftswissenschaften<br />
sowie Geisteswissenschaften. 1928 wurde<br />
der Universität der Rechtsstatus verliehen<br />
und sie wurde in Katholische Universität<br />
Lublin umbenannt. Erst 1933 bekam sie das<br />
Recht, den Magistertitel zu verleihen und<br />
erst nach weiteren fünf Jahren wurde sie am<br />
9. April 1938 endgültig <strong>als</strong> Universität mit<br />
allen Rechten, einschließlich dem Promotions-<br />
und Habilitationsrecht in allen Fakultäten,<br />
anerkannt.<br />
Ihre finanzielle Unterstützung erhielt die<br />
KUL hauptsächlich von der Katholischen<br />
Kirche sowie von zahlreichen Stiftungen<br />
und Verbänden. Es wurde die Gesellschaft<br />
der Freunde der Katholischen Universität<br />
Lublin gegründet, deren Aufgabe die finanzielle<br />
Sicherstellung der Arbeit an der KUL<br />
war. Die Entwicklung schritt in den ersten<br />
Jahren schnell voran, was sich nicht nur in<br />
der Anzahl der Studenten, sondern auch in<br />
der zunehmenden Zahl renommierter Professoren<br />
und Dozenten widerspiegelte.<br />
55
Mit dem Einfall der Deutschen Wehrmacht<br />
in Polen 1939 wurde die Universität<br />
von den Nazis geschlossen und in ein Militärkrankenhaus<br />
umgewandelt. Der Rektor<br />
und viele der Professoren wurden verhaftet.<br />
Verschiedene Versuche, die Lehre während<br />
der Kriegsjahre im Untergrund weiter zu<br />
führen, wurden aufgedeckt und unterbunden.<br />
Nach dem Abzug der Deutschen wurde<br />
noch während des Krieges am 21. August<br />
1944 die KUL wieder eröffnet. Trotz<br />
der großen Zerstörung und der einhergehenden<br />
Schwierigkeiten stiegen die Studentenzahlen<br />
rasch an.<br />
In den folgenden Jahren verstärkte die<br />
kommunistische Regierung zunehmend<br />
den politischen und finanziellen Druck auf<br />
die Universität. Es wurden verschiedene<br />
Versuche unternommen, ihre Entwicklung<br />
zu stoppen und den gesellschaftlichen Einfluss<br />
zu reduzieren. So wurde beispielsweise<br />
die Potulicka Stiftung, die auf die Gräfin<br />
Aniela Potulicka zurückgeht und die eine<br />
der Hauptfinanzquellen der Gesellschaft<br />
der Freunde der Katholischen Universität<br />
Lublin bildete, enteignet und vom Staat<br />
übernommen. Die Studentenzahlen wurden<br />
drastisch limitiert, die Entwicklungschancen<br />
der Absolventen beschränkt. Die<br />
philologische Abteilung wurde geschlossen,<br />
der Rektor inhaftiert. Das Promotionsund<br />
Habilitationsrecht der Geisteswissenschaftlichen<br />
Fakultät wurde aberkannt, der<br />
Austausch mit ausländischen Universitäten<br />
unterbunden und Publikationen streng<br />
zensiert. Schließlich führte die Behandlung<br />
der Universität <strong>als</strong> gewinnorientiertes<br />
Unternehmen zu sehr hohen Steuern, aufgrund<br />
deren verspäteter Zahlungen Gebäude<br />
und übriger Universitätsbesitz konfisziert<br />
wurden.<br />
Die Reaktion der KUL war eine verstärkte<br />
und ausgeweitete Forschung. Als einzige<br />
freie Universität innerhalb der Ostblockstaaten<br />
lebte sie von ihrer guten Reputation<br />
und wurde zum Rückzugsort und intellektuellen<br />
Zentrum für junge Menschen,<br />
die aus politischen oder sozialen Gründen<br />
zu anderen Universitäten nicht zugelassen<br />
oder an ihnen exmatrikuliert wurden.<br />
Mit dem Rücktritt des Chefs der kommunistischen<br />
Partei Gomulka 1970 entspannte<br />
sich die politische Situation leicht, wodurch<br />
zumindest der internationale wissenschaftliche<br />
Austausch wieder zugelassen wurde.<br />
In den 80er Jahren wurde nach mehreren<br />
Petitionen die Wiedereröffnung einiger Institute<br />
gestattet. Hinzu kam die Erlaubnis,<br />
Gebäude zu erweitern und neu zu bauen.<br />
Die Geisteswissenschaftliche Fakultät wurde<br />
wieder eröffnet, die Fakultät für Rechtswissenschaften<br />
und die Fakultät für Slawische<br />
Philologie wurden neu gegründet.<br />
Nach der Wahl Karol Wojtylas zum Papst<br />
1978 wurde 1982 das Johannes Paul II Institut<br />
gegründet, das dessen Forschung in die<br />
Lehre integrieren und seine Arbeiten einer<br />
breiteren Hörerschaft zugänglich machen<br />
sollte. 1983 wurde Karol Wojtyla die Ehrendoktorwürde<br />
der KUL verliehen.<br />
Nach der Wende 1989 kam es in der Folge<br />
der starken Inflation erneut zu finanziellen<br />
Schwierigkeiten, die nur mit Unterstützung<br />
des Vatikans und im Ausland lebender Polen<br />
bewältigt werden konnten. Nach umfangreicher<br />
Lobbyarbeit durch Rektor und<br />
Universitätsleitung wurde ein Gesetz verabschiedet,<br />
wonach die KUL ab Januar 1992<br />
rechtlich den übrigen Universitäten Polens<br />
gleichgestellt ist und auch die gleichen Zuwendungen<br />
erhält. Allerdings wurden die<br />
konfiszierten Gebäude nicht rückübertragen,<br />
wodurch die KUL heute keinen kompakt<br />
zusammenhängenden Campus besitzt,<br />
sondern über die Stadt verteilt ist.<br />
Am 4. April 2005 beschloss der Senat der<br />
Universität die Umbenennung in Katholische<br />
Universität Lublin – Johannes Paul<br />
II. Sie ist eine traditionsverbundene, humanistische<br />
Universität mit den Fakultäten<br />
Theologie, Philosophie, Kanonisches Recht<br />
und Verwaltung, Geisteswissenschaften,<br />
Sozialwissenschaften, Mathematik und<br />
Naturwissenschaften sowie Rechts- und<br />
Wirtschaftswissenschaften.<br />
Die Universität Maria Curie Sklodowska<br />
war 1944 die erste staatliche Universitätsneugründung<br />
Polens nach dem 2.<br />
Weltkrieg und bestand zunächst aus vier<br />
Fakultäten: Naturwissenschaft, Medizin,<br />
Tiermedizin und Landwirtschaft.<br />
56
In den ersten Jahren gab es an der UMCS<br />
verschiedene Fakultätsgründungen, wie die<br />
Pharmakologische Fakultät 1945, die Juristische<br />
Fakultät 1949 oder die Geisteswissenschaftliche<br />
Fakultät 1952, sowie Ausgliederungen,<br />
wie die aus Medizinischer und<br />
die Pharmakologischer Fakultät hervorgehende<br />
Medizinische Akademie oder die aus<br />
drei Fakultäten gebildete Landwirtschaftliche<br />
Hochschule. Aufgrund fehlender<br />
Gebäude und Strukturen, aber auch der<br />
Vernachlässigung der Stadt Lublin innerhalb<br />
Polens gestaltete sich der Aufbau sehr<br />
schwierig. Besserung bescherte die Gründung<br />
eines Universitätsviertels auf einem 17<br />
Hektar großen, von der Stadt zu Verfügung<br />
gestellten Gelände. Mit dem Bau von Studentenwohnheimen<br />
und der Anlage eines<br />
großen Parks entstand hier das erste „Universitätsstädtchen“<br />
Polens, das nicht nur<br />
den Aufstieg der UMCS begünstigte, sondern<br />
auch zur Entwicklung des heutigen<br />
Stadtzentrums beitrug. Dennoch konnte<br />
sich die Universität erst langsam etablieren<br />
und die Fluktuation bei Lehrkörper und inhaltlicher<br />
Ausrichtung reduzieren. Wichtige<br />
Forschungsarbeiten entstanden vor allem<br />
auf agrar- und naturwissenschaftlichen Gebieten.<br />
Heute gibt es an der UMCS die 10 Fachbereiche<br />
Rechtswissenschaften; Biologie und<br />
Bodenkunde; Chemie; Mathematik, Physik<br />
und Informatik; Wirtschaftswissenschaften;<br />
Kunst; Geisteswissenschaften; Psychologie<br />
und Pädagogik; Philosophie und Soziologie<br />
sowie Politikwissenschaften. Die<br />
Universität ist vor allem bei Studenten aus<br />
Lublin beliebt, kooperiert mit zahlreichen<br />
ausländischen Universitäten und nimmt an<br />
verschiedenen Austauschprogrammen teil.<br />
Aus der Geschichte beider Institutionen<br />
wird ersichtlich, dass sie jeweils vor verschiedenen<br />
Hintergründen und mit unterschiedlicher<br />
Motivation entstanden sind. Während<br />
die KUL <strong>als</strong> humanistische Lehr- und<br />
Forschungseinrichtung mit theologischem<br />
Schwerpunkt gegründet wurde, entstand<br />
mit der UMCS zunächst eine Universität<br />
mit medizinischem und agrarwissenschaftlichem<br />
Profil. In den Nachkriegsjahren<br />
ergänzen sich beide Einrichtungen, eine<br />
Konkurrenz ist nicht vorhanden. Nach der<br />
häufigen Umstrukturierung und Ausgliederung<br />
der Kernbereiche in eigene Akademien,<br />
veränderte sich diese Situation jedoch<br />
zunehmend. Je weiter einzelne Lehrbereiche<br />
der KUL beschnitten wurden, desto mehr<br />
wurden sie an der UMCS ausgeweitet, zumal<br />
besonders jene Fachbereiche unter<br />
Druck gerieten, die sich an der UMCS im<br />
Aufbau befanden.<br />
Die Universität Maria Curie Sklodowska<br />
wurde relativ schnell nach ihrer Gründung<br />
politisch <strong>als</strong> Gegenstück zur Katholischen<br />
Universität Lublin wahrgenommen<br />
und <strong>als</strong> solches auch bewußt etabliert. Vermutlich<br />
bestand die Hoffnung darin, durch<br />
wirtschaftliche und politische Besserstellung<br />
von Universität und Absolventen, die<br />
Interessenten bei Studenten und Personal<br />
für die einzelnen Fachbereiche an der KUL<br />
stark zu reduzieren und sie damit in die Bedeutungslosigkeit<br />
zu drängen. Geblieben<br />
wäre eine Katholische Universität mit den<br />
Fachbereichen Theologie und Kanonisches<br />
Recht, die <strong>als</strong> Spezialeinrichtung ihren gesellschaftlichen<br />
Einfluss auf intellektueller<br />
Breite verloren hätte.<br />
Ein fairer Wettstreit, bei dem die Eifernden<br />
gleiche Voraussetzungen besitzen,<br />
war vor diesem Hintergrund unter der kommunistischen<br />
Regierung praktisch nicht<br />
möglich und auch nicht gewollt. Dennoch<br />
hielt die Katholische Universität dank internationaler<br />
Unterstützung und nicht zuletzt<br />
auch dank der Wahl Karol Wojtylas<br />
zum Papst diesem Druck stand, ja nahm<br />
sogar genau die Bildungsaufgaben verstärkt<br />
wahr, die der Staat ihr zu entziehen suchte.<br />
Mit der Verleihung der Ehrendorktorwürde<br />
an Karol Wojtyla ebenso wie mit der Gründung<br />
des Johannes Paul II Institutes und<br />
schließlich der veränderten Namensgebung<br />
würdigte die Universität das Engagement<br />
57
und die Unterstützung ihres einstigen Dozenten.<br />
Heute gibt es in der inhaltlichen Ausrichtung<br />
beider Universitäten wenige Unterschiede.<br />
Sie stehen im direkten Wettbewerb<br />
um Studenten und Dozenten, der<br />
hinsichtlich der Qualität von Forschung<br />
und Lehre sicher sehr positiv zu bewerten<br />
ist. Manch bitterer Beigeschmack mag aus<br />
der Geschichte hier und da mitschwingen,<br />
am ehesten wohl, wenn man sich die Gestaltung<br />
der jeweilgen Universitätscampi<br />
betrachtet. Nach außen präsentieren sich<br />
beide Universitäten modern und aufstrebend.<br />
Die Zukunft verheißt eine spannende<br />
Entwicklung zweier Universitäten, vor dem<br />
Hintergrund ihrer verschiedenen, aber verflochtenen<br />
Geschichte und auf der Suche<br />
nach jeweils eigener, sich ergänzender Identität.<br />
Literatur:<br />
Zofia Skubala & Zbigniew Zokarski: „Polnische<br />
Universitäten“ Polonia Verlag Warschau<br />
1959<br />
Sonja Steier-Jordan: „Bildungssystem im<br />
Übergang“ Informationen zur politischen<br />
Bildung, Heft 273<br />
Die Universitätlogos wurden von den Internetsites<br />
der jeweiligen Universitäten heruntergeladen.<br />
58
„Lublin heute“ –<br />
Vermutungen über eine Stadt<br />
von Sara Stroux<br />
Das Interesse der deutschen Öffentlichkeit an Lublin scheint begrenzt. Nachrichten<br />
aus Lublin sind schwer zu finden und hätte die Stadt nicht eine grausame<br />
nation<strong>als</strong>ozialistische Vergangenheit, dann wäre sie wohl noch weniger Deutschen<br />
ein Begriff<br />
Liegt Lublin zu weit im Osten, ist sie mit<br />
rund 360.000 Einwohnern tatsächlich zu<br />
klein, vielleicht zu strukturschwach, um<br />
über die westlichen Landesgrenzen hinaus<br />
wahrgenommen zu werden? Eine der wenigen,<br />
die es genauer wissen wollten, ist Krisztina<br />
Koenen, die sich 1998 für die F.A.Z. auf<br />
den Weg gemacht hat, um ein Porträt über<br />
Lublin zu schreiben. Rund acht Jahre nach<br />
Einführung der Demokratie in Polen und<br />
der Öffnung der Märkte fällt ihr Befund<br />
gemischt aus: erfolgreiche polnische Unternehmer,<br />
eine alternative Kulturszene, aber<br />
Stadtansicht von Lublin 2005. (Urheber unbekannt)<br />
auch wachsende soziale Ungleichheiten,<br />
Armut und eine angespannte Finanzlage<br />
der Stadt. Folgende ihrer Beobachtungen<br />
zeichnet dann auch ein wenig hoffnungsvolles<br />
Bild: „Seine beste Zeit muss Lublin<br />
im vierzehnten, fünfzehnten und sechzehnten<br />
Jahrhundert gehabt haben. 1317 erhielt<br />
es das Stadtrecht, Handel und Handwerk<br />
bekamen eigene Freiräume. In dieser Periode<br />
entstand die kleine, doch berückend<br />
schöne Altstadt. Das alte Rathaus, die reich<br />
verzierten Renaissance-Bürgerhäuser lassen<br />
etwas vom damaligen Reichtum der Stadt<br />
erahnen. Von der gegenwärtigen öffentlichen<br />
Armut allerdings auch. Die Gebäude<br />
in den engen Gassen bewohnen meist Arme,<br />
darunter so mancher Krimineller, hier ist einer<br />
der sozialen Brennpunkte Lublins. Die<br />
feuchten, primitiven, oft baufälligen Wohnungen<br />
sind anderweitig nicht zu vermieten,<br />
und so beschleunigen die Einwohner<br />
den Verfall, den bisher nur geringe öffentliche<br />
Investitionen aufzuhalten versuchten.“<br />
Glaubt man den Fotos aus Reiseführern<br />
und der örtlichen Tourismusbehörde, dann<br />
zeigt sich die Lubliner Altstadt heute, weitere<br />
acht Jahre später, in neuem Glanz. Viele<br />
Gebäude sind in den letzten Jahren instand<br />
gesetzt, die Fassaden aufwendig restauriert<br />
worden. Die EU-Fördermittel, die Polen seit<br />
dem EU-Beitritt 2004 in grossem Umfang<br />
zu Gute kommen, werden einen entscheidenden<br />
Beitrag zur Finanzierung der Erneuerungsmassnahmen<br />
geleistet haben. Denn<br />
nur 1,78% des umgerechnet rund 200 Mio.<br />
Euro starken Haushalts der Stadt Lublin<br />
standen beispielsweise letztes Jahr für Kul-<br />
Stadtrenovierung<br />
(David Kolb)<br />
59
Haus der Familie Konopnica<br />
(Markt Nr. 12) Fassade 1999<br />
(David Kolb)<br />
Fassade nach der Renovierung<br />
2004<br />
(Quelle: Stadt Lublin)<br />
tur und den Schutz nationaler Kulturgüter<br />
zur Verfügung. Investitionen jedenfalls, die<br />
in das architektonische Erbe der Stadt fliessen,<br />
scheinen im Zeitalter der Tourismusindustrie<br />
gut angelegt. Denn man erwartet,<br />
wie auf der Homepage der Stadt zu lesen ist,<br />
nach Abschluss der Instandsetzung der Altstadt<br />
und dem Ausbau der Hotelinfrastruktur<br />
einen Anstieg der Touristenzahlen, auch<br />
aus dem Ausland. Anders <strong>als</strong> Warschau,<br />
Danzig oder Posen, deren weitgehend zerstörte<br />
Altstädte nach dem Zweiten Weltkrieg<br />
mit dem Ziel historische Kontinuität<br />
zu gewährleisten wieder aufgebaut wurden,<br />
oder Städte wie Elbing, die erst in den letzten<br />
beiden Jahrzehnten die in Fachkreisen<br />
stark umstrittenene „Retroversion“ (Rekonstruktion)<br />
ihrer Altstadt durchsetzten konnte,<br />
war die Bausubstanz der Altstadt von<br />
Lublin nach 1945 nur wenig zerstört. An bedeutenderen<br />
Gebäuden haben die Lubliner<br />
zwischen 1947 und 1952 nur das aus dem 19.<br />
Jahrhundert stammende „Neue Rathaus“<br />
(Nowy Ratusz) wieder aufgebaut. Ein wichtiges<br />
Stück Stadtgeschichte allerdings bleibt<br />
im heutigen Alltag unsichtbar, erst in den<br />
letzten Jahren wurde es im Massstab 1:250<br />
rekonstruiert: das jüdische Viertel Podzamcze.<br />
Da wo heute der Busbahnhof, ein Parkplatz<br />
und viel Verkehr (Al. Tysiaclecia) das<br />
Stadtbild bestimmen, wohnten bis zur vollständigen<br />
Zerstörung des Stadtteils durch<br />
die Nation<strong>als</strong>ozialisten die Juden Lublins.<br />
Zahlen und Statistiken lassen erahnen,<br />
dass „Lublin heute“ mehr sein muss <strong>als</strong> eine<br />
pittoreske Altstadt und Zeuge einer bewegten<br />
Vergangenheit, viel mehr. Und gerade<br />
das macht es spannend.<br />
1317 zur Zeit ihrer Gründung umfasste<br />
die Stadt etwa 24 km 2 , heute nimmt sie eine<br />
Fläche von 147 km 2 ein und hat sich damit<br />
in ihrer Ausdehnung mehr <strong>als</strong> versechsfacht.<br />
Die Einwohnerzahlen, die im ausgehenden<br />
19. Jahrhundert noch bei rund<br />
50.000 lagen, haben sich sogar mehr <strong>als</strong><br />
versiebenfacht. Die grössten Zuwachsraten<br />
verzeichnete die Stadt im letzten Jahrhundert,<br />
besonders nach 1945. Dass bedeutet,<br />
dass neben Eingemeindungen auch unzählige<br />
neue Wohngebiete zum Wachstum<br />
Lublins beigetragen haben müssen.<br />
Ein Stück Stadt, von der man <strong>als</strong> flüchtiger<br />
Besucher nichts zu sehen bekommen wird.<br />
Grossplattenbausiedlungen in Typenserien<br />
wie sie in den 1960er, 1970er Jahren in vielen<br />
Ländern entstanden? Ebenso wie in der<br />
ehemaligen DDR produziert in Fabriken<br />
nach sowjetischen Vorbildern mit dem Ziel<br />
die Industrialisierung des Bauens voranzutreiben,<br />
unter dem Motto „Besser, schneller<br />
und billiger bauen“? Mit den gleichen bauphysikalischen,<br />
baukonstruktiven und vor<br />
allem sozialen Problemen wie wir sie heute<br />
in Deutschland haben? Und denselben hilflosen<br />
Lösungsansätzen: in verschiedenen<br />
Farben angemalt, mit unterschiedlichen<br />
Eingangsportalen versehen um Identifikation<br />
zu erleichtern? Vielleicht.<br />
Auch die Zeit nach 1989, die Liberalisierung<br />
und Privatisierung der Märkte, der<br />
Reformprozess Polens muss die Stadt verändert<br />
haben. Polen gilt <strong>als</strong> Niedriglohnland.<br />
Durchschnittlich umgerechnet 570<br />
Euro verdient wer in Polens Wirtschaft beschäftigt<br />
ist, so heisst es auf der Homepage<br />
der Stadt Lublin mit der sie um internationale<br />
Investoren wirbt. Stimmen die Zahlen,<br />
dann ist es für Unternehmen günstig<br />
nach Lublin zu kommen. Mehr <strong>als</strong> umgerechnet<br />
35 Euro/m 2 muss man für Bauland<br />
nicht bezahlen, Büroflächen in guter Lage<br />
kann man für 15 Euro/m 2 (22 Euro/m 2 in<br />
Warschau) mieten, Steuervergünstigungen<br />
sind selbstverständlich. Jeder fünfte Einwohner<br />
Lublins ist Student. Eine renommierte<br />
Katholische, eine Technische, eine<br />
Medizinische, die Marie Curie-Slodowska<br />
Universität, eine Universität für Agrarwissenschaften<br />
und sieben weitere Colleges<br />
(u.a. Wirtschaft, Sozialwissenschaften, Europastudien)<br />
müssten der Stadt einen klaren<br />
Standortvorteil gegenüber vielen anderen<br />
polnischen Städten verschaffen. Nach<br />
eigenen Angaben sind die wichtigsten<br />
Wirtschaftszweige der Stadt die Automobil-,<br />
Chemie- und Lebensmittelindustrie,<br />
Maschinenbau, Möbelfabrikation, Stromerzeugung,<br />
Handel und Dienstleistung.<br />
387 Unternehmen mit ausländischem Kapital<br />
meldet die Stadt 2004, knapp 1 % aller<br />
Lubliner Unternehmen. McDonald’s,<br />
OBI und Media Markt sind schon da. Die<br />
Gelder kommen vor allem aus Westeuropa.<br />
Dänen produzieren Bier, Franzosen<br />
Autozubehör, Deutsche investieren mit der<br />
60
Übernahme des Grand Hotel Lublianka in<br />
die Tourismusindustrie. Die wichtigsten<br />
Handelspartner Lublins sind jedoch nach<br />
wie vor Staaten im Osten wie die Ukraine<br />
oder Weissrussland. Auf deren Märkte spekulierte<br />
wohl auch einer der ersten ausländischen<br />
Grossinvestoren Lublins, der koreanische<br />
Automobilhersteller Daewoo, <strong>als</strong><br />
er Mitte der 1990er Jahre die Mehrheit des<br />
Lubliner Staatsbetriebs FSC übernahm. Das<br />
Unternehmen produzierte bis dahin den<br />
Lieferwagen „Zuk“. Mit dem neuen Besitzer<br />
kam der neue Name, „Daewoo Motor Polska“,<br />
und ein neues Modell: der für den osteuropäischen<br />
Markt gefertigte Kleintransporter<br />
„Lublin“. Scheinbar erfolgreich, denn<br />
obwohl der koreanische Mutterkonzern<br />
2001 Konkurs anmeldete, hat der „Lublin“<br />
überdauert. Der Transporter, finanziert von<br />
über 60 neuen Anteilseignern, geht heute <strong>als</strong><br />
„Lublin III“ vom Band.<br />
Ein gut präpariertes architektonisches<br />
Erbe, anonyme Stadtansichten und ein robuster<br />
Kleintransporter – unterschiedliche<br />
Facetten einer Stadt, über die sich aus der<br />
Ferne nur Vermutungen anstellen lassen.<br />
Höchste Zeit, sie an der Wirklichkeit zu<br />
messen!<br />
Literatur<br />
Krisztina Koenen: Lublin. Auf dem Weg<br />
nach Eldorado, in: Frankfurter Allgemeine<br />
Magazin, 23.01.1998, Nr.934<br />
Lorenz, Frank: Die Wiederherstellung historischer<br />
Altstädte in Polen seit 1985, in:<br />
Langer, Andrea: Der Umgang mit dem kulturellen<br />
Erbe in Deutschland und Polen,<br />
Warschau 2004, S.191-197<br />
Gawarecki, Henryk: Lublin. Krajobraz i architektura,<br />
Warschau 1964<br />
Links<br />
www.um.lublin.pl<br />
www.loit.lublin.pl<br />
www.tnn.lublin.pl<br />
www.daewoo.lublin.pl<br />
Daewoo Lublinj II<br />
(Quelle: Daewoo)<br />
Stadtansicht von Lublin 2005.<br />
(Urheber unbekannt)<br />
61
Kapitel III<br />
Identität und Erinnerung –<br />
Cusanische Standpunkte<br />
63
Deutsch-Polnische Begegnungen:<br />
Lauter Klippen, Hürden, Stolpersteine?<br />
von Elisabeth Suntrup<br />
Deutsch-polnische Begegnungen im Jahr<br />
2006, zwei Ereignisse, zwei widerstreitende<br />
Bilder. Erstes Bild: Der deutsche Papst Benedikt<br />
XVI. reist im Mai nach Polen. Allein<br />
und mit abgenommenem Käppchen<br />
geht er am letzten Tag seiner Pilgerfahrt<br />
durch das Tor des ehemaligen Konzentrationslagers<br />
Auschwitz und betet vor den Augen<br />
der Anwesenden Überlebenden vor der<br />
„Todeswand“, vor der einst Zehntausende<br />
von Häftlingen durch seine Landesleute erschossen<br />
wurden. Für den Auschwitz-Überlebenden<br />
August Kowalcyk ist der Besuch<br />
eines deutschen Papstes in Auschwitz ein<br />
unglaubliches Zeichen der Versöhnung: „Ist<br />
das nicht ein Wunder, dass ich 64 Jahre nach<br />
den Exekutionen auf der anderen Seite des<br />
Zellengitters stehe? Mit einem Menschen,<br />
der die gleiche Nationalität hat wie meine<br />
Peiniger, aber die Soutane des höchsten<br />
Würdenträgers der Kirche trägt?“, zitiert<br />
ihn die Stuttgarter Zeitung. Zweites Bild:<br />
Am Vorabend des für den 3. Juli geplanten<br />
Gipfeltreffens zum „Weimarer Dreieck“ sagt<br />
der polnische Staatspräsident Lech Kacynski<br />
das Treffen mit Bundeskanzlerin Angela<br />
Merkal und dem französischen Staatspräsidenten<br />
Jacques Chirac kurzfristig ab. In der<br />
Presse wurde daraufhin spekuliert, ob eine<br />
Satire in der deutschen Zeitung taz, in der<br />
Kacynski <strong>als</strong> ‚Polens neue Kartoffel‘ karikiert<br />
wird, der Grund für die Absage gewesen<br />
sein könnte. Beide Ereignisse zeigen, wie<br />
groß die Bandbreite der deutsch-polnischen<br />
Wahrnehmungen gegenwärtig ist. Sie reicht<br />
von dem „Wunder der Versöhnung“ bis hin<br />
zu Empfindlichkeiten und Misstrauen, die<br />
auch heute, mehr <strong>als</strong> sechzig Jahre nach dem<br />
Ende des Zweiten Weltkrieges, die deutschpolnischen<br />
Beziehungen belasten.<br />
Die vielfältigen Formen von gelungenen<br />
Begegnungen zwischen beiden Ländern,<br />
aber auch die Stolpersteine, die ihnen bis<br />
heute im Weg liegen, sollen im folgenden an<br />
einigen Beispielen aufgezeigt werden.<br />
Historische Voraussetzungen: Von der<br />
deutsch-polnischen Symbiose zur ‚Erbfeindschaft’<br />
Auch wenn es mit Blick auf die erste<br />
Hälfte des 20. Jahrhunderts größtenteils in<br />
Vergessenheit geraten ist: Das deutsch-polnische<br />
Verhältnis war nicht immer problematisch.<br />
Im Gegenteil, über Jahrhunderte<br />
gab es enge Verflechtungen zwischen Deutschen<br />
und Polen, manche sprechen gar von<br />
einer regelrechten Symbiose. Das polnische<br />
Bürgertum beispielsweise war im Mittelalter<br />
weitgehend deutscher Herkunft, umgekehrt<br />
wurden Gebiete wie Niederschlesien und<br />
Breslau von der polnischen Kultur und Sprache<br />
beeinflusst. Über Jahrhunderte kamen<br />
deutsche Siedler nach Ostpolen, deren Kultur<br />
sie mitprägten. Umgekehrt zogen im 19.<br />
Jahrhundert viele Polen aus dem preußisch<br />
besetzten Westpolen nach Nordrhein Westfalen,<br />
wo sich bis heute Spuren ihrer Sprache<br />
und Bräuche finden lassen. Konfliktfrei<br />
waren diese Migrationsbewegungen freilich<br />
nicht, wie die Ausstellung „Kaczmarek und<br />
64
andere. Polnische und polnischsprachige<br />
Zuwanderer im Ruhrgebiet 1875 bis heute“<br />
deutlich macht, die seit ihrer Erstpräsentation<br />
in Essen 1997 sowohl in Deutschland<br />
<strong>als</strong> auch in Polen auf großes Interesse gestoßen<br />
ist. Den Tiefpunkt erreichte das<br />
deutsch-polnische Verhältnis zweifelsohne<br />
während der Zeit der deutschen Besatzung<br />
zwischen 1939 und 1945: In Erinnerung geblieben<br />
sind aus dieser Zeit im kollektiven<br />
Gedächtnis der Polen nicht nur die Vertreibung<br />
und Ermordung Millionen polnischer<br />
Bürger durch die Deutschen, sondern auch<br />
der Versuch, die polnische Nation zu beseitigen.<br />
Auf deutscher Seite hingegen sind bei<br />
vielen die Vertreibung der Deutschen aus<br />
den ehemaligen reichsdeutschen Gebieten<br />
in Erinnerung geblieben, die die Auseinandersetzung<br />
mit den Verbrechen der eigenen<br />
Landsleute zunächst oftm<strong>als</strong> verdrängte.<br />
Scharfe Klippen und ihre Umschiffungsmanöver<br />
– Deutsch-polnische Begegnungen<br />
ab 1945<br />
Nach 1945 war das Klima zwischen<br />
den beiden Nachbarstaaten somit denkbar<br />
schlecht, zumal Westdeutschland und<br />
Polen den beiden verfeindeten politischen<br />
Systemen angehörten. Eine Auseinandersetzung<br />
mit den historischen Belastungen<br />
wurde deshalb zunächst verschoben. Ähnliches<br />
galt im übrigen auch für das Verhältnis<br />
zwischen Polen und der DDR, die<br />
eine Art „Zwangsfreundschaft“ <strong>als</strong> sozialistische<br />
Bruderstaaten verband, aus der<br />
die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit<br />
ausgeblendet blieb. Dennoch wurden<br />
bereits während der Zeit des „Kalten<br />
Krieges“ wichtige Schritte zu einer Annäherung<br />
und Versöhnung der beiden Völker<br />
eingeleitet, und zwar nicht zuletzt, weil immer<br />
wieder Menschen und einzelne Institutionen<br />
– auch gegen den jeweiligen Zeitgeist<br />
– dafür warben, die Begegnung mit<br />
dem Nachbarn zu suchen. Eine kaum zu<br />
unterschätzende Türöffnerfunktion hatten<br />
dabei die Kirchen, die sich bereits in den<br />
60er Jahren für einen Dialog zwischen beiden<br />
Völkern einsetzten. Man denke in diesem<br />
Zusammenhang vor allem an die Versöhnungsbotschaft<br />
der polnischen Bischöfe<br />
(„Wir gewähren Vergebung und bitten um<br />
Verzeihung“) an ihre deutschen Mitbrüder<br />
im Jahre 1965. Daneben hatten insbesondere<br />
Kulturschaffende, Künstler und Intellektuelle<br />
eine wichtige Vorreiterfunktion für<br />
die Begegnung zwischen den beiden Nachbarn:<br />
Im westdeutschen Kulturbetrieb etwa<br />
kam es in den 60er Jahren zu einer regelrechten<br />
„Polenwelle“. Die Musik von Krzystof<br />
Penderecki, Filme von Andrzej Wajda<br />
oder Andrzej Munk sowie polnische<br />
Lyrik wurden begeistert rezipiert und vermittelten<br />
das Bild eines anderen, modernen<br />
Polens. Die ostdeutschen Intellektuellen<br />
hingegen entdeckten Polen vor allem<br />
während der 70er <strong>als</strong> eine Form des anderen<br />
Sozialismus, in dem Künstler und Medienleute<br />
westlicher orientiert waren und<br />
freier agieren konnten. Umgekehrt spielten<br />
deutsche Autoren, wie etwa Heinrich Böll,<br />
Günter Grass oder Siegfried Lenz, für die<br />
Herstellung eines anderen Deutschlandbildes<br />
in Polen eine wichtige Rolle. Auf politischer<br />
Ebene legte Willy Brandt mit seiner<br />
Neuen Ostpolitik in den 70er Jahren<br />
die Grundlagen für eine Annäherung zwischen<br />
beiden Ländern, die im Kniefall an<br />
der Gedenkstätte des Warschauer Ghettos<br />
ihr Symbol fand. Der erste Annäherungsversuch<br />
eines deutschen Staatsoberhauptes<br />
an den östlichen Nachbarn verlief jedoch<br />
keineswegs ‚stolperfrei’: So kam es in der<br />
Bundesrepublik zu öffentlichen Protesten<br />
gegen das Warschauer Abkommen, in dem<br />
die Bundesrepublik die Oder-Neiße-Grenze<br />
vorläufig anerkannte und in dem viele<br />
eine endgültige Verzichtserklärung für die<br />
ehemaligen deutschen Ostgebiete sahen.<br />
Nach der Pionierarbeit auf kultureller<br />
und politischer Ebene ermöglichte die<br />
Öffnung der Grenzen ab den 70er Jahren<br />
erstm<strong>als</strong> auch persönliche Begegnungen<br />
zwischen Westdeutschen und Polen bzw.<br />
Ostdeutschen und Polen. Hunderttausende<br />
Polen reisten nun <strong>als</strong> Touristen nach<br />
West- oder Ostdeutschland und umgekehrt.<br />
Während die DDR in den 80er Jahren<br />
die Grenze gegenüber dem reformfreudigen<br />
Nachbarn wieder schloss, löste<br />
die Entstehung der polnischen Gewerkschaftsbewegung<br />
Solidárnosc Anfang der<br />
80er Jahre in der Bundesrepublik eine neue<br />
Polenbegeisterung aus: In einer großange-<br />
65
legten Hilfsaktion schickten Westdeutsche<br />
etwa zwei Millionen Pakete mit Lebensmitteln<br />
und Bekleidung nach Polen. Auch das<br />
Bistum Trier, zu dem ich dam<strong>als</strong> gehörte,<br />
rief zu Spenden auf, und ich kann mich<br />
noch gut daran erinnern, wie ich mit meiner<br />
Mutter zusammen <strong>als</strong> Sechsjährige die sogenannten<br />
„Polenpäckchen“ geschnürt und<br />
dabei zum ersten Mal überhaupt von dem<br />
Land gehört habe, das mir dam<strong>als</strong> wie aus<br />
einer anderen Welt erschien.<br />
Anfangseuphorie und jede Menge Stolpersteine<br />
– deutsch-polnische Begegnungen<br />
seit 1990<br />
Mit dem Grenzvertrag am 14. November<br />
1990 und dem Nachbarschafts- und<br />
Freundschaftsvertrag vom 17. Juni 1991, unterzeichnet<br />
durch den polnischen Ministerpräsidenten<br />
Jan Krystof Bielecki und Bundeskanzler<br />
Helmut Kohl, wurde 45 Jahre<br />
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges<br />
erstm<strong>als</strong> die rechtliche Basis für eine ganz<br />
neue Zusammenarbeit zwischen den beiden<br />
Ländern gelegt. Dabei begegneten sich<br />
Anfang der 90er Jahre zwei Nachbarn, die<br />
nicht nur großes Interesse, ja Begeisterung<br />
füreinander empfanden, sondern die auch<br />
von ähnlichen Interessen innerhalb Europas<br />
geleitet waren: Die Idee einer „Deutschpolnischen<br />
Interessengemeinschaft“ kam zu<br />
dieser Zeit auf: Während das wiedervereinigte<br />
Deutschland unter Helmut Kohl ein<br />
Interesse an einer Vertiefung und Erweiterung<br />
der EU Richtung Osten hatte, nicht<br />
zuletzt, um die Angst vor einem wiedererstarkenden<br />
Deutschland in der Mitte Europas<br />
zu entkräften, setzt sich auf polnischer<br />
Seite die Überzeugung durch, dass der „Weg<br />
nach Europa“ über Deutschland führt“ (vgl.<br />
Freudenstein/Tewes 2002, S.30).<br />
Seitdem haben in vielen Bereichen Begegnungen<br />
zwischen den beiden Nachbarländern<br />
stattgefunden, aus denen zum Teil<br />
dauerhafte Verflechtungen entstanden sind.<br />
Ein Beispiel dafür ist die 1991 eröffnete Europa-Universität<br />
Viadrina, die die beiden<br />
Zwillingsstädte Frankfurt/Oder und Slubice<br />
miteinander verbindet. Wie sehr die<br />
beiden Grenzstädte inzwischen miteinander<br />
verflochten und welche ‚geistigen Brücken’<br />
durch die Universität entstanden sind,<br />
konnte ich bei der Mitorganisation einer<br />
Fachschaftstagung des <strong>Cusanuswerk</strong>es, die<br />
unter dem Titel „Going East – wirtschaftliche<br />
und soziale Implikationen“ vom 31.<br />
Oktober bis 3. November 2002 an der Viadrina<br />
stattgefunden hat, selbst miterleben.<br />
Zu nennen ist in diesem Zusammenhang<br />
auch das 1993 gegründete „Deutsch-Polnische<br />
Jugendwerk“, an dessen Austauschprogrammen<br />
mittlerweile 1,3 Millionen<br />
Jugendliche teilgenommen haben. Darüber<br />
hinaus gibt es weitreichende wirtschaftliche<br />
Verflechtungen: Deutschland ist Polens<br />
wichtigster Handelspartner, ein Drittel von<br />
Polens Exportgütern geht nach Deutschland,<br />
ein Viertel der Importgüter werden<br />
aus Deutschland eingeführt. Umgekehrt ist<br />
Polen für Deutschland der wichtigste Auftragnehmer,<br />
über 10% aller Auslandsaufträge<br />
aus dem östlichen Nachbarland. Doch<br />
trotz dieser vielfältigen politischen, kulturellen<br />
und wirtschaftlichen Kontakte gibt es<br />
bis heute jede Menge ‚Stolpersteine’, die die<br />
bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland<br />
und Polen vor allem in den letzten Jahren<br />
deutlich haben abkühlen lassen.<br />
Rechtlich-politische Hürden: Vertreibungspolitik<br />
und Entschädigungszahlungen<br />
Die Verschlechterung der bilateralen Beziehungen,<br />
wie sie derzeit zu beobachten<br />
ist, hat aus Sicht vieler Experten entscheidend<br />
mit der Rückkehr der Vergangenheit<br />
in den deutsch-polnischen Dialog zu tun.<br />
Während die belastete Geschichte zwischen<br />
beiden Ländern aus deutscher Sicht<br />
lange Zeit <strong>als</strong> Ansporn diente, um die Beziehungen<br />
zum Nachbarland zu verbessern,<br />
wurde sie in der polnischen Wahrnehmung<br />
seit Ende der 90er Jahre instrumentalisiert,<br />
um Bedingungen an den polnischen EU-<br />
Beitritt zu knüpfen. Auslöser der bis heute<br />
andauernden Geschichtsdebatte waren<br />
die scharfen Worte der Vorsitzenden des<br />
„Bundes der Vertriebenen“ (BdV) Erika<br />
Steinbach, die bei ihrem Amtsantritt 1998<br />
eine Entschuldigung der „Vertreiberstaaten“<br />
und Entschädigungen gegenüber den Vertriebenen<br />
forderte. Andernfalls solle die<br />
deutsche Außenpolitik Polens EU-Beitritt<br />
blockieren. Einen ganz besonders empfindlichen<br />
Nerv in Polen traf vor allem die<br />
66
Gründung der „Preußischen Treuhand“<br />
im Jahr 2003, einer Klägervereinigung, die<br />
das Ziel verfolgt, vor europäischen Gerichtshöfen<br />
Entschädigungen oder eine Wiederherstellung<br />
des Eigentums von Vertriebenen<br />
in Polen einzuklagen; die ersten Klagen vor<br />
dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof<br />
in Straßburg stehen demnächst an. Zusammen<br />
mit dem von Steinbach parallel zu<br />
ihren Entschädigungsforderungen vorangetriebenen<br />
„Zentrum gegen Vertreibungen“<br />
wurde die „Preußische Treuhand“ in Polen<br />
<strong>als</strong> Beleg für den angenommenen deutschen<br />
Revisionismus wahrgenommen. Welche<br />
Polemik die Debatte dabei entzündete,<br />
zeigt die umstrittene Karikatur auf dem Titelblatt<br />
des polnischen Magazins „Wprost“<br />
von September 2003, die Erika Steinbach in<br />
SS-Uniform auf Gerhard Schröder reitend,<br />
darstellt:<br />
Anspielung auf die Partei der Kaczynskis<br />
tituliert wird – formulierten Ansprüche.<br />
Denn sie bieten der nationalkatholischen<br />
Partei eine hervorragende Plattform, um<br />
Ängste und Misstrauen in der Bevölkerung<br />
zu schüren und antideutsche Ressentiments<br />
zu wecken. Die daraus entstandenen politischen<br />
Konstellation tragen derzeit kaum<br />
dazu bei, die Stolpersteine zwischen beiden<br />
Ländern aus dem Weg zu räumen – siehe<br />
der gescheiterte Weimargipfel. Während<br />
von polnischer Seite vor allem nationalbewusste<br />
Töne zu hören sind, die eher Konflikte<br />
<strong>als</strong> Konsens oder partnerschaftliche<br />
Nachbarschaft suchen, ist in Berlin zwar einerseits<br />
das Bemühen erkennbar, die Krise<br />
in den deutsch-polnischen Beziehungen<br />
möglichst niedrig zu halten und Sympathie<br />
gegenüber dem Nachbarn zu signalisieren.<br />
Andererseits ist eine klare Distanzierung<br />
von den Forderungen Steinbachs ebenso<br />
wenig erkennbar. Die nächsten Konflikte<br />
sind da schon in Sicht.<br />
Stolperstein Nr. 1: Klischees und Vorurteile<br />
Klippenreiches politische Klima – Warschauer<br />
Tacheles versus Charmeoffensive<br />
aus Berlin<br />
Vor dem Hintergrund der andauernden<br />
Erinnerungsdebatte ist der Erfolg der Zwillingsbrüder<br />
Kaczynski nicht zuletzt auch<br />
eine Reaktion auf das wieder erwachte polnische<br />
Misstrauen gegenüber Deutschland<br />
sowie auf die von den Vertriebenenverbänden<br />
– unserer „Recht- und Gerechtigkeitspartei“,<br />
wie sie in der deutschen Wochenzeitung<br />
Die Zeit vom 10. August 2006 in<br />
Den größten Stolperstein im deutschpolnischen<br />
Verhältnis bilden aus meiner<br />
Sicht allerdings die tief verwurzelten Klischees<br />
und Stereotypen, die den Blick auf<br />
den Nachbarn oftm<strong>als</strong> verstellen und die<br />
in Polenwitzen hier oder in antideutschen<br />
Vorurteilen dort ihren Ausdruck finden.<br />
Allerdings ist dabei nicht alles so, wie es auf<br />
den ersten Blick vielleicht scheinen mag:<br />
Einer national orientierten Bevölkerung,<br />
die aufgrund der politischen Situation derzeit<br />
das Bild in den Medien beherrscht,<br />
steht in Polen eine wachsende, überwiegend<br />
urbane Bevölkerungsgruppe gegenüber,<br />
die die Anbindung an den Westen<br />
und die Begegnung mit Deutschland geradezu<br />
sucht. Auch die jüngsten Ergebnisse<br />
einer Umfrage des Instituts für öffentliche<br />
Angelegenheiten, nach der 44 % der Polen<br />
die Deutschen heute sympathisch finden<br />
(vor dreißig Jahren waren es gerade mal<br />
7 %), belegen diesen Trend. In Deutschland<br />
hingegen besteht derzeit die größte Gefahr<br />
darin, nach der Euphorie Anfang der 90er<br />
Jahre wieder einmal in Desinteresse und<br />
Gleichgültigkeit gegenüber dem polnischen<br />
67
Nachbarn zurückzufallen. Verständigung<br />
hat jedoch zuerst einmal mit ‚Verstehen wollen‘<br />
zu tun. Vielleicht sollte man sich das in<br />
Zukunft auf beiden Seiten wieder stärker in<br />
Erinnerung rufen. Das zweisprachige Magazin<br />
„Dialog“, das seit 1987 von der „Deutschpolnischen<br />
Gesellschaft“ herausgeben wird<br />
und seitdem mit großem Engagement daran<br />
arbeitet, mit den gegenseitigen Vorurteilen<br />
aufzuräumen, ist dafür im übrigen ein hervorragendes<br />
Beispiel.<br />
Literatur<br />
Freudenstein, Roland, „Szenen einer Nachbarschaft.<br />
Deutschland und Polen am Beginn<br />
des 21. Jahrhunderts“, in: Die politische<br />
Meinung, Nr. 396, November 2002,<br />
S. 29-37.<br />
Freudenstein, Roland/Tewes, Hennig,<br />
„Stimmungstief zwischen Deutschland und<br />
Polen. Für eine Rückkehr zur Interessengemeinschaft,<br />
in: Internationale Politik, Nr. 2,<br />
2000, S. 51-56.<br />
Goll, Thomas/Leuerer, Thomas (Hgg.), Polen<br />
und Deutschland nach der EU-Osterweiterung.<br />
Eine schwierige Nachbarcshaft,<br />
Baden Baden 2005.<br />
Leuerer, Thomas, „‚...wird der Pole dem<br />
Deutschen nie Bruder sein..’ – Sterotypen<br />
und Vorurteile <strong>als</strong> Konstanten der gegenseitigen<br />
deutsch-polnischen Wahrnehmung?“,<br />
in: Goll, Thomas / Leuerer, Thomas (Hgg.),<br />
Polen und Deutschland nach der EU-<br />
Osterweiterung. Eine schwierige Nachbarschaft,<br />
Baden Baden 2005, S. 31-48.<br />
Roser, Thomas, „Der Papst besucht Auschwitz.<br />
Als Deutscher am Ort, wo die Worte<br />
versagen“, in: Stuttgarter Zeitung, Nr. 122,<br />
29. Mai 2006, S. 3<br />
Roser, Thomas, „Der Heilige Vater wurde<br />
zum Polen. Polens Presse ist von der Pilgerfahrt<br />
begeistert – Juden sind vom Auftritt in<br />
Auschwitz ernüchtert“, in: Stuttgarter Zeitung,<br />
Nr. 123, 30. Mai 2006, S. 4<br />
Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik<br />
Deutschland (Hrg.), Annäherungen<br />
– Zblizenia. Deutsche und Polen 1945-1995,<br />
Düsseldorf 1996.<br />
Internet<br />
www.gelsenkirchen.de<br />
www.wirtschaft-polen.de<br />
www.deutsch-polnisches-jahr.de<br />
Hofmann, Gunter, „War da was? Deutschlands<br />
Politiker wollen sich keine Krise mit<br />
Polen einreden lassen.“, in: Die Zeit, Nr. 30,<br />
20. Juli 2006, S. 6.<br />
Ders., „Trübe Wege. Eine Ausstellung über<br />
Flucht und Vertreibung in Berlin entlastet<br />
die deutsche Geschichte und erschwert<br />
die Beziehungen zu Polen“, in: Die Zeit,<br />
10.08.2006.<br />
Köhler, Peter, „Polens neue Kartoffel. Schurken,<br />
die die Welt beherrschen wollen. Heute:<br />
Lech „Katsche“ Kacynski“, in: taz, Nr.<br />
8005, 26.06.2006, S. 20.<br />
Kossert, Andreas, „Noch ist Polen nicht verstanden.<br />
Die Deutschen sollten sich endlich<br />
von den Klischees über ihr Nachbarland<br />
verabschieden“, in: Die Zeit, 04.09.2003,<br />
Nr. 37.<br />
68
Wer nicht erinnern will,<br />
muss wiederholen?<br />
von María Teresa Quirós-Fernández<br />
Die Zeitzeugen des Faschismus sterben aus - in Deutschland, wie in Polen und<br />
Spanien. Es liegt jetzt an den Kindern und Enkeln, die realen und symbolischen<br />
Gräber ihrer Großeltern zu öffnen und sich dem mit ihnen verloren gehenden<br />
und verloren gegangenem Wissen zu stellen. Ein Vergleich der Erinnewrungskulturen<br />
in drei Ländern<br />
Diese Seiten entstanden in England und<br />
damit ausserhalb eines der hier in Betracht<br />
kommenden Länder. Die geographische<br />
Distanz wirkte sich unmittelbar auf meine<br />
Annäherung an das Thema aus. Bei meinen<br />
Recherchen in den englischen Bibliothekskatalogen<br />
stieß ich zunächst auf Reden und<br />
Kommentare von Exilpolen in England aus<br />
der Zeit, die uns heute auf nationaler und<br />
internationaler Ebene auf vielfältige Weise<br />
beschäftigt. Ich las die Ideen und Diskussionen<br />
die dam<strong>als</strong> das zukünftige Polen betrafen.<br />
Während der Recherchen betrachtete<br />
ich immer wieder den Titel, den der Essay<br />
tragen sollte: Wer nicht erinnern will, muss<br />
wiederholen? Erinnerungskulturen in Polen,<br />
Deutschland und Spanien. Was dieses erinnern<br />
und wiederholen betraf, stellten sich mir<br />
Fragen, die ein Ergebnis dessen waren, was<br />
in dem Roman Pawels Briefe (1999) von Monika<br />
Maron in Hinblick auf das Erinnern<br />
an die verstorbenen Großeltern beschrieben<br />
wird: die Schwierigkeit des Erinnerns, wenn<br />
im Innern kein versunkenes Wissen zu Tage<br />
gefördert werden kann, da es schlicht und<br />
ergreifend nicht existiert. Welche Kultur des<br />
Erinnerns wird bzw. kann hinsichtlich der<br />
mir vorliegenden vergangenen, aber textuell<br />
gegenwärtigen Geschichten, meine Generation<br />
und die uns folgenden auf der Grundlage<br />
fehlenden Wissens hervorbringen? Wir<br />
sind damit nicht nur mit dem Widerstreit<br />
von Erinnern und Vergessen, sondern - zunächst<br />
einmal persönlich - mit den uns fehlenden<br />
Erinnerungen konfrontiert. Bedeutet<br />
dies, dass wir gefährdet sind, bestimmte<br />
vergangene Ereignisse zu wiederholen, da<br />
wir sie aufgrund fehlenden Wissens nicht<br />
erinnern können? Und, wenn wir deshalb<br />
nicht erinnern können, wie lässt sich dann<br />
das verlorene Wissen wieder holen bzw. zurückgewinnen?<br />
Spanien 2006 oder das Brechen des sog.<br />
Pakt des Schweigens<br />
Das Jahr 2006 ist in Spanien von fast allen<br />
Parteien mit Ausnahme der PP (Partido<br />
Popular) zum „Jahr der historischen Erinnerung“<br />
erklärt worden, in dem die Zweite<br />
Republik und die Zeit nach dem Ende der<br />
Francodiktatur gewürdigt werden sollen.<br />
Erst 1986 gab es erstmalig ein öffentliches<br />
Gedenken an den Bürgerkrieg. Als das Parlament<br />
in einer Erklärung vom 20. November<br />
2002 den Franco-Putsch von 1936 verurteilte,<br />
schien innerhalb Spaniens eine lang<br />
verdrängte Debatte aufzuleben.<br />
69
Über Jahrzehnte betrieb der Franquismus<br />
eine Erinnerungspolitik, die auf der<br />
Dualität von Siegern und Verlierern gründete,<br />
wobei das „Verlierergedächtnis“ mit<br />
aller Macht unterdrückt wurde. Nach<br />
Francos Tod 1975 wurde das ehem<strong>als</strong> aufoktroyierte<br />
Schweigen zugunsten der neu<br />
zu errichtenden Demokratie weiter fortgeführt<br />
und das Wieder-holen einer in der nationalen<br />
Geschichtsschreibung marginalisierten<br />
und deformierten republikanischen<br />
Geschichte umgangen, was der sich neu<br />
herauszubildenden kollektiven Identität<br />
im Kontext der gerade errichteten Demokratie<br />
nicht nur zum Vorteil gereichte. Seit<br />
kurzem lässt sich nun in Spanien ein regelrechter<br />
Boom hinsichtlich der Aufarbeitung<br />
der jüngsten Geschichte beobachten,<br />
die auf unterschiedliche Weise in der spanischen<br />
Literatur thematisiert wird und für<br />
den schwierigen Umgang mit eben dieser<br />
einen ästhetischen Ausdruck sucht.<br />
Vor allem die Öffnung der über Jahrzehnte<br />
zwar allgegenwärtigen, aber tabuisierten<br />
Massengräber der Opfer des Faschismus<br />
scheint im Augenblick in aller<br />
Dramatik das Ausgraben des Verdrängten<br />
zu symbolisieren, in dessen Prozess eine<br />
längst überfällig gewordene Trauerarbeit<br />
und Aufarbeitung möglich wird. Diese erneute<br />
Hinwendung zur Vergangenheit führt<br />
das Bedürfnis vor Augen, den sog. Pakt des<br />
Schweigens aus der Zeit der Transición, d.h.<br />
der (friedlichen) Übergangsphase von der<br />
Francodiktatur zur Demokratie, endgültig<br />
zu durchbrechen.<br />
Über viele Jahre wurde die Transición <strong>als</strong><br />
eine Art politische Erfolgsgeschichte dargestellt.<br />
Artikel, wie der von Kenneth Maxwell,<br />
Spains Trasition to Democracy: A Model<br />
for Eastern Europe? (1991), diskutierten<br />
die bis dahin ablesbaren Ergebnisse dieses<br />
politischen „Modells“ auch in Hinblick auf<br />
seine Anwendbarkeit für andere Staaten.<br />
Der Erfolg wurde dabei an der politischen<br />
und ökonomischen Entwicklung Spaniens<br />
in jenen Jahren bemessen. Die gegenwärtigen<br />
Debatten lassen jedoch den Preis erkennen,<br />
der auf jenem Weg zur Demokratie<br />
zu zahlen war: die erschwerte Aufarbeitung<br />
des Spanischen Bürgerkrieges und der ihm<br />
folgenden Diktatur. Veranstaltungen wie<br />
das vom Goethe-Institut und Instituto Cervantes<br />
im Mai 2005 organisierte Symposium<br />
La cultura de la memoria: la memoria<br />
histórica en España y Alemania / Kultur des<br />
Erinnerns: Vergangenheitsbewältigung in<br />
Spanien und Deutschland lassen deutlich<br />
werden, wie wichtig die Beschäftigung mit<br />
und der Austausch zwischen den jeweiligen<br />
Kulturen des Erinnerns ist.<br />
Es liegt bald vor allem in den Händen<br />
der Kinder und Enkel, die realen und symbolischen<br />
Gräber ihrer Großeltern zu öffnen<br />
und das mit ihnen verloren gegangene Wissen<br />
zu betrauern, da es nur zum Teil wiederholbar<br />
ist. Gleichzeit scheint mir der Akt<br />
des Gräberöffnens selbst ein erster Schlüssel<br />
zum Verständnis der sich gegenwärtig<br />
(neu) herausbildenden Erinnerungskultur<br />
in Spanien zu sein und eine erste Antwort<br />
auf meine Frage, wie wir erinnern können,<br />
wofür es in uns kein Wissen gibt. Eine Kultur<br />
des Erinnerns kann (oder sollte) sich<br />
nicht lediglich in Gedenkfeiern oder theoretischen<br />
Abhandlungen erschöpfen: Sie<br />
muss zurück an die Wurzeln des Geschehenen<br />
führen - zu dem Moment, der bereits<br />
vergangen und nun verändert gegenwärtig<br />
zu unseren Füssen liegt - und zunächst einmal<br />
das, was noch existiert (aber verdeckt<br />
ist), fassbar werden lassen.<br />
Polen und Deutschland: Erinnerungskulturen<br />
im Widerstreit?<br />
Im Falle Polens und Deutschlands sind<br />
es nationale (innenpolitische Entwicklungen)<br />
und binationale (die schwierige<br />
Annäherung beider Staaten nach 1945) Aspekte,<br />
die nach 1945 und schließlich nochm<strong>als</strong><br />
nach 1989 die jeweiligen Kulturen des<br />
Erinnerns mitgestalteten.<br />
Eine gemeinsame, deutsch-polnische<br />
Erinnerungsarbeit zu etablieren, stellte und<br />
stellt dabei hinsichtlich des Zweiten Weltkrieges<br />
nicht nur eine Notwendigkeit, sondern<br />
auch eine große Herausforderung dar.<br />
Der Angriff Hitler-Deutschlands auf Polen,<br />
Okkupation und Zwangsarbeit einerseits<br />
und Flucht und Vertreibung der Deutschen<br />
aus Polen andererseits belasteten das Verhältnis<br />
stark. Einzelne Etappen waren nötig,<br />
um Grundlagen für einen heute zunehmend<br />
70
stattfindenden Dialog zu schaffen. Dazu gehörten<br />
etwa die Wiedererlangung von Polens<br />
Souveränität, die Vereinigung beider<br />
deutschen Staaten und die Verträge, die in<br />
den 90er Jahren abgeschlossen wurden, um<br />
Grundsätzliches in der deutsch-polnischen<br />
Beziehung zu regeln. Auf dieser politischen<br />
Grundlage konnten sich die deutschen und<br />
polnischen Kulturen des Erinnerns weiterentwickeln<br />
und Gemeinsamkeiten in der<br />
Erinnerungsarbeit gestärkt werden, um sich<br />
selbst lange Zeit tabuisierten Themen (wie<br />
etwa der Zwangsumsiedelung) zu widmen.<br />
Ein Problem stellen dabei immer wieder<br />
Vorurteile dar, die auf beiden Seiten fest im<br />
kollektiven Gedächtnis verankert zu sein<br />
scheinen und Polarisierungen begünstigten.<br />
Hierin zeigt sich, dass eine Reflektion der<br />
bisherigen Erinnerungspraktiken in den jeweiligen<br />
Staaten wichtig ist, die sich in den<br />
Jahrzehnten des Kalten Krieges herausgebildet<br />
haben. So ließ sich auf polnischer Seite<br />
zum einen - ähnlich wie im Falle Spaniens<br />
zur Zeiten der Transición - ein Verhalten erkennen,<br />
das sich in der postdiktatorischen<br />
Phase mehr durch Tendenzen des Vergessens,<br />
der Amnesie und des Schlussstrichs <strong>als</strong><br />
durch Erinnern auszeichnete, um den politisch-gesellschaftlichen<br />
Neubeginn nicht zu<br />
gefährden. Des weiteren scheint das vermittelte<br />
z.T. sehr einseitige Geschichtsbild der<br />
kommunistischen Regierung noch wenig<br />
hinterfragt worden zu sein, was die notwendige<br />
Zusammenarbeit bezüglich der wohl<br />
schwierigsten Aufgabe, der Konfrontation<br />
mit dem Holocaust, erschwert. Ein Beispiel<br />
hierfür ist die polnischen Debatte um das<br />
Buch Nachbarn. Der Mord an den Juden<br />
von Jedwabne (2001) von Jan Tomasz Gross,<br />
das nicht nur viele Fragen hinsichtlich des<br />
bisherigen polnischen Selbstverständnisses<br />
aufgeworfen hat, sondern auch dazu herausfordert,<br />
die unterschwellige und schwierige<br />
Frage nach einem europäischen Schuldkomplex<br />
im Kontext des Holocaust zu stellen.<br />
Während in Polen die Erinnerung an<br />
Verbrechen am polnischen Volk im Vordergrund<br />
stand und z.T. eine Interpretationsgrundlage<br />
für die gesamt polnische<br />
Geschichte bot, stand in beiden deutschen<br />
Staaten der verübte Genozid an den Juden<br />
im Zentrum der Auseinandersetzung mit<br />
der Vergangenheit. Die deutsch-deutsche<br />
Erinnerungsarbeit ließ dabei unterschiedliche<br />
Umgangsweise mit diesem Thema erkennen.<br />
Die ersten Nachkriegsjahre waren<br />
von Tendenzen des Verdrängens einerseits<br />
und des Verschiebens andererseits gekennzeichnet:<br />
Während der „erste deutsche Arbeiter-<br />
und Bauernstaat“ sich mittels eines<br />
internationalistischen Klassenstandpunktes<br />
von der NS-Vergangenheit abschirmte und<br />
sie <strong>als</strong> Legitimationsstrategie für die SED-<br />
Diktatur nutzte, zeichnete sich der Westen<br />
immer wieder durch Verdrängung aus. Die<br />
ideologische Distanzierung führte im Osten<br />
zu einer früher einsetzenden Kritik und<br />
Abrechnung mit dem Nation<strong>als</strong>ozialismus,<br />
die jedoch im Zeichen der sozialistischen<br />
Gemeinschaft stand. Auf dieser Grundlage<br />
entwickelten sich unterschiedliche Kulturen<br />
des Erinnerns, die um nationale Geschichte<br />
und Identität rangen. Nach 1989 hingegen<br />
galt es, sich der Herausforderung einer<br />
gesamtdeutschen Geschichte zu stellen. Die<br />
Schwierigkeit bestand nun darin,, auch die<br />
Geschichte und Konsequenzen der SED-<br />
Diktatur aufzuarbeiten. „Deutschland ist<br />
das einzige Land Westeuropas, das die Erfahrungen<br />
beider Totalitarismen gehabt hat,<br />
genau wie die mittel- und osteuropäischen<br />
Länder der heutigen Erweiterung. Darum<br />
kann kein Land Europas besser <strong>als</strong> Deutschland<br />
diese komplexe, widersprüchliche, reiche<br />
und tragische Erfahrung sich verständlich<br />
machen, um davon zu lernen, nicht nur<br />
auf der Ebene des akademischen Wissens,<br />
auch auf der Ebene der Praxis und der Zukunftsplanung“,<br />
äußerte sich der Buchenwald-Überlebende<br />
Jorge Semprun in seiner<br />
Rede zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz<br />
am 27. Januar 2003 im Deutschen<br />
Bundestag. Im Zuge dieser „doppelten Vergangenheitsbewältigung“<br />
haben sich in<br />
Deutschland tatsächlich verschiedene Strategien<br />
entwickelt, um sich der Aufarbeitung<br />
der zwei Totalitarismen zu stellen. Ein gemeinsamer,<br />
deutsch-polnischer Austausch<br />
über die Erfahrungen im Prozess der Herausbildung<br />
einer „post-totalitären“ Kultur<br />
des Erinnerns könnte in der Tat auch die<br />
Grundlage für eine gemeinsame deutschpolnische<br />
“Zukunftsplanung” sein.<br />
71
Erinnerungskulturen Europas in Zeiten<br />
der Postmemory<br />
So verschieden die Ausgangsbedingungen<br />
bei der Herausbildung der jeweiligen Erinnerungskulturen<br />
in Spanien, Polen und<br />
Deutschland gewesen sein mögen, sie stehen<br />
sich zumindest in einem Punkt im Moment<br />
sehr nahe, der die Zukunft der Kulturen<br />
des Erinnerns betrifft: Was geschieht,<br />
wenn wir uns nicht mehr erinnern können,<br />
weil uns (selbst erfahrene) Erinnerungen<br />
fehlen? Besteht dann die Gefahr, dass sich<br />
die traumatischen Ereignisse des letzten<br />
Jahrhunderts wiederholen?<br />
Marianne Hirsch hat sich in ihre Studie<br />
mit dem after image der Shoa in Beziehung<br />
zu den Kindern von Holocaust-Überlebenden<br />
beschäftigt. Sie führt darin das Konzept<br />
der Postmemory ein. Diese unterscheidet<br />
sich vom Gedächtnis durch die generationale<br />
Distanz und von der Geschichte durch<br />
das Fehlen tiefer persönlicher Bindung an<br />
die Ereignisse. Die Verbindung zum Gegenstand<br />
ist demnach (im weitesten Sinne<br />
narrativ) vermittelt. Hirsch distanziert sich<br />
jedoch von einem Verständnis der Postmemory<br />
<strong>als</strong> „leer“ oder „abwesend“. Vielmehr<br />
sei sie „besessen“ und „unnachgiebig“ und<br />
„as full or as empty, certainly as constructed,<br />
as memory itself“ (Hirsch, 1997: 22). Diese<br />
Gedanken führen mich zurück zu den mich<br />
eingangs bewegenden Fragen. Lassen sich<br />
die Ausführungen Hirschs ausweiten? Sind<br />
wir nicht allgemein mit einem “Nach-Gedächtnis”<br />
konfrontiert? Oder wie es Young<br />
formuliert, mit einer “recieved history”, einer<br />
durch Foto, Filme, etc. vermittelten Erfahrung<br />
(nicht nur) des Holocaust?<br />
Die entscheidende Frage ist meines Erachtens<br />
nicht, ob wir erinnern wollen, sondern<br />
vielmehr: Wie können wir in Zukunft<br />
erinnern und Vergangenes wieder holen,<br />
damit es sich nicht in ähnlicher Weise wiederholt?<br />
Welche Strategien können wir auf<br />
der Grundlage des fehlenden, nicht wiederholbaren<br />
Wissens entwickeln, um dies zu<br />
leisten? Die europäischen Erinnerungskulturen<br />
sind vielfältig und vielstimmig, auch<br />
wenn dies nicht (mehr) immer sichtbar bzw.<br />
hörbar ist. Gegenwärtige Generationen<br />
sollten diesen Umstand trotz des fehlenden<br />
Wissens berücksichtigen und Wege finden,<br />
auch das Abwesende - z.B. mittels Kunst<br />
oder Literatur – hervorzubringen oder zu<br />
(re-)konstruieren und in einem offenen Dialog<br />
zu diskutieren, in dem die Angst vor<br />
den eigenen Schatten nicht mehr größer ist,<br />
<strong>als</strong> das Bestreben, der europäischen Vergangenheit<br />
unvoreingenommen zu begegnen.<br />
Literatur<br />
Aleida Assmann/Ute Frevert: Geschichtsvergessenheit<br />
- Geschichtsversessenheit.<br />
Vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten<br />
nach 1945.Stuttgart 1999.<br />
Bernecker, Walther L./Brinkmann, Sören:<br />
Kampf der Erinnerungen. Der Spanische<br />
Bürgerkrieg in Politik und Gesellschaft<br />
1936-2006.Nettersheim 2006.<br />
Gross, Jan Tomasz: Nachbarn. Der Mord<br />
an den Juden von Jedwabne. München<br />
2001.<br />
Hirsch, Marianne: Family Frames: Photography,<br />
Narrative and Postmemory. Cambridge<br />
1997.<br />
Maron, Monika: Pawels Briefe. Frankfurt<br />
am Main 1999.<br />
Maxwell, Kenneth: Spain’s Transition to<br />
Democracy: A Model for Eastern Europe?,<br />
in: Proceedings of the Academy of Political<br />
Science, Vol. 38, No. 1, The New Europe:<br />
Revolution in East-West Relations. (1991),<br />
S. 35-49.<br />
Resina, Joan Ramon: Disremembering the<br />
Dictatorship: The Politics of Memory in the<br />
Spanish Transition to Democracy. Amsterdam<br />
2000.<br />
Semprún, Jorge: Blick auf Deutschland.<br />
Frankfurt am Main 2003.<br />
Young, James E.: At memory’s Edge: After-<br />
Images of the Holocaust in Contemporary<br />
Art and Architecture. New Haven 2000.<br />
72
Wypędzeni ze Wschodu.<br />
Niemcy i Polacy pamiętają inaczej.<br />
Vertrieben aus dem Osten.<br />
Deutsche und Polen erinnern (sich) anders.<br />
von Agnieszka Gryz-Männig<br />
Problem wypędzenia Niemców z<br />
byłych niemieckich terenów wschodnich<br />
postrzegany jest w Polsce i w<br />
Niemczech z innej perspektywy.<br />
Wyuczone modele pamięci narodowej<br />
próbując zapewnić sobie należytą<br />
pozycję krępują stosunki polsko-niemieckie.<br />
W Polsce ciągle oczekujemy<br />
padania na kolana, a Niemcy już tego<br />
nie chcą. W Niemczech podejmowana<br />
jest dyskusja o wypędzonych jako o ofiarach,<br />
a Polacy rolę ofiary już dawno<br />
przyznali sobie. Czy te różne ujęcia<br />
mają szansę się zbliżyć przy wspólnej<br />
kawie?<br />
Die Wahrnehmung der Vertreibung<br />
der Deutschen aus den ehemaligen<br />
Ostgebieten ist in Deutschland anders<br />
<strong>als</strong> in Polen. Die gewohnten Erinnerungsmuster<br />
belasten die deutschpolnischen<br />
Beziehungen, da jede Seite<br />
versucht, ihre Positionen durchzusetzen.<br />
In Polen erwartet man oft immer<br />
noch Kniefälle und die Deutschen wollen<br />
das nicht mehr. In Deutschland<br />
will man über die Vertriebenen <strong>als</strong><br />
Opfer diskutieren und für die Polen ist<br />
die Opferrolle längst vergeben. Gibt es<br />
einen Ort, an welchem sich die beiden<br />
Wahrnehmungen annähern können?<br />
Na spokojnej bocznej uliczce w centrum<br />
Gdańska-Wrzeszcza stoi domek szeregowy z<br />
małym ogrodem z tyłu. W tym domu na poddaszu<br />
pewna niemiecka rodzina żyła swoją<br />
codziennością. Nagle musieli opuścić swoje<br />
mieszkanie biorąc tylko to, co najpotrzebniejsze.<br />
Pełne wyposażenie kuchni, biały<br />
kredens, stół z czterema krzesłami i porcelanowy<br />
dzbanek do kawy nie zmieściły się<br />
do walizek.<br />
Kiedy polska babcia szukała w Gdańsku<br />
nowego mieszkania po wojnie, natrafiła<br />
na puste piękne mieszkanie na poddaszu<br />
w domku szeregowym na spokojnej bocznej<br />
uliczce w centrum Gdańska-Wrzeszcza.<br />
Z balkonem i ogrodem za domem. W<br />
pełni wyposażone mieszkanie zachęcało,<br />
In einer ruhigen Seitenstrasse im Zentrum<br />
von Danzig-Langfuhr steht ein Reihenhaus<br />
mit kleinem Garten dahinter. Im<br />
Dachgeschoss hatte eine deutsche Familie<br />
ihren Alltag gelebt. Dann musste sie das<br />
Haus verlassen und durfte auf die Schnelle<br />
nur das Notwendigste mitnehmen. Die<br />
ganze Kücheneinrichtung, ein weißer Küchenschrank,<br />
ein Tisch mit vier Stühlen<br />
und eine Porzellankaffeekanne, passten<br />
nicht mehr rein in die Koffer.<br />
Als eine polnische Großmutter in<br />
Gdańsk-Wrzeszcz nach dem Krieg eine<br />
neue Wohnung suchte, fand sie eine wunderschöne<br />
Dachgeschosswohnung in einer<br />
ruhiger Seitenstraße im Zentrum von<br />
Gdańsk-Wrzeszcz in einem Reihenhaus leer<br />
73
y szybko się przeprowadzić. Do tego jasna<br />
kuchnia z białym kredensem, stołem i<br />
czterema krzesłami. W kredensie dzbanek<br />
do kawy i wbudowany młynek. Wokół tego<br />
stołu stworzyła swoim polskim dzieciom<br />
namiastkę raju w całkowicie zniszczonym<br />
Gdańsku. Dla dzieci ten dom z ogrodem,<br />
chleb ze śmietaną i cukrem to synonim<br />
domu rodzinnego i najważniejsze wspomnienie<br />
powojennego Gdańska.<br />
Potem w innym polskim domu daleko<br />
od Gdańska, w innej szafce kuchennej na<br />
najwyższej półce starannie przechowywany<br />
jest ten sam dzbanek do kawy. Używa się<br />
go rzadko, za to popołudniowa kawa urasta<br />
wtedy do rangi wydarzenia szczególnego.<br />
Stara pamiątka z Gdańska ożywa. Z dzbanka<br />
wydobywa się para i zapach niedzielnego<br />
popołudnia. Rodzina siedzi razem przy<br />
innym stole z sześcioma krzesłami i każdy<br />
zatapia się w myślach w swojej filiżance. Dla<br />
babci kawa ma słodki smak młodej rodziny<br />
z trójką dzieci ale i gorzki posmak zmagań z<br />
powojenną codziennością. Dla mamy kawa<br />
to tylko niebiańska słodycz gdańskiego raju<br />
na spokojnej bocznej uliczce. Dziecko fascynuje<br />
całe to wydarzenie, dzbanek do kawy,<br />
który estetyką znacznie przewyższa wszystkie<br />
inne elementy wyposażenia kuchni<br />
dostępne w socjalistycznych sklepach AGD<br />
a i kawa smakuje lepiej niż pita tradycyjnie<br />
kawa po polsku nazywana kawą po turecku.<br />
Po latach dzbanek do kawy stoi w polsko-niemieckim<br />
domu w witrynie w pokoju<br />
dziennym i wypełnia go własną historią,<br />
gdańskim morskim powietrzem, historiami<br />
rodzin, w których uczestniczył przez te<br />
wszystkie lata. Historie znane i nieznane<br />
znowu ożywają. Ożywają też osoby te znane<br />
i te nieznane.<br />
Jakie były te historie nieznane i te osoby<br />
nieznane? Jak wyglądało życie w tej<br />
szeregówce w spokojnej bocznej uliczce w<br />
Gdańsku-Wrzeszczu przed wojną i przed<br />
późniejszymi decyzjami o przesunięciach<br />
granic? Czy ten dzbanek do kawy to część<br />
polskiej czy niemieckiej historii? Czy opowiada<br />
on tę historie po polsku czy po niemiecku?<br />
Jak pamiętają tamci nieznani? Wystarczy<br />
się wsłuchać i przy stole spotykają<br />
się wszystkie znane osoby. Te, których dziś<br />
już nie ma i te, z którymi nadal możemy<br />
vor. Mit Balkon und kleinem Garten hinter<br />
dem Haus. Die voll eingerichtete Wohnung<br />
lud ein, schnell einzuziehen. Und dazu eine<br />
helle Küche mit weißem Küchenschrank,<br />
einem Tisch mit vier Stühlen. In dem Küchenschrank<br />
eine Kaffeekanne und eingebaute<br />
Kaffeemühle. Um den Küchentisch<br />
hat sie ihren polnischen Kindern im völlig<br />
zerstörtem Gdańsk ein Stück Paradies geschaffen.<br />
Für die Kinder ist das Haus mit<br />
dem Garten, Brot mit Sahne und Zucker<br />
der Inbegriff des Elternhauses und die wichtigste<br />
Erinnerung an Nachkriegs-Gdańsk.<br />
Später wird die Kaffeekanne in einem<br />
anderen polnischen Elternhaus weit entfernt<br />
von Gdańsk ebenfalls in einem Küchenschrank<br />
ganz oben sorgfältig aufbewahrt.<br />
Nur selten wird sie benutzt, dann aber wird<br />
das Kaffeetrinken zum besonderen Ereignis<br />
und das alte Erinnerungsstück aus der<br />
Wohnung in Gdańsk wird wieder lebendig.<br />
Aus der Kanne steigen heiße Dampfschwaden<br />
auf, der Duft eines Sonntagnachmittages.<br />
Die Familie sitzt gemeinsam an einem<br />
Tisch mit sechs Stühlen und jeder rührt in<br />
Gedanken versunken in seiner Kaffeetasse.<br />
Für die Großmutter schmeckt der Kaffee<br />
süß nach junger Familie mit drei Kindern<br />
und bitter nach Strapazen des Nachkriegslebens.<br />
Für die Mutter schmeckt der Kaffee<br />
nur himmlisch gut nach dem Gdańsker Paradies<br />
in der ruhigen Seitenstraße. Für das<br />
Kind ist das ganze Ereignis sehr aufregend,<br />
die Kaffeekanne ist viel schöner <strong>als</strong> andere<br />
Küchengegenstände, die die sozialistischen<br />
Wohnungseinrichtungshäuser zu bieten<br />
hatten und der Kaffee schmeckt viel besser<br />
<strong>als</strong> der übliche polnische Kaffee auf die so<br />
genannte türkische Art.<br />
Wiederum Jahre später steht die Kaffeekanne<br />
in einem deutsch-polnischen Haushalt<br />
in der Vitrine im Wohnzimmer und<br />
fühlt den Raum mit eigener Geschichte, mit<br />
der Gdańsker Meeresluft, mit den Gedanken<br />
an die Leute, die aus ihr schon ihren<br />
Kaffee getrunken haben. Sie macht die bekannten<br />
und die unbekannten Geschichten<br />
wieder lebendig. Sie macht die bekannten<br />
und die unbekannten Personen wieder lebendig.<br />
Wie lauteten die unbekannten Geschichten<br />
und wie waren die unbekannten<br />
Personen? Wie war das Familienleben in<br />
74
napić się kawy. I przychodzą też osoby nieznane,<br />
które kiedyś dawno gromadziły się<br />
wokół tego dzbanka. Te nieznane osoby są<br />
tak samo częścią popołudniowej kawy jak<br />
osoby znane. Nie ma historii polskiej rodziny<br />
z Gdańska w szeregówce z ogrodem<br />
bez wcześniejszej niemieckiej historii w tym<br />
samym domu. Nie ma porcelanowego dzbanka<br />
do kawy znajdującego się w posiadaniu<br />
polskiej rodziny bez dzbanka do kawy<br />
będącego wcześniej w posiadaniu rodziny<br />
niemieckiej. Nie ma dzisiejszego Gdańska<br />
bez niemieckiego Danzig.<br />
Tak jak w tym opowiadaniu zacierają się<br />
granice między dzieciństwem a dorosłością,<br />
między życiem w domu rodzinnym a tworzeniem<br />
domu rodzinnego, tak też zacierają się<br />
granice między niemiecką a polską częścią<br />
historii tego dzbanka do kawy. Historie te<br />
wynikają jedna z drugiej i przechodzą jedna<br />
w drugą. I każda ze stron ma prawo do swojej<br />
części historii i swojej części wspomnień,<br />
jeśli historia i wspomnienia drugiej strony<br />
nie ulegną zapomnieniu lecz zostaną<br />
przyjęte z należytą uwagą i pokorą.<br />
Niezależnie od tragicznych politycznych<br />
i społecznych skutków narodowego socjalizmu<br />
Niemcy zachowują prawo do wspomnień<br />
domu rodzinnego i stołu w kuchni kiedyś w<br />
Danzig, a dziś w Gdańsku. My Polacy nie<br />
możemy odmawiać Niemcom tego prawa,<br />
nie możemy żądać od nich aby przez całe<br />
życie przeszli w głębokim poczuciu winy i<br />
winę tę przekazywali następnym pokoleniom.<br />
Czasy rozliczeń i jasnych rozgraniczeń<br />
między przyjacielem a wrogiem w stosunkach<br />
polsko-niemieckich niech<br />
pozostaną przeszłością. Niemcy, którzy zostali<br />
wypędzeni ze Wschodu mają prawo<br />
nazywać się „wypędzonymi”. Fakt, że miało<br />
miejsce wypędzenie Niemców z byłych niemieckich<br />
terenów wschodnich i pokazywanie<br />
tego faktu jeszcze nie oznacza relatywizacji<br />
i stawiania pod znakiem zapytania<br />
innej prawdy i przyczyn wypędzeń. My Polacy<br />
chcemy nauczyć się szanować niemieckie<br />
cierpienie w czasie wojny i po wojnie.<br />
Dobrą do tego okazją mogłyby być dwie pokazywane<br />
właśnie w Berlinie wystawy – z<br />
jednej strony wystawa Niemieckiego Muzeum<br />
Historycznego „Ucieczka, wypędzenie,<br />
dem Reihenhaus in der ruhigen Seitenstraße<br />
in Danzig-Langfuhr vor dem Krieg und<br />
vor den Nachkriegsentscheidungen über<br />
Grenzverschiebungen? Ist die Kaffeekanne<br />
ein Stück der deutschen oder der polnischen<br />
Geschichte? Erzählt sie die Geschichten auf<br />
deutsch oder auf polnisch? Wie erinnern sich<br />
die Unbekannten? Man hört zu und sieht<br />
am Tisch um sich herum alle bekannten<br />
Personen versammelt. Alle, die schon gegangen<br />
sind und die, mit welchen man den<br />
Kaffee heute noch genießen kann. Und man<br />
sieht auch die unbekannten Personen, die<br />
sich dam<strong>als</strong> um die Kaffeekanne versammelt<br />
hatten. Die Unbekannten gehören zu<br />
der heutigen Kaffeestunde genauso dazu wie<br />
die Bekannten. Es gibt nicht die Geschichte<br />
der polnischen Familie aus Gdańsk in dem<br />
Reihenhaus mit Garten ohne die deutsche<br />
Vorgeschichte in dem gleichen Haus. Es<br />
gibt keine Porzellankaffeekanne im Besitz<br />
der polnischen Familie ohne die Porzellankaffeekanne<br />
im Besitz einer deutschen Familie.<br />
Es gibt kein heutiges Gdańsk ohne<br />
die deutsche Vorgeschichte von Danzig.<br />
Wie sich in dieser Geschichte die Grenzen<br />
zwischen Kindheit und Erwachsensein,<br />
zwischen Elternhaus haben und Elternhaus<br />
neu schaffen verwischen, so verwischen sich<br />
auch die Grenzen zwischen dem deutschen<br />
und dem polnischen Teil der Geschichte der<br />
Kaffeekanne. Die Geschichten bauen aufeinander<br />
auf und gehen ineinander über. Und<br />
jeder hat das Recht auf seinen Teil der Geschichte<br />
und seinen Teil der Erinnerung.<br />
Wichtig ist, dass dabei die Geschichte und<br />
die Erinnerung des Anderen nicht vergessen,<br />
sondern mit Achtung und Respekt entgegen<br />
genommen wird.<br />
Den Deutschen steht unabhängig von<br />
den tragischen politischen und gesellschaftlichen<br />
Folgen des Nation<strong>als</strong>ozialismus das<br />
Recht auf Erinnerungen an ein Familienhaus<br />
mit ihrem Küchentisch dam<strong>als</strong> in Danzig,<br />
heute in Gdańsk, zu. Jemandem dieses<br />
Recht abzuerkennen, von jemanden zu fordern,<br />
das ganze Leben lang mit Schuldgefühlen<br />
zu leben und diese Schuldgefühle<br />
auch noch an die folgenden Generationen<br />
weiter zu geben, darf von uns Polen nicht<br />
mehr verlangt werden.<br />
75
integracja” i z drugiej strony wystawa „Wymuszone<br />
drogi – Ucieczka i wypędzenia w<br />
Europie XX wieku”, które mogłyby wyzwolić<br />
poważną polityczną dyskusję o pamięci narodowej.<br />
Jednak zamiast wsparcia dla wymiany<br />
poglądów wśród historyków i dziennikarzy,<br />
polska polityka ma do zaoferowania<br />
przedwczesne nadreakcje, niemalże histeryczne<br />
zachowania i niezrozumiałe wycofanie<br />
polskich eksponatów z wystawy „Wymuszone<br />
drogi”.<br />
Bezsprzeczna jest niemiecka wina. I<br />
wina ta przez nikogo, abstrahując od pojedynczych<br />
i nieistotnych żądań, nie jest dziś<br />
podważana i nie podlega relatywizacji. Ale<br />
besprzeczne jest i niemieckie cierpienie. Nawet<br />
jeśli cierpienie było zawinione, było to<br />
cierpienie, a fakt zawinienia nie unicestwia<br />
prawa Niemców do nazwania cierpienia<br />
cierpieniem. Uznanie tego cierpienia<br />
jest niezbędne dla zbudowania nowej polskiej<br />
tożsamości, która nie definiuje się już<br />
tylko przez własne cierpienie. Uznanie to<br />
może nas uwolnić z wprawdzie wygodnej,<br />
ale równocześnie uniemożliwiającej konstruktywny<br />
dialog, roli ofiary i tym samym<br />
odmitologizować nasze spojrzenie na własną<br />
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W<br />
dialogu i z poszanowaniem drugiej strony i<br />
bez destrukcyjnych potyczek o dopuszczalne<br />
proporcje niemieckiej winy i niemieckiego<br />
cierpienia. Opieranie się na matematyce<br />
w każdym historycznym przedsięwzięciu<br />
i walki z jednej strony o jedno zdjęcie<br />
wypędzonych więcej, a z drugiej o jedno<br />
zdjęcie ofiar wojny mniej, i odwrotnie, pozwoli<br />
wprawdzie na kultywowanie własnej<br />
pamięci narodowej, ale nie na zbudowanie<br />
wyzwolonej z historycznych zaszłości<br />
tożsamości narodowej. Matematyka doprowadzi<br />
tu do zbudowania tożsamości skoncetrowanej<br />
na sporach i rozliczeniach i<br />
wybierającej, jak ma to miejsce w ostatnich<br />
miesiącach, niestety coraz głośniejszą<br />
agresywną retorykę.<br />
Bez zbytnich emocji, z dala od własnych<br />
modeli pamięci narodowej i głęboko zakorzenionych<br />
obaw z jednej strony i opierając<br />
się na faktach z drugiej, można zbudować<br />
przez zbliżenie i we wzajemnym zaufaniu<br />
nową polską i nową niemiecką tożsamość.<br />
Tożsamość, która wprawdzie zna i uznaje<br />
historię, dokonuje jej analizy i wyciąga wnioski,<br />
ale w pierwszym rzędzie patrzy przed<br />
Die Zeiten der Aufrechnung und der<br />
klaren, über die Nationalität definierten<br />
Abgrenzung zwischen Feind und Freund<br />
in internationalen Beziehungen sollten der<br />
Vergangenheit angehören. Die Deutschen,<br />
die aus dem Osten vertrieben wurden, dürfen<br />
sich „Vertriebene“ nennen. Die Wahrheit,<br />
dass es Vertreibungen von Deutschen<br />
aus dem ehemaligen deutschen Ostgebieten<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg gab und das<br />
offene Aussprechen dieser Wahrheit bedeuten<br />
noch keine Relativierung und Infragestellung<br />
der Ursache der Vertreibungen. Wir<br />
Polen wollen es lernen, auch das deutsche<br />
Kriegs- und Nachkriegsleid anzuerkennen.<br />
So könnte man die zur Zeit in Berlin gezeigten<br />
Ausstellungen – einerseits die Ausstellung<br />
des Deutschen Historischen Museums<br />
„Flucht, Vertreibung, Integration“ und<br />
andererseits die Ausstellung „Erzwungene<br />
Wege – Flucht und Vertreibung im Europa<br />
des 20. Jahrhunderts“ – zum Anlass nehmen,<br />
einen ernsthaften politischen Diskurs<br />
über die Erinnerungskultur zu führen. Anstatt<br />
den Meinungsaustausch von Historikern<br />
und Journalisten zu unterstützen und<br />
sich Zeit für eine eigene Meinungsbildung<br />
zu nehmen, wird seitens der polnischen Politik<br />
schon im Vorfeld übereilt mit beinahe<br />
hysterischen Verhaltensweisen und dem<br />
unverständlichen Rückzug polnischer Exponate<br />
aus der Ausstellung „Erzwungene<br />
Wege“ überreagiert.<br />
Es gibt eine deutsche Schuld. Und die<br />
Schuld wird abgesehen von vereinzelten<br />
und unwesentlichen Stimmen einer Minderheit<br />
von der überwiegenden Mehrheit<br />
der Deutschen nicht grundsätzlich in Frage<br />
gestellt. Es gab aber auch deutsches Leid.<br />
Auch wenn das Leid indirekt selbst verschuldet<br />
war, bleibt es Leid. Das Recht der<br />
Deutschen, ihr Leid beim Namen zu nennen,<br />
bleibt trotz der Schuld unberührt. Die<br />
Anerkenntnis dieses Leides ist für uns Polen<br />
wichtig für die Entwicklung einer eigenen<br />
modernen Identität, die nicht mehr nur<br />
durch unser eigenes Leiden definiert wird.<br />
Sie kann uns aus der gleichzeitig bequemen<br />
und lähmenden Opferrolle befreien und somit<br />
einen klaren, entmystifizierten Blick auf<br />
unsere eigene Vergangenheit, Gegenwart<br />
und Zukunft ermöglichen. Im Dialog und<br />
mit Achtung gegenüber dem Anderen - ohne<br />
zerstörerische Auseinandersetzungen über<br />
noch zulässige Quoten deutscher Schuld<br />
76
siebie. Tożsamość, która sprawi, że polska<br />
i niemiecka pamięć narodowa staną się<br />
wspólną pamięcią historyczną.<br />
und deutschen Leides. Mit der Mathematik<br />
bei jeder geschichtsbezogenen Initiative und<br />
den Kämpfen einerseits um ein Vertriebenenfoto<br />
mehr und andererseits ein Kriegsfoto<br />
weniger, und umgekehrt, kann man zwar<br />
die eigene Erinnerungskultur weiter pflegen,<br />
aber keine selbstbewusste nationale Identität<br />
aufbauen. Es entsteht nur eine Schein-Identität,<br />
die auf Kampf und Aufrechnung konzentriert<br />
ist und die sich mittels ihrer in den<br />
letzten Monaten immer lauter werdenden<br />
aggressiven Rhetorik artikuliert.<br />
Losgelöst von störenden Emotionen und<br />
Gefühlen und befreit von eigenen Erinnerungsmustern<br />
und tief verwurzelten Ängsten<br />
einerseits und basierend auf den Tatsachen<br />
andererseits kann eine moderne<br />
polnische und eine moderne deutsche Identität<br />
im gegenseitigen Vertrauen durch Annäherung<br />
aufgebaut werden. Eine Identität,<br />
die zwar die Geschichte kennt, sie verarbeitet<br />
und aus ihr lernt, aber eben auch nach<br />
vorne schaut. Eine Identität, die es möglich<br />
macht, sich nicht mehr anders und nebeneinander<br />
sondern miteinander zu erinnern.<br />
Tylko wtedy polsko-niemiecka kawa może<br />
dobrze smakować.<br />
Nur so kann das deutsch-polnische Kaffeetrinken<br />
gut schmecken.<br />
77
Bibliografia/Literatur:<br />
NawojkaCieślińska-Lobkowicz,<br />
Nawarzyliśmy piwa. Wystawa Eriki Steinbach<br />
o wypędzeniach – ciąg d<strong>als</strong>zy, w: Tygodnik<br />
Powszechny z dn. 14. 08. 2006.<br />
Jürgen Danyel, Deutscher Opferdiskurs<br />
und europäische Erinnerung. Die Debatte<br />
um das „Zentrum gegen Vertreibungen“, w:<br />
Zeitgeschichte-online, Thema: Die Erinnerung<br />
an Flucht und Vertreibung, wyd. Jürgen<br />
Danyel, Januar 2004, URL: http://www.<br />
zeitgeschichte-online.de/md=Debatte-Vertreibung-Danyel.<br />
Hartmut Koschyk, Der neue Stellenwert von<br />
Flucht und Vertreibung in der Erinnerungskultur<br />
w: Die Vertreibung der Deutschen<br />
aus dem Osten in der Erinnerungskultur.<br />
Kolloquium der Konrad-Adenauer-Stiftung<br />
und des Instituts für Zeitgeschichte am 25.<br />
November 2004 in Berlin, Sankt Augustin<br />
2005, s. 139-143.<br />
Claudia Kraft, Die aktuelle Diskussion über<br />
Flucht und Vertreibung in der polnischen<br />
Historiographie und Öffentlichkeit, w:<br />
Zeitgeschichte-online, Thema: Die Erinnerung<br />
an Flucht und Vertreibung, Januar<br />
2004, URL: http://www.zeitgeschichte-online.de/md=Vertreibung-Kraft.<br />
Karl Schlögel, Die Europäisierung des „Vertreibungskomplexes“<br />
w: Die Vertreibung<br />
der Deutschen aus dem Osten in der Erinnerungskultur.<br />
Kolloquium der Konrad-<br />
Adenauer-Stiftung und des Instituts für<br />
Zeitgeschichte am 25. November 2004 in<br />
Berlin, Sankt Augustin 2005, S. 123-138.<br />
Joachim Trenkner, Nerwowy dzień. Dzwon<br />
z „Gustloffa“ obok sztandaru polskich sybiraków,<br />
w: Tygodnik Powszechny z dn. 14.<br />
08. 2006<br />
Severin Weiland, Ausstellung „Erzwungene<br />
Wege“. Auf schmalem Grat, w: Der Spiegel<br />
z dn. 10. 08. 2006.<br />
78
Liegt die Mitte ostwärts? –<br />
Deutsche und Polen in Europa<br />
von Julia Bürger<br />
Dieses Essay beschäftigt sich mit den polnisch-deutschen Beziehungen vor dem<br />
Hintergrund eines Europa, das der gemeinsamen Gestaltung bedarf. Im Zentrum<br />
stehen der Versuch einer Zustandsbeschreibung dieser Beziehungen, wechselseitige<br />
Wahrnehmungsprozesse und die Frage der Identifikation mit Europa.<br />
Europa – das ist zunächst einmal die Bezeichnung<br />
eines nicht einmal echten Kontinents.<br />
All das, was Europa darüber hinaus<br />
ist bzw. sein kann oder soll, wird von den<br />
dort lebenden Menschen immer wieder neu<br />
geschaffen und gestaltet und ist somit davon<br />
abhängig, welche Bedeutung Europa<br />
<strong>als</strong> Kategorie zugedacht wird. Das „neue“<br />
Europa, das bereits seit über 15 Jahren nicht<br />
mehr in zwei politische Blöcke geteilt ist, ist<br />
dabei nach wie vor ein „Europe in the Making“.<br />
In diesem bauen Deutsche und Polen<br />
zusammen an ihrer Zukunft, entwickeln gemeinsame<br />
Ziele und sogar eine gemeinsame<br />
Identität! Oder verstricken sie sich in gegenseitigen<br />
Vorwürfen, versuchen in einer<br />
Art europäischem Nullsummenspiel ihre<br />
eigenen Interessen gegen die der anderen<br />
auszuspielen und vermeiden wechselseitige<br />
Kontakte, so weit dies möglich ist? In der<br />
Realität ist von Allem etwas vorhanden. Jeder<br />
Bericht, jede persönliche Einzelerfahrung<br />
und jedes Forschungsergebnis macht<br />
ein Puzzleteil des Gesamtbildes „Deutsche<br />
und Polen in Europa“ aus, von dem hier nur<br />
einige zu finden sein werden. Als Psychologin<br />
kümmere ich mich dabei nicht so sehr<br />
um politische Überlegungen, <strong>als</strong> vielmehr<br />
um Wahrnehmungsprozesse, deren Subjektivität<br />
und Kontextabhängigkeit ich an dieser<br />
Stelle betonen möchte. Alle Leserinnen<br />
und Leser sind daher dazu aufgefordert, sich<br />
ihr eigenes Bild zu machen, und ggf. selbst<br />
einen Teil zur Gestaltung einer gemeinsamen<br />
Zukunft beizutragen. Und beginnen<br />
kann ja jede(r) zunächst einmal mit der<br />
Überlegung, ob für sie oder ihn die Mitte,<br />
verstanden <strong>als</strong> Ort, an dem sich etwas bewegt,<br />
an dem Interesse oder Begeisterung<br />
für das Ganze wachsen, ostwärts liegt...<br />
Laut dem, was man gemeinhin <strong>als</strong> „öffentliche<br />
Meinung oder Wahrnehmung“ bezeichnet,<br />
nehmen sowohl Deutsche <strong>als</strong> auch<br />
Polen für sich in Anspruch, in der „Mitte“<br />
Europas zu liegen. Für die meisten Deutschen<br />
ist dies allerdings nichts, was der Erwähnung<br />
bedarf. Es wird einfach <strong>als</strong> Tatsache<br />
hingenommen, hat aber keine besonders<br />
identitätsstiftende Wirkung (vielleicht, weil<br />
dies auch weniger positive Assoziationen<br />
hervorrufen würde). Im polnischen Selbstverständnis<br />
ist die Überzeugung, ein wesentlicher<br />
und zentraler Bestandteil Europas<br />
zu sein und für Europa Wesentliches<br />
geleistet zu haben, fest verankert. Es wird<br />
dabei auf die im Laufe der polnischen Geschichte<br />
erbrachten Dienste für Europa,<br />
wie die Verteidigung der christlichen (katholischen)<br />
Wertewelt gegen äußere Feinde<br />
79
oder die Überwindung des real existierenden<br />
Sozialismus, verwiesen. Diese polnische<br />
Eigenwahrnehmung ist in Deutschland<br />
jedoch wenig bekannt. Hier wirkt in<br />
der öffentlichen Wahrnehmung noch immer<br />
die Trennlinie des kalten Krieges bzw.<br />
die Grenze der EU-15 nach und Polen wird<br />
häufig unter den Sammelbegriff „Osteuropa“<br />
gefasst, der alles umfassen kann, was<br />
zum früheren Ostblock gehörte. Und damit<br />
will in Polen eigentlich niemand identifiziert<br />
werden. Nur ganz allmählich setzt sich<br />
in Deutschland zumindest die Unterscheidung<br />
zwischen MOE (mittelosteuropäische)<br />
und osteuropäische Staaten durch.<br />
Das Bewusstsein ein integraler Bestandteil<br />
Europas zu sein, ließ die EU-Mitgliedschaft<br />
aus polnischer Sicht (und der anderer<br />
MOE-Staaten) <strong>als</strong> natürliches Anrecht<br />
erscheinen, wohingegen in westlichen Ländern<br />
sich dieselbe zwar <strong>als</strong> wichtige und<br />
richtige Entwicklung darstellte, man sich<br />
dabei aber doch ganz gern in der Rolle des<br />
„Helfers“ oder „Gönners“ wahrnahm. Diese<br />
Prozessdynamik konnte und kann nach<br />
wie vor auf der einen Seite das Gefühl des<br />
„Abgelehnt werdens“ auf der anderen Seite<br />
Gefühle des „Ausgenutzt werdens“ oder der<br />
„Undankbarkeit“ entstehen lassen.<br />
Verkompliziert wird eine solche Dynamik<br />
durch die vielen unterschiedlichen<br />
Bedeutungen, die „Europa“ haben kann.<br />
Beispielsweise stehen die EU <strong>als</strong> Institution<br />
und „Europa“ <strong>als</strong> Gedanke und Aufgabe<br />
in einem recht verschwommenen Beziehungsverhältnis,<br />
das durch die aktuellen<br />
Debatten um eine europäische Identität zusätzlich<br />
vermischt wird. Laut der Eurobarometer-Umfrage<br />
vom Frühjahr 2006 macht<br />
es bei polnischen Befragten einen großen<br />
Unterschied, ob man nach der Verbundenheit<br />
mit der EU (61 %) oder Europa (84 %)<br />
fragt. In den deutschen Daten werden leider<br />
nur Angaben über die Verbundenheit<br />
mit Europa (in Ostdeutschland 62 %, in<br />
Westdeutschland 69 %) gemacht, obwohl<br />
ebenfalls nach beidem gefragt wurde. Die<br />
Frage, ob in Deutschland EU und Europa<br />
stärker miteinander verbunden sind, was ja<br />
durchaus Sinn machen würde, muss <strong>als</strong>o<br />
offen bleiben. Auf alle Fälle hat die Kategorie<br />
„Europa“ auf beiden Seiten eine gewisse<br />
Bedeutung, in Polen sogar eine besonders<br />
große, und die Zustimmung zur EU liegt in<br />
beiden Ländern inzwischen bei 56 % bzw.<br />
57 %.<br />
Es stellt sich allerdings die Frage, ob<br />
oder besser unter welchen Bedingungen ein<br />
europäisches Bewusstsein auch zu einer Verbesserung<br />
der Beziehungen zwischen (nationalen)<br />
Gruppen und zu gemeinsamem<br />
Handeln in und für Europa führt.<br />
Aber schieben wir diese Frage zunächst<br />
beiseite und versuchen uns ein Bild der polnisch-deutschen<br />
Beziehungen zu machen<br />
– und zwar in dem Bewusstsein, dass jede<br />
auf lange Sicht angelegte Beziehung gegenseitiges<br />
Interesse, Verständnis, Sensibilität,<br />
manchmal auch Durchhaltevermögen erfordert<br />
und dass sie bei alledem auch Freude<br />
bereiten sollte.<br />
Blickt man auf Medienberichte, aber<br />
auch Teile der Forschungsliteratur, werden<br />
die polnisch-deutschen Beziehungen gerne<br />
mit Adjektive wie kompliziert, kritisch,<br />
konfliktreich, schwierig, belastet, besorgniserregend<br />
usw. belegt, wobei sich das sowohl<br />
auf die politischen Beziehungen <strong>als</strong><br />
auch auf die wechselseitige Wahrnehmung<br />
in der Öffentlichkeit bezieht. Als Gründe<br />
werden meist die konfliktreiche Geschichte,<br />
nationale Interessenskonflikte, sehr negative<br />
Einstellungen und Stereotype oder<br />
ein zu großes Desinteresse der Deutschen<br />
an Polen und den Polen genannt.<br />
So ist der Einfluss der Geschichte auf die<br />
aktuellen polnisch-deutschen Begegnungen<br />
nach wie vor enorm. Aus psychologischer<br />
Sicht liegt dies v.a. daran, dass die jeweils<br />
spezifische Repräsentation der Vergangenheit<br />
im kollektiven Gedächtnis beider Nationen,<br />
aber auch auf individueller Ebene,<br />
aufgrund ihrer Allgegenwart in Medien und<br />
Alltagsgesprächen und ihrer hohen emotionalen<br />
Aufladung leicht und schnell aktivierbar<br />
ist und so die Wahrnehmung und<br />
die Handlungen der beteiligten Personen<br />
in hohem Maße beeinflusst. Dies führt einerseits<br />
immer wieder zu sehr heftigen Reaktionen<br />
oder auch dazu, dass alle Beteiligten<br />
sehr vorsichtig werden. Beispielsweise<br />
sollte im Rahmen eines polnisch-deutschen<br />
80
Studienseminars, in dem es um interkulturelle<br />
Fragestellungen deutsch-polnischer<br />
Begegnungen ging, eine gemeinsame Stadtführung<br />
durch Wrocław (Breslau) stattfinden.<br />
Doch weder die polnischen noch die<br />
deutschen Seminarleiterinnen konnten die<br />
beiden Stadtführerinnen, zwei sehr nette<br />
ältere polnische Damen, in einer zweiwöchigen<br />
Vorlaufzeit dazu bewegen, diese<br />
Führung für die polnisch-deutsche Gruppe<br />
gemeinsam durchzuführen, so dass es im<br />
Endeffekt eine deutsche und eine polnische<br />
Tour gab. Bei der anschließenden Auswertung<br />
in der gemischten Gruppe zeigte sich,<br />
dass sich die beiden Stadtführungen gerade<br />
in den Punkten, die sich auf den zweiten<br />
Weltkrieg und die Vertreibung bezogen,<br />
doch wesentlich unterschieden. Bemerkenswert<br />
war dabei nicht, dass bei einer Stadtführung<br />
versucht wird, die Informationen<br />
auf die jeweilige Zielgruppe abzustimmen,<br />
sondern vielmehr, dass sich die Stadtführerinnen<br />
auch nach genauer Information<br />
über den Hintergrund des Seminars und<br />
der ausdrücklichen Bitte um eine gemeinsame<br />
Stadtführung, dazu einfach nicht in<br />
der Lage sahen.<br />
Doch auch zu den anderen oben aufgeführten<br />
Gründen für schwierige Beziehungen<br />
lassen sich Beispiele finden. So wissen<br />
in Deutschland die wenigsten, wie man<br />
Łodz eigentlich ausspricht, Akademischen<br />
Auslandsämter müssen oft nach Bewerbern<br />
für ein Auslandssemester in Polen suchen,<br />
wohingegen die Bewerber für „westliche“<br />
Länder Schlange stehen, Witze und Karikaturen<br />
gibt es auf beiden Seiten zur Genüge<br />
und in der Politik sorgt man sich auf der einen<br />
Seite wegen der Ostsee-Pipeline, auf der<br />
anderen wegen der Arbeitsmigranten usw.<br />
Bestehen die deutsch-polnischen Beziehungen<br />
<strong>als</strong>o hauptsächlich aus Durchhaltevermögen,<br />
und evtl. ein wenig Sensibilität,<br />
aber wenig aus echtem Interesse und<br />
Freude? Oder ist es nicht gerade die Beständigkeit<br />
und teilweise Einseitigkeit, mit<br />
der die deutsch-polnischen Beziehungen<br />
<strong>als</strong> schwierig dargestellt werden, die diesen<br />
Teil der Realität immer wieder aufs Neue<br />
produzieren und so einen Geschmack des<br />
Unumstößlichen und Unabänderbaren hinterlassen?<br />
Durch die Arbeit nichtstaatlicher<br />
Organisationen wie dem Deutsch-Polnischen<br />
Jugendwerk und anderen deutschpolnischen<br />
Instituten, Verbänden und<br />
Kulturvereinen, aber auch durch Städtepartnerschaften,<br />
Wirtschaftszusammenarbeit<br />
oder den Tourismus entstanden und<br />
entstehen doch neue Räume für polnischdeutsche<br />
Begegnungen, die die Basis für<br />
ein besseres Kennenlernen bilden. Daraus<br />
entwickelt sich natürlich nicht automatisch<br />
eine bessere Verständigung und eine fruchtbare<br />
Beziehung, doch hier finden die kleinen<br />
Schritte statt, die eine Beziehung lebendig<br />
machen. Die Reichhaltigkeit polnisch-deutscher<br />
Erfahrungen stärker in das öffentliche<br />
Bewusstsein zu bringen, wäre schon ein großer<br />
Schritt in Richtung „gemeinsames Bauen<br />
an Europa“. Und dass deutsch-polnische<br />
Verständigung Spaß machen kann, zeigt<br />
nicht zuletzt der deutsche Schauspieler Steffen<br />
Möller. Er wurde durch eine polnische<br />
TV-Vorabendserie bekannt und stieg innerhalb<br />
kürzester Zeit zum polnischen Medienstar<br />
auf. In seinen Bühnenprogrammen<br />
nimmt er humorvoll polnische und deutsche<br />
Klischees ins Visier und entkräftet so<br />
auf intelligente Weise festgefahrene Stereotype.<br />
Seine Wirkung auf alle Bevölkerungsschichten<br />
in Polen ist immens, so dass er<br />
2005 für seine Tätigkeit mit dem Bundesverdienstkreuz<br />
ausgezeichnet wurde.<br />
Neben den Analysen durch Experten,<br />
den Alltagserfahrungen und den Medienberichten<br />
stellen Meinungsumfragen ein<br />
weiteres Puzzleteil im Gesamtbild dar. Laut<br />
den Studien des Instytut Spraw Publicznych<br />
(Institut für öffentliche Angelegenheiten,<br />
ISP), deren Daten im Herbst letzten Jahres<br />
in Polen und im Frühjahr diesen Jahres in<br />
Deutschland erhoben wurden, halten 61 %<br />
der Deutschen die wechselseitigen Beziehungen<br />
für gut, 28 % für schlecht. In Polen<br />
glauben 78 %, dass sich die Beziehungen gut<br />
entwickeln und 14 % glauben, dass sie sich<br />
schlecht entwickeln (abweichende Frageformulierungen<br />
auf deutscher und polnischer<br />
Seite). Ist das nun positiv oder negativ? Man<br />
könnte dieselben Zahlen sowohl <strong>als</strong> einen<br />
Beleg für die Schwierigkeit der Beziehungen<br />
– z.B. weil die Beziehungen zu einigen anderen<br />
Ländern besser bewertet werden –<br />
oder <strong>als</strong> Gegenbeleg – da die überwiegende<br />
Mehrheit die Beziehungen für gut hält – he-<br />
81
anziehen. Bei aller Vorsicht bei der Interpretation<br />
von Umfrageergebnissen zeigen<br />
sie aber doch, dass es nicht nur „Kritisches“<br />
geben kann bzw. dass sich in den letzten<br />
Jahren bereits etwas bewegt hat. Auf die<br />
Frage, mit welchen Ländern Polen zusammenarbeiten<br />
sollte, wird Deutschland bei<br />
wirtschaftlichen Kooperationen an erster,<br />
bei politischen Kooperationen an zweiter<br />
Stelle (nach den USA) genannt. Die Zahl<br />
der Polen, die sagen, dass von Deutschland<br />
eine Bedrohung für Polen ausgeht ist von<br />
58 % (1992; 1990 lagen die Zahlen bei 88 %)<br />
auf 21 % (2005) gesunken (Cwiek-Karpowicz,<br />
2005).<br />
Bezogen auf die heutigen Kontakte sagen<br />
23 % der Deutschen, dass sie mit dem<br />
Land Polen überhaupt nicht in Berührung<br />
kommen, <strong>als</strong>o nicht einmal durch das Lesen<br />
von Presseartikeln o.ä. Für den Großteil<br />
der Deutschen stellen Zeitungen und Fernsehen<br />
die Hauptinformationsquelle zu Polen<br />
dar. Selbst in Polen gewesen sind bereits<br />
35 % der Deutschen (die Zahl der Polen, die<br />
in Deutschland waren, liegt genauso hoch),<br />
im Jahr 2000 waren es noch 31 %. Ein kleiner<br />
Anstieg zwar, der allerdings eine wichtige<br />
Wirkung haben könnte, denn diejenigen,<br />
die bereits einmal in Polen gewesen sind,<br />
äußern eine bessere Meinung über Polen <strong>als</strong><br />
diejenigen, die ihre Informationen aus den<br />
Medien beziehen (wobei hier die Interaktion<br />
mit dem Bildungsniveau nicht klar zu<br />
erkennen ist). Während fast jeder polnische<br />
Befragte Assoziationen zu Deutschland<br />
aufweist, sagten 18 % der Deutschen, dass<br />
sie zu Polen gar keine Assoziationen hätten.<br />
Auch sind die Bilder, die Deutsche mit Polen<br />
verbinden, weiter gestreut und nicht so<br />
fest umrissen, wie dies umgekehrt der Fall<br />
ist. Allerdings sind die Assoziationen der<br />
Deutschen häufiger negativ konnotiert <strong>als</strong><br />
die der Polen zu Deutschland. Gleichzeitig<br />
fanden bei einzelnen Stereotypen der Deutschen<br />
über Polen zwischen 2000 und 2006<br />
Veränderungen statt, so bei der Einschätzung<br />
„rückständig“ (von 44 % auf 32 % gefallen)<br />
und fleißig (von 30 % auf 38 % gestiegen)<br />
(Fałkowski & Popko, 2006).<br />
Alles in allem kann man sagen, dass sich<br />
in den letzten Jahren in den polnisch-deutschen<br />
Beziehungen schon Vieles verbessert<br />
hat, diese Beziehungen aber weiterhin auf<br />
allen Ebenen mit Bedacht gepflegt und weiter<br />
aufgebaut werden sollten, wenn die Ost-<br />
West-Teilung Europas im alltäglichen Handeln<br />
und in den Köpfen verschwinden soll.<br />
Kann hierbei nun die Idee Europa oder<br />
eine europäische Identität weiter helfen? Ja<br />
und nein, denn der Umgang mit sozialen<br />
Identitäten (im Sinne der Theorie der sozialen<br />
Identität) ist eine komplizierte Angelegenheit.<br />
Dazu nur ein Beispiel. Die<br />
Herausbildung einer übergeordneten Kategorie,<br />
hier die europäische, kann in konkreten<br />
Begegnungssituationen durchaus<br />
zur Verbesserung der Gruppenbeziehungen<br />
führen, da die nationalen Gruppengrenzen<br />
unter bestimmten Umständen aufgeweicht<br />
werden. Aber in Fällen, in denen die Sub-<br />
Kategorie sichtbar bestehen bleibt - was<br />
bei den nationalen Kategorien mit Sicherheit<br />
noch einige Zeit so sein wird - und<br />
die übergeordnete Kategorie uneindeutig<br />
ist, wie bei Europa, kommt es leicht dazu,<br />
dass die Inhalte der Sub-Gruppen-Identität<br />
von den Gruppenmitgliedern, die sich<br />
stark mit dieser Sub-Gruppe identifizieren,<br />
auf die höhere Kategorie projiziert werden.<br />
Kurz gesagt, prototypisch deutsche Werte<br />
und Verhaltensweisen werden dann auch<br />
<strong>als</strong> prototypisch für europäische Werte und<br />
Verhaltensweisen angesehen. Ist dann die<br />
Identifikation mit dieser Form von „Europa“<br />
hoch, werden diejenigen, die <strong>als</strong> Europäer<br />
von diesem positiv belegten Bild<br />
des Europäers abweichen, negativ wahrgenommen,<br />
weil sie den Gruppennormen<br />
nicht entsprechen (Mummendey & Waldzus,<br />
2004). In diesem Licht betrachtet würde<br />
die Verstärkung einer europäischen Identität<br />
nicht unbedingt zu einer Verbesserung<br />
der Beziehungen zwischen Polen und Deutschen<br />
führen.<br />
Bestimmte Werte <strong>als</strong> europäische Werte<br />
festlegen zu wollen, halte ich persönlich<br />
für problematisch, es sei denn, man sieht <strong>als</strong><br />
gemeinsamen Wert die Wertschätzung der<br />
Heterogenität an. Identitätsstiftend können<br />
auch eine stärkere Betonung der gegenseitigen<br />
Interdependenz und die Ausrichtung<br />
auf gemeinsame Ziele wirken. Letztlich<br />
müssen aber doch die Menschen, deutsche<br />
und polnische Bürger, sich selbst über Kom-<br />
82
munikation, soziales Handeln und über das<br />
Gerüst von Gemeinsamkeiten und Unterschieden<br />
zu einer gemeinsamen Zukunft bekennen.<br />
Dabei geht es um die Ausdifferenzierung<br />
des Wissens über den anderen, die<br />
Entdeckung der vielen Identitäten, die wir<br />
in wechselnder Zusammensetzung gemeinsam<br />
haben (z.B. Frauen oder Männer, Stadtoder<br />
Landbewohner, Bier-, Wein- oder Vodka-liebhaber<br />
usw.) und die Wertschätzung<br />
von Unterschiedlichkeiten.<br />
Überall da, wo solche Prozesse vor sich<br />
gehen, wo Menschen Erfahrungen sammeln<br />
und sich darüber freuen können, liegt die<br />
Mitte. Ob dies aus deutscher Sicht ostwärts<br />
und aus polnischer Sicht westwärts ist, liegt<br />
an jedem einzelnen von uns.<br />
Literatur zum Weiterlesen<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte: Deutschland<br />
und Polen, 2005, Nr. 5-6<br />
- Bender, Peter (2005). Normalisierung wäre<br />
schon viel. Essay, a.a.O. S. 3-9.<br />
- Bingen, Dieter (2005). Die deutsch-polnischen<br />
Beziehungen nach 1945. a.a.O. S.<br />
9-17.<br />
- Dylla, D. & Jäger, T. (2005). Deutsch-polnische<br />
Europavisionen. a.a.O. S.40-46.<br />
Cwiek-Karpowicz, J. (2005). Public opinion<br />
on fears and hopes related to Russia<br />
and Germany. Instytut Spraw Publicznych.<br />
http://www.isp.org.pl/?ln=eng<br />
Eurobarometer:<br />
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb65/eb65_en.htm<br />
Fałkowski, M. & Popko, A. (2006). Die<br />
Deutschen über Polen und die Polen 2000-<br />
2006: Die Schlussfolgerungen der Forschungsstudie.<br />
Instytut Spraw Publicznych.<br />
http://www.isp.org.pl/?ln=eng<br />
Galasińska, A. & Galasiński, D. (2005).<br />
Shopping for a New Identity: Constructions<br />
of the Polish–German border in a Polish<br />
border community Ethnicities. 5: 510-529<br />
Mummendey, A. & Waldzus, S. (2004). National<br />
Differences and European Plurality:<br />
Discrimination or Tolerance between European<br />
Countries. In R. K. Herrmann, T.<br />
Risse & M. B. Brewer (Eds.). Transnational<br />
Identities: Becoming European in the EU<br />
(p. 59-72). Lanham: Rowman & Littlefield.<br />
Schlögel, K. (2002). Die Mitte liegt ostwärts.<br />
Europa im Übergang. Bundeszentrale<br />
für politische Bildung. Schriftenreihe<br />
Band 379.<br />
83
Polnische Großstadt in Deutschland untergetaucht!<br />
Eine Spurensuche auf den Fährten<br />
einer „unsichtbaren“ Migrantengruppe.<br />
von Judith Wellen<br />
Von Berlin zur polnischen Grenze sind<br />
es kaum 80 Kilometer. Polnischsprachige<br />
Menschen gibt es zuhauf in der Stadt – und<br />
das nicht erst seit gestern. Ohne polnische<br />
Bauarbeiter keine Hauptstadt – das galt zu<br />
Kaisers Zeiten wie vor wenigen Jahren noch<br />
am Potsdamer Platz. Heute sind in Berlin<br />
ungefähr 30.000 Polen gemeldet. Die Zahl<br />
derer, die tatsächlich hier leben, liegt wesentlich<br />
höher. Doch betrachtet man etwa<br />
die Signale, durch die Minderheiten in Berlin<br />
generell auf sich aufmerksam machen<br />
– Wagen beim Karneval der Kulturen, Restaurants<br />
oder Messerstechereien in Schulen<br />
berüchtigter Kiezlagen –, sind sie nahezu<br />
unsichtbar. Den Polen wirft (heute) keiner<br />
(mehr) vor, dass sie Ghettos bilden oder unsere<br />
Gesellschaft durch gefährliche Fundamentalismen<br />
überfremden wollen . Beinahe<br />
das Gegenteil ist der Fall. „Polen sind im<br />
deutschen Bewußtsein eher marginal“, sagt<br />
auch Heinrich Olschowsky, Professor für<br />
westslawische Literatur an der Humboldt-<br />
Universität Berlin. Abgesehen von einigen<br />
sich hartnäckig haltenden Clichées hätten<br />
bei einer Umfrage unter Deutschen von 1999<br />
Wie es nach Ansicht einiger Historiker Anfang<br />
des vorigen Jahrhunderts bei den sog. „Ruhrpolen“<br />
aufgrund ihrer Neigung zu Vereins-<br />
Gründungen und ihrer katholischen Konfession<br />
durchaus noch der Fall war. Siehe dazu etwa<br />
beispielsweise Wehler, Hans-Ulrich: Die Polen<br />
im Ruhrgebiet vor 1918, in: Ders: (Hrsg.): Krisenherde<br />
des Kaiserreichs 1871-1918. Studien zur<br />
deutschen Sozial- und Verfassungsgeschichte, 2.<br />
Aufl. Göttingen 1979, S. 220-237<br />
auf die Frage, was ihnen zu „Polen“ einfalle,<br />
erstaunlich viele gesagt: nichts. Und auch<br />
nach dem Vordringen der während der Fußball-WM<br />
so bedeutungsvoll aufgeladenen<br />
polnischen Wurzeln von Klose und Podolski<br />
in das Bewußtsein der deutschen Gesellschaft<br />
ist kaum jemandem präsent, dass Polen<br />
nicht nur das zweitgrößte Nachbarland<br />
der Bundesrepublik ist, sondern Polen in ihr<br />
auch die zweitgrößte Minderheit stellen.<br />
Auswanderungsland Polen –<br />
Kaleidoskop 1<br />
Auf der inneren Karte vor allem der<br />
Westdeutschen spielte Polen lange kaum<br />
eine Rolle. Der Freund war der Westen, der<br />
Feind war der Russe, Polen lag irgendwo<br />
dazwischen. Zum ersten Mal erschien das<br />
Land im westdeutschen Fernsehen zur Solidarnosc-Zeit<br />
und verblüffte die Zuschauer:<br />
Da streikten Leute – mit dem Papst und gegen<br />
den Sozialismus. Bald danach sah man<br />
die ersten Fiat Polski auf deutschen Autobahnen,<br />
und die Zeitungen begannen, über<br />
Polenmärkte zu schreiben. Bedienten die<br />
Bilder, die von Polen in Berlin zu Beginn der<br />
1980er Jahre - in Zeiten des Kalten Krieges<br />
und der Solidarnosc - in der Presse erschienen,<br />
noch die Stereotypen des Freiheitskämpfers<br />
gegen den Sozialismus oder des<br />
liebenswerten Opfers der Unterdrückung,<br />
so dämpfte die mit der Öffnung des Landes<br />
ab 1988 einsetzende Reiselust der Polen recht<br />
bald die Begeisterung für die „Ostblockzuwanderer“.<br />
Blumige Schilderungen in der<br />
84
Berliner Morgenpost etwa von „Flügen in<br />
die Freiheit“ (Flugzeugentführungen polnischer<br />
Maschinen nach Tempelhof 1981)<br />
weichen bereits Mitte der achtziger Jahre<br />
Kommentaren wie „Unter die echten politischen<br />
Verfolgten, die vor den Pressionen<br />
des Warschauer Militärregimes ausgewichen<br />
sind, haben sich längst zahlreiche Landsleute<br />
gemischt, die den Namen Emigranten<br />
nicht verdienen“, die schwarz arbeiten, über<br />
Devisen verfügen und gar Geschäfte machen.<br />
Außerdem hatte der gerettete Pole aus<br />
dem Sozialismus arm zu sein und demütig:<br />
„Die Polen sehen gar nicht so notleidend<br />
aus, wie im Fernsehen immer gezeigt wird“,<br />
beschwert sich so ein Berliner Händler in<br />
einer taz-Reportage (taz, 20. Februar 1989).<br />
Würde man die Welt nur aus der Zeitung<br />
kennen, hätte man – wenn überhaupt - heute<br />
die „polnische Gemeinde“ vorwiegend<br />
<strong>als</strong> eine Schar von Putzfrauen, Schwarzmarkthändlern<br />
und (im Rahmen der dunkel<br />
am Horizont drohenden Arbeitnehmerfreizügigkeit<br />
der EU-Osterweiterung) den<br />
deutschen Arbeitsmarkt durch Masseneinwanderung<br />
kostengünstiger Arbeitskräfte<br />
unterwandernder, polnischer Klempner vor<br />
Augen – natürlich alle katholisch. Letztendlich<br />
bleiben diffus bedrohliche Bilder<br />
von Schattenwirtschaft, Menschenhandel<br />
und Kriminalität im Gedächtnis hängen.<br />
Den Polen dagegen war und ist Deutschland<br />
viel präsenter. Sie besitzen vom Nachbarland<br />
sehr viel mehr und vor allem viel<br />
präziseres, aktuelleres Alltagswissen, was<br />
teils auch schlicht mit der Lagerung praktischer<br />
Interessen zusammenhängen mag:<br />
Für Polen ist es (noch) wesentlich interessanter,<br />
in Deutschland zu arbeiten, <strong>als</strong><br />
umgekehrt. Polen haben eher ins Nachbarland<br />
ausgewanderte Verwandte sowie<br />
entsprechende Reiseerfahrung und sprechen<br />
deutsch. Entsprechend verlief auch die<br />
Migration zwischen beiden Ländern bisher<br />
weitgehendst <strong>als</strong> Einbahnstraße vom Osten<br />
der Oder in den Westen, und dies kontinuierlich<br />
schon seit knapp hundertfünfzig<br />
Jahren.<br />
Anders <strong>als</strong> viele westeuropäische<br />
Länder und auch die Bundesrepublik<br />
Deutschland, die sich in den vergangenen<br />
Jahrzehnten faktisch – wenn auch nicht unbedingt<br />
ihrem Selbstverständnis nach – zu<br />
„Einwanderungsländern neuen Typs“ entwickelt<br />
haben, gehört Polen bis dato zu den<br />
wichtigsten europäischen Auswanderungsländern.<br />
In den Jahren nach dem Umbruch<br />
in Osteuropa bis in die Mitte der neunziger<br />
Jahre kam der Republik östlich von Oder<br />
und Neiße die Rolle des “zweifellos führenden<br />
Quellandes von Migranten in Europa” <br />
zu. Schätzungsweise 1 Million Menschen<br />
polnischer Herkunft leben je in Brasilien<br />
und Frankreich (Marie Curie-Skladowska!),<br />
10,6 Millionen Polish Americans in<br />
den USA (v.a. Chicago, scherzhaft auch die<br />
zweitgrößte polnische Stadt nach Warschau<br />
genannt, mit dem größten polnisch-sprachigen<br />
Fernsehsender außerhalb Polens, Polvision.),<br />
in Großbritannien etwa 170.000<br />
und seit dem EU-Beitritt Polens 120.000 in<br />
Irland (selbst noch bis in seine jüngere Vergangenheit<br />
eher Quellen- <strong>als</strong> Zielland von<br />
Migration), womit Polen hier die mittlerweile<br />
größte nationale Minderheit stellen.<br />
Der weitaus größte Teil der nach Westeuropa<br />
gerichteten Migration aus Polen in den<br />
1980er und 1990er Jahren ging dabei in die<br />
Bundesrepublik Deutschland . Seit 1980<br />
sind so etwa zweieinhalb Millionen Menschen<br />
– endgültig oder nur vorübergehend<br />
– aus Polen in die Bundesrepublik migriert.<br />
Bei einer Bevölkerungszahl Polens von ca.<br />
38 Mio. Einwohnern entspricht dies einem<br />
ausgesprochen hohen Anteil von etwa 7%.<br />
Einwanderungsland Deutschland –<br />
Kaleidoskop 2<br />
Schon im Kaiserreich und verstärkt wieder<br />
in den vergangenen zwanzig Jahren<br />
Heinz Fassmann, Josef Kohlbacher, Ursula<br />
Reeger: Die “neue Zuwanderung” aus Ostmitteleuropa<br />
– Eine empirische Analyse am Beispiel<br />
der Polen in Österreich. Wien 1995, S. 55<br />
Siehe hierzu Heinz Fassmann, Rainer Münz<br />
(Hg.): Migration in Europa. Historische Entwicklung,<br />
aktuelle Trends und politische Reaktionen.<br />
Frankfurt/M., New York 1996, S. 39. In<br />
den letzten Jahren, vor allem nach der EU-Osterweiterung<br />
richtete sich die Migration dagegen<br />
eher auf Länder wie Irland und England, die<br />
nicht – wie Deutschland – die Freizügigkeit<br />
polnischer Arbeitnehmer in einer Art Schonfrist<br />
des Arbeitsmarktes für die kommenden Jahre<br />
eingeschränkt haben.<br />
85
ildeten bzw. bilden polnische Migranten<br />
somit eine der wichtigsten Zuwanderergruppen<br />
in Deutschland. Am eingehendsten erforscht<br />
ist die Situation polnischer Einwanderer<br />
aus dem preußischen Osten ins<br />
Ruhrgebiet im Laufe des durch die Industrialisierung<br />
bedingten zunehmenden Bedarfs<br />
an Arbeitskräften seit den 1870er Jahren bis<br />
zum Zweiten Weltkrieg (die sog. „Ruhrpolen“).<br />
Ungefähr 150.000 Deutsche (und einige<br />
interessante Wortneuschöpfungen wie<br />
etwa „Mottek“ für Hammer, nach dem polnischen<br />
młotek) stammen heute von diesen<br />
„Ruhrpolen“ ab, die <strong>als</strong> ungelernte Saisonarbeiter<br />
in Bergbau, Hüttenwesen sowie<br />
Landwirtschaft zunehmend an Attraktivität<br />
gewannen, da sie flexibel einsetzbar waren,<br />
die unpopuläre Arbeit in den Zechen nicht<br />
scheuten, längere Arbeitszeiten leisteten und<br />
dafür geringere Löhne erhielten. Aufgrund<br />
ihrer Sprache und ihrer katholischen Konfession<br />
vielerorts <strong>als</strong> „fremd“ wahrgenommen,<br />
bildeten die „Ruhrpolen“ bald ein eigenständiges<br />
Arbeitermilieu in den Städten<br />
des Ruhrgebiets. Um einerseits die Nachfrage<br />
nach Arbeitskräften zu befriedigen, andererseits<br />
aber die vermehrte Zuwanderung<br />
dieser Vorväter späterer „Gastarbeiter“ (und<br />
die befürchtete Entstehung einer Art früher<br />
Form von „Parallelgesellschaft“) abzubremsen,<br />
führte die preußische Verwaltung 1890<br />
eine sog. Karenzzeit ein, welche die polnischen<br />
Arbeiter zwingen sollte, nach Ende<br />
der Saison das Land wieder zu verlassen.<br />
Einige wissenschaftliche Untersuchungen<br />
beschäftigen sich darüber hinaus<br />
zunehmend auch mit jüngeren Migrationsbewegungen,<br />
etwa mit den im Rahmen der<br />
Öffnung Polens in den 1980er Jahren eintreffenden<br />
Migranten (sowohl Aussiedler – <strong>als</strong>o<br />
solche Einwanderer, die auf Grundlage des<br />
Bundesvertriebenengesetzes die deutsche<br />
Staatsangehörigkeit beantragt und erhalten<br />
haben - <strong>als</strong> auch polnische Staatsbürger).<br />
Während diese Einwanderer in der ersten<br />
Hälfte der achtziger Jahre vor dem Hintergrund<br />
des Ost-West-Konflikts <strong>als</strong> „Freiheitskämpfer“<br />
(Solidarnosc!) noch wohlwollend<br />
aufgenommen wurden, so wandelte sich<br />
dieses positive Polenbild Ende der achtziger<br />
Jahre mit dem enormen Anstieg der Zuwandererzahlen,<br />
der eng mit dem ökonomischen<br />
Wandel Polens seit 1989 und einer zuvor unbekannte<br />
Arbeitslosigkeit verbunden war,<br />
die einerseits für die Migranten einen wichtigen,<br />
wenn nicht den wichtigsten Push-<br />
Faktor darstellte, andererseits mit einem<br />
starken Bedarf Deutschlands an Niedriglohn-<br />
und Saisonarbeitskräften korrespondierte.<br />
Andere Migrationszüge – wie etwa<br />
diejenigen polnischer Displaced Persons, die<br />
nach ihrer Befreiung 1945 in den westlichen<br />
Besatzungszonen, (und später in der Bundesrepublik)<br />
blieben, Rückwanderungswellen<br />
in umgekehrter Richtung wie die in den<br />
wiedergegründeten polnischen Staat nach<br />
Ende des ersten Weltkrieges oder aktuell die<br />
Folgen des EU-Beitritts Polens und der EU-<br />
Dienstleistungsrichtlinie mit der vorläufigen<br />
7-jährigen Einschränkung der Freizügigkeit<br />
(„Übergangsfrist“) für polnische Arbeitsmigranten<br />
– fanden und finden dagegen bisher<br />
weit weniger Beachtung in der Forschung .<br />
Auch die scheinbar simplere Frage nach<br />
der Quantität der polnischen Migration läßt<br />
sich von der Literatur erwartungsgemäß<br />
nicht eindeutig beantworten, was zu einem<br />
großen Teil einfach daran liegt, dass sich in<br />
den harten Zahlen zugleich die vielfältigen<br />
weicheren Aspekte einer facettenreichen Migrantenidentität<br />
wiederspiegeln. Generell<br />
wird die Zahl der Menschen mit polnischer<br />
Muttersprache – nicht notwendigerweise<br />
Staatsangehörigkeit! - in der Bundesrepublik<br />
heute von verschiedenen Quellen auf<br />
über zwei Millionen geschätzt. Allerdings<br />
taucht diese Zahl, nach der die Polen hinter<br />
den Türken die zweitgrößte Einwanderergruppe<br />
in Deutschland stellen würden,<br />
in keiner offiziellen Einwanderungsstatistik<br />
auf. Zum einen lassen sich die polnischen<br />
Migranten dritter, vierter oder gar fünfter<br />
Generation formal nur noch schwer ausmachen:<br />
Die letzte große historische polnische<br />
Einwanderungswelle etwa, die der „Ruhrpolen“,<br />
war streng genommen keine Immigration,<br />
sondern eine Binnenwanderung.<br />
Die 300.000 ethnischen Polen, die dam<strong>als</strong><br />
nach Westen wanderten, waren im staats-<br />
Angenommen hat sich diesem Desiderat in<br />
jüngerer Zeit etwa die Tagung „Polnische Migranten<br />
in Deutschland“ (März 2000) am Institut<br />
für Europäische Regionalforschungen der<br />
Universität Siegen sowie in versch. Arbeiten zur<br />
Frage der Arbeitsmigration und Freizügigkeit<br />
etwa Wolfgang Cyrus.<br />
86
ürgerlichen Sinne Deutsche aus den östlichen<br />
Provinzen Preußens. Sie sprachen<br />
jedoch Polnisch, verfügten über einen polnischen<br />
Kulturbegriff und gründeten eine<br />
Unzahl polnischer Vereine und Organisationen.<br />
Diese bereits erwähnten „Ruhrpolen“<br />
haben zahlreiche polnische Familiennamen<br />
hinterlassen (14% der Deutschen tragen slawische<br />
Namen, viele davon polnische) und<br />
sind abgesehen davon - und entgegen aller<br />
ursprünglicher Befürchtungen - durch<br />
Assimilation beinahe rückstandslos in der<br />
deutschen Gesellschaft aufgegangen. Zum<br />
anderen sprengen allein die verbreitete<br />
Pendelmigration zwischen Lebensmittelpunkt<br />
im Heimatland und Arbeitsplatz in<br />
Deutschland oder die sog. „doppelten Identitäten“<br />
etwa von Aussiedlern den üblichen<br />
Begriff von Migration und erschweren die<br />
Lesbarkeit von Statistiken. Die Einwanderungswelle<br />
der „Vertriebenen“ nach dem 2.<br />
Weltkrieg aus den ehem<strong>als</strong> deutschen Ostgebieten<br />
betraf so größtenteils ethnisch<br />
Deutsche. Viele unter ihnen waren jedoch<br />
mit doppelter Identität und zweisprachig<br />
aufgewachsen. Auch ist beispielsweise der<br />
Großteil der seit 1980 in die Bundesrepublik<br />
zugewanderten polnischen Staatsbürger<br />
nach Polen zurückgekehrt bzw. mußte aufgrund<br />
des befristeten Aufenthaltsrechts zurückkehren<br />
(oder <strong>als</strong> Illegale im Land bleiben).<br />
Dadurch hat sich die Zahl gemeldeter<br />
Ausländer polnischer Staatsangehörigkeit<br />
in den 1990er Jahren bei knapp 300.000<br />
eingependelt; mit einem Anteil von etwa<br />
4% aller Ausländer stellen die Polen nach<br />
Staatszugehörigkeit gerechnet demnach die<br />
fünftgrößte Gruppe unter den in Deutschland<br />
lebenden Ausländern. Hinzu kommen<br />
Illegale, deren Zahl schwer zu schätzen ist.<br />
Darüber hinaus ergeben sich grundlegende<br />
Fragen der Kategorisierung: Je nachdem,<br />
ob Muttersprache, Staatsangehörigkeit<br />
oder Abstammung den Statistiken zugrunde<br />
gelegt wird, fallen auch die Zahlen aus.<br />
Es gibt polnische Angaben, die von über 70<br />
Millionen Polen weltweit sprechen. Neutralere<br />
Schätzungen gehen ehr von 44 bis<br />
60 Millionen aus. Die „Polonia“, die polnische<br />
Diaspora, rechnet mit etwa 20 Millionen<br />
Auslandspolen, <strong>als</strong> deren wichtigstes<br />
Definitionsmerkmal weder Staatsbürgerschaft<br />
noch Abstammung oder Geburtsort,<br />
sondern interessanterweise vor allem die<br />
Beherrschung der polnischen Sprache zu<br />
Grunde gelegt wird (möglicherweise auch,<br />
weil aufgrund der vielfachen Teilungen des<br />
Landes in weiten Strecken der Geschichte<br />
Polens nur die Sprache das Land vereint<br />
hat). Und an die Frage der polnischen Diaspora<br />
knüpft sich in der Bundesrepublik<br />
dabei neben generellen Fragen der Migrationsproblematik<br />
wiederum die gelegentlich<br />
wieder aufflammende Diskussion um die<br />
Wiederanerkennung einer 1939 per Nazidekret<br />
delegalisierten polnischen Minderheit<br />
in Deutschland .<br />
Ein Fazit dieser Spurensuche fällt daher<br />
schwer. Vielleicht: Die Gesamtheit der<br />
polnischen Migration nach Deutschland<br />
läßt sich möglicherweise genauso schwer in<br />
Zahlen fassen wie die Lebensgeschichten<br />
der einzelnen Menschen, die sich dahinter<br />
verbergen.<br />
PS: Abseits von Staatsbibliothek, Statistiken<br />
und Bücher-Stapeln finden sich bei<br />
einer Spurensuche polnischen Alltags in<br />
Berlin heute neben dem Fußballclub „POC<br />
Olympia Berlin“, zahlreichen Eckläden,<br />
polnischen Lesungen auf Radio Multikulti,<br />
dem stadtbekannten „Club der polnischen<br />
Versager“ (nicht nur ein schönes Beispiel<br />
dafür, wie die gängigen Polen-Bilder sehr<br />
bewußt ironisiert werden, sondern einfach<br />
auch ein netter Ort, einen Samstagabend<br />
zu verbringen), auch sehr populäre Restaurants<br />
mit polnischer Küche ! Liebe geht ja<br />
bekanntlich durch den Magen, und gesellschaftliche<br />
Akzeptanz scheinbar manchmal<br />
auch.<br />
Von Befürwortern wird dabei die Anzahl<br />
dauerhaft in Deutschland lebender, gemeldeter<br />
polnischer Staatsbürger von immerhin 300.000<br />
und die Tatsache, dass die deutsche Minderheit<br />
in Polen bei einem vergleichbaren Bevölkerungsanteil<br />
von 0,36 – 0,38% den Status <strong>als</strong><br />
nationale Minderheit genießt, ins Feld geführt.<br />
www.polnischeversager.de<br />
Etwa „Waschmaschinewsky“ in Berlin-Freidrichshain.<br />
Sehr empfehlenswert ist das große<br />
Frühstück „Warschauer Pakt“ (Sa/ So). www.<br />
waschmaschinewsky.de<br />
87
Kapitel IV<br />
Polnische Persönlichkeiten –<br />
Cusanische Perspektiven<br />
89
Leszek Balcerowicz – Pole durch und durch<br />
oder ökonomischer Metropolit?<br />
von Heiner Tschochohei<br />
Leszek Balcerowicz hat Ehrendoktorwürden von den verschiedensten Universitäten<br />
der Welt erhalten. Der amtierende Präsident der polnischen Nationalbank<br />
wurde bekannt durch den sogenannten Balcerowicz-Plan, mit dem auf einen<br />
Schlag die Systemtransformation in Polen vollzogen wurde. Fraglich ist, worin<br />
der ungestüme Charakter des Plans begründet liegt: polnisches Naturell, historische<br />
Konsequenz polnischer Wirtschaftspolitik oder in der Person Balcerowicz’<br />
selbst? Die Antwort liegt in der Mitte.<br />
Was in der wirtschaftspolitischen Literatur<br />
<strong>als</strong> „Big Bang“ oder „Schocktherapie“<br />
bekannt geworden ist, erinnerte am 1.<br />
Januar 1990 in Polen an die Öffnung eines<br />
Kaufhauses zum Winterschlussverkauf: Neonlicht<br />
flackerte auf, Angebotsschilder wurden<br />
in Stellung gebracht, die Kassen gut<br />
mit Wechselgeld bestückt und die ersten<br />
Kunden, die das Geschäft betraten, wirkten<br />
kaufwillig, aber orientierungslos. Die<br />
Analogie mag nicht perfekt sein, steht aber<br />
sinnbildlich für die Maßnahmen, die Leszek<br />
Balcerowicz nach dem Fall des eisernen<br />
Vorhangs zu Beginn der 1990er Jahre durchführte,<br />
um Polen schnellstmöglich in eine<br />
Marktwirtschaft zu überführen.<br />
Um im Bild zu bleiben: Der sozialistische<br />
Winter war hart – das Warenangebot war<br />
knapp und die Inflation betrug zum Ende<br />
der Herrschaft der Vereinigten Polnischen<br />
Arbeiterpartei mitunter 50 % – auf monatlicher<br />
Basis. Dabei trieb die inkonsequente<br />
Wirtschaftspolitik Nachkriegspolens ganz<br />
besondere Blüten. Die kommunistische Elite<br />
war gegenüber der Arbeiterbewegung zu Zugeständnissen<br />
beim Lohn bereit, die in keinem<br />
Verhältnis zur Produktivitätsentwicklung<br />
standen. Unter marktwirtschaftlichen<br />
Bedingungen hätte dies relativ schnell zu<br />
einer Inflation bzw. Hyperinflation geführt.<br />
Innerhalb von klassischen Planwirtschaften<br />
mit einem rigiden Preissystem war jedoch<br />
die Logik von Angebot und Nachfrage außer<br />
Kraft gesetzt; dies führte in der Folge<br />
in solchen Fällen zu Versorgungsengpässen.<br />
Ende der 1980er Jahre war in Polen allerdings<br />
eine Kombination beider Phänomene<br />
zu beobachten, da sich die Inflation nach<br />
der ersten zaghaften Freigabe der Preise gewissermaßen<br />
entlud und andererseits nach<br />
wie vor Nachfrageengpässe vorherrschten.<br />
Weiterhin musste die neue Regierung unter<br />
Tadeusz Mazowiecki im Herbst 1989 mit einer<br />
sehr hohen Auslandsverschuldung fertig<br />
werden.<br />
In dieser Situation galt es, dem Wirtschaftssystem<br />
eine neue Gestalt zu geben.<br />
Wie in allen Staaten Mittel- und Osteuropas<br />
war die wirtschaftspolitische Stabilisierungsagenda<br />
im Wesentlichen von fünf<br />
Punkten bestimmt: Erstens: Preisliberalisierung,<br />
die die Senkung bzw. Abschaffung<br />
von Subventionen, die Freigabe von Preisen<br />
und den freien Binnenhandel beinhal-<br />
90
tete. Zweitens: Ausgleich des Staatshaushaltes,<br />
was in der Regel mit einem Anstieg<br />
von (Einkommens-)Steuern und der Senkung<br />
der Staatsausgaben einher ging. Drittens:<br />
Restriktive Steuerung der Geldmenge<br />
durch Anhebung der Leitzinsen. Viertens:<br />
Einschnitte bei den Löhnen. An fünfter<br />
Stelle ist die Öffnung des internationalen<br />
Handels zu nennen. Dies war normalerweise<br />
nur durch eine Abwertung der eigenen<br />
Währung möglich.<br />
Je nach wirtschaftlichem Status quo der<br />
einzelnen, ehem<strong>als</strong> kommunistischen Ökonomien<br />
hatten die Maßnahmenpakete noch<br />
weitere Neuerungen und Änderungen, beispielsweise<br />
die Schaffung eines mehrgliedrigen<br />
Bankensystems, zu umfassen. Der<br />
entscheidende Unterschied war allerdings<br />
nicht das Spektrum der wirtschaftspolitischen<br />
Eingriffe, sondern die Geschwindigkeit<br />
und Reihenfolge der Umsetzung.<br />
Während Ungarn etwa bekannt wurde <strong>als</strong><br />
Stellvertreter für eine sequenzielle Strategie,<br />
ist Polen nach wie vor Sinnbild für den<br />
oben genannten „Big Bang“ – die Schocktherapie.<br />
Diese wird in der Fachliteratur <strong>als</strong><br />
eine Strategie bezeichnet, die irreversible<br />
Maßnahmen herbeiführt, indem schnellstmöglich<br />
und sehr akzentuiert die einzelnen<br />
Schritte durchgeführt werden. Die polnischen<br />
Akteure der Systemtransformation<br />
stellen im Übrigen die besondere Strategiewahl<br />
nahezu unisono <strong>als</strong> conditio sine qua<br />
non in der Literatur dar. Verordnet wurde<br />
die Therapie zum 1. Januar 1990 federführend<br />
von Leszek Balcerowicz, einem bis zu<br />
diesem Zeitpunkt in der öffentlichen Wahrnehmung<br />
unbekannten, eher akademisch<br />
orientierten Wirtschaftswissenschaftler. Infolgedessen<br />
sind die wirtschaftspolitischen<br />
Reformen unter dem Titel „Balcerowicz-<br />
Plan“ weltweit bekannt geworden.<br />
Mithin stellt sich die Frage, warum sich<br />
die Regierung Mazowiecki bzw. Balcerowicz<br />
selbst seinerzeit so entschied. Diese<br />
Diskussion kann vor dem Hintergrund geführt<br />
werden, dass die Schocktherapie sehr<br />
große Einbußen für die breite Bevölkerung<br />
bedeutete. In den Jahren 1990 und 1991 lag<br />
Polen mit Blick auf Wirtschaftswachstum,<br />
Inflation, Arbeitslosigkeit und Budgetdefizit<br />
deutlich hinter der Tschechischen Republik,<br />
Ungarn und Slowenien. Bemerkenswert<br />
ist dabei, dass Balcerowicz zwar im<br />
Vorfeld von einer anfänglich schwierigeren<br />
wirtschaftlichen Situation ausging, seine<br />
Projektionen jedoch in allen Bereichen in<br />
negativer Hinsicht noch übertroffen wurden.<br />
In der Retrospektive steht dies für<br />
Balcerowicz eher in Zusammenhang mit<br />
der desolaten Ausgangssituation <strong>als</strong> mit<br />
der Natur „seines“ Programms: „If a country<br />
has been operating under difficult initial<br />
and external conditions, it is a mistake<br />
to blame social discontent on a particular<br />
type of economic programme“ (Balcerowicz<br />
1995, 163). Andererseits ließe sich der Balcerowicz-Plan<br />
auch vor dem Hintergrund<br />
des heutigen EU-Mitgliedsstaates Polen<br />
diskutieren, der in mancherlei Hinsicht Erfolgsgeschichten<br />
zu bieten hat. Jedoch ist<br />
die hier verfolgte Frage, woher dam<strong>als</strong> die<br />
Motivation für die Schocktherapie rührte.<br />
Es gilt weniger zu ergründen, inwiefern die<br />
eine der anderen Transformationsstrategie<br />
vorzuziehen ist, sondern welche Beweggründe<br />
im Herbst 1989 zur Ausarbeitung<br />
des Plans in der beschriebenen radikalen<br />
Weise führten.<br />
Vor dem Hintergrund einer sehr bewegten<br />
polnischen Nationalgeschichte liegt<br />
es nahe, nach Anhaltspunkten in der Historie<br />
zu suchen. Ein weiterer, hier zu diskutierender<br />
Aspekt sind in der logischen<br />
Konsequenz die damaligen politischen<br />
Rahmenbedingungen. Und schließlich<br />
muss die Person Balcerowicz selbst thematisiert<br />
werden, was allerdings ohne Rückbezug<br />
auf die Geschichte Polens nach 1945 unvollständig<br />
wäre.<br />
Begibt man sich auf die historische<br />
Fährtensuche, so stellt sich schnell die Frage<br />
nach dem Anfang. Was wählt man <strong>als</strong><br />
Bezugspunkt? Das Königreich Polen des<br />
15. Jahrhunderts, das Kongresspolen der<br />
Restaurationszeit oder doch erst das Polen<br />
nach Ziehung der Curzon-Linie? Obwohl<br />
gerade dem deutschen Autor bezüglich der<br />
eigenen Geschichte diese Frage bekannt<br />
vorkommt, so ist sie nicht leicht zu beantworten.<br />
Denn mit der ersten geschriebenen<br />
Verfassung Europas 1791 liegen sehr fassbare<br />
Anhaltspunkte vor, aber schon mit<br />
der dritten Teilung Polens 1795 haben mit<br />
91
Preußen, Russland und Österreich drei sehr<br />
unterschiedlich strukturierte Staaten ihren<br />
Einfluss in der polnischen Geschichte hinterlassen.<br />
Einzig das selbstbewusste Auftreten<br />
der Magnaten zur Zeit der Adelsrepublik<br />
ließe ein wenig Raum für Spekulation<br />
über die vehement agierende polnische Natur.<br />
Nachvollziehbarer scheint daher ein<br />
Blick in die jüngere Vergangenheit zu liegen.<br />
Dieser offenbart jedoch einen dem Schock-<br />
Nimbus des Balcerowicz-Plan diametral<br />
entgegenstehenden Blick auf die polnische<br />
Wirtschaftspolitik: Die polnische Volksdemokratie<br />
hat in den Nachkriegsjahrzehnten<br />
– eher atypisch für die COMECON-Staaten<br />
– bereits verschiedene Marktelemente<br />
eingeführt, etwa eine teilweise dezentrale<br />
Preisbildung. Auch die Zentralplanung<br />
wurde stellenweise ausgesetzt, jedoch nur<br />
zugunsten sogenannter Regierungsaufträge.<br />
In der Folge muss man einen Hybrid<br />
zwischen Markt- und Planwirtschaft konstatieren,<br />
was summa summarum zu einem<br />
Konglomerat ineffizienter Strukturen führte<br />
und in keiner Weise <strong>als</strong> Sinnbild für klar akzentuiertes<br />
und zielorientiertes wirtschaftspolitisches<br />
Agieren stehen konnte. Man mag<br />
diesen ökonomischen Zwitter <strong>als</strong> das Optimum<br />
im Zusammenspiel von historisch<br />
bedingter ausgeprägter Freiheitsliebe und<br />
kommunistischer Doktrin auffassen. Insofern<br />
ließe sich auch argumentieren, dass der<br />
Balcerowicz-Plan in der Folge des früh einsetzenden<br />
gesellschaftlichen Strebens nach<br />
Freiheit und ökonomischer Selbstbestimmung<br />
stand. Schließlich ließe sich im selben<br />
Sinne auch die Entstehungsgeschichte<br />
des Komitees zur Verteidigung der Arbeiter<br />
und vor allen Dingen der Gewerkschaft Solidarnosc<br />
Ende der 1970er Jahre beifügen.<br />
Auf der anderen Seite muss aber festgehalten<br />
werden, dass es auch innerhalb der genannten<br />
Bewegungen nie eine einhellige<br />
Meinung über das adäquate Vorgehen gab.<br />
Entsprechend kann man zwar diverse Anhaltspunkte<br />
für eine Entsprechung von Balcerowicz-Plan<br />
und polnischer Identität konstatieren,<br />
muss deren Fragilität jedoch auch<br />
anerkennen.<br />
Es scheint opportun, sich in der Suche<br />
nach der Motivation für den dam<strong>als</strong> sehr<br />
drastisch daherkommenden Balcerowicz-<br />
Plan auf die Begleitumstände der Systemtransformation<br />
zu beschränken. Wie bereits<br />
angesprochen ist die Wirtschaftspolitik<br />
Nachkriegspolens von marktwirtschaftlichen<br />
Ansätzen durchsetzt gewesen. Mitunter<br />
wird dem Plan daher sogar der Schock-<br />
Therapiecharakter abgesprochen, was jedoch<br />
die Lage der Bevölkerung verkennt. Denn<br />
tatsächlich handelte es sich um den „Big<br />
Bang“. Um dies zu verstehen, muss man der<br />
ökonomischen Schule des Balcerowicz-Plans<br />
näherkommen. Das Maßnahmenpaket basiert<br />
auf der neoklassischen Denkweise, die<br />
in ihrer simplen Lehrbuchform von streng<br />
rational agierenden Akteuren ausgeht. Ganz<br />
besonders zu betonen ist die ahistorische<br />
Natur von Handlungen. Frühere Ereignisse<br />
spielen keine Rolle, im Interesse der Überlegung<br />
steht vielmehr, wie eigennützig handelnde<br />
Individuen miteinander interagieren<br />
und unter welchen Bedingungen schließlich<br />
ein Marktgleichgewicht erreicht wird.<br />
In diesem Sinne war es nicht Teil des Plans,<br />
der Bevölkerung die Systemtransformation<br />
zu vermitteln; die Inflation schien Legitimation<br />
genug, um die notwendigen Maßnahmen<br />
simultan und schnell aufeinander<br />
folgend durchzuführen. Der Ruf aus der<br />
Bevölkerung kann dementsprechend nicht<br />
der Beweggrund für Balcerowiczs Auftreten<br />
gewesen sein. Zweifelsohne galt es, auf<br />
die Versorgungsprobleme und die Inflation<br />
zu reagieren. Soweit herrschte Konsens; die<br />
weitere Strategieentscheidung fand jedoch<br />
ohne direkte Ableitung eines Volkswillens<br />
statt. Es stellt sich die Frage, ob daher nicht<br />
der Blick auf die außerpolnischen Rahmenbedingungen<br />
gerichtet werden muss. Und<br />
tatsächlich forderte der internationale Währungsfonds<br />
(IWF) einschneidende Maßnahmen,<br />
um die Inflation einzudämmen<br />
und Polens Kreditwürdigkeit wiederherzustellen.<br />
Noch zielweisender waren für Polen und<br />
Balcerowicz aber nicht die allgemeinen Vorgaben<br />
und Empfehlungen des IWF, sondern<br />
die besonderen Kontakte, die Balcerowicz<br />
beispielsweise zu Jeffrey Sachs, einem einflussreichen<br />
US-Ökonomen, unterhielt (und<br />
unterhält!). Zustandegekommen waren diese<br />
bereits in den siebziger Jahren, <strong>als</strong> Balcerowicz<br />
nach dem Studium an der heutigen<br />
Warschauer Wirtschaftsuniversität (bereits<br />
dam<strong>als</strong> die „modernste“ Ökonomiefakul-<br />
92
tät Polens) vor seiner Promotion zunächst<br />
ein <strong>MB</strong>A-Programm an der New Yorker St.<br />
John’s University absolvierte. In der Folgezeit<br />
brachte er seine Fachkompetenz allerdings<br />
mehr im akademischen Umfeld und<br />
im „Untergrund“ ein. 1978 initiierte er einen<br />
informellen Zusammenschluss von Experten,<br />
die sog. Balcerowicz-Gruppe. Im<br />
munteren Zusammenspiel mit sympathisierenden<br />
ausländischen Ökonomen entwickelte<br />
das Bündnis Alternativen zum maroden<br />
polnischen Wirtschaftssystem. Um den<br />
sozialen Frieden zu wahren, wurden einzelne<br />
Mitglieder im Verlauf der achtziger Jahre<br />
dann von der Regierung zu Stellungnahmen<br />
und zur Mitwirkung an aktuellen<br />
Reformvorhaben eingeladen. Dieser Kanal<br />
für die westlich orientierte Wirtschaftsdoktrin<br />
der damaligen Zeit (man erinnere sich<br />
an Reaganomics und den Thachterismus)<br />
in die polnische Politik ist auch ein Erklärungsgrund<br />
für den oben genannten Systemhybrid.<br />
Vor allen Dingen aber ist er ein<br />
Vorläufer für die offene Einflussnahme der<br />
westlichen Welt bei der Ausgestaltung des<br />
Balcerowicz-Plans. So waren nicht nur einige<br />
Gefolgsleute aus der Balcerowicz-Gruppe<br />
Mitglied in der Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung<br />
des Plans (Marek Dabrowski etwa),<br />
sondern in beratender Funktion auch der<br />
Neoklassiker Jeffrey Sachs mit deutlicher<br />
personeller und administrativer Unterstützung<br />
des IWF. Nicht zu unterschätzen auch<br />
die „Hilfestellung“, die seitens der EU erfolgte.<br />
In diesem Licht muss der Balcerowicz-Plan<br />
denn eher im Kontext internationaler<br />
Einflussnahme <strong>als</strong> vor dem Hintergrund<br />
polnischer Tradition gesehen werden.<br />
Für die Natur des Balcerowicz-Plans gibt<br />
es keine monokausale Erklärung. Die Systemtransformation<br />
geschah im Konzert mit<br />
den anderen Staaten Mittel- und Osteuropas<br />
und war letztlich Ergebnis des Zusammenbruchs<br />
des gesamten Ostblocks. Nicht<br />
zuletzt wegen der übergeordneten Systemdebatten<br />
muss ein großer Teil der Motivation<br />
für den Charakter der Maßnahmen aus<br />
dem globalen Zeitgeist abgeleitet werden<br />
– mehr <strong>als</strong> aus der polnischen Identität. Zu<br />
markant sind die Umstände in Balcerowicz’<br />
Ausbildung: geprägt vom inkonsequenten<br />
Vorgehen der sozialistischen Regierungen<br />
und ausgebildet an polnischen und USamerikanischen<br />
Wirtschaftselitehochschulen,<br />
war er zu empfänglich für die Rezepte,<br />
die von Jeffrey Sachs herangetragen<br />
wurden. Hier den Brückenschlag zur polnischen<br />
Adelsrepublik oder Kongresspolen<br />
zu machen, erscheint wagemutig. Jedoch<br />
ließe sich andersherum spekulieren, dass<br />
erst der Umgang mit Polen <strong>als</strong> Spielball europäischer<br />
Interessenspolitik über die Jahrhunderte<br />
hinweg verhindert hat, dass sich<br />
eine Tradition von Wirtschaftspolitik und<br />
ökonomischer Führungsweise entwickelte.<br />
Die Zukunft wird zeigen, wie sich Polen in<br />
der Europäischen Union darstellen und seinen<br />
eigenen Weg finden wird.<br />
Literatur<br />
Adam, J. (1994): The transition to a market<br />
economy in Poland, in: Cambridge Journal<br />
of Economcis, Vol. 18, pp. 607 – 618.<br />
Balcerowicz, L. (1995): Socialism, Capitalism,<br />
Transformation, Budapest et al.: Oxford<br />
University Press.<br />
Fuhrmann, R. (1990): Polen: Handbuch;<br />
Geschichte, Politik, Wirtschaft, Hannover:<br />
Fackelträger.<br />
Hoen, H. (1996): „Shock vs. Gradualism“<br />
in Central Europe Reconsidered, in: Comparative<br />
Economic Studies, Vol. 38 (1), pp.<br />
1 – 20.<br />
Lavigne, M. (1999): The Economics of Transition.<br />
From Socialist to Market Economy,<br />
2nd edition, London: MacMillan.<br />
Neunhöffer, G. (2001): Die neoliberale Kulturrevolution<br />
– neoliberale Think Tanks in<br />
Polen, in: UTOPIE kreativ, Vol. 126, pp. 313<br />
– 323.<br />
Shields, S. (2003): The „Charge of the Right<br />
Brigade“: Transnational Social Forces and<br />
the Neoliberal Configuration of Poland’s<br />
Transition, in: New Political Economy,<br />
Vol. 8 (2), pp. 225 – 244.<br />
93
Nikolaus Kopernikus<br />
von Olaf Schweisthal<br />
Es scheint, dass Weltbilder um so erfolgreicher<br />
sind, je mehr sie bestimmten<br />
Grundbedürfnissen des Menschen entgegenkommen,<br />
die psychologischer, geistiger<br />
oder ästhetischer Natur sein können. Die<br />
Überzeugungskraft der sinnlichen Wahrnehmung,<br />
insbesondere des Visuellen, ist<br />
groß; unsere gesamte physiologische Konstitution<br />
ist gleichsam ehern geschmiedet an<br />
die Ruhe und Unverrückbarkeit des uns tragenden<br />
Bodens. Die Vorstellung einer bewegten<br />
Erde widerspricht dem Augenschein<br />
und hat zunächst wenig Plausibilität. Das<br />
auf der Geozentrik, <strong>als</strong>o der Mittelpunktstellung<br />
der Erde basierende Zwei-Kugel-<br />
Universum der Antike trug der unmittelbaren<br />
Sinneswahrnehmung in hohem Grade<br />
Rechnung; zudem muss es <strong>als</strong> in sich widerspruchsfrei<br />
und einfach bezeichnet werden.<br />
Auch anspruchsvollere Beobachtungen und<br />
Messungen der gestirnten Umwelt lassen<br />
sich zwanglos darin einordnen: Eine gewaltige<br />
Hohlkugel, an deren Innenseite die Fixsterne<br />
befestigt sind, dreht sich in westlicher<br />
Richtung gleichmäßig um eine feste Achse.<br />
Die Erde wird <strong>als</strong> vergleichsweise winzige,<br />
ruhende Kugel imaginiert, deren Mittelpunkt<br />
zugleich derjenige der Sternenkugel<br />
ist. Die Planeten, zu denen auch Sonne<br />
und Mond gerechnet wurden, bewegen sich<br />
in dem weiten Raum zwischen Erd- und<br />
Himmelskugel. Ein „Außerhalb“ der letzteren,<br />
im Sinne der Raumvorstellung, gibt<br />
es nicht; die Sternenkugel ist „eingelagert“<br />
in ein unbestimmtes Etwas, eine Art Nichts<br />
vom Standpunkt der irdischen Erfahrung<br />
aus – jenseits von Raum, Zeit und Materie:<br />
die Wirkungsregion göttlicher Ursächlichkeit,<br />
des „unbewegten Bewegers“ (nach Aristoteles).<br />
Eingefügt in die Sternenkugel sind weitere<br />
Hohlkugeln, die ein gemeinsames Zentrum<br />
besitzen: den Mittelpunkt der Erde.<br />
Sie tragen die Planeten auf ihrer Bahn entlang.<br />
Das System der geozentrischen Kugeln<br />
geht auf den Platon-Schüler Eudoxus zurück<br />
und wurde geschaffen, um die Bewegungen<br />
der Planeten auf die <strong>als</strong> vollkommen<br />
geltende Figur des Kreises bzw. der Kugel<br />
zurückzuführen, die Platon zur Konstituente<br />
des Kosmos erklärt hatte. Nach Aristoteles<br />
war die im Zentrum des Universums<br />
stehende Erde zunächst umgeben von den<br />
sphärischen Hüllen der drei irdischen Elemente<br />
Wasser, Luft und Feuer; die Feuersphäre<br />
wiederum wurde umschlossen von<br />
den kristallenen Sphären bzw. Hohlkugeln,<br />
in die jeweils - in wachsender Entfernung<br />
von der Erde - Mond, Merkur, Venus, Sonne,<br />
Mars, Jupiter und Saturn eingelagert<br />
waren und im Umlauf gehalten wurden.<br />
Jenseits der kristallenen und durchsichtigen<br />
Planetensphären kam die Fixsternsphäre<br />
bzw. die Sternenkugel, die absolute Grenze<br />
des Weltalls.<br />
In der Schrift „Über den Himmel“<br />
schreibt Aristoteles: Die natürliche Bahn ihrer<br />
Teile und der ganzen Erde ist zur Mitte<br />
des Alls hin gerichtet. Deswegen befindet<br />
sie sich jetzt in diesem Mittelpunkt. Nun<br />
könnte man fragen, wenn beide Mittelpunkte<br />
zusammen fallen, zu welchem strebt<br />
alles Schwere und die Teile der Erde naturgemäß<br />
hin, zu dem des Alls oder zu dem der<br />
94
Erde? Notwendig zu dem des Alls, da auch<br />
alles Leichte und das Feuer, das die Gegenbewegung<br />
zum Schweren ausführt, nach<br />
dem Rande des die Mitte umschließenden<br />
Raumes strebt. Nur mittelbar ist die Mitte<br />
der Erde auch Mitte des Alls, der Sturz erfolgt<br />
auch zur Mitte der Erde hin, aber nur<br />
mittelbar, insofern sie ihre Mitte in der Mitte<br />
des Alls hat [...] Dass die Erde sich nicht<br />
bewegt, auch nicht außerhalb der Mitte ist<br />
hieraus zu erkennen. Zudem ist aus dem<br />
Gesagten auch der Grund ihres Verweilens<br />
klar. Denn wenn, wie man beobachtet, die<br />
Körper von allen Seiten nach der Mitte fallen<br />
und das Feuer von der Mitte zum Rande<br />
hin strebt, dann kann unmöglich irgendein<br />
Teil von ihr die Mitte verlassen, es sei denn<br />
mit Gewalt.<br />
Die aristotelische Beweisführung geht<br />
von einer dem naiven Realismus nahe stehenden<br />
Betrachtungsart aus. Die Dinge<br />
werden zunächst einmal so gedeutet, wie<br />
sie den Sinnen erscheinen. Die sich hierauf<br />
aufbauenden Schlussfolgerungen und Verallgemeinerungen<br />
sind rein spekulativer<br />
Natur. Aristoteles schließt eine sich bewegende<br />
Erde kategorisch aus. Wenn sich die<br />
Erde tatsächlich bewegen würde wäre nach<br />
Aristoteles die gesamte irdische Physik vielfältigen<br />
Verzerrungen und Verschiebungen<br />
unterworfen. So würden etwa die Wolken,<br />
die ihren „natürlichen“ Ort einnehmen,<br />
stets hinter der rotierenden Erde zurückbleiben.<br />
Unter der Bezugnahme auf den Platon-<br />
Schüler Herakleides von Pontos, der unter<br />
anderem die Drehung der Erde um ihre<br />
Achse und damit die Ruhe der Sternenkugel<br />
behauptet hatte, führt Ptolemäus in seiner<br />
Schrift „Almagest“ die genannten aristotelischen<br />
Argumente zur Mittelpunktstellung<br />
der Erde im Universum an und fährt fort:<br />
Obwohl sie den gebrachten Argumenten<br />
nichts entgegenzusetzen haben, haben gewisse<br />
Denker ein Schema ersonnen, das sie<br />
für akzeptabler halten, von dem sie glauben,<br />
dass nichts dagegen eingewendet werden<br />
kann, wenn sie zum Beispiel vorschlagen,<br />
dass der Himmel ruht, jedoch die Erde<br />
um ein und dieselbe Achse von West nach<br />
Ost rotiert, indem sie eine Umdrehung in<br />
ungefähr einem Tag vollendet. Diese Leute<br />
vergessen jedoch, dass es zwar keinen Einwand<br />
gegen diese Theorie geben mag, soweit<br />
Himmelserscheinungen betroffen sind, doch<br />
nach den (irdischen) Bedingungen zu urteilen,<br />
die uns und die Objekte der Luft um<br />
uns betreffen, muss eine solche Hypothese<br />
lächerlich erscheinen [...] Wenn die Erde<br />
in einer solch kurzen Zeit solch eine große<br />
Drehung um ihre Achse macht [...] muss<br />
alles, was nicht auf der Erde steht, ein und<br />
dieselbe Bewegung im Gegensinn der Erde<br />
gemacht haben, und Wolken sowie alle Dinge,<br />
die fliegen und geworfen werden können,<br />
könnten niem<strong>als</strong> nach Osten wandern,<br />
denn die Erde würde sie alle stets überholen,<br />
so dass alles nach Westen zurückbleiben<br />
würde. Der astronomischen Plausibilität der<br />
Erdrotation wird deren physikalische Unmöglichkeit<br />
entgegengestellt.<br />
Kopernikus – dies gilt <strong>als</strong> der Kern der<br />
mit seinem Namen verbundenen „Wende“ –<br />
hat die kosmische Mittelpunktsstellung der<br />
Erde im aristotelisch-ptolemäischen Weltsystem<br />
mit derjenigen der Sonne vertauscht.<br />
Er hat die irdische Heimstatt, die der sinngebundenen<br />
Erfahrung ruhend und unverrückbar<br />
erscheint, <strong>als</strong> in „rasender“ Bewegung<br />
begriffen erkannt, ihr den kosmischen<br />
Status eines Planeten verliehen. Damit hat<br />
er die sinnliche Unmittelbarkeit der wahrgenommenen<br />
Gestirnbewegung <strong>als</strong> Schein<br />
entlarvt, dem absoluten Oben-Unten-System<br />
der Geozentrik ein System der Relativität<br />
entgegengestellt, ohne jedoch dessen<br />
kosmologische und erkenntnistheoretische<br />
Implikation voll zu durchschauen.<br />
Im „Commentariolus“, einer Frühfassung<br />
seiner Lehre, hat Kopernikus die<br />
Grundzüge der Heliozentrik thesenartig<br />
wie folgt umrissen: Erster Satz (prima petitio):<br />
Für alle Himmelskörper oder Sphären<br />
gibt es nicht nur einen Mittelpunkt. / Zweiter<br />
Satz: Der Erdmittelpunkt ist nicht der<br />
Mittelpunkt der Welt, sondern nur der der<br />
Schwere und des Mondbahnkreises. / Dritter<br />
Satz: Alle Bahnkreise umgeben die Sonne,<br />
<strong>als</strong> stünde sie in aller Mitte, und daher liegt<br />
der Mittelpunkt der Welt in Sonnennähe. /<br />
Vierter Satz: Das Verhältnis der Entfernung<br />
Sonne-Erde zur Höhe des Fixsternhimmels<br />
ist kleiner <strong>als</strong> das vom Erdhalbmesser zur<br />
Sonnenentfernung, so dass diese gegenüber<br />
95
der Höhe des Fixsternhimmels unmerklich<br />
ist. / Fünfter Satz: Alles, was an Bewegung<br />
am Fixsternhimmel sichtbar wird, ist nicht<br />
von sich aus so, sondern von der Erde aus<br />
gesehen. Die Erde <strong>als</strong>o dreht sich mit den<br />
ihr anliegenden Elementen in täglicher Bewegung<br />
einmal ganz um ihre unveränderlichen<br />
Pole. Dabei bleibt der Fixsternhimmel<br />
unbeweglich <strong>als</strong> äußerster Himmel. /<br />
Sechster Satz: Alles, was uns bei der Sonne<br />
an Bewegung sichtbar wird, entsteht nicht<br />
durch sie selbst, sondern durch die Erde<br />
und unseren Bahnkreis, mit dem wir uns<br />
um die Sonne drehen, wie jeder andere Planet.<br />
Und so wird die Erde von mehrfachen<br />
Bewegungen dahin getragen. / Siebenter<br />
Satz: Was bei den Wandelsternen <strong>als</strong> Rückgang<br />
oder Vorrücken erscheint, ist nicht von<br />
sich aus so, sondern von der Erde aus gesehen.<br />
Ihre Bewegung allein genügt <strong>als</strong>o für<br />
so viele verschiedenartige Erscheinungen<br />
am Himmel. Nicht von sich aus so - das ist<br />
die Formel für die Zurückweisung des Augenscheins,<br />
der sinnlichen Täuschung - die<br />
Formel der Relativität.<br />
Nikolaus Kopernikus wurde am 19. Februar<br />
1473 in Thorn (Polen) <strong>als</strong> Sohn einer<br />
vermutlich deutschen Kaufmannsfamilie<br />
geboren. Nach dem frühen Tod seines Vaters<br />
übernahm sein Onkel Lucas Watzenrode<br />
(Bischof von Ermland) seine Erziehung.<br />
Kopernikus studierte in Krakau, Bologna<br />
und Padua Mathematik, Astronomie, aristotelische<br />
Philosophie, lateinische Literatur,<br />
Recht und Medizin. 1495 wird Kopernikus<br />
zum Domherrn beim ermländischen<br />
Kapitel in Frauenburg gewählt. Domherren<br />
waren finanziell gut versorgt und hatten einen<br />
vergleichsweise bescheidenen Kreis an<br />
Pflichten (ihnen oblagen wechselnde Verwaltungsaufgaben,<br />
ein theologisches Studium<br />
und die Erlangung der Priesterweihe<br />
wurden für entbehrlich erachtet). Kopernikus<br />
stand in engem privaten Kontakt mit<br />
dem Astronomen Domenico Novara. Dieser<br />
hegte Zweifel an der Richtigkeit der<br />
ptolemäischen Astronomie und hat sie auch<br />
Kopernikus übermittelt. Die erste Niederschrift<br />
des heliozentrischen Weltsystems<br />
erfolgt in der „Commentariolus“, die spätestens<br />
1514 abgeschlossen war. Erste Arbeiten<br />
an seinem Hauptwerk „De revolutionibus<br />
orbium caelestium“ (Über die Kreisbewegungen<br />
der Himmelskörper) finden um 1516<br />
statt. 1539 kommt der Mathematikprofessor<br />
Joachim Rhetikus nach Frauenburg und<br />
wird Kopernikus‘ Schüler und glühender<br />
Bewunderer. 1540 veröffentlicht Joachim<br />
Rhetikus in Danzig die „Narratio prima“;<br />
hiermit wird die heliozentrische Lehre des<br />
Kopernikus erstmalig der Öffentlichkeit<br />
zugänglich gemacht. Im November 1542 erleidet<br />
Kopernikus einen schweren Schlaganfall,<br />
der zu einer rechtsseitigen Lähmung<br />
führt. Am 24. Mai 1543 stirbt Kopernikus,<br />
wenige Stunden nachdem er das erste gedruckte<br />
Exemplar seines Hauptwerkes in<br />
Händen hält.<br />
Literatur<br />
Kirchhoff, Jochen: Kopernikus. Reinbeck<br />
bei Hamburg (rowohlt) 1996<br />
96
Juliusz Zarębski –<br />
ein Kosmopolit im Schatten Chopins<br />
von Jorma Daniel LünenbÜRger<br />
Unter den polnischen Komponisten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts<br />
nimmt Juliusz Zarębski (1854-1885) eine besondere Stellung ein: <strong>als</strong> Klaviervirtuose<br />
steht er ganz in der Tradition von Chopin und Liszt, weist aber <strong>als</strong> Komponist<br />
in den wenigen Werken, die er vor seinem frühen Tod vollenden konnte,<br />
weit über seine Zeit hinaus.<br />
Es ist ein häufig wiederkehrendes Phänomen,<br />
dass besonders begnadeten Musikern<br />
nur eine kurze Lebensspanne beschieden<br />
ist. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)<br />
und Franz Schubert (1797-1828) sind hierfür<br />
nur die berühmtesten, keineswegs aber die<br />
einzigen Beispiele. Auch Fryderyk Chopin<br />
(1810-1849), der bis heute bekannteste polnische<br />
Komponist, hatte eine kaum längere<br />
Lebensspanne. Diesen drei Musikern war<br />
es aber vergönnt, in musikalischen Metropolen<br />
aufzuwachsen und auf einem geradlinigen<br />
Weg die Erfolge zu erringen. Juliusz<br />
Zarębskis kurzer Lebensweg, der in Schitomir<br />
begann und endete, zeichnete sich dagegen<br />
durch viele Umwege aus.<br />
Schon bei der ersten Beschäftigung mit<br />
dem Thema hat man es unweigerlich mit einer<br />
Gemengelage aus verschiedenen Eigennamen<br />
zu tun, die die Wirren der Geschichte<br />
widerspiegeln. Einerseits hat Schitomir,<br />
die zwischen Kiew und Lemberg gelegene<br />
Hauptstadt der Provinz Wolynien, mehrere<br />
Namensvarianten. Als Żytomierz war die<br />
Stadt Teil des polnischen Königreiches und<br />
fiel 1793 bei der zweiten polnischen Teilung<br />
an Russland, heute nennt sie sich auf ukrainisch<br />
Žytomyr. Auch die französischen<br />
Formen Jitomir und Gitomir wurden verwendet.<br />
Andererseits benutzte auch Juliusz<br />
Zarębskis verschiedene Namensformen.<br />
Auf französisch nannte er sich Jules (de) Zarembski,<br />
und vereinzelt ist auch die deutsche<br />
Variante Julius Zaremski überliefert.<br />
„Dieser Zarębski – hol ihn der Teufel!<br />
– ist ein ebenso begabter Pianist wie Komponist!“<br />
Dieser Ausspruch ist von Alexander<br />
Borodin überliefert, nachdem er den<br />
jungen polnischen Musiker bei Franz Liszt<br />
(1811-1886) kennen gelernt hatte. Liszt,<br />
der 1832 bereits das Debüt Chopins in Paris<br />
miterlebt hatte, war seit 1874 der Lehrer<br />
Zarębskis. Der erste Unterricht fand in Rom<br />
statt, später folgte Zarębski seinem Lehrer<br />
nach Weimar und begleitete ihn auch bei<br />
dessen Konzertreisen. Zarębski war einer<br />
der auserwählten Schüler, die mit dem Meister<br />
vierhändig spielen durften. Liszt spielte<br />
eine wichtige Rolle für Zarębski, er war<br />
nicht nur Lehrer, sondern auch eine Vaterfigur<br />
für ihn. In einem Brief an Liszt unterschrieb<br />
Zarębski bereits 1876 mit „ergebenster<br />
Schüler und Freund“.<br />
Die musikalische Ausbildung Zarębskis<br />
hatte allerdings schon in früher Kindheit<br />
begonnen. Den ersten Klavierunterricht<br />
hatte er bei seiner Mutter. Mit der drei Jahre<br />
Portrait in: R. D. Golianek,<br />
J. Zarębski, Kraków 2004<br />
97
älteren Schwester Maria spielte er vierhändig<br />
Klavier und aus dem Jahre 1865 gibt es<br />
die erste Überlieferung eines Konzertes in<br />
seiner Heimatstadt Schitomir. Wenig später<br />
entstanden erste Kompositionen. Ab 1870<br />
studierte Zarębski am Wiener Konservatorium<br />
bei Joseph Dachs, belegte auch das<br />
Fach Komposition bei Franz Krenn und<br />
schloss bereits 1872 ab. Im folgenden Jahr<br />
erwarb er in nur drei Monaten in St. Petersburg<br />
das Diplom eines freien Künstlers.<br />
Seit seiner Ausbildung lebte Zarębski mehr<br />
im Ausland <strong>als</strong> in Polen, das war nicht untypisch<br />
in dieser Zeit. Im Schatten von Liszt<br />
hatte er mit einer regen Konzerttätigkeit<br />
begonnen, die ihn in die wichtigsten Musikstädte<br />
Europas führte. Zarębski hatte<br />
sich <strong>als</strong> Pianist einen Namen gemacht.<br />
Unter den Schülern von Liszt hatte<br />
Zarębski die deutsche Pianistin Johanna<br />
Wenzel kennen gelernt, die aus Schweidnitz<br />
bei Breslau stammte. Er heiratete sie<br />
Anfang 1879 in Schitomir. Es ist symptomatisch<br />
für die Geschichte Polens, dass die<br />
Heimatorte der beiden im 20. Jahrhundert<br />
ihre territoriale Zugehörigkeit verändert<br />
haben. 1879 konzertierte Zarębski in Brüssel<br />
und bekam dort am Konservatorium<br />
eine Professorenstelle angeboten, die er 1880<br />
antrat. Im gleichen Jahr wurde die einzige<br />
Tochter Wanda geboren, die auch Pianistin<br />
werden sollte. Das Leben des Weitgereisten<br />
veränderte sich innerhalb kurzer Zeit. Bei<br />
gemeinsamen Auftritten in Brüssel wurde<br />
das Ehepaar Zarębski vom Publikum gefeiert.<br />
Trotz der äußerlich gefestigten Position<br />
musste Juliusz Zarębski seine Tätigkeiten<br />
einschränken, weil er körperlich<br />
sehr schwach war und die Tuberkulose<br />
fortschritt. So hatte er nie sehr viele Schüler<br />
und komponierte auch nur wenig. Dennoch<br />
entstanden zwischen 1880 und 1885<br />
viele seiner Werke. Im Sommer 1885 reiste<br />
er, von der Krankheit gezeichnet, in seine<br />
Heimatstadt und verstarb dort am 15. September.<br />
Liszt reiste auch in seinen letzten Lebensjahren<br />
noch viel und kam in den<br />
1880er-Jahren dreimal nach Brüssel, wo er<br />
Anteil nahm am Leben seiner ehemaligen<br />
Schüler. „Der edle Charakter von Juliusz<br />
Zarębski und sein großes Künstlertalent<br />
bleiben mir in stetiger Erinnerung“ schrieb<br />
Liszt an dessen Witwe, <strong>als</strong> er die Nachricht<br />
vom Tod seines ehemaligen Schülers erhalten<br />
hatte. Liszt selbst starb ein Jahr später.<br />
Es kann nur Spekulation bleiben, wie sehr<br />
ihn der frühe Tod eines seiner besten Schüler<br />
schmerzte. Zarębskis Ehefrau Johanna,<br />
die nach polnischer Sitte Janina Zarębska<br />
genannt wurde, sollte Brüssel treu bleiben.<br />
Sie bekam dort eine Kammermusikprofessur,<br />
die sie bis 1924 inne hatte, und starb im<br />
Jahr 1928.<br />
Die äußeren Lebensumstände sagen wenig<br />
über den künstlerischen Gehalt eines<br />
Musikers aus, erleichtern jedoch das Verständnis<br />
des Menschen Juliusz Zarębski.<br />
Sein Œuvre ist sehr übersichtlich, weil er<br />
in jungen Jahren vor allem aktiver Pianist<br />
war und dann – <strong>als</strong> er eine feste Anstellung<br />
hatte – krankheitsbedingt zurückstecken<br />
musste. Dennoch hat er deutliche Spuren<br />
hinterlassen, die einen Einblick in sein Leben<br />
geben können. Das Œuvre umfasst<br />
vor allem Klavierwerke, aber auch einige<br />
Liedvertonungen und Kompositionen für<br />
kammermusikalische Besetzungen. In den<br />
Foto: Franz Liszt mit seinen ehemaligen Schülern<br />
Franz Servais, Juliusz und Janina Zarębski,<br />
Brüssel 1881<br />
(Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung)<br />
Skizzen fanden sich auch einige Orchesterbearbeitungen<br />
seiner Klavierwerke, die jedoch<br />
nicht vollendet wurden. Das wohl bekannteste<br />
Werk war die zunächst nur aus<br />
Rezensionen bekannte „Große Fantasie“,<br />
die erst jüngst identifiziert wurde.<br />
98
Zarębski ist natürlich nicht der einzige<br />
polnische Komponist seiner Zeit, manche<br />
sind berühmter <strong>als</strong> er. Chopin hatte ein<br />
weltweites Interesse für die polnische Musik<br />
geweckt. Es war dann das Verdienst von<br />
Stanisław Moniuszko (1819-1872), mit Halka<br />
eine polnische Nationaloper geschaffen<br />
zu haben. Der in Lublin geborene Henryk<br />
Wieniawski (1835-1880) war ein international<br />
gefeierter Geigenvirtuose und <strong>als</strong> komponierender<br />
Pianist machte sich Ignacy Jan<br />
Paderewski (1869-1941) einen Namen. Karol<br />
Szymanowski (1882-1937) war es dann vorbehalten,<br />
den Weg für die bekannten Komponisten<br />
des 20. Jahrhunderts zu bereiten.<br />
Bei Zarębski werden immer wieder seine<br />
Fertigkeiten hervorgehoben, polnische Folklore<br />
in der Kunstmusik neu erklingen zu<br />
lassen. Hier hatte Chopin Pionierarbeit geleistet<br />
mit zahlreichen Polonaisen und Mazurkas,<br />
und hier verstand es Zarębski, neue<br />
originelle Ideen zu entwickeln. So ist die<br />
Franz Liszt gewidmete Grande Polonaise<br />
op. 6 (ca. 1881) eines der berühmtesten Beispiele,<br />
in der die oft orchestrale Behandlung<br />
des Klaviers in einer groß angelegten Form<br />
zu hören ist. Der Einfluss von Liszt wird in<br />
den verschiedenen Farbschattierungen deutlich,<br />
die in Les roses et les épines op. 13 (ca.<br />
1882) erklingen. Zwar hatte Zarębski begonnen,<br />
manche seiner Klavierstücke zu orchestrieren,<br />
eigenständige Orchesterwerke sind<br />
aber nicht vorhanden.<br />
Liszt war auch der Widmungsträger von<br />
Zarębskis letztem und größtem Opus, dem<br />
Klavierquintett op. 34, das 1885 vollendet<br />
wurde. Liszt hörte in Brüssel die Uraufführung<br />
des Werkes am 30. April 1885, wenige<br />
Monate vor dem Tod von Zarębski, der<br />
selbst den Klavierpart spielte. Es gibt zwar<br />
Hinweise, dass Zarębski bereits um 1770 ein<br />
Klavierquintett geschrieben hatte, die Noten<br />
sind aber nie aufgetaucht. Das Quintett<br />
op. 34 für Klavier und Streichquartett hat<br />
eine herausgehobene Stellung im Œuvre von<br />
Zarębski wenn man bedenkt, dass alle anderen<br />
Werke mit Opuszahl nur für Klavier (zu<br />
zwei oder vier Händen) geschrieben worden<br />
sind. Liszt war sehr angetan von dem Werk,<br />
wie der bei der Uraufführung mitwirkende<br />
ungarische Geiger Jenö Hubay zur Erstausgabe<br />
des Werkes 1931 zu berichten wusste.<br />
Das Quintett steht in einer Tradition von<br />
zahlreichen Klavierquintetten in der zweiten<br />
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Nach Schumanns<br />
Quintett op. 47 von 1842 schrieben<br />
u. a. Johannes Brahms (1864), César Franck<br />
(1879) und Antonín Dvořák (1887) Werke<br />
für diese Besetzung. In Zarębskis Quintett<br />
werden seine hohen Fähigkeiten besonders<br />
deutlich. Er verwendet zum einen eine breite<br />
Palette an Klangmöglichkeiten: orchestrale<br />
Klangfülle wechselt mit intimsten<br />
kammermusikalischen Momenten, lyrisch<br />
dahinfließende Melodien werden von rhythmisch-tänzerischen<br />
Episoden unterbrochen.<br />
Zum anderen sind in diesem Werk auch die<br />
harmonischen Mittel wegweisend: Zarębski<br />
verwendet wie selbstverständlich dissonante<br />
Klänge, die nicht aufgelöst werden und so<br />
impressionistische Klangflächen entstehen<br />
lassen. Zarębski ist hier seiner Zeit weit voraus,<br />
man kann nur erahnen, wohin diese<br />
Begabung hätte führen können!<br />
Nachdem das Quintett im Mai 1890 am<br />
Brüsseler Konservatorium mit der Witwe<br />
Zarębskis am Klavier wiederaufgeführt wurde,<br />
war es für ein paar Jahrzehnte vergessen.<br />
„Klavier mit zwei Tastaturen“: Karikatur von Juliusz<br />
Zarębski, (aus: Mucha.Pismo humorystyczne i ilustrowane“,<br />
21 (9) III 1879, S. 2.)<br />
Erst nach der Drucklegung wurde es regelmäßig<br />
gespielt und inzwischen einige Mal<br />
aufgenommen. Das Schicksal dieses Werkes<br />
spiegelt das gesamte Schicksal des Komponisten<br />
wider, durch den frühen Tod geriet<br />
er zunächst in Vergessenheit. Seine Klavierwerke<br />
und das Quintett wurden zwar wieder<br />
gespielt, aber erst in jüngster Gegenwart<br />
bekam er durch die Musikwissenschaftler<br />
Malou Haine (Brüssel) und Ryszard Daniel<br />
Golianek (Poznań) auch die gebührende<br />
Aufmerksamkeit in der Musikforschung.<br />
Dennoch sind bis heute viele Fragen offen.<br />
99
Bezeichnend für Zarębski ist, dass er<br />
immer wieder versuchte, die Grenzen der<br />
Konventionen zu erweitern. Das betrifft<br />
ihn nicht nur <strong>als</strong> Komponisten, sondern<br />
auch <strong>als</strong> Klavierinterpreten. Als er 1878<br />
nach Paris kam, traf er neben Charles Gounod<br />
auch die Brüder Mangeot, die einen<br />
Flügel mit zwei Tastaturen entwickelt hatten.<br />
Die zweite Tastatur war seitenverkehrt<br />
und erweiterte dadurch die Möglichkeiten<br />
des Pianisten, erforderte aber zugleich<br />
auch eine erhebliche Umstellung. Zarębski<br />
sprach von der „Emanzipation der beiden<br />
Hände und Erweiterung ihres musikalischen<br />
Bereichs.“ Auf der Pariser Weltausstellung<br />
1878 trat Zarębski mit dem Mangeot-Klavier<br />
auf. Dass das Instrument nur<br />
eine Randnotiz der Musikgeschichte blieb,<br />
hängt vor allem damit zusammen, dass es<br />
ein Einzelstück war und bei den Konzerten<br />
in Paris und London und in anderen Städten<br />
ein erheblicher Transportaufwand notwendig<br />
war.<br />
„Chopin est mort – vive Zarębski!“<br />
schrieb man in Paris um 1880. Schon fünf<br />
Jahre später hatte sich das Bild gewandelt.<br />
Während Chopin sich <strong>als</strong> Synonym für<br />
die polnische Musik im 19. Jahrhundert<br />
ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat,<br />
steht Zarębski bis heute in seinem Schatten.<br />
Dieser Schatten hat aber inzwischen<br />
an Schwärze verloren und vieles ist schon<br />
erkennbar. Juliusz Zarębski war ein Weltenbummler,<br />
ein Kosmopolit. Der Radius<br />
seines Wirkens reichte von St. Petersburg<br />
und Kiew nach Rom und Paris, von Warschau<br />
und Wien nach Berlin und Brüssel.<br />
Zarębski hat uns eindrucksvolle Zeugnisse<br />
seiner Musikalität hinterlassen, durch seine<br />
Krankheit konnte er aber nur einen Bruchteil<br />
seiner Ideen umsetzen. Neben allen<br />
seinen musikalischen Verdiensten lohnt es<br />
sich, auch einmal die europäische Dimension<br />
seines Lebens in Betracht zu ziehen.<br />
Literatur<br />
Chechlińska, Zofia. Artikel „Zarębski, Juliusz.”<br />
The New Grove Dictionary of Music<br />
and Musicians. Vol. 27, hg. V. Stanley Sadie,<br />
London 22001, S. 749.<br />
Golianek, Ryszard Daniel. Dzieła musyczne<br />
Juliusza Zarębskiego. Chronologiczny<br />
katalog tematyczny. The musical works of<br />
Juliusz Zarębski. Chronological thematic<br />
catalogue. Poznań 2002.<br />
Golianek, Ryszard Daniel. „Three Previously<br />
Unknown Musical Pieces by Juliusz<br />
Zarębski.” Ad Parnassum. A Journal<br />
of Eighteenth- and Nineteenth-Century<br />
Instrumental Music, 2003, I (2), S. 111-120.<br />
Golianek, Ryszard Daniel. „Die Handschriften<br />
der Kompositionen Jules Zarembskis<br />
im Goethe- und Schiller-Archiv<br />
in Weimar.“ Die Musikforschung, 2004<br />
(2), S. 53-60.<br />
Golianek, Ryszard Daniel. Juliusz Zarębski.<br />
Człowiek - muzyka - kultura. Kraków<br />
2004.<br />
Haine, Malou. „Un élève particulièrement<br />
doué de Franz Liszt: Jules Zarembski.“ Liszt<br />
Saeculum, 1997, 58 (1), S. 3-12.<br />
Haine, Malou. „Dix-neuf lettres de la correspondance<br />
entre Liszt et les époux Zarembski.“<br />
Liszt Saeculum, 1997, 58 (1), S. 13-26.<br />
Ochlewski, Tadeusz (Hg.). Geschichte der<br />
polnischen Musik. Warschau 1988.<br />
Szalkowska, Beata und Couvreur, Manuel.<br />
„Bruxelles et la musique polonaise (1875-<br />
1925).“ Ausstellungskatalog „Art nouveau<br />
polonais. Bruxelles-Cracovie. 1890-1920.“<br />
Conception: Paul Aron, Crédit Communal<br />
de Belgique, Bruxelles 1997, S. 113-132.<br />
Strumiłło, Tadeusz. Juliusz Zarębski.<br />
Kraków 21985.<br />
100
Janusz Korczak – der polnische Pestalozzi<br />
von Koralia Sekler<br />
Die Entdeckung des Kindes, seiner Rolle in der Gesellschaft, durch Janusz<br />
Korczak ist in die Geschichte der Pädagogik und Heilerziehung eingegangen.<br />
Zum ersten Mal sprach ein Erzieher nicht von einem zu erziehenden Kind, sondern<br />
von einem Menschen, der sich an dem Erziehungsprozess gleichberechtigt<br />
beteiligt.<br />
Henryk Goldszmit, bekannt <strong>als</strong> Janusz<br />
Korczak, wurde am 22. Juli 1878 oder 1879<br />
in Warschau geboren. Die Ursache für die<br />
Unklarheit bzgl. des Geburtsdatums ist das<br />
Versäumnis seines Vaters, der <strong>als</strong> Rechtsanwalt<br />
die Geburt seines Sohnes nicht rechtzeitig<br />
gemeldet hat. Aus diesem Grund existiert<br />
keine Geburtsurkunde. 1890 starb<br />
Henryks Vater – Józef Goldszmit.<br />
Janusz Korczak <strong>als</strong> Arzt<br />
In den Jahren 1898 – 1905 studierte er an<br />
der medizinischen Fakultät der Universität<br />
Warschau. Ab 1903 bis 1911 arbeitete Korczak<br />
<strong>als</strong> Kinderarzt im Bauman-Berson-Kinderkrankenhaus<br />
in Warschau. Zusätzlich<br />
bildete er sich in Medizin im Ausland (in<br />
Berlin, Paris und London) fort. 1904/1905<br />
arbeitete er <strong>als</strong> Lazarettarzt im russisch-japanischen<br />
Krieg.<br />
1911 gab Korczak seine Arztpraxis, die er<br />
parallel zu seiner Tätigkeit im Krankenhaus<br />
führte, auf. Von 1914 bis 1918 war er <strong>als</strong> Militärarzt<br />
im Ersten Weltkrieg tätig. In dieser<br />
Zeit entstand das Werk „Wie man ein Kind<br />
lieben soll?“<br />
1919/1920 übernahm er im polnisch-bolschewistischen<br />
Krieg medizinische Tätigkeiten<br />
in epidemiologischen Militärkrankenhäusern<br />
und steckte sich mit Typhus an.<br />
Während seiner Pflege starb Korczaks Mutter<br />
an der gleichen Erkrankung (1920).<br />
Korczak <strong>als</strong> Publizist und Redakteur<br />
Seine erste Publikation „Der gordische<br />
Knoten“ veröffentlichte er <strong>als</strong> Gymnasiast<br />
im Jahre 1896. 1899 erstellte er die erste literarische<br />
Arbeit unter dem Pseudonym Janusz<br />
Korczak. Es schrieb sowohl Kinderbücher<br />
wie „Der Bankrott des kleinen Jack“ (1926)<br />
und „Lustige Pädagogik. Meine Ferien. Radioplaudereien<br />
des alten Doktors“ (1939) <strong>als</strong><br />
auch zahlreiche pädagogische Werke über<br />
die Entwicklung und Erziehung von Kindern:<br />
“Kinder der Straße“ (1901), „Kind des<br />
Salons“ (1906), „Wie man ein Kind lieben<br />
soll?“ (1920-1921), „Das Recht des Kindes<br />
auf Achtung“ (1929).<br />
Gleichzeitig veröffentlichte er viele Zeitungsartikel<br />
und moderierte Kinder- und<br />
Pädagogiksendungen im Radio (1931 - 1939<br />
„Radioplaudereien des alten Doktors“). Am<br />
9. Oktober 1926 gründete Korczak die „Kleine<br />
Rundschau“, die er bis 1931 in Zusammenarbeit<br />
mit Kindern <strong>als</strong> Beilage zu der<br />
polnisch-jüdischen Zeitung „Unsere Rundschau“<br />
erstellte. 1942 entstanden die „Get-<br />
Janusz Korczak<br />
Arzt, Pädagoge, Publizist<br />
101
totagebücher“, in denen Korczak u.a. seine<br />
letzten Tage beschrieb.<br />
Janusz Korczak <strong>als</strong> „Vater“ der Waisen<br />
Im Sommer 1899 (oder 1901) fuhr er in<br />
die Schweiz, um die Arbeit von Pestalozzi<br />
besser kennen zu lernen. Vor allem interessierten<br />
ihn Schulen, Krankenhäuser, Wohlfahrtsinstitutionen,<br />
aber auch praktische<br />
Ideen für didaktische Mittel.<br />
Im Jahre 1908 wurde Korczak zum Mitglied<br />
einer Hilfsgesellschaft für Waise und<br />
fing mit dem Bau des jüdischen Waisenhauses<br />
(Dom Sierot) in der Krochmalna-<br />
Straße in Warschau an.<br />
Janusz Korczak mit den Waisenkindern<br />
Am 7. Oktober 1912 zog er mit „seinen<br />
Waisenkindern“ dorthin und übernahm<br />
unentgeltlich die Leitungsfunktion des<br />
Hauses.<br />
1919 eröffnete er zusammen mit Maryna<br />
F<strong>als</strong>ka (Leiterin) das Waisenhaus „Nasz<br />
Dom“ (Unser Haus) für polnische Kinder.<br />
Das jüdische Kinderhaus „Dom Sierot“<br />
wurde im Jahre 1940 ins Warschauer Ghetto<br />
zwangsverlegt.<br />
Am 5. oder 6. August 1942 wurde dieses<br />
Waisenhaus liquidiert und seine Bewohner<br />
(das Personal, ca. 200 Kinder und Janusz<br />
Korczak) höchstwahrscheinlich nach Treblinka<br />
deportiert und dort ermordet. Der<br />
Marsch vom Ghetto zum Umschlagplatz<br />
wurde zu einem oft in der Kunst und Literatur<br />
dargestellten Motiv bis hin zu einem<br />
Mythos.<br />
Leitgedanken der Pädagogik Korczaks<br />
Im Zentrum der Pädagogik von Korczak<br />
steht das Kind, das seit seiner Geburt<br />
<strong>als</strong> Mensch gesehen wird und nicht nach<br />
bestimmten Zielen Anderer erst zu einem<br />
Menschen erzogen wird.<br />
„Einer der schlimmsten Fehler besteht<br />
darin anzunehmen, daß die Pädagogik<br />
eine Lehre über das Kind und nicht eine<br />
Lehre über den Menschen sei.“<br />
(Janusz Korczak 1972, 45)<br />
In der gesamten Arbeit von Janusz Korczak<br />
(<strong>als</strong> Arzt, Schriftsteller und Waisenhausleiter)<br />
wird der Glaube an das Kind,<br />
seine Fähigkeiten, Autonomie und seine<br />
Anstrengungen, immer besser zu sein,<br />
stark vertreten. Korczak fördert und fordert<br />
die Emanzipation aller Kinder. Er kritisiert<br />
eine „f<strong>als</strong>che“ unbewusste Erziehung,<br />
bei der die Erwachsenen ihre körperliche,<br />
geistige und materielle Überlegenheit nur<br />
dazu ausnutzen, um die Kinder ihren Zielen,<br />
Plänen, ihrem Snobismus, ihren Komplexen<br />
und sogar ihren Trieben gefügig zu<br />
machen. Dieser Art von Erziehung stellt<br />
Korczak seine natürliche nicht von vornherein<br />
von einem engen Ziel bestimmte Erziehung<br />
gegenüber.<br />
Die „Entdeckung des Kindes“ und seiner<br />
Rechte (das Recht des Kindes auf seinen<br />
Tod, das Recht des Kindes auf den heutigen<br />
Tag und das Recht des Kindes so zu sein,<br />
wie es ist) durch Korczak liefern folgende,<br />
von mir ausgewählte, Grundsätze:<br />
– Förderung individueller Bedürfnisse der<br />
Kinder (weniger zukunftsorientiert – eher<br />
im „Hier und Jetzt“),<br />
– freie Entfaltungsmöglichkeiten (aber<br />
abhängig von sozialen Gegebenheiten),<br />
102
– Abbau eines Kindheitside<strong>als</strong> (jedes Kind<br />
ist ein Individuum), d.h. Recht des Kindes<br />
auf „Mittelmäßigkeit“,<br />
– Gleichberechtigung der Kinder gegenüber<br />
den Erwachsenen (sowohl innerhalb der<br />
Familie <strong>als</strong> auch in Einrichtungen),<br />
– Förderung der Selbstentfaltung , Selbstständigkeit<br />
und Selbstverwaltung,<br />
– Zubilligung altersgemäßer Rechte und<br />
Pflichten,<br />
– Förderung des Rechts der Kinder auf autonome<br />
Regierung und Verwaltung in Form<br />
von eigenem Kollegialgericht.<br />
In dem von Korczak eingeführten Gericht<br />
hatten die Kinder die Möglichkeit<br />
einer Kommunikationsentwicklung und<br />
öffentlicher Problemdarstellung. Das Gericht<br />
richtete auch über die Erzieher und Janusz<br />
Korczak, was eine hohe erzieherische<br />
Bedeutung für die Kinder hatte und ihre<br />
Stellung (<strong>als</strong> gleichberechtigter Partner) im<br />
Erziehungsprozess veränderte. Die Richterfunktionen<br />
übten die Kinder aus.<br />
Damit hatte Korczak vor, die Abhängigkeit<br />
der Kinder von ihren Erziehern zu reduzieren,<br />
klare Regeln für alle einzuführen,<br />
beim Kind das Interesse für sein Verhalten<br />
zu wecken und gleichzeitig sein Reflexionsvermögen<br />
und Eigenverantwortung zu fördern.<br />
Wie soll ein Erzieher nach Korczaks<br />
Grundsätzen arbeiten?<br />
Die Erziehung, so Korczak, soll vom<br />
Kind ausgehen. Mitgefühl und einfühlendes<br />
Verstehen sind die Voraussetzungen<br />
erzieherischen Handelns. Korczak warnt<br />
alle Pädagogen vor der allgemeinen Generalisierung<br />
der Kinder. Es gibt keine Kinder<br />
im Allgemeinen, sondern jedes Kind ist ein<br />
Individuum (genau wie jeder Erwachsene).<br />
Demzufolge soll in einem Erziehungsprozess<br />
jedes Kind individuell betrachtet und<br />
erzogen werden. Die Kinder werden nicht<br />
zu Menschen gemacht, sie sind Menschen!<br />
praktische Arbeit mit Kindern ist nach Korczak<br />
von der pädagogischen Theorie weit<br />
entfernt. Darum muss jeder Pädagoge wachsam<br />
erziehen, da er währenddessen selbst<br />
von dem Kind erzogen wird. Das Aneignen<br />
von zahlreichen theoretischen Ansätzen<br />
reicht leider nicht aus, um Kinder adäquat<br />
zu fördern. In Beziehungen zu ihnen sind<br />
vielmehr Empathie, Fähigkeit, von Kindern<br />
zu lernen und ihre Signale rechtzeitig aber<br />
auch entsprechend zu deuten, unabdingbar.<br />
Der Erzieher ist ein sorgfältiger und gewissenhafter<br />
Beobachter des Kindes. Diese Beobachtungen<br />
sollen schriftlich festgehalten<br />
und anschließend reflektiert werden, um sie<br />
während der Förderung optimal nutzen zu<br />
können.<br />
Der Erzieher soll einerseits Freiräume<br />
zum Experimentieren und für die weitere<br />
Entfaltung jedes einzelnen Kindes schaffen<br />
und andererseits in der Lage sein, bei Gefahren<br />
einzugreifen und entsprechend zu<br />
handeln (auch Grenzen setzen).<br />
Korczaks pädagogische Grundgedanken<br />
sind, trotz der fast hundert Jahre, weiterhin<br />
aktuell und werden in vielen erziehungswissenschaftlichen<br />
Arbeiten <strong>als</strong> revolutionär<br />
und reformierend bezeichnet. Janusz Korczak<br />
hat zum ersten Mal in der Geschichte der<br />
Pädagogik das Kind <strong>als</strong> gleichberechtigten<br />
Partner gesehen und nach diesem Prinzip<br />
gelebt.<br />
Er behielt bis zum Schluss seines Lebens<br />
die Fähigkeit, wie eins „seiner“ Waisenkinder<br />
zu fühlen, zu denken und zu handeln.<br />
Diesen Kindern blieb er bis zum Tode<br />
treu.<br />
Zwischen dem Pädagogen und dem Kind<br />
soll eine dialogische Beziehung aufgebaut<br />
werden, die aus gegenseitigem Respekt besteht<br />
und in Form von gleichberechtigter<br />
Partnerschaft geführt wird. Die tatsächliche<br />
103
Henryk Goldszmit, znany jako Janusz<br />
Korczak, urodził się 22 lipca 1878 lub 1879<br />
roku w Warszawie. Przyczyną niejasności<br />
jego urodzin jest zaniedbanie przez ojca,<br />
który jako adwokat, nie zgłosił na czas narodzin<br />
swego syna. Z tego powodu nie istnieje<br />
metryka jego urodzenia. W 1890 roku<br />
zmarł Henryka ojciec – Józef Goldszmit.<br />
Janusz Korczak jako lekarz<br />
W latach 1898 – 1905 studiował na wydziale<br />
medycznym Warszawskiego Uniwersytetu.<br />
Od 1903 do 1911 roku pracował<br />
jako pediatra w szpitalu dzecięcym im. Baumana<br />
i Bersona w Warszawie. Dodatkowo<br />
dokształcał się w medycynie za granicą<br />
(w Berlinie, Paryżu i Londynie). W latach<br />
1904/1905 pracował jako lekarz w szpitalu<br />
wojskowym podczas rosyjsko-japońskiej<br />
wojny. W roku 1911 zamknął swój gabinet lekarski,<br />
który prowadził równocześnie z pracą<br />
w szpitalu. Od 1914 do 1918 roku - podczas<br />
pierwszej wojny światowej - był lekarzem<br />
wojskowym. W tym czasie powstało dzieło<br />
„Jak kochać dziecko?” W latach 1919/1920<br />
przejął podczas polsko-bolszewickiej wojny<br />
medyczne funkcje w epidemiologicznych<br />
wojskowych szpitalach i zaraził się tyfusem.<br />
Podczas jego pielęgnacji zmarła matka<br />
Korczaka, która zaraziła się od niego tą<br />
samą chorobą (rok 1920).<br />
Janusz Korczak jako publicysta i redaktor<br />
Jego pierwszą publikację „Gordyjski<br />
węzeł” wydał jako gimnazjalista w roku<br />
1896. W 1899 roku napisał pierwszą literacką<br />
pracę pod pseudonimem Janusz Korczak.<br />
Pisał książki dziecięce, takie jak: „Bankructwo<br />
małego Dżeka” (1926), „Pedagogika<br />
żartobliwa. Moje wakacje. Gadaninki radiowe<br />
Starego Doktora” (1939) i wiele pedagogicznych<br />
prac o rozwoju i wychowaniu dzieci:<br />
„Dzieci ulicy” (1901), „Dziecko salonu”<br />
(1906), „Jak kochać dziecko?” (1920-1921),<br />
„Prawo dziecka do szacunku” (1929).<br />
Jednocześnie opublikował wiele<br />
artykułów do gazet i prowadził w radiu programy<br />
dziecięce i pedagogiczne (w latach<br />
1931-1939 „Gadaninki radiowe Starego Doktora”).<br />
9 października 1926 roku utworzył<br />
„Mały Przegląd”, który redagował do roku<br />
1931 wraz z dziećmi jako dodatek do polsko-żydowskiej<br />
gazety „Nasz Przegląd”. W<br />
1942 roku powstały „Pamiętniki w getcie”,<br />
w których Korczak opisuje, miedzy innymi,<br />
swoje ostatnie dni.<br />
Janucz Korczak jako „ojciec” sierot<br />
Latem 1899 (oder 1901) roku wyjechał do<br />
Szwajcarii, aby lepiej poznać działalność Pestalozziego.<br />
Przede wszystkim interesowały<br />
go szkoły, szpitale, instytucje dobroczynne,<br />
ale także praktyczne pomysły pomocy naukowych.<br />
W roku 1908 Korczak został członkiem<br />
Stowarzyszenia Pomocy Sierotom i rozpoczął<br />
budowę żydowskiego Domu Sierot przy ulicy<br />
Krochmalnej w Warszawie. 7 października<br />
1912 przeprowadził się tam ze „swoimi sierotami”<br />
i objął funkcję dyrektora bez wynagrodzenia.<br />
W roku 1919 otworzył wraz z<br />
Maryną F<strong>als</strong>ką (dyrektorką) dom sierot dla<br />
polskich dzieci (Nasz Dom). Zydowski dom<br />
dziecka został w roku 1940 zmuszony do<br />
przeprowadzki do warszawskiego getta. 5 lub<br />
6 sierpnia 1942 roku zlikwidowano żydowski<br />
Dom Sierot, a jego mieszkańców (personal,<br />
około 200 dzieci i Janusza Korczaka) deportowano<br />
najprawdopodobniej do Treblinki,<br />
gdzie zostali zamordowani. Marsz z getta do<br />
Umschlagplatz stał się bardzo często przedstawianym<br />
motywem w sztuce i literaturze a<br />
zarazem mitem.<br />
104
Literatur<br />
BARCZEWSKA, L./MILEWICZ, B.<br />
(Hrsg.), 1981: Wspomnienia o Januszu Korczaku.<br />
Warszawa: Nasza Księgarnia<br />
BIEWEND, E., 1974: Liebe ohne Illusionen.<br />
Leben und Werk des Janusz Korczak.<br />
Heilbronn.<br />
KLEIN, F., 1996: Janusz Korczak. Sein Leben<br />
für Kinder. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.<br />
KUNZ, L. (Hrsg.), 1994: Einführung in die<br />
Korczak- Pädagogik. Weinheim und Basel:<br />
Beltz Grüne Reihe.<br />
KORCZAK, J., 1967: Wie man ein Kind lieben<br />
soll. Göttingen.<br />
KORCZAK, J., 1972: Janusz Korczak: die<br />
Verantwortung des Pädagogen; Erinnerungen<br />
der Mitarbeiter; Tagebuch im Ghetto.<br />
1.Aufl. Düsseldorf: Rochus<br />
KORCZAK, J., 2001: Von Kindern und anderen<br />
Vorbildern. Gütersloh: GTB.<br />
KORCZAK, J., 2001: Verteidigt die Kinder!<br />
Gütersloh: GTB.<br />
KORCZAK, J., 2001: Das Recht des Kindes<br />
auf Achtung. Gütersloh: GTB.<br />
LIFTON, B., 1990: Der König der Kinder.<br />
Das Leben von Janusz Korczak. Stuttgart:<br />
Klett- Cotta.<br />
RADTKE, U., 2000: Janusz Korczak <strong>als</strong><br />
Pädagoge. Zum Recht des Kindes auf Achtung.<br />
Marburg.<br />
SCHONIG, B., 1999: Auf dem Weg zu einer<br />
eigenen Pädagogik. Annäherungen an<br />
Janusz Korczak. Hohengehren: Schneider<br />
Verlag.<br />
105
Marie Sklodowska-Curie<br />
Ein Leben für die Wissenschaft<br />
von Melitta Naumann-Godó<br />
Paris am Nachmittag des 20. April 1995,<br />
einem Donnerstag. Am Panthéon sowie<br />
entlang der Rue Soufflot und ihrer Nachbarstraßen<br />
sammelte sich bei schönem Wetter<br />
eine beträchtliche Menschenmenge. An<br />
zwei Seiten des Platzes waren große Tribünen<br />
aufgestellt. Eine riesige Trikolore zierte<br />
in ganzer Breite das Säulenportal des neoklassizistischen<br />
Gebäudes, dessen Krypta<br />
seit der französischen Revolution Gedächtnis-<br />
und letzte Ruhestätte von berühmten<br />
Franzosen ist, denen die Nation ihren Respekt<br />
erweist. Unter der großen Kuppel<br />
prangt die Inschrift: „Den großen Männern,<br />
ihr dankbares Vaterland.“<br />
Es war der Wunsch des Staatspräsidenten<br />
Francois Mitterrand, dass in den letzten Tagen<br />
seiner Amtszeit die Gebeine von Marie<br />
und Pierre Curie in das Panthéon überführt<br />
würden. Ihn begleiteten der polnische Präsident<br />
Lech Walesa, der französische Premierminister<br />
und Verwandte der beiden großen<br />
Wissenschaftler, die sich um eine grauhaarige<br />
Dame, die jüngste Tochter Ève, gruppierten.<br />
Hier ein Auszug aus Mitterrands Rede:<br />
„Indem wir die sterblichen Überreste von Pierre<br />
und Marie Curie in das Heiligtum unseres<br />
kollektiven Gedächtnisses überführen,<br />
vollzieht Frankreich nicht nur ein Werk der<br />
Anerkennung; es bekräftigt damit auch seinen<br />
Glauben an die Wissenschaft und seinen<br />
Respekt vor jenen, die wie Pierre und Marie<br />
Curie ihre Kraft und ihr Leben der Forschung<br />
widmen. Diese Zeremonie heute ist allerdings<br />
insofern gänzlich ungewöhnlich, <strong>als</strong> erstm<strong>als</strong><br />
in unserer Geschichte eine Frau zu Ehren ihrer<br />
besonderen Verdienste in das Panthéon<br />
eingeht. “<br />
Eine zielstrebige junge Frau<br />
Maria Salomee Sklodowska wurde am 7.<br />
November 1867 in Warschau geboren. Ihr<br />
Kosename in der Familie war Mania. Die<br />
Stadt und das ganze so genannte Kongress-<br />
Polen litten in jener Zeit unter russischer<br />
Herrschaft. Gerade deshalb blieben die Nationalgefühle<br />
der Bevölkerung nach wie vor<br />
überaus lebendig. Marias Eltern, Wladyslaw<br />
Sklodowski und Bronislawa Boguska,<br />
stammten beide aus verarmten Landadel.<br />
Beide Familien litten sehr unter den Repressionen,<br />
die den verschiedenen antizaristischen<br />
Revolten zwischen 1830 und 1863<br />
folgten. Schon Maries Großeltern gehörten<br />
Kreisen der Intelligenz an, die sich die nationale<br />
Befreiung zum Ziel gesetzt hatten<br />
und deshalb die kulturelle Identität ihres<br />
Volkes durch schulische Bildung zu erhalten<br />
suchten. So wurde allen Kindern der Familie<br />
– auch den vier Töchtern – trotz des frühen<br />
Tuberkulosetods der Mutter eine sehr<br />
gute Ausbildung zuteil.<br />
Da Frauen im zaristischen Polen der Zugang<br />
zur Hochschule verwehrt blieb, schlossen<br />
Maria und ihre ältere Schwester Bronia<br />
einen Pakt: Maria nahm eine Stelle <strong>als</strong> Gouvernante<br />
an, um der Schwester ein Medizinstudium<br />
in Paris zu finanzieren, und Bron-<br />
106
ia sollte nach ihrer Approbation wiederum<br />
ihr zum Studium zu verhelfen. So geschah<br />
es. sechs Jahre lang arbeitete sie <strong>als</strong> Gouvernante<br />
und Hauslehrerin bei reichen polnischen<br />
Familien und hegte währenddessen<br />
Kontakte zur illegalen Fliegenden Universität,<br />
ehe sie zu ihrer Schwester nach Paris an<br />
die Sorbonne in die akademische und geistige<br />
Freiheit durfte.<br />
Trotz der knappen Mittel, der Kälte im<br />
Winter und des häufigen Hungerns hielt<br />
Marie in der Rückschau „diese Jahre der<br />
Einsamkeit, die nur dem Studium gewidmet<br />
waren“, mit für die besten ihres Lebens.<br />
Ihrem Bruder schrieb sie: „Man muss einfach<br />
an seine Begabung glauben und sich<br />
zum Ziel setzen, diese Begabung auch zu<br />
entfalten“. Bei der Abschlussprüfung für<br />
das Lizenziat in Physik, im Frühsommer<br />
1893, war sie die Beste. Sie erhielt daraufhin<br />
ein Stipendium der Alexandrinowitsch-<br />
Stiftung. Mit den 600 Rubeln konnte sie<br />
einen entsprechenden Abschluss in Mathematik<br />
anstreben; sie erwarb dieses Lizenziat<br />
im Juli 1894 <strong>als</strong> Zweitbeste und - bislang<br />
einmalig in der Geschichte der Stiftung -<br />
zahlte später die ganze Summe der Stiftung<br />
wieder zurück.<br />
Arbeiten und Leben Seite an Seite mit<br />
Pierre Curie<br />
„Pierre“, so schrieb Marie später, „begegnete<br />
mir mit einer einfachen und aufrichtigen<br />
Sympathie für mein arbeitsreiches<br />
Leben“. Es dauerte nicht lange bis er sie<br />
bat, sein Leben mit ihm zu teilen – doch<br />
Marie zögerte: Die Entscheidung für den<br />
Franzosen hätte die endgültige Trennung<br />
nicht nur von ihrem Vater bedeutet, der auf<br />
ihre Rückkehr hoffte, sondern auch von ihrem<br />
Heimatland, in dessen Dienst sie ihr<br />
mühsam erworbenes Wissen zu stellen gedachte.<br />
Nach Ende des Semesters machte sie mit<br />
ihrem Vater einige Wochen Urlaub. Pierre<br />
beschwor sie nach Paris zurückzukommen<br />
– aus Angst sie zu verlieren. Während der<br />
nächsten Monate nach ihrer Rückkehr vermochte<br />
er schließlich sie gänzlich für sich<br />
zu gewinnen. Die Trauung fand am 26. Juli<br />
1895 im Rathaus von Sceaux statt. Das junge<br />
Paar – mit weiterhin schmalem Budget<br />
– bezog eine kleine Wohnung in der Nähe<br />
der Städtischen Schule für Industrielle Physik<br />
und Chemie, an der Pierre Oberassistent<br />
war. Der Direktor erlaubte ihr sogar, an der<br />
Seite ihres Mannes im Labor zu arbeiten<br />
(was für die damalige Zeit höchst außergewöhnlich<br />
war).<br />
Marie wie auch Pierres Neugier war<br />
durch ein merkwürdiges Phänomen geweckt<br />
worden, das im Vorjahr der Physiker<br />
Henri Becquerel entdeckt hatte: Radioaktivität,<br />
das Aussenden einer unsichtbaren<br />
durchdringenden Strahlung von Uransalzen.<br />
Eben die Erforschung dieser Strahlen<br />
wählte Marie <strong>als</strong> Thema ihrer Doktorarbeit.<br />
Nach einigen Referenzmessungen am<br />
Uran begann Marie Curie, systematisch<br />
andere Substanzen daraufhin zu untersuchen,<br />
ob auch sie die bemerkenswerte Eigenschaft<br />
aufweisen, spontan unsichtbare<br />
Strahlung zu emittieren. Sie prüfte unzählige<br />
Metalle, Salze und Oxide, sowie natürliche<br />
Minerale. Dabei vermerkte sie in ihren<br />
Aufzeichnungen: „Zwei Uranminerale,<br />
die Pechblende und das Torbenit sind viel<br />
aktiver <strong>als</strong> das Uran selbst. Das ist bemerkenswert<br />
und lässt einen glauben, diese Minerale<br />
könnten ein Element enthalten, das<br />
sehr viel aktiver ist <strong>als</strong> das Uran.“ Angesichts<br />
dieser vielversprechenden Vermutung<br />
gab Pierre Curie seine eigenen Forschungen<br />
gänzlich auf und fahndete zusammen mit<br />
Marie in Pechblende nach der hypothetischen<br />
neuen Substanz. Dieses Vorhaben<br />
war allerdings schwieriger, <strong>als</strong> das junge<br />
Paar zunächst angenommen hatte, denn der<br />
Massenanteil des gesuchten Elements am<br />
Ausgangsmaterial war geringer <strong>als</strong> eins zu<br />
eine Million. Doch schon wenige Monate<br />
später verkündeten die Curies ihre Entdeckung<br />
in einem Bericht der Akademie der<br />
Wissenschaften, sowie zeitgleich in der pol-<br />
107
nischen Zeitschrift „Swiatlo“: „Wir sind der<br />
Meinung, dass die Substanz, die wir aus der<br />
Pechblende gewonnen haben, ein noch nicht<br />
beschriebenes Metall enthält. Bestätigt sich<br />
das Vorhandensein dieses neuen Metalls,<br />
schlagen wir vor, es nach der Herkunft eines<br />
der Autoren Polonium zu nennen.“ Inzwischen<br />
hegten sie den Verdacht, Pechblende<br />
könne sogar noch ein weiteres bis dahin unbekanntes<br />
radioaktives Element enthalten.<br />
Und tatsächlich vermochten sie ein zweites<br />
radioaktives Element nachzuweisen, das nur<br />
in sehr geringer Konzentration darin vorkam<br />
und 900fach so radioaktiv war wie Uran.<br />
Sie bezeichneten es in ihrem gemeinsam geführten<br />
Laborbuch <strong>als</strong> Radium. Trotz der<br />
ermüdenden Trennungsarbeit in ihrem Labor,<br />
das nicht mehr <strong>als</strong> eine Baracke mit geteertem<br />
Boden und Glasdach war, fand Marie<br />
Curie die Muße, folgendes zu notieren:<br />
„Wir hatten besondere Freude daran zu sehen,<br />
dass unsere Radiumkonzentrate spontan<br />
leuchteten. Pierre hatte zwar gehofft,<br />
dass sie sehr schöne Farben haben würden.<br />
Er musste aber zugeben, dass die unerwartete<br />
Erscheinung ihm viel besser gefiel. [...]<br />
Es geschah, dass wir nach dem Abendessen<br />
an unsere Arbeitsstätte zurückkehrten, um<br />
alles noch einmal zu betrachten. [...] Von allen<br />
Seiten gewahrten wir ihre schwach erhellten<br />
Umrisse, und dieses Leuchten, das in<br />
der Dunkelheit zu schweben schien, war für<br />
uns jedes Mal ein neuer Grund für freudige<br />
Gefühle und Zufriedenheit.“ Von den Gefahren<br />
der radioaktiven Strahlung ahnten<br />
Marie und Pierre Curie dam<strong>als</strong> noch nichts.<br />
Beide erlitten verbrennungsähnliche Verletzungen,<br />
<strong>als</strong> sie sich hochaktiven Präparaten<br />
aussetzten, die in einer versiegelten Glasröhre<br />
innerhalb einer dünnen Metallschachtel<br />
waren. Die daraus resultierenden Verbrennungen<br />
und ihre Symptome beschrieben sie<br />
anschließend kaltblütig minutiös in einem<br />
Brief an die Akademie.<br />
Inzwischen interessierten sich auch andere<br />
Physiker und Chemiker in verschiedenen<br />
Ländern für die neuen Elemente und<br />
ihre geheimnisvolle Strahlung rätselhaften<br />
Ursprungs. An der Revolution der Physik<br />
um die Wende zum 20. Jahrhundert hatten<br />
Marie und Pierre Curie wichtigen Anteil:<br />
Für ihre Arbeiten über die Radioaktivität<br />
erhielten sie 1903 einen der ersten Nobelpreise.<br />
Ihr privates Glück aber war nur von<br />
kurzer Dauer. Das Paar hatte zwei Töchter<br />
Irène und Ève, doch erlitt Marie wenige<br />
Monate vor ihrer Nobelpreisverleihung<br />
eine Fehlgeburt, wahrscheinlich infolge der<br />
ständigen Strahlenexposition im Labor. Am<br />
19. April 1906 wurde Pierre Curie von einer<br />
Pferde-Droschke überfahren und war sofort<br />
tot. Marie und ihre Kinder traf die Nachricht<br />
wie ein Schock. Pierre Curie wurde im<br />
engsten Familienkreis auf dem Friedhof in<br />
Sceaux bestattet. Zum ersten und einzigen<br />
Mal in ihrem Leben führte Marie in dieser<br />
Zeit ein Tagebuch, in dem sie ihre eigenen<br />
Gefühle notierte. Ungefähr ein Jahr<br />
lang wandte sie sich in Briefform direkt an<br />
Pierre, um ihre Erinnerung an die letzten<br />
gemeinsam verbrachten Momente und ihre<br />
Gedanken lebendig zu halten. Sie war untröstlich<br />
über den Verlust ihres Mannes und<br />
Gefährten, doch sie schaffte es, sich wieder<br />
aufzuraffen und vergrub sich in Arbeit, um<br />
zu vergessen.<br />
Marie trägt die Fackel weiter<br />
Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes<br />
widmete Marie sich verbissen der Forschung<br />
und Lehre. Sie wollte unbedingt das Gemeinschaftswerk<br />
fortsetzen. Man bot ihr<br />
seine Nachfolge <strong>als</strong> Professor an: die Vorlesungen<br />
und das Laboratorium. Marie nahm<br />
an und hielt im November 1906 <strong>als</strong> erste<br />
Frau eine Vorlesung an der Sorbonne. Bei<br />
der wissenschaftlichen Arbeit, in die sie sich<br />
stürzte, unternahm sie einen neuen Versuch,<br />
Radium abzutrennen und in Reinform zu<br />
gewinnen. Drei Jahre später gelang es ihr<br />
schließlich mit viel Mühe, elementares Radium<br />
zu erhalten.<br />
Im November 1910 kandidierte sie auf<br />
Anraten von Freunden um den frei gewordenen<br />
Platz eines kürzlich verstorbenen Mitglieds<br />
in der Akademie der Wissenschaften.<br />
Sie landete damit im Kreuzfeuer der Medien.<br />
Im konservativen Lager der Medien<br />
erhoben sich nationalistische Stimmen, erinnerten<br />
an ihre polnische Herkunft und<br />
behaupteten, die Entdeckung des Radiums<br />
sei allein Pierre Curie anzurechnen. Je länger<br />
der Medienrummel dauerte, desto mehr<br />
gemahnte er an die Dreyfus-Affäre. Da half<br />
108
es wenig, dass die Zeitung „Le Temps“ an<br />
Maries Verdienste erinnerte. Den entscheidenden<br />
Punkt nämlich vermochte niemand<br />
auszuräumen: Sie war kein Mann. Als sie<br />
daraufhin in der Stichwahl 28:30 dem Physiker<br />
M. Brillouin unterlag, beschloss sie,<br />
nie wieder für die Akademie der Wissenschaften<br />
zu kandidieren.<br />
Das Aufsehen, die Angriffe und die verlorene<br />
Wahl waren durchaus nicht alles, was<br />
Marie 1911 überstehen musste. Es kam noch<br />
sehr viel schlimmer durch die „Affäre Langevin“.<br />
Obwohl Marie Curie dam<strong>als</strong> bereits<br />
seit fünf Jahren verwitwet war und ihr Kollege<br />
und Physiker Paul Langevin getrennt<br />
von seiner Frau und seinen vier Kindern<br />
lebte, kam es zu einer erneuten Schlammschlacht<br />
in der französischen Presse, in der<br />
allein Marie Curie öffentlich gebrandmarkt<br />
und verurteilt wurde. Reaktionäre Elemente<br />
in der französischen Presse benutzten den<br />
Vorfall um xenophobischen Hass zu schüren<br />
gegen eine „ausländische Frau, die ein<br />
französisches Heim zerstörte.“ Zudem sparten<br />
sie nicht mit einer Vielzahl an Vorurteilen<br />
gegenüber gottlose Intellektuelle und<br />
emanzipierte Frauen.<br />
Auf dem Höhepunkt der „Affäre Langevin“<br />
erhielt Marie Curie wieder ein Telegramm<br />
aus Stockholm, das ihren zweiten<br />
Nobelpreis ankündigte, diesmal für<br />
Chemie. Wenige Tage später erhielt sie von<br />
Svante Arrhenius, einem Mitglied der königlich<br />
Schwedischen Akademie die Mitteilung,<br />
sie möge „unter diesen Umständen von<br />
der Absicht zurückzutreten, hier den Nobelpreis<br />
entgegenzunehmen“. Marie schrieb<br />
zurück, dass ihr der Nobelpreis für die Entdeckung<br />
des Radiums und Poloniums zuerkannt<br />
wurde und dass sie beabsichtige nach<br />
Schweden zu kommen, um ihn abzuholen,<br />
denn „ich denke es gibt keine Verbindung<br />
zwischen meiner wissenschaftlichen Arbeit<br />
und [...] meinem Privatleben. “<br />
Blutbefund, der von den bekannten Fällen<br />
perniziöser Anämie abweicht, verraten die<br />
wahre Ursache: die Einwirkung des Radiums.<br />
Am Freitag, den 6. Juli 1934, nahm Marie<br />
Curie in aller Bescheidenheit ihren Platz<br />
am Friedhof von Sceaux ein. Kein Trauerzug,<br />
keine offizielle Vertretung. Ihr Sarg<br />
wurde oberhalb des Sarges von Pierre Curie<br />
bestattet. Ihre Geschwister warfen eine<br />
Handvoll polnischer Erde, die sie von daheim<br />
mitgebracht hatten, in das offene<br />
Grab.<br />
Literatur<br />
Ève Curie, Madame Curie. Frankfurt/M.-<br />
Hamburg, S. Fischerverlag, 1952.<br />
Susan Quinn, Marie Curie: A Life. London,<br />
Heinemann, 1996.<br />
Pierre Radványi, Die Curies : Eine Dynastie<br />
von Nobelpreisträgern. Spektrum der<br />
Wissenschaft Biographie, 2001.<br />
Per-Olov Enquist, Das Buch von Blanche<br />
und Marie, Roman/Hanser, 2004.<br />
Während des ersten Weltkriegs gründete<br />
Marie Curie einen radiologischen Notdienst<br />
für Verwundete. In den Jahren danach<br />
nahm sie wieder voller Engagement<br />
ihre Forschungen über Eigenschaften der<br />
radioaktiven Elemente auf. Sie starb am<br />
4. Juli 1934. Die abnormen Symptome, der<br />
109
Lech Wałęsa –<br />
Vom Helden der Demokratisierung zum<br />
Exzentriker der Demokratie<br />
von Magdalena Hoffmann<br />
Der gesellschaftliche Umbruch in Polen, der mit dem Streik 1980 in Danzig<br />
seinen Anfang genommen hat, ist unweigerlich mit der Person Lech Wałęsas<br />
verbunden. Er wird zu einem Symbol – und scheitert anschließend im Alltag<br />
der erkämpften Demokratie.<br />
Am 14. August 1980 springt Lech Wałęsa<br />
über die Mauer der bereits bestreikten Danziger<br />
Lenin-Werft und hebt damit das für<br />
ihn geltende Hausverbot eigenmächtig auf.<br />
Der Arbeiterschaft ist er bestens bekannt,<br />
sogleich erkennt sie ihn <strong>als</strong> ihren „Anführer“<br />
an. Wałęsa ist nämlich seit 1967 auf<br />
der Werft <strong>als</strong> Elektriker tätig gewesen, wo<br />
er sich schon früh politisch betätigt. So ist<br />
er 1970 <strong>als</strong> Mitglied des illegalen Streikkomitees<br />
beim Dezemberstreik aktiv beteiligt,<br />
der wegen des gewaltsamen Vorgehens<br />
der Staatsmacht mit Toten und Verletzten<br />
endet. Danach setzt er sich stets für eine<br />
Verbesserung der katastrophalen Arbeitsbedingungen,<br />
sowie für ein Denkmal für die<br />
getöteten Arbeiter von 1970 ein, was 1976<br />
zu seiner Entlassung und Hausverbot führt.<br />
Dies verhindert nicht, dass er nach wie vor<br />
seine Linie verfolgt; 1978 schließt er sich<br />
dem „Gründungskomitee der freien Gewerkschaften“<br />
an und führt mit seinen Mitstreitern<br />
Protestaktionen durch, was ihm<br />
1979 mehrere Haftstrafen beschert.<br />
Seine Unerschrockenheit, seine Tatkraft<br />
und seine Bereitschaft, sich durch die Arbeiterschaft<br />
in die Pflicht nehmen zu lassen,<br />
qualifizieren ihn zu einer Führungsfigur. Außerdem<br />
ist er mit Redetalent und Ausstrahlungskraft<br />
gesegnet – Eigenschaften, mit<br />
denen er eine Menschenmenge buchstäblich<br />
zu „elektrisieren“ weiß. Dass Lech Wałęsa<br />
aber zu der Symbolfigur von Solidarność<br />
schlechthin wird, verdankt sich seinem politischen<br />
Instinkt, den er für die sich im Zuge<br />
der Augustereignisse aufbrechende Veränderungskraft<br />
beweist. Er erfasst aber nicht<br />
nur die Stimmung richtig, sondern versteht<br />
es darüber hinaus, sie zu kanalisieren und<br />
sich ihr <strong>als</strong> Identifikationsfigur anzubieten.<br />
Mehrere Entwicklungen im Vorfeld begünstigen<br />
die Entwicklung auf der Danziger<br />
Lenin-Werft, die <strong>als</strong> „Mutter aller polnischen<br />
Werften“ gilt und insgesamt rund<br />
17.000 Arbeiter umfasst. Seitdem sich 1976<br />
nach der brutalen Niederschlagung von<br />
Arbeiterprotesten in Radom und dem Ursus-Werk<br />
bei Warschau ein „Komitee zur<br />
Verteidigung der Arbeiter“ (KOR) unter<br />
der Ägide angesehener Intellektueller wie<br />
Jacek Kuroń und Adam Michnik gebildet<br />
hat, entstehen weitere Bürgerrechtsorganisationen<br />
sowie eine rege Untergrundpresse.<br />
Eine Kooperation der segmentierten sozialen<br />
Gruppen kündigt sich damit an, die<br />
denselben Wunsch nach einer Verbesserung<br />
110
der materiellen, sozialen und politischen<br />
Lage haben. Die katholische Kirche sorgt<br />
für zusätzlichen „Kitt“ – nach der Wahl von<br />
Karol Woijtyła zum Papst im Jahr 1978 und<br />
spätestens nach seiner Polenreise im Juni<br />
1979 wird deutlich, dass er der Hoffungsträger<br />
der Polen ist.<br />
Der Auslöser des entscheidenden Auguststreiks<br />
1980 wirkt im Rückblick wie<br />
eine Fußnote der Geschichte: Die beliebte<br />
Kranführerin Anna Walentynowicz, die<br />
ebenfalls Mitglied des „Gründungskomitee<br />
der freien Gewerkschaften“ ist, wird entlassen.<br />
Zunächst ist der Streik <strong>als</strong>o ein „werftinterner“<br />
Streik, dessen Forderungen sich<br />
auf die Wiedereinstellung von Anna Walentynowicz,<br />
Lohnanhebungen, sowie ein<br />
Lech Wałęsa während des Auguststreiks,<br />
1981<br />
Denkmal für die getöteten Arbeiter von<br />
1970 beschränkt. Nachdem bereits eine Einigung<br />
mit dem Direktor erzielt worden ist<br />
und der Streik vor seinem Ende steht, wird<br />
der Ruf laut, sich auch für andere Betriebe<br />
einzusetzen und allgemeine politische Forderungen<br />
zu erheben: Wałęsa nimmt die<br />
Herausforderung an und setzt den Streik<br />
fort. Damit findet die entscheidende Wende<br />
vom „bloßen“ Besetzungsstreik zum „Solidaritätsstreik“<br />
statt. Nicht mehr das partikulare<br />
Interesse der Danziger Arbeiterschaft<br />
steht jetzt im Mittelpunkt, sondern das der<br />
gesamten polnischen Arbeiterschaft, nein,<br />
noch mehr: der ganzen polnischen Nation,<br />
sofern sie sich mit dem Wunsch nach<br />
Freiheit, Offenheit und Demokratie identifiziert.<br />
Wałęsa beweist ein ungeheures Gespür<br />
für diese vibrierende Stimmung, in der<br />
plötzlich so viel mehr möglich erscheint <strong>als</strong><br />
ursprünglich erhofft und versteht es darüber<br />
hinaus, sie in einem Symbol einzufangen,<br />
in dem sich Polen wieder finden kann:<br />
das Kreuz. Ein Augenzeuge schildert:<br />
„Am Sonntag, den 17. August, lud Walesa<br />
wie Simon von Kyrene das Holzkreuz vom Tor<br />
auf seine Schultern und trug es an den Ort,<br />
wo das zukünftige Denkmal geplant war. Das<br />
Kreuz wurde einbetoniert, und gefestigt wurde<br />
damit für die Tage unseres Streiks auch<br />
die Einheit von mehreren hundert Betrieben<br />
– Werften, Fabriken, Institutionen, Ämtern,<br />
Hochschulen, Vereinen und Verbänden…“<br />
Die gewaltfreie „Revolution auf Knien“<br />
hat begonnen. Die Arbeiter harren in großer<br />
Disziplin aus, versammeln sich zum Gebet.<br />
Priester lesen die Messe, Frauen und Kinder<br />
bringen Essen an die Zäune und sprechen<br />
Mut zu. Intellektuelle (u.a. Tadeusz Mazowiecki<br />
und Bronisław Geremek) kommen<br />
aus Warschau und stellen sich <strong>als</strong> Berater<br />
zur Verfügung – anders <strong>als</strong> im März 1968,<br />
<strong>als</strong> die Studenten protestiert haben und im<br />
Dezember 1970, <strong>als</strong> die Arbeiter gestreikt<br />
haben, kommt es nun zur wichtigen Verbündung<br />
von Arbeitern und Intellektuellen.<br />
Krzemiński beschreibt die eigentümliche<br />
Atmosphäre auf dem Danziger Werftgelände<br />
im August 1980 <strong>als</strong> „eine Mischung aus<br />
politischer Kundgebung, Messe, Volksfest<br />
und verschanztem Lager“.<br />
Die feste Entschlossenheit der Streikenden<br />
zwingt die Machthaber schließlich<br />
zum Einlenken; am 31. August unterschreibt<br />
Wałęsa in demonstrativer Manier<br />
mit einem überdimensionalen Kugelschreiber<br />
die „Vereinbarung von Danzig“, mit<br />
der die Forderungen weitgehend erfüllt<br />
werden: Es werden „unabhängige und sich<br />
selbst verwaltende“ Gewerkschaften zugelassen<br />
und eine Prüfung der Schicksale der<br />
Entlassenen und Gefangenen zugesichert.<br />
Ferner wird ein neues Zensurgesetz, das<br />
mehr Meinungspluralismus ermöglichen<br />
soll, erlassen, sowie ein Wirtschaftsprogramm<br />
zur Verbesserung der Lebenssituation<br />
in Aussicht gestellt. Im September<br />
organisiert sich die Solidarność-Bewegung<br />
offiziell, indem sie sich ein Statut <strong>als</strong> „Unabhängige,<br />
sich selbst verwaltende Gewerk-<br />
111
schaft Solidarność“ gibt. Sie versteht sich <strong>als</strong><br />
Dachverband einer gewerkschaftlichen Organisation<br />
mit dezentraler Struktur; Lech<br />
Wałęsa wird ihr erster Vorsitzender. Innerhalb<br />
kurzer Zeit treten ihr etwa 13 Millionen<br />
Polen bei – das Organisationsmonopol über<br />
die Arbeiterschaft kann von der kommunistischen<br />
Partei nicht mehr glaubhaft beansprucht<br />
werden. Dies bringt sie in tiefe Bedrängnis,<br />
die Unruhe auf Seiten der Partei<br />
nimmt zu, zumal die UdSSR beginnt, mit<br />
einer Intervention zu drohen. Im März 1981<br />
kommt es zu einer gewaltsamen Auflösung<br />
einer Solidarność-Versammlung in Bromberg,<br />
was die Atmosphäre zusätzlich belastet.<br />
Nachdem im September/Oktober die<br />
Solidarność auf ihrem Kongress einen „Aufruf<br />
an die Arbeiter Osteuropas“ formuliert<br />
und ein Treffen zwischen Wałęsa, dem Primas<br />
Glemp und Jaruzelski erfolglos endet,<br />
verkündet General Jaruzelski am frühen<br />
Morgen des 13. Dezember 1981 die Verhängung<br />
des Kriegszustandes in Polen. Wałęsa<br />
wird interniert, Solidarność-Anhänger verhaftet,<br />
Panzer fahren vor der Lenin-Werft<br />
auf. Ein Versammlungsverbot wird ausgesprochen,<br />
sowie nächtliche Ausgangssperren<br />
verhängt. Das Telefonnetz und Verkehrsverbindungen<br />
werden unterbrochen, Schulen<br />
und Universitäten geschlossen, zahlreiche<br />
Posten werden vom Militär besetzt.<br />
Wałęsa wird am 12. November 1982 aus<br />
seinem Internierungsort Arłamów (Südostpolen)<br />
entlassen und gilt fortan <strong>als</strong> „Privatperson“.<br />
Er steht zwar nach wie vor unter<br />
polizeilicher Beaufsichtigung, doch sein<br />
Ruf und sein Bekanntheitsgrad im Ausland<br />
„immunisieren“ ihn vor weiteren Übergriffen.<br />
1983 wird ihm der Friedensnobelpreis<br />
verliehen, den seine Ehefrau Danuta stellvertretend<br />
in Oslo entgegen nimmt, da<br />
Wałęsa fürchtet, dass ihm ansonsten die<br />
Einreise verwehrt bliebe. Er unterhält Kontakt<br />
zu anderen Solidarność-Anhängern<br />
und ist im Untergrund aktiv, doch vergehen<br />
noch einige Jahre, bis er wieder Gelegenheit<br />
erhält, seine charismatische Integrationskraft<br />
auszuüben. Die Jahre 1982-88 sind<br />
durch viele Untergrundaktivitäten, durch<br />
eine sehr schlechte Versorgungslage sowie<br />
parteiinterne Auseinandersetzungen in der<br />
kommunistischen Partei (PZPR) geprägt.<br />
Neben der desaströsen wirtschaftlichen Situation<br />
sorgt die grassierende Korruption<br />
und Vetternwirtschaft innerhalb der PZPR<br />
für Streit zwischen den „Betonköpfen“ und<br />
Reformern, der die Partei letztlich paralysiert.<br />
Erst 1988 kommt wieder deutlich Bewegung<br />
in die politische Szene: Einerseits<br />
mehren sich ab April 1988 wieder die Streiks,<br />
bei denen auch die Wiederzulassung von<br />
Solidarność gefordert wird, woran der nach<br />
wie vor existierende Selbstbestimmungswille<br />
deutlich wird. Andererseits setzen sich die<br />
Reformer in der PZPR durch. Beide Entwicklungen<br />
bereiten den Boden für die Verhandlungen<br />
„am runden Tisch“, die vom<br />
6. Februar bis 5. April 1989 in Warschau<br />
stattfinden. Es gelingt Lech Wałęsa erneut,<br />
die vielen Gruppen hinter sich zu bringen<br />
und <strong>als</strong> ihr gemeinsamer Wortführer Geschlossenheit<br />
gegenüber der Regierung zu<br />
zeigen. Die Verhandlungen haben die Wiederzulassung<br />
von Solidarność und freien<br />
Gewerkschaften, Abschaffung der Zensur,<br />
Religionsfreiheit sowie den Zugang der Opposition<br />
zu Massenmedien zum Ergebnis.<br />
Ferner einigt man sich auf die Wiedereinführung<br />
des 1952 abgeschafften Staatspräsidentenamtes,<br />
auf die Schaffung des Senats<br />
<strong>als</strong> zweiter Parlamentskammer, sowie auf<br />
„halbfreie“ Neuwahlen zum Sejm. Dieser<br />
Teil der Vereinbarung war „ein politisches<br />
Kunstwerk der Halbheiten“ (Krzemiński),<br />
denn nur 1/3 der zu wählenden Sitze standen<br />
zur freien Wahl, die „restlichen“ 2/3<br />
waren bereits für die Regierungspartei vorgesehen.<br />
Trotz dieses eigentümlichen Kompromisses<br />
verhelfen die Wahlen am 4. Juni<br />
1989 Solidarność zu einem moralischen Sieg:<br />
Sie gewinnt alle „freien“ Sitze und 99 von<br />
100 Senatssitzen. Da die Blockparteien sich<br />
zunehmend von der PZPR distanzieren,<br />
scheitert sie mit der Regierungsbildung, was<br />
dazu führt, dass letztlich Tadeusz Mazowiecki<br />
am 20. August 1989 der erste nichtkommunistische<br />
Regierungschef im „Ostblock“<br />
wird.<br />
Am 29. Dezember 1989 wird eine maßgebliche<br />
Verfassungsänderung vorgenommen<br />
– die Volksrepublik Polen wird wieder<br />
zur Republik Polen, Passagen zum kommunistischen<br />
Führungsanspruch werden<br />
gestrichen, es erfolgt die Umwandlung in<br />
einen demokratischen Rechtsstaat. Nach<br />
diesem historischen Triumph bröckelt nun<br />
112
die Geschlossenheit von Solidarność und<br />
eine beginnende Entfremdung von Mazowiecki<br />
und Wałęsa wird deutlich, die bald<br />
zu einer zwischen Intellektuellen und Arbeitern<br />
anwächst.<br />
Ab dem Jahr 1990 lernt man Wałęsas Eigenschaften<br />
unter anderem Vorzeichen kennen:<br />
Seine praktische Orientierung wächst<br />
zu einem ausgeprägten Antiintellektualismus,<br />
seine Impulsivität steigert sich zur<br />
Unberechenbarkeit, sein Charisma gleicht<br />
bald vornehmlich polemischer Attitüde.<br />
Das sich bereits abzeichnende Zerwürfnis<br />
mit Mazowiecki vollzieht sich im Frühjahr<br />
1990 auf einem Kongress der Solidarność,<br />
Statt vom Vorgänger Jaruzelski eingeführt<br />
zu werden, lässt er sich im Warschauer Königsschloß<br />
vom Präsidenten der Londoner<br />
Exilregierung, Ryszard Kaczorowski, die<br />
Amtsinsignien Vorkriegspolens übergeben.<br />
Dabei ruft er die 3. Republik aus, womit<br />
eine demonstrative Missachtung der<br />
Volksrepublik verbunden ist, denn bei dieser<br />
Zählung sieht er das souveräne Polen in<br />
der (unmittelbaren) Tradition der „Adelsrepublik“<br />
und der 2. Republik des Zwischenkriegspolens.<br />
Betende Arbeiter der Lenin-Werft während des Auguststreiks 1980<br />
bei dem Wałęsa gegen die „intellektuellen<br />
Eierköpfe“ wettert. Dementsprechend polemisch<br />
fällt auch der Wahlkampf zur Neuwahl<br />
des Staatspräsidenten aus, die wegen<br />
der fehlenden demokratischen Legitimation<br />
des bisherigen Amtsinhabers, General Jaruzelski,<br />
ausgeschrieben wird. Die Spaltung<br />
von Solidarność wird nun für jeden offenbar:<br />
Während Mazowiecki für den liberalen<br />
Flügel antritt, vertritt Wałęsa den katholisch-konservativen<br />
Flügel. Nach einer<br />
Stichwahl gegen den dubiosen Geschäftsmann<br />
Tymiński gewinnt Wałęsa letztlich<br />
die Wahl zum Staatspräsidenten am 9. Dezember<br />
1990 mit 74, 25 %, (woraufhin Mazowiecki<br />
<strong>als</strong> Regierungschef zurücktritt).<br />
Bei seinem Amtsantritt am 22. Dezember<br />
1990 gelingt Wałęsa noch ein Coup:<br />
Nach Jahren der unbestrittenen gesellschaftlichen<br />
Führung tut sich Wałęsa<br />
schwer mit dem kleinlich wirkenden, unaufregenden<br />
Alltag einer Demokratie. Mit<br />
seinem zunehmenden Machtanspruch, der<br />
sich in seinem Ziel einer neuen präsidialen<br />
Verfassungsordnung nach französischem<br />
Vorbild ausdrückt, eröffnet er den „Krieg<br />
an der Spitze“, indem er sich auf ständige<br />
Machtkämpfe mit dem Sejm einlässt. Am<br />
18. November 1992 wird übergangsweise die<br />
„kleine“ Verfassung verabschiedet, die eine<br />
Stärkung der Rechte des Sejm und der Regierung<br />
vorsieht, dem Präsidenten aber immer<br />
noch viel Einfluss zugesteht. Die Querelen<br />
hören nicht auf und werden durch das<br />
extrem unübersichtliche Parteienspektrum,<br />
das Koalitionen erschwert, und häufige Regierungswechsel<br />
immer wieder angefacht.<br />
Nach den Sejmwahlen im Jahr 1993 spitzt<br />
sich die Lage noch zu, denn die Wałęsa verhasste,<br />
postkommunistische SLD (Bündnis<br />
113
der Demokratischen Linken) und die PSL<br />
(Bauernpartei) bilden die neue Regierung.<br />
Wałęsa verweigert sich diesem Wahlergebnis,<br />
indem er wichtige Gesetzesvorhaben<br />
blockiert, Ministerernennungen nicht vollzieht<br />
und wiederholt mit der Auflösung des<br />
Parlaments droht. Dieses Verhalten bringt<br />
ihm den Ruf ein, ein „Meister der Destruktion“<br />
(Adam Michnik) zu sein. Es bleibt<br />
nicht folgenlos, denn eine starke Politikverdrossenheit<br />
greift um sich, die Gesellschaft<br />
spaltet sich zunehmend.<br />
Nach einem sehr polemisch geführten<br />
Wahlkampf verliert Wałęsa im November<br />
1995 nur knapp gegen Aleksander<br />
Kwaśniewski von der SLD. 1997 unterstützt<br />
er zwar die sich neu formierte AWS (Wahlaktion<br />
Solidarität), nimmt dabei aber nur<br />
eine Nebenrolle ein. Im Jahr 2000 zeigt sich<br />
sein öffentlicher Bedeutungsverlust auf bestürzende<br />
Weise: Bei seiner erneuten Kandidatur<br />
zur Wahl des Staatspräsidenten erhält<br />
er nur noch etwa 1 %.<br />
Literatur<br />
Bingen, Dieter: Die Republik Polen. Eine<br />
kleine politische Landeskunde, Bonn 1998.<br />
Krzemiński, Adam: Polen im 20. Jahrhundert.<br />
Ein historischer Essay, München 1998.<br />
Schmidt-Rösler, Andrea: Polen. Vom Mittelalter<br />
bis zur Gegenwart, Regensburg 1996.<br />
Wałęsa, Lech: Ein Weg der Hoffnung (Autobiographie),<br />
Wien/ Hamburg 1987.<br />
(Der Augenzeugenbericht ist der Autobiographie<br />
entnommen)<br />
Ziemkiewicz, Rafał: „Spokojnie, to tylko<br />
Wałęsa“ (übers.: „Ruhig, das ist nur<br />
Wałęsa“), erschienen in der Tageszeitung<br />
„Rzeczpospolita“ vom 28. August 2006.<br />
Wałęsas politischer Entwicklung haftet<br />
etwas Tragisches an; seine persönlichen<br />
Eigenschaften haben ihn unter politischen<br />
Ausnahmebedingungen zur Führungsfigur<br />
werden lassen, unter (demokratischen) Normalbedingungen<br />
aber zu einem Exzentriker.<br />
Die polnische Öffentlichkeit ist mittlerweile<br />
sein Pathos, seine Sprunghaftigkeit und sein<br />
Inszenierungstalent gewohnt, und reagiert<br />
gelassen mit Nichtbeachtung darauf. Dies<br />
wird auch der ausländischen Presse empfohlen;<br />
ein polnischer Publizist gab Ende<br />
August in der Tageszeitung „Rzeczpospolita“<br />
ausländischen Journalisten den Rat,<br />
sich ihm wie einem seltenen Exemplar zu<br />
nähern: „Achtung, das ist Wałęsa – schaut,<br />
staunt, und hört, was er sagt, denn morgen<br />
wird er etwas anderes erzählen.“<br />
Offensichtlich gibt es nicht nur einen<br />
Kairos für die Übernahme von Führung,<br />
sondern auch einen für den eigenen Rückzug.<br />
Letzterer scheint Wałęsa leider entgangen<br />
zu sein.<br />
114
„Diese Menschen – das ist Polen“<br />
von Judith Luig<br />
Aufteilungen, Vertreibungen und Verfolgungen haben Polens Geschichte im<br />
20. Jahrhundert bestimmt. Aber nicht nur. Gegen die Einflüsse von außen gab<br />
es im Lande selbst immer wieder Bemühungen um nationale Einheit. Und<br />
Schriftsteller, die vor allzu viel Patriotismus warnten und nach einer moderaten<br />
polnischen Identität suchten.<br />
„Der Polnische Roman im 20. Jahrhundert“.<br />
Dieser Arbeitstitel wäre für meine<br />
Doktormutter ein Fest. In ihrer freundlich-kritischen<br />
Art würde sie meinen Ansatz<br />
wie folgt auseinandernehmen: „Was bedeutet<br />
‚polnisch’? Louis Begley wurde 1933<br />
<strong>als</strong> Ludwig Beglejter in Strji geboren. Zählt<br />
sein Roman Wartime Lies zur polnischen Literatur?“<br />
Ein ähnliches Problem stelle sich<br />
für die gewählte Zeitspanne. „Verändert<br />
sich die Kunst, nur weil ein neues Jahrhundert<br />
anbricht? Gehört nicht Schneeweiß und<br />
Russenrot zur europäischen Popliteratur der<br />
Neunziger, obwohl es 2002 erschien?“ Und<br />
überhaupt: „Kann man von dem polnischen<br />
Roman im 20. Jahrhundert reden?<br />
Man kann, würde ich ihr antworten. Natürlich,<br />
meine Doktormutter hätte schon<br />
Recht mir ihrem Einwand: Wie überall änderte<br />
sich die polnische Literatur mit den<br />
jeweiligen zeitgenössischen Einflüssen und<br />
nicht mit dem Jahrtausendwechsel. Auch<br />
hier schuf die Moderne neue Kunstrichtungen.<br />
Zwei Weltkriege und die organisierte<br />
Vernichtung von Menschen zwangen<br />
zu einem neuen Nachdenken über Kunst<br />
und Literatur. Doch anders <strong>als</strong> die Autoren<br />
anderer Länder wurden die Künstler Polens<br />
im 20. Jahrhundert durch ein alles dominierendes<br />
Thema vereint. „Das Kardinalproblem“,<br />
so erklärt Karl Dedecius, Leiter<br />
des Deutschen Polen-Instituts, „war, ist und<br />
bleibt das Verhältnis der Polen zu ihren beiden<br />
Großnachbarn Russland und Deutschland,<br />
die Polens alte Landkarte bis zur Unkenntlichkeit<br />
verstümmelt haben.“ Und<br />
auch wenn die Geschichte von nation<strong>als</strong>ozialistischer<br />
Besatzung und kommunistischer<br />
Herrschaft bekanntermaßen nur eine Fortführung<br />
der endlosen Unterwerfung und<br />
Zerstückelung Polens, die bereits 1772 begann,<br />
ist, so hat die Erfahrung von Fremherrschaft<br />
und Terror doch die Kunst des<br />
20. Jahrhunderts in ganz besonderer Weise<br />
beeinflusst. Die größte Aufgabe der Intellektuellen<br />
zu Beginn dieses Jahrhunderts<br />
war, ein Polen, „was bislang nur in der Vorstellung<br />
seiner Patrioten exististierte,“ wie<br />
Marci Shore in Caviar and Ashes schreibt,<br />
Wirklichkeit werden zu lassen. Wie die Suche<br />
nach einer polnischen Identität sich in<br />
der Darstellung Polens und seiner Einwohner<br />
im Roman dieser Zeit wiederfindet, ist<br />
Gegenstand der folgenden Kurzporträts.<br />
Nächte und Tage<br />
Nach dem 1. Weltkrieg war die polnische<br />
Intelligentia damit beschäftigt, den neu<br />
entstandenen Staat zu unterstützen. Wie<br />
viele ihrer Altersgenossen hatte sich Maria<br />
Dąbrowska (1889-1965), die Tochter eines<br />
115
Witold Gombrowiczs<br />
(Quelle: Staatsbibliothek<br />
Berlin)<br />
verarmten Gutsbesitzers, während ihres<br />
Studiums in Brüssel an den Bestrebungen<br />
zur Unabhängigkeit beteiligt. Als sie nach<br />
Polen zurückkehrte, wandte sie sich den<br />
Problemen der Landarbeiter zu. Ihr erster<br />
Roman Landlose (1925) ist eine kritische<br />
Darstellung der Armut der Bauern, eines<br />
der großen Probleme der jungen Republik.<br />
Dąbrowskas Realismus wurde prägend<br />
für die Literatur ihrer Zeit. Ihr wohl<br />
berühmtestes Werk Nächte und Tage (1934)<br />
ist eine 2000-seitige Generationengeschichte,<br />
die oft mit Thomas Manns Buddenbrocks<br />
verglichen wurde.<br />
Am Bodensee<br />
Der Einmarsch der Deutschen im September<br />
1939 beendete jäh jegliches nationales<br />
kulturelles Schaffen. Polnische<br />
Literatur und Musik waren verboten, Zuwiderhandelnden<br />
drohte die Todesstrafe. Als<br />
Gegenreaktion auf die deutsche Dominanz<br />
der Vierziger Jahre wurde nach dem Krieg<br />
gerade die Literatur besonders wichtig, die<br />
zerschnittene Fäden wieder aufnahm und<br />
sich an den Werken der „polnischen Spötter“<br />
der Vorkriegszeit orientierte. Wie zum<br />
Trotz gegen Tod, Vernichtung und Zerstörung<br />
drängte Stanisław Dygats (1914-1978)<br />
in seinem 1946 erschienenen Roman Am<br />
Bodensee (Jezioro Bodenskie) den Krieg in<br />
den Hintergrund und setzte sich damit von<br />
seinen Zeitgenossen ab, die vor allem die<br />
gegen Polen begangenen Grausamkeiten<br />
der Deutschen in ihren Werken beschreiben.<br />
Dygats Buch, verfasst 1942, erzählt von<br />
einem Lager für Kriegsgefangene am Bodensee,<br />
ähnlich dem, in dem der Autor selbt<br />
während des Krieges festsaß. Die äußerst<br />
moderaten Bedingungen des Lagers stehen<br />
im krassen Gegensatz zu der Wirklichkeit<br />
der Arbeits- und Konzentrationslager. Langeweile<br />
scheint hier das größte Leiden. Da<br />
die Insassen den verschiedensten Nationalitäten<br />
angehören, beginnt der Protagonist,<br />
seine eigene Beziehung zu seinem Land und<br />
sein „Polentum“ zu definieren. Diese Reflexionen<br />
finden vor allem Ausdruck in einer<br />
Rede „Ich und mein Volk“, in dem Dygat<br />
das Thema des ewig leidenden Polen ironisiert.<br />
Das Land wird mit Jesus verglichen:<br />
Polen erinnert in seiner Form an ein Herz,<br />
[...] man kann es auch mit einem Menschen<br />
mit ausgebreiteten Armen vergleichen. Ja.<br />
Mit ausgebreiteten, ans Kreuz geschlagenen<br />
Armen.<br />
Doch durch tolpatschiges Verhalten<br />
nimmt der Redner sich jeden Anspruch auf<br />
Glaubwürdigkeit. Unter den polnischen<br />
Zuhörern wird die Intention des Redners<br />
verstanden. Sie hinterfragt die romantische<br />
Vorstellung des leidenden Landes und<br />
drückt doch gleichzeitig einen nationalen<br />
Charakter aus, der gegen andere abgegrenzt<br />
wird. „Diese ausländischen Holzköpfe haben<br />
natürlich nichts begriffen“, lobt einer<br />
die Aufführung des Sprechers. Darüberhinaus<br />
bringt die Pose des vaterlandslosen<br />
Polen dem Protagonisten noch ganz andere<br />
Vorteile. Er setzt sie erfolgreich zur Verführung<br />
einer jungen Französin ein.<br />
Am Bodensee kritisiere „die romantische<br />
Grundidee des polnischen Messianismus“<br />
und entlarve Polens „sentimentale<br />
Fiktionen“ wenn auch auf eine „liebenswert-ironische<br />
Weise“, kommentiert Dedecius.<br />
Dygats Darstellung patriotischer<br />
Gefühle stieß selbst in der Atmosphäre des<br />
demokratischen Pluralismus, der zu dieser<br />
Zeit auf dem polnischen Büchermarkt<br />
herrschte, auf erbitterte Gegener. „Ein besonders<br />
eifriger linker Kritiker“, schreibt<br />
der Literatuwissenschaftler Hans-Christian<br />
Trepte, „verstieg sich sogar zu der Meinung,<br />
[...] daß Dygat auf dem Scheiterhaufen verbrannt<br />
werden müßte.“ So wie die Ketzer<br />
zu Zeiten der Reformation.<br />
Trans-Atlantik<br />
Ein kritischer Blick auf Polnisches findet<br />
sich auch in Witold Gombrowiczs spielerischen<br />
bis absurden Schriften, die er in<br />
den Nachhwehen des 2. Weltkrieges verfasst.<br />
In Trans-Atlantik, seinem zweiten Roman,<br />
erzählt ein junger polnischer Exilant<br />
von seinen abenteuerlichen bis grotesken<br />
Erlebnissen in Argentinien. Das avantgardistische<br />
Buch löste heftigste Kontroversen<br />
aus, <strong>als</strong> es 1953 in Paris erschien. Die erst ein<br />
Jahr zuvor gegründete Volksrepublik Polen<br />
tat sich mit Gombrowiczs Satire schwer. Als<br />
116
provokant und beleidigend empfanden viele<br />
die Geschichte des Exilanten, der sich bei<br />
Ausbruch des Krieges weigert, wie die anderen<br />
Polen heimzukehren um fürs Vaterland<br />
zu kämpfen. Nationales wird hier mit einem<br />
Fluch bedacht:<br />
So fahrt denn hin ihr, fahrt ihr Landsleute zu<br />
eurer Nation! Fahrt ihr nur zu Eurer heiligen<br />
wohl Verdammten Nation! Fahrt denn hin zu<br />
diesem hl. Dunklen Gebilde, welches seit jahrhunderten<br />
krepiert, aber nicht fertigkrepieren<br />
kann!<br />
Im Vorwort zur polnischen Ausgabe<br />
des Romans erklärt der Autor seine Kritik<br />
am Patriotismus: „Trans-Atlantik ist eine<br />
Abrechnung [...] mit einem schwachen Polen.<br />
[...] dies ist ein Korsarenschiff, das eine<br />
Menge Dynamit schmuggelt, um unsere<br />
bisherigen nationalen Gefühle zu sprengen.<br />
Es enthält auch ein ganz deutliches Postulat<br />
in bezug auf dieses Gefühl: Das Polentum<br />
überwinden.“ Die Erfahrungen des Nation<strong>als</strong>ozialismus<br />
sollten nach Gombrowiczs<br />
Meinung die Menschen lehren, das enge<br />
Konzept einer nationalen Identität aufzugeben.<br />
„Das Problem ist nicht das Verhältnis<br />
der Polen zu Polen, sondern das Verhältnis<br />
des Menschen zur Nation. [...] ich strebe<br />
(wie immer) eine Verstärkung und Bereicherung<br />
des individuellen Lebens, eine Vermehrung<br />
seiner Widerstandsfähigkiet gegen<br />
das drückende Übergewicht der Masse an.“<br />
Die schöne Frau Seidenman<br />
Die Sowjetische Herrschaft verändert<br />
polnisches Schreiben ein weiteres mal. Auf<br />
dem Schriftstellerkongress 1949 in Sczcecin<br />
wird der sozialistische Realismus <strong>als</strong> maßgebliche<br />
Stilrichtung festgelegt. Polnische<br />
Autoren, deren Werke der Obrigkeit missfallen,<br />
können nur im Ausland veröffentlicht<br />
werden. Wie zum Beispiel Andrzej Szczypiorski.<br />
Sein Roman Początek (Der Anfang),<br />
erschien 1986 in Frankreich.<br />
Die schöne Frau Seidenman, so der deutsche<br />
Titel, ist ein Porträt von Warschauern<br />
in den Vierziger Jahren. Mit zärtlicher Ironie<br />
erschafft Sczcypiorski kleinere und größere<br />
Momentaufnahmen von Menschen,<br />
die jeder auf unterschiedliche Weise versuchen,<br />
„mit einer Prise Illusion und Leid“<br />
ihr Schicksal anzunehmen. Sein Spektrum<br />
reicht von Richtern und Ärzten bis hin zu<br />
Kleinkriminellen und Prostituierten. Szczypiorski<br />
schildert einen einfachen Schneider,<br />
dem gegen seinen Willen ein jüdisches<br />
Vermögen zugefallen ist, das er jetzt in ein<br />
ehrgeiziges Musemsprojekt für seine Heimatstadt<br />
stecken will; er berichtet von der<br />
Entscheidung eines jungen Juden, der freiwillig<br />
zurück ins Getto geht, und einer Ordensschwester,<br />
die jüdische Kinder versteckt<br />
und zum Katholizismus erzieht.<br />
Im Zentrum der zahlreichen Geschichten<br />
steht die Verwandlung der Titelheldin, Irma<br />
Seidenman, von einer jüdischen Arztwitwe<br />
in eine polnische Offizierswitwe, die<br />
zugleich für die Verwandlung des Landes<br />
steht. Nachdem sie der Gestapo entkommen<br />
ist, erwacht ihr Patriotismus. „Diese<br />
Menschen“, stellt sie fest „das ist Polen.“<br />
Während sie unter Dr. Kordas Augen die<br />
Milch trank, barfuß, mit tränennassem Gesicht,<br />
bebend in der Kühle der frühen Stunde,<br />
überkam sie zum ersten Mal im Leben die<br />
freudige Gewißheit, dass dies ihr Land war<br />
mit nahen und geliebten Menschen, denen sie<br />
nicht nur ihre Lebensrettung verdankte, sondern<br />
auch ihre Zukunft. Noch nie hatte sie so<br />
tief und so schmerzlich ihre Zugehörigkeit zu<br />
Polen empfunden, noch nie hatte sie mit soviel<br />
bitterer Freude und Hingabe an Ihr Polentum<br />
gedacht. Polen, dachte sie, mein Polen.<br />
Polen wird bei Sczcypiorski zu einer Vision<br />
eines Landes und seiner Bevölkerung.<br />
Den Nazis soll es nicht gelingen, die Menschen,<br />
ihre Menschlichkeit und ihre Ordnung<br />
zu beherrschen. Das drückt unter<br />
anderem die Figur des Schneiders aus, der<br />
durch die Deutschen zu Geld gekommen<br />
ist, der sich aber der Struktur der polnischen<br />
Gesellschaft bewußt bleibt:<br />
Ein geheimnisvoller, paradoxer und dennoch<br />
wichtiger Faden der Abhängigkeit verband<br />
sie [...], ein Faden, der sich aus dem uralten<br />
Knäuel des Polentums, der polnischen Geschichte<br />
und Kultur herleitete, [...] ein Faden<br />
der Abhängigkeit und Gemeinsamkeit.<br />
117
(Quelle: www.cafebabel.com)<br />
Doch die Hoffnung wird enttäuscht. In<br />
Vorrausblenden zeigt der Roman, dass sich<br />
Polen nach dem Krieg keinesfalls in eine<br />
ideale Welt der Brüderlichkeit verwandeln<br />
wird. Irma Seidenman, die sich entschlossen<br />
hat die Identität ihrer f<strong>als</strong>chen Papiere<br />
anzunehmen, wird von den Kommunisten<br />
in demselben Gebäude, in dem die Gestapo<br />
sie festnahm, von den Russen <strong>als</strong> Jüdin entlarvt<br />
und verliert ihre Arbeit.<br />
Im Gegensatz zu dem Widerstand, mit<br />
dem die Figuren in dem Roman den Deutschen<br />
begegnen, scheint die sowjetische Zeit<br />
von Resignation bestimmt zu sein. Szczypiorskis<br />
versöhnlicher Ansatz in der Schilderung<br />
der Deutschen findet sich nicht in seinem<br />
Porträt der kommunistischen Ära. Die<br />
Vorrausblenden zeigen besiegte Menschen.<br />
„Die polnische Sache“, so stellt der Eisenbahner<br />
Filipek fest, „ist mit Schweinemist<br />
besuldet.“<br />
Schneeweiß und Russenrot<br />
Für die junge Generation polnischer Autoren<br />
ist die Zeit unter den Nazion<strong>als</strong>ozialisten<br />
in Vergessenheit geraten. Ihr Gegner<br />
ist der russische Schwarzmarkt und der kapitalistische<br />
Westen. Zwei Jahre vor dem<br />
EU-Beitritt Polens erscheint Schneeweiß<br />
und Russenrot, ein Roman, der die narzisstischen<br />
Selbstdarstellungen deutscher<br />
Popliteraten imitiert. Doch während es bei<br />
Stuckrad-Barre und Kracht um die Marken<br />
von Jeans, Autos oder Sonnenbrillen geht,<br />
markieren die Polen bei Dorota Masłowska<br />
ihre Männlichkeit ganz traditionell durch<br />
Drogen- und Frauenkonsum. Andrezj, genannt<br />
der Starke, ist Anti-Held des Postkommunismus.<br />
Seine politische Haltung<br />
bezeichnet er <strong>als</strong> „links-patriotisch“ oder<br />
„national-anarchistisch“, wobei ihm selber<br />
nicht ganz klar zu sein scheint, was er damit<br />
meint.<br />
Der Leser begleitet Andrezj bei seinem<br />
Streifzug durch die Tristesse von Plattenbausiedlungen,<br />
billigen Diskos und dreckigen<br />
Wohnungen, auf der Suche nach<br />
Sex und Speed. Andrezjs Alltag ist ein<br />
selbst-kreierter Kriegsschauplatz. Verzweifelt<br />
kämpft er um eine polnische Identität,<br />
die er selbst nicht näher umschreiben kann,<br />
und in der er vor allem von wirtschaftlichem<br />
Erfolg und dem Zerstören des russisch dominierten<br />
Schwarzmarktes träumt. Russland<br />
wird zur Metapher für alles, was die<br />
Jugend zerstört. „Magda sei übler <strong>als</strong> eine<br />
gewöhnliche Schlampe vom Bahnhof“, zitiert<br />
der Ich-Erzähler, „übler <strong>als</strong> die, die am<br />
Hauptbahnhof stehen. Weingummirot im<br />
Gesicht, schmutzig. Wie die von den Russen.“<br />
Eben jene Magda steht in dem Roman<br />
für die komplette Chanchenlosigkeit ihrer<br />
Generation. „In diesem Land gibt es keine<br />
Zukunft, unsere Liebe hat hier keine Chance“,<br />
sagt sie in einem der raren Momente<br />
der Reflektion, „wohin du guckst, überall<br />
Gewalt, denk nur an diesen polnisch-russischen<br />
Krieg, der jetzt in der Stadt stattfindet,<br />
dass man nicht reinkann, ohne auf<br />
russische Triebschweine zu stoßen.“ Doch<br />
dieser Krieg wird immer nur angedeutet,<br />
er bleibt eine vage rassistische Phobie, eine<br />
Drogenfantasie des Protagonisten. Tatsächlich<br />
taucht kein einziger Russe in dem Roman<br />
auf. Es bleibt bei Schattenschlachten,<br />
wie in jener Speed-getrübten Szene, in der<br />
Anstreicher das Haus des Starken in weißroten<br />
Farben zur Kampfansage streichen<br />
wollen. Einer von ihnen erklärt den Hintergrund:<br />
Weil entweder ist man Pole oder man ist kein<br />
Pole. Entweder ist man polnisch oder man ist<br />
russisch. Mit Schmackes gesagt, entweder man<br />
ist Mensch oder Arschloch. Und Schluss, so<br />
viel dazu.<br />
Doch der Westen ist ebenso verdammt<br />
in der Wahrnehmung von Maslowskas Figuren.<br />
Weil er „stinkt, eine zerstörte Umwelt<br />
hat, die er mit diversen unnatürlichen<br />
Verbindungen verschmutzt, PVC, THC“,<br />
so erklärt es der Starke. Er weiß, „dass dort<br />
Judenfresser, Arbeiterfresser den Ton angeben,<br />
Mörder, die sich selbst und ihre unehelichen<br />
Kinder durch Unterdrückung<br />
ernähren, dadurch, dass sie den Leuten Markenkacke<br />
in Markenpapier durch die Firma<br />
McDonald´s verkaufen.“ Beim Erscheinen<br />
ihres ersten Romanes war die Autorin<br />
18 Jahre alt. Dass sich ihre groteske Skizze<br />
der polnischen Jugend oft im Belanglosen<br />
verliert, wurde von der begeisterten Presse<br />
118
zum Programm erklärt. Masłowskas Protagonist,<br />
so schreibt eine Journalistin, „verkörpert<br />
eine Generation, die sich im Aufbruch<br />
befindet.“ Viel ist von diesem Aufbruch in<br />
Schneeweiß und Russenrot aber nicht zu<br />
spüren. Es ist viel eher die Bestandsaufnahme<br />
einer Generation junger Polen nach dem<br />
Absturz.<br />
Abschließend bleibt mir noch zu bemerken,<br />
dass meine Doktormutter wahrscheinlich<br />
recht hätte. Bei der Vielfalt an Autoren<br />
und Stilrichtungen fällt es schwer, von dem<br />
polnischen Roman des 20. Jahrhunderts zu<br />
reden. Wie ich aber in diesen kurzen Beschreibungen<br />
einiger Bücher gezeigt habe,<br />
kann man durchaus von einem Leitmotiv<br />
des polnischen Romans reden: die Suche<br />
nach einem Polentum. Und auch mit Beginn<br />
eines neuen Jahrhunderts, das Polen <strong>als</strong><br />
eine demokratische Republik erleben sollte,<br />
ist der „polnische Komplex“ (Gombrowicz)<br />
nicht überwunden. Die Kaczynski-Brüder<br />
und die Politik ihrer Partei „Recht und Gerechtigkeit“<br />
scheinen alles daran zu setzen,<br />
ihr Volk in alten Feindschaften verharren zu<br />
lassen. Dass das Präsidialamt die linksalternative<br />
tageszeitung mit dem nation<strong>als</strong>ozialistischen<br />
Stürmer verglichen hat, nachdem<br />
Jaroslaw Kaczynski auf einer Satireseite der<br />
taz <strong>als</strong> neue polnische Kartoffel bezeichnet<br />
worden war, zeigt, dass das Thema Nationalismus<br />
auch die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts<br />
dominieren wird. Der Vorfall hat<br />
nochm<strong>als</strong> deutlich gemacht, dass die Pressefreiheit<br />
in Polen nicht gewährleistet ist. Wie<br />
sich diese Regierung auf die Freiheit der<br />
Schriftsteller auswirkt, werden die nächsten<br />
Monate zeigen.<br />
Dedecius, Karl, Panorama der Polnischen<br />
Literatur des 20. Jahrhunderts, Zürich 1997.<br />
Gombrowicz, Witold, Trans-Atlantik, Berlin<br />
1988.<br />
Masłowska, Dorota, Schneeweiß und Russenrot,<br />
Köln 2002.<br />
Miłosz, Czesław, Geschichte der Polnischen<br />
Literatur, Köln 1985.<br />
Sczcypiorski, Andrej, Die Schöne Frau Seidenman,<br />
Zürich 1988.<br />
Literatur:<br />
119
Joseph Conrad<br />
(d .i. Józef Teodor Konrad Korzeniowski)<br />
und das „Herz der Finsternis“<br />
von Anne Kraume<br />
Wie es im Kongo aussieht, wie aus dem polnischen Seemann Józef Teodor<br />
Konrad Korzeniowski der englische Schriftsteller Joseph Conrad wurde und wie<br />
nebenbei ein Schlüsseltext der modernen Literatur entstand: eine Reise ins Herz<br />
der Finsternis und ihre – literarischen – Folgen<br />
Auftakt<br />
Von Juli 1925 bis Mai 1926 bereist der<br />
französische Schriftsteller André Gide den<br />
Kongo. Nur kurze Zeit nach seiner Rückkehr<br />
nach Frankreich erscheinen die beiden<br />
Bücher Voyage au Congo (1927) und Le Retour<br />
du Tchad (1928), in denen er die Erlebnisse<br />
und Eindrücke von dieser Afrikareise<br />
verarbeitet; dem Band Voyage au Congo<br />
ist eine knappe Widmung vorangestellt: „A<br />
la mémoire de Joseph Conrad“, heißt es da<br />
einfach. Dieser Joseph Conrad, an den André<br />
Gide mit seiner Reiseerzählung erinnern<br />
möchte, hatte 35 Jahre vor diesem, von Juni<br />
bis Dezember 1890 nämlich, ebenfalls den<br />
Kongo bereist, und auch er hat seine afrikanischen<br />
Erfahrungen später literarisch verwertet.<br />
Heart of Darkness heißt der Roman<br />
von 1899, auf den sich André Gide in seinem<br />
Voyage au Congo immer wieder bezieht –<br />
explizit, indem er Conrad zum Teil wörtlich<br />
zitiert; aber auch implizit, indem er etwa<br />
dessen Formulierung vom „Herz der Finsternis“<br />
aufgreift und zu Beginn seiner Reise<br />
feststellt: „nous pénétrons dans de mystérieuses<br />
ténèbres“.<br />
Bei beiden Autoren, dem französischen<br />
und dem englischsprachigen, markiert die<br />
Reise ins Herz der Finsternis – oder vielmehr<br />
ihre literarische Verarbeitung – eine<br />
Art Wendepunkt: Als André Gide nach<br />
Afrika reist, hat er gerade seinen Roman Les<br />
Faux-Monnayeurs abgeschlossen, an dem er<br />
sechs Jahre lang gearbeitet hat und der so<br />
etwas wie die Summe seiner literarischen<br />
Veröffentlichungen werden sollte. Es zieht<br />
ihn weg aus Frankreich und Europa, weg<br />
auch von den rein literarischen Aufgaben<br />
dort – so schreibt er in einem Brief an Roger<br />
Martin du Gard: „L’idée du voyage se glisse<br />
constamment entre moi et mon livre […].<br />
C’est une hantise. Il est temps de partir, décidément.“<br />
Der Aufbruch markiert für Gide<br />
einen Neuanfang: vom Zeitpunkt seiner<br />
Kongoreise rücken mehr <strong>als</strong> bisher auch politische<br />
und soziale Probleme in sein Blickfeld,<br />
und die literarischen Fragen, mit denen<br />
er sich bisher beschäftigt hat, verlieren darüber<br />
zunehmend an Bedeutung.<br />
Joseph Conrad<br />
Wenn André Gides Kongoreise daher,<br />
zugespitzt formuliert, so etwas wie das<br />
Ende seiner Karriere <strong>als</strong> Autor von rein literarischen<br />
Werken darstellt, so verhält<br />
es sich im Fall von Joseph Conrad gerade<br />
120
umgekehrt: Mit der Veröffentlichung von<br />
Heart of Darkness <strong>als</strong> Fortsetzungsroman<br />
in Blackwood’s Magazine im Frühjahr 1899<br />
wird er tatsächlich erst zum anerkannten<br />
und erfolgreichen Schriftsteller in England<br />
– zum Niederschreiben dieses Textes unterbricht<br />
er die Arbeit am Manuskript von<br />
Lord Jim, aus dem wenig später, 1904, sein<br />
erster großer Roman werden sollte.<br />
Die Etappe von Joseph Conrads Leben,<br />
die mit der Veröffentlichung von Heart of<br />
Darkness ihren Anfang nimmt, ist gewissermaßen<br />
die dritte und letzte große Phase<br />
in diesem Leben – und jeder dieser drei Phasen<br />
können unterschiedliche geographische<br />
Räume zugeordnet werden. Der englische<br />
Autor Joseph Conrad wird nämlich unter<br />
dem Namen Józef Teodor Konrad Korzeniowski<br />
1857 <strong>als</strong> Sohn polnischer Eltern im<br />
dam<strong>als</strong> russischen Gouvernement Kiew geboren,<br />
und er lebt nach dem frühen Tod seiner<br />
Eltern bis zum Alter von 17 Jahren unter<br />
der Obhut eines Onkels im – zu seiner Zeit<br />
geteilten – Polen, ehe er in Marseille eine<br />
Karriere <strong>als</strong> Seemann beginnt. Von 1878 an<br />
segelt er unter britischer Flagge, und erst<br />
im Jahr 1886 erwirbt er nicht nur sein Kapitänspatent,<br />
sondern zugleich auch die britische<br />
Staatsbürgerschaft. Joseph Conrad,<br />
der gebürtige Pole, ist ein Autor zwischen<br />
den Welten: niem<strong>als</strong> wird er sich in England<br />
wirklich vollkommen zugehörig fühlen,<br />
aber noch weniger kann das zaristische<br />
Polen eine Heimat für ihn sein. Wenn die<br />
Zeit seiner schriftstellerischen Reife <strong>als</strong>o<br />
im Herzen der Finsternis ihren Anfang<br />
nimmt, ebenso weit weg von Polen wie von<br />
England, dann ist das kein Zufall: Damit<br />
wird deutlich, dass Joseph Conrads Heimat<br />
vielleicht weniger geographisch <strong>als</strong> vielmehr<br />
sprachlich-literarisch auszumachen ist.<br />
Der Kongo<br />
Als Józef Teodor Konrad Korzeniowski<br />
1894 seinen Abschied von der See nimmt,<br />
da unterschreibt er seine Entlassungspapiere<br />
erstm<strong>als</strong> mit dem anglisierten Namen<br />
„J. Conrad“. Seinen ersten längeren Text auf<br />
Englisch hat er allerdings schon vier Jahre<br />
vorher geschrieben – es handelt sich um ein<br />
Tagebuch aus kurzen Notizen und navigatorischen<br />
Vermerken, mit dem er seine Reise<br />
durch den Kongo protokolliert hat. Conrad<br />
reist wie Charlie Marlow, der Icherzähler<br />
aus Heart of Darkness, <strong>als</strong> Angestellter einer<br />
belgischen Handelsgesellschaft nach<br />
Afrika, für die er das Kommando eines<br />
Flussdampfers auf dem Kongo übernimmt.<br />
Der Kongo war zum Zeitpunkt von Conrads<br />
Reise, Ende des 19. Jahrhunderts, de<br />
facto Eigentum des belgischen Königs Leopold<br />
II., der sich das Land durch diplomatische<br />
Schachzüge, eine Reihe von Expeditionsprojekten<br />
und nicht zuletzt durch die<br />
Entsendung von Henry Morton Stanley <strong>als</strong><br />
Gouverneur dorthin gesichert hatte. Konzessionen<br />
an private Handelsgesellschaften<br />
sollten die Erschließung des riesigen Territoriums<br />
– und nicht zuletzt auch die Verbreitung<br />
der „europäischen Zivilisation“<br />
– vorantreiben, aber tatsächlich dienten sie<br />
allein der Ausbeutung des Landes und seiner<br />
Bewohner. Joseph Conrad bricht seinen<br />
Aufenthalt im Kongo nach sechs Monaten<br />
ab und reist schwer krank zurück nach Europa.<br />
Die literarische Reise von Charlie Marlow,<br />
von der dieser in Heart of Darkness<br />
erzählt, hat nun mit der tatsächlichen Reise<br />
des späteren Autors Joseph Conrad eine<br />
Reihe von Gemeinsamkeiten – der Autor<br />
ebenso wie seine literarische Figur erhalten<br />
ihren Posten <strong>als</strong> Kapitän nur dank der<br />
Intervention einer Tante bei den zuständigen<br />
Stellen in Brüssel; beide reisen flussaufwärts<br />
von der Mündung des Kongo ins<br />
Landesinnere und haben unterwegs mit<br />
denselben praktischen Schwierigkeiten zu<br />
kämpfen; beiden präsentiert sich die koloniale<br />
Wirklichkeit des Landes in ihrer ganzen<br />
Grausamkeit. Dennoch gibt es aber auch<br />
wesentliche Unterschiede zwischen den<br />
tatsächlichen und der literarischen Reise<br />
– Unterschiede, die ihre Begründung nicht<br />
zuletzt in der symbolischen Dimension finden,<br />
die der literarischen Reise ins Herz der<br />
Finsternis von Anfang an zukommt und die<br />
aus der Erzählung einen Schlüsseltext der<br />
Moderne macht.<br />
Unbestimmtheiten...<br />
Das Dominospiel wird nicht begonnen.<br />
Die Erzählung Heart of Darkness präsentiert<br />
sich dem Leser <strong>als</strong> eine Erzählung in<br />
121
der Erzählung – es gibt eine Rahmenhandlung,<br />
in der eine Gruppe von Freunden an<br />
Bord eines Schiffes nahe der Themsemündung<br />
auf den Wechsel der Gezeiten wartet,<br />
Charlie Marlow ist einer von ihnen – und<br />
eigentlich soll Domino gespielt werden, um<br />
die Wartezeit zu überbrücken. Die Steine<br />
sind schon zur Hand, aber statt zu spielen,<br />
beginnt Marlow eine scheinbar ebenso unvermittelte<br />
wie ziellose Erzählung von seiner<br />
Reise ins Herz der Finsternis. Keiner der<br />
Schauplätze in Marlows Geschichte hat einen<br />
Namen, alles bleibt im Unbestimmten<br />
– angefangen mit der zweideutigen Titelmetapher<br />
tauchen alle Orte im Text chiffriert<br />
auf: Brüssel ist die „Gräberstadt“, der Fluss<br />
Kongo taucht <strong>als</strong> riesige zusammengeringelte<br />
Schlange auf der Landkarte auf, das<br />
Land selbst wird nur <strong>als</strong> „Wildnis“ beschrieben...<br />
Conrads – oder Marlows – Erzählung<br />
lässt die reine Geographie auf diese Art und<br />
Weise mythisch grundiert und symbolisch<br />
überhöht erscheinen; alles kann hier auch<br />
<strong>als</strong> Zeichen für etwas anderes stehen, alles<br />
ist bedeutungsvoll und nichts wirklich konkret.<br />
Die Ambivalenzen setzen sich auch auf<br />
der Ebene der Personen fort: außer Marlow<br />
selbst und dem genial-dämonischen Elfenbeinagenten<br />
Kurtz, dessen Station im Inneren<br />
des Landes immer mehr zum Ziel von<br />
Marlows Reise wird, hat niemand in der<br />
Erzählung einen Namen – stattdessen werden<br />
alle Figuren nur mit ihren Funktionen<br />
bezeichnet, der Manager ebenso wie der<br />
Prokurist der Handelsgesellschaft. In der<br />
Darstellung der ganzen Absurdität dieser<br />
europäisch-bürokratisierten Lebensformen<br />
mitten im Dschungel scheinen nicht zuletzt<br />
weitere Ambivalenzen des Textes und seiner<br />
Intentionen auf – ist er <strong>als</strong> grundsätzliche<br />
Kritik an diesen kafkaesken Verwaltungsapparaten<br />
zu verstehen, oder sogar <strong>als</strong> Anklage<br />
der kolonialen Ausbeutungsmechanismen?<br />
Marlow wie Conrad legen sich nicht<br />
fest – bei ihnen wird erzählt, und dieses Erzählen<br />
muss notwendig immer unbestimmt<br />
bleiben – unbestimmter auch <strong>als</strong> zum Beispiel<br />
ein Dominospiel, bei dem stets klar ist,<br />
welcher Anschluss wozu passt.<br />
Stimmen<br />
Marlows Erzählung überbrückt das Warten<br />
auf den Wechsel der Gezeiten. Aber sie<br />
berichtet auch vom Warten – immer wieder<br />
muss der Icherzähler auf seiner Reise<br />
im Kongo warten, darauf, dass die Reise beginnt,<br />
darauf, dass sein Dampfer repariert<br />
wird, darauf, dass er Kurtz trifft, darauf,<br />
dass sich der Nebel lichtet. Die beiläufige<br />
Langsamkeit von Marlows Erzählung hat<br />
<strong>als</strong>o ihren Grund – und im Verlauf von dieser<br />
Erzählung wird es langsam dunkel über<br />
der Themse. Die Freunde, die um den Erzähler<br />
Marlow herumsitzen, nehmen von<br />
ihm nichts mehr wahr außer seiner Stimme,<br />
die auf diese Weise seltsam losgelöst von der<br />
Person über dem Schiff schwebt. Nicht einmal,<br />
wer von der Gruppe dieser körperlosen<br />
Stimme wirklich noch zuhört, ist auszumachen<br />
– es gibt nichts weiter <strong>als</strong> die Stimme<br />
und die Geschichte, die sie erzählt: „For a<br />
long time already [Marlow], sitting apart,<br />
had been no more to us than a voice...“<br />
Auch innerhalb der Geschichte, die Marlow<br />
erzählt, ist immer wieder die Rede von einer<br />
Stimme, die ihre Zuhörer fesselt: der Elfenbeinagent<br />
Kurtz zieht mit seiner Stimme sowohl<br />
seine Gefolgsleute <strong>als</strong> auch die Schwarzen<br />
rund um seine Station und nicht zuletzt<br />
auch Marlow selbst in seinen Bann – und<br />
vor allem dank dieser Fähigkeit ist Kurtz<br />
der erfolgreichste Agent der Handelsgesellschaft.<br />
Dieser „Macht der Mündlichkeit“,<br />
die in jenen Passagen aufscheint, in denen<br />
die Faszination beschrieben wird, die Kurtz<br />
auf seine Zuhörer ausübt, setzt der Text von<br />
Conrads Heart of Darkness aber ein anderes<br />
Modell entgegen. Dieses Modell ergänzt die<br />
Vorstellung von der Mündlichkeit nur teilweise<br />
– teilweise stellt es diese Vorstellung<br />
aber gerade auch in Frage: Wenn in Conrads<br />
Erzählung ein Buch <strong>als</strong> Symbol für die europäische<br />
Zivilisation schlechthin beschrieben<br />
wird, dann werden damit ganz andere Ideen<br />
aktiviert <strong>als</strong> die, die seine eigene – eben<br />
doch nur scheinbar mündliche – Erzählung<br />
vordergründig motivieren.<br />
Der Seemann Charlie Marlow findet mitten<br />
im Kongo, in einer verlassenen Hütte<br />
am Ufer des Flusses, ein zerfleddertes Buch<br />
– An Inquiry into some Points in Seamanship,<br />
versehen mit handschriftlichen Anmerkungen<br />
des vorherigen Besitzers. Das<br />
122
Buch scheint nicht allein deshalb fehl am<br />
Platz, weil es ein europäischer Text mitten<br />
in der afrikanischen „Wildnis“ ist, sondern<br />
auch, weil es Anweisungen für die Schifffahrt<br />
auf dem offenen Meer enthält, das<br />
von dem Fundort am Ufer des Flusses Kongo<br />
denkbar weit entfernt ist. Dennoch ist<br />
die Autorität des Buches ungebrochen: bei<br />
Marlows Spurensuche in der Fremde und<br />
im Fremden wird dieses Buch zum Phantombild<br />
des Vertrauten und zum Orientierungspunkt<br />
im Unbestimmten.<br />
Das Buch im Buch<br />
So wie in Heart of Darkness die Figur<br />
Charlie Marlow sein in der Wildnis gefundenes<br />
Seemannshandbuch liest, so liest<br />
später der Autor André Gide in eben derselben<br />
Wildnis Joseph Conrad: das europäische<br />
Buch wird auch für diesen Reisenden<br />
in der afrikanischen Wildnis zum Anhaltsoder<br />
Bezugspunkt, der ihm hilft, seinen<br />
Weg durch diese Wildnis zu bahnen. Der<br />
Seemann und Leser Marlow findet auf seiner<br />
Reise im Kongo – und durch diese Reise<br />
– seine Stimme und wird zum Erzähler.<br />
Der Schriftsteller André Gide wird dagegen<br />
auf seiner Reise in besonderer Weise zum<br />
Leser – zum Leser eines Buches, das gerade<br />
in seiner Unbestimmtheit immer wieder<br />
neue Anschlüsse ermöglicht. Joseph Conrads<br />
Novelle ist deshalb nicht durch einen<br />
Mangel, sondern eher eine Fülle an Bedeutung<br />
gekennzeichnet – diese entsteht immer<br />
wieder aufs Neue in der Übermittlung<br />
der vielen kleinen Unbestimmtheiten dieser<br />
Erzählung, und so in jeder neuen Lektüre<br />
von Heart of Darkness.<br />
Zum Weiterlesen<br />
Kaplan, Carola M.: Conrad the Pole: Definitely<br />
not „One of Us“, in: Alex S. Kurczaba<br />
(Hg.): Conrad and Poland, Lublin/New<br />
York 1996, S. 135-151.<br />
Putnam, Walter C. III: L’aventure littéraire<br />
de Joseph Conrad et d’André Gide, Saratoga<br />
1990.<br />
Schwarz, Daniel R.: Rereading Conrad,<br />
Columbia 2001.<br />
Speary, Susan: The Readability of Conrad’s<br />
Legacy: Narrative, Semantic and Ethical<br />
Navigations into and out of „Heart of<br />
Darkness“, in: Attie de Lange/Gail Fincham<br />
(Hg.): Conrad in Africa: New Essays<br />
on „Heart of Darkness“, Lublin/New York<br />
2002, S. 41-64.<br />
Watt, Ian: Essays on Conrad, Cambridge<br />
2000.<br />
West, Russell: Conrad and Gide. Translation,<br />
Transference and Intertextuality,<br />
Amsterdam/Atlanta 1996.<br />
Wiggershaus, Renate: Joseph Conrad,<br />
München 2000.<br />
Und natürlich:<br />
Joseph Conrad: Heart of Darkness, edited<br />
by Robert Kimbrough, New York/London<br />
1988<br />
123
Schwierigkeiten bei der Missionierung des<br />
Weltraums<br />
Anstöße für die Theologie in der Science-Fiction-Literatur von<br />
Stanislaw Lem<br />
von Clemens Bohrer<br />
Bei der Missionierung des Weltraums trifft Pater Lazimon auf ungeahnte Probleme:<br />
Die extrem kälteempfindlichen Quintolen wollen nach ihrem Tod statt<br />
ins Paradies lieber in die Hölle, weil es dort angenehm heiß ist. Der polnische<br />
Science-Fiction-Autor Stanislaw Lem versetzt religiöse Ansichten in eine skurrile<br />
Zukunft und gibt einer theologischen Betrachtungsweise in doppelter Hinsicht<br />
einen Anstoß.<br />
Quelle: Wikipedia<br />
Auf seiner 21. Reise landet Ijon Tichy auf<br />
Dychtonien, einem erdähnlichen Planeten,<br />
auf dem er in einem Kloster des Destruktianerordens<br />
Aufnahme findet. Die Mönche,<br />
so erfährt Tichy, leben im Verborgenen,<br />
weil sie die letzten Gläubigen in einer Welt<br />
sind, deren Einwohner den Glauben verloren<br />
haben und nunmehr sogar die verbliebenen<br />
Geistlichen verfolgen. Sein Aufenthalt<br />
erlaubt Tichy auch intensive Studien<br />
der dychtonischen Theologie, die angesichts<br />
der technologischen Entwicklung nach und<br />
nach alle wesentlichen Glaubensätze und<br />
Dogmen aufgeben musste. Erfindungen wie<br />
das Klonen oder die Wiedererweckung von<br />
Menschen aus DNA-Resten, Bewusstsein<br />
und Intelligenz in Computern und sogar<br />
Flüssigkeiten und die beliebige Programmierung<br />
von Persönlichkeiten und deren Glaubensgrundsätzen<br />
setzten die dychtonische<br />
Kirche im Laufe der Jahrhunderte immer<br />
mehr unter Druck. So musste die Kirche<br />
beispielsweise zustimmen, dass auch intelligente<br />
Maschinen und Flüssigkeiten der Sakramente<br />
teilhaftig werden oder einsehen,<br />
dass Glaube nicht ein Akt der Entscheidung<br />
sondern ein Produkt der biopsychischen<br />
Programmierung ist. Die letzten Gläubigen<br />
auf Dychtonien, so stellt Tichy schließlich<br />
fest, sind Computer in der Kleidung und<br />
mit dem Aussehen von Mönchen.<br />
Die Episode mit den Computermönchen<br />
kann beispielhaft für die vielen skurrilen<br />
Abenteuer sein, die Stanislaw Lem seinen<br />
Helden Ijon Tichy in den Reiseberichten<br />
erleben lässt, die unter dem Titel Sterntagebücher<br />
zusammengefasst sind. Neben dem<br />
Roman Solaris von 1960 sind die 1957 veröffentlichten<br />
Sterntagebücher wohl das bekannteste<br />
Werk von Lem, der im März 2006<br />
im Alter von 84 Jahren in Krakau verstorben<br />
ist. Seine Werke wurden in 57 Sprachen<br />
übersetzt und sind in einer Auflage von über<br />
45 Millionen weltweit erschienen, der Roman<br />
Solaris wurde zweimal verfilmt (zuletzt<br />
2003).<br />
Lem wurde 1921 in der polnischen Stadt<br />
Lwiw geboren, absolvierte eine Medizinausbildung<br />
und beschäftigte sich mit Fragestellungen<br />
auf dem Gebiet der Philosophie,<br />
Kybernetik und Mathematik. Während des<br />
Zweiten Weltkriegs schloss er sich der Wi-<br />
124
derstandbewegung gegen die deutschen<br />
Besatzer an, die ihn zeitweise zwangen <strong>als</strong><br />
Kraftfahrzeugsmechaniker und Schweißer<br />
zu arbeiten. Der „katholisch erzogene Atheist<br />
mit jüdischem Familienhintergrund“<br />
(FAZ vom 29.03.2006, 39) nahm in seinen<br />
Werken viele Entwicklungen wie die Genund<br />
Nanotechnik, den bargeldlosen Zahlungsverkehr<br />
und den Biochip früh vorweg.<br />
Bezeichnend für Lems Stil ist sein satirischer<br />
Zugang zu diesen Themen, der sich<br />
durch einen ernsthaften und mitunter protokollhaften<br />
Ton bei der Schilderung absurder<br />
und phantastischer Zukunftsszenarien<br />
auszeichnet. Die Faszination, die etwa der<br />
Leser der Sterntagebücher empfindet, rührt<br />
von einem unnachahmlichen Einfallsreichtum<br />
und einer sprühenden Phantasie bei der<br />
Anlage der Geschichten. So entfernt und<br />
abstrus die Abenteuer zunächst wirken, die<br />
Lems Helden erleben, so nah sind sie doch<br />
wieder der Lebenswelt seines Publikums.<br />
Hinter all den Unmöglichkeiten scheinen<br />
doch die Problemstellungen und Fragen der<br />
Gegenwart auf, auch wenn sie unter den<br />
Bedingungen des literarischen Genres in<br />
absurder Weise zugespitzt werden:<br />
Auf seiner 22. Reise begegnet Ijon Tichy<br />
einem Dominikanerpater. Pater Lazimon ist<br />
Chef der Weltraummission in einem Gebiet<br />
von 2.400.000 bewohnten Planeten und<br />
klagt dem Gast sein Leid mit dem Fortgang<br />
der Mission. Auf vielen Planteten stößt die<br />
Lehre der Kirche auf ungeahnte Schwierigkeiten,<br />
etwa bei den Quintolen, die bei einer<br />
Temperatur von 600 Grad Celsius frieren<br />
und sich daher nach ihrem Tod lieber<br />
in der Hölle <strong>als</strong> im Paradies wiederfänden.<br />
Da die Quintolen darüber hinaus fünf verschiedene<br />
Geschlechter haben, ist es für<br />
die Theologie ein heikles Problem, wer in<br />
den Priesterstand treten darf. Bei den Bischuten<br />
ist dagegen die Auferstehung etwas<br />
alltägliches, die Dartriden wollen sich mit<br />
dem Schwanz bekreuzigen, weil sie weder<br />
Hände noch Füße haben. Die Bewohner<br />
des Planeten Arpetusa sind hingegen vom<br />
Aussterben bedroht, sie haben aufgehört<br />
Ehen zu schließen und Kinder zu zeugen,<br />
weil es sie so heftig nach Erlösung verlangt,<br />
dass sie massenhaft in die Klöster eintreten<br />
und das Zölibat einhalten. Die frommen<br />
Memnogen schließlich haben ihrem Missionar<br />
Pater Oribas aus Nächstenliebe und<br />
um seines Seelenheils willen einen so grauenvollen<br />
Märtyrertod bereitet, dass sie sich<br />
sicher sind ihm den Status eines Heiligen<br />
und somit einen Platz im Himmelreich geschenkt<br />
zu haben.<br />
Diese und ähnliche Erzählungen von<br />
Stanislaw Lem sind Anstöße. Zunächst in<br />
einem durchaus wörtlichen Sinn, nämlich<br />
<strong>als</strong> Geschichten, an denen man Anstoß<br />
nehmen kann. Mancher könnte es <strong>als</strong> Verspottung<br />
seines Glaubens empfinden, wenn<br />
Stanislaw Lem einen Computer <strong>als</strong> Prior<br />
eines Ordens vorstellt, die kirchliche Lehre<br />
durch die Erfindung außerirdischer Gläubiger<br />
absurd werden lässt oder Glaubenssätze<br />
durch die Anwendung auf abstruse<br />
zukünftige Gesellschaftssysteme der Lächerlichkeit<br />
preisgibt. Ihre „Anstößigkeit“<br />
erhalten Lems Erzählungen durch eine bestimmte<br />
Technik, die er zumindest in den<br />
Geschichten, in denen religiöse oder theologische<br />
Themen eine Rolle spielen, immer<br />
wieder benutzt. Der polnische Science-Fiction-Autor<br />
entwirft dabei regelmäßig ein<br />
phantastisches Szenario, das er weit in die<br />
Zukunft oder auf einen fremden Planeten<br />
verlegt. In das auf diese Weise entstandene<br />
Hintergrundbild platziert er Menschen und<br />
Meinungen, wie er sie aus seiner eigenen<br />
Zeit und Umwelt kennt. So ist die Lehre der<br />
dychtonischen Kirche, die Lem <strong>als</strong> Zerrbild<br />
in Anlehnung an die Lehre der katholischen<br />
Kirche entwirft, in der futuristischen Umwelt<br />
zwangsläufig ein Anachronismus. Die<br />
Methoden der Weltraummission bleiben<br />
die gleichen wie der Leser sie aus dem Geschichtsunterricht<br />
kennt, d.h. die Prediger<br />
werden nicht auf die in der Zukunft liegende<br />
Situation weiterentwickelt, sondern Lem<br />
entwirft sie geradezu <strong>als</strong> absurden Kontrapunkt.<br />
Der Leser empfindet die Lächerlichkeit<br />
bestimmter Glaubenssätze in der von<br />
Lem erfundenen Welt wie man heute vielleicht<br />
das Tragen von gepuderten Perücken<br />
in deutschen Gerichtssälen lachhaft finden<br />
würde. Oder um es in einem Bild aus dem<br />
Neuen Testament auszudrücken: Stanislaw<br />
Lem bringt neuen Wein und alte Schläuche<br />
in einer Weise zusammen, dass die Behälter<br />
reißen müssen und die Unsinnigkeit des<br />
Unternehmens klar wird. Dem Autor steht<br />
natürlich die katholische Kirche in Polen in<br />
125
der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts vor Augen<br />
und er bedient sich bestimmter charakteristischer<br />
Rollen oder Äußerungen auf der<br />
Seite von Theologie und Kirche, um diese<br />
bewusst in eine Umgebung zu verpflanzen,<br />
in der sie unzeitgemäß wirken müssen. Lem<br />
führt keine theologische Debatte gegen den<br />
Zölibat oder gegen bestimmte Lehrsätze.<br />
Aber er stellt sie literarisch so geschickt in<br />
eine skurrile Umwelt, dass der Leser nicht<br />
nur die Umwelt, sondern auch die religiösen<br />
Praktiken oder Meinungen für absurd halten<br />
muss.<br />
Die Geschichten Lems sind „philosophisch-utopische<br />
Traktate und Fabeln über<br />
das Verhältnis des Menschen zur Technik,<br />
Bagatellen voll abstruser Ideen und Spinnereien,<br />
voller Schalkhaftigkeit und Witz“<br />
(taz vom 29. März 2006, 16). Dabei mag<br />
man es belassen und die Erzählungen mit<br />
mehr oder minder großer Freude lesen. Im<br />
Sinne eines Anstoßes können sie auch eine<br />
Herausforderung für die theologische Forschung<br />
sein. Denn ein ernster Kern liegt<br />
sicher in der den Texten impliziten Aufforderung,<br />
dass sich Theologie auf die Bedingungen<br />
der jeweiligen Zeit und Lebenswelt<br />
einlassen muss. Zeitgenossenschaft im<br />
Sinne der Berücksichtigung von gegenwärtiger<br />
Kultur im Hinblick auf theologische<br />
Fragestellungen und die Kommunikation<br />
theologischer Einsichten in die Gesellschaft<br />
hinein kommt insoweit eine erhöhte Bedeutung<br />
zu, <strong>als</strong> dass die Lebenswelt vieler Menschen<br />
sich in einem stetigen Veränderungsprozess<br />
befindet. Am eindrücklichsten lässt<br />
sich dieser Prozess vielleicht an der technischen<br />
Entwicklung im Bereich elektronischer<br />
Medien festmachen, durch die sich<br />
die Informations- und Kommunikationswelt<br />
radikal gewandelt hat. Aber auch Fortschritte<br />
in der Medizin fordern die theologische<br />
Ethik in einer Weise heraus, wie es<br />
vor einigen Jahrzehnten noch nicht absehbar<br />
war. Stanislaw Lems Geschichten zeigen<br />
eine Kluft auf, die der Autor zwischen einer<br />
für die Zukunft erdachten Kultur und einer<br />
an der Vergangenheit orientierten Haltung<br />
bestimmter Protagonisten erzeugt. Diese<br />
Kluft wird mitunter ins Extreme und Lächerliche<br />
gesteigert, wenn die Protagonisten<br />
die Probleme der Zukunft mit den Mitteln<br />
und Lösungsansätzen einer weit entfernten<br />
Vergangenheit angehen wollen. Die Erzählungen<br />
von Lem können ins Bewusstsein<br />
rücken, dass eine Veränderung der Lebenswelt<br />
durch Technologie auch die Theologie<br />
nicht unberührt lässt. Am einfachsten<br />
lässt sich dies in der Tat auf dem Gebiet der<br />
Medizintechnik zeigen, wo Stichworte wie<br />
Pränataldiagnostik oder Stammzellenforschung<br />
die theologisch-ethische Diskussion<br />
in Gang hält. Etwas hintergründiger, aber<br />
nichts desto trotz sehr wirkmächtig sind Errungenschaften<br />
auf dem Gebiet der Informationstechnologie,<br />
die in mancher Hinsicht<br />
für die Theologie herausfordernd sein<br />
können: Internetdienste wie Google Earth<br />
oder Wikipedia scheinen am Horizont das<br />
Versprechen der Allwissenheit aufleuchten<br />
zu lassen, Auferstehung ist in den virtuellen<br />
Welten der Massive Multiplayer Online Roleplaying<br />
Games wie World of Warcraft und<br />
damit im Erfahrungsbereich vieler Kinder<br />
und Jugendlichen eine Alltagserscheinung<br />
und die Beichte kann heute auch im Internet<br />
abgelegt werden, zumindest nach Meinung<br />
bestimmter Webmaster mit entsprechendem<br />
Angebot. Technologie, so kann<br />
man schließen, hat nicht nur in den entfernten<br />
und phantastischen Zukunftswelten<br />
von Stanislaw Lem theologische Relevanz,<br />
sondern fordert die aktuelle theologische<br />
Forschung heraus keine Kluft zwischen Lebenswelt<br />
und Botschaft entstehen zu lassen.<br />
Zum Weiterlesen<br />
Stanislaw Lem, Sterntagebücher, Frankfurt<br />
am Main 1998<br />
126
Wer ist Maciek?<br />
von Mechthild Barth<br />
In Wartime Lies erzählt Louis Begley von einem jüdischen Jungen, der mit<br />
seiner schönen Tante quer durch Polen vor dem Tod flieht. Verbirgt sich hinter<br />
diesem Roman in Wahrheit eine Autobiographie? Hilft das Versteckspiel mit der<br />
eigenen Vita dem Erinnern? Wie viel Dichtung und wie viel Wahrheit verträgt<br />
Erinnerung?<br />
Louis Begleys erster Roman Wartime Lies<br />
(auf Deutsch unter dem Titel Lügen in Zeiten<br />
des Krieges veröffentlicht) wurde seit seinem<br />
Erscheinen Anfang der 90er Jahre von der<br />
Kritik hoch gelobt und von vielen gelesen.<br />
Das Interesse der Öffentlichkeit galt zum<br />
einen dem Autor, der sich überraschenderweise<br />
<strong>als</strong> ein erfolgreicher, 57-jähriger Anwalt<br />
aus New York entpuppte; zum anderen<br />
stellte sich von Anfang an die Frage, inwieweit<br />
der Roman über den jüdischen Jungen<br />
Maciek, der vor der nation<strong>als</strong>ozialistischen<br />
Verfolgung quer durch Polen flieht, erfunden<br />
war. Denn eigentlich glich er mehr einer<br />
Autobiographie. Wurde diese Geschichte<br />
vielleicht nur <strong>als</strong> Roman ‚getarnt‘?<br />
Gewisse Parallelen zwischen der Kindheit<br />
des Autors und der Macieks sind jedenfalls<br />
äußerlich vorhanden: Louis Begley wurde<br />
<strong>als</strong> Ludwig Beglejter 1933 im dam<strong>als</strong> noch<br />
polnischen Stryj (heute Ukraine) <strong>als</strong> einziger<br />
Sohn eines jüdischen Arztes und seiner<br />
Frau geboren und versteckte sich während<br />
des Zweiten Weltkriegs gemeinsam mit<br />
der Mutter an verschiedenen Orten in Polen.<br />
Maciek hingegen – ebenfalls Sohn eines<br />
Arztes – begibt sich zusammen mit seiner<br />
einfallsreichen und schönen Tante Tania auf<br />
die Flucht vor dem Tod.<br />
Auch im Roman selbst stellt sich gleich<br />
zu Beginn die Frage nach der Identität der<br />
Hauptfiguren, denn die Kindheit Macieks<br />
wird in einer Vorgeschichte mehr <strong>als</strong> vierzig<br />
Jahren später von einem Mann um die<br />
fünfzig erinnert (<strong>als</strong>o mehr oder weniger<br />
demselben Alter wie Begley). Er bleibt im<br />
Grunde inkognito, seine äußeren Umstände<br />
werden nur angedeutet. Das Versteckspiel,<br />
das der Junge gemeinsam mit seiner Tante<br />
betreiben muss, um zu überleben, scheint<br />
auch dieser Mann, von dem wir nicht einmal<br />
den Namen erfahren, noch weiterzuführen.<br />
So sind von Anfang an die Parallelen<br />
zwischen ihm und dem Jungen Maciek<br />
verschwommen gelassen: „He thinks on the<br />
story of the child that became such a man.<br />
For the sake of an old song, he calls the child<br />
Maciek.“<br />
Noch wichtiger <strong>als</strong> die Frage nach Autenthizität<br />
scheinen mir allerdings die Fragen<br />
nach Identität und Erinnerung zu sein, die<br />
sich durch das Verschleiern der Geschichte<br />
und ihrer inneren Zusammenhänge stellen:<br />
Zu welcher Identität kann ein Heranwachsender<br />
gelangen, wenn er eben diese leugnen<br />
muss, um zu überleben? Hilft das Verfremden,<br />
das Literarisieren der eigenen Vita, unerträgliche<br />
Erinnerungen – zumindest auf<br />
Papier – zu bannen? Schreibt man auch gegen<br />
das Vergessen an, wenn man eine fiktive<br />
127
Variante möglichen (Über-)Lebens erzählt,<br />
hinter der sich vielleicht die tatsächlich<br />
stattgefundene Geschichte verborgen hält?<br />
Bereits der Titel Wartime Lies weist auf<br />
die Thematik von Begleys Romans hin.<br />
Maciek und seine Tante überstehen den<br />
Holocaust nur mit Hilfe eines Rollenwechsels:<br />
Aus den galizischen Juden werden polnische<br />
Katholiken. Die beiden fliehen von<br />
Versteck zu Versteck, wobei das ständige<br />
Verstellen zur wichtigsten Überlebensstrategie<br />
wird. Im Alter zwischen sechs und elf<br />
durchläuft der Junge, der die Geschichte<br />
aus seiner Perspektive erzählt, eine höchst<br />
eigentümliche Schule des Lebens, die dem<br />
Ideal, wie es in klassischen Bildungsromanen<br />
oder auch in traditionellen, dem Humanismus<br />
verpflichteten Autobiographien<br />
vertreten wird, geradezu ins Gesicht schlägt:<br />
Um des nackten Überlebens Willen wird er<br />
strikt dazu angehalten, ein f<strong>als</strong>ches Spiel zu<br />
treiben und unbedingt seine wahre Identität<br />
zu verbergen und zu leugnen. Macieks prägende<br />
Erfahrung wird die der Verstellung<br />
und der Täuschung, und so gestaltet sich<br />
seine Entwicklung von einem unbedarften<br />
Kind zu einem perfekten Lügner.<br />
Dieses Versteckspiel setzt der namenlose<br />
Mann auch Jahrzehnte später noch<br />
fort. Seine Kindheit kann nur <strong>als</strong> „the stuff<br />
of nightmares“ beschrieben werden, und<br />
dementsprechend ist seine Verbindung zur<br />
Vergangenheit eine ausgesprochen ambivalente,<br />
die es ihm unmöglich macht, seine<br />
Geschichte ohne eine fiktionale Brechung<br />
zu erzählen. Die Fiktionalisierung des eigenen<br />
Lebens – mag sie nun <strong>als</strong> Kunstgriff<br />
innerhalb des Romans geschehen oder <strong>als</strong><br />
Verfremdung der Autobiographie – ermöglicht<br />
es dem Erzählenden, sich der inneren<br />
Wahrheit zu nähern, selbst wenn die äußeren<br />
Ereignisse dabei abgeändert werden. So<br />
berichtet das Kind Maciek in der Hauptgeschichte<br />
über ein Leben, welches das des<br />
Mannes der Rahmenhandlung, aber auch<br />
das des Autors sein könnte, jedoch genau so<br />
nicht stattgefunden haben muss.<br />
Gleichzeitig spiegelt sich in dieser Fiktionalisierung<br />
beziehungsweise Verschleierung<br />
der eigenen Geschichte auf Romanebene<br />
die prägende Welterfahrung des Kindes wider,<br />
das nur zu überleben vermag, wenn es<br />
sich selbst verleugnet. Zwar versucht Tania<br />
durchaus, ihrem Neffen ein Bewusstsein<br />
für seine Herkunft zu vermitteln, indem sie<br />
ihn heimlich in den jüdischen Glauben einführt,<br />
während er offiziell auf die Erstkommunion<br />
vorbereitet wird, doch letztendlich<br />
ist es die Perfektionierung der Täuschung,<br />
die Maciek am stärksten formt. Seine gesamte<br />
Existenz verdankt er einer Lüge, und<br />
so wundert es nicht, dass auch der Mann der<br />
Vorgeschichte, der wohl ebenfalls eine von<br />
Gefahr und Vernichtung geprägte Kindheit<br />
erleben musste, seine Identität nicht entblößen<br />
möchte oder diese vielleicht nicht einmal<br />
wirklich nennen könnte.<br />
Zudem wirft die Thematik und die damit<br />
verknüpfte erzählerische Konstruktion<br />
von Wartime Lies ein anderes Licht auf eine<br />
grundsätzliche Problematik beim Schreiben<br />
über die Shoa. In den ersten Jahrzehnten<br />
nach dem Ende des Nation<strong>als</strong>ozialismus<br />
war es das Bedürfnis nach einem<br />
faktentreuen Zeugnis der Überlebenden,<br />
das viele Schreibende veranlasste, eine<br />
möglichst exakte Wiedergabe ihrer Erlebnisse<br />
anzustreben. Gerade in der Literatur<br />
über den Holocaust sind res factae und res<br />
fictae lange <strong>als</strong> unversöhnbare Opponenten<br />
betrachtet worden – eine Haltung, die sich<br />
im Grunde erst seit Beginn der 90er Jahre<br />
allmählich verändert hat. Nicht die empirische<br />
Wahrheit ist heutzutage mehr das<br />
ausschließliche Kriterium, das hier anzulegen<br />
ist, sondern vielmehr wird die Fiktion<br />
<strong>als</strong> Bestandteil der Wahrheit angesehen, die<br />
jeder einzelnen Version innewohnt. Gerade<br />
in der Fiktionalisierung lässt sich eine Form<br />
finden, die sowohl die Schwierigkeit von<br />
„Dichtung und Wahrheit“ beim autobiographischen<br />
Schreiben zum Ausdruck <strong>als</strong><br />
auch eine individuelle Traumatisierung zu<br />
einer allgemeinen Darstellung bringt und<br />
dadurch eine weitere Tür zum Verständnis<br />
einer solchen Erfahrung öffnet.<br />
Das Schreiben über die Shoa findet mehrere<br />
Jahrzehnte danach unter anderen Vorzeichen<br />
statt, wie man das auch deutlich<br />
bei Begley erkennen kann, dessen Wartime<br />
Lies teilweise sogar an einen Abenteuerroman<br />
erinnert. Heutzutage, wo die Fakten<br />
über den Holocaust mehr oder weniger be-<br />
128
kannt zu sein scheinen, kann das Bekannte<br />
auf eine irritierende Weise neu erzählt werden,<br />
<strong>als</strong> wäre es das erste Mal. Werke wie<br />
Ruth Klügers weiter leben, Sarah Kofmans<br />
Rue Ordener. Rue Labat oder Art Spiegelmans<br />
Comic Maus zeigen deutlich, dass<br />
nicht mehr so sehr eine Wertung der Geschehnisse<br />
im Vordergrund steht <strong>als</strong> vielmehr<br />
die Einflüsse auf das Individuum, das<br />
subjektive Erfahren.<br />
Ein Roman wie Wartime Lies, der die<br />
Geschichte eines Überlebens erzählt und<br />
die Auswirkungen dieses Überlebens auf<br />
das Individuum nicht nur schildert, sondern<br />
eben auch narrativ darstellt, ermöglicht<br />
eine neue Perspektive auf ein in unserer<br />
Kultur inzwischen tief verankertes Weltwissen.<br />
Diese neue Sicht lässt uns fragen, wie<br />
wir mit solchen zentralen Gedächtnisorten<br />
wie dem Trauma der Shoa in unserer Zeit<br />
umgehen sollen. Ähnlich wie die so lange<br />
andauernde Diskussion um das Holocaust-<br />
Denkmal in Berlin sind Werke wie Wartime<br />
Lies, Imre Kertész’ Roman eines Schicksallosen<br />
oder Roberto Benignis Film Das Leben<br />
ist schön von größter gesellschaftlicher Relevanz.<br />
Denn sie lassen uns unter anderem<br />
darüber nachdenken, wie die Erinnerung an<br />
die Shoa weitergegeben werden soll und befähigen<br />
den Leser oder Zuschauer dazu, auf<br />
bekannte, ja vertraute Themen einen neuen,<br />
unverbrauchten Blick zu werfen und somit<br />
zu einem anderen Umgang mit ihnen zu gelangen.<br />
narrativen Inszenierung, wie stark die historische<br />
Erfahrung von Verfolgung und Vernichtung<br />
noch in unser Jetzt hineinreicht<br />
und es prägt.<br />
Literatur<br />
Louis Begley: Wartime Lies. New York:<br />
Knopf 1991.<br />
Imre Kertész: Roman eines Schicksallosen.<br />
Berlin: Rowohlt 1994.<br />
Ruth Klüger: weiter leben. Eine Jugend.<br />
Göttingen: Wallstein 1992.<br />
Sarah Kofman: Rue Ordener. Rue Labat.<br />
Autobiographisches Fragment. Tübingen:<br />
edition diskord 1995.<br />
Art Spiegelman: Maus. A Survivor‘s Tale.<br />
New York: Pantheon Books 1986.<br />
Die Frage nach der Identität des Kindes<br />
Maciek wird im Roman Begleys am Ende<br />
negativ beantwortet. Der Verlust der Kindheit<br />
führt auch zu einem Verlust des Selbst,<br />
da das Kind niem<strong>als</strong> die Möglichkeit erhalten<br />
hat, das zu sein, was es war: „And where<br />
is Maciek now? He became an embarrassment<br />
and slowly died.“ Der pessimistische<br />
Schluss straft die abenteuerlich anmutende<br />
escape story Lügen, da sie sich auf die dargestellte<br />
Weise letztendlich doch nur <strong>als</strong><br />
das Konstrukt des namenlosen Mannes herausstellt,<br />
der aufgrund seiner Erlebnisse in<br />
der Kindheit seine wahre Identität nicht zu<br />
enthüllen vermag und dem Holocaust auch<br />
<strong>als</strong> Erwachsener nicht entkommt. Dennoch<br />
schreibt auch er beziehungsweise der Autor<br />
mit dieser fiktiven Erinnerung gegen das<br />
Vergessen an und verdeutlicht mit seiner<br />
129
Witold Gombrowicz und der Antiroman<br />
von Maria Karger<br />
Wer war Witold Gombrowicz?<br />
Witold Gombrowicz stammte aus<br />
kleinem polnischem Landadel. Am 04. August<br />
1904 in Małoszyce geboren wuchs er in<br />
einer Umgebung auf, in der sehr viel Wert<br />
auf Tradition, Manieren, eben Form gelegt<br />
wurde. Provinziell und katholisch, adelig<br />
und polnisch, so wurde Gombrowicz erzogen<br />
– in einer Familie, in der sich seine<br />
Brüder noch duellierten, wenn jemand sie<br />
zu scharf fixiert hatte, in der die Eltern zu<br />
siezen waren und Mahlzeiten nach einem<br />
althergebrachten Zeremoniell eingenommen<br />
wurden. Das Hauptmotiv von Gombrowicz’<br />
Gesamtwerk – die Rebellion gegen<br />
Formen in jeder Hinsicht, sein Plädieren für<br />
das Ungeformte, Unfertige, Unreife – fußt<br />
nach seiner eigenen Aussage auch auf den<br />
Erfahrungen seiner Kindheit und Jugend:<br />
dem immerwährenden Sich-Aufreiben an<br />
Regeln und Riten.<br />
Den Erwartungen seiner Familie entsprechend<br />
studierte Gombrowicz in Warschau<br />
Rechtswissenschaften und arbeitete einige<br />
Jahre <strong>als</strong> Jurist. Das gab er jedoch auf, nachdem<br />
1933 sein erstes Buch Pamiętnik z okresu<br />
dojrzewania (dt.: Memoiren aus der Epoche<br />
des Reifens) erschien – allerdings nicht etwa<br />
deshalb, weil der Erzählband ein großer Erfolg<br />
gewesen wäre. Die Kritiker hielten das<br />
Werk für ebenso unfertig und unreif wie seinen<br />
Autor.<br />
Mit seinem nächsten Roman (bzw. Anti-<br />
Roman) Ferdydurke (1938) feiert Gombrowicz<br />
zwar auch keine großen Erfolge – er<br />
bleibt nach wie vor umstritten. Doch gilt<br />
er immerhin <strong>als</strong> junger und viel versprechender<br />
Nachwuchsliterat und erhält <strong>als</strong><br />
solcher eine Freikarte für eine Jungfernfahrt<br />
auf einem Passagierschiff. Abenteuerlustig<br />
tritt er die Reise ins ferne Buenos Aires an.<br />
Als aber kurz nach seiner Ankunft in Europa<br />
der zweite Weltkrieg ausbricht, verlängert<br />
Gombrowicz seinen Aufenthalt am Rio de<br />
la Plata – um ganze 24 Jahre. Um seinen Lebensunterhalt<br />
zu bestreiten, nimmt er eine<br />
Tätigkeit <strong>als</strong> Bankangestellter in der Banco<br />
Polacco auf, in seiner Freizeit verkehrt er mit<br />
jungen und unbekannten Künstlern in Bars<br />
und Cafes, spielt Schach und diskutiert.<br />
Vom europäischen Kulturbetrieb, wo er sich<br />
so gern profiliert hätte, bleibt er allerdings<br />
ausgeschlossen. Damit jemand von seinen<br />
Gedanken und Theorien Kenntnis nähme,<br />
publiziert Gombrowicz monatlich sein Dziennik<br />
(dt.: Tagebuch) in der polnischen Exilantenzeitschrift<br />
„Kultura“. Nach Meinung<br />
seiner Kritiker ist Dziennik Gombrowicz’<br />
vielschichtigstes, sprachgewaltigstes und bedeutendstes<br />
Werk. (Es geht dabei auch nicht<br />
wie in einem klassischen Tagebuch um stille<br />
Selbstergründung oder intime Geständnisse<br />
– man muss sich eher einen vielstimmigen<br />
Erzählerchor vorstellen, der den Leser direkt<br />
anspricht und alle inneren Widersprüche<br />
des Autors plastisch entwickelt.)<br />
Erst 1963 nimmt Gombrowicz eine Gelegenheit<br />
wahr, wieder nach Europa zurückzukehren:<br />
Mit einem Stipendium der<br />
Ford Foundation lebt er ein Jahr in West-<br />
Berlin; <strong>als</strong> das ausläuft, zieht er nach Südfrankreich,<br />
wo er 1969 an den Folgen seines<br />
Asthmas stirbt. Nach Polen ist er nie mehr<br />
zurück gekehrt.<br />
130
Worum ging es Witold Gombrowicz<br />
und wie setzte er es um?<br />
Eine Grundaussage durchzieht Gombrowicz’<br />
gesamtes schriftstellerisches Schaffen<br />
– und zwar inhaltlich ebenso wie auch in<br />
Sprache und Werkform: „Unser Lebenselement<br />
ist die ewige Unreife.“<br />
Mit Unreife meint Gombrowicz das<br />
Recht auf Individualität und geistige Freiheit,<br />
jenseits der „reifen Formen des Lebens“.<br />
Denn der Mensch, so Gombrowicz,<br />
besitze keinen eigenen ursprünglichen<br />
harten Persönlichkeitskern, keine dauerhafte<br />
Form – er ist per se <strong>als</strong>o unreif, unförmig.<br />
Andererseits ist er aber für seine<br />
Existenz und für sein Bewusstsein darauf<br />
angewiesen, eine „Form“ zu haben und<br />
nicht „a-morph“ dahinzutreiben. Zu dieser<br />
Form aber kann der Mensch nur im Umgang<br />
mit anderen Subjekten kommen, die<br />
ihn definieren, ihn formen, ihm „eine Fresse<br />
machen“. Erst im Umgang mit und in<br />
Abgrenzung zu anderen wird der Mensch<br />
jung oder alt, schön oder hässlich, klug oder<br />
dumm. Form ist für Gombrowicz <strong>als</strong>o die<br />
Kultur, das heißt Verhaltensnormen, Moral,<br />
Religion, Ideologie, aber auch Sprache,<br />
Kunst oder Liebe und die künstlerischen –<br />
vor allem literarischen – Konventionen. Die<br />
Unform hingegen ist das Freie, Natürliche,<br />
Ungestaltete im Menschen, das durch die<br />
äußeren Formen permanent eingeengt und<br />
angegriffen wird.<br />
Es geht <strong>als</strong>o immer um Polarität, um<br />
Form gegen Unform, um Reife gegen Unreife.<br />
Wie Gombrowicz diese Gegensätzlichkeit<br />
in seinen Werken zum Ausdruck<br />
gebracht hat, versteht man vielleicht am<br />
besten, wenn man ihn in Kontrast setzt<br />
zu einem anderen großen Schriftsteller des<br />
20. Jahrhunderts: Thomas Mann. Auch bei<br />
Thomas Mann war die Feder seines schriftstellerischen<br />
Schaffens die Polarität, insbesondere<br />
der permanente Kampf von Natur<br />
und Kultur. Thomas Mann reagiert darauf,<br />
indem er – ironischerweise – die Form selbst<br />
<strong>als</strong> Stilmittel aufbietet, <strong>als</strong> „Schutzwehr“ im<br />
Kampf gegen die Mächte des Chaos.<br />
Gombrowicz hingegen macht es ganz<br />
anders: Die Auseinandersetzung, die Abrechnung<br />
mit Zwängen und Konventionen<br />
vollzieht er nicht allein inhaltlich, nein: er<br />
bricht auch mit den Formen und den Konventionen<br />
der Darstellung selbst, er sprengt<br />
sie geradezu, indem er sprachlich und gestalterisch<br />
und damit den Eindruck von<br />
Groteske erzeugt).<br />
Das zeigt sich zum Beispiel an Ferdydurke,<br />
jenem großen Roman, der in Wahrheit<br />
ein Anti-Roman ist, ein Brechen mit der<br />
literarischen Gattung Roman, die Gombrowicz<br />
wie alle literarischen Kategorien<br />
aufgrund ihrer Formenstrenge für steril,<br />
versnobt und unehrlich gegenüber der Realität<br />
hält.<br />
Kennzeichnend dafür ist schon der Titel<br />
Ferdydurke, der nicht das Geringste mit<br />
dem Werk zu tun hat – ein Unsinnswort<br />
und nicht wie sonst bei einem Romantitel<br />
ein Name, ein Symbol oder ein Schlüsselbegriff<br />
für seinen Inhalt.<br />
An der Geschichte des Protagonisten Józio<br />
zeigt Gombrowicz dann, was er meint,<br />
wenn er sagt, dass erst die Gesellschaft den<br />
Menschen die „Fressen macht“. Eine „Fresse“<br />
(poln. geba) ist in der Sprache Gombrowicz’<br />
jene Maske, die den Menschen von<br />
den anderen übergestülpt wird. In Ferdydurke<br />
wird Józio, ein polnischer Schriftsteller<br />
von 30 Jahren, von den Kritikern für<br />
sein erstes Werk verrissen; man hält ihn für<br />
ebenso unreif und unausgegoren wie seine<br />
Texte (Biographische Parallelen zu Gombrowicz<br />
drängen sich auf!). Weil nun die<br />
Kritiker ihn für einen jungen und unbedarften<br />
Jüngling halten, bekommt er auch<br />
genau diese „Fresse“ aufgesetzt; im Buch<br />
wird diese Entwicklung aber völlig überspitzt<br />
und grotesk weitergeführt: Ein Herr<br />
Professor Pimko kommt Józio zu Hause besuchen<br />
und schleppt ihn fort, in ein Provinzgymnasium.<br />
Der Schriftsteller, der sich<br />
seines Alters und bereits abgeschlossenen<br />
Hochschulstudiums ja bewusst ist, versucht<br />
sich zu wehren, aber zu seinem Entsetzen<br />
stellt er fest, dass sich seine Stimme<br />
verändert, dass seine Hände zu Händchen<br />
und sein Kopf zu einem Köpfchen werden.<br />
Und aus seinem anfangs noch energischen<br />
Widerstand wird ein widerwillig gemachter<br />
Kratzfuß gegenüber dem Herrn Professor.<br />
131
Vor allem: Weder Lehrer noch Mitschüler<br />
an seinem neuen Wirkungsort erkennen<br />
sein wahres Alter: Als Kind betrachtet wird<br />
Józio schließlich wirklich zum Kind. Man<br />
hat ihm eine „Fresse gemacht“. Und wie jede<br />
„Fresse“ formt sie den Menschen um, verändert<br />
ihn auch in tiefsten Inneren. Józio wird<br />
seinem Äußeren entsprechend auch in seinem<br />
Wesen „infantilisiert“.<br />
Józio wird auch „verliebt gemacht“ und<br />
zwar in Sutka, die Tochter seiner Wirtsfamilie,<br />
bei der er <strong>als</strong> frisch gebackener Gymnasiast<br />
unterkommt. Er verliebt sich <strong>als</strong>o<br />
nicht aus freien Stücken und Gombrowicz<br />
illustriert damit seine höchst irritierende<br />
These, niemand könne sich ohne den<br />
Einfluss Dritter verlieben. Der eigene Enthusiasmus<br />
(auch für künstlerische Schönheit,<br />
für Musik oder Landschaften) erwächst<br />
nur in Interaktion mit der Begeisterung<br />
anderer. Denn das eigene ICH, das<br />
in sich selbst gründende Individuum, gibt es<br />
nicht und kann es nicht geben und kann daher<br />
auch keine Entscheidungen treffen.<br />
Sogar sich selbst (<strong>als</strong> schaffender Schriftsteller)<br />
sieht Gombrowicz <strong>als</strong> Opfer externer<br />
Formungsprozesse. In seinem Tagbuch notiert<br />
er, dass er seine Bücher „in der Angst<br />
vor der Kritik (…), im Hass gegen die Kritik<br />
und in der Begierde, der Kritik zu entgehen“<br />
schreibe.<br />
Nicht einmal der Sprache, seinem ureigenen<br />
Ausdrucksmittel traut Gombrowicz. Sie<br />
ist für ihn bereits eine das Individuum vergewaltigende<br />
Form, die in Wahrheit nicht<br />
dazu dient, die Wirklichkeit zu beschreiben,<br />
sondern die vielmehr die zu beschreibenden<br />
Erfahrungen überhaupt erst wesentlich konstituiert:<br />
Denn Wahrnehmung kann nicht<br />
„authentisch“ sein, sie wird immer durch die<br />
sprachliche Fähigkeit des Wahrnehmenden<br />
geprägt. Man versteht nicht, was man nicht<br />
benennen kann, und man versteht es auch<br />
nur so, wie man es benennen kann. Deshalb<br />
kann auch er <strong>als</strong> Schriftsteller nicht „frei<br />
schaffen“; notwendigerweise vordefiniert<br />
und von Konventionen geprägt sind seine<br />
künstlerischen Äußerungen durch den jeweiligen<br />
Gattungsrahmen<br />
„Jeder sagt nicht, was er sagen will, sondern<br />
was sich schickt. Die Worte vereinigen<br />
sich verräterisch hinter dem Rücken,<br />
und nicht wir sagen die Worte, sondern die<br />
Worte sagen uns (…)!“ lässt Gombrowicz<br />
die Hauptfigur Hendrik in „Die Trauung“<br />
sagen.<br />
Zugegeben – Gombrowicz’ mehr oder<br />
weniger existentialistische Theorien sind aus<br />
heutiger Sicht wenig originell (wobei er sie<br />
allerdings 20 Jahre vor ihrem Durchbruch<br />
in Philosophie und Soziologie formulierte).<br />
Sein Verdienst liegt vielmehr darin, dass<br />
es ihm gelungen ist, seine Ideen in lebendige,<br />
zugleich sehr intensive und vor allem<br />
auch lustige und lesbare künstlerische Texte<br />
umzusetzen.<br />
Wie wurde und wird<br />
Witold Gombrowicz rezipiert?<br />
Gombrowicz zehrte zu Lebzeiten wenig<br />
von seinem schriftstellerischem Ruhm. Vor<br />
der Emigration war er allenfalls umstritten,<br />
später nur wenig beachtet. In Polen sind seine<br />
Bücher wegen seiner unverhohlenen Kritik<br />
an der nationalen Tradition viele Jahre<br />
verboten.<br />
Erst in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts<br />
gelangte Gombrowicz zu Weltruhm.<br />
Seine Theaterstücke wurden nach<br />
Jahrzehnten uraufgeführt, seine Prosa, vor<br />
allem seine Tagebücher wurden beklatscht.<br />
Die größten Erfolge feiert Gombrowicz zu<br />
dieser Zeit in Frankreich und Deutschland.<br />
1968 wurde Gombrowicz sogar für den Literaturnobelpreis<br />
vorgeschlagen.<br />
In Polen, wo die Werke Gombrowicz’<br />
bis 1989 nicht bzw. nur eingeschränkt veröffentlicht<br />
werden durften, hat er in den<br />
letzten Jahren ein immer größer werdendes<br />
Publikum gefunden. Ferdydurke ist heute<br />
eine verbreitete Schullektüre; seine Theaterstücke<br />
sind klassisches Repertoire an polnischen<br />
Bühnen.<br />
Anlässlich des 100. Geburtstags des<br />
Schriftstellers ist das Jahr 2004 sogar vom<br />
Sejm (dem polnischen Parlament) zum Witold-Gombrowicz-Jahr<br />
ausgerufen worden.<br />
132
Die wichtigsten Werke von Witold Gombrowicz<br />
Erzählungen<br />
Pamiętnik z okresu dojrzewania (Memoiren aus der Epoche des Reifens) (1933)<br />
Bakakaj (dt. Bacacay) (1957) (zweite, verbesserte und ergänzte um zwei neuen Erzählungen<br />
Ausgabe von Memoiren aus der Epoche des Reifens)<br />
Romane<br />
Ferdydurke (1938)<br />
Opętani (dt. Die Besessenen) (1939)<br />
Trans-Atlantyk (1953)<br />
Pornografia (dt. Verführung) (1960)<br />
Kosmos (dt. Indizien) (1965)<br />
Theaterstücke<br />
Ślub (dt. Die Trauung) (1953)<br />
Iwona Księżniczka Burgunda (dt. Yvonne, die Burgunderprinzessin) (1958)<br />
Operetka (dt. Operette) (1966)<br />
Andere Schriften<br />
Dziennik (dt. Tagebuch) (1953-1956)<br />
Dziennik (s.o.) (1957-1961)<br />
Dziennik (s.o.) (1961-1966)<br />
Testament, Entretiens avec Dominique de Roux (dt. Eine Art testament) (1969)<br />
Wędrówki po Argentynie (dt. ArgentinischeWanderungen und andere Schriften) (1977)<br />
133
„Wie leben?“<br />
Zur Bedeutung und Ethik des Erinnerns bei<br />
Cesław Miłosz und Wisława Symborska<br />
von Monika Mann<br />
Einige ausgewählte Stellungnahmen der Literaturnobelpreisträger Cesław<br />
Miłosz und Wisława Symborska bieten sich an, im Erinnerungsdiskurs verortet<br />
zu werden. Dabei fällt auf, dass sich beide in ihrer Einschätzung der Bedeutung<br />
der Erinnerung unterschiedlich positionieren. Aufgrund ihrer Aussagen<br />
wird außerdem die Frage zu beantworten versucht, wie der ethische Auftrag<br />
und die Notwendigkeit der Erinnerung gelebt werden können, angesichts der<br />
so subjektiven und ideologiegefährdeten Struktur individuellen wie kollektiven<br />
Erinnerns.<br />
„Zu den geistigen Entdeckungen und<br />
literarischen Überraschungen der zweiten<br />
Hälfte unseres Jahrhunderts gehört zweifelsohne<br />
[…] vor allem die polnische Poesie,<br />
die seit jeher der wertvollste und wirkungsvollste<br />
Teil der polnischen Literatur<br />
war und ist. Sie brach über uns herein mit<br />
dem ganzen Gewicht der in ihr angestauten<br />
moralischen und historischen Auseinandersetzungen:<br />
zwischen Zwang und Freiheit,<br />
zwischen Ost und West, zwischen Vergangenheit<br />
und Zukunft.“ So äußert sich Karl<br />
Dedecius, der Übersetzer vieler polnischer<br />
Autoren und der Vermittler der polnischen<br />
Literatur in Deutschland, über die polnische<br />
Lyrik des vergangenen Jahrhunderts.<br />
Zwei Autoren prägten die Lyrik des 20.<br />
Jahrhunderts in besonderem Maße: Cesław<br />
Miłosz und Wisława Symborska. Beide sind<br />
für die kulturelle Identität Polens von großer<br />
Bedeutung und gelten <strong>als</strong> international<br />
renommierte Dichter. Sie gewannen neben<br />
zahlreichen anderen internationalen Preisen<br />
den Nobelpreis für Literatur: Miłosz im<br />
Jahr 1980 und Szymborska im Jahr 1996. Da<br />
mir aufgrund fehlender Kenntnisse der polnischen<br />
Sprache ihre Texte nur in den deutschen<br />
Übersetzungen zugänglich sind, verbietet<br />
sich für mich eine direkte sprachliche<br />
Analyse ihres lyrischen Schaffens. So nehme<br />
ich das Thema des Doktorandenkolloquiums<br />
zum Anlass, ihr Werk und ihr Selbstverständnis<br />
<strong>als</strong> polnische Dichter nach ihrer<br />
Rolle <strong>als</strong> Dichter „zwischen Vergangenheit<br />
und Zukunft“ zu befragen.<br />
Damit steht die Frage nach der Bedeutung<br />
der Erinnerung der Geschichte im Zentrum<br />
dieses Essays. Geschichte entsteht<br />
durch individuelles wie kollektives Erinnern.<br />
Die Merkmale individueller Erinnerung<br />
sind nach Aleida Assmann die der subjektiven<br />
Perspektivität, der Fragmentarität<br />
und der Labilität. Erst in den Medien der<br />
Sprache, der Schrift und des Bildes können<br />
sie gemeinschaftsbildend wirken, identitätsstiftend<br />
sein, willentlich gebildet werden<br />
und in Mythen und Erzählungen und anderen<br />
kulturellen Formen symbolisch materialisiert<br />
werden. Doch auch im kollek-<br />
134
tiven Gedächtnis kann keine Objektivität<br />
erreicht werden: Es bleibt perspektivisch<br />
und beruht auf dem Prinzip der Auswahl,<br />
das heißt, dass das Vergessen für das kulturelle<br />
Gedächtnis einen konstitutiven Teil<br />
bildet. Die Dringlichkeit der Frage, wie die<br />
Grauen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts<br />
erinnert werden können, damit sie<br />
sich nicht wiederholen, motiviert und prägt<br />
den Erinnerungsdiskurs der letzten Jahre<br />
in besonderer Weise. „Im Falle einer traumatisierten<br />
Erinnerung wie der der Überlebenden<br />
des Holocaust ist die Maxime von<br />
der heilenden Kraft des Vergessens […] der<br />
ethischen Forderung der gemeinsamen Erinnerung<br />
gewichen“ schreibt Aleida Assmann.<br />
Doch wie kann dieser ethischen Forderung<br />
nachgegangen werden, eingedenk<br />
der eben beschriebenen unzuverlässigen<br />
Struktur des individuellen und kollektiven<br />
Erinnerns? Konstruktionen individuellen<br />
und kollektiven Gedenkens bedürfen der<br />
kritischen Reflexion und einer transkulturellen<br />
Beobachterperspektive. Gerade die<br />
identitätsstiftenden Speicherungs- und Filterungsvorgänge<br />
kollektiven Erinnerns unterliegen<br />
der Gefahr der Instrumentalisierung<br />
und ideologischen Prägung. Aleida<br />
Assmann spricht hierbei gerade der künstlerischen,<br />
individuellen Reflexion die Kraft<br />
zu, die Raster kollektiven Gedenkens aufzubrechen<br />
und Horizonte zu verschieben.<br />
„Insbesondere die individuelle, aber verallgemeinerbare<br />
künstlerische Schöpfung hat<br />
einen wichtigen Anteil an der Erneuerung<br />
des Gedächtnisses, indem sie die fest gezogene<br />
Grenze zwischen dem Erinnerten<br />
und Vergessenen infrage stellt und durch<br />
überraschende Gestaltung immer wieder<br />
verschiebt.“ Innerhalb dieses Erinnerungsdiskurses<br />
sollen so nun zwei künstlerischdichterische<br />
Positionen von Miłosz und<br />
Symborska skizziert werden, wie sie aus ihren<br />
Nobelpreisreden und Ausschnitten ihres<br />
lyrischen Werks deutlich werden. Es können<br />
nur einige wenige Texte berücksichtigt werden;<br />
insofern ist die folgende Darstellung<br />
keine umfassende Verortung ihrer Standpunkte<br />
und nicht mehr <strong>als</strong> ein Schlaglicht<br />
auf einige Äußerungen der Dichter.<br />
Durch Erinnerung werden Biographien<br />
und Identitäten geschaffen, und so sollen<br />
nun zunächst einige Lebensstationen der<br />
beiden Künstler kurz vorgestellt werden.<br />
Miłosz und Symborska haben den Dichterstatus<br />
und die nationale wie internationale<br />
Anerkennung gemeinsam. Im Blick auf ihre<br />
Lebensgeschichte fallen aber sehr schnell<br />
ihre völlig unterschiedlichen Lebensrealitäten<br />
auf: Miłosz Biographie erscheint sehr<br />
bewegt und von den zeitgeschichtlichen Ereignissen<br />
geprägt. Er wurde in Seteiniai in<br />
Litauen geboren und verbrachte seine Jugend<br />
und Studienzeit in Wilna, das dam<strong>als</strong><br />
zu Polen gehörte und das vor dem Holocaust<br />
<strong>als</strong> „Jerusalem des Nordens“ galt. Wilna war<br />
ein Ort, der von Litauern, Polen, Juden und<br />
Weißrussen gleichermaßen geprägt wurde<br />
und an dem unterschiedlichste kulturelle<br />
Traditionen nebeneinander lebten. Zu seiner<br />
eigenen Identität äußerte sich Miłosz in<br />
seiner Nobelpreisrede: „My family already<br />
in the Sixteenth Century spoke Polish […],<br />
so I am a Polish, not a Lithuanian, poet. But<br />
the landscapes and perhaps the spirits of Lithuania<br />
have never abandoned me.“ Eine<br />
solche polnisch-litauische Identität ist auch<br />
ein Produkt seiner Phantasie, wie er <strong>als</strong> späterer<br />
Exilant selber von sich sagt: „Durch<br />
die Entfernung werde ich dazu verleitet, mir<br />
in meiner Phantasie eine Heimat zu schaffen,<br />
die in der Geschichte liegt. Wo immer<br />
ich mich auf Erden bewege, trage ich sie<br />
mit mir wie eine Schnecke ihr Haus.“ Seine<br />
Erinnerung an seine Herkunft ist somit<br />
durchaus nostalgisch geprägt. Der Anfang<br />
seiner dichterischen Karriere liegt in Wilna.<br />
Dort bildete sich in den dreißiger Jahren<br />
eine dichterische Avantgarde, die Literatengruppe<br />
„Zagary“ („Fackelträger“), die<br />
gegen die Krakauer, optimistischere Avantgarde<br />
gerichtet war, und die Miłosz mitbegründete.<br />
Apokalyptische Visionen prägten<br />
diese Dichtung, die auf spätere, grausame<br />
historische Realitäten hinzuweisen scheinen.<br />
Im Zentrum standen die politische<br />
und soziale Realität, kein ästhetischer Formalismus.<br />
Nach dem Krieg war er Diplomat<br />
der Volksrepublik Polen in New York,<br />
Washington und Paris, bis er im Jahr 1951<br />
mit der Regierung brach und in den Westen<br />
ging. Er verbrachte einen Großteil seines<br />
Lebens im französischen und amerikanischen<br />
Exil und wurde 1961 Professor für<br />
Slawistik an der Universität Berkeley, bis er<br />
nach dem Ende des Kommunismus nach<br />
Polen zurückkehrte und von da an in Kra-<br />
135
kau lebte. Er starb im Jahr 2004 in Krakau.<br />
Seine Dichtung ist stark von einem humanistischen<br />
Geist geprägt. Lyrik ist nur dann<br />
sinnvoll, wenn sie im Dienst des Menschen<br />
steht: „Was ist Poesie, die weder Völker /<br />
Noch Menschen rettet?“ schreibt er 1945.<br />
Der Holocaust und der zweite Weltkrieg sowie<br />
das Schicksal Polens prägen sein Werk<br />
und sein Verständnis von der Aufgabe der<br />
Literatur in ganz besonderer Weise. Die<br />
Geschichte und ihre Erinnerung stehen im<br />
Zentrum seiner Aufmerksamkeit.<br />
Szymborska dagegen, geboren in Kornik<br />
bei Posen, studierte Polonistik und Soziologie<br />
in Krakau und lebt seitdem in dieser<br />
Stadt ein stilles und zurückgezogenes Leben<br />
<strong>als</strong> Schriftstellerin<br />
und Rezensentin. Sie<br />
stellte ihr Frühwerk in<br />
den Dienst des sozialistischen<br />
Realismus, von<br />
dem sie sich aber später<br />
distanzierte. Ihr Werk<br />
ist geprägt von unmit-<br />
Wolken<br />
Mit der Beschreibung der Wolken<br />
müßt ich mich eilen –<br />
schon im Bruchteil eines Moments<br />
sind sie nicht mehr die, sind sie andere.<br />
[…]<br />
Nicht beschwert mit dem Erinnern von<br />
nichts,<br />
erheben sie sich mühelos über die<br />
Fakten.<br />
Was wären das schon für Zeugen,<br />
sie verlaufen sofort in jede Richtung.<br />
Verglichen mit den Wolken<br />
erscheint das Leben verwurzelt,<br />
fast schon dauerhaft und beinahe ewig.<br />
telbarem Realitätsbezug,<br />
selbstironischer<br />
Distanz, einfachen syntaktischen<br />
Strukturen<br />
und sachlicher Lexik,<br />
mikrokosmischer Metaphorik<br />
und thematischer<br />
Vielfalt. Sie ist<br />
ein „Kosmos für sich“<br />
und ein „Phänomen der<br />
Unwiederholbarkeit“,<br />
wie Dedecius schreibt.<br />
Miłosz hat zahlreiche<br />
Äußerungen über seine<br />
Dichtung und deren<br />
Motivation gemacht –<br />
Szymborska hält sich in diesem Punkt sehr<br />
zurück und tritt kaum in Kommunikation<br />
mit der Öffentlichkeit. Im Unterschied zu<br />
Miłosz befassen sich ihre Texte – auf der<br />
Textoberfläche - kaum mit geschichtlichen,<br />
nationalen und politischen Tatsachen. Ihre<br />
Texte sind weniger historisch <strong>als</strong> vielmehr<br />
anthropologisch motiviert. Wenn sie über<br />
Leiden schreibt, steht nicht polnisches Leiden,<br />
sondern menschliches Leiden im Zentrum<br />
ihres Interesses – womit sie in der<br />
polnischen Literaturszene eine Ausnahme<br />
bildet. Ihr Humanismus scheint nicht historisch<br />
geprägt, sondern ihr geht es um<br />
den Menschen und die Welt in einer sehr<br />
viel umfassenderen Perspektive. Ihre Nobelpreisrede<br />
ist eine der wenigen Gelegenheiten,<br />
bei denen sich Szymborska über ihre Arbeit<br />
und ihre Motivation äußert. Dort sagte sie<br />
etwas Bemerkenswertes zur Herkunft von<br />
dichterischer Inspiration: „Inspiration, was<br />
auch immer sie sei, entsteht aus einem fortwährenden<br />
»Ich weiß nicht«.“ Diese Inspiration<br />
ist nicht nur Dichtern vorbehalten,<br />
sondern allen Menschen, die Fragen stellen,<br />
denn „alles Wissen, aus dem nicht neue<br />
Fragen aufkeimen, ist schnell totes Wissen“.<br />
So gelangt auch der Dichter nie an einen<br />
Punkt, „fertig“ zu sein, die Antwort gefunden<br />
zu haben, am Punkt ewiger Wahrheit<br />
angelangt zu sein: „[…]<br />
sobald er [der Dichter]<br />
nur einen Punkt gesetzt<br />
hat, beginnt er zu zögern;<br />
es wird ihm klar,<br />
daß seine Antwort provisorisch<br />
und völlig unzulänglich<br />
ist.“ Somit<br />
wird er immer wieder<br />
von jenem »Ich weiß<br />
nicht« vorangetrieben.<br />
Nun aber zur zentralen<br />
Fragestellung: Welche<br />
Bedeutung messen<br />
Szymborska und Miłosz<br />
der Erinnerung zu und<br />
wie ist ihr ethischer<br />
Auftrag ausführbar? Im<br />
Oktober 2000 trafen<br />
sich in Wilna vier Dichter<br />
aus Deutschland, Polen<br />
und Litauen: Günter<br />
Grass, Czesław Miłosz,<br />
Wisława Symborska und Tomas Venclova.<br />
An diesem Ort wollten sie „grenzübergreifend<br />
über die Zukunft der Erinnerung<br />
nachdenken“. In dem Band Die Zukunft der<br />
Erinnerung, der anlässlich dieser Begegnung<br />
entstand, veröffentlichten sie Texte zu dieser<br />
Fragestellung. Miłosz, der sich in seinem<br />
Beitrag mit der Geschichte der Stadt Wilna<br />
befasst, macht schon in den ersten Sätzen<br />
seinen Standpunkt innerhalb des Erinnerungsdiskurses<br />
deutlich: „Weil es mir um<br />
das kollektive Gedächtnis geht, muß ich<br />
gestehen, daß ich die historische Wahrheit<br />
136
in gewissen Grenzen für möglich und<br />
zudem für sehr notwendig halte.“ Wie<br />
aber ist der Begriff „historische Wahrheit“<br />
zu verstehen? Besonders Miłosz<br />
Nobelpreisrede gibt auf diese Frage<br />
Antwort: Für ihn steht die Suche nach<br />
Realität im Zentrum seines Schaffens.<br />
Seinen Realitätsbegriff versucht er vor<br />
allen philosophischen Relativierungen<br />
zu verteidigen und definiert ihn <strong>als</strong><br />
„the incomprehensible<br />
quality of<br />
God-created things,<br />
namely being, the<br />
esse“. Aufgabe des<br />
Dichters sei es somit<br />
„to comtemplate<br />
Being“. Die<br />
Erkenntnis von Realität<br />
aber sei gerade<br />
über die Erinnerung<br />
möglich:<br />
„»To see« means not<br />
only to have before<br />
one’s eyes. It may<br />
mean <strong>als</strong>o to preserve<br />
in memory. »To<br />
see and to describe«<br />
may <strong>als</strong>o mean<br />
to reconstruct in<br />
imagination. A distance<br />
achieved,<br />
thanks to the mystery<br />
of time, must<br />
not change events,<br />
landscapes, human<br />
figures into a tangle<br />
of shadows growing<br />
paler and paler.<br />
On the contrary, it<br />
can show them in<br />
full light, so that<br />
every event, every<br />
date becomes expressive<br />
and persists as an eternal reminder<br />
of human depravity and human<br />
greatness.” Der Dichter wird so<br />
ein „eternal reminder”, der die erkannte<br />
Wahrheit kommuniziert. Aufgrund<br />
dieses Erkenntnisvorgangs ist für ihn<br />
auch ein teleologisches Geschichtsbild<br />
möglich: „it is probable that in spite of<br />
all horrors and perils, our time will be<br />
judged as a necessary phase of travail<br />
Psalm<br />
[…]<br />
Von ungezählten Insekten nenne ich<br />
nur die Ameise,<br />
die zwischen dem linken und rechten<br />
Schuh des Grenzpostens<br />
auf dessen Frage: woher, wohin – sich<br />
zu keiner Antwort bequemt.<br />
Oh, dieses ganze Durcheinander auf<br />
einmal auf allen Kontinenten!<br />
Schmuggelt da nicht vom anderen<br />
Ufer die Rainweide<br />
Das hunderttausendste Blatt über den<br />
Fluß?<br />
[…]<br />
Kann überhaupt von Ordnung<br />
gesprochen werden,<br />
wo man nicht einmal die Sterne<br />
ausbreiten kann,<br />
damit man weiß, wem welcher<br />
leuchtet?<br />
[…]<br />
Nur das, was menschlich ist, kann<br />
wahrhaft fremd sein.<br />
Der Rest ist Mischwald,<br />
Maulwurfsarbeit und Wind.<br />
before mankind ascends to a new awareness.”<br />
Ein solches Realitäts- und Erinnerungskonzept<br />
ist stark metaphysisch<br />
geprägt. Es wird gestützt durch<br />
ethische und moralische Argumente.<br />
Miłosz wehrt sich gegen eine Zeit, die<br />
den Wahrheitsbegriff nicht mehr eindeutig<br />
beantworten kann, die - wie es<br />
in den kommunistischen Staaten geschah<br />
- Geschichte neu schreibt, die<br />
Auschwitz leugnet.<br />
Scharf kritisiert er<br />
selbst poststrukturalistische<br />
Literaturtheorien<br />
<strong>als</strong><br />
Weg zum Totalitarismus.<br />
Eine solche<br />
Kritik erscheint<br />
mir äußerst fragwürdig,<br />
ebenso<br />
wie Miłosz Realitätsbegriff,<br />
der von<br />
Jahrhunderten europäischer<br />
Philosophiegeschichte<br />
unberührt<br />
erscheint.<br />
Individuelle, dichterische<br />
Erinnerung<br />
ist für ihn der Weg<br />
zur Erkenntnis von<br />
Wahrheit; kollektive<br />
Erinnerung der<br />
Weg, diese Wahrheit<br />
zu tradieren<br />
und zu erhalten,<br />
um zu einer besseren<br />
Welt zu gelangen.<br />
Im Folgenden<br />
sollen Gedichte<br />
vorgestellt werden,<br />
die Symborska dem<br />
Band Die Zukunft<br />
der Erinnerung beisteuerte. Das, was<br />
bei Miłosz „historische Wahrheit“ genannt<br />
wurde, wird bei ihr relativiert,<br />
wie in ihrem Gedicht Wolken deutlich<br />
wird.<br />
Im Vergleich mit der Fluidität der<br />
Wolken erscheint das Leben auf der<br />
Erde dauerhaft und ewig. Doch diese<br />
Dauer und Ewigkeit ist dadurch schon<br />
137
elativiert, da sie sich allein auf die Materie<br />
der Erde bezieht, die nur im Vergleich<br />
mit den Wolken so statisch erscheint. Die<br />
Wolken zeigen dem Menschen, dass es kein<br />
absolutes, transzendentes Sein gibt, sondern<br />
nur Werden und Entstehen. Das Sein bleibt<br />
eine menschliche Erfahrung, aber es besitzt<br />
keinen Absolutheitsanspruch und keine metaphysische<br />
Komponente. Diese Relativität<br />
des menschlichen Seins wird auch in ihrem<br />
Gedicht Psalm gezeigt, in dem das Reich<br />
der Natur und die Staaten- und Nationenbildung<br />
der Menschen miteinander in Kontrast<br />
gesetzt werden.<br />
Die Erfahrung von Fremdheit, Hass,<br />
Krieg und Grenzen sind menschliche Erfahrungen,<br />
die Realitätsanspruch besitzen, aber<br />
keine Ewigkeit und Allgemeingültigkeit.<br />
Auch die Erinnerung ist kein Mittel, um<br />
Fakten Ewigkeit zu verleihen. Ihr Gedicht<br />
Ende und Anfang erzählt vom Ende eines<br />
Krieges und der mühevollen, oft verzweifelten<br />
und erschöpfenden Arbeit des Neubeginns.<br />
Dieses Gedicht zeigt einerseits die Notwendigkeit<br />
der Erinnerung und die Notwendigkeit<br />
des Vergessens <strong>als</strong> conditio humana.<br />
Die Erinnerung ist präsent, solange<br />
es Menschen gibt, in deren Erinnerung die<br />
Erfahrungen präsent sind. Doch Vergangenheit<br />
birgt weder Wahrheit noch die Antwort<br />
für das Morgen, denn die „durchgerosteten<br />
Argumente“ werden „auf den Müll“<br />
geschmissen. Die Präsenz einer Erfahrung<br />
schwindet mit jeder nachkommenden Generation,<br />
bis das Vergessen einsetzt, Gras über<br />
die Sache wächst. Die Wolken bilden den<br />
Schluss des Gedichtes. Was somit bleibt, ist<br />
nicht die Dauer, das Verweilen, die Ewigkeit<br />
der Erinnerung, sondern der Wechsel, das<br />
Werden, die Vergänglichkeit. Dies ist kein<br />
teleologisches Weltbild, sondern ein dynamisches,<br />
das keine allgemeingültigen, fest<br />
gefügten Wahrheiten und Realitäten für<br />
sich beansprucht.<br />
Miłosz und Szymborska geben unterschiedliche<br />
Antworten auf die Frage nach<br />
der Bedeutung der Erinnerung. Miłosz stellt<br />
sich <strong>als</strong> Lyriker in den Dienst an den Menschen<br />
und begibt sich über Kontemplation<br />
auf eine metaphysische Suche nach dem,<br />
was er „historische Wahrheit“ oder „Realität“<br />
nennt. In diesem Erkenntnisvorgang<br />
glaubt er, dass sich jenes „esse“ in der zeitlichen<br />
Distanz, in der Erinnerung herauskristallisieren<br />
wird; eine historische Wahrheit,<br />
die er mit sich trägt wie seine Heimat<br />
und von der seine Lyrik Zeugnis gibt. Insofern<br />
ist in seiner Vorstellung der Dichter<br />
und seine Texte jener „eternal reminder“,<br />
der die Erinnerung der Wahrheit verbürgen<br />
soll. Bei Szymborska gibt es keine historische<br />
Wahrheit, keine Metaphysik, kein<br />
„esse“ im Sinne Miłosz’. Sie betrachtet die<br />
Ende und Anfang<br />
Nach jedem Krieg<br />
muß jemand aufräumen.<br />
Leidliche Ordnung<br />
kommt nicht von allein.<br />
[…]<br />
Jemand, mit dem Besen in der Hand,<br />
erinnert sich noch, wie es war.<br />
Jemand hört zu und nickt<br />
mit dem nicht geköpften Kopf.<br />
Aber ganz in der Nähe schon<br />
treiben sich welche herum,<br />
die das langweilig finden.<br />
Manchmal buddelt einer<br />
unterm Strauch<br />
durchgerostete Argumente aus<br />
und wirft sie auf den Müll.<br />
Diejenigen, die wussten,<br />
worum es hier ging,<br />
machen denen Platz,<br />
die wenig wissen.<br />
Weniger noch <strong>als</strong> wenig.<br />
Und schließlich so gut wie nichts.<br />
Im Gras, das über Ursachen<br />
und Folgen wächst,<br />
muß jemand ausgestreckt liegen,<br />
einen Halm zwischen den Zähnen,<br />
und in die Wolken starrn.<br />
Welt aus einer mikrokosmischen Perspektive<br />
und ruft dem Leser die unterschied-<br />
138
lichsten Seinsformen dieses Kosmos ins Bewusstsein.<br />
Dadurch verliert die Seinsform<br />
Mensch an Absolutheitsanspruch. Ihre Begriffe<br />
von Wahrheit und Erinnerung verlieren<br />
sich in der Generationenfolge, sind der<br />
Zeit unterworfen und keine allgemeingültigen<br />
Einheiten. Erinnerung ist nicht fixierbar,<br />
und es gibt keinen Anspruch auf eine<br />
ewige Erinnerung, denn das Vergessen ist<br />
ebenso Teil des natürlichen Prozesses von<br />
Werden und Vergehen. Das Vergessen wird<br />
in Szymborkas Texten nicht angeklagt. Es<br />
ist vielmehr eine menschliche Erfahrung<br />
wie das Leid, das erinnert werden soll. Da es<br />
keinen Anspruch auf eine ewige, allgemeingültige<br />
Wahrheit gibt, kann es auch keinen<br />
Anspruch auf eine ewige Erinnerung geben,<br />
die eine solche Wahrheit verbürgen könnte.<br />
Wie aber soll Erinnerung an den Holocaust<br />
gelebt werden, Erinnerung, die einerseits<br />
so lebensnotwendig ist, andererseits<br />
so vergänglich, konstruierbar und subjektiv?<br />
Miłosz zeigt <strong>als</strong> Zeitzeuge eindrücklich<br />
den Kampf gegen das Vergessen und gegen<br />
die Leugnung geschehener Verbrechen, der<br />
absolut notwendig ist. Szymborskas Texte<br />
aber sind genauso notwendig. Denn nur im<br />
Bewusstsein um die Relativität unserer Erkenntnis,<br />
um die Konstruiertheit und Vergänglichkeit<br />
von Erinnerung, kann die Suche<br />
nach dem, was war, immer wieder neu<br />
motiviert werden. Nur dann, wenn nachfolgende<br />
Generationen jenes „Ich weiß nicht“<br />
stellen, kann Vergangenes wieder lebendig<br />
werden. Somit ist Vergessen nicht nur ein<br />
menschliches Übel. Es motiviert den Menschen,<br />
immer wieder neu die erzählte und<br />
tradierte Vergangenheit auf ihre Subjektivität<br />
zu befragen, Fakten zu bewahren und<br />
zu erhalten und Wahrheitssuche zu betreiben,<br />
die nicht abschließbar ist. Ist die<br />
Wahrheit einmal festgesetzt und definiert,<br />
warum sollte man sich dann noch mit ihr<br />
auseinandersetzen? Szymborkas Texte zeigen,<br />
dass es kein Erinnerungsmonopol gibt.<br />
Erinnerung wird dann <strong>als</strong> ethischer Auftrag<br />
gelebt, wenn sich die Menschen im Bewusstsein<br />
um ihre subjektive Perspektivität<br />
immer wieder neu auf die Suche begeben<br />
und Geschichte so lebendig erhalten.<br />
Wie leben? – fragte im Brief<br />
mich jemand, den ich dasselbe<br />
hatte fragen wollen.<br />
Weiter und so wie immer,<br />
wie oben zu sehn,<br />
es gibt keine Fragen, die dringlicher wären<br />
<strong>als</strong> die naiven.<br />
(aus: „Das Ende eines Jahrhunderts“<br />
von Wisława Szymborska)<br />
Literatur<br />
Assmann, Aleida: Individuelles und kollektives<br />
Gedächtnis – Formen, Funktionen<br />
und Medien. In: Das Gedächtnis der<br />
Kunst. Geschichte und Erinnerung in der<br />
Kunst der Gegenwart. Hrsg. von Kurt Wettengl.<br />
Frankfurt (Main), 2000.<br />
Dedecius, Karl: Poetik der Polen. Frankfurter<br />
Vorlesungen. Frankfurt (Main), 1992.<br />
Grass, Günter; Miłosz, Czesław; Szymborska,<br />
Wisława; Venclova, Tomas: Die Zukunft<br />
der Erinnerung. Hrsg. von Martin<br />
Wälde. Göttingen, 2001.<br />
Miłosz, Czesław: Zeichen im Dunkel. Poesie<br />
und Poetik. Hrsg. von Karl Dedecius.<br />
Frankfurt (Main), 1979.<br />
Miłosz, Czesław: Nobel Lecture.<br />
http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1980/milosz-lecture-en.html<br />
Polnische Literatur. Annäherungen. Eine<br />
illustrierte Literaturgeschichte in Epochen.<br />
Hrsg. von Wacław Walecki. Krakau-Oldenburg,<br />
1999.<br />
Polnische Poesie des 20. Jahrhunderts.<br />
Hrsg. und übertragen von Karl Dedecius.<br />
Frankfurt (Main)/Berlin/Wien, 1982.<br />
Szymborska, Wisława: Die Gedichte. Herausgegeben<br />
und übertragen von Karl Dedecius.<br />
Frankfurt (Main), 1997. (Hier ist<br />
auch ihre Nobelpreisrede enthalten.)<br />
139
Cinématographie engagée – Polnisches Kino<br />
von Stefanie Manthey<br />
Innerhalb des Konvoluts an Fotos von<br />
und über den polnischen Drehbuchautor<br />
und Regisseur Krzysztof Kieslowski (1941-<br />
1996) gibt es eine wiederholt praktizierte<br />
und eingefangene Geste, der Motivcharakter<br />
zukommt. Die Daumen beider Hände<br />
im 90°-Winkel voneinander abgespreizt,<br />
setzen beide an den Kuppen des Daumes,<br />
beziehungsweise Zeigefingers der jeweils<br />
anderen Hand an und bilden ein querrechteckiges<br />
Sichtfeld aus. Indem man diese Geste<br />
nachvollzieht und sich mit dieser Rahmung<br />
im Umraum orientiert, nähert man<br />
sich der Position, die Koen Tachelet mit<br />
Bezug auf Kieslowskis Schaffen <strong>als</strong> die „dekalogische<br />
Kreuzung zwischen Beobachten<br />
und Handeln“ bezeichnet. Historisch fundierter<br />
und spezifischer wird diese Position,<br />
wenn man sich anhand von Begriffen und<br />
Bezeichnungen wie Filmhochschule Lodz,<br />
„Schwarze Serie“, „Kino der moralischen<br />
Unruhe“, Andrzej Munk, Jerzy Bossak und<br />
Jerzy Toeplitz, Andrzej Wajda und Krzysztof<br />
Zanussi, Polnisches Filminstitut, Adam<br />
Mieckiewicz-Institut sowie www.culture.<br />
pl mit den rahmenden Faktoren vertraut<br />
macht, die polnischem Kino Charakter,<br />
Tiefe und Gesicht gegeben haben und geben.<br />
Tachelet, Koen, Zehn Geschichten, eine<br />
Gemeinschaft, in: Programmheft Die Zehn<br />
Gebote. Nach den Geschichten und Filmen<br />
Dekalog 1-10 von Krzystof Kieślowski und<br />
Krzystof Piesiewicz. In einer Fassung von Koen<br />
Tachelet für die Münchner Kammerspiele,<br />
München 2004, S. 5-7, S. 6.<br />
Die Aufarbeitung seiner Geschichte sowie<br />
Bemühungen um dessen vitale und eigenständige<br />
Fortexistenz sind zwei Tendenzen,<br />
die sich seit Beginn der 1990 Jahre<br />
gegenseitig profilieren und innerhalb eines<br />
gesamteuropäischen Kontextes auszurichten<br />
suchen, in dem Identität und Erinnerung<br />
sowohl die Funktion von Kategorien zur<br />
Orientierung wie Leitmotiven zukommt.<br />
Mit diesen beiden Begriffen sind zugleich<br />
ein Anspruch und eine Aufgabenstellung<br />
formuliert, denen man ohne Wissen um geschichtliche<br />
Sachverhalte nicht gerecht werden<br />
kann. Sie haben Spuren im Leben der<br />
Menschen hinterlassen, die fortdauern und<br />
sich langsam zu erzählbaren Stoffen herauskristallisieren.<br />
Ein Jahrzehnt, eine Generation<br />
sind Zeiteinheiten auf der Suche nach<br />
Verortung und Profilierung in größeren Zusammenhängen,<br />
die immer wieder in den<br />
Alltag der Menschen, dessen Struktur und<br />
Rituale zurückverweisen. Parallel dazu entwickelt<br />
sich das kommerzielle Kino zu einer<br />
eigenen Größe, werden Nationalepen<br />
und literarische Stoffe polnischer Literatur<br />
des 19. Jahrhundert produziert, in alten und<br />
neuen Fassungen rezipiert, vermarktet und<br />
aufgearbeitet. <br />
Vor 1990 sind es historische Einschnitte,<br />
die das Nachkriegskino prägen: Die Befreiung<br />
Ostmitteleuropas von der deutschen<br />
Okkupation 1945. 1948/1949 den Zeitraum,<br />
Das junge polnische Kino, hrsg. v. Adam-<br />
Mickiewicz-Institut, Warschau 2005;<br />
Meyer, Stefan und Robert Thalheim, Asche<br />
oder Diamant? Polnische Geschichte in den<br />
Filmen Andrzej Wajdas, Berlin 2000.<br />
140
in dem Polen und anderen neu gegründeten<br />
Satellitenstaaten unter kommunistischer<br />
Herrschaft mit Gewalt die aus der ehemaligen<br />
UDSSR importierte Doktrin des Sozialistischen<br />
Realismus aufgezwungen wurde.<br />
1956 markiert einen Wendepunkt, der<br />
den Beginn des langsamen, aber unaufhaltsamen<br />
Prozesses der Entstalinisierung ankündigte,<br />
1970 einen weiteren politischen<br />
Wendepunkt, der August 1980 die Geburt<br />
der Solidarnosc-Bewegung und der Dezember<br />
1981 die Verhängung des Kriegsrechts.<br />
1989 den Fall des kommunistischen Systems<br />
mit den bis in die Gegenwart reichenden<br />
Konsequenzen und Auswirkungen, die eine<br />
umfassende Neuorientierung Polens <strong>als</strong> eigener<br />
Staat notwendig machten. <br />
In diesem zeitlichen Umfeld liegen die<br />
Anfänge für das zehnteilige, rund dreizehnstündige<br />
Filmepos Dekalog, das 1989 bei den<br />
Filmfestspielen von Venedig vor internationalem<br />
Publikum uraufgeführt wurde. Auf<br />
Hendrykowski, Marek, Veränderungen<br />
in Ostmitteleuropa, in: Geschichte des<br />
Internationalen Films, hrsg. v. Geoffrey<br />
Nowell-Smith, Stuttgart – Weimar 1998,<br />
S. 591-600, S. 591. Zu den Entwicklungen<br />
der 1990er Jahre im Bereich polnischen<br />
Filmschaffens siehe folgende Artikel, die<br />
<strong>als</strong> Download auf der Seite www.culture.<br />
pl zur Verfügung stehen: Bozena, Janicka,<br />
Der polnische Film in den Jahren 1989-<br />
1999. Das Jahrzehnt des Oskars; Lubelski,<br />
Tadeusz, Der zeitgenössische polnische<br />
Dokumentarfilm. Eine Diskussion mit der<br />
Wirklichkeit.<br />
„Die Zeit war ungut. […] Was noch kommen<br />
sollte, hing in der Luft. Im Land herrschten<br />
Chaos und Unruhe – in allen Bereichen,<br />
in jeder Hinsicht, in fast jedem Leben. Die<br />
Spannung, das Gefühl der Sinnlosigkeit und<br />
die Vorahnung noch schlechterer Zeiten waren<br />
spürbar und offensichtlich. In der übrigen Welt<br />
– dam<strong>als</strong> fing ich an zu reisen – beobachtete ich<br />
ähnliche Unsicherheiten; nicht in der Politik,<br />
sondern im ganz normalen Leben. Unter dem<br />
höflichen Lächeln hatte ich Gleichgültigkeit<br />
gespürt. Ich hatte das eindringliche Gefühl,<br />
dass ich immer häufiger Menschen sah, die<br />
nicht wussten, wofür sie lebten.“ Krzystof<br />
Kieślowski und Krzystof Piesiewicz, Dekalog.<br />
Zehn Geschichten für zehn Filme. Aus dem<br />
Polnischen von Beata Prochowska, Frankfurt<br />
Wunsch der akkreditierten Journalisten<br />
wurden im Vorfeld Flugblätter mit dem<br />
Wortlaut der Zehn Gebote verteilt. Hinter<br />
dem Regisseur und Drehbuchautor Krzysztof<br />
Kieslowski lagen zu diesem Zeitpunkt<br />
rund drei Jahre Auseinandersetzung mit<br />
dem Normenkatalog der abendländischen<br />
Kultur. Ursprünglich beabsichtigte er in<br />
seiner Funktion <strong>als</strong> kommissarischer Chef<br />
der Filmgruppe „Tor“ die zehn Drehbücher<br />
zu schreiben, um jungen Regisseuren die<br />
Möglichkeit zu einem Spielfilmdebüt im<br />
polnischen Fernsehen zu geben. Die umfassende<br />
Lektüre von Literatur zum Alten<br />
und Neuen Testament sowie von Studien<br />
theologischer und philosophischer Kommentare<br />
mündete in eine zwölfmonatige<br />
Ausarbeitung der Drehbücher in Zusammenarbeit<br />
mit dem Rechtsanwalt Krysztof<br />
Piesiewicz in der Küche von Kieslowskis<br />
Warschauer Wohnung. Zum Zeitpunkt<br />
der Fertigstellung der Drehbücher war<br />
Kieslowski nicht mehr bereit, die filmische<br />
Umsetzung an junge Regisseure zu delegieren.<br />
Es war entschieden, die herausfordernde<br />
Verantwortung für den gehaltvollen<br />
Stoff und dessen Übersetzung in ein filmisches<br />
Epos selbst zu übernehmen. Dazu<br />
reichte er die Drehbücher zunächst beim<br />
(Main) 1990, S. 9.<br />
Zehn Gebote, Dekalog im Alten Testament<br />
die Gebote, die Mose von Gotte auf dem Sinai<br />
empfing; sie sind in zwei weitgehend übereinstimmenden<br />
Fassungen überliefert: in 2.<br />
Mos. 20, 2-17 sind sie in die Sinaierzählung<br />
eingegliedert und erscheinen dort <strong>als</strong> die erste<br />
und wichtigste Rechtsbekundung Gottes; in 5.<br />
Mos. 5,6-21 werden sie in der Abschiedsrede des<br />
Mose vor dem Einzug Israels in das verheißene<br />
Land zitiert. Die Zehn Gebote sind Reihen von<br />
Rechtssätzen apodiktischen Rechts, wie sie auch<br />
sonst im Alten Testament vorkommen. Diese<br />
Rechtssatzform enthält im Gegensatz zum kasuistischen<br />
Recht absolute und universale Verbote,<br />
die <strong>als</strong> Ausdruck göttlichen Willens verstanden<br />
werden und die Richtschnur für Glauben und<br />
Handeln von Menschen darstellen sollen. Im<br />
Neuen Testament bleibt die Bedeutung der<br />
Zehn Gebote erhalten (Mk 7, 8-13); es werden<br />
jedoch einzelne Gebote verschärft bzw. durch<br />
radikalere Forderungen ergänzt (Mt. 5, 21-30;<br />
Mk. 10, 17-21).Brockhaus Enzyklopädie in vierundzwanzig<br />
Bänden, 19., völlig neu bearbeitete<br />
Auflage, Mannheim 1989, Bd. 24, S. 463<br />
141
polnischen Fernsehen ein, um die Finanzierung<br />
des Projekts zu sichern. Nachdem<br />
diesem Antrag stattgegeben worden war,<br />
wurde Kieslowski beim Kulturministerium<br />
mit dem Anliegen vorstellig, zwei Sequenzen<br />
zusätzlich <strong>als</strong> Kinoversionen zu produzieren.<br />
Er stellte dem zuständigen Gremium<br />
insgesamt vier Drehbücher unter der Bedingung<br />
zur Verfügung, dass eine Langfassung<br />
auf der Drehbuchversion von Dekalog 5 (Ein<br />
kurzer Film über das Töten) basieren müsse.<br />
Die Dreharbeiten dauerten von März 1987<br />
bis Juni 1988, die Produktionszeit belief sich<br />
inklusive der Schnittarbeiten auf neunzehn<br />
Monate. Kieslowski drehte jede Folge mit<br />
wechselnden Schauspielern und Kameramännern<br />
innerhalb von zwanzig Tagen ab.<br />
Er konzipierte den Arbeitsplan so, dass Sequenzen<br />
aus unterschiedlichen Folgen, wenn<br />
sie am gleichen Ort innerhalb der insgesamt<br />
<strong>als</strong> Schauplatz dienenden Trabantenstadt in<br />
der Nähe von Warschau spielten, nach Neueinrichtung<br />
der spezifischen Beleuchtung<br />
unmittelbar aufeinander folgend gedreht<br />
werden konnten. Der Dekalog wurde 1990<br />
in beinahe allen Ländern Europas zur besten<br />
Sendezeit ausgestrahlt, arte und der Sender<br />
Freies Berlin realisierten zusätzlich Dokumentationen<br />
über den Themenkomplex und<br />
dessen Realisierung. Gegenwärtig überwiegen<br />
Bemühungen, den Dekalog sowohl<br />
zu historisieren, <strong>als</strong> auch in der Folge von<br />
Aufführungen im Rahmen von Kieslowski<br />
gewidmeten Filmreihen in ausgewählten<br />
Wach, Margarete, Krysztof Kieślowski. Kino<br />
der moralischen Unruhe, Köln 2000, S. 266,<br />
268, 270-273. Für eine eigenhändige Zeichnung<br />
dieses wesentlichen Arbeitsplatzes siehe: Ausst.<br />
Kat. Krzysztof Kieślowski. Signs and Memory,<br />
hrsg. v. Muzeum Kinematografii, Lodz 2005, S.<br />
18, Abb. 6.<br />
Wach, Margarete, Krysztof Kieślowski. Kino<br />
der moralischen Unruhe, Köln 2000, S. 286.<br />
Siehe auch die im näheren zeitlichen Umfeld<br />
zusammengestellten Arbeitsmaterialien und<br />
Untersuchungen: Dekalog. Zehn Geschichten<br />
für zehn Filme, Hamburg 1990; Dekalog.<br />
Materialien und Arbeitshilfen, hrsg. v. Katholischem<br />
Filmwerk, Frankfurt am Main 1991;<br />
Das Gewicht der Gebote und die Möglichkeiten<br />
der Kunst, hrsg. v. Walter Lesch und Matthias<br />
Loretan, Freiburg im Breisgau 1993.<br />
Programmkinos hinsichtlich seiner überzeitlichen<br />
Bedeutung zu befragen. Auf diese<br />
Weise wird ein Referenzfeld aufgespannt,<br />
in das sich die individuelle Auseinandersetzung<br />
einzubetten und einzubringen vermag.<br />
In der Sicherung von Erinnerungen aus dem<br />
Umfeld der Entstehungszeit und der Erstpräsentation<br />
gewinnt das Gesamtwerk an<br />
Identität. <br />
I<br />
Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine<br />
anderen Götter neben mir haben.<br />
Im Mittelpunkt von Dekalog Eins stehen<br />
der Sprachwissenschaftler und Mathematiker<br />
Krzystof und sein elfjähriger Sohn Pawel.<br />
Nachdem Pawel vom Milchholen zurückgekehrt<br />
ist, stellt er seinem Vater am<br />
noch frühen Morgen am Frühstückstisch<br />
große Fragen. Er fragt danach, was der Tod<br />
ist und was nach dem, vom Vater <strong>als</strong> totalem<br />
Ende bezeichneten Zustand bleibt. Die Liste<br />
faktischer Todesursachen, die Erklärung,<br />
dass der Tod eine Unterbrechung des Versorgungskreislaufs<br />
zwischen Herz und Gehirn<br />
ist, stellen ihn nicht zufrieden. Er will<br />
wissen was bleibt. Sein Vater antwortet ihm<br />
zögerlich: „Was eine Person erreicht hat, die<br />
Erinnerung an diese Person. Die Erinnerung<br />
ist wichtig. Die Erinnerung daran, dass jemand<br />
sich auf eine bestimmte Art und Weise<br />
bewegt hat oder dass sie freundlich waren.<br />
Man erinnert sich an ihre Gesichter, ihr<br />
Lächeln, dass ein Zahn fehlte/ Co Pozostanie?<br />
Co osiagnáł człowiek, wspomnienie o<br />
nim.Wspomnienie jest wane. Wspomnienie<br />
o tym, że ktoś poruszał sie na swój sposób<br />
albo, że byl mily. Człowiek przypomina sobie<br />
ich twarze, uś miech, brakujacy záb.“ An<br />
dieser Stelle möchte der Vater die Unterhaltung<br />
unterbrechen. Er sagt, dass es zu früh<br />
sei, zu früh für diese Fragen an diesem Morgen.<br />
Er scheut sich, das Thema Tod in seiner<br />
Existentialität und den kulturellen Formen<br />
und Ritualen der Verarbeitung auf der Suche<br />
nach Letztbegründungen zwischen ihm<br />
Ausst. Kat. Krzysztof Kieślowski. Signs and<br />
Memory, hrsg. v. Muzeum Kinematografii,<br />
Lodz 2005; Kat. Ausst. Krzysztof Kieślowski<br />
1941-1996. Regisseur. Film Director, hrsg. v.<br />
Polnischen Filminstitut, Warschau 2006; Wach,<br />
Margarete, Krysztof Kieślowski. Kino der moralischen<br />
Unruhe, Köln 2000, S.265-306.<br />
142
und seinem Sohn groß werden zu lassen.<br />
Er ahnt, dass sie in dieser Frage nicht einer<br />
Meinung sind und möglicherweise auch<br />
nicht sein können. Er weicht dieser ebenso<br />
realen wie schmerzlichen Erfahrung jedoch<br />
nicht aus und fragt danach, was passiert sei,<br />
nachdem sie beide realisiert haben, dass die<br />
frisch geholte Milch sauer ist. Pawel erzählt<br />
von der für ihn unverständlichen Nähe von<br />
Freude und Leid, von erlebtem Glück und<br />
dem Tod der vertrauten, streunenden Existenz<br />
eines Hundes aus der Nachbarschaft,<br />
bei dessen Anbahnung er nicht anwesend<br />
war. Er erinnert sich an die formelhaften<br />
Worte, die bei einem christlichen Begräbnis<br />
gesprochen werden und spricht sie laut<br />
aus. Der Vater bezeichnet sie <strong>als</strong> narkotische<br />
Aussagen. Pawel ringt mit der Trennschärfe,<br />
die sich zwischen ihm und seinem Vater<br />
aufbaut, während dieser zugibt, in der Frage<br />
nach der Existenz der Seele unwissend<br />
zu sein. So endet das von Pawel begonnene<br />
Gespräch mit der vage ausgesprochenen<br />
Vermutung, dass es dem Hund jetzt besser<br />
gehe. Der akustisch vorgebrachte Trost<br />
vermag sich jedoch nicht im Gesichtsausdruck<br />
einzunisten. Der Vater verliert seinen<br />
Sohn durch einen tragischen Unfall. Seine<br />
Berechnungen der Tragfähigkeit des Eises<br />
eines nahe gelegenen zugefrorenen Sees, auf<br />
dem Pawel seine neuen Schlittschuhe ausprobieren<br />
will, erweisen sich <strong>als</strong> nicht zutreffend.<br />
<br />
II<br />
Du sollst dir kein Gottesbild machen. Du<br />
sollst keinen Götzen dienen.<br />
Hauptfiguren von Dekalog Zwei sind<br />
ein älterer Chefarzt, eine junge Violinistin<br />
mit Namen Dorota Geller und deren<br />
krebserkrankter Mann Andrzej. Verzweifelt<br />
versucht sie zu erfahren, ob ihr Mann<br />
Für Basisinformationen über die einzelnen<br />
Teile siehe: Lexikon des Internationalen Films.<br />
Kino, Fernsehen, Video, DVD, hrsg. v. Hans<br />
Peter Koll, Stefan Lux und Hans Messias,<br />
3 Bde., Frankfurt am Main 2001, Bd. 1, S.<br />
580-581; Filmklassiker. Beschreibungen und<br />
Kommentare, hrsg. v. Thomas Koebner, 4 Bde.,<br />
3. Aufl. Stuttgart 2001, Bd. 4 (1982-1999), S.<br />
309-327.<br />
sterben wird. Von der Diagnose möchte sie<br />
abhängig machen, ob sie sich für oder gegen<br />
das Kind entscheidet, das sie von ihrem<br />
Geliebten erwartet. Aus der Stimmung angespannten<br />
Wartens heraus, in die immer<br />
wieder auf ihrem Anrufbeantworter hinterlassene<br />
Nachrichten des Geliebten hindurchdringen,<br />
tritt sie ans Fenster und entlaubt<br />
Blatt für Blatt einen Gummibaum.<br />
Schließlich bleibt nur noch der Stamm, den<br />
sie nach unten umbiegt, ohne jedoch die<br />
Verbindung zu den Wurzeln vollends abzutrennen.<br />
Ebenso hartnäckig bemüht sie sich<br />
um ein Gespräch mit dem Chefarzt. Nachdem<br />
dies zustandegekommen und der Arzt<br />
über die Umstände informiert ist teilt er ihr<br />
mit, dass ihr Mann sterben wird. Dieser<br />
überlebt gegen alle medizinische Vernunft,<br />
während in ihrem Organismus neues Leben<br />
heranwächst.<br />
III<br />
Du sollst den Namen des Herrn<br />
nicht missbrauchen.<br />
Dekalog Drei spielt an einem Heiligabend<br />
in Warschau. Das Familienfest des<br />
Taxifahrers Janusz wird dadurch gestört,<br />
dass seine ehemalige Geliebte Ewa erscheint<br />
und ihn auffordert, ihr bei der Suche<br />
nach ihrem Mann Edward zu helfen.<br />
Gemeinsam suchen sie eine Unfallstation,<br />
eine Ausnüchterungszelle und den Bahnhof<br />
nach Spuren ab. Die vergebliche Suche<br />
mündet darin, dass sie ihre vage Hoffnung<br />
eingesteht, ihn an diesem Abend wiedergewinnen<br />
zu können. Die Szene des Abschieds<br />
der beiden und ihrer Fahrzeuge findet<br />
auf einer dreieckigen, schneebedeckten<br />
Verkehrsinsel statt, auf der auch ein mit<br />
bunten Leuchtkugeln geschmückter Weihnachtsbaum<br />
steht. Die beiden, sich gegenüberstehenden<br />
Autos blinken noch ein letztes<br />
Mal auf, bevor beide samt ihrer Insassen im<br />
Morgengrauen dorthin zurückkehren woher<br />
sie gekommen sind.<br />
IV<br />
Du sollst den Sabbat heiligen<br />
Auftakt von Dekalog Vier ist ein Ereignis<br />
am Ostermontag: Der Schauspielschü-<br />
143
lerin Anka fällt, nachdem ihr Vater Michal<br />
wegen einer Geschäftsreise die gemeinsame<br />
Wohnung verlassen hat, ein Brief ihrer<br />
verstorbenen Mutter in die Hände, der<br />
erst nach dem Tod des Vaters geöffnet werden<br />
soll. Mit weissumrandeter Sonnenbrille<br />
kommt sie zum Flughafen, um ihn abzuholen.<br />
Auf seine floskelhaft-höflichen Fragen<br />
antwortet sie nicht. Als er sie auffordert zu<br />
sagen, was vorgefallen sei, sagt sie den Inhalt<br />
des Briefs auswendig auf. Die Konfrontation<br />
mit der Aussage, dass er nicht ihr<br />
leiblicher Vater sei, führt zu einem langen,<br />
nächtlichen Gespräch, während dessen beide<br />
ihre Gefühle füreinander erforschen. Am<br />
nächsten Morgen gesteht sie ihm gegenüber,<br />
dass sie den Brief erfunden und die Handschrift<br />
der Mutter gefälscht hat.<br />
V<br />
Du sollst Vater und Mutter ehren<br />
In Dekalog Fünf steht die Fragwürdigkeit<br />
tradierter, normativer Gesetze des Zusammenlebens<br />
von Menschen von Beginn<br />
an im Mittelpunkt. „Das Gesetz sollte nicht<br />
die Natur imitieren, das Gesetz sollte die<br />
Natur verbessern. Die Menschen haben das<br />
Gesetz erfunden, um ihre Verhältnisse zu<br />
regeln. Das Gesetz entscheidet darüber, wer<br />
wir sind und wie wir leben. Entweder wir<br />
beobachten oder wir brechen es. Die Menschen<br />
sind frei. Ihre Freiheit wird von der<br />
anderer begrenzt. Bestrafung bedingt Rache.<br />
Insbesondere dann, wenn sie auf Verletzung<br />
zielt, aber sie beugt Kriminalität und<br />
Verbrechen nicht vor.“ Mit diesen Worten<br />
zweifelt der hochbegabte Jurastudent Piotr<br />
öffentlich am Sinn der Bestrafung des Verbrechers<br />
durch den Staat. Während er seine<br />
Prüfungsfragen beantwortet, begeht ein<br />
junger Mann namens Jacek einen brutalen<br />
Mord an Waldemar Rybkowski, einem Taxifahrer.<br />
Im Anschluss daran kehrt er zu<br />
dem Auto des Getöteten zurück, schraubt<br />
das Taxischild ab und wirft es ins Feld, bevor<br />
er ein von der Ehefrau des Taxifahrers<br />
gemachtes Butterbrot aus dem Handschuhfach<br />
nimmt und regungslos verspeist. Die<br />
Tat ändert an seinem ebenso aggressiven<br />
wie teilnahmslosen Verhalten seinem und<br />
dem Leben anderer gegenüber nichts. Piotr<br />
muss in seinem ersten Fall pflichtverteidigen.<br />
Er kann ihn nicht vor der Todesstrafe<br />
retten. Vor der Hinrichtung erfährt er von<br />
einer schweren Schuld, die den Verurteilten<br />
seit Jahren quält.<br />
VI<br />
Du sollst nicht töten<br />
Dekalog Sechs handelt von der Komplexität<br />
und Fragilität, die einem möglicherweise<br />
zu begründenden Liebesverhältnis eigen<br />
ist, das sich nicht auf wechselseitige Bedürfnisbefriedigung<br />
beschränkt. Der neunzehnjährige<br />
Postangestellte Tomek beobachtet<br />
heimlich seine Nachbarin Magda durch<br />
ein Fernrohr. Dieses hat er sich durch einen<br />
nächtlichen Einbruch in eine Schule besorgt.<br />
Eine Lache aus glitzernden Glassplittern<br />
verbleibt auf dem Turnhallenboden,<br />
während alle übrigen distanzierenden Glasbarrieren<br />
intakt bleiben. Die Kontaktaufnahmen<br />
bleiben indirekt: Fenster, Schalteröffnungen<br />
sowie teleskopartig auszufahrend<br />
Hilfsmittel sind dazwischengeschaltet. Der<br />
Kontakt, der für einen Abend zustande<br />
kommt, treibt den jungen Mann aufgrund<br />
der zynischen Zurückweisung seiner idealisierten<br />
Vorstellung der Frau, die sexuelle<br />
Abenteuer, aber keine Liebe kennt, in einen<br />
Selbstmordversuch, der das Verhältnis<br />
auf eine veränderte Grundlage stellt, dessen<br />
Ausgang aufgrund der unterschiedlichen<br />
Schluss-Sequenzen von Fernseh- und Kinoversion<br />
ambivalent bleibt.<br />
VII<br />
Du sollst nicht ehebrechen<br />
Dekalog Sieben vermittelt einen Einblick<br />
in das Leben einer Familie, in der die Konstellation<br />
aus Vater Stefan, Mutter Ewa und<br />
Tochter Majka im Umfeld der Geburt der<br />
mittlerweile fünfjährigen Ania umdefiniert<br />
wurde. Die Großmutter hat ihrer Tochter in<br />
ihrer Position <strong>als</strong> Direktorin der Schule, an<br />
der der Polnischlehrer Wojtek lehrt, der der<br />
leibliche Vater des Kindes ist, die Mutterschaft<br />
zu ihren eigenen Gunsten entzogen<br />
und die angemaßte Mutterschaft rechtlich<br />
besiegeln lassen. Die leibliche Mutter Majka<br />
jedoch kann es nicht mehr ertragen, auf<br />
ihr Kind verzichten zu müssen und entführt<br />
es um mit ihm nach Kanada auszuwandern.<br />
Vor der Konfrontation mit dem leiblichen<br />
Vater machen beide Halt an einem im Wald<br />
144
stehenden Kinderkarussel. Ania steigt auf<br />
eines der Pferde und genießt die Fahrt, die<br />
in ein kurzes Gespräch mündet, in dem<br />
Majka ihr zu verstehen gibt, dass diejenige,<br />
die sie Mutter nennt, nicht ihre Mutter ist<br />
und doch eine Mutter hat.<br />
VIII<br />
Du sollst nicht stehlen<br />
In Dekalog Acht wird die Ethikprofessorin<br />
Sofia, die ihren Studenten stets konkrete<br />
Beispiele menschlichen Verhaltens liefert,<br />
mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert,<br />
<strong>als</strong> die nach Amerika ausgewanderte<br />
Jüdin Elzbieta, die Übersetzerin ihrer Bücher,<br />
danach fragt, wie das Verhalten einer<br />
polnischen Familie zu bewerten ist, die<br />
sie <strong>als</strong> kleines Kind zunächst taufen lassen<br />
wollte, letztlich jedoch unter Berufung auf<br />
das achte Gebot Hilfe verweigerte. Sie stellt<br />
diese Frage in dem Hörsaal, in dem die Professorin<br />
für gewöhnlich lehrt. Bevor sie sie<br />
stellt, wechselt sie von einem Platz in den<br />
mittleren Reihen in die erste Reihe. Vorgeblich,<br />
weil der weiter zurückliegende eine zu<br />
große Entfernung für das Mikrophon des<br />
Kassettenrekorders darstellt, mit dem sie<br />
die Vorlesung mitschneidet.<br />
IX<br />
Du sollst nicht f<strong>als</strong>ches Zeugnis geben wider<br />
deinem Nächsten<br />
Dekalog Neun beginnt mit einem Gespräch,<br />
in dem der glücklich verheiratete<br />
Chirurg Roman erfährt, dass er für immer<br />
impotent sein wird. Angst und Selbstzweifel,<br />
Verdächtigungen und Eifersucht keimen<br />
auf, während sie sich ewige Liebe und<br />
Treue schwören. In einem Gespräch mit einer<br />
gesanglich sehr begabten Studentin, die<br />
Patientin des Krankenhauses ist, in dem der<br />
Chirurg arbeitet, wird die anmaßende Winzigkeit<br />
dessen angedeutet, was ein Mensch<br />
zum Leben braucht: Wechselseitige Liebe<br />
und Anerkennung, die sich zwischen den<br />
natürlichen und individuell unterschiedlichen<br />
Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger<br />
passt. Insgeheim unterstellt er seiner<br />
Frau Hanka eine Beziehung zu einem<br />
anderen Mann und spioniert ihr nach. Dadurch,<br />
dass sie tatsächlich eine Affäre mit<br />
dem Studenten Mariusz hat, wird die Ehe<br />
auf eine harte Probe gestellt. F<strong>als</strong>che Schlüsse<br />
führen schließlich zu einem Selbstmordversuch.<br />
X<br />
Du sollst nicht begehren deines Nächsten<br />
Frau, Haus, Sklave, Rind, Esel oder sonst etwas,<br />
das ihm gehört. (Dt)<br />
In Dekalog Zehn werden die Konsequenzen<br />
der Erbschaft einer kostbaren<br />
Briefmarkensammlung hinsichtlich Neid<br />
und Besitzgier mit Anleihen an Krimin<strong>als</strong>tücke<br />
ausbuchstabiert. Die Brüder Artur<br />
und Jerzy streben danach die Sammlung<br />
zu komplettieren. Bei einem konspirativen<br />
Treffen im Park mit dem Markenhändler,<br />
in dem es weniger um Philatelistisches <strong>als</strong><br />
um Blutgruppen geht, erklärt sich Jerzy<br />
bereit, eine Niere für die krankte Tochter<br />
des Markenhändlers zu spenden. Doch die<br />
Sammlung wird trotz aller Sicherheitsmassnahmen<br />
gestohlen. Hatten die beiden schon<br />
zuvor nur den eigenen Vorteil im Auge, so<br />
steigern sie sich nun in gegenseitige Schuldzuweisungen<br />
und Verdächtigungen.<br />
Jüngere und junge, weniger bekannte<br />
polnische RegisseurInnen nehmen sich<br />
einzelner Themen und Stoffe wie Schuld,<br />
Familie und Erinnerung, die im Dekalog<br />
angedeutet oder aufgegriffen werden, wegen<br />
deren Aktualität in einer sich radikal<br />
veränderten Welt an, die Spuren christlicher<br />
Werte aufweist. Mit Zweifel, aber<br />
ohne Angst arbeiten sie an einer Weiterentwicklung<br />
der hier fassbaren, am Dokumentarischen<br />
geschulten Filmsprache in ihrer<br />
bisweilen spröden, langsamen Nachhaltigkeit<br />
in der furchtlosen Auseinandersetzung<br />
mit kulturübergreifenden Urthemen. 10 Auf<br />
den verwandten Filmbändern und anderen<br />
Speichermedien haben alle Varianten von<br />
10 Siehe: Krzystof Krauze, Schuld, 1999; Filip<br />
Zylber, Abschied von Maria, 1993; Wojciech<br />
Smarzowski, Hochzeit 2004; Dorota Kedzierzawska,<br />
Krähen, 1994; Magdalena Piekorz,<br />
Striemen, 2004; Dariusz Jabłoński, Der<br />
Fotograf, 1998, Macie J. Drygas, Hört meinen<br />
Schrei, 1991; Slawomir Fabicki, Männersache,<br />
2001; Wojciech Staroń, Eine Polin in Sibirien,<br />
1998.<br />
145
Menschen gleichberechtigt Platz. 11 Ihren<br />
Aussagen und Werken zufolge scheint ihnen<br />
viel daran zu liegen, sich der Wirklichkeit in<br />
ihren Eigenheiten mit dem Bewusstsein für<br />
deren in sich brüchige Strukturen und Rituale<br />
anzunähern und deren Durchlässigkeit<br />
gegenüber den großen Themen auf ebenso<br />
behutsame wie radikale Weise ausgehend<br />
von ihrem unmittelbaren Lebens- und Erfahrungsumfeld<br />
transparent werden zu lassen.<br />
12 Parallel dazu entstehen Filme mit bisweilen<br />
surreal überformten Qualitäten über<br />
Phänomene wie Egoismus, kapitalismusgesättigte<br />
Dekadenz und Exzesse. 13 Die staatliche<br />
Filmförderung, ein jahresübergreifendes<br />
Festivalwesen innerhalb Polens sowie die Beteiligung<br />
junger Regisseure an internationalen<br />
Kurzfilmfestiv<strong>als</strong> tragen dazu bei, dass<br />
diese Form der Filmkultur im Angesicht der<br />
wachsenden Kommerzialisierung weiterexistieren<br />
kann. 14 Der ideale Betrachter dieser<br />
Filme ist ein cinophiler Mensch jeglicher<br />
Altersklasse, für den der Gang ins Kino ein<br />
selbstverständliches Ritual innerhalb des lebenslangen<br />
Prozesses ist, sich in der Welt<br />
und den darin lebenden Menschen zurechtfinden<br />
zu lernen und dabei im Bewusstsein<br />
für Vorträglichkeiten, Wiederholungen und<br />
Nachträglichkeiten ebenso kostbare wie<br />
schmerzliche Erfahrungen zu sammeln.<br />
11 Siehe: Piotr Trzask<strong>als</strong>ki, Edi, 2002; Maciej<br />
Adamek, Leben Lernen, 2003; Borys Lankosz,<br />
Evolution, 2001.<br />
12 Siehe: Marek Lechki, Meine Stadt, 2002;<br />
Mariusz Front, Doppelporträt, 2000; Dariusz<br />
Gajewski, Warschau, 2003.<br />
13 Mariusz Treliński, Die Egoisten, 2000; Lech<br />
J. Majewski, Wojaczek, 1999; Łukasz Barczyk,<br />
Wandlungen, 2003; Piotr Szczepański, Generation<br />
C.K.O.D.<br />
14 Die Filmförderung fällt in die Zuständigkeit<br />
folgender Institutionen: Biuro Komitetu<br />
Kinematografii, Warschau; Agencia Produkcji<br />
Filmowej, Warschau; Agencija Scenariuszowa,<br />
Warschau; Film Polski Agencija Promocij, Warschau;<br />
Filmoteca Naradowa, Warschau. Monatlich<br />
erscheint die Zeitschrift „Kino“ (www.<br />
kino.onet.pl). Für eine Übersicht der jährlich<br />
stattfindenden Festiv<strong>als</strong> siehe: Polski Cinema<br />
2001, hrsg. v. Film Polski Agencija Promocji,<br />
Warschau 2001, S. 17.<br />
146
Teuflische Einbildungen.<br />
Der polnische Regisseur Roman Polanski und<br />
die Imagination des Bösen<br />
von Julian Hanich<br />
Der polnische Regisseur Roman Polanski hat in seinem Leben viele Spielarten<br />
des menschlichen Horrors kennengelernt. Diese Erfahrungen spiegeln sich in<br />
seinen Filmen. Allerdings vermeidet er dabei häufig die direkte Darstellung<br />
von Gewalt und Grauen und verlässt sich lieber auf den Vorstellungswillen des<br />
Zuschauers.<br />
Der Mensch Roman Polanski hat dem<br />
„Bösen“ vielfach ins Gesicht gesehen: dem<br />
„Bösen“ in seinen scheußlich schillernden<br />
Facetten von Genozid, Mord, Folter, Denunziation<br />
und Vergewaltigung. Der Regisseur<br />
Roman Polanski ist dem „Bösen“ ein<br />
ganzes Filmemacherleben lang auf den Fersen<br />
geblieben, um es einzufangen, auf die<br />
Leinwand zu zerren und seine Fratze dem<br />
Zuschauer vor Augen zu führen – oder sollte<br />
man vielleicht eher sagen: es mit suggestiven<br />
Aussparungen wirkungsmächtig anzudeuten?<br />
Auf der einen Seite stehen die persönlichen<br />
Erfahrungen: Der polnische Jude Polanski,<br />
geboren am 18. August 1933, wuchs im Krakauer<br />
Getto auf, wo er die kaltblütige Erschießung<br />
einer Frau hautnah erlebte, den<br />
Abtransport seiner Mutter mit ansehen<br />
musste und selbst nur knapp der Liquidierung<br />
des Gettos entkam. Er überlebte auf<br />
dem Land bei Bauern-Familien, die ihn versteckten.<br />
Nach dem Krieg erfuhr er, dass<br />
seine Mutter in Auschwitz vergast worden,<br />
dass sein Onkel in Buchenwald gestorben,<br />
dass sein Vater dem Tod in Mauthausen nur<br />
knapp entronnen war. Am 9. August 1969<br />
wurde seine Frau Sharon Tate, dam<strong>als</strong> im<br />
achten Monat schwanger, in ihrem Haus in<br />
den Hollywood Hills brutal von vier Mitgliedern<br />
der Gruppe um Charles Manson<br />
mit 16 Messerstichen ermordet. Mit dem<br />
Blut von Polanskis Frau hatte eine der Täterinnen<br />
noch das Wort „Pig“ an die Wand<br />
geschmiert, bevor sie floh. Er selbst stand<br />
1977 in den USA vor Gericht, weil er ein 13-<br />
jähriges Mädchen erst zum Drogenkonsum<br />
verführt und dann oral, vaginal und anal penetriert<br />
hatte. Er entzog sich dem Urteil, <strong>als</strong><br />
sich eine Gefängnisstrafe abzeichnete und<br />
floh im Februar 1978 nach Frankreich. Seitdem<br />
ist er nicht mehr in die USA zurückgekehrt,<br />
dem Land, wo er mit Rosemary’s Baby<br />
(1968) und Chinatown (1974) zwei seiner<br />
größten Filme gedreht hatte. Selbst seinen<br />
Oscar für die „beste Regie“ (Der Pianist)<br />
nahm er 2002 nicht selbst entgegen.<br />
Auf der anderen Seite findet man seine<br />
filmische Auseinandersetzung mit dem<br />
Abgründigen, Niederträchtigen, Abscheulichen.<br />
Auch wenn man mit einer monokausalen<br />
Ursache-Wirkungs-Erklärung zwischen<br />
Leben und Werk selten weit kommt,<br />
liegt es dennoch nahe, in seiner Biographie<br />
zumindest eine Teilerklärung für seine Faszination<br />
für das „Böse“ zu suchen. In einem<br />
Roman Polanski<br />
(Foto: Steve Pyke)<br />
147
Interview erzählte er einmal: „When I was<br />
eight years old I was attacked and robbed in<br />
Krakow. Someone nearly bashed my skull<br />
in with a stone wrapped in newspaper. He<br />
hit me five times, very hard. When I woke<br />
up, I saw the blood running over my face<br />
and eyes. And ever since that day, whenever<br />
I’m standing under the shower, I feel the<br />
blood running over me.” Blut rinnt auch<br />
über das Auge des Betrachters seiner Filme<br />
– wenngleich es meist sein inneres Auge ist.<br />
Polanski hat Filme gedreht über Folter und<br />
Trauma (Der Tod und das Mädchen, 1994),<br />
den Holocaust (Der Pianist), Inzest (Chinatown),<br />
den mörderischen Willen zur Macht<br />
(Macbeth, 1971) und sadistischen Sex (Bitter<br />
Moon, 1992). Und mit Filmen wie The<br />
Fearless Vampire Killers (1967), Rosemary’s<br />
Baby und The Ninth Gate (1999) ist er immer<br />
wieder zu jenem Genre zurückgekehrt,<br />
das die Frage der manichäischen Konfrontation<br />
von „Gut“ und „Böse“ brennglasartig<br />
bündelt: dem Horrorfilm.<br />
Das Erstaunliche dabei: Polanski meidet<br />
häufig den direkten Blick ins Gesicht<br />
des Horrors – dennoch entkommen seine<br />
Zuschauer dem Angesicht des „Bösen“<br />
nicht. Wie ist das möglich? Anders <strong>als</strong> seine<br />
amerikanischen Kollegen Martin Scorsese,<br />
Quentin Tarantino oder Stanley Kubrick<br />
(ganz zu schweigen von der blutrünstigen<br />
Horde der Horror-Regisseure), gehört es zu<br />
Polanskis Stilprinzip, das „Böse“ nicht zu<br />
zeigen, sondern es vielmehr anzudeuten.<br />
Die Darstellung des Monsters, des Teufels,<br />
der Gewalt verlagert er geschickt von der<br />
Kinoleinwand auf die „innere“ Leinwand<br />
des Zuschauers. Mit anderen Worten: Er<br />
gelangt durch Suggestion zur Imagination,<br />
durch die Kraft der Andeutung zur Einbildungskraft.<br />
Polanski hat selbst einmal<br />
von der „landscape of the mind“ gesprochen:<br />
jener Bilder-Landschaft, bei der externe<br />
filmische Reize in interne mentale Einbildungen<br />
übergehen. Polanski behauptet,<br />
stark von Richard L. Gregorys Klassiker Eye<br />
and Brain. The Psychology of Seeing (1966)<br />
beeinflusst zu sein. Darin argumentiert der<br />
britische Psychologe, dass unsere Wahrnehmungen<br />
durch die Summe unserer optischen<br />
Erfahrungen mitgeformt werden.<br />
In seiner Autobiographie von 1984 schreibt<br />
der Filmemacher zusammenfassend: „Wir<br />
sehen weit weniger, <strong>als</strong> wir glauben – weil<br />
in unserem Gehirn bereits frühere Eindrücke<br />
gespeichert sind.“ Die Imagination<br />
in Polanskis Kino (und nicht nur dort) ist<br />
immer ein synthetischer Akt, der sich parasitär<br />
unterschiedlicher mentaler Zustände<br />
bedient: der aktuellen Wahrnehmung, der<br />
Erinnerung sowie allgemeiner konzeptueller<br />
Vorstellungen.<br />
Dazu gibt es ein schönes Beispiel aus dem<br />
Film The Fearless Vampire Killers (der bei<br />
uns <strong>als</strong> Tanz der Vampire bekannt wurde).<br />
Der Vampirjäger Professor Abronsius (Jack<br />
McGowran) und sein Assistent Alfred (Roman<br />
Polanski) setzen an, dem schlafenden<br />
Vampir Shagal (Alfie Bass) einen spitzen<br />
Holzpflock ins Herz zu hämmern. Polanski<br />
zeigt diese Szene nicht direkt – stattdessen<br />
nimmt er einen Umweg, indem er<br />
die Tat <strong>als</strong> Schattenwurf an die Wand projiziert.<br />
Als Alfreds Schatten auf den vom<br />
Professor gehaltenen Pflock schlägt, legen<br />
wir jedoch das in der Szene zuvor gesehene<br />
Bild des aufgebahrten Vampirs und die beiden<br />
tatsächlichen Protagonisten ‚über’ die<br />
Schattenbilder an der Wand. Man könnte<br />
von einer mentalen Doppelbelichtung sprechen:<br />
Wir sehen Imaginations- und Wahrnehmungsbild,<br />
mentales und Filmbild<br />
gleichzeitig übereinander geschichtet. Die<br />
Gewaltdarstellung wird folglich nur angedeutet<br />
und findet erst in unserem Kopf<br />
ihre volle Konkretisierung. Dass Polanski<br />
daraus auch noch einen herrlichen Gag zu<br />
ziehen in der Lage ist, beweist seine Größe<br />
in Sachen Suggestion: Nach einem Schnitt<br />
enthüllt er uns nämlich, dass die beiden gar<br />
nicht auf den Vampir eingehauen haben<br />
(wie man zunächst annehmen musste), sondern<br />
dass der Pflock in ein Kissen geschlagen<br />
wurde:<br />
Roman Polanski und Jack McGowran in The Fearless<br />
Vampire Killers Quelle: MGM)<br />
148
Am exemplarischsten führt uns Polanski<br />
das Wirkungsprinzip der Andeutung jedoch<br />
am berühmten Ende von Rosemary’s Baby<br />
vor Augen, auf das ich nun im Detail eingehen<br />
will. Worin geht es in Rosemary’s Baby?<br />
Das frischvermählte Ehepaar Woodhouse<br />
bezieht zu Beginn des Films ein großes,<br />
leicht unheimlich anmutendes Apartment<br />
in New York City. Wie sich herausstellt, ist<br />
mit der Wohnung, mit den Nachbarn und<br />
in der Folge auch mit Rosemary (Mia Farrow)<br />
irgendetwas nicht in Ordnung. Eines<br />
Nachts träumt Rosemary, wie sie von Satan<br />
vergewaltigt wird. Oder erlebt sie den<br />
teuflischen Beischlaf tatsächlich? Jedenfalls<br />
stellt sie wenig später fest, dass sie in jener<br />
Nacht befruchtet wurde. Die Schwangerschaft<br />
verläuft merkwürdig: Sie nimmt beinahe<br />
nichts mehr zu sich, entwickelt paranoide<br />
Züge und wähnt sich verfolgt. Oder<br />
stellt ihr tatsächlich jemand nach? Dennoch<br />
gebiert sie das Kind – nur um dann herauszufinden,<br />
dass sie von einer satanischen Sekte,<br />
zu der auch ihr Mann Guy (John Cassavettes)<br />
und das benachbarte Ehepaar Minnie<br />
(Ruth Gordon) und Roman Castevet (Sidney<br />
Blackmer) gehören, benutzt wurde, um<br />
den Sohn des Teufels auszutragen. Oder ist<br />
es gar nicht Satans Sohn?<br />
In der besagten Schlussszene betritt Rosemary<br />
mit einem Messer bewaffnet das<br />
Wohnzimmer ihrer Wohnung, wo sich die<br />
satanische Sekte versammelt hat. Langsam,<br />
beinahe tranceartig nähert sie sich der<br />
schwarzen Wiege ihres Kindes (siehe Foto).<br />
Da ihr das Baby sofort nach der Geburt entzogen<br />
wurde, hat sie es bis dahin noch nicht<br />
zu Gesicht bekommen. Das gleiche gilt für<br />
uns Zuschauer: Wir haben es bisher nur<br />
schreien gehört, gesehen haben wir es nicht.<br />
Der Clou an dieser Szene, ja des gesamten<br />
Films ist gerade, dass wir das Teufelskind<br />
nie tatsächlich sehen werden. Die Szene ist<br />
zunächst geprägt von nahezu völliger Stille.<br />
Nur das leise Tick-Tack, Tick-Tack einer<br />
Wanduhr ist aus dem Hintergrund zu hören.<br />
Vorsichtig zieht Rosemary den Schleier<br />
der Wiege beiseite, wobei der Film uns weiterhin<br />
bewusst den Blick auf das Kind verwehrt.<br />
Als Rosemary das Kind erblickt, weiten<br />
sich ängstlich ihre Augen. Sie reißt ihre<br />
linke Hand vor dem Mund und sieht sich<br />
erschrocken um. Die Musik schwillt an; die<br />
Streicher imitieren weibliche Schreie.<br />
Mia Farrow in der Schlussszene von Rosemary’s Baby<br />
(Quelle: Paramount Pictures)<br />
Zu diesem Zeitpunkt dürfte bei den meisten<br />
Zuschauern die Imagination noch vage<br />
und schemenhaft sein (wenn überhaupt irgendetwas<br />
visualisiert wird). Mit anderen<br />
Worten: Es stellt sich noch keine visuelle<br />
Vorstellung des monströsen Kindes ein.<br />
Dies ändert sich jedoch schrittweise – und<br />
zwar schon sehr bald. Zunächst, wenn wir<br />
Rosemary fragen hören: „What have you<br />
done to it? What have you done to its eyes?”<br />
Und dann, deutlicher noch, wenn der Nachbar<br />
Roman Castavet antwortet: “He has his<br />
father’s eyes.” Die beiden Verweise auf die<br />
Augen des Kindes legen es dem Zuschauer<br />
nahe, zur Vergewaltigungsszene zurückzugehen,<br />
in welcher für einen kurzen Moment<br />
die beängstigenden, orangefarbenen Augen<br />
des Teufels auffunkelten. Da uns der Film<br />
sehr stark nahe legt, dass Rosemarys Kind<br />
identisch ist mit Satans Sohn, setzt er ein<br />
sehr lebhaftes Imaginationsbild frei, das sich<br />
– einerseits – aus der Erinnerung der Teufelsaugen<br />
aus der früheren Szene und – andererseits<br />
– einer Vorstellung von Babys im<br />
Allgemeinen zusammensetzt: ein mentales<br />
Bild <strong>als</strong>o, in dem ein Babygesicht und teuflische,<br />
orangefarbene Augen (vergleichbar,<br />
aber nicht identisch mit den vorher im Film<br />
gesehenen) verschmelzen.<br />
Dieses Imaginationsbild wird neu belebt<br />
und in anderen Facetten konkretisiert,<br />
wenn zwei Frauen aus der Sekte Rosemary<br />
auffordern, die Hände und Füße des Kindes<br />
anzusehen. Vor meinem mentalen Auge<br />
blitzte in diesem Moment das Bild eines Ba-<br />
149
ys mit widerlichen, entstellten, braunen<br />
Händen auf, vergleichbar mit – aber kleiner<br />
<strong>als</strong> – diejenigen des Teufels in der zuvor<br />
erwähnten Vergewaltigungsszene. Da die<br />
Vergewaltigungsszene jedoch keine Darstellung<br />
der Füße des Teufels enthält, muss<br />
der Zuschauer daher auf mentales Bildmaterial<br />
jenseits des Filmes zurückgreifen. In<br />
meiner Vorstellung sah ich das Baby mit<br />
zwei Pferdefüßen ausgestattet, wie ich sie<br />
ganz ähnlich <strong>als</strong> Kind in dem beliebten<br />
Bilderbuch Hans Wundersam gesehen hatte.<br />
Meine visuelle Imagination dieser Szene<br />
bediente sich <strong>als</strong>o zweier unterschiedlicher<br />
Formen der Erinnerung: Ich erinnerte mich<br />
an eine frühere Szene des Films und eine<br />
Darstellung, die ich <strong>als</strong> Kind gesehen hatte<br />
– und brachte beide in das Imaginationsbild<br />
mit ein.<br />
Weiterführende Literatur<br />
Edward Casey: Imagining. A Phenomenological<br />
Study. Bloomington: Indiana University<br />
Press, 2000.<br />
Paul Cronin (Hg.): Roman Polanski Interviews.<br />
Jackson: University of Mississippi<br />
Press, 2005.<br />
Richard L. Gregory: Eye and Brain. The<br />
Psychology of Seeing. London: Weidenfeld,<br />
1977.<br />
Roman Polanski: Autobiographie. München:<br />
Heyne, 1985.<br />
Um es noch einmal zu betonen: Diese<br />
bildliche Imagination ist ein synthetischer<br />
Akt. Zwei unterschiedliche mentale Zustände<br />
– Erinnerung und allgemeine konzeptuelle<br />
Vorstellung – verbinden sich in einem<br />
dritten – der Imagination – und fördern so<br />
ein synthetisiertes Bild des Teufelssohnes<br />
zutage. Durch geschickte Manipulation<br />
bringt uns der Regisseur Roman Polanski<br />
<strong>als</strong>o dazu, das Bild von Satans Sohn so lebhaft<br />
auf unsere mentale Leinwand zu projizieren,<br />
dass viele Zuschauer es danach<br />
tatsächlich <strong>als</strong> Teil des Zelluloidstreifens<br />
wähnten. In seiner Autobiographie weist<br />
Polanski auf eben diese Reaktionen mancher<br />
Zuschauer hin, „die sich einbildeten,<br />
das Baby samt teuflischen Pferdefüßen erblickt<br />
zu haben. Dabei war das einzige, was<br />
sie im Bruchteil einer Sekunde tatsächlich<br />
gesehen hatten, eine hauchfeine Überblendung<br />
der katzengleichen Augen, die auf<br />
Rosemary herabstarren – und zwar schon<br />
in ihrem Alptraum zu Beginn des Films.“<br />
Auch mir ging es so, <strong>als</strong> ich den Film für<br />
diesen Essay kürzlich noch einmal sah: Völlig<br />
überzeugt dem Film-Bild des satanischen<br />
Kindes am Ende wieder zu begegnen, war<br />
ich überrascht, <strong>als</strong> dieses sich an keiner Stelle<br />
materialisierte. In meiner Erinnerung an<br />
den Film hatte ich die visuelle Imagination<br />
offenbar unter visueller Wahrnehmung gespeichert.<br />
Gibt es einen lebhafteren Beweis<br />
für die Macht von Polanskis unheimlichen<br />
Suggestionen des „Bösen“?<br />
150
Klaus Kinski<br />
von Michael Lentze<br />
Klaus Kinski war ohne Zweifel einer der<br />
größten Schauspieler des vergangenen Jahrhunderts.<br />
In zahllosen Filmen zeigte er sein<br />
künstlerisches und schauspielerisches Genie.<br />
In vielen Werken ist er <strong>als</strong> Person zu erleben,<br />
die stets zwischen Genie und Wahnsinn<br />
agiert und auf einem schmalen Grad<br />
den Zuschauer bedrückt und fesselt gleichermaßen.<br />
Kinski – geboren <strong>als</strong> Nikolaus Günther<br />
Karl Nakszynski in Zoppot bei Danzig<br />
– führt auch privat ein Leben, das durch<br />
ständige Grenzüberschreitungen fasziniert.<br />
Er wird oft <strong>als</strong> Egomane beschrieben, der<br />
keinen Gott neben sich dulde. Er legte eine<br />
selbstzerstörerische Radikalität und Professionalität<br />
an den Tag, die berufliche und<br />
private Konflikte oft eskalieren ließ, ihn<br />
aber letztlich zu der ihm eigenen Kreativität<br />
führte.<br />
In einzigartiger Weise vermochte er seine<br />
jeweiligen künstlerischen Rollen mit dem<br />
realen Leben zu verschmelzen: „Ein Künstler,<br />
der ausschließlich aus und für sich existierte<br />
und keinerlei Distanz zur Profession<br />
kannte: Das Leben und die Kunst wurden<br />
identisch“ (Ina Brockmann: Klaus Kinski,<br />
Deutscher Taschenbuchverlag 2001).<br />
Er kannte kein Maß und kein Urteil<br />
und vertraute letztlich nur der eigenen Person.<br />
In seinem Werk zeigte und lebte er den<br />
haltlosen Rowdy letztlich ebenso authentisch<br />
wie den sensiblen Künstler. Nur wenige<br />
Schauspieler polarisieren derartig stark<br />
wie Klaus Kinski: er wurde geliebt oder gehasst<br />
ob seiner Tabubrüche und Wutanfälle.<br />
Er wurde bewundert für seine gnadenlose<br />
Offenheit der Gesellschaft und dem Leben<br />
gegenüber und mit Abscheu betrachtet <strong>als</strong><br />
Person, die jeden Respekt vor Dingen und<br />
Personen verloren zu haben schien.<br />
Viele seiner Filme entstanden in Zusammenarbeit<br />
mit Werner Herzog, der die Ambivalenz<br />
im Umgang mit Kinski erlebt hat<br />
und in seinem Werk „Mein liebster Feind<br />
– Klaus Kinski“ (1999) retrospektiv darlegt.<br />
In einem Interview zu diesem Film sagte<br />
er einmal: „Im übrigen habe ich auch mit<br />
Kinski jeden Tag völlig anders und neu gearbeitet<br />
- je nach Bedürfnis, nach Lage oder<br />
je nach Zerbrechlichkeit zum Beispiel. Es<br />
gab viele Tage, an denen er sozusagen ein<br />
Stützkorsett brauchte und andere, wo er<br />
eine bedingungslose Sicherheit im Hintergrund<br />
forderte, die ich ihm zu geben hatte.<br />
Manchmal musste ich ihn absichtlich provozieren,<br />
damit er sich erst Mal leer brüllt<br />
und nach zwei Stunden Schreikrämpfen<br />
ganz leise, konzentriert und gefährlich war.<br />
Jeder Tag begann unausrechenbar morgens<br />
beim gemeinsamen Frühstück.“ (aus der<br />
Wochenzeitung: Freitag37, Berlin, 29. Oktober<br />
1999).<br />
Kinski vermochte es in einzigartiger Weise,<br />
Rastlosigkeit, Kompromißlosigkeit und<br />
Besessenheit in seinen Rollen zu verkörpern.<br />
Daß sich seine Einstellung auch im realen<br />
Leben widerspiegelte, verwundert nicht.<br />
In seinen Memoiren „Ich bin so wild nach<br />
deinem Erdbeermund“ (München, 1975)<br />
beschreibt Kinski in schonungsloser Offenheit,<br />
wie er auf der ständigen Hast nach<br />
Arbeit, Liebe, Arbeit, Liebe, Arbeit und viel<br />
Liebe lebt.<br />
151
In seinem letzten Film „Kinski Paganini“<br />
agiert Klaus Kinski sowohl <strong>als</strong> Hauptdarsteller<br />
wie <strong>als</strong> Regisseur. Schon in den<br />
sechziger Jahren entdeckt Kinski Parallelen<br />
zwischen sich und dem berühmten italienischen<br />
Geiger: beide verausgaben sich<br />
für das Publikum, provozieren mit ihrem<br />
künstlerischen Ausdruck, führen einen exzessiven<br />
Lebensstil mit scheinbar unersättlicher<br />
Lust am Sex.<br />
In Deutschland gelangte der Film<br />
schließlich 1999 in die Kinos – Jahre nach<br />
Kinskis Tod. Die Reaktionen reichten von<br />
absoluter Ablehnung bis hin zu totaler Bewunderung.<br />
Eine Polarisierung in den öffentlichen<br />
Meinungen, wie sie Kinski sein<br />
Leben lang begleitet hat.<br />
Kinski sammelt für den Film Jahrzehnte<br />
lang alles an Informationen über Niccolo<br />
Paganini, was er auftreiben kann, dazu<br />
Requisiten jeder Art. Er schreibt das Drehbuch,<br />
überarbeitet es, versucht Geldgeber<br />
für sein Projekt zu finden, was ihm erst<br />
Ende der achtziger Jahre gelingt.<br />
In seinem Film will er seine Perfektion<br />
und seine Ideen umsetzen – ohne irgendwelche<br />
Kompromisse eingehen zu müssen.<br />
Er bereitet jede Einstellung jahrelang vor,<br />
wählt jedes Musikstück selber aus und will<br />
sich um der Authentizität wegen sogar alle<br />
Zähne ziehen lassen – sein Zahnarzt verweigerte<br />
sich jedoch dem Eingriff. In seiner<br />
Autobiographie schreibt er schließlich über<br />
die Dreharbeiten: „Die Arbeit an Pagani<br />
war die einzige magische Arbeitszeit meines<br />
Lebens gewesen.“ (Klaus Kinski: Ich brauche<br />
Liebe, München 1991).<br />
Als der Film schließlich 1988 in der fertigen<br />
Fassung vorliegt, stößt er auf Ablehnung,<br />
da er <strong>als</strong> zu brutal und nahezu pornographisch<br />
angesehen wird. Kinski selber<br />
kämpft die letzten Jahre seines Lebens<br />
schließlich um die Aufführung – großenteils<br />
vergebens.<br />
Er begeistert mit seinem Werk in Privataufführen<br />
zwar viele Menschen, ins<br />
Kino bringt er ihn aber nicht. „Was mich<br />
interessiert ist, daß das Kinopublikum meinen<br />
Film sieht. Der Kampf um den Verleih<br />
meines Filmes wird nicht eher enden, <strong>als</strong><br />
bis die ganze Welt Kinski Paganini sehen<br />
kann.“ (aus: Ich brauche Liebe).<br />
152
Dramatische Theologie in Innsbruck – der<br />
europäische Theologe Jozéf Niewiadomski<br />
von Sebastian Maly<br />
Der in Innsbruck lehrende, aus Lublin stammende Theologe Józef Niewiadomski<br />
steht für das theologische Paradigma einer „Dramatischen Theologie“. Welche<br />
dramatischen Erkenntnisse stecken hinter diesem Ansatz?<br />
Begegnet bin ich dem Theologen Jozéf<br />
Niewiadomski das erste Mal am Beginn<br />
meines Studiums in einem theologischen<br />
Sammelband, der das theologische Verhältnis<br />
des Christentums zu anderen Religionen<br />
zum Thema hatte. Im Inhaltsverzeichnis<br />
stand auch ein von einem Autorentrio verfasster<br />
dreiteiliger Aufsatz mit dem Titel<br />
„Dramatischer Ansatz für die Begegnung<br />
der Weltreligionen“. Einer der Autoren war<br />
Niewiadomski. Ich überblätterte den Aufsatz<br />
mit einem Kopfschütteln, klang er mir<br />
doch zu sehr nach dem, was viele Theologen<br />
sehr gerne tun: Sie laufen irgendeinem<br />
in anderen Wissenschaften aufgebrachten<br />
Stichwort hinterher und machen daraus ein<br />
neues theologisches Paradigma („Narrative<br />
Theologie“, „Neurotheologie“, „Kommunikative<br />
Theologie“), womit sich inzwischen<br />
auch gut Drittmittel einwerben lassen.<br />
Bei besagtem Aufsatz musste ich zunächst<br />
an ein Theater der Weltreligionen denken,<br />
schlimmstenfalls malte ich mir eine Art Familienaufstellung<br />
der Weltreligionen aus.<br />
Ich habe bis heute den besagten Aufsatz<br />
nicht gelesen. Inzwischen weiß ich aber,<br />
dass hinter dem „dramatischen Ansatz“ der<br />
drei Autoren eine „Dramatische Theologie“<br />
(DT) steckt, die tatsächlich ein ernstzunehmendes<br />
theologisches Paradigma darstellt,<br />
das Aufmerksamkeit und keinen leisen<br />
Spott verdient, auch wenn man selbst nicht<br />
auf diese Weise Theologie treiben möchte.<br />
Einer der Hauptakteure der dramatischen<br />
Theologie ist Jozéf Niewiadomski. Er wurde<br />
1951 in Lublin geboren. Nach Studien in<br />
Lublin und Innsbruck wurde er 1975 zum<br />
Priester der Diözese Lublin geweiht und<br />
verfolgte anschließend eine akademische<br />
Laufbahn an der Universität Innsbruck.<br />
Dort war er der erste Assistent und Doktorand<br />
von Raymund Schwager SJ, dem leider<br />
kürzlich verstorbenen Dogmatikprofessor,<br />
der <strong>als</strong> Gründungsvater der DT zu gelten<br />
hat, weswegen man ihn in Fachkreisen liebevoll-spöttisch<br />
den „Sündenbock-Schwager“<br />
genannt hat. Auf die Ursache dieses<br />
Spitznamens komme ich gleich noch zurück.<br />
Niewiadomski promovierte und habilitierte<br />
in Innsbruck, war dann von 1991 bis<br />
1996 Professor für Dogmatik in Linz, bevor<br />
er 1996 Professor für Dogmatik in Innsbruck<br />
wurde, wo er bis heute lehrt und wirkt.<br />
Bei aller intellektuellen Eigenständigkeit<br />
verfolgt Niewiadomski – u.a. auch <strong>als</strong><br />
Teilnehmer eines groß angelegten interfakultären<br />
Forschungsprojekts („Dramatische<br />
Theologie: Innsbrucker Forschungsprojekt<br />
zu Religion, Gewalt, Kommunikation und<br />
Weltordnung“) – das von seinem Lehrer<br />
Schwager begründete Paradigma einer DT.<br />
153
Deswegen ist die DT gut geeignet, den Theologen<br />
Niewiadomski vorzustellen und dabei<br />
ein intellektuelles Profil sichtbar zu machen,<br />
das sich auch mit dem Thema unseres<br />
Europäischen Doktorandenkolloquiums<br />
„Erinnerung und Identität“ in Verbindung<br />
bringen lässt.<br />
Was ist DT? DT ist ein Forschungsprojekt<br />
oder -programm, das in vielfältiger<br />
Weise auf wissenschaftliche, gesellschaftliche<br />
und historische Herausforderungen<br />
reagiert. Niewiadomski hat gemeinsam mit<br />
Schwager und anderen dieses Programm in<br />
einem Aufsatz aus dem Jahr 1996 zu formulieren<br />
versucht. Der „harte Kern der DT“,<br />
wie Schwager und Niewiadomski es nennen,<br />
besteht demnach aus folgenden Thesen:<br />
1. Ein dauerhafter und echter Friede<br />
zwischen den Menschen, der nicht auf einer<br />
Opferung Dritter aufgebaut ist und ohne<br />
Polarisierung auf Feinde auskommt, übersteigt<br />
menschliche Kräfte. Wenn er dennoch<br />
Wirklichkeit wird, ist dies ein klares<br />
Zeichen dafür, dass Gott selber in den<br />
Menschen am Wirken ist (inkarnatorische<br />
Logik).<br />
2. Wenn echte Versöhnung zwischen<br />
Menschen versagt, wird das Unbewältigte<br />
– oft im Namen Gottes – auf Dritte abgeschoben.<br />
Auf diese Weise entstehen ‚Sün-<br />
Eine ausführliche Bibliographie von Niewiadomski<br />
findet sich unter http://systheol.uibk.<br />
ac.at/niewiadomski/publ/ .<br />
Ich stütze mich bei der Darstellung der DT<br />
auf den Aufsatz Schwager/Niewiadomski et al.<br />
(1996), Dramatische Theologie <strong>als</strong> Forschungsprogramm,<br />
in: Zeitschrift für Katholische Theologie<br />
118 [1996], 317-344. Auch alle wörtlichen<br />
Zitate entstammen diesem Aufsatz. Leider<br />
rekonstruiert der Aufsatz das Forschungsprogramm<br />
der DT auf eine m.E. unnötig<br />
komplizierte und teilweise verwirrende Weise,<br />
indem er es in ein fragwürdiges wissenschaftstheoretisches<br />
Korsett zu zwängen versucht,<br />
das wiederum die Wissenschaftlichkeit von<br />
Theologie gewährleisten soll. Außerdem sind<br />
die Ausführungen mit allerlei theologischen Voraussetzungen<br />
und Begriffen gespickt, die nicht<br />
erklärt werden, und selbst beim Fachtheologen<br />
das ein oder andere Stirnrunzeln auslösen.<br />
denböcke’. Da Jesus Christus in seiner gewaltfreien<br />
Feindesliebe sich selber vom<br />
Bösen treffen ließ und da Gott ihn vom<br />
Tod erweckt hat, kann durch den Glauben<br />
an Jesus Christus das Versagen beim eigenen<br />
Bemühen um echte Versöhnung positiv<br />
aufgearbeitet und in das Bemühen um einen<br />
dauerhaften Frieden integriert werden.<br />
3. Der in der Spannung zwischen<br />
Abschiebung (der Schuld) und Versöhnung<br />
ermöglichte Lebensraum stellt den Ort aller<br />
anderen menschlichen und mitmenschlichen<br />
Erfahrungen (z.B. Endlichkeit, Sexualität)<br />
dar und transformiert auch die<br />
Naturerfahrungen des Menschen.<br />
Der „harte Kern“ der DT formuliert ein<br />
Paradigma, einen Rahmen, innerhalb dessen<br />
eine Theologie auf der Höhe zeitgenössischer<br />
Probleme getrieben werden soll.<br />
Dieser Rahmen stellt seinerseits bereits eine<br />
vorausgegangene bestimmte Deutung der<br />
christlichen Tradition dar. Diese Deutung<br />
enthält zwei zentrale Elemente: (1) Die Geschichte<br />
Gottes mit den Menschen ist im<br />
Sinne eines Dramas – wobei angemerkt<br />
werden muss, dass die genaue Bedeutung<br />
dieses Begriffs nirgendwo im Aufsatz geklärt<br />
wird – zu verstehen: Gott versucht<br />
mit den Menschen zu kommunizieren. Die<br />
Menschen gehen nicht angemessen darauf<br />
ein, es kommt zu Gewalt, die Menschen<br />
verstricken sich in Schuld und schieben<br />
diese Schuld im Kreuz Jesu auf Gott ab.<br />
Doch Gott überwindet all das und wendet<br />
die Geschichte so, dass am Ende ein<br />
‚Happy End’ steht. (2) Die christliche Soteriologie<br />
oder Erlösungslehre ist der Hintergrund,<br />
auf dem dieses Drama seine eigentliche<br />
Bedeutung gewinnt. Gott geht<br />
es in all seinem Handeln um das Heil der<br />
Menschen. Nicht der Mensch schafft im<br />
Drama sein Heil. Es wird ihm von Gott geschenkt<br />
bzw. Gott wirkt im und durch den<br />
Menschen sein Heil.<br />
Laut der dritten These konstituieren beide<br />
Elemente den Lebensraum der Menschen,<br />
der dann die Interpretation aller<br />
weiteren Erfahrungen des Menschen bestimmt.<br />
Die DT will somit alle geschicht-<br />
154
lichen Erfahrungen und Naturerfahrungen<br />
des Menschen von ihrem Paradigma her<br />
deuten. Für diese Aufgabe geht die DT über<br />
den genannten harten Kern hinaus und bedient<br />
sich dazu des Denkens des in den USA<br />
lehrenden, aus Frankreich stammenden Literaturwissenschaftlers<br />
und Religionsphilosophen<br />
René Girard. Dessen sog. „mimetische<br />
Theorie“ soll ein Instrumentarium<br />
bilden, „um in kritischer Auseinandersetzung<br />
mit den Human- und Gesellschaftswissenschaften<br />
die vielfältigen religiösen,<br />
politischen und psychischen Erfahrungen,<br />
die die Menschen im Laufe der Geschichte<br />
gemacht haben, den zentralen Hypothesen<br />
[dem besagten harten Kern, SM] […] zuzuordnen.“<br />
Girard hat seine mimetische Theorie in<br />
einer Vielzahl, auch ins Deutsche übersetzter<br />
Publikationen entwickelt. Die mimetische<br />
Theorie versucht alle kulturellen Phänomene<br />
auf das mimetische Verhalten des Menschen<br />
zurückzuführen. Unter „mimetischem Verhalten“<br />
ist dabei zunächst die These zu verstehen,<br />
dass ein Großteil unseres Verhaltens<br />
auf einer wechselseitigen Nachahmung des<br />
Verhaltens anderer beruht. Ursache des für<br />
Girard interessanten mimetischen Verhaltens<br />
ist das Aneignungsverhalten oder das<br />
Begehren des Menschen – ob es dabei um<br />
lebenswichtige Ressourcen, attraktive Sexualpartner<br />
oder um das dicke Auto des Nachbarn<br />
geht. Auf zweierlei Weise findet im<br />
Begehren eine Nachahmung, eine mimesis<br />
statt. Zunächst ahmt derjenige, der etwas<br />
begehrt, was er nicht hat, den nach, der das<br />
Begehrte besitzt. Jener begehrt das Objekt,<br />
das er nicht besitzt, in ähnlicher Weise, wie<br />
derjenige, der es besitzt. Dieses Begehren<br />
des Habenichts steigert nun wiederum das<br />
Begehren desjenigen, der das Objekt tatsächlich<br />
besitzt. Das Auftreten eines Rivalen<br />
bestätigt nämlich die Berechtigung des<br />
Begehrens. Dieser Widerstand stachelt dann<br />
Auf Deutsch zuletzt erschienen ist René<br />
Girard: Ich sah den Satan vom Himmel fallen<br />
wie einen Blitz. Eine kritische Apologie des<br />
Christentums. München: Hanser 2002 (frz.<br />
Originalausgabe 1999). Auf dieses Buch stütze<br />
ich mich bei der Darstellung der Theorie Girards.<br />
Eine ausführliche Bibliographie ist unter<br />
http://theol.uibk.ac.at/cover/girard_bibliography.html<br />
abrufbar.<br />
das Begehren des Habenichts erneut an etc.<br />
Diese mimetische Natur des Begehrens<br />
gibt Girard zufolge Aufschluss darüber, wie<br />
schlecht zwischenmenschliche Beziehungen<br />
normalerweise funktionieren. Die mimetischen<br />
Rivalitäten sind darüber hinaus die<br />
Hauptquellen zwischenmenschlicher Gewalt.<br />
Viele Gewalteskalationen zeichnen<br />
sich gerade dadurch aus, dass in ihnen das<br />
Objekt, um das es ursprünglich ging, keine<br />
Rolle mehr spielt. Die Gewalt wird vielmehr<br />
durch die jeweilige Nachahmung des anderen<br />
am Laufen gehalten. Ein Blick auf die<br />
schrecklichen Eskalationen im Nahen Osten<br />
in den letzten Monaten mag diese Theorie<br />
prima facie plausibel erscheinen lassen.<br />
Will eine Gesellschaft überleben, muss<br />
sie dieser Gewaltspirale entgegenwirken.<br />
Girard hat durch religions- und kulturgeschichtliche<br />
Studien eine grundlegende<br />
Strategie in vielen Gesellschaften zu diesem<br />
Zweck ausgemacht: Er nennt sie den „Sündenbockmechanismus“.<br />
Die innere Einigung<br />
der Gesellschaft ereignet sich durch<br />
eine gemeinsame Polarisierung der Gesellschaft<br />
auf Opfer oder Feinde hin. Die Tötung<br />
oder Ausstoßung des zum Opfer oder<br />
Feind Erklärten reinigt die Gesellschaft<br />
von der ihr inhärenten Gewalt, weil dieser<br />
Akt keine mimesis nach sich zieht. Das<br />
Opfer wird deswegen bewusst in ein ‚Jenseits’<br />
befördert, weil es von dort aus kein<br />
gewaltsames ‚Feedback’ gibt. Während der<br />
Sündenbock <strong>als</strong> solcher austauschbar ist, ist<br />
seine Funktion für die Gesellschaft, nämlich<br />
ihre Einung, unersetzlich. Deswegen<br />
wird die Entfernung des Sündenbocks wiederholbar<br />
gemacht bzw. ritualisiert, damit<br />
sich die Gesellschaft immer wieder der ‚Heil<br />
bringenden Abwesenheit’ des Sündenbocks<br />
vergewissern kann. Aus dieser gewalttätigen<br />
Polarisierung entspringen somit laut Girard<br />
sakrale Projektionen (Mythen, Rituale<br />
etc.), durch welche die empirischen Opfer<br />
verdeckt werden. Die Religion und insbesondere<br />
die archaischen Religionen bewahren<br />
in ihrer Struktur dieses Wissen um den<br />
Zusammenhang von Gewalt, Mimesis und<br />
Sündenbock auf – selbstverständlich ohne<br />
dieses Wissen explizit zu machen.<br />
Nach Girard stellen jedoch die Weltreli-<br />
155
gionen Versuche dar, das eigentlich Religiöse<br />
von den gewalttätigen Projektionen zu<br />
differenzieren. Zu einer wirklichen Aufdeckung<br />
und Überwindung der Projektionen<br />
und der Gewalt kommt es jedoch erst in<br />
der jüdisch-christlichen Offenbarungsgeschichte:<br />
Im Geschick Jesu wird der Sündenbockmechanismus<br />
enttarnt und dekonstruiert;<br />
denn das Opfer ist unschuldig,<br />
hat aber gleichzeitig eine Heil bringende<br />
Wirkung, indem es zum Inbegriff der Gewaltlosigkeit<br />
und Liebe wird. Allerdings<br />
handelt es sich nur um eine halbierte Aufklärung.<br />
Denn gerade in der Deutung des<br />
Todes Jesu <strong>als</strong> Opfer habe die christliche<br />
Tradition dieselbe mythologisierende Projektion<br />
verwendet wie die archaischen Religionen<br />
auch. Diese dem Christentum<br />
innewohnende Widersprüchlichkeit sieht<br />
Girard auch <strong>als</strong> Grund dafür an, dass die<br />
den Sündenbockmechanismus aufhebende<br />
Wirkung der christlichen Lehre historisch<br />
so wenig Durchschlagkraft gehabt hätte.<br />
Anstatt den Gewaltverzicht vorzuleben,<br />
hätte sich das Christentum im Gegenteil<br />
selbst immer wieder <strong>als</strong> Ausgangspunkt von<br />
Gewalt herausgestellt.<br />
Die ausführliche Darstellung der Theorie<br />
Girards entspricht der Bedeutung, welche<br />
diese Theorie für die DT hat, was die<br />
Protagonisten der DT auch zugeben. Zwar<br />
wird auch davon gesprochen, dass die weitere<br />
Arbeit zeigen werde, ob „auch die mimetische<br />
Theorie mit der Zeit so schwerfällig<br />
wird, dass sie für die Progressivität des<br />
Forschungsprogramms eine Gefahr darstellt.“<br />
Die DT ist <strong>als</strong>o nicht einfach mit<br />
einer ‚Girardisierung’ der Theologie gleichzusetzen.<br />
Faktisch wird man <strong>als</strong> Außenstehender<br />
jedoch den Eindruck nicht los, dass<br />
die DT die Umrisse der mimetischen Theorie<br />
Girards bereits in ihrem „harten Kern“<br />
internalisiert hat, obwohl Schwager und<br />
Niewiadomski in ihrem Aufsatz behaupten,<br />
es handle sich dabei nur um eine „Hilfshypothese“.<br />
Die Theorie Girards erweist sich<br />
nicht zuletzt wegen ihrer inhärenten These<br />
einer gewissen Überlegenheit des Christentums<br />
<strong>als</strong> theologisch sehr attraktiv.<br />
Mit der DT ist nicht nur ein Forschungsprogramm,<br />
sondern auch eine politische<br />
Aufgabe verbunden. Demnach wendet sich<br />
das Programm gegen die weit verbreitete<br />
Tendenz in verschiedenen, auch nichtchristlichen<br />
religiösen Gemeinschaften,<br />
nationalistischen oder tribalistischen Kräften<br />
zu verfallen und dadurch politische<br />
Gemeinschaften in ihrer Polarisierung auf<br />
Feinde ideologisch zu stärken. Spätestens<br />
durch diese politische Intention der DT<br />
wird deutlich, welches Licht die DT auf<br />
das Thema unseres Doktorandenkolloquiums<br />
„Erinnerung und Identität“ werfen<br />
könnte. Die DT ist keine ‚Theologie nach<br />
Auschwitz’ im engeren Sinne des Begriffs.<br />
Sie steht allerdings mit ihrem Fokus auf die<br />
menschlichen Gesellschaften inhärente Gewalt<br />
und deren Überwindung in der Tradition<br />
einer ‚Theologie nach Auschwitz’: Sie<br />
erkennt das jüdische Erbe des Christentums<br />
– gerade im Blick auf den schon im Alten<br />
Testament, v.a. in der prophetischen Literatur<br />
propagierten Gewaltverzicht – voll<br />
und ganz an und bezieht christliche Position,<br />
ohne die älteren Brüder und Schwestern<br />
abzuwerten; sie macht die Erfahrungen des<br />
20. Jahrhunderts nicht explizit, aber implizit<br />
zur Grundlage einer zeitgenössischen<br />
Deutung des christlichen Glaubens; sie erkennt<br />
an, dass nur Gott allmächtig ist und<br />
der auf sich allein gestellte Mensch das Heil<br />
und den Frieden in der Welt nicht hervorbringen<br />
kann.<br />
Gerade in dieser Deutung der DT erweist<br />
sich Józef Niewiadomski <strong>als</strong> ein europäischer<br />
Theologe. Denn so klar und<br />
deutlich die Gewalt im 20. Jahrhundert<br />
immer wieder von Deutschen ausging, so<br />
offensichtlich haben sich die Spuren dieser<br />
Gewalt in das kollektive und in das kulturelle<br />
Gedächtnis aller Europäer eingegraben.<br />
Ebenso offensichtlich – wenigstens in<br />
der Perspektive der DT – ist auch, dass eine<br />
Überwindung der Gewalt nur möglich ist,<br />
wenn die Menschen beginnen, den Sündenbockmechanismus<br />
zu durchschauen und –<br />
für den Fall, dass sie Christen sind – sich<br />
im Blick auf den Gekreuzigten mit ihrer eigenen<br />
Schuld und ihrem eigenen Versagen<br />
beim Bemühen um Versöhnung auseinanderzusetzen.<br />
Damit fordert die DT aber<br />
nichts Übermenschliches. Denn sie ist sich<br />
bewusst, dass ein echter Friede die menschlichen<br />
Kräfte übersteigt und nur von Gott<br />
kommen kann. Und dennoch: Wenn echte<br />
156
Versöhnung Wirklichkeit würde, wäre das<br />
ein Zeichen des Handelns Gottes auf Erden.<br />
Übrigens ist Niewiadomski (oder einfach<br />
„Niewi“, wie ihn die Innsbrucker Theologiestudierenden<br />
nennen, was ich aus sicherer<br />
Quelle weiß) auch Herausgeber und<br />
Autor eines Buches mit dem Titel „Die<br />
theologische Hintertreppe“ (erschienen<br />
2005). Analog zur „Philosophischen Hintertreppe“<br />
von Wilhelm Weischedel werden<br />
dort Theologen nicht über ihre Werke, sondern<br />
über ihre menschliche Seite, ihre Vorlieben,<br />
Schwächen, Hobbies etc. vorgestellt.<br />
Leider kann ich hier keinen Hintertreppen-<br />
Zugang zu Niewiadomski anbieten, weil ich<br />
ihn persönlich nie kennen gelernt habe. Aber<br />
ich kann – nach eingehender Beschäftigung<br />
mit seiner Homepage – immerhin mitteilen,<br />
dass er sich auch außerhalb der Universität<br />
sehr engagiert, sich für Opern und Kino interessiert<br />
und anscheinend eine Schwäche<br />
für sehr bunte Krawatten hat.<br />
157
Happy Birthday –<br />
Karl Dedecius zum 85. Geburtstag<br />
Karl Dedecius –<br />
Wszystkiego najlepszego<br />
z okazji 85-tych urodzin<br />
von Gabriela Biesiadecka<br />
Karl Dedecius – der bedeutendste Übersetzer der polnischen Literatur ins<br />
Deutsche und der Vermittler zwischen zwei Kulturen – feierte dieses Jahr seinen<br />
85. Geburtstag. Seine Aufgabe hat er selbst mit der eines Fährmanns verglichen:<br />
„Übersetzen heißt über-setzen, hinüber über den trennenden Fluss auf die andere<br />
Seite.“<br />
Lebensstationen,<br />
Sprachen und Übersetzen<br />
Karl Dedecius wurde <strong>als</strong> Sohn deutscher<br />
Eltern in der damaligen Vielvölkerstadt<br />
Łódź geboren. Er besuchte dort das<br />
polnische humanistische Stefan-Żeromski-<br />
Gymnasium und wuchs auf diese sehr natürliche<br />
Weise mit der polnischen Sprache<br />
und den polnischen Klassikern auf. „Das<br />
Gymnasium lehrte mich […], die mehrdeutige<br />
polnische Literatur, ihre Geheimschrift,<br />
zu lesen und zu verstehen. Freilich hauptsächlich<br />
die klassische. Die moderne nur bis<br />
zum Expressionismus, Tuwim und den anderen<br />
‚Skamandriten‘. Noch keine ‚Avantgardisten‘.“<br />
In seiner Klasse gab es dam<strong>als</strong> ein<br />
Dutzend Polen, sechs Deutsche, sieben Juden,<br />
zwei Franzosen und einen Russen. „Direktor<br />
Marczyński legte Wert darauf, daß wir<br />
zu Toleranz, gegenseitigem Respekt, zu Europäern<br />
erzogen wurden.“ Schon während seiner<br />
Zeit <strong>als</strong> Gymnasiast fanden auch die ersten<br />
Nachdichtungsversuche statt: „In der<br />
Schule übersetzte ich zum ersten Mal einen<br />
polnischen Dichter: Jan Kochanowski (1530-<br />
1584) – aus dem Lateinischen. […] Ich übersetzte<br />
Kochanowski gern, nicht nur wegen der<br />
Liebesgedichte. Zwei seiner Leitideen, zwei<br />
Hauptthemen seines Werks haben mich besonders<br />
geprägt: die Vergänglichkeit alles Irdischen,<br />
die vanitas vanitatum, und die Idee<br />
der Freiheit.“ Im Mai 1939, kurz vor Ausbruch<br />
des Zweiten Weltkrieges, legte Dedecius<br />
sein Abitur ab und bereitete sich auf ein<br />
Studium im Warschauer Institut der Theaterkunst<br />
vor. Dieses Studium konnte er aber<br />
nicht mehr antreten. Nach dem deutschen<br />
Einmarsch in Polen wurde der 19-jährige<br />
Dedecius zunächst in den Reichsarbeitsdienst<br />
und dann in die Deutsche Wehrmacht<br />
eingezogen. In Stalingrad wurde er<br />
schwer verwundet und geriet in sowjetische<br />
Kriegsgefangenschaft. Während dieser Zeit<br />
brachte er sich selbst die kyrillische Schrift<br />
und die russische Sprache bei, indem er die<br />
Werke von Lermontov und Jessenin studierte.<br />
„Meine Übertragungsproben wurden mit<br />
158
der Zeit zu Ausdrucksübungen. Sie lehrten<br />
mich, Partituren zu lesen – und zu hören.<br />
Das Übersetzen war der Beginn eines Studiums:<br />
andere Länder, andere Völker, andere<br />
Zeiten verstehen zu lernen, die Voraussetzungen<br />
des Zusammenlebens zu erkunden.“<br />
Nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft<br />
1950 ging Dedecius zuerst zu seiner Verlobten<br />
in die DDR. Bis 1952 arbeitete er <strong>als</strong><br />
Oberassistent und wissenschaftlicher Übersetzer<br />
der Theaterwissenschaftlichen Abteilung<br />
am Deutschen Theater-Institut in<br />
Weimar. Ende des Jahres zog er nach Westdeutschland<br />
um und wurde bei der Frankfurter<br />
Allianz Versicherung AG eingestellt.<br />
Da sein neuer Beruf nichts mit der Schriftstellerei<br />
zu tun hatte, setzte Dedecius sein<br />
Übersetzungswerk in seiner Freizeit fort.<br />
Er beschäftigte sich mit polnischer Kultur<br />
und Literatur und pflegte private Kontakte<br />
zu polnischen Schriftstellern. Er übersetzte<br />
auch Werke aus dem Russischen ins Deutsche.<br />
1959 erschien die erste von ihm herausgegebene<br />
Anthologie „Lektion der Stille“.<br />
In den folgenden Jahren übersetzte er bekannte<br />
polnische Schriftsteller und Dichter<br />
wie u.a. Zbigniew Herbert, Stanisław Jerzy<br />
Lec, Tadeusz Różewicz, Adam Zagajewski<br />
und zwei polnische Nobelpreisträger:<br />
Wisława Szymborska und Czesław Miłosz.<br />
Außerdem veröffentlichte er eigene Essays<br />
zu Literatur und Übersetzungstechnik. Als<br />
Hauptwerk Dedecius’ gilt die „Polnische Bibliothek“,<br />
die 1982 bis 2000 im Suhrkamp<br />
Verlag erschien. Sie entstand im Rahmen der<br />
Tätigkeiten des Deutschen Polen-Instituts in<br />
Darmstadt, das von Dedecius 1979/1980 initiiert<br />
und danach fast zwei Jahrzehnte von<br />
ihm geleitet wurde. Die „Polnische Bibliothek“<br />
– eines der anspruchsvollsten Projekte<br />
der deutsch-polnischen Kulturbeziehungen<br />
– umfasst 50 Bände und liefert den Lesern<br />
das literarische Schaffen der polnischen<br />
Nachbarn vom Mittelalter bis zur Neuzeit.<br />
Ferner hat das Institut sieben Bände<br />
„Panorama der polnischen Literatur des 20.<br />
Jahrhunderts“ (1996-2000) herausgegeben.<br />
Schließlich ist auch noch eine vierbändige<br />
„Bibliographie deutsch-polnischer Wechselbeziehungen<br />
vom Mittelalter bis heute“ entstanden,<br />
die <strong>als</strong> Quelle für Wissenschaftler,<br />
Studenten und Kulturforscher dienen soll.<br />
Als Antwort auf diese wichtigen deutschen<br />
Initiativen wurden auch in Polen an der Posener<br />
Universität die „Deutsche Bibliothek“<br />
und im Krakauer Literarischen Verlag eine<br />
belletristische Reihe „Bibliothek deutschsprachiger<br />
Autoren“ veröffentlicht. In Zusammenarbeit<br />
mit dem Deutschen Polen-<br />
Institut verleiht die Robert Bosch Stiftung<br />
seit 2003 den mit jeweils zwei mal 10.000<br />
Euro dotierten Karl-Dedecius-Preis für<br />
Übersetzer.<br />
Ehrendoktorwürden, Auszeichnungen,<br />
Preise und poetische Geschenke<br />
Dedecius’ beständiges Engagement<br />
und sein Enthusiasmus, der „die neuere<br />
polnische Literatur <strong>als</strong> Beitrag der europäischen<br />
für unser Bewußtsein wiederentdeckt“<br />
(Urkunde der Verleihung des<br />
Übersetzerpreises der Deutschen Akademie<br />
für Sprache und Dichtung 1967) wurden<br />
vielseitig wahrgenommen und geehrt.<br />
Dedecius ist Inhaber mehrerer Ehrendoktorwürden,<br />
auch der der Universität Lublin<br />
(1987), sowie Träger zahlreicher Preise und<br />
Auszeichnungen. „In dankbarer Würdigung<br />
seines Wirkens für die Vermittlung<br />
zwischen polnischer und deutscher Kultur“<br />
überbrachte der damalige Bischof Karl<br />
Lehmann den „Besonderen Apostolischen<br />
Segen“ des Heiligen Vaters Johannes Paul<br />
II. anlässlich des 65. Geburtstags von Karl<br />
Dedecius. In den kommenden Jahren kamen<br />
die Würdigungen an Dedecius sowohl<br />
von deutscher <strong>als</strong> auch von polnischer Seite:<br />
Im Jahre 1990, am 7. Oktober, erhielt er<br />
den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels<br />
und am 3. Mai 2003 <strong>als</strong> erster Deutscher<br />
die höchste polnische Auszeichnung,<br />
den Orden des Weißen Adlers. Bei der Verleihung<br />
des Friedenspreises, die vier Tage<br />
nach dem Mauerfall stattfand, sagte Heinrich<br />
Olschowsky, Emeritus für Polonistik<br />
am Institut für Slawistik der Humboldt-<br />
Universität zu Berlin und Vertrauensdozent<br />
des <strong>Cusanuswerk</strong>es: „Den ehrenden<br />
Auftrag, die Laudatio zu halten, habe ich<br />
gern übernommen. Er bietet die Gelegenheit,<br />
öffentlich zu bekunden, daß das Anliegen<br />
von Karl Dedecius, mit Büchern<br />
mehr Verständigung zwischen Deutschen<br />
und Polen zu erreichen, grenzenlos war. Es<br />
stiftete zwischen uns Verbundenheit, die<br />
sich zwei Jahrzehnte gegen den Widersinn<br />
159
der Abgrenzungspraxis in der DDR gleichsam<br />
konspirativ behaupten mußte. Lange<br />
Zeit war Warschau unser einzig möglicher<br />
Begegnungsort. Polnische Literatur hat <strong>als</strong>o<br />
Deutsche aus beiden Staaten zusammengeführt.<br />
Davon mögen unter anderem die<br />
Nachdichtungen von Dedecius in Anthologien<br />
Leipziger und Ostberliner Verlage zeugen<br />
wie auch die Beiträge von Polonisten aus<br />
der DDR in den Büchern des Deutschen Polen-Instituts<br />
in Darmstadt.“<br />
Die Stadt Lódź hat Dedecius zum Ehrenbürger<br />
ernannt und ihm die Dauerausstellung<br />
im historischen Museum gewidmet.<br />
1999 bekam er den ersten Viadrina-Preis<br />
der Europa-Universität Frankfurt an der<br />
Oder für seine besonderen Verdienste um<br />
die deutsch-polnische Verständigung. Poeten,<br />
die er übersetzte, haben ihm ihre Dichtungen<br />
geschenkt. „Für Karl Dedecius in unverbrüchlicher<br />
Freundschaft“ – das Gedicht<br />
„COLANTONIO – S.GIEROLAMO E IL<br />
LEONE“ von Zbigniew Herbert, in dem<br />
er den Bezug auf Hieronymus, den Lehrmeister<br />
von Dedecius, nahm. Seine Übertragungskunst<br />
thematisiert das Gedicht<br />
„AN K.D.“ – wie der Übersetzer selbst sagt<br />
–„eines der schönsten Geschenke, die Tadeusz<br />
Różewicz mir machte.“<br />
AN K.D.<br />
Du übersetzt<br />
mein gedächtnis<br />
in dein gedächtnis<br />
mein schweigen<br />
in dein schweigen<br />
das wort leuchtest du aus<br />
mit dem wort<br />
hebst das bild<br />
aus dem bild<br />
förderst das gedicht<br />
aus dem gedicht zutage<br />
verpflanzt<br />
meine zunge<br />
in eine fremde<br />
dann<br />
tragen meine gedanken<br />
früchte<br />
in deiner sprache<br />
Poetische Intuition, subtiles Sprachgefühl<br />
und profunde Kenntnis von Kultur<br />
und Geschichte<br />
…haben Karl Dedecius zum Übersetzungsmeister<br />
der polnischen Literatur ins<br />
Deutsche gemacht. Die Übersetzungskunst<br />
von Dedecius erklärt Olschowsky in seiner<br />
Laudatio am Beispiel des Gedichtes „Kiesel“<br />
von Zbigniew Herbert, das eine moralische<br />
Meditation der Natur darstellt:<br />
„Sein Originaltitel lautet ‚Kamyk‘ (kleiner<br />
Stein). Außer der Verkleinerungsform enthält<br />
das polnische Wort keine besonderen<br />
Bedeutungsnuancen. Dedecius wählte dafür<br />
‚Kiesel‘, obwohl die polnische Entsprechung<br />
dieses Wortes ‚krzemień‘ ausschließlich<br />
die mineralogische Beschaffenheit eines<br />
Gesteins anzeigt (wie zum Beispiel Kieselerde).<br />
Diese ‚Eigenmächtigkeit‘ erbringt einen<br />
Bedeutungszuwachs: Der Titel wird<br />
zur Sinnspitze des Textes. Aus der blassen<br />
Bezeichnung wird ein Bild; anschaulich,<br />
genau, reich an sinnlichen Assoziationen:<br />
weiß, kühl, glattgeschliffen, gerundet. Dem<br />
Kiesel trauen wir zu, daß er uns Menschen<br />
moralisch zu prüfen in der Lage ist. Es heißt<br />
von ihm:<br />
sein eifer und seine kühle<br />
sind richtig und voller würde<br />
ich spür einen schweren vorwurf<br />
halt ich ihn in der hand<br />
weil dann seinen edlen leib<br />
eine f<strong>als</strong>che wärme durchdringt.<br />
Dieser Einfall entspringt nicht handwerklicher<br />
Perfektion“ – betont Olschowsky<br />
– „sondern poetischer Intuition! Er gliedert<br />
den polnischen Text in eine Motivreihe<br />
deutscher Dichtung von Goethe bis Rilke<br />
ein. Das Fremde enthält so die Aura des Vertrauten.“<br />
Marion Gräfin Dönhoff, die ehemalige<br />
Chefredakteurin der ZEIT, betonte Dedecius’<br />
„umfassende Kenntnis der Geistes- und<br />
Kulturgeschichte beider Völker.“ Sie schrieb:<br />
„Kein anderes Volk [<strong>als</strong> das polnische – Anmerkung<br />
der Autorin] hat so viele Wechsel<br />
durchleiden müssen. […] Für ein Volk mit<br />
solcher Vergangenheit ist Literatur natürlich<br />
nicht einfach Belletristik. Für die Polen<br />
160
waren Dichter und Schriftsteller stets die<br />
Hüter des nationalen Erbes. Sie – wie auch<br />
die Kirche – waren die Wahrer der Kontinuität.“<br />
Das Verständnis dafür lässt sich in<br />
der Nachdichtung von Karl Dedecius besonders<br />
entdecken und spüren. Er selbst<br />
sagt: „Die Übersetzung ist ein Organ der gesellschaftlichen<br />
Wahrheitsfindung und <strong>als</strong> solches<br />
auch das der Friedensstiftung. Eine der<br />
moderneren Definitionen von Kultur besagt,<br />
daß Kultur solche Traditionen und Glaubensvorstellungen<br />
beinhalte, die den Hintergrund<br />
einer Gesellschaft bilden. Die literarische<br />
Übersetzung, <strong>als</strong> ein Teil des Kulturgeschehens,<br />
macht der Sprach-Gesellschaft, an die<br />
sie sich wendet, die Hintergründe der anderen<br />
Sprachgesellschaft, von der sie zeugt, erkennbar.<br />
Landläufige Information behandelt<br />
das Fremde klinisch, vordergründig, <strong>als</strong> ein<br />
Drittes. Die literarische Übersetzung beruht<br />
auf Partnerschaft. Ihr gilt das andere nicht <strong>als</strong><br />
Fremdes, sondern <strong>als</strong> ein Zweites. Die Übersetzung<br />
führt durch Zwiesprache zu Hintergründen,<br />
die die Drittinformation verborgen<br />
läßt.“<br />
Der Übersetzungsprozess fängt nach<br />
Dedecius schon bei der Auswahl der Bücher<br />
an, die sorgfältig durchgeführt werden soll.<br />
Er sagt: „Das Buch ist die vornehmste Form<br />
des Gesprächs.“ Auch „Die Sprache – unser<br />
aller Instrument – ist das hochempfindliche<br />
Werkzeug des Dialogs.“ „Sprache ist das, was<br />
uns zusammenführt oder auseinandertreibt.<br />
Der Sprache, der eigenen und der des anderen,<br />
schulden wir besondere Aufgeschlossenheit<br />
und Behutsamkeit.“ Das folgende Gedicht,<br />
in dem wir den Übersetzer Dedecius auch<br />
<strong>als</strong> den Dichter Dedecius kennen lernen<br />
können, bringt einen schwierigen Übersetzungsprozess<br />
zum Ausdruck:<br />
Übersetzen.<br />
Über Sätzen sitzen?<br />
Lauter Fragen.<br />
Übersetzen.<br />
Über Sätzen sitzen.<br />
Aufsitzen? Nachsitzen,<br />
Hinter die Sätze sehen. Aufsehen? Nachsehen?<br />
Über den Sätzen stehen. Vorstehen? Beistehen?<br />
Unter die Sätze dringen.<br />
Vordringen? Eindringen?<br />
Lauter Fragen.<br />
Dieser Gedanke findet seine Kontinuität<br />
in Dedecius’ Buch „Vom Übersetzen“: „Das<br />
Übersetzen ist ein bewegtes, unsicheres Dasein<br />
zwischen Alternativen. Aber das Übersetzen<br />
hat unverzichtbare pädagogische Qualitäten.<br />
Es bändigt Gegensätze. Es bringt Ungleiches<br />
auf einen gemeinsamen Nenner. Es übt die<br />
Selbstlosigkeit, die Anpassungsfähigkeit und<br />
die Toleranz.“ Und an anderer Stelle: Übersetzungen<br />
sind „der Brückenbau, der die<br />
voneinander getrennten Ufer, Landzungen<br />
und Menschengruppen wieder zusammenführt.<br />
Ein zuverlässiges Kommunikationssystem.<br />
[…] Die übersetzte Literatur ist der<br />
materialisierte Kommunikationswille.“<br />
Seit über 50 Jahren arbeitet Karl Dedecius<br />
an seinem Lebenswerk: Er baut mit<br />
Erfolg eine „Brücke des Verstehens von Literatur<br />
und der Verständigung zwischen<br />
Völkern.“<br />
Literatur<br />
Karl Dedecius: Lebenslauf aus Büchern und<br />
Blättern. Frankfurt a.M.1990, Suhrkamp.<br />
Karl Dedecius: Ein Europäer aus Lodz. Erinnerungen.<br />
Frankfurt a.M.2006, Suhrkamp.<br />
Heinrich Olschowsky: „…er bringt das<br />
Eine/zum Anderen“. Laudatio, in: Friedenspreis<br />
des Deutschen Buchhandels<br />
1990. Karl Dedecius. Ansprachen aus Anlaß<br />
der Verleihung. Frankfurt a.M.1990.<br />
Börsenverein des Deutschen Buchhandels<br />
e.V. im Verlag der Buchhändler-Vereinigung<br />
GmbH.<br />
Marion Gräfin Dönhoff: Die Bewahrer:<br />
Das Deutsche Polen-Institut in Darmstadt<br />
wird 20. DIE ZEIT 03/2000.<br />
Natasza Stelmaszyk: Wege zur polnischen<br />
Literatur. Interview mit Karl Dedecius,<br />
in: Veröffentlichungen zum Forschungsschwerpunkt.<br />
Massenmedien und Kommunikation.<br />
Siegen 2000, Hausdruckerei<br />
Universität-GH.<br />
161
Programm<br />
Donnerstag, 16. November 2006 <br />
Geschichte und Gedächtnis<br />
09:00 Eröffnung der Tagung<br />
prof. dr hab Wiesław Andrzej Kamiński<br />
Rektor der Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej (UMCS)<br />
prof. dr hab Henryk Gmiterek<br />
Dekan der Humanistischen Fakultät der UMCS<br />
prof. dr hab Janusz Golec<br />
Leiter des Instituts für Germanistik, UMCS<br />
prof. dr hab Piotr Kołtunowski<br />
Leiter des Lehrstuhls für Landes- und Kulturkunde der<br />
deutschsprachigen Länder, UMCS<br />
Prof. Dr. Josef Wohlmuth<br />
Leiter der Bischöflichen Studienförderung <strong>Cusanuswerk</strong><br />
Katharina Wildermuth, M.A.<br />
DAAD-Lektorin an der UMCS<br />
Dr. Stefan Raueiser<br />
Referent in der Bischöflichen Studienförderung <strong>Cusanuswerk</strong><br />
Ort: Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej (UMCS), Fakultätsratssaal<br />
10:30 Die Geschichte eint – das Gedächtnis trennt<br />
N.N.<br />
15:00 Lokales Gedächtnis. Thematische Workshops<br />
Lublins jüdische Geschichte.<br />
Ein Stadtgang<br />
mgr Wiesław Wysok, Mitarbeiter der Bildungsabteilung,<br />
Staatliches Museum Majdanek / Państwowe Muzeum na Majdanku<br />
Jüdische Stadtgeschichte.<br />
Die Ausstellung im Zentrum „Brama Grodzka - Teatr NN“<br />
N.N.<br />
Juden in Lublin.<br />
Das Internetprojekt „Jüdisches Leben in Europa jenseits der<br />
Metropolen“<br />
N.N.<br />
20:30 „Es war einmal“. Die Geschichte des zerstreuten Rabbiners Szimiel<br />
Darsteller: Witold Dabrowski<br />
Ort: „Brama Grodzka - Teatr NN“<br />
162
Freitag, 17. November 2006<br />
Bezeugte Geschichte<br />
09:00 Besuch des Staatlichen Museums Majdanek<br />
geführter Rundgang durch das ehem. Lagergelände<br />
und die aktuelle Dauerausstellungmgr<br />
Wiesław Wysok und Wojciech Lenarczyk<br />
Mitarbeiter des Staatlichen Museums Majdanek/<br />
Państwowe Muzeum na Majdanku<br />
15:00 Bildungsarbeit und historische Lernen.<br />
Erfahrungen mit deutschen und polnischen Jugendlichen<br />
mgr Wiesław Wysok, Mitarbeiter der Bildungsabteilung,<br />
Staatliches Museum Majdanek/Państwowe Muzeum na Majdanku<br />
16:30 Shoah und Zweiter Weltkrieg – Gedenkpolitiken und<br />
Erinnerungskulturen im deutsch-polnischen Vergleich<br />
mgr Tomasz Kranz, Leiter der Wissenschaftsabteilung,<br />
Staatliches Museum Majdanek/Państwowe Muzeum na Majdanku<br />
20:30 Gottesdienst<br />
Ort: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL)<br />
Samstag, 18. November 2006 <br />
Memoria und Anamnese<br />
10:00 Kein Europa ohne Versöhnung<br />
Gespräch mit S. E. Erzbischof Prof. Dr. Józef Życiński<br />
Ort: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL)<br />
14:00 Vergegenwärtigende Erinnerung –<br />
Herausforderung christlicher Theologie<br />
Prof. Dr. Josef Wohlmuth<br />
Leiter der Bischöflichen Studienförderung, Bonn<br />
16:00 Erinnerung und Identität. Thematische Workshops<br />
Ort: Centrum Polonijne<br />
Der polnische Geschichtswettbewerb „Historia Bliska“ –<br />
Erinnerungsarbeit mit Jugendlichen<br />
mgr Alicja Wancerz-Gluza<br />
Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa<br />
Erinnerung und kulturelle Bedeutung von Polens<br />
und Deutschlands ehemaligen Osten<br />
Dr. Burkhard Olschowsky<br />
Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen<br />
im östlichen Europa, Oldenburg<br />
19:00 Erinnerung und Identität<br />
Abschlussplenum<br />
Ort: UMCS, Fakultätsratssaal<br />
21:00 Abschlussabend<br />
Ort: Restaurant Sielsko Anielsko<br />
163