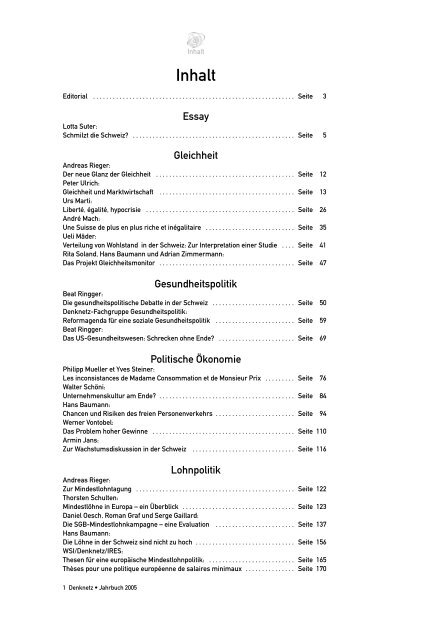Das komplette Buch als Download - Denknetz
Das komplette Buch als Download - Denknetz
Das komplette Buch als Download - Denknetz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Inhalt<br />
Inhalt<br />
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 3<br />
Essay<br />
Lotta Suter:<br />
Schmilzt die Schweiz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 5<br />
Gleichheit<br />
Andreas Rieger:<br />
Der neue Glanz der Gleichheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 12<br />
Peter Ulrich:<br />
Gleichheit und Marktwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 13<br />
Urs Marti:<br />
Liberté, égalité, hypocrisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 26<br />
André Mach:<br />
Une Suisse de plus en plus riche et inégalitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 35<br />
Ueli Mäder:<br />
Verteilung von Wohlstand in der Schweiz: Zur Interpretation einer Studie . . . . Seite 41<br />
Rita Soland, Hans Baumann und Adrian Zimmermann:<br />
<strong>Das</strong> Projekt Gleichheitsmonitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 47<br />
Gesundheitspolitik<br />
Beat Ringger:<br />
Die gesundheitspolitische Debatte in der Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 50<br />
<strong>Denknetz</strong>-Fachgruppe Gesundheitspolitik:<br />
Reformagenda für eine soziale Gesundheitspolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 59<br />
Beat Ringger:<br />
<strong>Das</strong> US-Gesundheitswesen: Schrecken ohne Ende? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 69<br />
Politische Ökonomie<br />
Philipp Mueller et Yves Steiner:<br />
Les inconsistances de Madame Consommation et de Monsieur Prix . . . . . . . . . Seite 76<br />
Walter Schöni:<br />
Unternehmenskultur am Ende? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 84<br />
Hans Baumann:<br />
Chancen und Risiken des freien Personenverkehrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 94<br />
Werner Vontobel:<br />
<strong>Das</strong> Problem hoher Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 110<br />
Armin Jans:<br />
Zur Wachstumsdiskussion in der Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 116<br />
Lohnpolitik<br />
Andreas Rieger:<br />
Zur Mindestlohntagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 122<br />
Thorsten Schulten:<br />
Mindestlöhne in Europa – ein Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 123<br />
Daniel Oesch, Roman Graf und Serge Gaillard:<br />
Die SGB-Mindestlohnkampagne – eine Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 137<br />
Hans Baumann:<br />
Die Löhne in der Schweiz sind nicht zu hoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 156<br />
WSI/<strong>Denknetz</strong>/IRES:<br />
Thesen für eine europäische Mindestlohnpolitik: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 165<br />
Thèses pour une politique européenne de salaires minimaux . . . . . . . . . . . . . . . Seite 170
Inhalt<br />
Fiscalité<br />
Olivier Longchamp:<br />
Assurer la victoire du profit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 175<br />
Bruno Fässler:<br />
Die Unternehmenssteuerreform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 183<br />
Andres Frick:<br />
Zur Diskussion der Staatsverschuldung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 188<br />
Denken<br />
Beat Ringger:<br />
Wie wirken Ideologien? Die Magie der Denkfiguren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 201<br />
Bernhard Walpen:<br />
Auf dem Pilgerberg oder: Dialektik der Freiheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 210<br />
<strong>Denknetz</strong><br />
Andreas Rieger:<br />
Definitionsmacht zurückgewinnen:<br />
Zur Gründung des <strong>Denknetz</strong>es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 219<br />
Beat Ringger:<br />
Tätigkeiten und Projekte des <strong>Denknetz</strong>es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 222<br />
Impressum<br />
<strong>Das</strong> ›Jahrbuch‹ wird herausgegeben von <strong>Denknetz</strong> / Réseau de Réflexion.<br />
Redaktion: Hans Baumann, Beat Ringger, Walter Schöni und Bernhard Walpen<br />
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des Verfassers bzw. der Verfasserin<br />
wieder, nicht unbedingt die der Herausgeberschaft und der Redaktion.<br />
Copyright: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Fotokopie, elektronische Erfassung<br />
Übersetzung von Beiträgen bedürfen der Anfrage und schriftlichen Genehmigung der<br />
Redaktion.<br />
Gestaltung: Lucio Giugni, Layout: Heinz Scheidegger, Korrektorat: Jeannine Horni, Druck<br />
und Bindung: freiburger graphische betriebe<br />
Verlag: edition 8, Postfach 3522, 8021 Zürich, info@edition8.ch www.edition8.ch<br />
Postanschrift: <strong>Denknetz</strong> / Réseau de Réflexion, Postfach 9177, 8036 Zürich<br />
E-mail: info@denknetz-online.ch; Internet: www.denknetz-online.ch<br />
ISBN 3-85990-108-7<br />
2 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
3 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Editorial<br />
Editorial<br />
Lange Jahre neoliberaler Vorherrschaft haben unsere Wirtschaft und Gesellschaft<br />
ungleicher gemacht. Nicht nur real, sondern auch im Denken.<br />
Soziale Spaltung, Ausgrenzung, Arbeitslosigkeit und exzessives Profitstreben<br />
schienen <strong>als</strong> Normalität akzeptiert – <strong>als</strong> kleine Übel auf dem Weg<br />
zu Markt und ›Leistungsgerechtigkeit‹.<br />
Die Zeit der Denkverbote ist vorbei. Exorbitante Löhne, Diskriminierungen<br />
und Hierarchien werden wieder offen thematisiert und kritisiert,<br />
die Ehrfurcht gegenüber den (Fehl-)Leistungen des Topmanagements ist<br />
verflogen. Ungelöste Probleme der Geschlechtergerechtigkeit, der Gesundheitsversorgung<br />
usw. sind wieder auf der Tagesordnung.<br />
<strong>Das</strong> <strong>Denknetz</strong> setzt sich mit den gesellschaftlichen Problemen kritisch<br />
auseinander. Emanzipatives und befreiendes Denken erhält ein Forum<br />
für die notwendigen Debatten und Diskussionen über aktuelle Fragen<br />
aus Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitspolitik. Im April 2004 gegründet,<br />
zählt das <strong>Denknetz</strong> mittlerweilen 300 Einzel- und Kollektivmitglieder.<br />
<strong>Das</strong> <strong>Denknetz</strong> ist den Werten der Gleichheit, der Freiheit und der<br />
Solidarität verpflichtet. Leitthema der ersten Phase ist die Frage der<br />
Gerechtigkeit und Gleichheit. <strong>Das</strong> <strong>Denknetz</strong> hat dazu zwei Tagungen<br />
durchgeführt: Die erste fand im Juni 2004 unter dem Titel ›Der neue<br />
Glanz der Gleichheit‹ statt – diesen Titel haben wir auch für das vorliegende<br />
erste Jahrbuch übernommen. Die zweite befasste sich im April<br />
2005 mit dem Thema Mindestlohnpolitik in Europa. Von beiden Tagungen<br />
sind Beiträge in diesem Band dokumentiert.<br />
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, halten die erste Ausgabe des <strong>Denknetz</strong>-Jahrbuches<br />
in Ihren Händen. Mit diesem Jahrbuch wollen wir<br />
Ihnen Folgendes bieten:<br />
• Analysen, die ein vertieftes Verständnis gesellschaftlicher Veränderungen<br />
ermöglichen und Hintergrundinformationen liefern.<br />
• Essays, die Denkanstösse und unerwartete Sichtweisen vermitteln.<br />
• Programmatische Texte, die den Diskurs über politische Orientierungen<br />
fördern.<br />
Die Beiträge bilden ein beträchtliches Spektrum von Positionen ab.<br />
Diese Breite ist gewollt. Auf dem Weg zu kohärenten Positionen gegen<br />
den neoliberalen Kapitalismus und für eine umfassend demokratische<br />
Gesellschaft möchten wir Debatten zusammenführen, die oft genug voneinander<br />
getrennt laufen. Die AutorInnen geben ihre eigene Meinung<br />
wieder, die sich mit den Ansichten des <strong>Denknetz</strong>es <strong>als</strong> Organisation<br />
nicht decken müssen.
Editorial<br />
Die Rubriken geben unsere inhaltlichen Schwerpunkte wieder:<br />
Die Sparte Essay soll politische Impulse setzen und unerwartete Sichtweisen<br />
eröffnen. Gleichheit bringt Texte zum <strong>Denknetz</strong>-Schwerpunktthema<br />
und enthält Beiträge der <strong>Denknetz</strong>-Tagung 2004. Gesundheitspolitik<br />
greift in die aktuellen politischen Debatten ein und enthält die Reformagenda<br />
einer <strong>Denknetz</strong>-Fachgruppe. Politische Ökonomie will zur kritischen<br />
Analyse der wirtschaftspolitischen Entwicklung der Schweiz beitragen.<br />
Die Rubrik nimmt auch Themen genereller Natur auf oder<br />
bezieht sich auf interessante internationale Erfahrungen. Lohnpolitik<br />
dokumentiert Beiträge der <strong>Denknetz</strong>-Tagung 2005. Ausserdem werden<br />
die Mindestlohnkampagne des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes<br />
ausgewertet und die notorisch vorgetragenen Jeremiaden über die angeblich<br />
zu hohen Löhne in der Schweiz kritisch beleuchtet. Fiscalité enthält<br />
Beiträge zur schweizerischen Debatte über die Steuernpolitik und<br />
zur Staatsverschuldung. Denken umfasst Artikel methodischen und ideologiekritischen<br />
Inhaltes und untersucht entsprechende Problemfelder<br />
(Diskurse, Ideologien, Utopien, Weltanschauungen u.a.m.). <strong>Denknetz</strong><br />
schliesslich bietet Texte zur Geschichte, zur Ausrichtung und zur Selbstreflexion<br />
unserer Organisation.<br />
<strong>Das</strong> <strong>Denknetz</strong> entwickelt seine Inhalte und Arbeitsweisen ständig weiter.<br />
<strong>Das</strong> periodische Erscheinen des Jahrbuches soll es ermöglichen, Entwicklungen<br />
über grössere Zeiträume zu erfassen, zu analysieren und zu<br />
diagnostizieren. Ein Instrument ist der Gleichheitsmonitor, der hier<br />
vorgestellt und für das nächste Jahrbuch erstm<strong>als</strong> erstellt wird. Wir sind<br />
eine junge Organisation, die im Begriff ist, ihr Fundament aufzubauen.<br />
Dies spiegelt sich auch im Jahrbuch.<br />
Die Texte werden im Jahrbuch in ihrer Origin<strong>als</strong>prache veröffentlicht:<br />
französisch oder deutsch.<br />
Die meisten Texte sind speziell für das Jahrbuch geschrieben worden,<br />
und wir danken allen AutorInnen herzlich für die Beiträge. Unser Dank<br />
geht auch an den Verlag edition 8 und seinen Geschäftsleiter Heinz<br />
Scheidegger, der durch seine offene, unkomplizierte und professionelle<br />
Arbeitsweise wesentlich zum Gelingen des Jahrbuches beigetragen hat.<br />
Wir freuen uns über Widerspruch wie Zuspruch. Schreiben Sie uns am<br />
besten per E-Mail an info@denknetz-online.ch.<br />
<strong>Das</strong> <strong>Denknetz</strong> ist ein Verein und wird von seinen Mitgliedern getragen.<br />
Wir laden Sie ein, dem <strong>Denknetz</strong> beizutreten. Sie finden alle<br />
Informationen und die Online-Anmeldemöglichkeit auf unserer Homepage<br />
www.denknetz-online.ch.<br />
Die Jahrbuch-Redaktion<br />
4 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Essay<br />
Schmilzt die Schweiz?<br />
Eben will ich die gesammelten Gründe für und gegen das Fortbestehen<br />
der Schweiz, wie wir sie kennen, zuhanden von <strong>Denknetz</strong> analysieren,<br />
reflektieren und in gefällige Essayform kleiden. Nur ein paar Momente<br />
Aufschub noch, ein paar Minuten <strong>als</strong> Recherche getarntes Surfen im<br />
Netz: ein wenig Einstimmung ins Thema durch die Lektüre der guteidgenössischen<br />
NZZ.<br />
Da stosse ich auf die fantastische Meldung von der Abdeckung des<br />
Gurschengletschers mit einer 3,8 Millimeter dicken Superfrischhaltefolie,<br />
die das Abschmelzen des Eises am Gemsstock verhindern oder<br />
zumindest verlangsamen soll. Prompt protestieren die Schweizer Sektionen<br />
von WWF und Greenpeace gegen die kurzsichtige Symptombekämpfung<br />
und empfehlen stattdessen griffige Klimaschutzmassnahmen,<br />
was immer das heissen mag. Die Naturschutzorganisation Pro<br />
Natura hingegen zeigt Verständnis für das tourismusnahe Andermatter<br />
Projekt und konzentriert ihren Widerstand gegen den Polyester/Polypropylen-Gletscherschutz<br />
auf landschaftlich besonders wertvolle Gebiete,<br />
die sie nicht näher definiert. 1<br />
Statt über die Schweiz denke ich jetzt <strong>als</strong>o über die Existenzberechtigung<br />
von Gletschern nach und über die Vergänglichkeit der Natur.<br />
Schon in der Primarschule hatte mich eine unerklärliche Traurigkeit<br />
beschlichen, wenn der Lehrer etwa die stetige Geschiebeablagerung in<br />
Flussmündungen erklärte. <strong>Das</strong> nahe gelegene Bödeli zwischen Thunerund<br />
Brienzersee fand ich <strong>als</strong> Kind denn auch höchst befremdlich, obwohl<br />
ich die Landschaft um Interlaken gar nicht anders kannte und den<br />
einmal unzerteilten Wendelsee nie mit eigenen Augen gesehen hatte, da<br />
die Schwemmebene kurz nach der letzten Eiszeit entstand. Trotzdem<br />
war mir die irreversible Veränderung unheimlich, ein Sicherheitsverlust.<br />
Die Welt soll so bleiben, wie sie ist, wünschte sich das Kind.<br />
Wie wir alle, hat es mittlerweile mit der intensiven, komplexen und<br />
oft unberechenbaren Dynamik<br />
Lotta Suter<br />
von Mensch und Umwelt leben<br />
1952, Studium der Philosophie, Politologie gelernt. Wer weiss heute nicht um<br />
und Publizistik. Mitbegründerin und lang- die Interdependenz von Ökologie<br />
jährige Redaktorin der WochenZeitung, seit und Ökonomie, Natur und Kultur,<br />
1997 USA-Korrespondentin für diverse Me- Territorium und Politik. Und doch<br />
dien, lebt bei Boston. Veröffentlichungen: versteht sich gerade die kleine,<br />
›Einzig und allein. Die USA im Ausnahme- dicht besiedelte Schweiz, in der alzustand‹<br />
(2003); ›In aller Welt zu Hause. Al les mit allem verhängt und daher<br />
Imfeld – eine Biografie‹ (2005).<br />
ständig in Bewegung, in Entwick-<br />
5 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Essay<br />
lung, im Umbruch ist, gerne <strong>als</strong> zeitlose unberührte Naturschönheit. Neben<br />
meinem computerisierten Arbeitsplatz zum Beispiel zeigt eine wunderschöne<br />
Aufnahme des Matterhorns mit Riffelsee im Vordergrund<br />
den Juni 2005 an; der Swissworld-Kalender ist ein Geschenk des<br />
zukunftsorientierten Schweizer Konsulats für Wissenschaft, Forschung<br />
und Bildung SHARE in Boston. Produziert ist er von Präsenz Schweiz,<br />
der offiziellen »Drehscheibe für den Auftritt der Schweiz im Ausland«.<br />
Was ist das für eine Schweiz, die <strong>als</strong> Matterhorn verkleidet auftritt<br />
und ihre Gletscher mit PVC-Blachen vor der globalen Erderwärmung<br />
schützt? Braucht es diese Schweiz? Oder eine ganz andere?<br />
Ob es überhaupt noch eine Schweiz braucht? Darüber habe ich zum<br />
letzten Mal nachgedacht, <strong>als</strong> wir anfangs der siebziger Jahre ›Des<br />
Schweizers Schweiz‹ von Peter Bichsel lesen und interpretieren mussten.<br />
Mein damaliger Schulaufsatz ist ein äusserst spröder, fast abweisender<br />
Text. Eben aus einem Austauschjahr in den USA zurückgekehrt, wo ich<br />
miterlebt hatte, wie weisse und schwarze Mitschüler sich in den Pausen<br />
regelmässig die Köpfe einschlugen, wie kaum achtzehnjährige Freunde<br />
gegen ihren Willen nach Vietnam geschickt wurden oder – das war<br />
dam<strong>als</strong> für eine aus der Schweiz noch unerhört – wie Menschen auf der<br />
Strasse bettelten, hungerten und froren, kamen mir Bichsels Schweizprobleme<br />
sehr klein und unbedeutend vor. Ich verfasste zuhanden des<br />
fortschrittlichen Deutschlehrers die erwartbaren kritischen Gedanken<br />
zur selbstgerechten, musealen, unveränderbaren Schweiz und krönte<br />
das Ganze mit gymnasialen Weisheiten wie: Politische Freiheit ist kein<br />
Zustand, sondern eine Tätigkeit. Oder: Die typisch schweizerische<br />
Selbstgerechtigkeit wird bloss sich selbst gerecht. <strong>Das</strong>s mit des Schweizers<br />
Schweiz auch meine eigene Herkunft und Heimat zur Diskussion<br />
stand, hatte ich ausgeblendet. Diese Verkomplizierung hielt ich mir mit<br />
einer gestelzten pseudosoziologischen Definition der Nation <strong>als</strong> »Kollektiv<br />
der sozialen Beziehungen« vom Leib.<br />
Heute lese ich ›Des Schweizers Schweiz‹ anders. Die Provokation des<br />
1967 geschriebenen Essays ist längst erkaltet, viele Thesen sind überholt.<br />
Politisch interessant bleibt die Ambivalenz des Autors, der über ›sein‹<br />
Land gleichzeitig sagt, das Gemeinsame beeindrucke ihn nicht und er<br />
habe Heimweh nach dem Bekannten. »Die Schweiz ist mir bekannt. <strong>Das</strong><br />
macht sie mir angenehm. Hier kenne ich die Organisation. Hier kann<br />
ich etwas durchschauen«, schreibt Peter Bichsel. »Ich fühle mich hier<br />
sicher, weil ich einordnen kann, was hier geschieht. Hier kann ich unterscheiden<br />
zwischen der Regel und dem Ausserordentlichen. Sehr<br />
wahrscheinlich bedeutet das Heimat. <strong>Das</strong>s ich sie liebe, überrascht mich<br />
nicht.« 2<br />
6 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Essay<br />
<strong>Das</strong>s mir diese Textstelle jetzt auffällt und gefällt, hat mit meinem<br />
Alter und meiner Stellung <strong>als</strong> Auslandschweizerin zu tun; aber das ist<br />
nicht das Ende, sondern der Anfang einer allgemein gültigen Erklärung.<br />
Männer und vor allem Frauen, die wie ich in der Schweiz der fünfziger<br />
Jahren geboren wurden, haben von Kind weg das Abbröckeln erstarrter<br />
Werte und Strukturen miterlebt, das Schmelzen einer unübersehbaren<br />
gesellschaftlichen Gletscherlandschaft. Für uns war nichts mehr so<br />
absolut, wie unsere Eltern es kannten. Kernfamilie, Eiserner Vorhang,<br />
berufliche Ständeordnung, Patriarchat, Klassengesellschaft, die Parteienlandschaft<br />
– alles geriet ins Wanken. Viele stürzten sich kopfüber in<br />
die neue Zeit mit dem neuen grossartigen Vokabular: Pille und freie Liebe,<br />
Bildungsoffensive und Arbeiterbewegung, Feminismus und internationale<br />
Solidarität. Die Linke, die Frauenbewegung, der Umweltschutz<br />
– alles wurde nach 68 neu und erfunden, besser natürlich und radikaler.<br />
Wer etwas auf sich hielt, war antikapitalistisch, antipatriarchal, antiautoritär.<br />
Wir sprengten unsere sozialen und politischen Fesseln ohne Rücksicht<br />
auf Verluste – und verlagerten hartnäckige sentimentale Sehnsüchte,<br />
Bichsel würde sie vielleicht »Heimweh nach Bekanntem« nennen, in<br />
die sichere Ferne: in den Schoss lateinamerikanischer oder afrikanischer<br />
Grossfamilien oder an den Küchentisch eines hoch romantisierten Proletariats.<br />
An die Schweiz, dieses konservative, kontrollierende, fichierende Vaterland,<br />
wurden in dieser bewegten Zeit wenig Gedanken und noch weniger<br />
Gefühle verschwendet; linker Patriotismus war eine Contradictio<br />
in adjecto, so undenkbar wie der berühmte schwarze Schimmel. Nie und<br />
nimmer wäre Anita Fetz in den siebziger oder achtziger Jahren im roten<br />
T-Shirt mit Schweizer Kreuz aufgetreten, wie sie das im Herbst 2001 im<br />
Nationalrat <strong>als</strong> Rednerin für den UNO-Beitritt tat. Worin unterschied<br />
sich diese linke nationalistische Geste vom rechten Fahnenmeer, das zur<br />
gleichen Zeit in den USA Demokratie und Dissens überflutete und<br />
wegspülte? War es wirklich der richtige Moment, um auf symbolischer<br />
Ebene um Begriffe wie Patriotismus, Nation, Freiheit, Demokratie zu<br />
kämpfen, wie es uns Hermann Lübbe im Philosophieseminar theoretisch<br />
immer wieder nahe gelegt hatte? Oder war es bloss spielerische<br />
postmoderne Verkleidung, opportunistischer Chauvinismus, eine oberflächliche<br />
taktische Finte? Hat die Linke überhaupt politische Optionen<br />
für die Schweiz <strong>als</strong> Nation? War und ist die 1989 propagierte Schweiz<br />
ohne Armee, die Konversion zur Friedenssicherung, ein solcher Ansatz?<br />
Was gibt es sonst? Was bedeutet es, wenn die Linke in Europafragen vor<br />
allem darüber streitet, wie für die Schweiz das Schlimmste zu verhindern<br />
wäre? Was, wenn die sozialdemokratische Aussenministerin angesichts<br />
7 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Essay<br />
der veränderten Weltlage mit einem bilateralen Freihandelsabkommen<br />
Schweiz–USA liebäugelte? Ist angesichts der heiligen Krieger in West<br />
und Ost die Schweiz in der Rolle der ehrlichen Maklerin vielleicht doch<br />
die bestmögliche Vision? 3 Ist das noch eine linke Idee? Braucht die Linke<br />
überhaupt noch eine Schweiz?<br />
Wenn ich den Thesen glaube, welche die <strong>Denknetz</strong>-Redaktion zum<br />
Thema dieses Essays zusammengestellt hat, steckt die Schweizer Industrie<br />
in einer Sackgasse, die verbleibenden Weltkonzerne sind immer<br />
weniger an der Nation interessiert, der Reichtum <strong>als</strong> Klammer des Vielvölkerstaates<br />
schrumpft bedrohlich, und das Einzige, was die Schweiz<br />
noch zusammenhält, ist historische Trägheit. Da fragt man sich tatsächlich:<br />
Was spricht dagegen, die Deutschschweiz zu Deutschland, die<br />
Romandie zu Frankreich und den Tessin zu Italien zu schlagen? – Abgesehen<br />
davon, dass man für die Rätoromanen vielleicht doch ein kleines<br />
Allegria-Reservat aussparen sollte, ist der Vorschlag zur Auflösung<br />
der Schweiz AG nicht neu. Schon die Jugendbewegung der achtziger<br />
Jahre wollte aus dem Staat Gurkensalat machen und forderte freie Sicht<br />
aufs Mittelmeer. Angenommen, nicht bloss die Gletscher, sondern auch<br />
die politische Formation des Landes schmölze dahin und wir hätten den<br />
schweizlosen europäischen Raum – was dann?<br />
Wir haben in der Schweizer Linken bisher vor allem die eine Seite<br />
gesellschaftlicher Veränderung diskutiert: Den Gang durch die Institutionen,<br />
schweizerische oder europäische, und was Kritik von innen<br />
heraus bewirken kann, wann und wo dieses Mitmachen korrumpiert.<br />
Seltener sprechen wir darüber, was passiert, was übrig bleibt, was fehlt,<br />
wenn Werte und Strukturen tatsächlich zerschlagen werden.<br />
Ich bilde mir ein, Feministinnen hätten zuerst entdeckt, wie eng Befreiung<br />
und Deregulierung beieinander liegen und wie schnell das eine<br />
in das andere umschlagen kann. Die Auflösung patriarchaler Herrschaftsverhältnisse<br />
– wie etwa im alten Ehe- und Scheidungsrecht der<br />
Schweiz oder im Konzept des Ernährerlohns festgeschrieben – brachte<br />
nicht automatisch eine schöne neue Frauenwelt, sondern auch viel ökonomische<br />
Unsicherheit und soziale Unverbindlichkeit für alle, die nicht<br />
jung, gesund und kinderlos waren. Wenige wollen die alte Familie<br />
zurück – aber wo sind die neuen verlässlichen Beziehungsformen für<br />
gute und schlechte Zeiten? Wer übernimmt soziale Verantwortung, wer<br />
macht die unbezahlte Arbeit – wenn nicht immer noch oder schon wieder<br />
die Frauen? Der Feminismus wollte Emanzipation; offeriert wurde<br />
im besten Fall Gleichstellung mit der Männernorm des klassischen<br />
Homo oeconomicus. Vom sozialen Ballast befreite Singles, Männer wie<br />
Frauen, wurden zu idealen kleinen Profitcenters oder Arbeits- und Kon-<br />
8 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Essay<br />
sum-Monaden. Die Wirtschaft war am Mehrangebot von flexiblen, gut<br />
ausgebildeten oder billigen Arbeitskräften durchaus interessiert, aber<br />
nicht an einer grundsätzlich neuen gesellschaftlichen Arbeitsteilung und<br />
-organisation. »Diese durchgehende Verkapitalisierung unserer Werte ist<br />
nicht einmalig und war eigentlich vorauszusehen«, schrieb ich 1988<br />
zum zwanzigjährigen Jubiläum der neuen Frauenbewegung. 4<br />
Sehen wir eine solche Gefahr der Vereinnahmung unserer Werte auch<br />
auf staatspolitischer Ebene voraus? Oder nehmen wir an, dass eine<br />
Abkehr von der Nation oder ihre Aufhebung im europäischen Raum<br />
automatisch das Ende von Chauvinismus, Konservativismus und Fremdenfeindlichkeit<br />
bedeutet? Warum waren diejenigen Kulturschaffenden,<br />
die 1991 im Kontext der 700-Jahrfeier eine Abschaffung der<br />
Schweiz forderten, so sicher, dass das eine Befreiung aus der Enge und<br />
nicht bloss eine Deregulierung mit den immer gleichen Verlierern<br />
wäre?<br />
»Nur hier [in der Schweiz, ls.] kann ich mit Sicherheit Schüchterne<br />
von Weltgewandten unterscheiden«, schreibt Peter Bichsel. Historische<br />
Trägheit? Vielleicht; sie ist ein wichtiger menschlicher und politischer<br />
Faktor, der nicht gering geschätzt werden sollte. Als ich 1997 mit vier<br />
Kindern vom Tösstal nach Neuengland auswanderte, erlebte ich, was<br />
es braucht, bis man an einem neuen Ort »zwischen der Regel und dem<br />
Ausserordentlichen« unterscheiden kann. Was ich in den USA jedoch<br />
schnell begriffen habe: Wer sich deplatziert und verloren, ja bedroht<br />
fühlt durch die Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung, ist besonders<br />
anfällig für das Sicherheitsversprechen fundamentalistischer Ideen.<br />
Wo der Ausnahmezustand, der Kampf ums Überleben, zur Regel gemacht<br />
wird, gerät die Demokratie selbst in Gefahr. 5<br />
Bei einem Schweizbesuch im Herbst 2003 hingen überall SVP-Plakate,<br />
die eine baldige Islamisierung der Schweiz androhten. <strong>Das</strong> überraschte<br />
mich nicht. Auch nicht das wütende Geschimpfe meiner Freunde über<br />
die xenophobe Propaganda der Rechten. Hingegen vermisste ich ein<br />
starkes, positives – und plakatives! – Gegenbild: die kühne Vision einer<br />
weltoffenen, integrativen, kulturell neugierigen Schweiz. War das nicht<br />
seit 1848 die Aufgabe der Linken im Land? Wieso sollte es heute so viel<br />
anders sein?<br />
Die Nation<strong>als</strong>taaten haben sich gewandelt, aber sie werden sich in Europa<br />
noch eine ganze Weile nicht in Luft auflösen – das zeigte nicht bloss<br />
die Schweizer EU-Abstimmung vom Dezember 1992, sondern das bewiesen<br />
auch die Urnengänge in Frankreich und den Niederlanden im<br />
Mai 2005. In all diesen Voten war der Patriotismus, man könnte auch<br />
sagen die Vorliebe für ›das Bekannte‹, beim Volk weitaus stärker <strong>als</strong> bei<br />
9 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Essay<br />
der Classe politique, die pragmatischer und auch opportunistischer mit<br />
veränderten Machtverhältnissen umgeht. Diese Diskrepanz ist mittlerweile<br />
hinlänglich bekannt und sollte endlich entdramatisiert werden. Ein<br />
›Non‹ oder ›Nee‹ zu einer europäischen Verfassung bedeutet nicht gleich<br />
den Untergang Europas, wenn man das Gesamtbild vor Augen hat: Erstens<br />
entwickelten sich die europäischen Staaten innert erstaunlich kurzer<br />
Zeit von militärischen Gegnern zu politischen Akteuren, die ihre<br />
grossen und kleinen Konflikte und Differenzen aushandeln, manchmal<br />
grosszügig, öfters kleinlich und krämerisch, wie das unter Nachbarn so<br />
üblich ist. Und zweitens gilt trotz der lauten und hässlichen Propaganda<br />
der Nationalisten in vielen Ländern: Die hartnäckige Ausrichtung eines<br />
Grossteils der Franzosen, Holländerinnen, Schweizer und Engländerinnen<br />
am Nahbereich ist an sich weder reaktionär noch progressiv. Rechte<br />
wie Linke sagten in den letzten Jahrzehnten Nein zur Supernation Europa.<br />
Pragmatische Zusammenarbeit ist trotzdem möglich, wie die bestehenden<br />
Verträge und wie auch die jüngste Abstimmung in der Schweiz<br />
zu den Schengen/Dublin-Abkommen zeigt. – In den USA sind es zur<br />
Zeit übrigens die Republikaner, die von einem Grossreich träumen, und<br />
liberale Politologen, die sich eine Zerschlagung des Leviathan und einen<br />
lockereren Zusammenschluss von vereinigten Staaten wünschen.<br />
In ihrem Essay ›Kann Patriotismus solidarisch sein?‹ argumentiert<br />
die Philosophin Martha Nussbaum mit Aristoteles gegen Platos ideales<br />
Staatswesen, in dem jeder für jeden, ob nah oder fern, gleichermassen<br />
verantwortlich ist. »Wenn wir wollen, dass unser Zusammenleben mit<br />
andern moralische Leidenschaft beinhaltet – für Gerechtigkeit in einer<br />
Welt der Ungerechtigkeit, für Hilfe in einer Welt, in der viele das Nötigste<br />
entbehren müssen – tun wir gut daran, vorerst bei den vertrauten starken<br />
Gefühlen für die eigene Familie, Gemeinde und Nation anzusetzen.<br />
Nur sollte sich unsere Anteilnahme nicht auf diese lokalen Bindungen<br />
beschränken.« 6<br />
Eine linke Standortpolitik ohne Chauvinismus wäre es, diese leidenschaftliche<br />
Anteilnahme von innen nach aussen zu fördern und zu organisieren.<br />
Die Schweiz ist ein politisch intensiv gestalteter Raum mit<br />
guter Verfassungsgrundlage und immenser – wenn auch nicht immer<br />
rühmlicher – Erfahrung im Handeln und Verhandeln auf nationaler und<br />
internationaler Ebene. Diese Stärken der Politik gilt es zu erhalten und<br />
auszubauen. <strong>Das</strong>s sich Wirtschaftsinteressen nicht mit Landesgrenzen<br />
decken, ist – auch wenn es die aktuelle Globalisierung so suggeriert –<br />
nicht neu. Es kann nie Aufgabe einer fortschrittlichen Politik sein, der<br />
wirtschaftlichen Entwicklung hinterher zu rennen und ihr eilig geschaffene<br />
Grossräume anzubieten, die noch profitabler genutzt werden kön-<br />
10 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Essay<br />
nen. Grosse politische Einheiten wie Europa, die USA oder China bieten<br />
bezüglich menschengerechten Verteilung von Arbeit und Einkommen<br />
ebenso lausige Lösungen an wie die Kleinstaaten. Die Aufgabe<br />
eines demokratischen Rechtsstaates ist es, die Lebensgrundlage ihrer<br />
Bewohnerinnen und Bewohner, die weit mehr sind <strong>als</strong> frei verfügbares<br />
Humankapital, zu schützen und zu gewährleisten. Es braucht eine<br />
Schweiz, die allem Menschlichen, dem kühnsten Intellekt wie der kindlichsten<br />
Sehnsucht, eine Heimat bietet – mit einem unerschrockenen<br />
Blick auf die Welt.<br />
Anmerkungen<br />
1 Gemäss sda-Meldung in der NZZ Online vom 10. Mai 2005.<br />
2 Peter Bichsel ›Des Schweizers Schweiz‹. Zürich 1969.<br />
3 Halbzeitbilanz des Bundesrates zum aussenpolitischen Bericht 2000 ›Präsenz und<br />
Kooperation‹.<br />
4 ›Also kein Höhenflug‹, in WOZ 17/1988.<br />
5 Ausführlicher in meinem <strong>Buch</strong> ›Einzig und allein. Die USA im Ausnahmezustand‹,<br />
Rotpunktverlag, Zürich 2003.<br />
6 Martha Nussbaum ›Can patriotism be compassionate?‹, erschienen in der linken<br />
US-Zeitschrift Nation vom 17. Dezember 2001.<br />
11 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Gleichheit<br />
Der neue Glanz der Gleichheit<br />
Die kapitalistische Wirtschaft schafft und potenziert permanent soziale<br />
Ungleichheit. Der Neoliberalismus rechtfertigt dies nicht allein <strong>als</strong> notwendiges<br />
Übel, sondern besingt die Ungleichheit <strong>als</strong> heilsame Sprungfeder<br />
des Fortschritts.<br />
In der gesellschaftlichen Dynamik schafft die soziale Ungleichheit aber<br />
immer wieder Widerstand und soziale Bewegungen, die gegen die Ungerechtigkeit<br />
kämpfen. Die wachsende Ungleichheit lässt grosse Schichten<br />
der Bevölkerung in einer unhaltbar prekären materiellen Situation,<br />
die ein Leben in Würde verhindert und die beim jetzigen Stand des gesellschaftlichen<br />
Reichtums absurd ist. Gleichzeitig wird die Ungleichheit<br />
von breiten Teilen der Gesellschaft <strong>als</strong> ungerecht empfunden.<br />
<strong>Das</strong>s unsere Gesellschaft derart durch soziale Ungleichheit geprägt<br />
wird, stellt aber auch ein Hindernis für gesellschaftliche Freiheit dar. Soll<br />
diese nicht ein Privileg für eine Minderheit sein, muss nicht nur die<br />
Gleichheit vor dem Gesetz und gegenüber den politischen Rechten<br />
garantiert sein. Es braucht ebenso die Gleichheit im Zugang zu den<br />
öffentlichen Gütern und zu einem breit verstandenen Service publique,<br />
welcher die Bedürfnisse aller gleichermassen abdeckt, sei es nun Bildung,<br />
Gesundheit, Kultur, Kommunikation, usw. Es braucht ebenso die<br />
nötigen Ressourcen für ein eigenständiges Leben in Würde und soziale<br />
Sicherheit. Freiheit und Gleichheit sind deshalb untrennbar miteinander<br />
verbunden. Die Mainstream-Ideologen haben in den zwei letzten<br />
Jahrzehnten versucht, die Gesellschaft vom Gegenteil zu überzeugen; sie<br />
haben die Kritik der sozialen Ungleichheit in Anlehnung an den neoliberalen<br />
Soziologen Helmut Schoeck <strong>als</strong> »Neid-Logik« diffamiert und<br />
Ungleichheit <strong>als</strong> Bedingung der Freiheit postuliert, ja »das Ende der<br />
Gleichheit« proklamiert. Als magerer Rest wurde noch eine »Chancengleichheit<br />
der Startbedingungen« im ungehinderten Wettbewerb zugestanden.<br />
Die Folgen dieser Ideologie und der von ihr geprägten Politik<br />
werden immer deutlicher und führen dazu, dass eine Trendwende möglich<br />
wird und die Frage der sozialen Gleichheit wieder an Bedeutung gewinnt.<br />
Diese weiter zu denken ist eine der zentralen Herausforderungen<br />
des <strong>Denknetz</strong>es. Die erste Tagung des <strong>Denknetz</strong>es im Jahr 2004 stand<br />
denn auch unter dem Titel: ›Der neue Glanz der Gleichheit‹ 1 . Anschliessend<br />
folgen das Tagungsreferat von Peter Ulrich sowie weitere Diskussionsbeiträge<br />
zu dieser Thematik. Andreas Rieger<br />
1 ReferentInnen an dieser Tagung waren: Peter Ulrich, Wirtschaftsethiker Universität<br />
St. Gallen; Louis Chauvel, Soziologe Paris und Genf; Thorsten Schulten, WSI-Düsseldorf;<br />
Susanne Schunter-Kleemann, Sozialwissenschafterin Bremen.<br />
12 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
13 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gleichheit<br />
Gleichheit und Marktwirtschaft<br />
Welche Bedeutung kommt der materiellen Gleichheit<br />
in der republikanisch verfassten Gesellschaft zu?<br />
Es war einmal in der frühen Moderne, da hatten die Vordenker des aufgeklärten<br />
Bürgertums einen Traum: den Traum einer Gesellschaft freier<br />
und gleicher Bürger, die sich wechselseitig <strong>als</strong> solche achten und sich<br />
deshalb auch wechselseitig das Recht zuerkennen, ein selbstbestimmtes<br />
und gutes Leben zu führen und <strong>als</strong> mündige Bürger an der Gestaltung<br />
der res publica, der öffentlichen Dinge des Gemeinwesens, zu partizipieren.<br />
Wo ist dieses bürgerliche Emanzipationsprojekt mit dem Ziel der<br />
allgemeinen Freiheit in republikanischer Gleichheit geblieben? Längst<br />
haben sich die ehem<strong>als</strong> ›staatstragenden‹ Parteien, die sich hierzulande<br />
<strong>als</strong> bürgerlich zu bezeichnen pflegen, davon mehr oder weniger verabschiedet.<br />
Nicht mehr das Credo »Freiheit in bürgerlicher Gleichheit«,<br />
sondern das Zwei-Welten-Konzept von »Freiheit oder Gleichheit« bestimmt<br />
heute den realpolitischen Zeitgeist, und das ist gleichbedeutend<br />
mit »Freiheit versus Gleichheit« oder gar »Mehr Freiheit – weniger<br />
Staat«. Und Hand aufs Herz: Ist nicht auch die politische Linke von<br />
diesem seltsamen Gegensatzdenken infiziert, indem sie den Sozi<strong>als</strong>taat<br />
weitestgehend nur <strong>als</strong> Korrektiv gegen einen ökonomisch verkürzt gedachten<br />
Liberalismus versteht? (Die Polarisierung der realpolitischen<br />
Debatte lässt grüssen.)<br />
Der Leitgedanke, den ich Ihnen beliebt machen möchte, ist folgender:<br />
Wer nur die sozi<strong>als</strong>taatlichen Errungenschaften des (hinter uns liegenden)<br />
20. Jahrhunderts gegen die real existierenden bürgerlichen Denkmuster<br />
verteidigt, lässt sich unnötig in die Defensive drängen und bleibt<br />
argumentativ ohnmächtig angesichts der heute tonangebenden Sachzwangrhetorik<br />
vom globalen Standortwettbewerb. Es gilt stattdessen,<br />
die Definitionsmacht über die bürgergesellschaftlichen Leitbegriffe<br />
zurückzugewinnen und zu zeigen, dass es die ureigenen, aber realpolitisch<br />
verratenen emanzipatorischen Ideale des bürgerlichen Liberalismus<br />
selbst sind, die heute der Idee der Gleichheit einen neuen Glanz<br />
und neue politische Überzeugungskraft verleihen!<br />
<strong>Das</strong> ist natürlich kein ›schnelles Rezept‹, sondern der Ansatzpunkt für<br />
eine Neuorientierung im ethisch-politisch-ökonomischen Denken. Es<br />
geht um eine gesellschaftspoliti-<br />
Peter Ulrich<br />
sche Fortschrittsperspektive, wel-<br />
1948, Dr. rer. pol., Leiter des Instituts für che die praktische Vernunft auf<br />
Wirtschaftsethik der Universität St. Gallen.<br />
ihrer Seite hat und deshalb im
Gleichheit<br />
Prinzip über kurz oder lang auch mehrheitsfähig werden müsste, sofern<br />
wir der aufklärerischen Kraft vernünftiger Argumente überhaupt noch<br />
etwas zutrauen. Zwar legt sich auch mir diesbezüglich bisweilen Pessimismus<br />
aufs Gemüt. Aber Pessimismus lähmt und ist keine praktisch<br />
sinnvolle Haltung. Deshalb schlage ich Ihnen vor, sich auf der Basis<br />
eines ›methodischen Optimismus‹ auf einen kleinen Denkversuch über<br />
reale Freiheit in Gleichheit einzulassen, und zwar in fünf Gedankenschritten:<br />
Zuerst gilt es die Geschichte zu vergegenwärtigen, in der wir<br />
stehen; man kann bekanntlich die Gegenwart immer nur <strong>als</strong> eine geschichtlich<br />
gewordene verstehen. Im zweiten Schritt skizziere ich eine<br />
bürgergesellschaftliche Fortschrittsperspektive jenseits der f<strong>als</strong>chen Polarität<br />
»Freiheit vs. Gleichheit«. Daraus ergeben sich im dritten Schritt<br />
Herausforderungen und Konsequenzen für eine buchstäblich ›zivilisierte‹<br />
Marktwirtschaft. Viertens gilt es zu bedenken, ob und wie weit<br />
sich das alles mit der ökonomischen Ratio, <strong>als</strong>o mit der Funktionslogik<br />
der Marktwirtschaft verträgt. Schliessen werde ich mit einer kurzen<br />
Einschätzung, ob dieser Entwurf eine realpolitische Chance haben<br />
könnte.<br />
1. Zur Geschichte des bürgerlichen<br />
Emanzipationsprojekts<br />
In keinem anderen Land Europas war 1848 die vom dam<strong>als</strong> progressiven<br />
(<strong>als</strong>o ›linken‹) Bürgertum betriebene liberale Revolution so erfolgreich<br />
wie in der Schweiz, kulturell ausgehend von den beiden radikal<br />
protestantischen Städten Zürich und Genf. 1 Gewiss hängt das zutiefst mit<br />
der inneren Affinität zwischen der protestantischen Ethik und dem<br />
»Geist des Kapitalismus« zusammen, auf die Max Weber in seiner<br />
berühmten religionssoziologischen Studie so überzeugend hingewiesen<br />
hat. 2 Die Emanzipation des modernen Citoyen aus feudalgesellschaftlichen<br />
Abhängigkeiten ist vom wirtschaftlichen Selbständigkeitsstreben<br />
des frühmodernen Bourgeois nicht zu trennen. Der ökonomische und<br />
der politische Liberalismus sind <strong>als</strong>o am Anfang eins. Diese für die<br />
Schweiz charakteristische integrale Ausrichtung der bürgerlichen Revolution<br />
hat mit der speziellen republikanischen Tradition einer sich föderalistisch<br />
und basisdemokratisch von unten nach oben legitimierenden<br />
politischen Kultur der Eidgenossenschaft zu tun. Der frühbürgerliche<br />
Liberalismus war ein republikanischer Liberalismus, der den Geschäftssinn<br />
der Bourgeois in den politischen Bürgersinn der Citoyens einzubinden<br />
verstand und gerade daraus seine Stärke bezog. <strong>Das</strong> Bürgertum<br />
war genau deshalb ›staatstragend‹, weil es begriff, dass niemand anders<br />
<strong>als</strong> der Staat, verstanden <strong>als</strong> republikanisches Gemeinwesen, das Kost-<br />
14 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
15 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gleichheit<br />
barste gewährleistet, was es für freie und souveräne Bürger gibt, nämlich<br />
ihre Bürgerrechte. Es wäre den liberalen Vordenkern der Gründerzeit<br />
daher niem<strong>als</strong> in den Sinn gekommen, den Staat – ihren Staat! –<br />
notorisch schlecht zu reden und zum (klein zu haltenden) Inbegriff aller<br />
Übel abzustempeln, wie das rezente Libertäre heutzutage so gerne tun.<br />
Diese verhängnisvolle Tendenz setzte allerdings schon bald mit der<br />
fortschreitenden Zuspitzung der sozialen Frage ein. Zu dieser kam es<br />
notabene gerade in Folge des von Eric Hobsbawm so bezeichneten<br />
»grossen Booms« von 1848 bis etwa 1875, einer ›Blütezeit‹ des entfesselten<br />
Laisser-faire-Kapitalismus mit enorm hohem Wirtschaftswachstum. 3<br />
Dieses selbst löste die sozialen Probleme keineswegs – das Gegenteil war<br />
der Fall. Dieses historische Faktum widerlegt übrigens all jene, die heute<br />
den Ruf nach Wirtschaftswachstum für das Patentrezept zur Lösung<br />
aller sozialen Fragen unserer Zeit halten. Es war erst die gegen Ende des<br />
19. Jahrhunderts in allen Industrieländern rasch aufsteigende Arbeiterbewegung,<br />
welche sozialpolitische Reformen durchsetzte, und zwar<br />
gegen das Bürgertum, das sich im Dilemma zwischen dem unteilbaren<br />
Anspruch seines politisch-emanzipatorischen Projekts und den eigenen<br />
wirtschaftlichen Partikulärinteressen – wen wunderts – für Letztere entschied.<br />
Die republikanisch-liberale Synthese brach damit auseinander.<br />
Ein vulgärer Wirtschaftsliberalismus ›schluckte‹ bedauerlicherweise den<br />
aufgeklärten politischen Liberalismus, und das sich ›freisinnig‹ nennende<br />
Bürgertum wurde ab da von einer gesellschaftlich progressiven zu<br />
einer konservativen Kraft, die ihr emanzipatorisches Projekt der allgemeinen<br />
Freiheit, das heisst einer Gesellschaft freier und gleicher Bürger<br />
und Bürgerinnen, fortan der Arbeiterbewegung, der Sozialdemokratie<br />
und später weiteren sozialen Bewegungen überliess.<br />
Die Aufgabe, diese fatale gedankliche Spaltung und interessenpartikuläre<br />
Vereinnahmung des liberalen Emanzipationsprojekts ideologisch<br />
zu überdecken, fällt seither jener marktmetaphysischen Gemeinwohlrhetorik<br />
zu, die bis heute immer dann bemüht wird, wenn ›bürgerliche‹<br />
Realpolitik mit den Leitideen einer wohl geordneten Gesellschaft freier<br />
und gleicher Bürger besonders augenfällig unvereinbar ist, wie beispielsweise<br />
seit der neoliberalen Wende von Thatcherism und Reagonomics.<br />
Heute wird diese Rhetorik vor allem benutzt, um die Parteilichkeit einer<br />
mehr alt- <strong>als</strong> neoliberalen 4 Globalisierungspolitik, die auf einen deregulierten<br />
globalen Standortwettbewerb in offenen Weltmärkten zielt, zu<br />
verbergen hinter den angeblich fantastischen Chancen, welche diese<br />
Entwicklung allen Ländern und allen Menschen in ihnen biete. (Die<br />
WTO und der ›Washington Consensus‹ lassen grüssen.)<br />
Eine dieser meistens ungenannten, da ziemlich parteilichen Chancen
Gleichheit<br />
besteht darin, dass im ›Standortwettbewerb‹ nun endlich auch die staatlichen<br />
Rahmenordnungen und mit ihnen die unterschiedlich entwickelten<br />
Sozi<strong>als</strong>taatskonzepte gegeneinander ausgespielt und der Verwertungslogik<br />
des weltweit Rendite suchenden Kapit<strong>als</strong> unterworfen<br />
werden können. Mit andern Worten: Der Primat demokratischer Politik,<br />
der gewissen Kreisen gerade wegen seines unausrottbaren Zielhorizonts<br />
einer gerechten Gesellschaft freier und gleicher (Welt-) BürgerInnen<br />
so verhasst ist, kann nun indirekt bekämpft werden, indem auf die<br />
›Sachzwänge‹ der globalen Märkte verwiesen wird.<br />
2. Sozialer Fortschritt wohin?<br />
Die bürgergesellschaftliche Vision<br />
Aus der Entstehungsgeschichte ist ein fataler Geburtsfehler des Sozi<strong>als</strong>taats<br />
zu erkennen: Im Ansatz betreibt er weitgehend eine kompensatorische<br />
Sozialpolitik, die <strong>als</strong> blosses Korrektiv den symptomatischen<br />
Folgen eines entfesselten Wirtschaftsliberalismus hinterher rennt. Unter<br />
den Verhältnissen des Standort- und Rahmenordnungswettbewerbs<br />
gerät so der Sozi<strong>als</strong>taat mit der Sachlogik des entgrenzten Marktes<br />
immer mehr in Konflikt und muss sich von deren Protagonisten zunehmend<br />
›ökonomische Unvernunft‹ vorwerfen lassen, <strong>als</strong> ob der Sozi<strong>als</strong>taat<br />
selbst der Verursacher der ›explodierenden‹ sozialen Kosten der<br />
ökonomischen ›Rationalisierung‹ wäre. Hinter dieser wird er immer<br />
weiter zurückzubleiben, wenn es nicht gelingt, diese angebliche ökonomische<br />
Sachlogik ideologiekritisch <strong>als</strong> gemeinwohlschädliches, parteiliches<br />
Projekt zu entlarven und ihm eine gesellschaftlich attraktive Alternative<br />
entgegenzustellen.<br />
Der ideologiekritische Ansatzpunkt zur Entlarvung der neoliberalmarktradikalen<br />
Gemeinwohl-Rhetorik besteht nun in etwas Arbeit am<br />
Freiheitsbegriff, die gesuchte Alternative in der Leitidee einer wohl<br />
geordneten Gesellschaft freier und gleicher Bürger und Bürgerinnen.<br />
Wohlverstandene Freiheit ist die gleiche grösstmögliche reale Freiheit<br />
aller Bürger und Bürgerinnen oder sie verdient ihren Namen nicht!<br />
Diese Definition enthält zwei konstitutive Momente, die es auseinander<br />
zu halten gilt: das Moment der prinzipiellen Gleichheit und das Moment<br />
der realen Qualität der Freiheit.<br />
Zunächst zur prinzipiellen Gleichheit des Freiheitsanspruchs: In einer<br />
wahrhaft freiheitlichen Gesellschaft findet die legitime Freiheit des Einen<br />
ihre ethische Grenze stets im gleichberechtigten Anspruch aller Anderen.<br />
Gerade der echte Liberale versteht konsequenterweise die Freiheit<br />
<strong>als</strong> kostbares rechtsstaatliches Gut, das allen Bürgerinnen und Bürgern<br />
gleichermassen <strong>als</strong> ein unveräusserliches Bürgerrecht zusteht. Er begreift<br />
16 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
17 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gleichheit<br />
mit andern Worten die staatsbürgerliche oder republikanische Gleichheit<br />
aller <strong>als</strong> Kriterium einer liberalen Gesellschaftsordnung. Und er vertritt<br />
damit – dies ist sehr wichtig – einen politischen Liberalismus 5 , der<br />
sich nicht auf puren Wirtschaftsliberalismus reduzieren lässt, wie wir<br />
noch sehen werden. Der ethisch-politische Kern des politischen Liberalismus<br />
5 , der die emanzipatorische Kraft des bürgergesellschaftlichen<br />
Ide<strong>als</strong> ausmacht, ist die tiefe Überzeugung von der moralischen Gleichheit<br />
aller Menschen in ihrer humanen Würde <strong>als</strong> Subjekte selbstbestimmten<br />
Denkens und Handelns. Indem wir uns <strong>als</strong> Menschen wechselseitig<br />
das »Recht auf gleiche Rücksicht und Achtung« zusprechen 6 ,<br />
begründen wir die wohl praktisch stärkste Idee der modernen Ethik und<br />
politischen Philosophie überhaupt, nämlich die Idee universaler und<br />
unantastbarer Menschen- und Bürgerrechte: Menschenrechte in der<br />
ideellen ›moral community aller Weltbürger‹, Bürgerrechte <strong>als</strong> Angehörige<br />
eines demokratisch verfassten Rechtsstaates (wobei es selbst ein<br />
universales Menschenrecht ist, in einem Staat Bürger zu sein).<br />
Nun zum zweiten Moment des bürgergesellschaftlichen Emanzipationsprojekts,<br />
dem der realen Qualität der Bürgerfreiheit. Reale Freiheit<br />
heisst, im Lebensalltag über konkrete Wahlmöglichkeiten oder Optionen<br />
zu verfügen. Nur wer real wählen kann, kann wirklich ein selbstbestimmtes<br />
Leben führen. Die reale Freiheit hängt nun aber in einer mehr<br />
oder weniger durchökonomisierten Gesellschaft wesentlich von der verfügbaren<br />
Kaufkraft ab: Nicht mehr allein »Stadtluft macht frei«, wie die<br />
frühbürgerlichen Vorkämpfer zu sagen pflegten, sondern genügend<br />
Geld macht frei und unabhängig. An diesem Punkt ist der sozi<strong>als</strong>taatliche<br />
Selbstanspruch der Bürgergesellschaft festzumachen. Die republikanische<br />
Gleichheit freier BürgerInnen setzt unverzichtbar auch die<br />
Gewährleistung ›anständiger‹ sozioökonomischer Lebensbedingungen<br />
für alle voraus, und zwar aus politisch-liberaler Sicht so weit (und nur so<br />
weit), wie dies die Voraussetzung dafür ist, dass der Status und die Selbstachtung<br />
einer Person <strong>als</strong> vollwertige(r) Bürger(in) nicht verletzt wird.<br />
Denn die Selbstachtung des Bürgers hängt untrennbar mit der guten<br />
Erfahrung einer real selbstbestimmten Lebensführung zusammen, wie<br />
John Rawls immer betont hat:<br />
»Die Bedeutung der Selbstachtung liegt darin, dass sie für ein sicheres<br />
Selbstwertgefühl sorgt: für die sichere Überzeugung, dass unsere bestimmte<br />
Konzeption des Guten es wert ist, verwirklicht zu werden. Ohne<br />
Selbstachtung mag nichts der Ausführung wert erscheinen, und sollten<br />
einige Dinge für uns einen Wert haben, dann hätten wir nicht den Willen<br />
sie zu verfolgen.« 7<br />
Wie Avishai Margalit in seinem viel beachteten <strong>Buch</strong> über die Politik
Gleichheit<br />
der Würde gezeigt hat, kommt es daher sehr darauf an, dass eine ›anständige‹<br />
Gesellschaft (decent society) mit ihren Regeln und Institutionen<br />
niemanden demütigt, das heisst der systematischen Erfahrung der strukturellen<br />
Ohnmacht aussetzt, die Kontrolle über das eigene Leben <strong>als</strong><br />
real freie Person zu verlieren. Denn wie gesagt: Wem das passiert, der<br />
verliert über kurz oder lang auch seine Selbstachtung <strong>als</strong> vollwertiger<br />
Bürger. Er nimmt sich immer weniger <strong>als</strong> autonomes Subjekt und immer<br />
mehr <strong>als</strong> Objekt fremder Entscheidungen wahr. Als besonders<br />
demütigend empfunden wird die prekäre Erfahrung der Unmöglichkeit,<br />
die eigene Existenz durch eigene Leistung und selbst verdientes Einkommen<br />
sicherstellen zu können, speziell die Situation unfreiwilliger<br />
Erwerbslosigkeit. Eine bloss kompensatorische Sozialpolitik vermag<br />
daran umso weniger zu ändern, je mehr sie die Form und den Beigeschmack<br />
staatlicher ›Fürsorge‹ annimmt, um deren einzelfallbezogene<br />
Gewährung die Betroffenen ›demütig‹ ersuchen und wofür sie ihre privatesten<br />
lebensalltäglichen Wahlmöglichkeiten den Ermessensentscheidungen<br />
von ›Sozialämtern‹ unterwerfen müssen. Diese entwürdigende<br />
Erfahrung ist, so meine ich, letztlich noch Ausdruck eines (teil-)modernisierten<br />
Obrigkeitsstaates und dem bürgergesellschaftlichen Grundsatz<br />
republikanischer Gleichheit nicht angemessen. Es geht eben nicht<br />
nur um Geld, so nötig dieses auch sein mag, es geht um den Subjektstatus<br />
freier Bürger! Die Scham mancher Leute, den Schritt zum Sozialamt<br />
zu gehen, spricht hier Bände.<br />
Was folgt daraus nun <strong>als</strong> springender Punkt? – Ein unverkürzt verstandener<br />
sozialer Fortschritt im Sinne der Ausweitung der realen Bürgerfreiheit<br />
aller, ein selbstbestimmtes und ›anständiges‹ Leben führen zu<br />
können, sollte sich nicht in der Ausweitung der materiellen Umverteilung<br />
durch kompensatorische Sozialpolitik, sondern genau umgekehrt<br />
im Rückgang des Bedarfs nach sozi<strong>als</strong>taatlichen Transfers für ›bedürftige‹<br />
Menschen äussern! Wohlgemerkt: Ich stimme damit keineswegs in<br />
den zynischen libertären Ruf nach mehr individueller ›Eigenverantwortung‹<br />
ein, der die strukturellen Voraussetzungen der zumutbaren existenziellen<br />
Selbstbehauptung und Selbstverantwortung der Bürger ausblendet.<br />
Ich plädiere vielmehr für die schrittweise Umorientierung der<br />
Sozialpolitik von der nachträglichen materiellen Symptombekämpfung<br />
auf die Bekämpfung der ursächlichen strukturellen Ohnmacht der<br />
schwächeren Gesellschaftsmitglieder, indem diese von vornherein ermächtigt<br />
(das heisst berechtigt und befähigt) werden, sich im Existenzkampf<br />
aus eigener Kraft behaupten und ein selbstbestimmtes Leben<br />
führen zu können. Auf eine programmatische Kurzformel gebracht:<br />
emanzipatorische Gesellschaftspolitik statt kompensatorische Sozialpo-<br />
18 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
19 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gleichheit<br />
litik – mit dem Ziel einer grösstmöglichen realen Freiheit aller Bürgerinnen<br />
und Bürger.<br />
3. Bürgergesellschaft und<br />
›zivilisierte‹ Marktwirtschaft<br />
Was aber heisst ›emanzipatorische Gesellschaftspolitik‹ unter den aktuellen<br />
sozioökonomischen Verhältnissen konkret? Gemäss dem republikanisch-liberalen<br />
Leitbild einer voll entfalteten Bürgergesellschaft oder<br />
Civil Society ist für das Verhältnis von Politik und Markt die Neutralität<br />
der staatlichen Ordnung gegenüber den verschiedenen Lebensformen<br />
grundlegend: Wenn die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung allen<br />
Bürgerinnen und Bürgern die gleiche reale Freiheit gewährleisten will,<br />
im Rahmen eines »vernünftigen Pluralismus« 8 ihren je eigenen Entwurf<br />
des guten Lebens zu verfolgen, so darf sie selbst nicht einen bestimmten<br />
Entwurf privilegieren und andere diskriminieren, sondern soll ihnen gegenüber<br />
unparteilich und neutral sein. Dem steht nun allerdings rasch<br />
einmal die strukturelle Parteilichkeit der Marktwirtschaft in Bezug auf<br />
verschiedene Lebensentwürfe im Weg: 9 Sie bevorzugt systematisch unternehmerische<br />
Lebensentwürfe (im weitesten Sinn des Begriffs), die sich<br />
ganz der Logik und den Sachzwängen des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs<br />
unterwerfen oder sich damit sogar identifizieren, etwa nach<br />
dem Motto »Wettbewerb macht Spass, weil ich ein Siegertyp bin«.<br />
Schwerer <strong>als</strong> diese ›Erfolgsmaximierer‹, die ihre Lebensenergie am<br />
liebsten in die ›Positionierung‹ am Markt investieren, haben es alternative<br />
Lebensentwürfe, die den Lebenssinn in anderen Kategorien <strong>als</strong><br />
jenes des ökonomischen Erfolgs suchen und dafür auf eine gewisse<br />
Emanzipation von den Sachzwängen des Wettbewerbs angewiesen sind.<br />
Je härter der Wettbewerb, umso häufiger werden sie vom Markt die rote<br />
Karte erhalten, und umso mehr gilt, was Max Weber schon vor 100 Jahren<br />
klar erkannt hat:<br />
»Wer sich in seiner Lebensführung den Bedingungen des kapitalistischen<br />
Erfolgs nicht anpasst, geht unter oder kommt nicht hoch.« 10<br />
Die bürgergesellschaftliche Pointe, die sich daraus ergibt, ist nicht<br />
schwer zu erkennen: Um der grösstmöglichen realen Freiheit aller Bürgerinnen<br />
und Bürger willen kommt es darauf an, nicht nur – wie es die<br />
Liberalen aller Prägungen immer schon postuliert haben – den Staat,<br />
sondern eben auch die Marktwirtschaft buchstäblich zu zivilisieren. Und<br />
das heisst: Es gilt sie konsequent <strong>als</strong> bürgergesellschaftlichen Rechtszusammenhang<br />
auszugestalten. Die sachzwanghafte Eigenlogik des<br />
Marktes wird dann nicht mehr <strong>als</strong> guter Grund akzeptiert, um die reale<br />
Freiheit und Chancengleichheit der Bürger und die Gerechtigkeit der
Gleichheit<br />
Spielregeln ihres Zusammenlebens einzuschränken – vielmehr gilt die<br />
umgekehrte Rangordnung: In einer wahren Bürgergesellschaft gilt der<br />
freie Bürger mehr <strong>als</strong> der freie Markt! Mit Ralf Dahrendorf, dem wohl<br />
wahrhaftigsten Liberalen deutscher Zunge, formuliert:<br />
»Die Rechte der Bürger sind jene unbedingten Anrechte, die die<br />
Kräfte des Marktes zugleich überschreiten und in ihre Schranken verweisen.«<br />
11<br />
Hier trennen sich offenkundig die Wege einer wohl verstandenen<br />
Bürgergesellschaft von jenen eines ökonomistisch verkürzten Neoliberalismus,<br />
der in gar nicht freiheitsförderlicher Weise allein auf Marktöffnung,<br />
Wettbewerbsintensivierung und Wirtschaftswachstum setzt und<br />
uns weismachen will, der marktwirtschaftliche Zwangszusammenhang<br />
diene letztlich allen. Wer dieser wettbewerbskonditionierten Mentalität<br />
noch nicht restlos erlegen ist, der stimmt vielmehr folgendem Postulat<br />
zu: Die Kräfte des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs sind einzubinden<br />
in zeitgemäss entwickelte wirtschaftliche und soziale Bürgerrechte – in<br />
einem Wort: Wirtschaftsbürgerrechte. 12<br />
Deren Konkretisierung in den verschiedenen Dimensionen eines<br />
›zivilisierten‹ Wirtschaftslebens stellt natürlich ein epochales Projekt dar,<br />
das unter mündigen Bürgern demokratisch anzugehen ist. Wesentlich ist<br />
jedoch, dass in emanzipatorischer Absicht primär nicht mehr nur materielle<br />
Güter, sondern Wirtschaftsbürgerrechte zu verteilen sind; darin<br />
besteht die gesellschaftspolitische Wendung der Sozi<strong>als</strong>taatsfrage. Natürlich<br />
zielen so verstandene Wirtschaftsbürgerrechte gleichwohl auf die<br />
materielle Verbesserung der Lebenslage der Schwächeren; aber sie tun<br />
das vorwiegend indirekt, indem sie primär die Selbstbestimmungs- und<br />
Selbstbehauptungschancen und damit den Bürgerstatus im Wirtschaftsleben<br />
stärken.<br />
Dazu gehören zum einen Rechte, welche die Optionen wirtschaftlicher<br />
Betätigung erweitern, beispielsweise der Zugang zu Bildung und<br />
Know-how, zu Kapital und Kredit <strong>als</strong> Voraussetzungen des freien Unternehmertums<br />
für jedermann. Gerade die letztere Funktion erfüllen ja<br />
die ›normalen‹ Banken kaum mehr von sich aus, hierzulande genauso<br />
wenig wie in Drittweltländern: Kredit erhält im Regelfall nur, wer schon<br />
Kapital hat. 13 Ebenso wichtig sind für Arbeitnehmer individuelle und<br />
kollektive Informations-, Anhörungs- und Mitspracherechte, zumindest<br />
soweit es um ihren Arbeitsplatz und ihre Arbeitsbedingungen geht.<br />
Während diese nur exemplarisch angedeuteten wirtschaftlichen<br />
Betätigungsrechte der Gewährleistung des Status vollwertiger Bürger-<br />
Innen in der Marktwirtschaft dienen, zielt eine zweite, meines Erachtens<br />
in Zukunft zunehmend an Bedeutung gewinnende Dimension von<br />
20 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
21 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gleichheit<br />
Wirtschaftsbürgerrechten auf faire Chancen der partiellen Emanzipation<br />
aller BürgerInnen vom Zwang, sich um fast jeden Preis im marktwirtschaftlichen<br />
Wettbewerb <strong>als</strong> ›Unternehmer‹ ihrer eigenen Arbeitskraft<br />
behaupten zu müssen. <strong>Das</strong> ist kein Gegensatz: Eine Balance von<br />
Integration in das Erwerbsleben einerseits und Emanzipation vom<br />
marktwirtschaftlichen Zwangszusammenhang entspricht vielmehr der<br />
ganz normalen Balance, die freie BürgerInnen zwischen Autonomie (im<br />
Sinne einer unantastbaren Privatsphäre) und Sozialintegration (im Sinne<br />
der vollwertigen Partizipation an der ›res publica‹) suchen. Wir haben<br />
nur noch nicht begriffen, dass dies auch die Voraussetzung für ein real<br />
freies Wirtschaftsleben ist. Die wirtschaftlichen Betätigungsrechte bedürfen<br />
um dieser Balance willen der Ergänzung um soziale Schutz- und<br />
Teilhaberechte, jetzt verstanden <strong>als</strong> Rechte, welche die Menschen ein<br />
Stück weit aus der ›gnadenlosen‹ Abhängigkeit von ihrem Selbstbehauptungserfolg<br />
am Markt befreien. Sie gewähren denjenigen, die sich<br />
aus welchen Gründen auch immer nicht in den Markt integrieren können<br />
oder wollen, eine zumutbare Möglichkeit einer nicht demütigenden<br />
Existenzform ausserhalb des (heute noch) <strong>als</strong> normal geltenden Erwerbslebens.<br />
Nicht demütigend heisst hier, dass ihnen die Stigmatisierung <strong>als</strong><br />
Versager und Sozialfälle erspart wird. Und das geht letztlich nur, wenn<br />
sie nicht eine ›Spezialbehandlung‹ <strong>als</strong> gesellschaftliche Problemgruppe<br />
erfahren, sondern ein allgemeines, ganz normales Bürgerrecht in Anspruch<br />
nehmen können, ohne dafür eine spezielle Berechtigung oder gar<br />
Bedürftigkeit nachweisen zu müssen. Der universalistische Charakter sozialer<br />
Bürgerrechte – so, wie wir ihn in der Schweiz von der guten alten<br />
AHV her kennen – ist <strong>als</strong>o in emanzipatorischer Absicht auf reale Bürgerfreiheit<br />
wesentlich. Idealiter läuft das in längerfristiger Perspektive auf<br />
das Ziel eines unbedingten Grundeinkommens für alle erwachsenen<br />
Bürger (plus z.B. 50% davon für alle Kinder) hinaus, wie es der belgische<br />
Sozialphilosoph Philippe Van Parijs überzeugend dargelegt hat. 14<br />
Solche faszinierenden Konzepte für die Zukunft zeigen auf, wie viel<br />
sinnvoller sozioökonomischer Fortschritt in unserer ach so hyperdynamischen,<br />
auf endlose Produktivitäts- und Wachstumssteigerung versessenen,<br />
aber in Bezug auf den lebenspraktischen Sinn des Ganzen ziemlich<br />
orientierungslos gewordenen spätindustriellen Gesellschaft noch<br />
möglich wäre. Und sie machen uns bewusst, dass alle Länder der Welt,<br />
auch die ›fortgeschrittenen‹ OECD-Länder, in bürgergesellschaftlicher<br />
Perspektive noch ›Entwicklungsländer‹ sind. Nicht ganz zufällig treffen<br />
sich solche Konzepte daher durchaus mit jüngsten Erkenntnissen zur<br />
globalen Entwicklungsproblematik, hat sich doch auch dort längst gezeigt,<br />
dass ohne Geld entwicklungspolitisch zwar nichts geht, aber mit
Gleichheit<br />
Geld allein sich noch keine gute sozioökonomische Entwicklung betreiben<br />
lässt, eben weil die Ermächtigung der Menschen zur Integration und<br />
teilweisen Emanzipation vom Markt dafür grundlegend ist. Kein Geringerer<br />
<strong>als</strong> der indische Wirtschaftsnobelpreisträger Amartya Sen hat<br />
deshalb sein jüngstes <strong>Buch</strong> zum Thema mit dem trefflichen Titel ›Development<br />
as Freedom‹ überschrieben. 15<br />
Wirtschaftsbürgerrechte müssen natürlich auch ökonomisch tragbar<br />
sein. <strong>Das</strong> bringt uns zum vierten Punkt:<br />
4. Verträgt sich die bürgergesellschaftliche Vision<br />
mit der ökonomischen Vernunft?<br />
Der Begriff der ›ökonomischen Vernunft‹ ist natürlich gewollt mehrdeutig.<br />
In einem umfassenden, lebenspraktischen Sinn von ›vernünftigem<br />
Wirtschaften‹ ist die Wirtschaft Mittel und das gute Leben und<br />
Zusammenleben der Bürger Zweck. Den Zweck, <strong>als</strong>o das Leitbild der<br />
Gesellschaft, in der wir leben wollen, müssen wir der Marktwirtschaft<br />
vorgeben; insbesondere dürfen wir die Bestimmung der Zwecke guter<br />
sozioökonomischer Entwicklung nicht Ökonomen überlassen, die im<br />
Sinne der neoklassisch eng geführten Mainstream Economics denken,<br />
denn die sind allenfalls Experten für die Mittel, aber eben nicht für die<br />
Zwecke. Und wenn es da zu einer Konfusion von Mitteln und Zwecken<br />
kommt, resultiert daraus meistens plattester politischer Ökonomismus.<br />
So etwa, wenn Avenir Suisse derzeit allen Ernstes folgende These verbreitet:<br />
damit die Schweizer bereit sein würden, sich mehr für das<br />
Wirtschaftswachstum anzustrengen, müsse zuerst der »gefühlte Wohlstand«<br />
abnehmen und eventuell auch die direkte Demokratie, <strong>als</strong>o ein<br />
Stück Bürgerfreiheit, abgebaut werden. 16 Natürlich damit die Bevölkerung<br />
noch leichter dem Zwangszusammenhang deregulierter Märkte<br />
und dem entsprechenden Leistungsdruck unterworfen werden kann…<br />
Nein, so denken und reden die Befürworter einer wohl geordneten Gesellschaft<br />
freier und gleichberechtigter BürgerInnen nicht! Im Bemühen,<br />
solch ökonomistischer Ziel/Mittel-Verkehrung mit einer emanzipatorischen<br />
Gesellschaftspolitik Gegensteuer zu geben, kommt man aber<br />
am Sachzwangcharakter des Standortwettbewerbs nicht vorbei. <strong>Das</strong><br />
zirkelhafte Problem dabei ist bekannt: Die ›Zivilisierung‹ der globalen<br />
Marktkräfte ist mit fortschreitender ökonomischer Globalisierung selbst<br />
vermehrt nur noch auf der Ebene einer supranationalen Globalisierungspolitik<br />
möglich. Solange es daran mangelt, müssen sich gesellschaftspolitische<br />
Reformen, <strong>als</strong>o auch neue Wirtschaftsbürgerrechte,<br />
auch unter der herrschenden ökonomischen Ratio rechnen, die letztlich<br />
allein die Effizienz der Kapitalverwertung meint. Immerhin zeigen<br />
22 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
23 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gleichheit<br />
jedoch gerade die Erfahrungen in Entwicklungsländern, etwa in Lateinamerika,<br />
dass selbst ein eng gedachtes Wirtschaftswachstum nicht in<br />
nachhaltiger Weise stattfinden kann unter Bedingungen einer fortschreitenden<br />
sozialen Desintegration der Gesellschaft, die ›wachsende‹<br />
Teile der Bevölkerung von der Teilhabe am Produktions- und Konsumtionsprozess<br />
ausschliesst. Es fehlt dann nicht nur chronisch an Massenkaufkraft<br />
und damit an Binnennachfrage, sondern aufgrund der symptomatischen<br />
sozialen Unruhen und der politischen Instabilität solcher<br />
Länder auch an einem attraktiven Investitionsklima für das weltweit<br />
Rendite suchende Kapital. Pointierter gesagt: Eine Volkswirtschaft ohne<br />
Volk kann nicht anhaltend gedeihen. Die Beteiligung der ganzen Bevölkerung<br />
am Produktivitätsfortschritt und die Gewährleistung einer hinreichenden<br />
existenziellen Sicherheit und wirtschaftlichen Betätigungsmöglichkeit<br />
für alle Bürger sind <strong>als</strong>o durchaus auch gesellschaftliche Voraussetzungen<br />
einer Volkswirtschaft, die sich in raschem Strukturwandel<br />
befindet. Die Weiterentwicklung der Wirtschaftsbürgerrechte kann dazu<br />
einen wesentlichen Beitrag leisten.<br />
5. Hat die bürgergesellschaftliche Vision<br />
eine realpolitische Chance?<br />
Schliessen wir unsere perspektivischen Gedanken mit einer ganz kurzen<br />
strategischen Einschätzung ihrer (mittel- bis längerfristigen) Realisierbarkeit.<br />
Ich denke, das aufgeklärte Bürgertum – und Reste davon gibt<br />
es auch heute noch in den sich ›bürgerlich‹ nennenden Parteien – ist gut<br />
beraten, sich für das Leitbild einer voll entwickelten Bürgergesellschaft<br />
zu öffnen; wenn nicht aus dem ideellen Interesse an der allgemeinen<br />
Bürgerfreiheit, so doch wenigstens aus dem klugen Umgang mit den<br />
skizzierten sozioökonomischen Voraussetzungen nachhaltigen Wirtschaftswachstums.<br />
Realpolitisch genügt es ja manchmal, wenn man sich<br />
trotz divergierenden Zielen wenigstens über die Mittel ein Stück weit<br />
einig werden kann.<br />
Die strategische List der bürgergesellschaftlichen Programmatik einer<br />
›zivilisierten‹ Marktwirtschaft setzt jedoch tiefer an. Es geht – wie einleitend<br />
gesagt – darum, in der öffentlichen Sozi<strong>als</strong>taatsdebatte aus der<br />
Defensive herauszukommen und die Definitionsmacht über Geschichte<br />
machende Begriffe zurückzugewinnen. Eben jene Begriffe von Freiheit<br />
und Bürgergesellschaft, die vorm<strong>als</strong> die staatstragende Kraft der einst<br />
progressiven bürgerlichen Parteien ausgemacht haben, aber von diesen<br />
inzwischen weitgehend ihren Partikulärinteressen untergeordnet und<br />
verraten worden sind. Der politische Raum ist meines Erachtens heute<br />
weit offen für Bewegungen und Parteien, die das Anliegen einer eini-
Gleichheit<br />
germassen gerechten oder wenigstens ›anständigen‹ Gesellschaft nicht<br />
mehr nur einfach gegen die ›bürgerliche‹ Politik vertreten, sondern diese<br />
gerade anhand ihrer eigenen ideologisch pervertierten Leitbegriffe von<br />
Freiheit, Fortschritt und wirtschaftlicher Vernunft programmatisch überbieten.<br />
17 Gewiss, das ist anspruchsvoll, denn es verlangt nach echter<br />
gesellschaftspolitischer Neuorientierung. Doch ich bin überzeugt: Eine<br />
immer breiter werdende Schicht ›bürgerlich‹ geprägter, aber gesellschaftlich<br />
modern und aufgeklärt denkender Menschen wartet heute<br />
geradezu auf eine solche republikanische Rejustierung der freiheitlichdemokratischen<br />
Gesellschaft und auf die vernünftige Einbettung der<br />
Marktkräfte in sie – eben im Sinne einer ›zivilisierten‹ Marktwirtschaft.<br />
Ich habe einleitend für einen »methodischen Optimismus« plädiert.<br />
Viel schöner hat das Robert Musil ausgedrückt, und damit will ich<br />
schliessen:<br />
»Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch Möglichkeitssinn geben.<br />
(…) Es ist die Wirklichkeit, welche die Möglichkeiten weckt, und<br />
nichts wäre so verkehrt, wie das zu leugnen.« 18<br />
Literatur<br />
Craig, Gordon C. (1988) ›Geld und Geist. Zürich im Zeitalter des Liberalismus 1830–1869‹.<br />
München.<br />
Dahrendorf, Ralf (1992) ›Moralität, Institutionen und die Bürgergesellschaft‹. In: Merkur,<br />
Nr. 7, 557–568.<br />
Dworkin, Ronald (1984) ›Bürgerrechte ernstgenommen‹. Frankfurt/M.<br />
Held, Thomas u.a. (2004) ›Ökonomik der Reformen‹. Zürich.<br />
Hobsbawm, Eric (1977) ›Die Blütezeit des Kapit<strong>als</strong>. Eine Kulturgeschichte der Jahre<br />
1848–1875‹. München.<br />
Musil, Robert (1987) ›Der Mann ohne Eigenschaften‹. Reinbek.<br />
Rawls, John (1998) ›Politischer Liberalismus‹. Frankfurt/M.<br />
Sen, Amartya (2000) ›Ökonomie für den Menschen. Wege zu Gerechtigkeit und Solidarität in<br />
der Marktwirtschaft‹. München–Wien.<br />
Thielemann, Ulrich u. Peter Ulrich (2003) ›Brennpunkt Bankenethik. Der Finanzplatz Schweiz<br />
in wirtschaftsethischer Perspektive‹. Bern.<br />
Ulrich, Peter (1993) ›Transformation der ökonomischen Vernunft. Fortschrittsperspektiven<br />
der modernen Industriegesellschaft‹. Bern (3. Aufl.).<br />
Ulrich, Peter (2001) ›Integrative Wirtschaftsethik. Grundlagen einer lebensdienlichen Ökonomie‹.<br />
Bern (3., rev. Aufl.).<br />
Ulrich, Peter (2004) ›Was ist „gute” sozioökonomische Entwicklung? Eine wirtschaftsethische<br />
Perspektive‹. In: Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, 5. Jg., H. 1.<br />
Ulrich, Peter (2005) ›Zivilisierte Marktwirtschaft‹. Freiburg i.B.<br />
Van Parijs, Philippe (1995) ›Real Freedom for All. What (if anything) can justify capitalism?‹.<br />
Oxford.<br />
Weber, Max (1904/05) ›Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus‹. In: ders.,<br />
›Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie‹, Bd. I. Tübingen (9. Aufl. 1988), 17–206.<br />
24 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
25 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gleichheit<br />
Anmerkungen<br />
1 Zur zentralen Rolle Zürichs im europäischen Liberalismus des 19. Jahrhunderts vgl.<br />
Craig (1988).<br />
2 Zur Aktualität zwischen protestantischer Ethik und »Geist des Kapitalismus« vgl. Weber<br />
(1904/05).<br />
3 Zum »grossen Boom« von 1848 bis 1875 vgl. Hobsboom (1977) und Ulrich (1993, 92ff).<br />
4 Zur systematischen Abgrenzung von alt- und neoliberaler Ordnungspolitik vgl. Ulrich<br />
(2001, 337ff).<br />
5 Als führender Vordenker gilt John Rawls (1998).<br />
6 Zum Recht auf gleiche Würde und Achtung vgl. Dworkin (1984, 20).<br />
7 vgl. Rawls (1998, 437).<br />
8 Ein »vernünftiger Pluralismus« (Rawls 1998) schliesst nur solche Weltanschauungen und<br />
Lebensformen ein, die ihrerseits die liberale Gleichberechtigung aller »Konzeptionen des<br />
Guten« und die ihnen gegenüber gebotene Unparteilichkeit (Neutralität) der politischen<br />
Ordnung anerkennen. Für totalitäre Positionen und Programme ist darin <strong>als</strong>o kein Platz.<br />
9 Dieser spezifisch wirtschaftsethische Einwand richtet sich auch noch gegen die Konzeption<br />
des politischen Liberalismus von Rawls; vgl. dazu und zu den praktischen Konsequenzen<br />
im Einzelnen Ulrich (2001, 257ff).<br />
10 vgl. Weber 1904/05, 56).<br />
11 vgl. Dahrendorf 1992, 567f.<br />
12 Der Begriff der Wirtschaftsbürgerrrechte ist mehr <strong>als</strong> nur ein anderer Ausdruck für wirtschaftliche<br />
und soziale Staatsbürgerrechte, denn die Kategorie der Wirtschaftsbürgerrechte<br />
umfasst (unabhängig von der Staatsangehörigkeit) alle Mitglieder einer Volkswirtschaft,<br />
die im Land aufenthalts- und arbeitsberechtigt sind, dort tatsächlich leben,<br />
arbeiten und Steuern zahlen. Vgl. dazu Ulrich 2001, 245.<br />
13 vgl. Thielemann/Ulrich 2003, 71ff.<br />
14 vgl. Van Parijs 1995.<br />
15 Sen begreift Armut und Unterentwicklung <strong>als</strong> Ausdruck eines »Mangels an Verwirklichungschancen«,<br />
d.h. an »substanziellen Freiheiten, [...] ein mit Gründen erstrebtes<br />
Leben zu führen« (2000, 110; vgl. Ulrich 2004).<br />
16 vgl. Held u.a. 2004.<br />
17 vgl. zu diesen drei Leitbegriffen weiterführend Ulrich (2005).<br />
18 vgl. Muusil 1987, 16f.
Gleichheit<br />
Liberté, égalité, hypocrisie<br />
<strong>Das</strong> Gesetz verbietet den Reichen wie den Armen, unter den Brücken<br />
zu schlafen, in den Strassen zu betteln und Brot zu stehlen, und darin<br />
eben erweist sich seine erhabene Gleichheit. Anatole Frances ironischer<br />
Befund hat von seiner Aktualität nichts eingebüsst. Moralische Appelle<br />
an das Gefühl der Eigenverantwortung bilden ein Kernstück der neuen<br />
Sozi<strong>als</strong>taatskritik. Unterstellt wird, alle Menschen hätten die Chance,<br />
einer Arbeit nachzugehen und sich damit ihr Leben zu verdienen; wer<br />
sie nicht nutze, sei selber schuld. Vorausgesetzt wird die Existenz eines<br />
Systems, das gerecht ist, weil es allen Menschen die gleiche Freiheit gibt,<br />
zu tun, was erlaubt, und zu unterlassen, was verboten ist. Freiheit und<br />
Gleichheit werden in einer Art und Weise aufeinander bezogen, die uns<br />
heuchlerisch erscheint, weil von unrealistischen Annahmen ausgegangen<br />
und verdrängt wird, dass die Chancen, den durch das Gesetz gewährten<br />
Freiraum zu nutzen, ungleich verteilt sind.<br />
Einer verbreiteten Meinung zufolge liegt der Rechten die Freiheit, der<br />
Linken dagegen die Gleichheit am Herzen, und der Versuch, beide Prinzipien<br />
gleichzeitig zu verwirklichen, müsse vergeblich bleiben. Diese<br />
Meinung ist unhaltbar. Ich möchte im Folgenden drei Theorien diskutieren,<br />
die den Zusammenhang von Freiheit und Gleichheit je anders<br />
erklären: den klassischen Liberalismus, den modernen Liberalismus<br />
sowie den Marxismus. Alle drei Theorien verstehen die Prinzipien der<br />
Freiheit und Gleichheit <strong>als</strong> fundamental und sich gegenseitig bedingend,<br />
interpretieren sie aber unterschiedlich. Die Freiheit, nicht gezwungen zu<br />
werden, etwas zu tun oder zu unterlassen, ist zu unterscheiden von der<br />
weitergehenden Freiheit, effektiv tun oder unterlassen zu können, wozu<br />
oder wogegen man sich entschieden hat; im ersten Fall spricht man von<br />
negativer, im zweiten von positiver Freiheit. Entsprechendes gilt für die<br />
Gleichheit. Als die Vorkämpfer der modernen Demokratie verkündet<br />
hatten, alle Menschen seien gleich, so dachten sie dabei an die Gleichheit<br />
vor dem Gesetz, in dem primär negative Freiheiten verankert waren.<br />
Aber ist diese Gleichheit eine hinreichende Bedingung gerechter<br />
Verhältnisse? Unterstellt das Gesetz nicht zu Unrecht, dass alle Rechtssubjekte<br />
über gleiche Handlungsmöglichkeiten verfügen, dass der Arme<br />
so gut wie der Reiche frei ist, nicht<br />
unter der Brücke zu schlafen?<br />
Urs Marti<br />
Der klassische oder konservati- 1952, Studium der Philosophie, lehrt polive<br />
Liberalismus – heute vor allem tische Philosophie am Philosophischen<br />
in der Version des ›Neoliberalis- Seminar und am Institut für Politikwissenmus‹<br />
bekannt – verteidigt Werte schaft der Universität Zürich.<br />
26 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
27 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gleichheit<br />
wie Privateigentum, Vertragsfreiheit und generell die Freiheit vom Staat,<br />
<strong>als</strong>o die negative Freiheit. Ihr bedeutendster Vertreter ist Friedrich August<br />
von Hayek (1899–1992). Sein Denken ist geprägt von einem tiefen<br />
Misstrauen gegenüber demokratischer Politik und wissenschaftlichem<br />
Denken. Die rationalistische Überzeugung, Institutionen liessen sich<br />
aufgrund vernünftiger Einsicht verbessern, hält er für anmassend, und<br />
die moderne Auffassung, Menschen hätten das Recht, sich selbst ihr Gesetz<br />
zu geben, für verhängnisvoll. <strong>Das</strong> von Menschen geschaffene Recht<br />
wird, so seine Warnung, mit einem höheren, übermenschlichen Gesetz<br />
unweigerlich in Konflikt geraten, nämlich mit der Marktordnung. Hayek<br />
bestreitet nicht, dass Wohltaten und Lasten durch den Marktmechanismus<br />
ungleich verteilt werden. Doch diese ungleiche Verteilung kann<br />
nicht <strong>als</strong> ungerecht gelten, weil dahinter keine Absicht steht. Vom Markt<br />
Gerechtigkeit zu verlangen, ist für Hayek absurd; ungerecht aber ist es,<br />
einige Leute durch die Zubilligung eines Anspruchs auf bestimmte Anteile<br />
zu privilegieren. Hayek formuliert seine Kritik im Namen der<br />
Gleichheit. Aus der Ungleichbehandlung der Menschen durch den<br />
Markt lässt sich kein Rechtsanspruch auf eine die Benachteiligten bevorzugende<br />
Ungleichbehandlung durch das menschliche Gesetz herleiten.<br />
Die Freiheit hingegen spielt bei Hayek eher in rhetorischer denn in<br />
systematischer Hinsicht eine Rolle. Die traditionellen Menschen- und<br />
Bürgerrechtserklärungen könnten, wie er schreibt, ersetzt werden durch<br />
den Grundsatz, Zwang sei ausschliesslich zwecks Durchsetzung allgemein<br />
gültiger Regeln erlaubt. 2 Rechte dienen der Eingrenzung der Regierungsmacht,<br />
dem Schutz privater Sphären. Weitergehende positive<br />
Freiheiten wie die Freiheit, die institutionellen Bedingungen menschlichen<br />
Handelns zu verändern, oder der Anspruch auf soziale und wirtschaftliche<br />
Rechte können nur zur Zerstörung der Marktordnung beitragen.<br />
Was ist an diesem Ansatz problematisch? Ich möchte vier Punkte hervorheben:<br />
• Weshalb darf die Institution des Marktes nicht im Sinne der Korrektur<br />
der ungleichen Verteilung von Gewinn und Verlust verändert werden?<br />
Weil nur ein von politischen Zugriffen freier Markt Wohlstand<br />
garantieren kann, so lautet die These, deren wissenschaftliche Bestätigung<br />
freilich aussteht. Aussagen über positive Korrelationen zwischen<br />
Deregulierung, Wachstum und Beschäftigung werden durch empirische<br />
Untersuchungen in Frage gestellt.<br />
• Ist aber nicht die ungleiche Verteilung das getreue Abbild ungleicher<br />
Anstrengungen und Fähigkeiten? <strong>Das</strong> Argument wird gerne ins Feld
Liberté, égalité, hypocrisie<br />
geführt, widerspricht aber der reinen Lehre. Hayek hat dargelegt, es<br />
könne zwar nützlich sein, wenn Menschen glauben, Leistung werde vom<br />
Markt belohnt, doch dieser Glaube sei f<strong>als</strong>ch. 3 Die Anhänger der freien<br />
Marktwirtschaft befinden sich, wie er zugesteht, in einem echten Dilemma;<br />
es ist nämlich fraglich, ob die Menschen die vom Markt erzeugten<br />
Ungleichheiten akzeptieren würden, falls sie wüssten, dass sie nicht Verdienst<br />
und Versagen widerspiegeln. Tatsächlich werden der Preis der<br />
Waren und der Lohn der Arbeit von Angebot und Nachfrage bestimmt;<br />
die effektive Leistung der Menschen kann keine Bemessungsgrundlage<br />
sein, ebenso wenig wie ihr Bedürfnis. Die modische Angewohnheit, wirtschaftliche<br />
Akteure moralisch zu qualifizieren, Gewinner zu loben und<br />
Verlierer zu tadeln, ist daher nicht nur angesichts der Erfahrung, sondern<br />
auch mit Blick auf die reine Lehre fehl am Platz.<br />
• Weshalb lässt sich aus dem Anspruch des Marktakteurs, vor staatlichen<br />
Eingriffen verschont zu bleiben, ein Recht herleiten, nicht aber aus dem<br />
Anspruch von Lohnabhängigen, vor wirtschaftlichem und sozialem<br />
Zwang verschont zu bleiben? Hayeks Antwort mag für unsere Ohren<br />
seltsam tönen. Die Idee sozialer und wirtschaftlicher Rechte, wie sie in<br />
den Artikeln 22–28 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte<br />
postuliert wird, basiere, wie er indigniert bemerkt, auf der Interpretation<br />
der Gesellschaft <strong>als</strong> einer mit Absicht errichteten Organisation, worin<br />
alle Menschen angestellt sind. 4 Die Botschaft ist eindeutig: Als Marktakteur<br />
ist der Mensch berechtigt, Rechte zu haben, nicht aber <strong>als</strong> blosser<br />
Angestellter. Möglicherweise kommt in diesem Urteil die traditionelle<br />
Überzeugung zum Ausdruck, nur Eigentümer seien vollwertige Menschen,<br />
denen Rechte zustehen. Zeitgenössische Neoliberale können sich<br />
der Einsicht, dass in modernen Gesellschaften die meisten Menschen<br />
angestellt sind, nicht mehr verweigern. Sie suchen daher die Lohnabhängigen<br />
auf das Niveau ›echter‹ Menschen zu heben, indem sie sie zu<br />
Unternehmern ihres Humankapit<strong>als</strong> erklären. Auch sie verdrängen freilich,<br />
dass die Ausgangsbedingungen auf Märkten in der Regel ungleich<br />
sind, dass die menschliche Existenz, die zu schützen die Funktion von<br />
Rechten ist, sich nicht auf die Dimension des Marktes reduzieren lässt,<br />
und dass folglich Ansprüche auf die Korrektur ungleicher Ausgangsbedingungen<br />
legitim sind.<br />
• Neue Heilsbotschaften verkünden täglich, es ginge allen besser, würden<br />
die Handlungsfreiheiten der Bessergestellten, vor allem der Unternehmer,<br />
mittels Deregulierung und Steuersenkung zusätzlich erweitert,<br />
die Handlungsfreiheiten der Schlechtergestellten, in der Regel der Lohnabhängigen,<br />
aber mittels restriktiverer Arbeits- und Sozialgesetze sowie<br />
28 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
29 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gleichheit<br />
tieferer Löhne noch mehr eingeschränkt. Eine seltsame Lehre. Der Neoliberalismus<br />
sieht sich denn auch dem Verdacht ausgesetzt, eine blosse<br />
Ideologie zu sein, die der Verteidigung von Privilegien dient. Niemand<br />
bezahlt gerne Steuern. Muss man deshalb Theorien konstruieren, die in<br />
ihrer vulgären Fassung nichts anderes besagen, <strong>als</strong> dass vom privaten<br />
Wohlergehen einiger privilegierter Menschen das Wohl der Gemeinschaft<br />
abhängt? Die Ansicht, die Besteuerung zum Zweck der Umverteilung<br />
sei menschenrechtswidrig 5 , ist absurd. Der erwirtschaftete Gewinn<br />
kann in der Regel nur zu einem kleineren Teil auf eigene Leistung<br />
zurückgeführt werden. Wesentlich tragen dazu, neben den bereits erwähnten<br />
Gesetzen von Angebot und Nachfrage, die Kooperation zwischen<br />
Menschen bei, die davon nicht alle in gleichem Mass profitieren,<br />
sowie die vom Staat zur Verfügung gestellte Infrastruktur.<br />
Die zweite Theorie, der moderne Liberalismus, ist sozialdemokratisch<br />
ausgerichtet und sieht die Aufgabe der Politik primär in der Ermöglichung<br />
individueller Selbstbestimmung. Im Gegensatz zum klassischen<br />
Liberalismus setzt der moderne Liberalismus sein Vertrauen in die<br />
menschliche Vernunft und in demokratische Praktiken. Sein bedeutendster<br />
Vertreter ist John Rawls (1921–2002). Er versteht die Gesellschaft <strong>als</strong><br />
eine Gesamtheit von rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Institutionen,<br />
die die Lebenschancen der Menschen entscheidend beeinflusst<br />
und ungleiche Ausgangspositionen schafft. Eine gerechte Gestaltung<br />
der Verhältnisse erfordert mithin eine Veränderung nicht nur der politischen<br />
Verfassung, sondern auch der sozioökonomischen Verhältnisse.<br />
Sie zielt auf den Abbau sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheiten, in<br />
erster Linie jedoch auf ein möglichst umfassendes System gleicher<br />
Grundfreiheiten für alle. Rawls versteht darunter negative wie positive<br />
Freiheiten, wozu, wie er explizit festhält, das Recht auf Privateigentum<br />
an Produktionsmitteln oder die Vertragsfreiheit im klassisch-liberalen<br />
Sinne nicht zählen. 6 Er bestreitet nicht die Effizienz von Märkten, macht<br />
aber geltend, dass sie eine Reihe von Aufgaben nicht lösen können, die<br />
eine gerechte Verfassung der Politik stellt. Dazu gehören Vollbeschäftigung<br />
und die Gewährung eines Existenzminimums zur Befriedigung<br />
elementarer Bedürfnisse; der Markt nimmt ja auf Bedürfnisse keine<br />
Rücksicht, sondern reagiert auf die Nachfrage, die Kaufkraft voraussetzt.<br />
Dazu gehören ebenso wirtschaftliche Chancengleichheit wie auch die<br />
Verhinderung wirtschaftlicher Machtballungen; Besteuerung und Änderungen<br />
des Besitzrechts sind notwendige Mittel zur Herstellung von<br />
Verteilungsgerechtigkeit. 7<br />
Der moderne Liberalismus vermag aufgrund seiner umfassenden und<br />
differenzierten Freiheitskonzeption zu überzeugen, mutet jedoch zuwei-
Gleichheit<br />
len weltfremd an. Die Realisierung seiner Postulate setzt einen demokratischen<br />
Staat, ein umfassendes System negativer und positiver Freiheitsrechte<br />
sowie eine Politik massiver Umverteilung voraus. Obwohl<br />
die ›Liber<strong>als</strong>‹ – im englischen Sprachraum meint der Begriff soviel wie<br />
sozialdemokratisch oder links – von ihren Gegnern zur Rechten oft <strong>als</strong><br />
Sozialisten bezeichnet werden, schrecken viele von ihnen davor zurück,<br />
die Frage nach der Rechtmässigkeit des Kapitalismus beziehungsweise<br />
die Notwendigkeit der Umverteilung wirtschaftlicher Macht zu thematisieren.<br />
Generell ist im Zeitalter des so genannten Postsozialismus 8 eine<br />
Vernachlässigung sozioökonomischer Fragen zu konstatieren. Rawls ist<br />
in dieser Hinsicht radikaler <strong>als</strong> viele seiner Schüler. Demokratien können<br />
ihm zufolge nur funktionieren, wenn alle BürgerInnen gleiche, umfassende<br />
politische Freiheiten, <strong>als</strong>o Partizipationsmöglichkeiten haben.<br />
Diese Freiheiten sind gefährdet, wenn diejenigen, die über grössere private<br />
Mittel verfügen, die öffentliche Diskussion beherrschen, wenn <strong>als</strong>o<br />
beispielsweise politische Parteien von privaten Interessen abhängig sind.<br />
Rawls hat denn auch die real existierenden Demokratien, vor allem<br />
jene der USA, kritisiert. 9 Ihr Hauptfehler liegt für ihn darin, dass sie die<br />
zur Sicherung der politischen Freiheit nötigen Ausgleichsmassnahmen<br />
nie ernstlich erwogen haben, dass die Gesetze Ungleichheiten der Vermögensverteilung<br />
zulassen, die mit der politischen Gleichheit unverträglich<br />
sind. Gemäss Rawls können weder der deregulierte noch der<br />
wohlfahrtsstaatliche Kapitalismus und ebenso wenig der Staatssozialismus<br />
mit Kommandowirtschaft die von ihm definierten Gerechtigkeitsprinzipien<br />
verwirklichen. Dies können nur die »Eigentumsdemokratie«,<br />
die eine breite Streuung des Eigentums und der Verfügungsmacht über<br />
Produktionsmittel garantiert, oder ein liberaler und demokratischer Sozialismus,<br />
der die freie Wahl von Beruf und Arbeitsplatz garantiert. Der<br />
Grundgedanke ist folgender: Im Gegensatz zum Wohlfahrtstaat, der die<br />
Auswirkungen einer ungerechten Ordnung fortwährend abzumildern<br />
versucht, die Ursachen der Ungerechtigkeit, nämlich die Konzentration<br />
wirtschaftlicher Macht bei einem kleinen Teil der Bevölkerung, aber unangetastet<br />
lässt, würde eine Demokratie, die sich auch auf den Bereich<br />
der Ökonomie erstreckt, mittels breiter Verteilung der Produktionsmittel<br />
Ungerechtigkeit im Sinne massiver Ungleichheit der Chancen gar<br />
nicht erst entstehen lassen.<br />
Von Marxismus ist zwar in zeitgenössischen politischen Kontroversen<br />
oft die Rede, doch scheinen viele, die den Begriff in polemischer Absicht<br />
verwenden, kaum eine Ahnung zu haben, worum es sich dabei handelt.<br />
Wenn hierzulande ein Bundesrat die Schweiz auf marxistischen Pfaden<br />
wähnt, dann wirkt das eher belustigend. 10 Was er darunter versteht, näm-<br />
30 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
31 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gleichheit<br />
lich die »Enteignung« des Bürgers durch den Staat mittels »Zwangssteuern«,<br />
umschreibt exakt das politische Anliegen des modernen Liberalismus.<br />
Die marxistische Theorie hingegen hält materielle Umverteilung<br />
nicht für ein geeignetes Mittel zum Zweck der Veränderung der<br />
Gesellschaft. Wenn Marx den Begriff der »gerechten Verteilung« für<br />
sinnlos erklärt 11 , dann kritisiert er die Strategie der deutschen Sozialdemokratie,<br />
die in ihrem Programm von 1875 auf die Gleichverteilung der<br />
Konsumgüter zielt. Die Art und Weise, wie diese in einer Gesellschaft<br />
verteilt werden, ist nach Marx aber bloss das Resultat der Verteilung des<br />
Eigentums über die Produktionsbedingungen, <strong>als</strong>o der ökonomischen<br />
Macht. Anders <strong>als</strong> die Kapitaleigner besitzen die Arbeiter nur ihre persönlichen<br />
Produktionsbedingungen, nämlich ihre Arbeitskraft. Unhaltbar<br />
ist dieser Zustand jedoch nicht, weil materielle Güter, sondern weil<br />
die Handlungsmöglichkeiten ungleich verteilt sind.<br />
Marx hat im ersten Band des Kapit<strong>als</strong> die Zirkulationssphäre, das<br />
heisst den Markt, ironisch <strong>als</strong> das Reich der angeborenen Menschenrechte<br />
gepriesen, worin alle Menschen frei und gleich sein, Eigentum<br />
besässen und ihren Eigennutz verfolgten. 12 <strong>Das</strong> heisst nicht, dass er die<br />
bürgerlichen Rechtsprinzipien von Freiheit, Gleichheit und Eigentum<br />
für überflüssig hält, vielmehr erkennt er ein Defizit der zugrunde liegenden<br />
Rechtsauffassung: Eine vieldimensionale Welt wird auf die Dimension<br />
des Marktes reduziert und Menschenrechte gelten <strong>als</strong> Rechte, die<br />
nur in dieser Dimension eingefordert werden können. Die kapitalistische<br />
Produktion findet ausserhalb der Marktsphäre statt, in einem<br />
Bereich, worin andere Gesetze herrschen und kein freiwilliger und für<br />
beide Seiten vorteilhafter Tausch stattfindet. Die Verkäufer der Ware Arbeitskraft<br />
stehen den Käufern nicht <strong>als</strong> gleichberechtigte Vertragspartner<br />
gegenüber, da der Mangel an Subsistenz- oder Produktionsmitteln sie<br />
zum Abschluss eines für sie unvorteilhaften Arbeitsvertrags zwingt. Ihnen<br />
fehlt jene Wahlfreiheit, die eine notwendige Prämisse der modernen<br />
Rechtskonzeption ist. Wohlhabende können sich dank der Einforderung<br />
der Rechte auf Privateigentum und Vertragsfreiheit gegen die Zugriffe<br />
der Staatsmacht wehren. Menschen jedoch, deren Ausgangsbedingungen<br />
auf dem Markt, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt, schlecht sind,<br />
können solche Rechte kaum nutzen, sie helfen ihnen nicht, ihre Ausgangsbedingungen<br />
zu verbessern. Rechte sind somit daraufhin zu prüfen,<br />
ob sie effektiv durchgesetzt und genutzt werden können, ob sie zur<br />
Erweiterung von Handlungsfreiheiten beitragen. Menschen brauchen<br />
Rechte, die sie befähigen, ökonomischem und sozialem Zwang auch<br />
dann zu widerstehen, wenn das einzige Gut, worüber sie verfügen, ihre<br />
Arbeitskraft ist.
Gleichheit<br />
<strong>Das</strong> System des Rechts basiert, wie Marx in Erinnerung ruft, auf<br />
dem Prinzip der Gleichheit. 13 Gleiches Recht ist jedoch notwendig ein<br />
›Recht der Ungleichheit‹. Jedes Recht ist die Anwendung des gleichen<br />
Massstabs auf ungleiche Individuen. Individuen können, so das Argument<br />
von Marx, nicht gleich sein, sonst wären sie eben keine Individuen,<br />
<strong>als</strong>o Menschen, die ihre unverwechselbare Besonderheit haben,<br />
worunter jetzt nicht ungleiche Ausgangsbedingungen aufgrund materiellen<br />
Besitzes gemeint sind, sondern besondere Fähigkeiten, Bedürfnisse<br />
und Wünsche. Wer grössere Fähigkeiten besitzt, kann mehr produzieren.<br />
Wer grössere Bedürfnisse hat, weil er eine Familie zu ernähren<br />
hat, wird dennoch nicht mehr verdienen <strong>als</strong> derjenige, der gleich viel<br />
produziert und nur für sich selbst zu sorgen hat. Um reale Ungleichheiten<br />
zwischen Menschen zu korrigieren, müsste das Recht ungleich<br />
sein, <strong>als</strong>o von Fall zu Fall einen anderen Massstab anlegen, was der<br />
Idee des Rechts widerspricht. Die Anwendung eines Massstabs setzt<br />
voraus, dass von der Individualität der Menschen abstrahiert und nur<br />
Vergleichbares berücksichtigt wird. Denkbar ist jedoch für Marx eine<br />
Gesellschaft, worin der Grundsatz gilt: Jeder nach seinen Fähigkeiten,<br />
jedem nach seinen Bedürfnissen. Es wäre dies eine völlig individualisierte<br />
Gesellschaft, und ihre ökonomische Basis wäre die Entfaltung<br />
aller menschlichen Anlagen, insbesondere die Befreiung der individuellen<br />
Produktivität und Kreativität. Menschen wären dann in einem<br />
umfassenden Sinne frei, sie hätten nicht nur unter keiner Form ökonomischer<br />
Fremdbestimmung zu leiden, sondern wären auch nicht<br />
auf ein staatliches Unterstützungs- und Umverteilungssystem angewiesen.<br />
Was ist die Grundlage dieser Utopie? Marx hat in seiner Rekonstruktion<br />
des Prozesses der kapitalistischen Akkumulation dargelegt, wie seit<br />
dem 14. Jahrhundert zahllose Menschen, sei es <strong>als</strong> freie Kleinbauern<br />
oder <strong>als</strong> kleine Unternehmer, von ihren Subsistenz- und Produktionsmitteln<br />
enteignet worden sind. Der kapitalistische Akkumulations- ist<br />
daher vor allem ein Enteignungsprozess, der bewirkt, dass immer mehr<br />
Menschen ihre Selbständigkeit einbüssen. In diesem Sinne kann Marx<br />
sagen, das kapitalistische Privateigentum stelle die Negation des individuellen,<br />
auf eigener Arbeit gegründeten Privateigentums dar. Weil indes<br />
der geschichtliche Fortschritt unumkehrbar ist, kann individuelles Eigentum<br />
nur auf der Basis der Kooperation und des Gemeinbesitzes der<br />
Produktionsmittel wiederhergestellt werden. 14 Gemeineigentum ist folglich<br />
deshalb erstrebenswert, weil es verhindert, dass Menschen, die ausser<br />
ihrer Arbeitskraft nichts besitzen, ihre Wahlfreiheit einbüssen, und<br />
weil es garantiert, dass niemand von der Gestaltung nicht nur der poli-<br />
32 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
33 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gleichheit<br />
tisch-rechtlichen, sondern auch der sozialen und ökonomischen Verhältnisse<br />
ausgeschlossen wird.<br />
Freiheit und Gleichheit sind im klassischen Liberalismus, im modernen<br />
Liberalismus und im Marxismus zentrale Werte. Kein Mensch<br />
bekämpft die Freiheit, wie Marx konstatiert hat 15 , er bekämpft höchstens<br />
die Freiheit der anderen. Grundsätzlich besteht auch Einigkeit darüber,<br />
dass Freiheit ohne Eigentum illusionär ist. Uneinigkeit besteht im Hinblick<br />
auf die Bedeutung der Begriffe Freiheit und Gleichheit sowie auf<br />
die Frage, welche Form von Eigentum sich mit der Freiheit am besten<br />
verträgt. Der klassische oder Neoliberalismus geht von einem verzerrten<br />
Menschenbild aus, er reduziert die menschliche Praxis auf das<br />
Markthandeln und sorgt sich folgerichtig primär um Marktfreiheiten.<br />
<strong>Das</strong> Freiheitsverständnis des modernen Liberalismus und mehr noch<br />
des Marxismus ist weit anspruchsvoller: Gesellschaftliche Institutionen<br />
sind nicht gott- oder naturgegeben, die Menschen müssen sich ihnen<br />
nicht unterwerfen. Es handelt sich um menschliche Schöpfungen, die<br />
veränderbar sind. Die Bedingungen, unter denen Menschen leben und<br />
arbeiten, können von ihnen gestaltet und verändert werden, eben darin<br />
besteht ihre Freiheit. Gegen den modernen Liberalismus lässt sich einwenden,<br />
dass seine Intentionen nie ganz klar werden. Soll durch eine<br />
materielle Umverteilung, die nach Möglichkeit jeder individuellen Besonderheit<br />
gerecht wird, das Leben unter kapitalistischen Verhältnissen<br />
erträglicher gestaltet werden, oder sollen positive Freiheitsrechte <strong>als</strong><br />
Instrumente zum Abbau von Machtdisparitäten auch im sozioökonomischen<br />
Bereich genutzt werden? Was schliesslich für den Marxismus<br />
spricht, ist die Radikalität seiner Freiheitsidee, die in der Aufforderung<br />
zum Ausdruck kommt, »an die Stelle der Herrschaft der Verhältnisse<br />
und der Zufälligkeit über die Individuen die Herrschaft der Individuen<br />
über die Zufälligkeit und die Verhältnisse zu setzen«. 16 Offen bleibt, wie<br />
ein System des Gemeineigentums organisiert werden kann, ohne dass<br />
es die Diktatur einer bürokratischen Elite begünstigt und zu neuen Formen<br />
der Fremdbestimmung führt.
Gleichheit<br />
Literatur<br />
France, Anatole (1894) ›Le lys rouge‹. Paris.<br />
Fraser, Nancy (1997) ›Justice Interruptus: Critical Reflections on the ‘Postsocialist’ Condition‹.<br />
New York.<br />
Hayek, Friedrich August von (1976) ›Law, Legislation and Liberty. Volume 2 The Mirage of<br />
Social Justice‹. London.<br />
Marx, Karl (MEW) ›Marx-Engels Werke‹, Berlin/Ost, 1956ff.<br />
Nozick, Robert (1974) ‹Anarchy, State, and Utopia‹. New York.<br />
NZZ (2005) ›Die Schweiz auf marxistischen Pfaden. Bundesrat Blocher plädiert für Stärkung<br />
des Eigentums‹. In: Neue Zürcher Zeitung, 11./12. Juni 2005, 17.<br />
Rawls, John (1979) ›Eine Theorie der Gerechtigkeit‹. Frankfurt (engl. Originalausgabe 1971).<br />
Rawls, John (2001) ›Justice as Fairness. A Restatement‹. Cambridge MA.<br />
1 vgl. Hayek 1976, 64–68.<br />
2 vgl. Hayek 1976, 102.<br />
3 vgl. Hayek 1976; 68, 73f.<br />
4 vgl. Hayek 1976, 104f.<br />
5 vgl. Nozich 1974.<br />
6 vgl. Rawls 1979, 82f<br />
7 vgl. Rawls 1979, 309–313.<br />
8 vgl. Fraser 1997.<br />
9 vgl. Rawls 1979, 255ff, 136–140.<br />
10 vgl. NZZ 2005.<br />
11 vgl. MEW 19, 18.<br />
12 vgl. MEW 23, 189f.<br />
13 vgl. MEW 19, 21.<br />
14 vgl. MEW 23, 791.<br />
15 vgl. MEW 1, 51.<br />
16 vgl. MEW 3, 424.<br />
Anmerkungen<br />
34 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Une Suisse de plus en plus<br />
riche et inégalitaire<br />
Quelques données de base sur la redistribution<br />
des richesses en Suisse (1990-2003)<br />
La mesure de notre progrès n’est pas notre<br />
capacité à accroître la richesse de ceux qui ont beaucoup,<br />
mais de procurer assez à ceux qui ont peu.<br />
Franklin D. Roosevelt en 1937<br />
Au cours des quinze dernières années, les inégalités de revenus en Suisse<br />
ont progressé fortement. Ce phénomène s’explique par l’accroissement<br />
des revenus des capitaux, par la stagnation des salaires réels et par la progression<br />
de la fiscalité indirecte (taxes et cotisations sociales) qui porte<br />
atteinte au revenu disponible des classes moyennes et modestes (salaires<br />
bruts moins impôts, cotisations sociales et loyer). Face à l’ampleur de<br />
certaines données, il n’est pas exagéré de parler d’une »redistribution du<br />
bas vers le haut«. Ce bref chapitre fournit quelques données de base sur<br />
la redistribution des richesses en Suisse au cours des quinze dernières<br />
années.<br />
Ce phénomène ne se limite pas à la Suisse: les syndicats allemands,<br />
qui publient chaque année un rapport sur la redistribution (›Verteilungsbericht‹),<br />
arrivent à des conclusions similaires dans leur dernier<br />
rapport paru en 2004.<br />
1. Progression des revenus du capital et de la fortune<br />
Toutes les études récentes portant sur la croissance économique ou sur<br />
le partage des richesses se focalisent exclusivement sur le Produit intérieur<br />
brut (PIB), qui mesure l’ensemble des richesses produites en Suisse.<br />
Cependant, un tel indicateur ne tient pas compte des revenus tirés des<br />
activités à l’étranger revenant en Suisse. Ainsi, pour mesurer les richesses<br />
d’un pays, il est plus pertinent de prendre en compte le Produit national<br />
brut (PNB), qui englobe également les revenus tirés de l’étranger.<br />
Le PNB est égal au PIB auquel on additionne les revenus rapatriés par<br />
les nationaux de l’étranger et au-<br />
André Mach<br />
quel on retranche les revenus des<br />
politologue, Maître-assistant en sciences étrangers résidents qu’ils ›expor-<br />
politiques à l’Université de Lausanne, tent‹ hors de nos frontières. On di-<br />
membre du PSS et de la rédaction du menstingue à ce propos le revenu du<br />
suel ›Pages de gauche‹<br />
travail et du capital versé à ou reçu<br />
35 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Egalité
Egalité<br />
de l’étranger. Alors que les revenus du travail sont constamment négatifs<br />
(en raison des nombreux travailleurs étrangers ou frontaliers qui gagnent<br />
leur salaire en Suisse, mais le dépensent à l’étranger), les revenus<br />
des capitaux suisses tirés de l’étranger sont quant à eux constamment positifs.<br />
En Suisse, le PNB est généralement supérieur au PIB car le solde<br />
des revenus des facteurs est structurellement positif. Cette caractéristique<br />
s’est fortement accentuée au cours des quinze dernières années, en raison<br />
de l’accroissement continu des revenus des capitaux suisses à l’étranger.<br />
Entre 1990 et 2000, le solde des revenus des capitaux de l’étranger<br />
a plus que doublé (de 19 à 44 milliards de francs). Ainsi, au cours des<br />
années 1990, le PNB a progressé plus vite que le PIB: en 2000, le PNB<br />
suisse dépassait de près de 10% le PIB (tableau 1). Les revenus des capitaux<br />
suisses à l’étranger se composent notamment des intérêts et des<br />
dividendes des placements effectués par des Suisses à l’étranger (obligations<br />
ou actions), des crédits des banques sur la scène internationale<br />
ou encore des revenus des entreprises tirés de leurs investissements à<br />
l’étranger. Comme quoi la Suisse est peuplée d’entreprises transnationales<br />
qui savent tirer profit de la mondialisation néo-libérale…<br />
Dans le même temps, la rémunération des actionnaires a connu une<br />
progression fulgurante. Le montant des dividendes versés aux actionnaires<br />
ainsi que les rachats de leurs propres actions par les entreprises,<br />
notamment pour soutenir le cours de leur action, ont augmenté dans des<br />
proportions inégalées au cours de la dernière décennie. Ils sont ainsi passés<br />
de deux milliards en 1982, à cinq en 1990 et à plus de trente milliards<br />
en 2001 aux prix courants (tableau 2). Même en tenant compte de<br />
l’inflation, cette progression est énorme et profite essentiellement aux<br />
détenteurs d’actions, qui se recrutent majoritairement parmi les couches<br />
les plus aisées de la population.<br />
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que la part de la rémunération<br />
des salariés par rapport au PNB a régulièrement diminué au cours des<br />
Tableau 1: Part des salaires dans le PNB<br />
36 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
années 1990. Entre 1992 et 2000, la part des salaires dans le PNB n’a<br />
cessé de s’éroder; au total, cette proportion a diminué de près de 4% en<br />
huit ans (de 59.2% à 55.4%), ce qui représente une baisse considérable.<br />
A partir de 2001, la situation des salariés s’est améliorée (tableau 1).<br />
De la même manière, la fortune nette totale des personnes physiques<br />
en Suisse a progressé de plus de 40% entre 1991 et 1997 à prix courants.<br />
Parmi les personnes détenant plus d’un million de francs de fortune<br />
nette, la progression a été de près de 70% durant la même période. En<br />
1997, la fortune totale détenue en Suisse se montait à 750 milliards de<br />
francs, dont 50% était détenu par 3% des contribuables, alors que 97%<br />
détenaient les autres 50% (tableau 2). Les prochaines statistiques sur la<br />
fortune des personnes physiques, qui ne paraissent que tous les six ans,<br />
devraient paraître en 2005 pour l’année 2003.<br />
Tableau 2: Fortune des personnes physiques en Suisse (1991 et 1997)<br />
Toujours en ce qui concerne la fortune, selon le rapport ›World Wealth<br />
Report‹ 2004 de Merrill Lynch et Cap Gemini sur les plus riches de la<br />
planète, (disposant d’une fortune supérieure à un million de dollars, sans<br />
tenir compte des biens immobiliers), paru en juin 2004, le nombre de<br />
millionnaires en dollars atteignait 180’000 en Suisse et disposaient d’une<br />
fortune totale de 750 milliards de francs. Dans le canton de Vaud, selon<br />
les dernières statistiques de l’administration cantonale, le nombre de<br />
millionnaires a plus que doublé au cours des dix dernières années pour<br />
atteindre un peu plus de 23’000. D’autre part, entre 1981 et 2001, la fortune<br />
brute déclarée dans le canton est passée de 36 milliards à 126 milliards<br />
de francs. Alors que les 10% les plus riches concentrent les deux tiers<br />
de la fortune cantonale, la moitié des contribuables ne dispose que de<br />
2% de cette fortune.<br />
37 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Egalité
Egalité<br />
Malgré la faible croissance du PIB au cours de la dernière décennie,<br />
la richesse de la Suisse a progressé de manière importante. C’est sa répartition<br />
qui pose problème: l’augmentation des richesses, en partie acquise<br />
à l’étranger, a essentiellement profité aux couches sociales les plus<br />
aisées. Ce phénomène est encore renforcé par le système fiscal suisse…<br />
2. Stagnation des salaires et diminution du revenu<br />
disponible en raison de la progression des taxes indirectes<br />
Parallèlement à cet accroissement des richesses pour les classes les plus<br />
aisées, on assiste en Suisse à une stagnation des salaires réels et à une<br />
érosion des revenus disponibles parmi la grande majorité de la population<br />
en raison de la progression des taxes indirectes.<br />
Au cours des années 1990, les salaires bruts réels (salaire brut moins<br />
inflation) ont en moyenne stagné, progressant moins vite que le PIB réel<br />
(tableau 4), avec cependant de fortes variations d’une branche économique<br />
à l’autre.<br />
Par ailleurs, pour la période 1996–2000, la progression des salaires<br />
a été nettement plus forte parmi les 10% gagnant le plus que parmi le<br />
reste des salariés, comme le montre le tableau 3.<br />
Tableau 3: Croissance annuelle des salaires bruts 1996–2000<br />
En prenant en compte le revenu disponible (salaire brut moins dépenses<br />
obligatoires, à savoir les impôts et cotisations sociales principalement),<br />
les chiffres sont encore plus éloquents. Les revenus disponibles des ménages<br />
modestes ont diminué durant la même période. C’est l’un des<br />
principaux résultats de la récente étude du bureau Ecoplan sur la ›Répartition<br />
de la richesse en Suisse‹, sur mandat du Département fédéral des<br />
finances en réponse à un postulat de Jacqueline Fehr (PS, ZH).<br />
En effet, on a assisté au cours des années 1990 à une forte progression<br />
des taxes indirectes et des dépenses obligatoires: introduction de la<br />
TVA, majoration de diverses taxes à l’échelon fédéral, cantonal et communal,<br />
augmentation massive des primes d’assurances-maladie ainsi que<br />
progression des loyers. Cette politique n’a fait qu’alourdir de manière<br />
uniforme les charges pesant sur l’ensemble des salariés et a ainsi contribué<br />
à réduire le pouvoir d’achat des revenus modestes. En même temps,<br />
les diminutions des différents droits de timbre portant sur l’émission et<br />
la négociation des actions, la réforme de la fiscalité des entreprises ainsi<br />
que l’introduction de la TVA ont toutes contribué à alléger les char-<br />
38 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
ges pour les entreprises, surtout celles tournées vers l’exportation, et<br />
pour les milieux financiers; de même, les charges fiscales pesant sur les<br />
revenus élevés et les grosses fortunes stagnaient.<br />
Selon l’étude Ecoplan, entre 1990 et 1998, le revenu disponible (salaire<br />
brut moins cotisations sociales, impôts et loyer, qui mesure le pouvoir<br />
d’achat) des 25% des ménages les plus modestes a diminué de 10 à<br />
15%; en même temps, le revenu disponible des 10% de revenus les plus<br />
élevés a progressé de 12%. Entre 1998 et 2001, années de reprise économique,<br />
la situation s’est améliorée pour les revenus modestes, avec<br />
une plus forte progression du revenu disponible que pour les revenus<br />
élevés (20% les plus riches, p. 31).<br />
Sur l’ensemble de la période, entre 1990 et 2001, seul les 10% des<br />
ménages les plus riches ont vu leur »revenu disponible à court terme«<br />
(revenu brut moins cotisations sociales obligatoires, impôts directs et loyer)<br />
progresser (de 0.7% par année); en revanche, pour toutes les autres<br />
catégories de revenus, il a stagné ou baissé. La progression des charges<br />
obligatoires indirectes expliquent très largement cette accentuation des<br />
inégalités de revenus.<br />
En 2001, le revenu brut moyen des 10% les plus riches était 4.7 fois<br />
supérieurs au revenu brut des 10% les plus pauvres; en prenant en<br />
compte le revenu disponible, le rapport se montait à 4.6 (tableau 4). En<br />
mesurant les différentes dépenses obligatoires pour calculer le revenu<br />
disponible, l’étude d’Ecoplan montre que les inégalités au niveau du revenu<br />
disponible sont quasiment les mêmes qu’au niveau du revenu brut.<br />
Ainsi, on peut constater que le caractère progressif de l’impôt sur le revenu<br />
est complètement neutralisé par les taxes indirectes et les cotisations<br />
sociales, en particulier les primes d’assurance-maladie. En tenant<br />
compte en plus du loyer, comme dépense obligatoire supplémentaire<br />
(revenu disponible à court terme), les inégalités sont encore plus fortes<br />
(Rapport Ecoplan 2004, 17–18).<br />
Finalement, selon une étude de l’OFS datant de 2001, on peut encore<br />
souligner qu’entre 1992 et 1999 le nombre de ›working poors‹ (personnes<br />
exerçant une activité rémunérée, mais vivant dans la pauvreté: 2’000<br />
francs par mois après impôts et cotisations sociales) a connu une forte<br />
progression entre 1992 et 1999, en passant de 170’000 à 250’000.<br />
Tableau 4: Revenu brut moyen…<br />
39 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Egalité
Egalité<br />
3. Il est urgent d’inverser la tendance…<br />
Dans le contexte d’un capitalisme mondialisé, la tendance générale consiste<br />
à réduire les charges fiscales portant sur les contribuables mobiles<br />
(entreprises, instituts financiers et grosses fortunes notamment), qui peuvent<br />
facilement se déplacer ou déplacer leurs activités sur l’ensemble de<br />
la planète, et à reporter les charges sur les taxes indirectes et les cotisations<br />
sociales, ce qui pèse lourdement sur la consommation des ménages.<br />
La Suisse a largement suivi cette logique au cours des quinze dernières<br />
années, accentuant ainsi les inégalités de revenus et freinant l’activité<br />
économique... En outre, en matière de répartition des richesses, la<br />
Suisse cumule deux gros handicaps: d’une part, des couches aisées et des<br />
entreprises de plus en plus transnationalisées qui accumulent leurs richesses<br />
sur l’ensemble de la planète sans qu’elles profitent à l’ensemble<br />
de la population en Suisse et d’autre part, des dépenses indirectes obligatoires<br />
(fiscalité, cotisations sociales, primes d’assurance-maladie et<br />
loyer) qui ont fortement progressé et diminué le revenu disponible des<br />
couches modestes. Cette accentuation des disparités de revenus a été en<br />
partie atténuée par l’augmentation des dépenses sociales au cours des<br />
années 1990 suite à la forte progression du chômage; cependant, le financement<br />
des dépenses sociales reste peu progressif en Suisse.<br />
Dans la presse et parmi les économistes, il a beaucoup été question de<br />
la faiblesse de la croissance de l’économie suisse au cours de ces dernières<br />
années. A ce propos, le déplacement de la pression fiscale des contribuables<br />
mobiles aux moins mobiles et des contribuables bénéficiant de<br />
revenus élevés à ceux qui ont plutôt de faibles revenus, est aussi une des<br />
raisons de la stagnation économique de ces dernières années, comme le<br />
soulignait une récente étude de la banque Bär (Wochenbericht, No. 18,<br />
12.5.04): »Ce n’est pas la hausse de la quote-part fiscale qui devrait être<br />
tenue pour responsable de la faible croissance économique enregistrée<br />
ces dernières années, mais en première ligne le déplacement de la pression<br />
fiscale relative des contribuables mobiles aux moins mobiles, des<br />
contribuables bénéficiant de revenus élevés à ceux qui ont plutôt de faibles<br />
revenus, du fait d’une hausse significative de la part des impôts indirects<br />
dans la charge fiscale totale.« Outre leur fonction de redistribution<br />
des richesses, de maintien de la cohésion sociale et garantie l’égalité des<br />
chances, les politiques fiscales et sociales contribuent également stimuler<br />
l’activité économique et la croissance, en soutenant la demande.<br />
Literature<br />
Deutscher Gewerkschaftsbund (2004) ›Verteilungsbericht 2003: Umverteilung zu Lasten der<br />
Arbeitnehmer setzt sich fort‹. Berlin (www.dgb.de/themen).<br />
Ecoplan (2004) ›Verteilung des Wohlstands in der Schweiz‹. Bern (www.ecoplan.ch).<br />
40 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Verteilung von Wohlstand<br />
in der Schweiz:<br />
Zur Interpretation einer Studie<br />
»Der Umverteilungsstaat kommt den untersten und den obersten Einkommen<br />
zugute, während der Mittelstand der Leidtragende ist«, so fasst<br />
die Neue Zürcher Zeitung vom 15.6.04 die Ecoplan-Studie1 zusammen.<br />
Die Studie lässt sich jedoch auch <strong>als</strong> Beleg für die Zunahme der sozialen<br />
Ungleichheit interpretieren. Soziale Ungleichheit liegt vor, wenn Mitglieder<br />
einer Gesellschaft oder verschiedener Gesellschaften dauerhaft<br />
in unterschiedlichem Mass über notwendige oder begehrte Güter verfügen.<br />
Es geht dabei nicht um individuelle Unterschiede wie Grösse,<br />
Hautfarbe oder körperliche Kraft, sondern um die Verteilung von Wohlstand,<br />
Ansehen und Macht. Ecoplan (www.ecoplan.ch) analysiert im<br />
Auftrag der Eidgenössischen Steuerverwaltung die Verteilung des Wohlstands<br />
in der Schweiz. Als Grundlage dienen die Einkommens- und<br />
Vermögensverhältnisse in den Jahren 1990 bis 2001.<br />
Wer nur das durchschnittliche Bruttoeinkommen der Haushalte betrachtet,<br />
stellt in den Jahren 1990 bis 2001 ein jährliches Wachstum von<br />
0,6% fest. Bei den untersten und obersten 20% der Einkommen lag der<br />
Anstieg etwas höher, bei Teilen der Mittelschicht etwas tiefer. Ein anderes<br />
Bild zeigt die Entwicklung der verfügbaren Einkommen nach Abzug<br />
der Ausgaben für Versicherungen, Steuern, etc. Diese Einnahmen nahmen<br />
zwischen 1990 und 1999 bei den obersten 10% stark zu, bei den<br />
untersten 10% stark ab. Ein kleiner Aufwärtstrend zeichnete sich bei<br />
einzelnen niedrigen Einkommen nach dem Jahr 1999 ab. Die Einkommensverteilung<br />
(ohne Rentenhaushalte) war aber auch im Jahr 2001<br />
ungleicher <strong>als</strong> 1990.<br />
Bei den Vermögen sind die Unterschiede noch viel ausgeprägter. Die<br />
obersten 20% vereinen über 85% der steuerlich erfassten Vermögen; der<br />
Mittelstand verfügt über 15%. Der<br />
Ueli Mäder<br />
grosse Rest geht leer aus. 3% der<br />
ist ordentlicher Professor für Soziologie an privaten Steuerpflichtigen haben<br />
der Universität Basel und an der Hochschu- in der Schweiz gleich viel steuerle<br />
für Pädagogik und Soziale Arbeit beider bares Nettovermögen wie die<br />
Basel. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die übrigen 97%. Während beispiels-<br />
soziale Ungleichheit und die Konfliktforweise im Kanton Basel-Stadt die<br />
schung. Er leitet dazu mehrere National- durchschnittlichen steuerbaren<br />
fondsprojekte.<br />
Einkommen der veranlagten steu-<br />
41 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gleichheit
Gleichheit<br />
erpflichtigen Haushalte während den 1990er-Jahren von rund 42’000<br />
Franken auf 48’000 Franken stiegen, erhöhte sich das (auf alle Haushalte<br />
umgelegte) steuerbare Durchschnittsvermögen von 83’000 Franken<br />
auf 198’000 Franken. Von den steigenden Vermögen profitierten aber<br />
nur etwa ein Viertel der Haushalte. Sie verfügten 1991 über 360’000<br />
Franken, 1999 über 700’000. Rund drei Viertel der privaten Steuerpflichtigen<br />
haben kein steuerbares Nettovermögen.<br />
Verfügbares Einkommen<br />
Um die Entwicklung der Einkommen beurteilen zu können, sind die frei<br />
verfügbaren Einkommen relevant. Ihr Anteil am Bruttoeinkommen<br />
sank zwischen 1990 und 2001 von 59% auf 55%. Nach dem durchschnittlichen<br />
Äquivalenzeinkommen 2 berechnet, stagnierten die absoluten<br />
Zahlen bei 36’000 Franken. Konkret reduzierten sie sich innerhalb von<br />
11 Jahren trotz leicht steigendem Bruttoeinkommen um 579 Franken.<br />
Nur die 10% reichsten Erwerbshaushalte konnten ihr frei verfügbares<br />
Einkommen in diesem Zeitraum erhöhen. Trotzdem titelt Beat Kappeler<br />
in der NZZ vom 20.6.04: »Die Armen werden nicht immer noch<br />
ärmer«.<br />
Beat Kappeler bezieht sich mit seiner Feststellung auf die untersten<br />
Löhne, die seit 1999 in einzelnen Branchen anstiegen. Im Gastgewerbe<br />
nahmen sie gemäss Gesamtarbeitsverträgen von 2400 Franken auf heute<br />
rund 3100 Franken zu. Im Detailhandel erhöhten sie sich um rund<br />
11%. <strong>Das</strong> ist gewiss bemerkenswert. Aber die Zwangsabgaben haben,<br />
wie die Studie veranschaulicht, »die armen Haushalte stärker getroffen<br />
<strong>als</strong> die reichen«. Deutliche Einkommenseinbrüche zeigen sich auch in<br />
der Mittelschicht. Beat Kappeler bringt hier einen weiteren Einwand an.<br />
Er bezeichnet »das Klagelied über den bedrängten Mittelstand« und die<br />
hohen Mietausgaben <strong>als</strong> Unfug. Denn die Volkszählung belege, »dass<br />
jeder Einwohner heute fünf Quadratmeter mehr bewohnt <strong>als</strong> 1990«. Bei<br />
dieser Argumentation mit dem Durchschnitt bleiben die grossen Unterschiede<br />
ausgeklammert. <strong>Das</strong>s Kappeler, wie von Lebenslagenkonzepten<br />
angeregt, auch das Wohnen in die Analyse einbezieht, ist sinnvoll. Aber<br />
hierbei wäre ebenfalls zu berücksichtigen, wie beispielsweise die Verengung<br />
öffentlicher Lebensräume (durch den zunehmenden Privatverkehr)<br />
die Lebensqualität beeinträchtigt.<br />
Ob sich die Situation bei den unteren Einkommen seit 1999 verbessert,<br />
lässt sich mit der Ecoplan-Studie nicht nachweisen. Die Studie ist,<br />
wie die vier Autoren (André Müller, Michael Marti, Robert Oleschak,<br />
Stephan Osterwald) klar festhalten, »auf die direkten Steuern fokussiert«.<br />
Sie vernachlässigt die indirekten Steuern sowie nicht steuerliche Zwangs-<br />
42 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
abgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden, die das Haushaltseinkommen<br />
reduzieren. Wie das geschieht, kommentiert Markus Schneider<br />
in der Weltwoche Nr. 1, 2004: »Gesenkt werden einige wenige direkte<br />
Steuern zugunsten derjenigen, die direkte Steuern zahlen. Also der<br />
Einkommensstarken. Die ständig steigenden Abgaben und Gebühren<br />
dagegen treffen alle. Resultat ist eine Umverteilung von unten nach oben<br />
– bei der die Linke fröhlich zuschaut. (…) Der kleine Mann und die kleine<br />
Frau bekommen dann die Auswirkungen zu spüren.«<br />
Gehen wir nach der Ecoplan-Studie vom gesamten Haushaltseinkommen<br />
(inkl. Transfereinkommen) pro Äquivalenzperson aus, stellen<br />
wir bei den untersten 10% zwischen 1990 und 1998 eine Zunahme von<br />
22’016 auf 23’919 Franken beziehungsweise eine Steigerung von 8,6%<br />
fest. Die obersten 10% erhöhten sich von 122’110 auf 142’110 Franken<br />
respektive um 17%. Ziehen wir vom gesamten Einkommen die Ausgaben<br />
für Versicherungen (AHV, IV, ALV, Unfall), Krankenkassenprämien,<br />
direkte Bundessteuern, kantonale und kommunale Einkommensund<br />
Vermögenssteuern ab, erhalten wir das verfügbare Einkommen I.<br />
Bei diesem zeigt sich zwischen 1990 und 1998 bei den untersten 10% der<br />
Einkommen ein Rückgang um 1% von 18’329 auf 18’114 Franken, bei<br />
den obersten 10% eine Steigerung von 99’331 auf 114’847 Franken um<br />
15,6%. Ziehen wir noch die Ausgaben für die Pensionskassen, die 3. Säule,<br />
Prämien, Übertragungen (an andere Haushalte) und die Miete der<br />
Erstwohnung ab, ergibt sich beim verfügbaren Einkommen II im selben<br />
Zeitraum bei den untersten 10% ein Rückgang um 15,3% von 14’965 auf<br />
12’682 Franken, bei den obersten 10% eine Steigerung um 12,4% von<br />
82’683 auf 92’932 Franken. Bei den untersten 10% der Einkommen sank<br />
<strong>als</strong>o der Anteil am Bruttoeinkommen von 68% (1990) auf 53% (1998),<br />
bei den obersten 10% von 67,7 auf 65,1%.<br />
Frage der Wahrnehmung<br />
Was einst <strong>als</strong> Grundwiderspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion<br />
und privater Aneignung diskutiert wurde, wird heute selten thematisiert.<br />
Michael Schefczyk stellt in der NZZ vom 3.12.01 eine Entpolitisierung<br />
der Frage fest, nach welchen Regeln gesellschaftlicher Reichtum zu verteilen<br />
sei. Auch in der Sozi<strong>als</strong>trukturforschung verlagert sich der Blick<br />
von der vertikalen auf die horizontale Ebene. Die Klassenmodelle des<br />
19. Jahrhunderts unterschieden die Werktätigen noch recht kategorisch<br />
vom Bürgertum nach dem Kriterium der Verfügungsgewalt über die<br />
Produktionsmittel. Analysen sozialer Klassen und Schichten (Max Weber<br />
und Theodor Geiger) definierten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts<br />
Menschen(gruppen) etwas differenzierter nach äusseren Merk-<br />
43 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gleichheit
Gleichheit<br />
malen (Beruf, Qualifikationen, Einkommen, Besitz) sowie nach inneren<br />
Dispositionen (Einstellungen). Der Blick galt dabei nach wie vor primär<br />
den vertikalen Ungleichheiten. <strong>Das</strong> änderte sich in der zweiten Hälfte<br />
des 20. Jahrhunderts. Seit den 1980er-Jahren beziehen verschiedene<br />
Theorien sozialer (Lebens-)Lagen (Stefan Hradil) nebst materiellen<br />
Ressourcen das subjektive Wohl (Lebenszufriedenheit) stärker ein. Die<br />
horizontalen Ungleichheiten stehen auch bei den Modellen sozialer<br />
Milieus im Vordergrund, die sich seit den 1990er-Jahren verbreiten und<br />
auf Menschen beziehen, welche sich in der Lebensauffassung und Lebensweise<br />
ähneln und quasi subkulturelle Einheiten innerhalb der Gesellschaft<br />
bilden. Grosse Bedeutung kommen hierbei der gemeinsamen<br />
Wertorientierung und dem Lebensstil zu. Die Lagen- und Milieuanalysen<br />
weisen gewiss auf wichtige Differenzierungen hin. Sie laufen aber<br />
Gefahr, trotz krasser gesellschaftlicher Gegensätze die Frage sozialer<br />
Klassen zu vernachlässigen und eine Entwicklung zu suggerieren, die<br />
von Klassen und Schichten zu Lagen und Milieus führe.<br />
Gerhard Schulze kommt in seiner Studie über ›Die Erlebnisgesellschaft‹<br />
3 zum Schluss, dass die Suche nach Glück die Sorge um das<br />
materielle Überleben abgelöst hat und die horizontal strukturierten<br />
Erlebnismilieus eine immer grössere Bedeutung erlangen. <strong>Das</strong> erlebnisorientierte<br />
Denken ersetzt laut Schulze das produkteorientierte. Beim<br />
erlebnisorientierten geht es mehr um den subjektiven Nutzen, beim<br />
produkteorientierten um den materiellen. Der Hobbygärtner löst mit<br />
seinem Ziergarten die Bäuerin mit ihren Kartoffeln ab. Dem Reich der<br />
Notwendigkeit folgt das Reich der Freiheit, der Leistungs- die Personenorientierung,<br />
dem Haben das Sein. Der Alltag wird zur Lebensbühne<br />
und zur Verlängerung der Innenwelt. Symbolwelten scheinen somit frei<br />
wählbar zu sein. Gesellschaft verkommt zur Episode. Nach Pierre Bourdieu<br />
beeinflussen hingegen mehr die äusseren Faktoren die Denk- und<br />
Handlungsmuster beziehungsweise den Habitus eines Menschen, wobei<br />
er die sozialen Klassen nicht einfach ökonomisch herleitet. 4 Es gibt auch<br />
»Die feinen Unterschiede«. 5 Sie äussern sich über Titel, Kleidung, Sprache,<br />
Manieren und den Geschmack. Der Lebensstil ist nicht beliebig. Er<br />
folgt dem sozialen Rang, der mitentscheidet, wie man grilliert, den<br />
Hausflur gestaltet oder den Tisch deckt. Bourdieu sieht die Bedeutung<br />
sozialer Milieus. Er orientiert sich aber auch an der Marx’schen Tradition,<br />
nach welcher das Sein das Bewusstsein bestimmt. Schulze hält sich<br />
(im Kontext der Individualisierung) indes mehr an Soziologe Ulrich<br />
Beck, der die »Reflexive Modernisierung« 6 unter anderem dadurch<br />
kennzeichnet, dass das Bewusstsein das Sein prägt.<br />
44 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Soziale Brisanz<br />
In stark individualisierten Gesellschaften wie der Schweiz wahren viele<br />
sozial Benachteiligte nach aussen den Schein, alles sei, wie es sein müsse.<br />
Sie strecken sich nach der Decke und geben den Stress weiter, den<br />
sie bei der Arbeit, auf der Stellensuche oder auf dem Sozialamt erleben.<br />
<strong>Das</strong> Treten nach unten ist ein bekanntes Muster. Wer sich ohnmächtig<br />
fühlt, empfindet das Bessere zuweilen <strong>als</strong> Bedrohung. Es fordert zum<br />
Handeln auf, von dem befürchtet wird, dass es scheitern und weitere<br />
Defiziterfahrungen mit sich bringen könnte. Konsumorientierte Verhaltensmuster<br />
bieten imaginäre Sicherheiten, wie Psychoanalytiker Horst-<br />
Eberhard Richter 7 beschreibt. Sie stützen die Konformität. Knappheit<br />
verstärkt auch die rivalitätsbezogene Sozialisation. Sie ist ein Nährboden<br />
für Ressentiments. Ständiger Aktivitätsdruck entspricht dem dominanten<br />
Leistungsideal: Was helfen könnte, macht Angst. So halten auch<br />
Familien mit niedrigen Einkommen an den Normen der Konkurrenz<br />
fest. Sie verteidigen die Vorbilder der Anpassung. <strong>Das</strong> betrifft auch die<br />
über 200’000 Kinder, die in den 250’000 Working-poor-Haushalten<br />
leben.<br />
Die Überforderung erhöht die Labilität des Selbstwertes. Der Normkodex,<br />
an dem das heranwachsende Kind sein Verhalten misst, übersteigt<br />
seine realen Möglichkeiten. Ängste der Eltern übertragen sich. <strong>Das</strong><br />
stellten wir in der Studie ›Armut im Kanton Basel-Stadt‹ 8 und teilweise<br />
auch in der Untersuchung über ›Working poor in der Schweiz‹ 9 fest. Bei<br />
den jüngsten Gesprächen mit erwerbstätigen Armen fiel uns indes auf,<br />
wie empört viele (erwerbstätige) Arme auf soziale Ungleichheiten reagieren.<br />
Sie kritisieren beispielsweise die hohen Managerlöhne und den<br />
Mangel an Lehrstellen. Die vorhandene Wut deutet auf eine Veränderung<br />
hin. Vielleicht führt sie von der Resignation zum gewerkschaftlichen<br />
Engagement? Die verbreitete Verunsicherung kann aber auch die<br />
Bereitschaft fördern, zu simplifizieren statt zu differenzieren und Halt bei<br />
autoritären, (neo-)populistischen Kreisen zu suchen. Die soziale Ungleichheit<br />
verschärft diese Gefahr, der soziale Ausgleich vermindert sie.<br />
45 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gleichheit
Gleichheit<br />
Literatur<br />
Beck, Ulrich, Anthony Giddens, Scott Lash (1996) ›Reflexive Modernisierung‹. Frankfurt/M.<br />
Bourdieu, Pierre (1997) ›<strong>Das</strong> Elend der Welt‹. Konstanz.<br />
Bourdieu, Pierre (1987) ›Die feinen Unterschiede‹. Frankfurt/M.<br />
Carigiet, Erwin, Ueli Mäder, Jean-Michel Bonvin (2003) ›Wörterbuch der Sozialpolitik‹. Zürich.<br />
Ecoplan (2004) ›Verteilung des Wohlstands in der Schweiz‹. Bern.<br />
Geissler, Rainer (2001) ›Facetten der modernen Sozi<strong>als</strong>truktur‹. In: Victoria Jäggi, Ueli Mäder,<br />
Katja Windisch (Hg.) ›Entwicklung, Recht, Sozialer Wandel. Social Strategies, Vol. 35‹.<br />
Bern, 537–553.<br />
Mäder, Ueli (1999) ›Für eine solidarische Gesellschaft‹. Zürich.<br />
Mäder, Ueli, Elisa Streuli (2002) ›Reichtum in der Schweiz‹. Zürich.<br />
Kutzner, Stefan, Ueli Mäder, Carlo Knöpfel (2004) ›Working poor in der Schweiz – Wege aus<br />
der Sozialhilfe‹. Zürich.<br />
Mäder, Ueli, Franziska Biedermann, Barbara Fischer, Hector Schmassmann (1991) ›Armut<br />
im Kanton Basel-Stadt. Social Strategies, Vol. 23‹, Basel.<br />
Richter, Horst-Eberhard (2002) ›<strong>Das</strong> Ende der Egomanie‹. Köln.<br />
Schulze, Gerhard (2000) ›Die Erlebnisgesellschaft‹. Frankfurt/M-New York.<br />
Wächter, Matthias (2004) ›Für eine solidarische Gesundheitspolitik‹. Bern.<br />
Anmerkungen<br />
1 vgl. Ecoplan 2004.<br />
2 Damit die Haushalte verschiedener Grösse untereinander vergleichbar sind, weist die<br />
Ecoplan-Studie die Einnahmen pro Äquivalenzperson bzw. für einen Ein-Personen-<br />
Haushalt aus. Die Umrechnung geschieht mit einer Skala, die davon ausgeht, dass jede<br />
zusätzliche Person in einem gemeinsamen Haushalt nicht dieselben Kosten verursacht<br />
wie die erste Person.<br />
3 vgl. Gerhard Schulze 2004.<br />
4 vgl. Pierre Bourdieu 1997.<br />
5 vgl. Pierre Bourdieu 1987.<br />
6 vgl. Ulrich Beck et al. 1996.<br />
7 vg. Horst-Eberhard Richter 2002.<br />
8 vgl. Ueli Mäder et al. 2004.<br />
9 vg. Stefan Kutzer et al. 2004.<br />
46 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
<strong>Das</strong> Projekt Gleichheitsmonitor<br />
<strong>Das</strong> Umfeld<br />
In den wirtschafs- und sozialpolitischen Debatten spielen statistische<br />
Indikatoren und internationale Vergleiche eine zentrale Rolle.<br />
Im so genannten Bench-marking werden nationale Volkswirtschaften<br />
miteinander verglichen und hinsichtlich ihrer ›Wettbewerbsfähigkeit‹<br />
bewertet. Die Berichte der OECD sind hier nur das bekannteste Beispiel.<br />
Die statistische Methode täuscht dabei eine ›wissenschaftliche‹<br />
Präzision vor, die sie so nicht garantieren kann. Von der Auswahl der<br />
Indikatoren und Vergleichsbeispiele über die Interpretation der Resultate<br />
bis hin zu auf den auf diesem Wissen aufbauenden politischen Strategien<br />
gibt es einen grossen Spielraum für unterschiedliche Sichtweisen.<br />
Entsprechend der Hegemonie des Neoliberalismus dominiert heute die<br />
neoliberale Sichtweise, die in der Förderung des ›Wettbewerbs‹, in der<br />
Deregulierung und Privatisierung des öffentlichen Sektors und der Herstellung<br />
eines ›flexiblen‹ Arbeitsmarkts den Univers<strong>als</strong>chlüssel für wirtschaftlichen<br />
und sozialen Erfolg sieht.<br />
Rita Soland<br />
1952, lic. phil. I, Management Weiterbildung<br />
an der Universität Zürich, Ausbildung<br />
in Qualitätsmanagement und Mediation;<br />
selbständige Beraterin (u.a. im Bereich der<br />
familienergänzenden Kinderbetreuung)<br />
und Mediatorin.<br />
Hans Baumann<br />
1948, lic. rer. pol. MAES, Ökonom der Gewerkschaft<br />
Unia.<br />
Adrian Zimmermann<br />
1974, lic. phil., Historiker, Forschungsassistent<br />
im EU-Projekt ›Konsensorientierte<br />
politische Kulturen in kleinen westeuropäischen<br />
Staaten‹ (Smallcons); Forschungsschwerpunkte:<br />
Geschichte der Arbeiterbewegung,<br />
Wirtschaftsverbände, Geschichte<br />
der Geschichts- und Sozialwissenschaften,<br />
Klassenformierung, Marxismus, Nation<br />
und Nationalismus, Wirtschaftsdemokratie,<br />
Archiv- und Informationswissenschaften.<br />
47 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gleichheit<br />
<strong>Das</strong> Ziel<br />
Auch der Gleichheitsmonitor will<br />
die Schweiz in Bezug auf statistische<br />
Schlüsselindikatoren international<br />
vergleichen. Damit soll<br />
ebenfalls ein Bench-marking angestrebt<br />
werden, aber in die andere<br />
Richtung: Wie sieht eigentlich<br />
die Lage der Lohnabhängigen in<br />
Bezug auf Löhne, Arbeitszeiten,<br />
Organisationsgrad, soziale Sicherheit,<br />
Kaufkraft (Mieten, Krankenkassenprämien!)<br />
im internationalen<br />
Vergleich aus? Ist die Schweiz<br />
<strong>als</strong> Arbeits- und Lebensort überhaupt<br />
so attraktiv, wie immer wieder<br />
behauptet wird? Wie stark<br />
sind die Ungleichheiten aufgrund<br />
des Geschlechts, der nationalen<br />
Herkunft und des Alters? Welchen<br />
Anteil am Volkseinkommen machen<br />
die Löhne, welchen die Ka-
Gleichheit<br />
pitaleinkünfte aus? Welcher Anteil am Vermögen und Einkommen<br />
gehört welchem Anteil der Bevölkerung?<br />
Die Methode<br />
Zum grössten Teil werden wir dabei mit den vorhandenen Statistiken<br />
arbeiten müssen, diese aber in einer anderen Form bündeln – eben im<br />
Hinblick auf die Analyse der Ungleichheit in der Schweiz und im internationalen<br />
Vergleich. Weiter könnte der Gleichheitsmonitor auch Interpretationshilfen<br />
zu einigen Indikatoren wie etwa der Soziallastquote<br />
geben, mit denen oft in einer manipulativen Weise operiert wird.<br />
Ein neues Element, das wir prüfen wollen, sind auch einzelne ausgewählte<br />
Personen oder Haushalte, die wir jährlich nach ihrem Einkommen,<br />
sozialen Status etc. befragen oder befragen lassen, um so beispielhaft<br />
Veränderungen aufzuzeigen. <strong>Das</strong> Resultat würde <strong>als</strong> Porträt der Personen<br />
und Haushalte publiziert. Damit würden hinter der trockenen<br />
Statistik lebendige Menschen sichtbar.<br />
48 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Vorschlag für eine Indikatorenreihe<br />
<strong>Das</strong> Ziel wäre, im Jahrbuch wie auch auf der Website des <strong>Denknetz</strong>es<br />
eine Indikatorenreihe über Gleichheit/Ungleichheit respektive soziale<br />
Kohäsion/Ausgrenzung zu führen, die jährlich nachgeführt wird und bei<br />
einzelnen ausgewählten Reihen auch internationale Vergleiche erlaubt.<br />
Die Vorschläge (Tabelle Seite 48) für eine Indikatorenreihe sind weder<br />
abschliessend noch umfassend. Dabei kann es sich natürlich nur um<br />
eine Zusammenstellung bestehender, bereits erhobener Indikatoren<br />
handeln, die wir dann kommentieren. Auch müssen wir sicher eine Auswahl<br />
treffen, damit der Aufwand zu bewältigen ist.<br />
Die Strategische Funktion<br />
Nirgends in Europa setzte sich im 19. Jahrhundert das Bürgertum so<br />
stark durch wie in der Schweiz. Die nahezu vollständige Überwindung<br />
eines feudal-aristokratischen Ständedenkens (teilweise auch schon in der<br />
alten Eidgenossenschaft) und die aufgrund der anfänglich ländlich-dezentralen<br />
Industrialisierung relativ spät einsetzende Formierung einer<br />
klassenbewussten Arbeiterschaft führte dabei zu einer paradoxen Situation:<br />
Zwar gibt es wegen der grossen Macht des Bürgertums traditionellerweise<br />
eine grosse materielle Ungleichheit in unserem Land, die<br />
aber wegen des ursprünglich aus derselben (klein-)bürgerlichen Tradition<br />
stammenden, landesüblichen egalitären Umgangs weniger stark<br />
wahrgenommen wird <strong>als</strong> in anderen Ländern. Der Gleichheitsmonitor<br />
will einerseits gerade an der starken Verankerung des Gleichheitsgedankens<br />
in der Schweiz anknüpfen und diese wieder stärken, andrerseits<br />
aber auch zeigen, dass diese wahrgenommene Gleichheit mit einer von<br />
wachsender sozialer Ungleichheit geprägten Realität kontrastiert. Damit<br />
soll klar werden, wie notwendig eine demokratische Kontrolle wirtschaftlicher<br />
Macht und eine Umverteilung der Einkommen und Vermögen<br />
geworden ist, die in der Schweiz allzu lange mit dem Hinweis auf<br />
die angeblich egalitären Verhältnisse abgeblockt worden sind.<br />
49 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gleichheit
Gesundheitspolitik<br />
Die gesundheitspolitische Debatte<br />
in der Schweiz<br />
Fakten und Scheinargumente<br />
Anfang Juni 2005 gab Bundesrat Couchepin den Ausschluss eines Grossteils<br />
der so genannten komplementär-medizinischen Therapien aus der<br />
obligatorischen Krankenversicherung bekannt. Er setzte sich damit über<br />
die vorherrschenden Einschätzungen der ExpertInnen hinweg und<br />
missachtete die Ergebnisse der Studien, die der Bundesrat vor fünf Jahren<br />
selbst in Auftrag gegeben hatte. Die ganze Geschichte könnte <strong>als</strong><br />
Posse abgetan werden, gäbe es nicht Hinweise, dass hinter den Kulissen<br />
bedeutsame Veränderungen im Gange sind. So war einige Wochen vor<br />
der Bekanntgabe von Couchepins Entscheid den AutorInnen der bundesrätlichen<br />
Studien unter Strafandrohung verboten worden, die den<br />
Studien zugrunde liegenden Daten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen,<br />
ja sie sollten sogar verpflichtet werden, die Daten vollumfänglich<br />
der Bundesverwaltung zu überlassen. Und kaum war Couchepins Entscheid<br />
publik, warb die Krankenkasse Groupe Mutuel in ganzseitigen<br />
Inseraten für Zusatzversicherungen, die die aus der Grundversicherung<br />
ausgeschlossene Komplementärmedizin abdecken. Was man dabei<br />
wissen muss: Die Kassen dürfen im Grundversicherungsbereich keinen<br />
Gewinn erzielen, im Bereich der Zusatzversicherungen hingegen sehr<br />
wohl. Und Couchepin war vor seinem Eintritt in den Bundesrat selbst<br />
Verwaltungsratsmitglied von Groupe Mutuel.<br />
Mehr Gewinnorientierung im Gesundheitswesen?<br />
Der Ausschluss der Komplementärmedizin ist Bestandteil einer umfassenden<br />
Strategie, die von massgebender bürgerlicher Seite in der Gesundheitspolitik<br />
seit einigen Jahren verfolgt wird. Erklärtes Ziel: Mehr<br />
Marktwirtschaft im Gesundheitswesen und die schrittweise Einführung<br />
der differenzierten medizinischen Versorgung à la carte. Wobei das<br />
Risiko einer Zweiklassenmedizin ganz bewusst in Kauf genommen wird.<br />
Weitere Elemente dieser Strategie sind:<br />
• Die Ausdünnung des Leistungskataloges<br />
der Grundversicherung<br />
Beat Ringger<br />
soll in den Bereichen Schulmedi- 1955, Zentr<strong>als</strong>ekretär vpod und geschäftszin<br />
und Psychotherapie weiter geleitender Sekretär des <strong>Denknetz</strong>es. Inteführt<br />
werden – der Ausschluss von ressensschwerpunkte: Gesundheits- und<br />
vier komplementär-medizinischen Sozialpolitik, politische Ökonomie, Psycho-<br />
Therapien war <strong>als</strong>o nur der An- logie und Fragen der Ideologiebildung.<br />
50 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
fang. Diese Politik wird von Bundesrat Couchepin und seinem neuen<br />
Vizedirektor im Bundesamt für Gesundheit, Hans-Ulrich Brunner, mit<br />
Vehemenz vorangetrieben. Die beiden scheuen sich dabei nicht, an<br />
(über?) die Grenzen der zulässigen Interpretation der einschlägigen gesetzlichen<br />
Bestimmungen zu gehen.<br />
• In den meisten Kantonen sollen die öffentlichen Spitäler zu ›Unternehmen‹<br />
gemacht werden – durch die Überführung in eine Aktiengesellschaft<br />
oder in eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Im Kanton Bern<br />
wurde gar versucht, für sämtliche Spitäler gesetzlich festzulegen, dass<br />
einer privaten Trägerschaft grundsätzlich Vorrang vor einer öffentlichen<br />
Trägerschaft einzuräumen sei. Dieses Vorhaben wurde von den StimmbürgerInnen<br />
an der Urne allerdings mit einer Zweidrittel-Mehrheit deutlich<br />
verworfen.<br />
• Privatspitäler sollen den öffentlichen Spitälern gleichgestellt werden,<br />
ohne dass sie in gleicher Weise zur medizinischen Grundversorgung<br />
beitragen. Dies führt zur Rosinenpickerei: Privatspitäler sichern sich<br />
lukrative Leistungen, aufwändige Therapien werden den öffentlichen<br />
Spitälern überlassen.<br />
• Die Stellung der privaten Krankenkassen wird erheblich gestärkt: Sie<br />
sollen künftig auswählen können, mit welchen ÄrztInnen sie Verträge<br />
eingehen und mit welchen nicht (Aufhebung des so genannten Kontrahierungszwangs).<br />
Ärzte ohne Vertrag können ihre Leistungen nicht<br />
mehr mit der entsprechenden Kasse abrechnen. Die Kassen sollen<br />
zudem gegenüber allen Leistungserbringern (Spitäler, Spitex, Kliniken,<br />
Arztpraxen) <strong>als</strong> einzige zahlende Organisation auftreten (Monismus).<br />
Kantone und andere öffentliche Trägerschaften würden ausgebootet<br />
und müssten ihre Finanzierungsanteile den Kassen übertragen.<br />
• Die Folge: Ein erheblicher Machtzuwachs für die Kassen, der noch<br />
beträchtlich gesteigert werden könnte, falls in einem zweiten Schritt auch<br />
gegenüber Spitälern und Kliniken der Kontrahierungszwang aufgehoben<br />
würde, worüber bereits diskutiert wird. Denn die Leistungserbringer<br />
sollen gegenüber den so gestärkten Krankenkassen zum Wettbewerb<br />
gezwungen werden. Die Kassen berücksichtigen dann diejenigen Institutionen,<br />
die die Leistung am kostengünstigsten erbringen. Dies könnte<br />
unabsehbare Folgen für die Qualität der Leistungen haben.<br />
• Unter dem Stichwort ›Managed Care‹ sollen auch in der ambulanten<br />
Versorgung Institutionen (Health Maintenance Organisations, HMO)<br />
gefördert werden, die nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen arbeiten:<br />
Die Vergütung der HMO-Leistungen soll ermöglichen, dass die HMO<br />
gewinnorientiert arbeiten können.<br />
• Die Kostenbeteiligung der PatientInnen an den Leistungen soll von<br />
51 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gesundheitspolitik
Gesundheitspolitik<br />
10% auf 20% angehoben werden (bei einer jährlichen Obergrenze von<br />
Fr. 700.–).<br />
Die letzten vier Punkte sind Bestandteile der bundesrätlichen Vorlagen<br />
zur Revision des Krankenversicherungsgesetzes (KVG). <strong>Das</strong> KVG<br />
stellt die in der Schweiz massgebende Grundlage zur Regulierung des<br />
Gesundheitswesens dar.<br />
<strong>Denknetz</strong>-Fachgruppe Gesundheitspolitik<br />
Diese Ausgangslage hat eine Reihe von Gesundheitsfachleuten bewogen,<br />
sich zu einer <strong>Denknetz</strong>-Fachgruppe Gesundheitspolitik zu formieren.<br />
Die Fachgruppe legt nun im vorliegenden <strong>Denknetz</strong>-Jahrbuch eine<br />
sozialpolitisch fortschrittliche Reformagenda für das Schweizer Gesundheitswesen<br />
vor. Diese Reformagenda soll dazu beitragen, dass die Linke<br />
über gemeinsame Bezugspunkte im Richtungskampf um die Zukunft der<br />
Gesundheitspolitik verfügt.<br />
Dies ist heute unumgänglich. Denn bei einigen kantonalen Abstimmungsvorlagen<br />
zu Spitalauslagerungen und -privatisierungen ist die<br />
Linke gespalten: Wiederholt legten sozialdemokratisch oder grün geführte<br />
Gesundheitsdepartemente entsprechende Abstimmungsvorlagen<br />
vor, und die gesundheitspolitischen Diskussionen innerhalb der Linken<br />
sind oft von Unsicherheiten geprägt.<br />
Ein weiterer Artikel beleuchtet die Entwicklung des Gesundheitswesens<br />
in den USA. Dort lässt sich exemplarisch verfolgen, was geschieht,<br />
wenn privates Kapital in breitem Masse ins Gesundheitswesen eindringen<br />
kann. Der Artikel wurde anlässlich einer Vortragstournee verfasst,<br />
die der vpod im März 2005 mit dem bekannten Kritiker des US-Gesundheitswesens,<br />
Prof. David Himmelstein von der Harvard Medical<br />
School, durchgeführt hat.<br />
<strong>Das</strong> schweizerische Gesundheitswesen:<br />
Gut und vergleichsweise gerecht im Zugang…<br />
Die Gesundheitsversorgung in der Schweiz gilt <strong>als</strong> qualitativ gut bis hervorragend.<br />
Auch bezüglich der Zugänglichkeit der Leistungen für alle<br />
sozialen Schichten schneidet die Schweiz in internationalen Vergleichsstudien<br />
gut ab. Zwar korreliert das Einkommen in allen Ländern mit<br />
dem Zugang zur Gesundheitsversorgung: je höher das Einkommen,<br />
desto besser der Zugang. Eine umfangreiche empirische Untersuchung<br />
in acht Ländern ergab jedoch, dass die Schweiz – zusammen mit Irland<br />
und den Niederlanden – diesbezüglich die geringsten Ungleichheiten<br />
aufweist. Unser Gesundheitswesen ist für alle Schichten vergleichsweise<br />
gut zugänglich. 1<br />
52 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Auch ein Forschungsprojekt von Robert E. Leu und Martin Schellhorn<br />
im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 45 kommt zu ähnlichen<br />
Ergebnissen. In dieser Untersuchung zeigte sich nur bei der<br />
Inanspruchnahme von ärztlichen SpezialistInnen ein signifikanter Unterschied:<br />
Reiche suchen häufiger SpezialärztInnen auf <strong>als</strong> weniger Reiche.<br />
Hingegen besuchen Einkommensschächere häufiger allgemein<br />
praktizierende Ärzte. 2 Leu zitiert zudem eine Studie von Doorslaer und<br />
Koolmann, laut der Einkommen und Gesundheit zwar in allen 13 untersuchten<br />
europäischen Ländern auseinanderdriften, am wenigsten<br />
aber in der Schweiz, den Niederlanden und in Deutschland. 3<br />
Seit 1996 ist in der Schweiz das Krankenversicherungsgesetz (KVG)<br />
in Kraft, das durch drei positive Bestimmungen heraussticht:<br />
• <strong>Das</strong> KVG beinhaltet ein Versicherungsobligatorium, das heisst, sämtliche<br />
in der Schweiz wohnhaften Personen müssen sich gegen Krankheit<br />
bei einer anerkannten Kasse versichern.<br />
• Durch die Grundversicherung werden alle Leistungen abgedeckt, die<br />
medizinisch sinnvoll sind. Dieser so genannte Grundkatalog ist offen<br />
(nicht abschliessend), das heisst, neue Verfahren, die wirkungsvoll sind,<br />
werden nach Überprüfung in den Katalog aufgenommen<br />
• Die Krankenkassen dürfen in der Grundversicherung nur ein einheitliches<br />
Angebot offerieren, und die Leistungen der Grundversicherung<br />
dürfen in der ganzen Schweiz nur zu einem einheitlichen Tarif erbracht<br />
werden (Tarifschutz).<br />
In der Schweiz sind zudem die wichtigsten und qualitativ besten<br />
Spitäler in der Regel in öffentlicher Hand und damit einer guten Grundversorgung<br />
verpflichtet. Diese Faktoren stützen die gute Qualität und die<br />
vergleichsweise egalitäre Zugänglichkeit des Schweizer Gesundheitssystems.<br />
Natürlich spiegeln sich soziale und kulturelle Ungleichheiten<br />
innerhalb der Gesellschaft auch in der Gesundheitsversorgung. Ein<br />
eloquenter Hochschullehrer hat bessere Aussichten, die Behandlung<br />
nach seinen Bedürfnissen und Präferenzen zu beeinflussen, <strong>als</strong> eine<br />
Reinigungsfachfrau kroatischer Herkunft, die nur über wenig Deutschkenntnisse<br />
verfügt.<br />
<strong>Das</strong> Schweizer Gesundheitssystem scheint jedoch nicht zusätzlich<br />
diskriminierend zu wirken, das heisst, es enthält bislang keine gravierenden<br />
Mechanismen zur Vergrösserung sozialer Unterschiede. Die<br />
Reinigungsfachfrau und der Marketingmanager können damit rechnen,<br />
im Spital ähnlich gut (oder mitunter auch weniger gut) versorgt zu<br />
werden, was den medizinisch-therapeutischen Bereich betrifft. Die privatrechtlichen<br />
Zusatzversicherungen – die nicht im KVG geregelt sind<br />
– betreffen vorab die Hotellerie und dürfen zu keinen relevanten<br />
53 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gesundheitspolitik
Gesundheitspolitik<br />
Unterschieden in der medizinischen Betreuung führen. Einzig die<br />
Möglichkeit, sich via Zusatzversicherung einen Belegarzt für operative<br />
Eingriffe aussuchen zu können, verletzt dieses Gleichheitsgebot.<br />
In der Schweiz gibt es zurzeit noch keine Zweiklassenmedizin, und<br />
es ist in den gesundheitspolitischen Diskursen von grosser Bedeutung,<br />
diese sozialpolitische Errungenschaft hervorzuheben. Es ist deshalb<br />
heikel, heute bestehende soziale Mängel mit einer Zweiklassenmedizin<br />
gleichzusetzen – dies könnte dazu beitragen, den Widerstand gegen Abbauvorhaben<br />
zu verwässern. Wenn beispielsweise die Zürcher Regierungsrätin<br />
Verena Diener erklärt, die Schweiz habe ja schon eine Zweiklassenmedizin,<br />
so möchte sie damit ihre Spar- und Abbaumassnahmen<br />
rechtfertigen, die eine Schlechterbehandlung von ›nur‹ grundversicherten<br />
gegenüber privat versicherten PatientInnen zur Folge haben.<br />
…aber mit Umsetzungslücken und unsozialer Finanzierung<br />
Die Umsetzung des KVG wird in einem wichtigen Punkt von den bürgerlichen<br />
Mehrheiten in den eidgenössischen Räten seit bald 10 Jahren<br />
verzögert. Dies betrifft die Pflegefinanzierung. <strong>Das</strong> KVG sichert nämlich<br />
eine umfassende Finanzierung jeglicher Form der Pflege durch die Kassen,<br />
nicht nur im Akutbereich (Spitäler), sondern auch in der Langzeitpflege.<br />
Die Pflegeheime wurden deshalb Mitte der 90er-Jahre beauftragt,<br />
die Pflegekosten klar von den Hotelleriekosten abzugrenzen und damit<br />
die datenmässigen Grundlagen für die Entgeltung durch die Kassen zu<br />
schaffen. Dabei wurde klar, dass diese Kosten deutlich höher ausfallen<br />
würden <strong>als</strong> ursprünglich angenommen. Deshalb verlängerte das Parlament<br />
wiederholt eine Übergangsregelung. Gemäss dieser Regelung<br />
müssen die Kassen in der Langzeitpflege lediglich 20% der Pflegekosten<br />
vergüten.<br />
Allerdings ist es sozialpolitisch brisant, möglichst viele Leistungen<br />
von den Krankenkassen abdecken zu lassen. Denn – und das ist der<br />
Hauptmangel des schweizerischen Gesundheitssystems – die Kassen<br />
erheben bei ihren Mitgliedern eine Kopfprämie, deren Betrag lediglich<br />
vom Wohnort und von der Kassenwahl abhängt, nicht aber von der Einkommens-<br />
oder Vermögenslage.<br />
Diese Kopfprämie ist europaweit einmalig. In keinem anderen Land<br />
wird die Gesundheitsversorgung derart unsozial finanziert. Die Finanzierung<br />
erfolgt in andern Ländern über Lohnprozente (gut Verdienende<br />
bezahlen mehr) oder über Steuererträge. Diese unsoziale Finanzierung<br />
wird auch von der World Health Organisation (WHO)bemängelt und<br />
hat dazu geführt, dass die Schweiz im internationalen Ranking bezüglich<br />
der Gesundheitsversorung lediglich auf Rang 20 figuriert. 4<br />
54 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Eine ›Kostenexplosion‹, die nie stattgefunden hat<br />
Die gesundheitspolitische Situation präsentiert sich <strong>als</strong>o wie folgt: Eine<br />
in weiten Teilen sozial ausgestaltete Leistungserbringung mit unsozialer<br />
Finanzierung wird von rechts unter Beschuss genommen mit dem Ziel,<br />
das System für gewinnorientierte Anbieter zu öffnen. Dabei wird die<br />
Kostenfrage ins Zentrum gerückt und behauptet, mehr Markt werde entscheidend<br />
dazu beitragen, die Kosten in den Griff zu bekommen. <strong>Das</strong>s<br />
dem nicht so ist, zeigt der Vergleich mit dem US-Gesundheitswesen<br />
(siehe Beitrag Seite 69).<br />
Vor allem aber hat die monierte Kostenexplosion gar nie stattgefunden.<br />
Die Steigerung der Gesundheitskosten betrug in der Schweiz in den<br />
Jahren 1990 bis 2001 durchschnittlich 2.4% und liegt damit deutlich<br />
unter dem Durchschnitt der OECD-Länder mit 3.4%. Dennoch ist der<br />
Anteil der Gesundheitskosten am Bruttoinlandprodukt mittlerweile auf<br />
über 11% gestiegen. Die Schweiz liegt damit hinter den USA deutlich<br />
über 14%) auf Rang zwei, knapp vor Deutschland. Dies hat aber ausschliesslich<br />
damit zu tun, dass das Wachstum des BIP in keinem anderen<br />
OECD-Land in der fraglichen Periode so tief ausgefallen ist wie in<br />
der Schweiz. Es betrug hierzulande im Jahresdurchschnitt 1990 bis 2001<br />
lediglich 0.2%. 5<br />
Allerdings ist eine andere, für die NormalbürgerInnen ganz wesentliche<br />
Kenngrösse tatsächlich explodiert: Die Krankenkassenprämien. Sie<br />
sind vor allem in den Jahren 1995 bis 99 ausser Kontrolle geraten, und<br />
erst durch diese Prämienexplosion entstand der Eindruck einer Kostenexplosion.<br />
Die Unterscheidung zwischen Prämien- und Kostenexplosion<br />
wird aber nur sehr selten gemacht, weil der Eindruck einer Kostenexplosion<br />
den politischen Zielen einer Spar- und Privatisierungspolitik<br />
die notwendige Begründung liefert. Die scheinbare Kostenexplosion ist<br />
das Generalargument schlechthin, mit der die bürgerliche Seite ihre<br />
Reformvorschläge begründet.<br />
Dabei ist die Diskrepanz in der Lastenverteilung enorm. In den Kantonen<br />
Basel-Stadt und Basel-Land sind die Kassenprämien zwischen<br />
1995 und 1999 um rund 80% gestiegen, die Leistungen der Kassen<br />
jedoch im gleichen Zeitraum lediglich um rund 20%. Für den Kanton<br />
Zürich lauten die Zahlen ähnlich: Anstieg der Prämien um 70%, der<br />
Leistungen ebenfalls nur um 20%. 6 Woher aber rührt diese Diskrepanz?<br />
Der Grund liegt in der Art, wie die Prämienverbilligungen durch das<br />
KVG geregelt sind. Vor der Einführung des KVG liess der Bund den<br />
Kassen wesentliche Beiträge zur Verbilligung der Prämien direkt zukommen.<br />
Mit der Einführung des KVG zog er sich von dieser Aufgabe<br />
zur Hälfte zurück. Die neue Regelung besagt, dass die Kantone das Mass<br />
55 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gesundheitspolitik
Gesundheitspolitik<br />
der Verbilligung bestimmen und dabei die Hälfte der Finanzierung<br />
mittragen müssen. Viele Kantone gaben in der Folge unter dem allgemeinen<br />
Spardruck weitaus weniger Verbilligungsbeiträge frei <strong>als</strong> vom<br />
Gesetzgeber angenommen. Die Kantone verzichteten lieber auf die<br />
Bundesanteile von 50%, nur um selbst möglichst geringe Ausgaben tätigen<br />
zu müssen. Die Leidtragenden sind die PrämienzahlerInnen: <strong>Das</strong><br />
Verhalten der Kantone führte zu einem massiven Rückgang der Staatsanteile<br />
an den Prämien, weshalb diese so massiv gestiegen sind.<br />
Eine fehlgeleitete Diskussion über ›Kostentreiber‹<br />
Wie kommt es grundsätzlich zur Kostensteigerung im Gesundheitswesen,<br />
die auch in der Schweiz feststellbar ist (wenn sie auch geringer ausfällt<br />
<strong>als</strong> in anderen Ländern und vor allem <strong>als</strong> von bürgerlicher Seite<br />
behauptet)? Meist werden dafür zwei Gründe angeführt.<br />
1. Da die Medizin laufend technische und pharmazeutische Fortschritte<br />
mache, liessen sich immer mehr Krankheiten und Unfallfolgen<br />
heilen – allerdings bei massiv zunehmenden Kosten. Insbesondere die<br />
Spitzenmedizin sei daran in hohem Masse beteiligt. Diese Argumentation<br />
verkennt, dass viele technische Fortschritte zu wesentlichen Einsparungen<br />
geführt haben (und auch in Zukunft führen werden). Zum<br />
Beispiel die so genannten nicht-invasiven Operationstechniken: Mikrotechnologien<br />
und Lasertechniken erlauben es, Operationen ohne vorgängiges<br />
Aufschneiden grosser Körperpartien vorzunehmen. Dadurch<br />
sinken nicht nur die Risiken bei der Operation, sondern auch die Kosten.<br />
So ist die Operation des grauen Stars (die am häufigsten vorgenommene<br />
Operation überhaupt) in den letzten Jahren dank der Lasertechnik<br />
um ein Vielfaches kostengünstiger geworden.<br />
2. Wir werden immer älter, und im Alter steigen die Gesundheitskosten<br />
massiv an. Auch diese Begründung stimmt nur bedingt. Denn unabhängig<br />
vom absoluten Alter sind es vor allem die Gesundheitskosten<br />
des letzten Lebensjahres vor dem Sterben, in denen massive Kosten<br />
anfallen. Es ist nicht in erster Linie die Zunahme des absoluten Alters,<br />
sondern die Zunahme der Massnahmen im letzten Lebensjahr, die zu<br />
einer Kostensteigerung führen. Bürgerliche GesundheitspolitikerInnen<br />
möchten uns glauben machen, die Kostensteigerung sei unausweichlich,<br />
weil weder der technische Fortschritt noch die zunehmende Alterung<br />
der Bevölkerung beinflussbar seien. Folglich müsse der Zugang zu den<br />
medizinischen Leistungen früher oder später rationiert werden. Wesentliche<br />
Gründe für den Kostenanstieg liegen aber nicht in der technischen<br />
oder demographischen Entwicklung an sich, sondern im Umgang<br />
damit.<br />
56 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Zum einen muss der Einsatz technischer Neuerungen und Vorgehensweisen<br />
umsichtig und bedarfsgerecht geplant werden, sonst führt er<br />
tatsächlich zu Kostensteigerungen, die niemandem nützen – ausser den<br />
Herstellern teurer Apparate und Medikamente und den Anwendern<br />
prestigeträchtiger Operationsverfahren. Der wesentliche Kostenfaktor<br />
liegt nicht in der Technik an sich, sondern in der gewinn- respektive<br />
prestigeorientierten Nutzung.<br />
Zum andern ist nicht die steigende Lebenserwartung das Problem,<br />
sondern der Umgang mit dem Sterben. Hier gilt es tatsächlich, eine neue<br />
Kultur zu entwickeln. Wir müssen ›sterben lernen‹, gerade weil es uns<br />
besser gelingt, Leben zu verlängern. Wir – die Kranken, die Angehörigen,<br />
das medizinische Personal – müssen uns der Herausforderung<br />
stellen, zu bestimmen, wann lebensverlängernde Massnahmen Sinn<br />
machen und wann nicht. Wir – und das ist das Schwierige – müssen die<br />
damit verbundenen Unsicherheiten bewältigen. Eine Rationierung<br />
medizinischer Leistungen würde dieses Lernen verunmöglichen: Wer<br />
genügend Geld hat, kann jede Rationierung umgehen und Leistungen<br />
privater Anbieter kaufen. Wem aus Rationierungsgründen Eingriffe verweigert<br />
würden, der wäre de facto zum Sterben verurteilt, weil er dieses<br />
Geld nicht auftreiben kann.<br />
Keine schöne Welt und keine, die ein Sterben in Würde einfacher<br />
macht. In dieser Welt werden den Reichen und gut Versicherten möglichst<br />
viele lebensverlängernde Massnahmen vorgeschlagen, weil sich<br />
dies für die Leistungserbringer rentiert. Solche Phänomene lassen sich<br />
in den USA gut beobachten. 7 Bei den weniger Bemittelten hingegen<br />
würden die Leistungen rationiert – Ungerechtigkeiten, f<strong>als</strong>che Entscheidungen<br />
und erniedrigende Situationen liessen sich nicht vermeiden.<br />
Welche Steuerung des Gesundheitswesens?<br />
»Unausweichliche Rationierungen« und »mehr Markt im Gesundheitswesen«<br />
stehen bei vielen PolitikerInnen und JournalistInnen leider hoch<br />
im Kurs. Beide Rezepte führen jedoch zum Gegenteil dessen, was sie<br />
beabsichtigen (oder zu beabsichtigen vorgeben). Die Gesundheitsversorgung<br />
würde mit dieser Rezeptur teurer – und gleichzeitig unsozialer.<br />
Welche Steuerung aber bietet sich aus sozialer Sicht an? Die nachfolgende<br />
Reformagenda der <strong>Denknetz</strong>-Fachgruppe beinhaltet unter anderem<br />
ein Konzept für eine soziale und möglichst kohärente Steuerung der<br />
Gesundheitsversorgung.<br />
Zu diesen Vorschlägen gilt es erstens anzumerken, dass eine massvolle<br />
Steigerung der Gesundheitskosten ein überaus positives Zeichen für die<br />
Lebensqualität einer Gesellschaft darstellt und die Zukunftsfähigkeit<br />
57 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gesundheitspolitik
Gesundheitspolitik<br />
dieser Gesellschaft stärkt. Es gibt wohl kein anderes Gut <strong>als</strong> die physische<br />
und psychische Gesundheit der Bevölkerung, in das sich mehr zu<br />
investieren lohnte. Und: Gerade die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens<br />
schafft die dringend nötigen Arbeitsplätze, die wir brauchen, um<br />
alle Menschen am Wirtschaftsleben vollwertig teilhaben zu lassen.<br />
Zweitens: Eine perfekte externe Steuerung – <strong>als</strong>o eine über Vorschriften,<br />
Machtpositionen oder finanzielle Anreize – gibt es nicht. Jeder Mechanismus<br />
führt zu Verzerrungen und lädt zu ›Missbräuchen‹ ein. Gerade<br />
deshalb ist darauf zu achten, dass in der Gesundheitsversorgung die<br />
intrinsischen Motive nach Kräften gefördert werden. Intrinsisch sind alle<br />
Motive, die aus der Arbeit selbst entstehen: Die Befriedigung, die das<br />
Gesundheitspersonal erlebt, wenn Operationen gelingen, wenn dank<br />
guter Pflege der Heilungsprozess voranschreitet, wenn PatientInnen ihre<br />
Dankbarkeit ausdrücken, wenn menschliche Anteilnahme zur Heilung<br />
beiträgt, wenn neue Verfahren entwickelt und erprobt werden und so<br />
weiter. Entsprechend müssen die Arbeitsbedingungen und die Kompetenzverteilungen<br />
im Gesundheitswesen optimal gestaltet werden. <strong>Das</strong><br />
Personal ist nach fairen Grundsätzen zu entlöhnen – nicht nur, um die<br />
berechtigten materiellen Interessen der Beschäftigten zu sichern, sondern<br />
auch eine qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung. Und:<br />
In wohl keinem anderen gesellschaftlichen Feld haben Profitinteressen<br />
weniger zu suchen <strong>als</strong> im Gesundheitswesen.<br />
Literatur<br />
Kocher, Gerhard, Willy Oggier (2004) ›Gesundheitswesen Schweiz 2004–2006. Eine aktuelle<br />
Übersicht ‹. Bern (2. Aufl.).<br />
Leu, Robert E., Martin Schellhorn (2004) ›Auswirkungen des KVG auf die Versicherten: Ausgewählte<br />
Resultate ‹ (Kurzfassung). Bern (NFP 45, Projekt Nr. 4045-059744/1; www.so<br />
zi<strong>als</strong>taat.ch).<br />
Schopper, Doris, Ruth Baumann-Hölzle, Marcel Tanner (Hg.) (2001) ›Mittelverteilung im<br />
schweizerischen Gesundheitswesen‹. Studie des Schweizerischen Tropeninstitutes und<br />
der Dialog Ethik. Basel.<br />
Friedhoff, Stephanie (2004) ›Hey Doc, was hab ich heute?‹ In: NZZ-Folio, März.<br />
1 vgl. Kocher/Oggier 2004, 76ff.<br />
2 vgl. Leu/Schellhorn 2004, 3.<br />
3 vgl. Leu/Schellhorn 2004, 4.<br />
4 vgl. Koch/Oggier 2004, 81.<br />
5 vgl. Kocher/Oggier 2004, 79.<br />
6 vgl. Schopper et al. 2001, 24.<br />
7 vgl. Friedhoff 2004.<br />
Anmerkungen<br />
58 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Eine Reformagenda für<br />
eine soziale Gesundheitspolitik<br />
Vorbemerkung<br />
Die unter bürgerlicher Dominanz forsch vorgetragenen KVG-Revisionsvorhaben<br />
streben einen Systemwandel an, der zu einer Zweiklassenmedizin und zu einer<br />
Stärkung gewinnorientierter Anbieter und Kassen führen soll. Der Schweiz steht<br />
<strong>als</strong>o eine grundlegende Auseinandersetzung über das künftige Gesundheitswesen<br />
bevor. Vor diesem Hintergrund hat sich im Herbst 2004 die Fachgruppe Gesundheitspolitik<br />
des <strong>Denknetz</strong>es formiert, deren Mitglieder ihre Arbeit ausschliesslich<br />
mit ihrem persönlichen Namen zeichnen. In einem ersten Schritt hat die Gruppe<br />
die nachstehende Reformagenda erarbeitet. Sie integriert die Gesichtspunkte von<br />
Fachleuten aus verschiedensten Tätigkeitsbereichen und erhebt den Anspruch,<br />
einen kohärenten, in sich stimmigen Bezugsrahmen für eine fortschrittliche, soziale<br />
und demokratische Gesundheitspolitik zu bieten. Sie ist jedoch nicht der Weisheit<br />
letzter Schluss, sondern will vielmehr zum Weiterdenken anregen.<br />
Lebensqualität und soziale Gerechtigkeit<br />
Die Lebensumstände und die Alltagsgestaltung haben starken Einfluss<br />
auf die Gesundheit der Menschen: Arbeitsbedingungen, Umweltbelastungen,<br />
Qualität und Art der Ernährung, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten<br />
und soziale Einbettung spielen eine wichtige Rolle. Die<br />
wirksamste Gesundheitspolitik be-<br />
Die Fachgruppe<br />
Gesundheitspolitik<br />
setzt sich zusammen aus: Rosmarie Glauser,<br />
geschäftsleitende Sekretärin VSAO<br />
Bern (Berufsverband der Assistenz- und<br />
OberärztInnen); Oliver Peters, persönlicher<br />
Mitarbeiter des Gesundheits- und Sozialdirektors<br />
Kanton Waadt; Renate Eichenberger,<br />
Präsidentin SBGRL (Berufsverband der<br />
Langzeitpflegenden); Beat Ringger, Zentr<strong>als</strong>ekretär<br />
vpod (Gewerkschaft des öffentlichen<br />
Person<strong>als</strong>) und Sekretär <strong>Denknetz</strong>;<br />
Ruedi Spöndlin, Redaktor Soziale Medizin;<br />
Elsbeth Wandeler, Leiterin Abt. Berufspolitik<br />
SBK Schweiz (Berufsverband des Klinikund<br />
Spital-Pflegeperson<strong>als</strong>); Erika Ziltener,<br />
Leiterin Patientenstelle Zürich.<br />
59 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gesundheitspolitik<br />
steht demnach darin, krank machende<br />
Entwicklungen und Verhaltensweisen<br />
zu korrigieren respektive<br />
zu vermeiden.<br />
Positiv an der heutigen Situation<br />
sind das steigende Engagement<br />
und die steigende Kompetenz der<br />
Bevölkerung im Umgang mit der<br />
eigenen Gesundheit, ebenso die<br />
zunehmende Vielfalt und Qualität<br />
des präventiven Gesundheitsangebotes.<br />
Gleichzeitig lassen sich heute<br />
fünf gesundheitsrelevante Problembereiche<br />
ausmachen:<br />
• Verdichtung der Arbeit, Zunahme<br />
von Stress, Arbeit auf Abruf
Gesundheitspolitik<br />
und anderen Formen prekärer Arbeit, Verlust der Arbeitsplatzsicherheit,<br />
Druck auf die Löhne – all dies führt auch zu gesundheitlichen Belastungen.<br />
Dabei gibt es bedeutende soziale Unterschiede. Beruflich besser<br />
gestellte Schichten stehen in der Regel auch gesundheitlich besser da<br />
und weisen etwa eine deutlich höhere Lebenserwartung auf.<br />
• Die Zahl der Personen, die ausgegrenzt werden und die ihre persönlichen<br />
und sozialen Perspektiven verlieren, steigt deutlich an, was auch<br />
auf die Gesundheit der Betroffenen durchschlägt.<br />
• Fehlentwicklungen in den Ernährungsgewohnheiten und im Suchtmittelkonsum<br />
nehmen wieder zu, insbesondere bei der Jugend.<br />
• Neue Epidemien, z.B. AIDS, SARS etc können die Gesundheit der<br />
Bevölkerung bedrohen.<br />
• Die Umweltverschmutzung führt nach wie vor zu starken Beeinträchtigungen<br />
der Gesundheit.<br />
Die Schweiz hat gegenüber diesen Problembereichen bislang keine<br />
kohärente Gesundheitsprävention aufgebaut. Die Prävention bleibt<br />
Flickwerk und ist damit dem Spardruck besonders stark ausgeliefert.<br />
Wir setzen uns ein für eine umfassende Gesundheitspolitik, die der<br />
Prävention die ihr gebührende Rolle zumisst und auch weitere Politikfelder<br />
berücksichtigt. Zu letzteren gehören die Schaffung von genügend<br />
fair bezahlten Arbeitsplätzen und die Sicherung gesundheitserhaltender<br />
Arbeitsbedingungen, die verstärkte Bekämpfung von Suchtmitteln, eine<br />
bedeutend bessere Integration der Ernährungsberatung in die allgemeine<br />
medizinische Versorgung und die Sicherung genügender Ressourcen<br />
zur Vermeidung von Epidemien.<br />
Wir konzentrieren unsere Überlegungen und Vorschläge im Folgenden<br />
auf die Ausgestaltung des Gesundheitswesens im engeren Sinne, das<br />
heisst der Institutionen, Regelwerke etc., die der Wiederherstellung der<br />
Gesundheit und der Pflege der Kranken dienen. Wir tun dies, weil in<br />
diesen Bereichen ein Reformprozess vorgesehen ist, der die<br />
Grundausrichtung der Schweizer Gesundheitspolitik berührt.<br />
Unsere Qualitätskriterien und Ansprüche<br />
an das Gesundheitswesen<br />
Eine gute Gesundheitsversorgung ist ein zentrales Menschenrecht*. Die<br />
Versorgung muss allen Mitgliedern einer Gesellschaft gleichermassen<br />
* Artikel 25 der allemeinen Menschenrechtserklärung der UNO vom 10.12.1948 besagt in<br />
Abschnitt 1: Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie<br />
Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche<br />
Versorgung und notwendige soziale Leistungen; sowie das Recht auf Sicherheit im<br />
Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem<br />
Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.<br />
60 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
zugute kommen; das ist eines der Fundamente einer demokratischen<br />
Gesellschaft, in der alle Menschen <strong>als</strong> gleichwertig erachtet werden.<br />
Entsprechend muss die Gesundheitsversorgung folgenden Kriterien<br />
genügen:<br />
• sie orientiert sich an den Bedürfnissen der PatientInnen<br />
• sie ist qualitativ hochstehend und strebt die bestmögliche Versorgung<br />
für alle an<br />
• sie ist nachhaltig und ausreichend finanziert<br />
• die Finanzierung erfolgt nach den Kriterien des sozialen Ausgleichs<br />
• der Zugang ist für alle in gleicher Weise gewährleistet<br />
• sie fördert und stützt das Engagement der in der Gesundheitsversorgung<br />
Beschäftigten<br />
• sie entwickelt sich laufend weiter<br />
• sie wird effizient erbracht.<br />
Die Gesundheitsversorgung ist eine öffentliche Aufgabe und wird im<br />
Rahmen des Service publique erbracht. Der Staat ist Garant dafür, dass<br />
alle BürgerInnen die entsprechenden Leistungen in Anspruch nehmen<br />
können. Die Gesundheitsversorgung ist kein geeignetes Feld für Marktund<br />
Profitorientierung. Die Leistungen sollen in erster Linie an den<br />
Bedürfnissen der PatientInnen ausgerichtet werden und nicht an den<br />
Gewinninteressen von Leistungserbringern oder Versicherern.<br />
Bausteine im Schweizer Gesundheitswesen,<br />
die wir bewahren wollen<br />
In der Gesundheitsversorgung der Schweiz gibt es eine Reihe wertvoller<br />
Bausteine, die wir bewahren wollen:<br />
• <strong>Das</strong> Versicherungsobligatorium mit einem offenen Leistungskatalog,<br />
der alles für die Gesundheitsversorgung Erforderliche abdeckt. Eine<br />
Aushöhlung dieses Leistungskatalogs, wie sie mit der Ausgrenzung der<br />
Komplementärmedizin durch den Bundesrat (Entscheid vom Juni 2005)<br />
eingeleitet wird, muss mit allen Mitteln verhindert werden.<br />
• Die Versicherten haben im ambulanten Bereich Wahlfreiheit, die zur<br />
Stärkung des Vertrauens zwischen medizinischen Fachleuten und PatientInnen<br />
beiträgt.<br />
• Die Leistungserbringung ist im Grossen und Ganzen von hoher Qualität,<br />
das Personal gut ausgebildet und engagiert.<br />
• Der Zugang zur erforderlichen medizinischen und pflegerischen Versorgung<br />
ist für alle gewährleistet, und die Gesetzgebung will eine Zweiklassenmedizin<br />
verhindern.<br />
• Es ist wichtig, dass die besten Spitäler unter öffentlicher Kontrolle und<br />
Lenkung stehen; dies ist in der Schweiz in überwiegendem Mass der Fall.<br />
61 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gesundheitspolitik
Gesundheitspolitik<br />
• Eine ausreichende Finanzierung ist weitgehend gesichert, wenn sie<br />
auch zu einem wesentlichen Teil über die höchst unsoziale Kopfprämie<br />
bei den Krankenkassenprämien erfolgt.<br />
Zwei Bedrohungen:<br />
Privates Kapital und Sparpolitik<br />
Diese Qualitäten stehen unter Druck von zwei Seiten:<br />
• Die forcierte Sparpolitik gefährdet eine ausreichende Finanzierung<br />
der Gesundheitsversorgung.<br />
• Die Öffnung des Gesundheitswesens für private, gewinnorientierte<br />
Kapitalien und die Stärkung von finanziellen Anreizsystemen gefährden<br />
die sachgerechte Gesundheitsversorgung, weil systemfremde Kriterien<br />
wichtig(er) werden <strong>als</strong> die Gesundheit der PatientInnen.<br />
Wir sind dezidierte GegnerInnen der Gewinnorientierung im Gesundheitswesen.<br />
<strong>Das</strong> Beispiel der USA zeigt, dass dies zu wachsenden<br />
Fehlversorgungen, zu steigender Ungerechtigkeit und zu wesentlich<br />
höheren Kosten führt.<br />
Wir sind ebenso GegnerInnen einer Sparpolitik auf Kosten der PatientInnen<br />
und des Person<strong>als</strong>. Einige politische Kräfte wollen diese<br />
Sparpolitik mit den Privatisierungsbemühungen kombinieren. Ihr Ziel<br />
ist eine Zweiklassenmedizin nach der Logik »unterfinanzierte und deshalb<br />
schlechte öffentliche Spitäler fürs Volk, Star-Kliniken mit Top-<br />
(Über)angebot für die Reichen«.<br />
Nötige Reformen<br />
In den folgenden zehn Problembereichen sind unseres Erachtens weit<br />
reichende Reformen dringlich.<br />
1. Krankenkassenprämien und Krankenversicherungen<br />
• Kein anderes OECD-Land kennt eine in vergleichbarem Ausmass unsoziale<br />
Finanzierung wie die Schweiz. <strong>Das</strong> Kopfprämiensystem muss<br />
dringend ersetzt werden durch eine Sozialversicherung, die auf die wirtschaftliche<br />
Leistungsfähigkeit abstützt, <strong>als</strong>o alle Einkommensarten, das<br />
Vermögen sowie die familiären Verpflichtungen berücksichtigt.<br />
• Innerhalb der obligatorischen Krankenversicherung (Grundversicherung)<br />
ist jede Risikoselektion nachhaltig zu unterbinden. Deshalb sind<br />
sämtliche obligatorischen Krankenkassenprämien in einen gesamtschweizerischen<br />
Finanzierungspool einzuzahlen; aus diesem Pool werden<br />
sämtliche Leistungen erbracht. Die Krankenkassen fungieren im<br />
obligatorischen Bereich lediglich <strong>als</strong> Zahl- und Beratungsstellen (dieses<br />
Modell lehnt sich an die Funktionsweise der Arbeitslosenkassen an). Sie<br />
62 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
können private Zusatzversicherungen anbieten, müssen aber auch in<br />
diesem Bereich <strong>als</strong> Non-Profit-Organisationen arbeiten.<br />
2. Spitalplanung<br />
• Die stationäre Akutversorgung wird besser geplant, Gewinnorientierung<br />
zurückgebunden. <strong>Das</strong> Angebot wird von der öffentlichen Hand<br />
abschliessend gesteuert und koordiniert.<br />
• Kostentreibende Geräte und Infrastrukturen sind sowohl im stationären<br />
<strong>als</strong> auch im ambulanten Bereich einem Bedürfnisnachweis zu<br />
unterstellen; diesem Nachweis sollen sich sowohl öffentliche <strong>als</strong> auch<br />
private Anbieter unterziehen müssen. So kann der Tendenz entgegengetreten<br />
werden, ertragreiche Diagnosen und Behandlungen privat anzubieten,<br />
aufwändige Heilungen und Rehabilitationen jedoch dem Staat<br />
zu überlassen.<br />
• Löhne und Arbeitsbedingungen sind für öffentlich subventionierte<br />
oder finanzierte Einrichtungen verbindlich zu regeln, faire Löhne und<br />
Arbeitsbedingungen sind zu sichern; der Einkauf von Medikamenten,<br />
Bedarfsmaterial, Investitionsgütern und Diensten ist über gemeinsame<br />
Einkaufs- und Dienstleistungsorganisationen zu bündeln und zu rationalisieren.<br />
• Der Bund stellt sicher, dass die Kantone die Spitalgrundversorgung<br />
koordiniert planen. Besonders aufwändige und/oder seltene Interventionen<br />
respektive Einrichtungen (›Spitzenmedizin‹) sind über das interkantonale<br />
Konkordat für Spitzenmedizin zu zentralisieren. Der Bund<br />
muss über geeignete Mittel verfügen, damit er diese Planung durchzusetzen<br />
kann.<br />
• Die Schweiz ist in fünf bis sechs Spitalregionen zu unterteilen, innerhalb<br />
derer die PatientInnen ihr Spital frei wählen können, soweit es das<br />
System des Gatekeepers zulässt (siehe Punkt 5.4).<br />
3. Ganzheitliche Versorgung<br />
Die Gesundheitsversorgung muss ganzheitlicher werden, allein mit technischen<br />
Neuerungen lässt sie sich nicht verbessern. ›Weiche Faktoren‹<br />
und Menschlichkeit sind genauso wichtig.<br />
• Der heutige Medizinbetrieb weist eine Tendenz zur Überspezialisierung<br />
und zum Reduktionismus auf. <strong>Das</strong> ist der Behandlungsqualität<br />
nicht förderlich und kann unnötige Kosten verursachen. Nötig ist die<br />
Förderung ganzheitlicher, psychosomatischer Ansätze; die Gesundheitsförderung<br />
ist auszubauen. Die Palliativmedizin, <strong>als</strong>o die Behandlung und<br />
Begleitung von PatientInnen mit schweren, unheilbaren Krankheiten<br />
und begrenzter Lebenserwartung, muss mehr Anerkennung finden.<br />
63 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gesundheitspolitik
Gesundheitspolitik<br />
• <strong>Das</strong> System der Gesundheitsversorgung muss für seriöse Methoden<br />
der Komplementärmedizin offen sein.<br />
• Im Bereich der Psychiatrie und Psychotherapie braucht es eine Vielfalt<br />
an Methoden: statistisch basierte und pharmakologische Therapien<br />
dürfen nicht dominieren. Eine angemessene Regelung der Zulassung<br />
nicht-ärztlicher PsychotherapeutInnen ist dringend geboten.<br />
• Der Status der Generalistin oder des Generalisten (HausärztIn) und<br />
der diagnostischen Tätigkeiten (z.B. bei der PatientInnen-Aufnahme in<br />
Spitälern) sind aufzuwerten.<br />
• Medizinisches Fachpersonal soll die Möglichkeit haben, sich mittels<br />
eines angemessenen Medizinstudiums zum Arzt weiterzubilden.<br />
4. Ambulante Versorgung<br />
• Eine gute Beziehung zwischen Arzt/Ärztin und PatientIn ist Voraussetzung<br />
für eine qualitativ gute und effiziente Behandlung. Deshalb ist<br />
die freie Wahl der GrundversorgerInnen (Allgemeinmediziner, Allgemeininternisten,<br />
Gynäkologinnen, Pädiater und Psychiaterinnen) unabdingbar.<br />
<strong>Das</strong> bedeutet, dass für diese ÄrztInnen weiterhin Kontrahierungszwang<br />
bestehen muss, sofern sie folgende Bedingungen erfüllen:<br />
– Facharzttitel, regelmässige Fortbildung (ermöglicht optimale Behandlung<br />
und stets aktuelles Wissen in evidenzbasierter Medizin, was kostensparend<br />
wirkt);<br />
– Kenntnisse respektive Weiterbildung in Gesundheitsökonomie, Praxisführung,<br />
Informatik (fördert Kostenbewusstsein und effiziente Praxisführung);<br />
– Tätigkeit in einer Gruppenpraxis oder Bereitschaft, in einem strukturierten<br />
Netzwerk mitzumachen. Ein strukturiertes Netzwerk ist dann<br />
gegeben, wenn ein regelmässiger fachlicher Austausch und eine regelmässige<br />
Zusammenarbeit stattfinden.<br />
• Der Zugang zu den SpezialfachärztInnen und den Spitälern in der obligatorischen<br />
Krankenversicherung soll grundsätzlich nur über die<br />
Grundversorger (Gatekeeper) möglich sein. Diese arbeiten in Netzwerken<br />
mit SpezialfachärztInnen und Spitälern zusammen. Alle ÄrztInnen,<br />
die in einem Netzwerk mitarbeiten, haben Anrecht auf einen Vertrag mit<br />
der Krankenkasse, sofern sie die oben genannten Bedingungen erfüllen.<br />
• Die Verknüpfung von Managed-Care-Versorgungsmodellen mit Budgetverantwortung<br />
ist abzulehnen. Sie birgt die Gefahr, dass bei überdurchschnittlich<br />
kostenintensiven, aber medizinisch sinnvollen Behandlungen<br />
das Netzwerk finanziell unter Druck gerät und eine nicht beabsichtigte,<br />
verdeckte Rationierung stattfindet. Dieser systembedingte<br />
Zwang zur ›Leistungsvermeidung‹, der in analogen Versorgungsmodel-<br />
64 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
len in unseren Nachbarländern sowie in den USA zu beobachten war<br />
und ist, steht dem Anliegen nach Förderung von Managed-Care-Modellen<br />
klar entgegen, da Netzwerke so unweigerlich in den Ruf geraten,<br />
eine qualitativ minderwertige Behandlung anzubieten.<br />
Unser Modell garantiert eine einheitliche Gestaltung der ambulanten<br />
Versorgung und erlaubt gleichzeitig eine Vielfalt von methodischen Ausrichtungen<br />
seitens der Leistungserbringer. Es stärkt die Stellung der Allgemeinpraktiker<br />
und hilft, SpezialärztInnen gezielt einzubeziehen.<br />
Unnötige Doppeluntersuchungen werden vom Gatekeeper erkannt und<br />
vermieden. Dank der Netzwerke wird ein regelmässiger Austausch und<br />
eine auf den ganzen Menschen ausgerichtete Versorgung gefördert. Die<br />
freie ÄrztInnenwahl bleibt erhalten. Wer zu einer bestimmten Spezialistin<br />
will, soll dies mit der Hausärztin vereinbaren können.<br />
5. Schaffung und Sicherung einer integrierten Versorgung<br />
Die Behandlungsketten (vor allem bei chronisch und mehrfach kranken<br />
Menschen) sind heute oft zuwenig integriert; die gleiche Untersuchung<br />
wird manchmal x-fach wiederholt, Informationen werden nicht ausgetauscht<br />
und Therapien nicht koordiniert. Eine Massnahme zur Schaffung<br />
und Sicherung einer integrierten Versorgung ist das Prinzip des<br />
Gatekeepers.<br />
Darüber hinaus ist es von ebenso grosser Bedeutung, allgemein akzeptierte<br />
Schnittstellen zwischen Institutionen zu schaffen, die Behandlungsprozesse<br />
laufend zu optimieren und im nötigen Masse zu standardisieren.<br />
Dabei müssen die grösseren Anbieter (Spitäler, Reha-Kliniken,<br />
Spitex, Pflegeheime) ihre Schnittstellen und Behandlungsprozesse regelmässig<br />
aufeinander abstimmen.<br />
6. Qualitätssicherung<br />
• <strong>Das</strong> Qualitätsmanagement muss in allen Bereichen der Gesundheitsversorgung<br />
<strong>als</strong> permanenter Prozess etabliert werden und einhergehen<br />
mit einer Stärkung der Rolle der PatientInnen.<br />
• Der Staat überprüft – unter anderem mit Hilfe geeigneter Datensammlungen<br />
– regelmässig die Qualität der erbrachten Leistungen und der angewandten<br />
Methoden. Er kann die Leistungserbringer zur Publikation<br />
ausgewählter Indikatoren verpflichten (z.B. ungeplante Re-Operationen<br />
und Rehospitalisierungen, Rate der Medikationsfehler etc.). Die Qualitätsmerkmale<br />
fliessen ein bei den Entscheiden über die Anforderungen<br />
an und die Zulassung von Leistungserbringern.<br />
• Zentral sind die PatientInnenrechte, das heisst das Recht auf vollständige<br />
Einsicht in die eigenen Akten, das Recht auf vollständige Aufklä-<br />
65 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gesundheitspolitik
Gesundheitspolitik<br />
rung über Diagnosen und vorgeschlagene Behandlungen, die Wahrung<br />
der Entscheidungssouveränität und der nötige Schutz bei Diagnoseoder<br />
Behandlungsfehlern.<br />
• Der Bund soll die Patientenorganisationen nach dem niederländischen<br />
Modell stärken und ihre Koordination finanzieren.<br />
• Zur Qualitätssicherung der stationären und der ambulanten Versorgung<br />
werden staatlich getragene Beschwerde- und Anrufungsinstanzen<br />
geschaffen, die multipartit besetzt werden (Leistungserbringer, Finanzierer,<br />
Personalverbände, Patientenorganisationen). Diese Instanzen müssen<br />
über geeignete Sanktions- und Ausschlusskompetenzen verfügen.<br />
• Besondere Sorgfalt ist im Bereich des Datenschutzes nötig: Der vollständige<br />
Schutz von personenbezogenen Gesundheitsdaten ist durchgängig<br />
sicherzustellen, um jede Form von Diskriminierung aufgrund des<br />
Gesundheitszustandes auszuschliessen.<br />
7. Finanzielle Vergütungssysteme<br />
<strong>Das</strong> perfekte Vergütungssystem gibt es nicht. Die Verrechnung nach Aufwand<br />
verleitet dazu, unnötige Leistungen zu erbringen, zum Beispiel<br />
Menschen länger <strong>als</strong> erforderlich im Spital zu behalten. Fixe Globalbudgets<br />
und Fallkostenpauschalen (d.h. eine fixe Pauschale pro Diagnose,<br />
unabhängig vom tatsächlichen Aufwand) wiederum bringen die<br />
Gefahr der Unterversorgung mit sich: Um Kosten zu sparen, werden die<br />
PatientInnen möglichst spärlich versorgt und möglichst rasch aus dem<br />
Spital entlassen – mitunter zu rasch. Bei Fallkostenpauschalen kann allerdings<br />
auch die Versuchung entstehen, mittels ›geeigneter‹ Diagnosen<br />
zu möglichst hohen Einkünften zu kommen.<br />
Umso wichtiger ist es, gewinnorientierte Motive so weit wie möglich<br />
einzudämmen und gleichzeitig eine ausreichende Finanzierung sicherzustellen,<br />
weil sonst die negativen Aspekte eines Vergütungssystems<br />
verstärkt werden. Insbesondere sind Leistungserbringer (Spitäler, Kliniken,<br />
HMOs usw.), die einem an der Börse kotierten Unternehmen<br />
gehören, von der Finanzierung durch die Kassen oder die öffentliche<br />
Hand auszuschliessen. Denn börsenkotierte Unternehmen sind den<br />
Zwängen der Finanzmärkte, d.h. der Gewinnmaximierung, uneingeschränkt<br />
ausgesetzt.<br />
• Die Finanzierung der stationären Versorgung ist so zu gestalten, dass<br />
eine Steuerung der Aktivitäten im Sinne der Spitalplanung möglich ist;<br />
das heisst, die Institutionen werden für Leistungen vergütet, zu denen<br />
sie auch beauftragt sind. Der optimale Mitteleinsatz soll mit einem diagnoseorientierten<br />
Controlling und Benchmarking überwacht werden.<br />
• Im ambulanten Bereich ist das Tarmed-System so zu verfeinern, dass<br />
66 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
auch die von spezialisierten ÄrztInnen verursachten Kosten effektiv<br />
kontrolliert werden können.<br />
• An den Schnittstellen von unterschiedlich finanzierten und tarifierten<br />
Versorgungssystemen (z.B. Spitex, Pflegeheime) können f<strong>als</strong>che Anreizmechanismen<br />
auftreten. Beispiel: Wenn die Krankenkassen bei der<br />
Spitex höhere Anteile zahlen <strong>als</strong> in der Langzeitpflege, haben sie ein<br />
finanzielles Interesse an einer möglichst raschen Heimeinweisung der<br />
PatientInnen. Solche f<strong>als</strong>chen Anreize sind zu vermeiden respektive zu<br />
eliminieren.<br />
8. Finanzierung der Langzeitpflege<br />
Die Langzeitpflege ist eine gesellschaftliche Aufgabe und muss aus Steuermitteln<br />
und Versicherungsleistungen finanziert werden – gleich wie<br />
alle andern medizinschen Leistungen. Hier befürworten wir ein schweizweit<br />
einheitliches Patientenabrechnungssystem. Dieses System ist so<br />
auszugestalten, dass die Betreuung bei psychischen Problemen besser erfasst<br />
und angemessen verrechnet werden kann. Damit wird verhindert,<br />
dass Pflegebedürftige mit psychischen Problemen voreilig in psychiatrische<br />
Kliniken verlegt werden, weil ihre Betreuung im Heim nicht<br />
finanziert werden kann. Denn vielfach ist der Heimaufenthalt der Situation<br />
des Betroffenen besser angemessen <strong>als</strong> ein Klinikaufenthalt und<br />
zudem auch kostengünstiger.<br />
Um die Finanzierung der Langzeitpflege zu stärken, erhebt der Bund<br />
eine Erbschaftssteuer, deren Erträge in die Finanzierung der Langzeitpflege<br />
fliessen. Eine solche Erbschaftssteuer sorgt dafür, dass kleine und<br />
mittlere Erbschaften von pflegebedürftigen Menschen erhalten bleiben,<br />
deren Vermögen heute durch die Pflegekosten rasch aufgebraucht wird.<br />
9. Medikamente und Pharmaindustrie<br />
Eine zunehmend mächtige und teilweise parasitäre Pharmaindustrie<br />
prägt vielfach die medizinische Versorgung, was sowohl bezüglich der<br />
Kosten <strong>als</strong> auch der Qualität problematisch ist.<br />
• Wir verlangen eine systematische Förderung von Generika und die<br />
Zulassung von Parallelimporten. Der kostspieligen Markteinführung<br />
von so genannten ›Me-too-drugs‹, die gegenüber bereits vorhandenen<br />
Produkten keine wirkliche Innovation darstellen, zu Lasten der Krankenversicherung<br />
ist mit geeigneten Mitteln entgegenzutreten. Klinische<br />
Studien zur Erprobung von Medikamenten sind unter öffentlicher Aufsicht<br />
durchzuführen. Der Einfluss der Pharmaindustrie auf die universitäre<br />
Forschung und auf die Aus- und Weiterbildung der Ärzteschaft<br />
muss offen gelegt und begrenzt werden.<br />
67 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gesundheitspolitik
Gesundheitspolitik<br />
• Wir fordern eine Politik der offenen Pharma-Patente. Offene Patente<br />
orientieren sich am Konzept der Open-Source-Software in der Informatik.<br />
Wer ein offenes Patent anmeldet, erlaubt allen die uneingeschränkte<br />
Nutzung der patentierten Wirkstoffe, verpflichtet jedoch alle<br />
NutzerInnen, sämtliche Erfahrungen und Weiterentwicklungen wiederum<br />
<strong>als</strong> offene Patente freizugeben.<br />
Wir erinnern daran, dass sich die Schweiz der Patentierung von chemischen<br />
Stoffen lange Zeit widersetzte und den Stoffschutz erst 1976<br />
einführte. Dies deshalb, weil sich die chemische Industrie der Schweiz<br />
so die Möglichkeit sichern konnte, bewährte Stoffe und Verfahren zu<br />
kopieren.<br />
Wir streben eine detaillierte Machbarkeitsstudie an, die den Aufbau<br />
eines öffentlich-rechtlichen Pharmakonzerns prüft. Ein solcher Konzern<br />
soll die Abhängigkeit der Gesundheitsversorgung von den privaten<br />
Pharmamultis mildern. Er soll<br />
• Wirkstoffe und Medikamente in enger Zusammenarbeit mit Universitäten,<br />
Forschungsinstituten und Firmen entwickeln, die sich zu einer<br />
Politik der offenen Patente verpflichten (z.B. Firmen in Schwellen-Entwicklungsländern);<br />
• dabei auch die Bedürfnisse der Bevölkerung in armen Ländern beachten;<br />
• die kombinierte und integrierte Forschung in den Bereichen der Komplementär-<br />
und Schulmedizin fördern und<br />
• ausgewählte Generika produzieren und vermarkten.<br />
10. Taggeldversicherung<br />
Die Schweiz braucht endlich ein Obligatorium in der Taggeldversicherung,<br />
mit der die Einkommensausfälle im Krankheitsfall abgedeckt<br />
werden. Dies liegt auch im Interesse der Früherkennung drohender Invalidität.<br />
Eine fortschrittliche Reformkoalition<br />
Die bundesrätlichen Vorschläge zur Revision des Krankenversicherungsgesetzes<br />
gehen zum grössten Teil in die entgegengesetzte Richtung<br />
dessen, was wir mit unserer Reformagenda anstreben.<br />
Wir laden deshalb die sozialpolitisch fortschrittlichen Kräfte der<br />
Schweiz ein, sich in der Gesundheitspolitik zu einer gemeinsamen Reformkoalition<br />
zusammenzuschliessen und hartnäckig und effizient für<br />
eine soziale Gesundheitsversorgung einzutreten.<br />
Wir freuen uns, wenn unsere Reformagenda dafür <strong>als</strong> inhaltlicher Bezugsrahmen<br />
dienen kann.<br />
68 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
<strong>Das</strong> US-Gesundheitswesen:<br />
Ein Schrecken ohne Ende?<br />
Bürgerliche Gesundheitspolitiker streben in der Schweiz einen umfassenden<br />
Umbau des Gesundheitswesens an. Viele Rezepte dafür stammen aus den USA:<br />
Markt und Wettbewerb, Managed Care und HMO, mächtige private Krankenversicherer,<br />
schrankenloser Marktzugang für profitorientierte Leistungsanbieter.<br />
Erstaunlich ist indessen, wie wenig hierzulande über das US-Gesundheitswesen<br />
und seine Entwicklungstrends bekannt ist. Denn all das, wovon die Schweizer<br />
Rechtsbürgerlichen träumen, ist in den USA Realität. Und diese Realität ist nicht<br />
nur hart für sozial Benachteiligte. Sie ist zunehmend belastend für die gesamte<br />
Gesellschaft: Die Kosten laufen aus dem Ruder, und dennoch wird die Versorgung<br />
der ärmeren Bevölkerungsschichten immer schlechter.<br />
Bundesrat Christoph Blocher lässt in einem Interview im Zürcher Tages-<br />
Anzeiger zum Jahresbeginn 2005 verlauten, er möchte die obligatorische<br />
Krankenversicherung am liebsten abschaffen. Was Blocher will, ist<br />
in den USA Wirklichkeit. Ein Versicherungsobligatorium gibt es hier<br />
nicht, und deshalb waren im Jahr 2003 16% der Bevölkerung (45 Mio.<br />
Menschen) ohne Versicherungsschutz. <strong>Das</strong> bleibt nicht ohne gravierende<br />
Folgen für die Betroffenen.<br />
Fehlender Versicherungsschutz und seine Folgen<br />
Normalerweise sind die Leute in den USA nur versichert, wenn sie über<br />
eine feste Anstellung verfügen. Die Prämien für den Abschluss einer individuellen<br />
Versicherungspolice sind wesentlich höher <strong>als</strong> diejenigen für<br />
die Kollektivversicherungen, die durch die Unternehmen abgeschlossen<br />
werden. Wer den Job verliert, verliert deshalb oft auch den Versicherungsschutz,<br />
weil er sich die höheren Prämien nicht leisten kann.<br />
Wie zum Beispiel Harold Kilpatrick aus Dyersburg im US-Staat Tennessee.<br />
Der 26-jährige Mann litt an Schizophrenie; er verlor seinen Job<br />
bei FedEX. Daraufhin wurde ihm die Behandlung verweigert, und auch<br />
das medizinische Unterstützungsprogramm Tenncare (die Umsetzung<br />
des US-weiten Medicare-Pro-<br />
Beat Ringger<br />
gramms) versagte ihm finanzielle<br />
1955, Zentr<strong>als</strong>ekretär vpod und geschäfts- Unterstützung. Kilpatricks Zuleitender<br />
Sekretär des <strong>Denknetz</strong>es. Intestand verschlimmerte sich, und<br />
ressensschwerpunkte: Gesundheits- und am 17. September 2003 nahm er<br />
Sozialpolitik, politische Ökonomie, Psycho- eine Gruppe Studenten des Dyerslogie<br />
und Fragen der Ideologiebildung.<br />
burg State Community College <strong>als</strong><br />
69 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gesundheitspolitik
Gesundheitspolitik<br />
Geiseln. Er verwundete zwei Menschen, bevor er von der Polizei erschossen<br />
wurde. 1<br />
Oder Nick Might, 25-jährig. Might leidet an Neurofibromatosis, einer<br />
Erbkrankheit, die zu Tumoren im ganzen Körper und auf der Haut führt.<br />
Auch Might verlor die Stelle und damit den Versicherungsschutz. Als<br />
allein lebender, kinderloser Erwachsener hatte er keinen Anspruch auf<br />
staatliche Unterstützung, musste alle Arztrechnungen selbst bezahlen<br />
und häufte so innerhalb von wenigen Monaten 20’000 Dollar Schulden<br />
an. Might musste die Telefonnummer wechseln, um sich die diversen<br />
Schuldeneintreibungsfirmen auf Distanz halten zu können.<br />
Wie schlecht es um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung steht,<br />
zeigen die Zahlen des Commonwealth Fund Biennial Health Insurance<br />
Survey, einer regelmässig durchgeführten repräsentativen Befragung<br />
der US-Bevölkerung zu finanziellen Aspekten der Gesundheitsversorgung.<br />
Gemäss dieser Umfrage gaben im Jahr 2003 37% aller Erwachsenen<br />
zwischen 19 und 64 an, dass sie aus Kostengründen Schwierigkeiten<br />
hatten, die Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen, die sie<br />
benötigt hätten. Dieser Anteil ist seit dem Jahr 2001 um 8% gestiegen.<br />
Die Verschlechterung der Lage betrifft vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten.<br />
Mehr <strong>als</strong> die Hälfte (52%) aller Erwachsenen zwischen<br />
19 und 64 Jahren, die in Haushalten mit einem Einkommen von weniger<br />
<strong>als</strong> 20’000 Dollar leben, waren im Jahre 2003 zumindest zeitweise<br />
ohne Versicherungsschutz. Die Schutzlosigkeit wird durch die zunehmende<br />
Praxis vieler Spitäler verschäft, den Nicht-Versicherten höhere<br />
Beträge zu verrechnen <strong>als</strong> den Versicherten. Versicherungen vergüten<br />
nur die vertraglich vereinbarten Preise, Nicht-Versicherte hingegen können<br />
sich nicht gegen überhöhte Preise wehren.<br />
Es erstaunt deshalb nicht, dass gemäss der repräsentativen Befragung<br />
der US-Bevölkerung 41% aller Erwachsenen angeben, sie hätten Schwierigkeiten,<br />
die Spital- und Arztrechnungen zu bezahlen. 18% müssen wegen<br />
medizinischer Rechnungen ihr Vermögen aufbrauchen, 8.2% sind<br />
gezwungen, sich zu verschulden. 11% geben an, dass sie wegen der Belastung<br />
durch medizinische Rechnungen nicht mehr in der Lage sind,<br />
ihre Grundkosten für Nahrung, Wohnung oder Heizung zu bestreiten. 2<br />
<strong>Das</strong> unsoziale Gesundheitssystem treibt eine zunehmende Zahl von<br />
AmerikanerInnen in harte Armut.<br />
Profitorientierung kommt teuer zu stehen<br />
Diese Zahlen und diese Schicksale kontrastieren drastisch mit den Chefgehältern<br />
der Versicherungsgesellschaften. Der durchschnittliche Jahreslohn,<br />
den sich die CEOs der 12 grössten US-Krankenversicherungs-<br />
70 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Gesellschaften auszahlen lassen, beträgt 15.2 Mio. Dollar. <strong>Das</strong> sind über<br />
66’000 Dollar pro Arbeitstag, wie Graef Crystal, Experte für Executive<br />
Pay, am 8.10.04 auf der Bloomberg-Homepage aufzeigte.<br />
Nigends auf der Welt ist der Anteil profitorientierter Anbieter von<br />
Gesundheitsleistungen so hoch wie in den USA. Sie haben in vielen<br />
Bereichen eine marktbeherrschende Stellung. Profitorientierte Betriebe<br />
dominieren die Bereiche Pflegeheime, psychiatrische Kliniken, Rehabilitationskliniken,<br />
HMOs (private ambulante Anbieternetze) und Nierendialyse-Zentren.<br />
Bereits sind auch 13% der Akutspitäler unter Kontrolle<br />
von privaten Kapitalgebern. 3<br />
Der Markt sorgt für Effizienz – so das neoliberale Dogma. Doch die<br />
Wirklichkeit folgt nicht dem Dogma: Kliniken, die von Investoren kontrolliert<br />
werden, optimieren den Profit, nicht die Kosten. Obwohl profitorientierte<br />
Spitäler häufig bei den Löhnen des Person<strong>als</strong> sparen, sind<br />
ihre Leistungen wesentlich teurer <strong>als</strong> jene vergleichbarer Non-Profit-Betriebe.<br />
Eine Vergleichsstudie aus dem Jahr 2004 kommt zum Schluss,<br />
dass profitorientierte Spitäler für ihre Leistungen um 19.95% höhere<br />
Kosten verrechnen <strong>als</strong> Non-Profit-Spitäler. 4 Dabei erfolgt die Rechnungstellung<br />
oft nicht korrekt, und Verurteilungen wegen Betrugs sind<br />
keine Seltenheit. Die grösste Spitalfirma Columbia/HCA musste 1.7<br />
Mia. Dollar an Bussen und Nachzahlungen leisten für überzogene Rechnungen,<br />
mehrfache Verrechung derselben Leistung oder f<strong>als</strong>che Angaben<br />
zur Diagnose; bei der zweitgrössten Firma Tenet sind es 700 Mio.<br />
Dollar für vergleichbare Betrügereien. 5<br />
Die Unübersichtlichkeit eines deregulierten Gesundheitssystems treibt<br />
die administrativen Kosten in die Höhe: Im Jahr 2003 betrugen sie in<br />
den USA 399.4 Mia Dollar (von insgesamt 1660.5 Mia Dollar Gesundheitskosten),<br />
was 24% der Gesamtkosten ausmacht. Dieser Anteil ist<br />
doppelt so hoch wie in Kanada. 6<br />
Dies alles kommt die Allgemeinheit teuer zu stehen und schlägt auch<br />
in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zu <strong>Buch</strong>e.Der Anteil der<br />
Gesundheitskosten am Bruttoinlandprodukt ist nirgends auf der Welt so<br />
hoch wie in den USA: 14.6% im Jahr 2002 (an zweiter Stelle folgt die<br />
Schweiz mit 11.2%).<br />
Managed Care und HMO: Die Bilanz ist negativ<br />
In den USA hat die Bedeutung von Health Maintenance Organisations<br />
(HMO) sprunghaft zugenommen: Waren 1985 erst 7% der US-Bevölkerung<br />
einer HMO angeschlossen, so ist es mittlerweile ein Drittel<br />
(83 Millionen in 1999, Sullivan 2003). <strong>Das</strong> Prinzip der HMO ist die Verbindung<br />
von Versicherung und Leistungserbringung: HMO offerieren<br />
71 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gesundheitspolitik
Gesundheitspolitik<br />
prämienbasierte Gesundheitsleistungen, die sie auch selbst erbringen<br />
oder durch Vertragsfirmen erbringen lassen. Zwei Drittel aller HMO<br />
arbeiten gewinnorientiert.<br />
Gewinnorientierte Investoren haben oft nicht viel übrig für die originären<br />
Anliegen des Gesundheitswesens. Zum Beispiel investieren<br />
mehrere US-Gesundheitsversicherungen, die zu den grössten HMO-Besitzern<br />
gehören, gleichzeitig in die Tabakindustrie. <strong>Das</strong> hat Folgen: Die<br />
grösste HMO der USA, Cigma, hatte ihre Mitglieder wiederholt verharmlosend<br />
über die Auswirkungen des Tabakkonsums informiert. Diese<br />
›Informationen‹ waren mit Philip Morris abgesprochen. Cigma besitzt<br />
Philip Morris-Aktien im Wert von 38.6 Mio. $. 7<br />
Ende der 80er-Jahre erlebte das US-Gesundheitswesen einen Kostenschub<br />
mit zweistelligen Zuwachsraten. Die Förderung von HMO wurde<br />
allenthalben <strong>als</strong> bestes Mittel zur Bremsung der Kosten angepriesen.<br />
Tatsächlich konnte der Kostenanstieg vorübergehend auf durchschnittliche<br />
5,4% gebremst werden – jedoch offensichtlich zu Lasten der Versorgungsqualität.<br />
Bereits 1996 stiessen die HMO bei einer deutlichen<br />
Mehrheit der US-BürgerInnen auf Ablehnung. Doch viele HMO-BenützerInnen<br />
haben keine Wahl, wieder zu einem Privatarzt zu wechseln,<br />
weil sie von ihrer Versicherung auf eine HMO festgelegt werden.<br />
Die sinkende Qualität in den HMO wird nicht nur von den Betroffenen<br />
wahrgenommen, sie lässt sich auch statistisch belegen. Eine Langzeitstudie<br />
(Rand Health Insurance Experiment) ergab, dass kranke<br />
PatientInnen mit tieferen Einkommen bei HMOs ein um 21% höheres<br />
Todesrisiko in Kauf nehmen müssen, <strong>als</strong> wenn sie bei einem frei praktizierenden<br />
Arzt versorgt werden.<br />
Mittlerweile haben die grossen HMO allerdings ihre Position gefestigt<br />
und vielfach eine monopolähnliche Stellung erlangt. Entsprechend steigen<br />
die Gesundheitskosten wieder deutlich stärker an. Deshalb sind es<br />
keineswegs mehr nur linke KritikerInnen, die eine negative Bilanz ziehen.<br />
Im Januar 1999 fragt das Wall Street Journal: »Wenn das Managed-<br />
Care-System die Kosten nicht kontrollieren kann – welche Zukunft hat<br />
es denn dann noch verdient?« Der prominenteste Kritiker von HMO<br />
heisst Paul Ellwood – prominent deshalb, weil er (noch unter der Nixon-<br />
Administration in den 70er-Jahren) der Erfinder des HMO-Konzeptes<br />
gewesen ist. Im Mai 1999 bezeichnete er die Qualität der HMO <strong>als</strong><br />
»nationale Schande«, nachdem er sie am eigenen Leib erfahren hatte:<br />
Er habe eine Querschnittlähmung nur verhindern können, weil er sich<br />
wiederholt gegen katastrophale Anordnungen von Ärzten und Pflegenden<br />
in einer HMO gewehrt habe.<br />
72 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Die Krise spitzt sich zu<br />
Der US-Gesundheitsökonom Stephen Heffler 8 schätzt, dass die US-<br />
Gesundheitskosten in den kommenden Jahren mit einer Rate von 7.3%<br />
steigen und im Jahr 2012 17.7% des BIP beanspruchen werden. 9<br />
Mittlere jährliche Wachstumsrate der Gesundheitskosten in den USA<br />
%<br />
10,6<br />
12,9<br />
Gleichzeitig verschlechtert sich die Situation für die breite Bevölkerung<br />
in den USA. Normalerweise sind Erwerbstätige in den USA von ihren<br />
Arbeitgebern gegen Krankheit und Unfall versichert, und meist bieten<br />
die Firmen auch Zusatzversicherungen für die ganze Familie. Doch diese<br />
Versicherungen sind freiwillig, und weil die Prämien in den letzten<br />
vier Jahren jedes Jahr um 10 oder mehr Prozent angestiegen sind, folgen<br />
Leistungsabbau und Kostenüberwälzung auf dem Fuss. Immer mehr<br />
Arbeitgeber erhöhen die Versicherungsbeiträge, die die Angestellten<br />
selbst bezahlen müssen, sie erschweren den Versicherungszugang (Wartezeiten<br />
nach Firmeneintritt, keine Versicherung für Teilzeitangestellte)<br />
oder streichen die Versicherung gleich ganz. Laut der Labor Research<br />
Association ist im Jahr 2003 erstm<strong>als</strong> seit mehr <strong>als</strong> vier Jahrzehnten nur<br />
noch eine Minderheit der Angestellten (45%) in der Privatwirtschaft<br />
gegen Krankheit versichert; noch im Jahr 2000 waren es 52%. Bei den<br />
Vollzeitangestellten ging dieser Anteil von 76% im Jahr 1990 auf 56% im<br />
Jahr 2003 zurück (Labor Research Association 2004).<br />
Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. Die National Coalition<br />
on Health Care – eine Dachorganisation mit den Ex-Präsidenten<br />
Bush, Carter und Ford <strong>als</strong> Ehren-Vorsitzenden – geht davon aus, dass die<br />
durchschnittliche Familienprämie auf 14’500 Dollar steigen und so<br />
innerhalb von drei Jahren um über 5’000 Dollar wachsen wird. Die<br />
Coalition befürchtet deshalb, dass die Zahl der Nicht-Versicherten bis<br />
ins Jahr 2006 auf etwa 51 bis 54 Mio. Menschen steigen wird.<br />
Die rasch wachsenden Kosten haben bewirkt, dass der staatliche Anteil<br />
an der Finanzierung der US-Gesundheitskosten stark zugenommen<br />
73 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
13,0<br />
Gesundheitspolitik<br />
8,5<br />
5,4<br />
7,4<br />
8,7<br />
7,2 6,9<br />
voraussichtlich
Gesundheitspolitik<br />
<strong>Das</strong> US-Gesundheitswesen in Stichworten und Kennzahlen<br />
• Die USA kennen kein Versicherungsobligatorium. 16% der Bevölkerung<br />
(2003) sind ohne Versicherungsschutz.<br />
• Der Grossteil der Leute ist über ihre Arbeitsstelle einer Krankenversicherung<br />
angeschlossen. Die Versicherung stellt einen üblichen – aber gesetzlich<br />
nicht vorgeschriebenen – indirekten Lohnbestandteil dar. Gegen eine<br />
vom Arbeitgeber vergünstige Zusatzprämie kann die ganze Familie<br />
mitversichert werden.<br />
• <strong>Das</strong> US-Gesundheitswesen ist mit Abstand das teuerste der Welt. Trotz<br />
hoher Wachstumsraten der US-Wirtschaft nimmt der Anteil am BIP<br />
laufend zu und betrug im Jahr 2002 14.6% (Schweiz: 11.2% BIP-Anteil<br />
bei deutlich geringerem Wirtschaftswachstum).<br />
• Insgesamt sind die Leistungen mittelmässig und äusserst unsozial verteilt.<br />
Der Gesundheitszustand der US-Bevölkerung ist alles andere <strong>als</strong> herausragend:<br />
Die Lebenserwartung betrug 1999 für Männer 73.9<br />
Jahre (Schweiz 77.0) und für Frauen 79.4 Jahre (Schweiz 82.8).<br />
• Da das US-Gesundheitswesen kaum reguliert ist, sind die Schnittstellenprobleme<br />
enorm und entsprechend hoch fallen die administrativen<br />
Kosten aus (24% aller Ausgaben). Zudem ist das System ohne<br />
grundlegende Reformen kaum mehr steuerbar.<br />
• Der US-Bundesstaat ist vor allem über zwei Finanzierungsprogramme<br />
am Gesundheitswesen beteiligt: Medicare erfasst alle über 65-<br />
Jährigen und alle Behinderten, die Anrecht auf Social Security haben.<br />
Medicare vergütet sowohl ambulante <strong>als</strong> auch stationäre Kosten. 1999<br />
profitierten 39 Mio. Menschen von Medicare. Schwachpunkt: Ärzten<br />
ist es erlaubt, auf die von Medicare vergüteten Preise einen privat zu<br />
bezahlenden Aufschlag zu verlangen, wovon zunehmend Gebrauch<br />
gemacht wird.<br />
• Medicaid ist das zweite bundesstaatliche Finanzierungsprogramm. Es<br />
kann auf Antrag hin von Leuten mit keinem oder geringem Einkommen<br />
beansprucht werden; die Anspruchsgrenzen werden von den<br />
einzelnen Staaten festgelegt. 41 Mio. AmerikanerInnen haben 1998<br />
Medicaid-Unterstützung bezogen. Weil Medicaid die Kosten nach<br />
dem Prinzip der Fallkostenpauschalen vergütet, gibt es jedoch viele<br />
Leistungserbringer, die keine Medicaid-PatientInnen akzeptieren.<br />
• Der Anteil der aus Steuermitteln finanzierten Gesundheitskosten ist mit rund<br />
60% wesentlich höher <strong>als</strong> in der Schweiz (25.3% im Jahr 2000).<br />
• <strong>Das</strong> US-Gesundheitswesen ist für profitorientierte Anbieter praktisch ohne<br />
Einschränkungen zugänglich. Alle Bereiche, die sich profitabel organisieren<br />
und betreiben lassen, sind durch gewinnorientierte Firmen<br />
dominiert, so etwa zwei Drittel aller HMO.<br />
• HMO (Versicherungen, die gleichzeitig die Gesundheitsleistungen erbringen)<br />
spielen eine grosse Rolle: Mehr <strong>als</strong> 80 Mio. Amerikaner sind<br />
einer HMO angeschlossen. Der übrige ambulante Bereich wird, wie<br />
in der Schweiz, von frei praktizierenden ÄrztInnen versorgt.<br />
74 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
75 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Gesundheitspolitik<br />
hat und heute bei rund 60% liegt. An diesem Anstieg sind die bundesstaatlichen<br />
Unterstützungsprogramme Medicaid und Medicare für<br />
Kriegsveteranen und Kinder wesentlich beteiligt. Doch die Bush-Regierung<br />
will nun die Leistungen der staatlichen Unterstützungsprogramme<br />
deutlich senken.<br />
Ein Ausweg aus dieser Krise ist vorderhand nicht in Sicht. Nachdem<br />
die Clinton-Administration mit einem breit angelegten Reformprogramm<br />
1994 am Widerstand der Wirtschaftslobby und der Republikaner<br />
gescheitert war, sind keine bedeutenden Reformansätze mehr auf<br />
die Agenda einer amtierenden Regierung gesetzt worden.<br />
<strong>Das</strong> Beispiel der USA zeigt einmal mehr, wie bedeutsam das Versicherungsobligatorium<br />
ist, und wie wichtig es ist, das profitorientierte<br />
Kapital im Gesundheitsbereich möglichst stark zurückzubinden, wenn<br />
wir eine Amerikanisierung des schweizerischen Gesundheitswesens verhindern<br />
wollen. Die Ausrichtung an US-amerikanischen Rezepten ist<br />
aber genau das Ziel von bürgerlichen GesundheitspolitikerInnen und<br />
Wirtschaftsverbänden, denn es lockt der ›Megamarkt Gesundheit‹. Die<br />
meisten KVG-Revisionsvorlagen (Spitalfinanzierung, Managed Care,<br />
Kostenbeteiligung, Pflegefinanzierung) könnten sie, sollten sie umgesetzt<br />
werden, bei der Realisierung dieser Ziele unterstützen.<br />
Anmerkungen und Literatur<br />
1 Colson, Nicole (2003) ›U.S. health care system in crisis‹. In: Socialist Worker Online, 17.10.<br />
www.socialistworker.org/2003-2/472/472_06_Healthcare.shtml).<br />
2 Collins, Sara et al. (2004) ›The Affordability Crisis in U.S. Health Care: Findings from the<br />
Commonwealth Fund Biennial Health Insurance Survey‹ (www.cmwf.org/usr_doc/col<br />
lins_biennial2003_723.pdf).<br />
3 Himmelstein, David, Steffie Woolhandler (2004) ›Mayhem in the Medical Marketplace.<br />
Physicians for a National Health Program‹. In: Monthly Review, Dezember.<br />
4 Devereaux, P.J. et al. (2004) ›Payments for care at private for-profit and private not-forprofit<br />
hospit<strong>als</strong>: a systematic review and meta-analysis‹. In: Canadian Medical Association<br />
Journal, vol. 170, 08.06., 1817–1824.<br />
5 Sullivan, Kip (2003) ›The Health Care Mess. Physicians for a National Health Program‹.<br />
6 Himmelstein, David, Steffie Woolhandler, Sidney M. Wolfe (2003) ›Healthcare Bureaucracy:<br />
US vs. Canada. Connecticut Coalition for Universal Health Care‹ (http://cthealth.<br />
server101.com/healthcare_bureaucracy_u_s__vs__canada.htm).<br />
7 Himmelstein, David, Steffie Woolhandler, Ida Hellander (2001) ›Bleeding the Patient. The<br />
Consequences of Corporate Health Care‹. Philadephia.<br />
8 Heffler, Stephen et al. (2004) ›Health Spending Projections For 2002…2012‹. In: Health Affairs,<br />
11.02., 79–93 (http://content.healthaffairs.org/cgi/reprint/hlthaff.w4.79v1).<br />
9 Beim Vergleich mit der Entwicklung in der Schweiz ist zu beachten, dass die US-Wirtschaft<br />
weitaus höhere Wachstumsraten aufweist <strong>als</strong> etwa die Schweizer Wirtschaft. <strong>Das</strong><br />
Schweizer Gesundheitswesen ist in den Jahren 1990 bis 2001 im Durchschnitt um geringe<br />
2.5% pro Jahr gewachsen, die Schweizer Wirtschaft jedoch um nur 0.2%; v.a. deshalb hat<br />
der Anteil des Gesundheitswesens am BIP auch in der Schweiz deutlich zugenommen.<br />
Jonas, Steven (2003) ›An Introduction to the US Health Care System‹. New York.<br />
Labor Research Association (2004) ›The Employer Based Health Care System is in Crisis‹.<br />
Lazarus, David (2004) ›Health care’s reality‹. In: San Francisco Chronicle, 10.09.
Économie politique<br />
Les inconsistances de Madame<br />
Consommation et de Monsieur Prix<br />
Une chance pour la démocratie économique!<br />
Le 22 février dernier, deux membres connus du Parti socialiste suisse<br />
(PSS), Simonetta Sommaruga et Rudolf Strahm, publiaient un opus<br />
pour ›moderniser‹ la Suisse1 . A peine préméditée, cette sortie de presse<br />
s’opérait alors que le PSS débutait quelques jours plus tard un débat sur<br />
sa ligne en matière politique économique. Un joli coup donc, plutôt<br />
réussi, du moins si l’on juge par la holà médiatique qui a suivi dans la<br />
presse suisse romande2 . Il n’en reste pas moins que si l’on prend le temps<br />
de l’analyse, l’aspect novateur des propositions de S. Sommaruga et R.<br />
Strahm reste inversement proportionnel au bruit médiatique déclenché.<br />
Recourir à la saine concurrence pour créer des emplois ou passer à une<br />
imposition via un taux fiscal unique (flat tax) n’a rien de très révolutionnaire,<br />
sauf à considérer les penseurs libéraux classiques ou Ronald<br />
Reagan comme de dangereux pèlerins du socialisme.<br />
Bien plus que cela, ce sont surtout les »fausses bonnes idées« qui<br />
dérangent et qu’il s’agit ici de critiquer. Une critique pour montrer en<br />
quoi les réformes que proposent S. Sommaruga et R. Strahm ont le goût<br />
amer de contre-réformes violement antisociales, mais aussi une critique<br />
pour démontrer l’existence d’alternatives, en particulier celle de la démocratie<br />
économique. Ce projet de la démocratie économique revêt aujourd’hui<br />
un caractère exemplaire. Il représente une matrice possible à<br />
l’action des mouvements anti-capitalistes, en Suisse et ailleurs. Mieux, il<br />
ouvre la voie au fondement d’un socialisme moderne, humain et libertaire.<br />
Un projet pour faire mentir<br />
ceux et celles qui croient qu’aucune<br />
alternative n’existe et préfèrent<br />
Philipp Müller<br />
1974, historien, membre de la rédaction du<br />
se réconforter en se fixant sur les<br />
mensuel d’opinions socialistes ›Pages de<br />
effets de manche de Madame Con-<br />
gauche‹, du comité directeur du PSS et du<br />
sommation et de Monsieur Prix.<br />
Cercle d’Olten des socialistes de gauche.<br />
Entre un consensus<br />
Yves Steiner<br />
banal et quelques fausses 1973, politologue, membre de la rédaction<br />
bonnes idées<br />
de ›Pages de gauche‹, assistant/doctorant<br />
En 2001 déjà, toujours en con- au Centre Walras Pareto (Université de Lauférence<br />
de presse, S. Sommaruga sanne), chercheur associé à la C.E.A.T.<br />
lançait son premier manifeste de (EPFL).<br />
76 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
77 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Économie politique<br />
gauche ›réformiste‹ au Gurten. En 2005, l’objectif de la conseillère aux<br />
Etats bernoise et de son mentor R. Strahm reste le même: parler franchement<br />
des problèmes que connaît ce pays et formuler des propositions<br />
de réformes concrètes. Objectif partiellement atteint. Certes, nos<br />
deux auteurs couvrent bien des thèmes et donnent une kyrielle d’informations,<br />
histoire de se faire une assez bonne idée de l’état de la Suisse<br />
aujourd’hui. Reste que du côté propositionnel, nos deux apôtres de la<br />
libre concurrence enfoncent, avec violence, des portes ouvertes tout en<br />
présentant leurs idées comme d’authentiques panacées, quoique simplement<br />
et franchement de droite.<br />
Qu’une formation de qualité soit indispensable, que la pauvreté soit<br />
insupportable et qu’il faille se battre pour des salaires minimaux et contre<br />
le travail au noir, que l’AVS doive être renforcée et que l’écologie soit<br />
centrale pour l’avenir de l’humanité, tout le monde à gauche en convient.<br />
Toutefois, ce consensus banal tourne au vinaigre par rapport à<br />
deux questions pourtant essentielles: la fiscalité et le service public.<br />
L’idée plate de la flat tax<br />
Leur première fausse bonne idée ›novatrice‹ n’est en fait pas entièrement<br />
assumée par Madame consommation et Monsieur prix tant elle sent le<br />
souffre néo-conservateur. Lancée il y a une bonne vingtaine d’année par<br />
des économistes proches de feu Ronald Reagan, la revendication d’un<br />
taux fiscal unique a été récemment développée dans la Weltwoche, journal<br />
alémanique relais de l’Union démocratique du centre (UDC). Le<br />
projet est simple: supprimer la progressivité de l’impôt, introduire un<br />
seuil minimal à partir duquel on passe à la caisse et prévoir des ristournes<br />
pour les pauvres ne disposant pas d’un revenu suffisant. La conséquence<br />
l’est également: plus question de taxer les contribuables en fonction<br />
de leur niveau de revenu et donc supprimer toute volonté de faire<br />
de l’impôt un moyen de redistribution effectif des richesses.<br />
Dans leur argument, S. Sommaruga et R. Strahm hésitent et déclarent<br />
que seulement si la droite entre en matière sur certaines concessions, la<br />
gauche social-libérale pourrait soutenir pareil »taux proportionnel«.<br />
L’ennui actuel est, disent-ils, que les hauts salaires et les grandes fortunes<br />
peuvent frauder les pouvoirs publics car il existe trop de lacunes dans<br />
la législation et le secret bancaire protégeant ceux qui ont quelque chose<br />
à cacher. Pour résoudre ce problème qui est aussi vieux que l’est la fiscalité<br />
moderne, il faudrait une harmonisation fiscale et la pénalisation<br />
de l’évasion fiscale. Bref, pour combattre la fraude et augmenter les recettes<br />
de l’Etat, il faut amener ceux et celles qui défendent les intérêts<br />
des fraudeurs à accepter de voter des dispositions de lutte contre la frau-
Économie politique<br />
de afin que la gauche social-libérale admette le principe de la flat tax et<br />
combatte la progressivité de l’impôt.<br />
Cette proposition pour le moins percutante témoigne de l’acharnement<br />
avec lequel R. Strahm notamment défend contre vents et marrées<br />
qu’il est possible de s’allier durablement avec une partie de la droite, en<br />
particulier sur des sujets aussi cruciaux que la politique financière. Comme<br />
le martèlent nos auteurs en fin d’ouvrage: »La concordance ne signifie<br />
pas fraternisation, copinage ou fusions, mais des alliances variables<br />
en fonction des thématiques. Ce sont elles qui feront avancer notre pays<br />
sur des questions décisives. Seulement elles!« (214, traduction libre). Reste<br />
que, et sans céder à la polémique gratuite, ce ne sont pas des alliances<br />
particulièrement variables qui ont caractérisé le débat fiscal dans ce<br />
pays ces quinze dernières années. Cet exemple illustre en fait autre chose.<br />
Pour les deux auteurs, la gauche doit se contenter d’un simple rôle<br />
d’accompagnateur social-libéral du capitaliste triomphant. Ainsi seulement,<br />
elle obtiendra les miettes qu’elle demande aux détenteurs du pouvoir<br />
sur le plan de l’éducation, de la santé ou du social.<br />
Quand la libéralisation détruit l’emploi, mais pas le profit<br />
La seconde bonne fausse idée de S. Sommaruga et R. Strahm, c’est la<br />
libéralisation du dernier kilomètre dans le secteur des télécoms, une idée<br />
qui traîne déjà elle depuis fin 1998 dans les cercles bourgeois et au sein<br />
de l’administration fédérale. Mais alors pourquoi faire plier Swisscom et<br />
ouvrir l’accès à ce fameux dernier kilomètre à n’importe quel opérateur<br />
qui le demanderait? La réponse tient en une phrase: plus de concurrence,<br />
donc plus d’emplois. D’ailleurs, l’ouverture du marché des télécoms<br />
depuis 1998 a prouvé, selon eux, que la libéralisation crée de l’emploi.<br />
Et nos deux modernistes de faire la leçon: »La gauche doit cesser de croire<br />
que son rôle est de protéger les anciens employés des PTT qui sont<br />
devenus Swisscom; elle doit défendre la capacité de tout un secteur à<br />
créer des emplois, chez Orange et Sunrise aussi!« (Le Temps, 23.02.<br />
2005). Le hic, c’est que la libéralisation dans le secteur des télécoms a<br />
plutôt fait office de tueur de jobs.<br />
En matière de chiffres, il est vrai que les opérateurs de télécoms sont<br />
un brin cachottiers. Quant à l’Office fédéral de la communication (OF-<br />
COM), l’autorité de régulation du marché des télécoms en Suisse, celuici<br />
peine à publier ces données, parfois même avec deux ans de retard.<br />
Pas d’excuses cependant pour les modernistes dits de gauche. Ces indications<br />
chiffrées existent bel et bien, comme dans le domaine de l’emploi.<br />
Ainsi, le nombre d’employés chez les trois plus grands opérateurs<br />
du pays que sont Swisscom, Sunrise et Orange (près de 90% des places<br />
78 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
79 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Économie politique<br />
de travail) a fondu d’environ 2’200 unités entre début 1998, date de la<br />
libéralisation, et fin 2004. En sept ans, le secteur a perdu au moins 10%<br />
de ses emplois. Ce chiffre ne dit toutefois rien sur la perte nette d’emplois<br />
chez ces opérateurs, qui s’élève elle à environ 2700 unités depuis<br />
fin 2002. En équivalents plein temps, ce nombre a chuté de 4.8% en<br />
2002, et de 5.3% en 2003. Dans sa Statistique officielle de 2003, l’OF-<br />
COM conclut qu’à fin 2003 »le niveau actuel de l’emploi est désormais<br />
inférieur à celui qui prévalait en 1998« 3 . A la décharge de S. Sommaruga<br />
et R. Strahm, il est vrai que l’OFCOM tient souvent un discours qui<br />
fait la part belle aux baisses de tarifs, déjà moins à la chute du nombre<br />
d’emplois dans les télécoms. Cela dit, le constat reste patent: la libéralisation<br />
n’a pas créé des emplois, et ça même l’OFCOM le dit.<br />
Ce que cet office fédéral ne dit pas, c’est que la libéralisation a contribué<br />
à faire des sous, beaucoup de sous. Là encore, les opérateurs de télécoms<br />
sont encore très cachottiers. Du côté de l’OFCOM étrangement,<br />
les résultats après impôts des opérateurs de télécoms sur sa Statistique<br />
officielle n’apparaissent pas, même en valeur agrégée histoire de protéger<br />
la confidentialité de la comptabilité des entreprises concernées. Reste<br />
que comme dans le cas de l’emploi, et si l’on se concentre sur les trois<br />
principaux opérateurs suisses, quelques indications tombent. En 2003,<br />
et pour la première fois de leur courte histoire, Sunrise et Orange ont<br />
annoncé des chiffres noirs. Curieuse coïncidence. Ou alors, preuve que<br />
les licenciements chez Orange et ceux issus de la fusion Diax/Sunrise<br />
sont tombés à point nommé. Ajouté au profit de Swisscom en 2003, le<br />
bénéfice net de ces opérateurs se montait, selon nos estimations, à 1,8<br />
milliards de francs. En 2004, il se situait à près de 2 milliards. Par employé,<br />
ce profit net était d’environ 102’000 francs en 2004 contre 43’300<br />
francs en 2002. Au final, et depuis la libéralisation, le profit total engrangé<br />
avoisine donc les 16 milliards de francs, soit autant que le prix<br />
des nouvelles lignes ferroviaires alpines. Cela dit, une grande part de ce<br />
profit – plus de 90% – a fini dans l’escarcelle de la Confédération, principale<br />
actionnaire de Swisscom. Mais cela veut surtout dire qu’en cas de<br />
libéralisation du dernier kilomètre, donc d’une baisse des revenus de<br />
Swisscom, s’opéra une redistribution des profits vers l’actionnariat privé<br />
des principaux opérateurs de télécoms en Suisse. Et voilà comment,<br />
une fois encore, creuser les déficits publics.<br />
Pour S. Sommaruga et R. Strahm, leur combat en faveur de la libéralisation<br />
dans les télécoms, ainsi que d’autres de leurs grandes idées, sont<br />
un »contre-projet« 4 (Basler Zeitung, 25.02.2005, p.4) aux thèses d’Avenir<br />
Suisse, le think tank des multinationales suisses, et à celles du Secrétariat<br />
d’Etat à l’économie (Seco). Etonnant. Le Seco ou Avenir Suisse dé-
Économie politique<br />
fendraient-ils aujourd’hui et demain le monopole de Swisscom contre la<br />
libéralisation du secteur des télécoms? Ce n’est pas vraiment ce qu’Avenir<br />
Suisse, amateur de contrevérités, écrit: »dans le sillage de la libéralisation<br />
[des télécommunications], l’emploi a augmenté dans l’ensemble<br />
de la branche [!] […] Le dynamisme du secteur des télécommunications<br />
montre ce qu’il serait possible de faire pour l’électricité, le gaz ainsi que<br />
la Poste et les chemins de fer« 5 . D’où une question: si nos modernistes<br />
souscrivent aujourd’hui à la première, mais fausse, partie de l’énoncé,<br />
que feront-ils demain pour la seconde?<br />
Le projet des sociaux-libéraux, en matière fiscale ou de service public<br />
comme avec les télécoms, doit donc être pris au sérieux. En acceptant<br />
le démantèlement du service public et en s’engageant en faveur de véritables<br />
contre-réformes fiscales, il vise à séduire un hypothétique centre<br />
mou 5 qu’il attire en faisant appel au porte-monnaie de tout un chacun<br />
qui est, il est vrai, grevé par un niveau de prix trop élevé. Or, tout projet<br />
socialiste, toute perspective d’affaiblissement réel de la droite dure,<br />
celle qui dirige ce pays depuis la nuit des temps, est rejetée sous couvert<br />
d’un discours pseudo-musclé sur les soi-disant dysfonctionnements de<br />
l’économie capitaliste.<br />
L’ouvrage de S. Sommaruga et R. Strahm a néanmoins un mérite incontestable.<br />
Il développe un programme et une vision de la Suisse telle<br />
qu’elle devrait être à leurs yeux. Aujourd’hui, les forces de gauche authentiquement<br />
socialistes se doivent d’affirmer avec davantage de conviction<br />
leur projet de société: celui du respect plein et entier des droits<br />
humains et de la démocratie économique. Reste à clarifier pareil projet.<br />
La démocratie économique en débat 6<br />
Sur cette question, il existe désormais un débat au sein du PSS, lancé par<br />
son l’aile gauche, le Cercle d’Olten des socialistes de gauche (www.socialism.ch),<br />
et à ses marges. Un débat qui a notamment trouvé écho dans<br />
les pages de la WochenZeitung 7 et celles du Courrier 8 . La perspective<br />
défendue par les tenants de la démocratie économique trouve ses origines<br />
dans l’entre-deux-guerres. Et elle se résume en une phrase: il n’y a<br />
pas de démocratie politique réelle sans démocratie économique.<br />
En effet, et alors que le monde économique conditionne notre vie<br />
comme aucune autre sphère d’activité, les milieux dirigeants suisses ont,<br />
depuis longtemps déjà, réussi à faire croire que »l’économie, c’est eux«.<br />
Dans les étages de direction des entreprises, les décisions d’importance<br />
se prennent sans le moindre contrôle démocratique. Pourtant, les salarié-e-s<br />
sont bien ceux et celles qui produisent les biens et services, et sans<br />
leur travail et leur consommation, rien ne se passerait. Contre cette in-<br />
80 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
81 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Économie politique<br />
égalité de condition, la démocratie économique vise à une transformation<br />
radicale des structures autoritaires et verticales de l’économie. Une<br />
idée un peu abstraite, mais qui implique un grand nombre de champs<br />
d’action concrets, en entreprise comme sur la place du marché.<br />
Au quotidien, la démocratie économique signifie que la vie matérielle<br />
est une affaire dont la gestion doit incomber à la société dans son entier.<br />
En effet, sans propriété sociale (coopérative, communale, publique) de<br />
biens ou de moyens de production et sans l’introduction de structures<br />
participatives égalitaires dans les entreprises, le contrôle démocratique<br />
du pouvoir économique est un leurre. Dans cette logique, les conseils<br />
d’administration doivent se transformer. Au lieu d’être des instruments<br />
aux mains des détenteurs du capital, ils doivent devenir des organes démocratiques<br />
de la société. Ce qui signifie qu’il convient ici d’instaurer<br />
une représentation paritaire des salarié-e-s, des consommateurs, des<br />
pouvoirs publics et (dans le secteur privé) des propriétaires.<br />
Dans cette voie, le renforcement du contre-pouvoir syndical est une<br />
nécessité pour que celui-ci, lorsqu’il lutte pour les droits et l’émancipation<br />
des salarié-e-s, puisse exercer son rôle charnier en vue de la réalisation<br />
de la démocratie économique. Cela inclut un renforcement des<br />
droits des commissions d’entreprises, de la protection contre le licenciement<br />
des salarié-e-s, en particulier les délégués syndicaux, et de la<br />
transparence des comptes d’entreprise. L’élection des cadres inférieurs<br />
et moyens et les chefs du personnel par les salarié-e-s d’une entreprise<br />
doit être aussi revendiquée. Enfin, il s’agit de lutter pour une humanisation<br />
du travail: en assurant une desserte en crèches, cantines, logements<br />
d’entreprises autogérés, en réduisant le temps de travail, en limitant au<br />
maximum sa pénibilité et en renforçant des éléments de co-gestion des<br />
processus de production.<br />
Face à la mondialisation du capital et aux politiques néolibérales, il est<br />
essentiel de trouver des formes de contrôle social sur les multinationales.<br />
On ne saurait se satisfaire des »codes de conduites« ou autre charte<br />
sociale d’entreprise, ni même de normes internationalement reconnues<br />
mais affranchies de tout mécanisme de sanction. L’appropriation des<br />
moyens de production par un mouvement démocratique venu d’en bas,<br />
leur transformation en outils destinés à satisfaire les besoins de tous et<br />
toutes constitue ainsi un mot d’ordre international et internationaliste.<br />
En Europe par exemple, les conseils d’entreprise européens constituent<br />
un point de départ pour un meilleur contrôle des firmes multinationales<br />
qui se soustraient à l’interventionnisme étatique sur le plan national.<br />
Ce n’est qu’à partir de ces éléments qu’une discussion sérieuse peut<br />
débuter sur la question de la consommation. La démocratie économi-
Économie politique<br />
que implique d’élargir les droits des salarié-e-s mais aussi ceux des consommateurs<br />
et consommatrices. En rejetant le soi-disant impératif de la<br />
production aveugle pour un marché anonyme, producteurs et consommateurs<br />
peuvent s’entendre, au sein d’organisations légitimées démocratiquement,<br />
sur la qualité, la quantité et le prix des biens produits.<br />
Les exemples existent, à l’image du combat exemplaire mené depuis<br />
longtemps par le syndicat paysan suisse Uniterre et la fédération syndicale<br />
paysanne mondiale Via Campesina. Les organisations non gouvernementales<br />
(ONG) ont elles aussi pu fêter quelques succès lors de<br />
campagnes contre des multinationales irrespectueuses (Nestlé, Shell,<br />
BP, etc.) ou dans des secteurs spécifiques (campagne Clean Clothes)<br />
pour faire entendre leurs revendications en faveur d’une production et<br />
d’un commerce justes. Et ici la Suisse a un avantage, dans ce pays où une<br />
lointaine tradition de l’organisation »démocratique« de la consommation<br />
existe. Aujourd’hui, le commerce de détail est dominé par deux grandes<br />
sociétés de consommation dont la structure s’apparente (encore) à<br />
une grande coopérative. Comme chacun et chacune peut devenir<br />
coopérateur, une réorientation de la Coop et de la Migros ne constitue<br />
donc nullement une idée farfelue…<br />
L’entreprise, la consommation, mais aussi le service public. La défense<br />
de ce dernier revêt un aspect central. Ce n’est pas un hasard si les néolibéraux<br />
prennent pour cible privilégiée les secteurs restants du service<br />
public, que ce soit sur le plan national ou au travers d’accords internationaux<br />
tel l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). Face<br />
à ces attaques, il faut renforcer la participation démocratique des salarié-e-s<br />
et des usagers dans la définition de ses missions du service public,<br />
démocratiser sa gestion interne et surtout l’élargir – par exemple au secteur<br />
pharmaceutique ou à l’assurance-maladie.<br />
Un projet unitaire pour la gauche anti-capitaliste<br />
Loin des logorrhées libérales mal assumées par S. Sommaruga ou R.<br />
Strahm, la démocratie économique propose un projet global et un objectif:<br />
faire reculer la logique du profit capitaliste. Les premiers répondront<br />
que cela est utopique. Pourtant, des débuts de réalisation existent.<br />
De Zanon en Argentine à Reconvilier dans le Jura, nombreuses et nombreux<br />
sont les salarié-e-s qui contestent l’omnipuissance patronale. Parallèlement,<br />
les associations de consommateurs et de consommatrices ou<br />
des organisations écologiques oeuvrent, à leur manière, pour la défense<br />
et l’élargissement de la démocratie économique.<br />
La démocratie économique représente aussi un possible dénominateur<br />
commun de l’action des mouvements anti-capitalistes. Elle est le<br />
82 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
83 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Économie politique<br />
fondement d’un socialisme moderne, humain et libertaire. Les mouvements<br />
sociaux, les partis et les ONG devraient s’en souvenir, car depuis<br />
la naissance de la gauche, cette dernière a inscrit la revendication d’une<br />
démocratie intégrale, et donc aussi économique, sur ses étendards. On<br />
mesure ici le niveau de renonciation atteint par nos modernistes. Mais<br />
on mesure surtout combien ce mot d’ordre peut à nouveau rassembler<br />
les forces et passer à l’offensive. Car une telle offensive est urgente. En<br />
lieu et place d’une démocratisation des structures économiques, nous<br />
avons assisté ces dernières années à une évolution inverse: la transformation<br />
du pouvoir économique en pouvoir politique accaparée par une<br />
oligarchie autoritaire. Même dans les pays qui se targuent, comme le fait<br />
la Suisse, d’être un berceau de la démocratie, la démocratie institutionnelle<br />
en tant qu’acquis politique majeur est en danger. Depuis longtemps,<br />
les forces néo-conservatrices ou simplement bourgeoises oeuvrent<br />
ouvertement en faveur de son affaiblissement. Pour leur faire face,<br />
la démocratisation de l’économie permet de dévoiler les contradictions<br />
entre une minorité oligarchique et les droits légitimes de la majorité populaire<br />
tout en ouvrant la perspective d’un changement social radical.<br />
1 ›Für eine moderne Schweiz, Ein praktischer Reformplan‹. Sommaruga est la présidente<br />
de la Fondation pour la protection des consommateurs et conseillère aux Etats bernoise.<br />
Strahm est le Surveillant des Prix, ancien conseiller national bernois (1991–2004).<br />
2 Les quotidiens 24Heures, l’Agefi, la Liberté ou la Tribune de Genève se sont empressés<br />
de rapporter les propos des hérauts de la gauche sociale-libérale, tout en faisant réagir,<br />
comme de bien entendu, d’autres membres du PSS. De sorte que le débat qui s’amorçait<br />
sur le programme économique de ce parti a été, du moins médiatiquement, lu et capturé<br />
au travers des propositions de S. Sommaruga et R. Strahm. Le quotidien Le Temps s’est<br />
lui fait le plus sûr relais de ces propositions. Dans ses colonnes, S. Sommargua devenait<br />
l’incarnation d’une »créativité de gauche« avec »le sourire de l’intelligence«, bref une<br />
»gauche éclairée [qui] a du ressort« (23.02.2005).<br />
3 OFCOM, Statistique officielle des télécommunications 2003. Bienne, octobre 2004, 4. Ce<br />
qui reste difficile à faire admettre à tout le monde, à commencer par le conseiller fédéral<br />
socialiste M. Leuenberger en charge de la libéralisation du dernier kilomètre: »Wir müssen<br />
auch sehen, dass hier in der Branche 6000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden.<br />
Diese haben alle Arbeitsplätze, die bei der Swisscom abgebaut wurden, kompensiert. Ich<br />
muss betonen: Diejenigen Arbeitsplätze, die bei der Swisscom abgebaut wurden, wurden<br />
nicht nur wegen des Konkurrenzdruckes abgebaut, sondern auch wegen der technologischen<br />
Entwicklung. <strong>Das</strong> heisst: Ohne die Marktöffnung, ohne die Konkurrenz wäre es<br />
zu Arbeitsplatzverlusten gekommen, unter dem Strich ist es jedoch nicht dazu gekommen«<br />
(Bulletin officiel, Conseil des Etats, 07.06.2005).<br />
4 Basler Zeitung, 25.2.2005, p. 4.<br />
5 Avenir Suisse, Cavalier Seul, Labor et Fides, 2003, 112.<br />
6 Ce que le syndicaliste repenti, et chroniqueur au quotidien le Temps, Beat Kappeler, appelle<br />
de ses vœux en commentant l’ouvrage de S. Sommaruga et R. Strahm: »Il faudra<br />
peut-être attendre un prochain congrès, lorsque la génération des 30-35 ans dira à ces<br />
vieux idéologues de dégager le terrain, pour qu’enfin les socialistes réalisent qu’ils ont<br />
une chance de gouverner avec la droite éclairée« (Le Temps, 24.02.2005).<br />
6 Cette partie a bénéficié des apports cruciaux d’Adrian Zimmermann.<br />
7 WoZ, 21.10.2004 et 11.11.2004.<br />
8 Le Courrier, 18.1.2005
Unternehmenskultur am Ende?<br />
Anmerkungen zu einem vieldeutigen Konzept<br />
Augenschein in Baden auf dem ehemaligen Industrieareal beim Bahnhof:<br />
Wenig erinnert heute noch an den traditionsreichen Elektrokonzern<br />
BBC, der hier einst seinen grössten Schweizer Standort hatte, und das<br />
ist beabsichtigt: »Zwei Jahre nach der Fusion der BBC mit Asea [im Jahre<br />
1988] setzten die neuen ABB-Verantwortlichen die Vertreter der öffentlichen<br />
Hand mit einer bereits abgeschlossenen Abbruchplanung massiv<br />
unter Druck. Geschichte, Tradition und Kultur der BBC wurden 1990<br />
<strong>als</strong> störend empfunden. […] Die damaligen ABB-Chefs hatten es sich in<br />
den Kopf gesetzt, dass in ihrem Revier nichts mehr an den Produktionsstandort<br />
erinnern sollte.« So beschreibt der Industriearchäologe Hans-<br />
Peter Bärtschi Episoden der Geschichte der Desindustrialisierung in der<br />
Schweiz 1 . Episoden dieser Art kennen wir inzwischen zu Dutzenden,<br />
auch in anderen Wirtschaftssektoren, und mit gleich bleibender Rollenverteilung:<br />
Die international mobile Truppe der Turnaround-Manager<br />
und Fusionsschwindler verlässt, mit reichen Abfindungen eingedeckt,<br />
die Teppichetage des Unternehmens und sucht nach neuen »Herausforderungen«;<br />
Bevölkerung und Arbeitskräfte erleiden derweil existenzielle<br />
Verunsicherung, und das Publikum reibt sich die Augen, weil<br />
kapitales Abzocken einmal mehr ohne juristische Sanktionen über die<br />
Bühne geht. Solche durchzusetzen wäre den HüterInnen der herrschenden<br />
Eigentumsordnung, den KapitalvertreterInnen in Politik und<br />
Wirtschaft, indessen zu beschwerlich. Lieber (und durchaus nicht grundlos)<br />
machen sie sich Gedanken über die sinkende Loyalität und Arbeitsdisziplin<br />
der geprellten Arbeitskräfte. Und rufen mit gewichtiger<br />
Miene nach neuen Vorbildern, nach verbindlichen Unternehmenskulturen.<br />
Wir erkunden in diesem Beitrag den aktuellen Krankheitszustand der<br />
Unternehmenskulturen und die möglichen Hintergründe ihres Verfalls<br />
in schweizerischen Unternehmen. Wir fragen aber auch, ob wir so<br />
etwas wie Unternehmenskulturen wirklich noch brauchen.<br />
Dienst nach Vorschrift<br />
statt Swiss Quality<br />
Im Rahmen einer international<br />
vergleichenden Studie hat die UnternehmensberatungsfirmaGallup<br />
2 Beunruhigendes herausge-<br />
Politische Ökonomie<br />
Walter Schöni<br />
Dr. phil. I, Sozialwissenschafter, Dozent für<br />
Personalentwicklung, Mitglied der Redaktion<br />
Widerspruch, Autor zahlreicher Fachbücher.<br />
84 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
funden: »Eine hohe Anzahl (69%) der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
in der Schweiz machen ›Dienst nach Vorschrift‹, sie besitzen <strong>als</strong>o<br />
– emotional gesehen – ein ambivalentes Verhältnis zu ihrem Job und<br />
sind weniger produktiv <strong>als</strong> Mitarbeitende mit einer hohen emotionalen<br />
Bindung […].« Nach Gallup führt das Defizit an emotionaler Bindung<br />
der Beschäftigten zu tieferer Arbeitsproduktivität und Kundenzufriedenheit<br />
und verursacht so Kosten in der Höhe von »etwa 65 Milliarden<br />
Franken«!<br />
Auch wenn diese grossspurige Diagnose eher im Akquisitionsinteresse<br />
der Unternehmensberater denn in fundierten Analysen begründet<br />
sein dürfte, weist sie immerhin auf eines hin: <strong>Das</strong> Management hat Probleme.<br />
Zwar ist es nicht so, dass die Beschäftigten nichts mehr leisten<br />
möchten, aber die Zahl derer, die noch glauben, dass sich im eigenen<br />
Unternehmen mit Arbeit (viel) Geld verdienen lässt, dass Leistung die<br />
Karrieretür öffnet und die Chancen für alle gleich sind, ist geschrumpft.<br />
Wenn Reorganisationen sich jagen, wenn immer neue und widersprüchliche<br />
Anordnungen ›von oben‹ das berufliche Engagement untergraben<br />
und die Angst vor Arbeitsplatzverlust wächst, ist ›Dienst nach Vorschrift‹<br />
eine nahe liegende Rückzugsposition. Im instabilen Umfeld vermögen<br />
selbst pastorale Ermahnungen der Firmenchefs, wonach vor dem Weltmarkt<br />
alle gleich seien und wir mit Swiss Quality uns behaupten könnten,<br />
den Seelenfrieden im Unternehmen kaum zu retten.<br />
Wie konnte es soweit kommen? Sind es die Übertreibungen der kapitalistischen<br />
Akkumulation, der Boom der Finanzmarktgeschäfte oder<br />
die anhaltende Fetischisierung des Shareholder Value, die den Verfall<br />
von Firmen- und Leistungskultur beschleunigt haben? Sicher ist Rudolf<br />
H. Strahm zuzustimmen, wenn er schreibt: »Die jüngste Spielart des Kapitalismus<br />
der Neunzigerjahre brachte fehlgeleitete und unfähige Wirtschaftseliten<br />
an die Schalthebel der Macht. […] Was haben wir allein im<br />
letzten Jahrzehnt an Blendertum, Managementdoktrinen, Modetheorien<br />
und Schlagwörtern alles erlebt! Was wurde uns da nicht mit grossem<br />
Imponiergehabe von den Konzernzentralen und Beraterfirmen an<br />
revolutionären Scheininnovationen vorgetragen.« <strong>Das</strong> Argument der<br />
fehlgeleiteten Wirtschaftseliten greift jedoch <strong>als</strong> Erklärung eindeutig zu<br />
kurz. Denn hinter ihren Übertreibungen, hinter ihrem Realitätsverlust<br />
und ihrer kriminellen Energie wirkt die Dynamik des kapitalistischen<br />
business as usual, und sie treibt grundsätzlich in dieselbe Richtung: <strong>Das</strong><br />
(Klein-)Aktionariat hofft auf wundersame Gewinnraten durch geschicktes<br />
globales Sourcing, die Bank bindet Kredite an hohe Rentabilitätsvorgaben,<br />
das Management verspricht den Investoren die konsequente<br />
Ökonomisierung aller Unternehmensressourcen – auch des Person<strong>als</strong>.<br />
85 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Politische Ökonomie
Politische Ökonomie<br />
Gerade das ›normale‹ Management hat mit seinen Parolen an die<br />
Adresse der Beschäftigten und mit seinem Opportunismus gegenüber<br />
Shareholdern grossen Anteil an der beklagten Bindungslosigkeit der Arbeitskräfte.<br />
<strong>Das</strong> gilt für privatwirtschaftliche und genauso für öffentlichrechtliche<br />
Unternehmen. Ein kurzer Rückblick auf Managementtrends<br />
in Theorie und Praxis zeigt: Noch vor drei Jahrzehnten erwarteten Unternehmen<br />
von ihren Mitarbeitenden, dass sie sich mit den Unternehmenszielen<br />
identifizieren und die eigene Berufslaufbahn danach ausrichten.<br />
Schon dam<strong>als</strong>, besonders nach den wirtschaftlichen Krisenerfahrungen<br />
der 1970er-Jahre, konnten allerdings viele nicht mehr<br />
ungebrochen an den sicheren Lebensarbeitsplatz glauben. Es folgte die<br />
bis heute anhaltende Periode unternehmerischer Flexibilisierung der<br />
Personalressourcen, begleitet von einer unerbittlichen kulturellen Umwertung:<br />
Die emotionale und soziale Bindung ans eigene Tätigkeitsumfeld,<br />
an den erlernten Beruf wird seither <strong>als</strong> Ausdruck persönlicher Unbeweglichkeit,<br />
eben <strong>als</strong> Flexibilitätshindernis diskreditiert, und ältere<br />
Arbeitnehmende gelten allgemein <strong>als</strong> nicht mehr businesstauglich. <strong>Das</strong><br />
Personalmanagement hat mit seinen Versprechungen, den Personaleinsatz<br />
kostenmässig jederzeit optimal zu halten und die Personalressourcen<br />
regelmässig durchzuscannen, in all den Jahren selber kräftig zu<br />
solchen Wertungen beigetragen und beim Personal Spuren tiefer Verunsicherung<br />
hinterlassen. 3<br />
Wandel des Arbeitsverhältnisses und<br />
der Mitarbeitereinbindung<br />
Die Irrläufe des Managementdiskurses sind nicht einfach auf individuelle<br />
Fehlleistungen der Verantwortlichen zurückzuführen. Sie verweisen<br />
auf einen grundlegenden Wandel in der Arbeitspolitik der Firmen und<br />
im Arbeitsverhältnis selber. Je mehr heute das hohe Lied der eigenverantwortlichen,<br />
sich unternehmerisch verhaltenden Arbeitskraft gesungen<br />
wird, desto mehr gerät in Vergessenheit, dass der Arbeitsvertrag kein<br />
beliebig wählbares Tauschverhältnis (Lohn gegen Leistung) repräsentiert,<br />
sondern ein Machtverhältnis zwischen ökonomisch völlig ungleichen<br />
Parteien. Wer ein Arbeitsverhältnis eingeht, leistet einiges mehr <strong>als</strong><br />
das, was Arbeitsvertrag und Pflichtenheft ausdrücklich verlangen: Sie<br />
oder er unterwirft sich betrieblicher Verfügungsgewalt, akzeptiert (fast)<br />
jeden Unternehmenszweck, fügt sich willkürlichen (mitunter diskriminierenden)<br />
Entscheiden und bringt selber Engagement, körperliche und<br />
psychische Ressourcen in die Arbeitsleistung ein. Dafür jedoch, dass die<br />
Arbeitskraft auf Teile ihrer individuellen Souveränität verzichtet und<br />
körperlichen wie psychischen Verschleiss in Kauf nimmt, erwartet sie zu<br />
86 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Recht nicht nur materielles Entgelt, sondern auch soziale Integration<br />
und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in einigermassen stabilen<br />
Arbeitsverhältnissen. Die wirtschaftliche Wachstumsdynamik der<br />
1950er- bis 1970er-Jahre konnte solche Arrangements aufrechterhalten,<br />
zumindest für die Kernbelegschaften der wachstumsstarken Wirtschaftssektoren<br />
mit ihren überwiegend inländischen, männlichen Beschäftigten.<br />
Die Arrangements werden heute von sehr vielen Unternehmen einseitig<br />
aufgekündigt. Weshalb? Schuld daran ist nicht nur der Trend zur<br />
›Flexibilisierung‹ der Personalressourcen, und auch der Kostendruck<br />
reicht <strong>als</strong> Begründung nicht aus. Dahinter steht eine grundsätzliche Veränderung<br />
des betrieblichen Machtverhältnisses durch die direkte Marktanbindung<br />
der Arbeitskraft. Marktanbindung bedeutet: War bis anhin<br />
die Arbeitskraft im Unternehmen durch Arbeitsvertrag, Kollektivvertrag<br />
und (teilweise) das Arbeitsgesetz vor marktbedingten Schwankungen<br />
und daraus resultierenden Gesundheits- und Existenzrisiken kurzfristig<br />
einigermassen geschützt, so verlagern seit Jahren viele Unternehmen<br />
den ›Markt‹ ganz gezielt ins Unternehmen hinein: Sie heizen mit<br />
Prämien oder Bestrafungen den Wettbewerb zwischen Arbeitsteams an,<br />
führen umsatz- oder produktivitätsabhängige Lohnkomponenten ein,<br />
planen Arbeitseinsätze in Abhängigkeit von Nachfrage und Kapazitätsauslastung<br />
usw. 4 Wird das Arbeitsverhältnis in dieser Weise enger an die<br />
Marktdynamik und ausdrücklich an den ›Weltmarkt‹ angebunden, so<br />
kann manche Inkonvenienz, die früher klar dem Betrieb zuzurechnen<br />
war, heute den Marktmechanismen, den Kundenwünschen oder der<br />
Konkurrenz in der Branche zugeschrieben werden. So ist das Unternehmen<br />
ein Stück weit aus der Verantwortung entlassen. Viele Unternehmensleitungen<br />
versprechen sich höhere wirtschaftliche Vorteile,<br />
wenn sie ihr Personal den Zwangsmechanismen des Marktes aussetzen,<br />
<strong>als</strong> wenn sie das Arbeitsumfeld stabil halten würden.<br />
<strong>Das</strong> hat Konsequenzen für die Firmenkultur und stellt den ›psychologischen<br />
Arbeitsvertrag‹ in Frage. Dieser, ein langjährig bewährtes<br />
Konstrukt der Arbeitspsychologie, erklärte die Dauerhaftigkeit von Arbeitsverhältnissen<br />
damit, dass das Institut des Arbeitsvertrags durch ein<br />
Geflecht von persönlichen Bindungen und Loyalitäten im Arbeitsumfeld,<br />
durch individuelle Lebensentwürfe und Motive ergänzt und stabilisiert<br />
wird. Im Zuge der wirtschaftlichen Deregulierung und Vermarktlichung<br />
des Arbeitsverhältnisses ist nun der psychologische Vertrag<br />
vielerorts aus dem Gleichgewicht geraten, weil Unternehmen dem Ideal<br />
einer stabilen Mitarbeitereinbindung einseitig abgeschworen haben.<br />
Aktuelle Ansätze der Arbeitspsychologie, die Basis des psychologischen<br />
87 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Politische Ökonomie
Politische Ökonomie<br />
Vertrags neu zu begründen – etwa die unzeitgemäss gewordene Arbeitsplatzsicherheit<br />
durch Arbeitsmarktfähigkeit zu ersetzen 5 – , bleiben jedoch<br />
defizitär, da traditionelle Aspekte der Gegenseitigkeit und Dauerhaftigkeit,<br />
die jeden Vertrag kennzeichnen müssen, weitgehend fehlen.<br />
Vage Arbeitgeberversprechen, Mitarbeitenden bei der Erhaltung ihrer<br />
Arbeitsmarktfähigkeit behilflich zu sein, können die mangelnde Stabilität<br />
des Arbeitsverhältnisses kaum wettmachen. Appelle des Managements,<br />
›eigenverantwortlich‹ zu sein und sich im eigenen Interesse beruflich<br />
weiterzuentwickeln, dürften ihre Wirkung verfehlen, da Unternehmensleitungen<br />
ihre Personalressourcen ganz offensichtlich selektiv<br />
bewirtschaften 6 und berufliche Entwicklungschancen willkürlich zuteilen.<br />
7 Die Botschaft selber erweist sich <strong>als</strong> zwiespältig: Zum einen ruft<br />
das Management die Beschäftigten ständig zu unternehmerischem Verhalten<br />
auf und rät ihnen davon ab, sich am Arbeitsplatz in Sicherheit zu<br />
wiegen, zum anderen verlangt es von ihnen, im Falle von Restrukturierungen<br />
geduldig der Dinge zu harren und sich dann den vollendeten<br />
Tatsachen anzupassen.<br />
Die Konsequenzen dieser ambivalenten Personalpolitik sind in einer<br />
Studie des Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrums der Universität Basel<br />
mit seltener Deutlichkeit dokumentiert worden. 8 400 Mitarbeitende der<br />
chemisch-pharmazeutischen Industrie wurden befragt, welche Veränderungen<br />
sie in ihrem Arbeitsumfeld erlebt haben und welche Gefühle<br />
sie damit assoziierten. Resultat: Die Befragten hatten zum Zeitpunkt der<br />
Befragung (im Jahre 2000) innert eines Halbjahres durchschnittlich<br />
mehr <strong>als</strong> sechs wesentliche Veränderungen erlebt: Reorganisationen,<br />
Personalabbau, neue ChefInnen, neues Lohnsystem usw. Zwischen 30%<br />
und 40% der Befragten empfanden nach eigenen Angaben Enttäuschung,<br />
Misstrauen oder Aggression <strong>als</strong> prägendes Gefühl im Arbeitsalltag.<br />
Die negativen Gefühle richteten sich auf das Unternehmen, den<br />
abrupten Wandel und ganz konkret auf das obere Management, weit<br />
weniger häufig dagegen auf das eigene Arbeitsumfeld und die direkten<br />
Vorgesetzten. Viele ManagerInnen scheinen mit ihren Durchhalteparolen<br />
(»Wir sind Worldplayer«, »1. Liga« usw.) und ihrem Verhalten in<br />
Krisensituationen bei vielen Mitarbeitenden jegliche Glaubwürdigkeit<br />
verspielt zu haben.<br />
Eine solche Firmenkultur können sich Konzerne leisten, die in der<br />
Lage sind, mit leicht überdurchschnittlichen Löhnen eine Art Inkonvenienzentschädigung<br />
zu entrichten, und die im übrigen damit rechnen<br />
können, dass zerstörte Motivationen bei der herrschenden Rate der Personalerneuerung<br />
bald einmal durch frische Arbeitskräfte ersetzt werden,<br />
welche die jüngste Reorganisation nicht miterlebt haben. Viele kleinere<br />
88 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
und mittelgrosse Unternehmen dagegen, die ohnehin kaum je zu den<br />
Verfechtern unbegrenzter Personalflexibilisierung gehört hatten und<br />
dem Schweinezyklus der Managementmoden ferner stehen, bekunden<br />
heute ernsthafte Probleme mit der fehlenden Mitarbeiterbindung. Ihnen<br />
geht <strong>als</strong> Folge des Karriereverhaltens gut qualifizierter Angestellter laufend<br />
Wissen verloren, und die Kosten der Personalfluktuation steigen;<br />
dies könnte sich bei einer allfälligen Erholung des Arbeitsmarktes noch<br />
verschärfen. Also zurück zu den goldenen Zeiten, wo strikte Angestelltenloyalität<br />
und Subordination das Bleiberecht im Unternehmen auf<br />
Lebenszeit begründen konnten?<br />
Wir dürfen wählen: Patriarchale oder<br />
modernisierte Unternehmenskultur<br />
Christoph Blocher, begnadeter Kulturvermittler, hat kurz vor seinem<br />
formellen Austritt aus seinem Unternehmen und dem Eintritt in den<br />
schweizerischen Bundesrat in einem Interview die Grundsätze der<br />
Firmenkultur bei der Ems AG zuhanden der Wirtschaft erläutert: »<strong>Das</strong><br />
ist wahre Identifikation: Der Chef ist Teil seiner Angestellten, und die<br />
Mitarbeiter sind Teil ihres Patrons.« 9 Eine bemerkenswerte Devise, die<br />
Erinnerungen weckt an die Ideologie der ›Betriebsgemeinschaft‹, mit<br />
der man in den 1930er-Jahren auch in der Schweiz die sozialen Klassenauseinandersetzungen<br />
einzudämmen und den Einfluss der Gewerkschaften<br />
am Werkstor aufzuhalten versuchte. 10 Möglicherweise soll uns<br />
Blochers Leitspruch aber auch in jene noch früheren Epochen der<br />
Menschheit zurückführen, wo jeder Primat sein eigenes Unternehmen<br />
verkörperte, es sich einverleibte und mit ins Grab nahm. Subtilere, aber<br />
nicht minder gewaltsame Formen der Einverleibung finden wir in den<br />
betont familiären Kulturen von wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen.<br />
11<br />
Wer jedoch weder der Betriebsgemeinschaft huldigt noch sich in den<br />
Unternehmerschoss zurücksehnt, hat ein Unbehagen mit dem Begriff<br />
›Unternehmenskultur‹. Dies dürfte mit seiner Doppeldeutigkeit zusammenhängen.<br />
Zum einen bezieht er sich auf die Tatsache, dass jedes<br />
soziale System einer Kultur bedarf, in der Reflexion und Austausch über<br />
die Organisationszwecke, den sozialen Umgang, über Machtausübung,<br />
das explizite und implizite Wissen der Organisationsmitglieder usw.<br />
möglich werden. Dies schliesst aus, den Begriff der Unternehmens- oder<br />
Organisationskultur ersatzlos zu streichen. Zum anderen ist Unternehmenskultur<br />
ebenso unbestreitbar ein strategisches Instrument der symbolischen<br />
Aufrechterhaltung von Machtstrukturen mit den Mitteln der<br />
Rechtfertigung, der Unterscheidung von Prestigepositionen, der rituali-<br />
89 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Politische Ökonomie
Politische Ökonomie<br />
sierten Einordnung, der Unterordnung unter kaum hinterfragte Zwecksetzungen.<br />
Diese kulturellen Leistungen sind in Wirtschaftsorganisationen,<br />
im übrigen aber auch in staatlichen Apparaten, Kirchenbürokratien<br />
oder Privatarmeen seit jeher Bestandteil der strategischen Planung. Organisationen<br />
des privaten genauso wie des öffentlichen Rechts haben<br />
längst ihre Kommunikations-, Marketing- und Person<strong>als</strong>täbe ausgebaut<br />
und bedienen sich kultureller Strategien des Machterhalts mit der Effektivität<br />
totalitärer Institutionen.<br />
Gibt es Alternativen?<br />
Selbst in der Perspektive der kapitalistischen Wirtschaft, <strong>als</strong>o systemimmanent<br />
betrachtet, liesse sich argumentieren, dass eine Unternehmenskultur,<br />
welche ausschliesslich die instrumentellen Funktionen der<br />
Machterhaltung bedient, auf die Dauer jede Innovation, jede Neuorientierung<br />
im veränderlichen Wirtschaftsumfeld blockieren dürfte. Mit<br />
Blick auf die wirtschaftliche Existenz von Gesellschaften und mündigen<br />
Gesellschaftsmitgliedern kann indessen die Funktion von Unternehmens-<br />
und Organisationskulturen nicht bloss immanent beurteilt werden.<br />
Vielmehr stellt sich die Frage, ob Mitglieder moderner Gesellschaften,<br />
die vielfältige Identitäten haben, ihren Lebensmittelpunkt<br />
<strong>als</strong>o normalerweise nicht in einer bestimmten Organisation finden, ihre<br />
Teilhabe an Organisationen nach selbst gesetzten Kriterien gestalten<br />
können. Denn nur so sind sie in der Lage, in ihrer individuellen Lebensund<br />
Arbeitsgeschichte ein gewisses Mass an psychosozialer, moralischer<br />
und politischer Kohärenz zu erreichen und Teilidentitäten auszubalancieren.<br />
Dies setzt erstens voraus, dass Unternehmenskulturen auf die unbedingte<br />
Einhaltung der Menschenrechte, der Selbstbestimmungs- wie<br />
auch der Wirtschaftsbürgerrechte 12 gegründet sind, und zwar sowohl organisationsintern<br />
<strong>als</strong> auch gegenüber externen Anspruchsgruppen. Die<br />
zweite Voraussetzung ist, dass die Unternehmenskultur für kollektive<br />
Reflexion und Gestaltung offen bleibt. Denn Kultur kann weder Eigentum<br />
einer Firmenleitung noch ein Monolith sein; ganz im Gegenteil reflektiert<br />
sie die vielfältigen Konfliktlinien zwischen den Dringlichkeiten<br />
der alltäglichen Lebensorganisation, den Interessen der Lohnabhängigen<br />
und den Prioritäten der betrieblichen Organisationspolitik. Unternehmenskultur<br />
braucht folglich, wenn sie offen bleiben und nicht zum<br />
Herrschaftsinstrument verkommen soll, eine verfassungsmässige, gesetzliche<br />
und normative Basis. Diese stärkt die Selbst- und Mitbestimmungsrechte<br />
der Beschäftigten und ihrer gewerkschaftlichen Vertretungen<br />
in der Organisation, stellt das volkswirtschaftliche und ökologische<br />
90 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Gesamtinteresse sicher und weist die einzelkapitalistische Räson in<br />
Schranken.<br />
Was bedeutet dies für den Unternehmensalltag? Gewissermassen <strong>als</strong><br />
Gegengewicht zur strukturellen Machthierarchie und Verfügungsgewalt<br />
muss im Unternehmen gewährleistet werden, dass vor jeder grundlegenden<br />
Entscheidung über die Zukunft von Beschäftigten Aushandlungsprozesse<br />
stattfinden können: Prozesse kollektiver Mitbestimmung,<br />
wenn es um Organisationseinheiten geht, Prozesse individuellen Aushandelns,<br />
wenn es um Einzelpersonen geht. Auszuhandeln ist ein Zielkonsens<br />
zwischen Mitarbeiter- und Unternehmensentwicklung, der<br />
folgende Elemente beinhaltet:<br />
• Mitarbeitende sind bereit, ihre Fähigkeiten auf Zeit in den Dienst der<br />
Geschäftstätigkeit zu stellen und sich mit den Anforderungen im Tätigkeitsbereich<br />
weiterzuentwickeln<br />
• das Unternehmen ist bereit, sich mit der bestehenden Belegschaft weiterzuentwickeln,<br />
individuelle Potenziale zu fördern und ein stabiles<br />
Umfeld für eine absehbare Zeitperiode sicherzustellen.<br />
Aushandlungsprozesse müssen wie ein roter Faden die ganze Führungsund<br />
Personalarbeit durchziehen, <strong>als</strong>o jedes Einstellungs- und Entlassungsgespräch,<br />
jedes Mitarbeitergespräch, jede betriebliche Personalplanung,<br />
jede Funktionseinstufung, jede Trainings- und Laufbahnplanung,<br />
jede Weiterbildungsvereinbarung. Stets geht es darum, divergierende<br />
Vorstellungen über berufliche Entwicklungsziele einerseits, über Unternehmens-<br />
und Abteilungsziele andererseits zu identifizieren, sie nach<br />
Möglichkeit ein Stück weit in Einklang zu bringen, allenfalls sogar einen<br />
temporären Machtkompromiss zu finden. Dieser wird sich aber nur einstellen,<br />
wenn einklagbare Rechte und Pflichten zur Mitbestimmung und<br />
Mitgestaltung institutionalisiert sind und das Arbeitsverhältnis Stabilität<br />
aufweist.<br />
Fazit: Die Mehrheit der Erwerbsbevölkerung ist den Zwängen der<br />
Märkte, der Ökonomisierung und Profitsteigerung zunehmend direkt<br />
ausgesetzt, auch und gerade <strong>als</strong> Angestellte mächtiger Wirtschaftsorganisationen.<br />
Diese wären aufgrund ihrer marktbeherrschenden Stellung<br />
in der Lage, ihre Angestellten vor Beschäftigungsrisiken besser zu schützen;<br />
stattdessen verlangen sie mehr Loyalität und Flexibilität – und wälzen<br />
Kosten auf die Allgemeinheit ab, wie die Wirtschaftsgeschichte auch<br />
in der Schweiz drastisch vor Augen führt. Also stellt sich mit Nachdruck<br />
nochm<strong>als</strong> die Frage: Brauchen wir so etwas wie Unternehmenskultur<br />
überhaupt? Oder: Welche Unternehmenskultur brauchen wir? Macht es<br />
Sinn, von Unternehmen eine ›bessere‹, verlässliche, offenere, wertbe-<br />
91 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Politische Ökonomie
Politische Ökonomie<br />
zogene Kultur zu fordern? Benötigen wir vielleicht die Einverleibung<br />
und Umarmung durch geschickte KommunikatorInnen, weil sie uns<br />
Aufmerksamkeit schenken und unser angeschlagenes Selbstwertgefühl<br />
stützen helfen? Solche Fragen aufwerfen heisst bereits, die kulturelle Debatte<br />
zu eröffnen, wirtschaftliche Praktiken der Unternehmen von innen<br />
her in Frage zu stellen, Sachzwänge und angebliche Naturgesetzlichkeiten<br />
zu dekonstruieren. Wird Unternehmenskultur so zu einer Kultur<br />
der Aushandlung zwischen ungleich mächtigen Akteuren, so sind die<br />
Machtverhältnisse im Unternehmen zwar nicht beseitigt; sie werden<br />
jedoch – auch in konfliktiver Weise – thematisierbar, und regressive<br />
unternehmerische Fantasien lassen sich erkennen und zurückweisen.<br />
Unternehmenskultur ist in diesem Verständnis ein Handlungsfeld mit<br />
durchaus harten wirtschaftlichen Konsequenzen, sofern jeder und jede<br />
die Chance wahrnimmt, kollektiv die Ziele des Unternehmens zu reflektieren,<br />
darauf Einfluss zu nehmen und den eigenen Beitrag, die eigene<br />
Rolle zu bestimmen. Dies mag wenig sein, ist aber wesentlich für die<br />
Durchsetzung von mehr Demokratie im Wirtschaftsleben.<br />
92 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Literatur<br />
Bärtschi, Hans-Peter (2004) ›Kilometer Null. Vom Auf- und Abbau der industriellen Schweiz‹.<br />
Zürich (Schriftenreihe der Vontobel-Stiftung Nr. 1660).<br />
Bundesamt für Statistik (Hg.) (2004) ›Weiterbildung in der Schweiz 2003. Auswertung der Arbeitskräfteerhebungen<br />
1996–2003‹. Neuchâtel.<br />
Dörre, Klaus, Bernd Röttger (Hg.) (2003) ›<strong>Das</strong> neue Marktregime. Konturen eines nachfordistischen<br />
Produktionsmodells‹. Hamburg.<br />
Kiefer, Tina, Werner R. Müller, Sabine Eicken (2001) ›Befindlichkeit in der Chemischen Industrie‹.<br />
Basel (WWZ-Studie Nr. 59).<br />
Raeder, Sabine, Gudela Grote (2003) ›Arbeitsmarktfähigkeit ersetzt Arbeitsplatzsicherheit‹.<br />
In: Die Volkswirtschaft, Nr. 11.<br />
Schöni, Walter (1999) ›Personalförderung und Macht im betrieblichen Sozi<strong>als</strong>ystem‹. In: Walter<br />
Schöni, Karlheinz Sonntag (Hg.) ›Personalförderung im Unternehmen‹. Zürich.<br />
Schöni, Walter (2000) ›Die unternehmerische Arbeitskraft. Eine neue Leitfigur neoliberaler<br />
Wirtschaftspolitik‹. In: Widerspruch, H. 39.<br />
Staehle, Wolfgang H. (1994) ›Management. Eine verhaltenswissenschaftliche Perspektive‹.<br />
München.<br />
Strahm, Rudolf H. (2004) ›Die sieben Realitäten des Kapit<strong>als</strong>‹. In: Tito Tettamanti (Hg.) ›Kapitalismus.<br />
Fluch oder Segen? Eine Debatte‹. Zürich.<br />
Ulrich, Peter (2005) ›Zivilisierte Marktwirtschaft. Eine wirtschaftsethische Orientierung‹.<br />
Zürich.<br />
Wood, Gerald (2005) ›Engagement, Motivation und emotionale Bindung‹. In: HR Today, Nr. 7/8.<br />
Anmerkungen<br />
1 vgl. Bärtschi 2004.<br />
2 vgl. Wood 2005. Gerald Wood ist Geschäftsführer der Gallup GmbH.<br />
3 Interessant ist, wie solche Wertungen im Personalbereich selber durchschlagen, insbesondere<br />
in Personalfachzeitschriften: In aufdringlichen Fotos und Stories von smarten<br />
und karrieregeilen Personalfachleuten und PersonalberaterInnen, die sich für Personalarbeiten<br />
jeder Art empfehlen.<br />
4 vgl. Dörre/Röttger 2003.<br />
5 vgl. Raeder/Grote 2003.<br />
6 vgl. Schöni 1999.<br />
7 Diese Willkür findet ihren Reflex in dem von der amtlichen schweizerischen Bildungsstatistik<br />
alle paar Jahre replizierten Befund, wonach Frauen, Teilzeitbeschäftigte und<br />
wenig Qualifizierte bei ihrer beruflichen Weiterbildung von den Unternehmen signifikant<br />
weniger unterstützt werden (vgl. Bundesamt für Statistik 2004).<br />
8 vgl. Kiefer et al. 2001.<br />
9 Interview mit Christoph Blocher. Von Matthias Ackeret und Oliver Prange. November 2002<br />
(www.persoenlich.com).<br />
10 <strong>Das</strong> deutsche ›Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit‹ aus dem Jahre 1934 brachte<br />
die Vision der organischen Betriebsgemeinschaft auf den Punkt: »Im Betriebe arbeiten<br />
der Unternehmer <strong>als</strong> Führer des Betriebes, die Angestellten und Arbeiter <strong>als</strong> Gefolgschaft<br />
gemeinsam zur Förderung der Betriebszwecke und zum gemeinen Nutzen von<br />
Volk und Staat.« Zit. nach Staehle (1994, 19).<br />
11 So wird dem Gründer von IKEA, Ingvar Kamprad, ein ausgeprägtes »Management durch<br />
Umarmung« nachgesagt (Stern-Interview mit I. Kamprad: ›IKEA ist Kult‹; www.stern.de/<br />
wirtschaft/unternehmen). Andere Beispiele oraler unternehmerischer Objektbeziehung<br />
sind aus Firmen der New Economy bekannt.<br />
12 Wirtschaftsbürgerrechte umfassen unter anderem Rechte zur autonomen Lebensgestaltung,<br />
demokratische Mitbestimmung und egalitäre Sicherung der Grundexistenz (vgl.<br />
Ulrich 2005). <strong>Das</strong> Konzept der Wirtschaftsbürgerrechte hat den Vorteil, dass es mit dem<br />
Selbstverständnis liberaler Grundrechte die Autokratie des Kapit<strong>als</strong> in Frage stellt; es bedarf<br />
aber der Erweiterung um politische Ansäze zur Demokratisierung des Wirtschaftslebens,<br />
sonst bleibt es bei der abstrakten Gegenüberstellung von Grundrechtspostulaten<br />
und (weitgehend) rechtloser Realität.<br />
93 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Politische Ökonomie
Politische Ökonomie<br />
Chancen und Risiken des<br />
freien Personenverkehrs<br />
Mit Schengen/Dublin und der erweiterten Personenfreizügigkeit<br />
regelt die Schweiz das Verhältnis zur EU neu<br />
Vom EWR-Nein bis zu den bilateralen Abkommen<br />
1992 lehnten die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den<br />
Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ab, und zwar mit<br />
einem ganz knappen Volksmehr. Gewerkschaften wie auch Arbeitgeber<br />
befürworteten den Beitritt. Die populistische Rechte unter Führung der<br />
SVP buchte mit der Ablehnung einen ihrer ersten politischen Grosserfolge.<br />
Gegen den Beitritt sprachen sich dam<strong>als</strong> auch Kreise der linksgrünen<br />
Bewegung aus, allerdings mit ganz verschiedenen Argumenten.<br />
Ein wichtiges Argument der links-grünen EWR-Gegner wurde auch<br />
lange innerhalb der Gewerkschaften diskutiert: Der EWR hätte zwar die<br />
vollständige wirtschaftliche Integration in die EU gebracht, eine echt politische<br />
Mitbestimmung wäre aber nach wie vor nur durch einen EU-Beitritt<br />
möglich gewesen. Immerhin: Als EWR-Mitglied hätte die Schweiz<br />
den gesamten politischen Acquis übernehmen müssen, <strong>als</strong>o auch die<br />
gesamten sozial- und umweltpolitischen Mindestbestimmungen der EU.<br />
Durch das so genannte Euro-Lex sollte die Schweizer Gesetzgebung an<br />
den EU-Standard angepasst werden. Dies hätte auch die Anerkennung<br />
der europäischen Sozialcharta und die Verbesserung des Schweizer<br />
Sozial- und Arbeitsrechts in diversen Bereichen bedeutet.<br />
Die Gewerkschaftslinke in der Schweiz war in einem Dilemma. Mit<br />
dem 1989 aufgelegten Binnenmarktprojekt und der geplanten Wirtschafts-<br />
und Währungsunion im Maastrichter Vertrag verfolgte die EU<br />
ein marktwirtschaftliches Projekt, das den Wettbewerb nochm<strong>als</strong> ankurbeln<br />
und alle noch vorhandenen wettbewerbshemmenden Faktoren<br />
innerhalb der Gemeinschaft beseitigen sollte. Allerdings wollte die<br />
damalige EG-Kommission unter dem gewerkschaftsnahen Präsidenten<br />
Delors dafür sorgen, dass das Binnenmarkt-Projekt durch einen umfangreichen<br />
Katalog von sozialen Mindeststandards und eine EU-Beschäftigungspolitik<br />
begleitet wird, wovon die Schweiz ebenfalls profitiert<br />
hätte. Zudem befürchtete die Linke, dass sich die Schweiz durch ein Nein<br />
zum EWR auf einen isolationistischen<br />
Kurs begeben würde, der<br />
Hans Baumann<br />
von der populistischen Rechten 1948, lic. rer. pol. MAES, Ökonom der Ge-<br />
bestimmt wird. <strong>Das</strong> Abwägen die- werkschaft Unia.<br />
94 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
ser Argumente führte schliesslich zur Position des ›kritischen Ja‹ der Gewerkschaftslinken.<br />
Man kritisierte <strong>als</strong>o einerseits das vom neoliberalen<br />
Geist geprägte Projekt der Wirtschafts- und Währungsunion, anerkannte<br />
aber gleichzeitig die sozialen Fortschritte in der EU und die Tatsache,<br />
dass der Kampf für soziale Mindestsicherung und für Beschäftigung in<br />
Europa nicht isoliert von der Schweiz aus geführt werden kann, sondern<br />
nur im Verbund mit den fortschrittlichen Kräften in den anderen europäischen<br />
Ländern. In diesem Sinn wurde der EWR-Beitritt <strong>als</strong> wichtige<br />
Vorstufe für einen EU-Beitritt, der dann auch die politische Mitbestimmung<br />
beinhalten würde, befürwortet.<br />
Unterschätzt haben die Gewerkschaften dam<strong>als</strong> die Ängste der Bevölkerung<br />
vor der Öffnung des Arbeitsmarktes. Tatsächlich stellte sich nach<br />
der knapp verlorenen Abstimmung über den EWR-Beitritt heraus, dass<br />
die Angst vor Lohndumping und Arbeitslosigkeit durch die Einführung<br />
des freien Personenverkehrs mit den EU-Ländern bei vielen Arbeitnehmerinnen<br />
und Arbeitnehmern den Ausschlag gegeben hat, um ein<br />
Nein zum EWR-Beitritt einzulegen. Offensichtlich hatten es Gewerkschaften<br />
und Linke versäumt, hier die richtigen Forderungen zu stellen,<br />
um mittels Übergangsfristen und sozialpolitischen Reformen im Innern<br />
eine Situation zu schaffen, in welcher der freie Personenverkehr ohne<br />
Nachteile für die Beschäftigten der Schweiz eingeführt werden kann.<br />
<strong>Das</strong>s der freie Personenverkehr und die Dienstleistungsfreiheit in Europa<br />
zu Sozial- und Lohndumping führen kann, war dam<strong>als</strong> auch noch<br />
nicht offensichtlich: Die Erfahrungen in der EU in den 1970er- und<br />
1980er-Jahren wiesen eher in die andere Richtung: der freie Personenverkehr<br />
und die offenen Grenzen hatten bisher nicht zu einer weiteren<br />
Arbeitsmigration von den südeuropäischen zu den nördlichen EU-Ländern<br />
geführt und kaum Lohn- und Sozialdumping verursacht.<br />
Erst mit der zunehmenden Globalisierung, dem Binnenmarktprojekt<br />
der EU, der Liberalisierung der Dienstleistungen und des öffentlichen<br />
Beschaffungswesens kam es vermehrt zur ›erzwungenen‹ Arbeitsmigration.<br />
<strong>Das</strong> heisst, dass etwa im früher regional tätigen, gewerblichen Bausektor<br />
vermehrt Arbeitnehmende von ihren Unternehmen in andere<br />
Länder ›entsandt‹ wurden, was bei wesentlich unterschiedlichen Arbeitskosten<br />
zwischen den Ländern zu Lohndumping führte. Im Verlaufe der<br />
1990er-Jahre verlangten deshalb die Gewerkschaften in Europa die<br />
Durchsetzung des Prinzips des gleichen Lohns für gleichwertige Arbeit<br />
am gleichen Ort (Ausführungsortsprinzip), was schliesslich in der EU<br />
1996 zur Annahme der Entsenderichtlinie führte, welche den Mitgliedsländern<br />
dieses Prinzip vorschrieb und auch Grundlage des schweizerischen<br />
Entsendegesetzes wurde.<br />
95 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Politische Ökonomie
Politische Ökonomie<br />
Nach der Niederlage beim EWR-Beitritt befürwortete die bürgerliche<br />
Mehrheit den Ausbau des bilateralen Weges und Ende der 1990er-Jahre<br />
wurde mit der EU das bilaterale Abkommen I mit sieben Paketen<br />
ausgehandelt, deren wichtigste das Transitverkehrsabkommen und der<br />
freie Personenverkehr waren.<br />
Linke und Gewerkschaften distanzierten sich zunächst vom bilateralen<br />
Weg, der vor allem der Kapit<strong>als</strong>eite nützt, und hätten sich lieber<br />
einen neuen Anlauf für den vollständigen EU-Beitritt gewünscht. Die<br />
zögerliche Politik des Bundesrates und der gestärkte populistische und<br />
isolationistische bürgerliche Flügel unter Führung der SVP verunmöglichten<br />
jedoch einen solchen Schritt. Die Gewerkschaften befürworteten<br />
deshalb das bilaterale Abkommen I <strong>als</strong> wichtigen Schritt zur wirtschaftlichen<br />
Integration der Schweiz in die EU. Diesmal jedoch wollte man<br />
den Fehler von 1992 nicht wiederholen und verlangte flankierende<br />
Massnahmen zum Schutz gegen Lohn- und Sozialdumping durch den<br />
freien Personenverkehr. Diese konnten schliesslich durchgesetzt werden<br />
und fanden auch das Vertrauen der Bevölkerung, welche das bilaterale<br />
Abkommen I 1999 in einer Volkabstimmung befürwortete.<br />
Im Jahr 2004 wurde mit der EU das bilaterale Abkommen II ausgehandelt,<br />
das <strong>als</strong> wichtigste Dossiers das Dublin/Schengen-Abkommen<br />
und die Zinsbesteuerung beinhaltet. Hinzu kam eine Zusatzvereinbarung<br />
zum bilateralen Abkommen I über die Ausdehnung des freien<br />
Personenverkehrs auf die neuen EU-Länder in Mittel- und Osteuropa.<br />
2005 wurde über diese beiden Abkommen abgestimmt, welche nicht<br />
nur eine fast vollständige, wirtschaftliche Integration der Schweiz in die<br />
neue, erweiterte EU bedeuten, sondern mit dem Dublin/Schengen-<br />
Abkommen zum ersten Mal gewichtige politische Implikationen haben.<br />
Die politische Mitsprache der Schweiz an der möglichen Weiterentwicklung<br />
des Schengen/Dublin-Abkommens bleibt jedoch weiterhin<br />
ein Flickwerk: ein offensichtlicher Nachteil des bilateralen Weges, der<br />
nicht ausgeräumt werden konnte, da wirkliche Mitbestimmung an der<br />
Weiterentwicklung des EU-Rechts nur durch einen Vollbeitritt zur EU<br />
möglich ist. <strong>Das</strong> Gleiche gilt für die Übernahme des ›sozialen Acquis‹<br />
der EU.<br />
Trotz der teilweise berechtigten Kritik am bilateralen Weg und der Abschottungspolitik<br />
der EU, die durch das Schengen/Dublin-Abkommen<br />
und dem Begriff ›Festung Europa‹ symbolisiert wird: Der Beitritt zu<br />
Schengen/Dublin ist mit dem freien Grenzübertritt eine logische Weiterentwicklung<br />
des Abkommens über den freien Personenverkehr und<br />
des Verhältnisses der Schweiz zur EU. Aus gewerkschaftlicher Sicht<br />
bringt Schengen/Dublin nicht unbedeutende Erleichterungen für die in<br />
96 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
der Schweiz tätigen Arbeitnehmenden aus den EU-Ländern, aber auch<br />
für die in der Schweiz tätigen Immigranten aus Drittländern, die endlich<br />
ohne die bisherigen Visumsprobleme bei der Durchreise durch ›Schengenland‹<br />
in die Schweiz ein- und ausreisen können. Der Schweizerische<br />
Gewerkschaftsbund hatte deshalb das bilaterale Abkommen II mit<br />
Schengen/Dublin befürwortet. Im Juni 2005 haben die Stimmbürger<br />
dem Schengen/Dublin-Abkommen mit fast 55 Prozent Ja-Anteil zugestimmt.<br />
Für die Gewerkschaften ist zweifellos die Ausdehnung des freien Personenverkehrs<br />
auf die neuen EU-Länder die wichtigere Neuerung, die<br />
2006 zusammen mit dem bilateralen Abkommen II in Kraft treten soll<br />
und das Verhältnis zur EU entscheidend verändern wird. Die extreme<br />
Rechte (Schweizer Demokraten), die Mehrheit der SVP und ein linkes<br />
Komitee um die MPS/BFS (Bewegung für den Sozialismus) bekämpften<br />
die Ausdehnung des freien Personenverkehrs.<br />
<strong>Das</strong> Abkommen über den freien Personenverkehr<br />
Gemäss dem bilateralen Abkommen I, das 2002 in Kraft trat, wurden<br />
ab Juni 2004 der Inländervorrang und die präventive Kontrolle der Arbeitsverträge<br />
für Arbeitnehmende aus den ›alten‹ EU-Ländern abgeschafft.<br />
Kurzaufenthalter, Selbständige und entsandte Arbeitnehmer (bis<br />
zu vier Monaten) brauchen keine Bewilligung mehr, sondern müssen<br />
nur gemeldet werden. Für die anderen gelten noch Kontingente bis zum<br />
Jahr 2007. Dann werden diese provisorisch aufgehoben und die<br />
Bewilligungspflicht entfällt für alle Personen aus den ›alten‹ EU-Ländern.<br />
Eine einseitige Schutzklausel bleibt aber bis 2014 Aufrecht erhalten<br />
(siehe Darstellung 1).<br />
Der freie Personenverkehr mit den acht neuen EU-Ländern Mittelund<br />
Osteuropas wird schrittweise und nach einem besonderen Rhythmus<br />
eingeführt. Grundsätzlich erhält die Schweiz eine Übergangsfrist bis<br />
zum 30. April 2011. Bis dann werden von der Schweiz noch arbeitsmarktliche<br />
Beschränkungen vorgeschrieben. So werden der Inländervorrang<br />
und die präventive Kontrolle der Arbeitsverträge gemäss der<br />
heutigen Ausländerverordnung aufrechterhalten. Gleichzeitig bleiben<br />
die Zulassungsbeschränkungen bestehen und gibt es aufsteigende Kontingente<br />
für die neuen EU-Länder (bis 2011 max. 3000 Daueraufenthalter<br />
und 29’000 Kurzaufenthalter). Grenzüberschreitende Dienstleistungen<br />
im Bau, Gebäudereinigung, Sicherheit und Gartenbau sowie<br />
Aufenthalte unter vier Monaten unterstehen ebenfalls diesen Beschränkungen.<br />
<strong>Das</strong> heisst auch, dass für all diese Arbeitsverhältnisse weiterhin<br />
die Bewilligungspflicht besteht.<br />
97 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Politische Ökonomie
2011 werden dann diese Beschränkungen und auch die Kontingente<br />
aufgehoben. Ab dann bleibt die einseitige Schutzklausel, die auch gegenüber<br />
den anderen EU-Ländern gilt, bis 2014 in Kraft. Folglich können<br />
bei einem ausserordentlichen Anstieg der Zuwanderung wieder einseitig<br />
Kontingente eingeführt werden. Ab 2014 gilt dann nur noch eine<br />
allgemeine Schutzklausel (siehe Darstellung 1).<br />
Darstellung 1: Fristen und Etappen des freien Personenverkehrs CH–EU<br />
Bisherige<br />
EU-Länder<br />
Neue EU-Länder<br />
Politische Ökonomie<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />
Die anderen Bereiche des bilateralen Abkommens I werden ab 2005<br />
ohne Einschränkung auf die neuen EU-Länder ausgedehnt (<strong>als</strong>o auch<br />
die Liberalisierung des öffentlichen Beschaffungswesens).<br />
Gemäss dem bilateralen Abkommen I kann die Schweiz zwischen<br />
2007 und 2009 über die Fortführung des Abkommens zur Personenfreizügigkeit<br />
nochm<strong>als</strong> neu entscheiden, <strong>als</strong>o das Abkommen auch aufkündigen,<br />
sofern die Erfahrungen damit negativ sind. So wird es nach<br />
2007 wahrscheinlich nochm<strong>als</strong> ein Referendum über den freien Personenverkehr<br />
geben. <strong>Das</strong> Gleiche gilt bei einer Ausdehnung des freien<br />
Personenverkehrs auf die EU-Kandidaten Rumänien und Bulgarien,<br />
welche die EU zweifellos verlangen wird.<br />
Die flankierenden Massnahmen I<br />
und die ersten Erfahrungen<br />
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit dem freien Personenverkehr<br />
in den anderen europäischen Ländern und den eigenen Erfahrungen mit<br />
entsandten Arbeitnehmern auf den internationalen Alptransit-Baustellen<br />
verlangten die Schweizer Gewerkschaften bereits für die bilateralen<br />
Abkommen I umfangreiche Massnahmen für den sozialen Schutz. Nach<br />
massivem Druck und langen Verhandlungen mit den Arbeitgebern<br />
konnten sie 1999 flankierende Massnahmen mit folgenden Kernelementen<br />
durchsetzen:<br />
98 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
• Ein Entsendegesetz, das anlehnend an die europäische Entsenderichtlinie<br />
für entsandte Arbeitnehmer die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften<br />
und der Lohn- und Arbeitszeitregelungen in Gesamtarbeitsverträgen<br />
am Ort der Ausführung vorschreibt. Unterstellt wurden alle<br />
Branchen und nicht nur, wie teilweise in anderen Ländern, die typischen<br />
Entsendebranchen wie das Baugewerbe.<br />
• Die Errichtung tripartiter Kommissionen zur Vermeidung von Lohnund<br />
Sozialdumping in Branchen ohne allgemeingültigen GAV. In Bereichen<br />
mit allgemeingültigen GAV erhielten die paritätischen Kommissionen<br />
die Kompetenz, den Vollzug des Entsendegesetzes zu gewährleisten.<br />
• Die erleichterte Erklärung zur Allgemeingültigkeit der GAV in Fällen<br />
von offensichtlichem Missbrauch.<br />
• Die Möglichkeit zur Einführung von staatlichen Mindestlöhnen in<br />
Normalarbeitsverträgen, ebenfalls bei offensichtlichem Missbrauch in<br />
Bereichen, die nicht bereits durch GAV oder vertragliche Mindestlöhne<br />
abgesichert sind.<br />
Letztere Massnahmen müssen die tripartiten Kommissionen bei den<br />
Kantonen respektive beim Bund beantragen, sofern sie wiederholt Missbräuche<br />
feststellen. Die Möglichkeit zur Einführung von verbindlichen,<br />
staatlichen Mindestlöhnen in Branchen ohne GAV bedeutet eine fast revolutionäre<br />
Neuerung im Schweizer Arbeitsrecht und einen interessanten<br />
Mittelweg zwischen den Ländern mit der Tradition eines staatlichen<br />
Mindestlohns für alle (Frankreich oder Grossbritannien) und der absoluten<br />
Tarifautonomie wie im deutschen oder skandinavischen Modell<br />
der Sozialbeziehungen.<br />
Gemäss einer Analyse der zuständigen Bundesämter führte das Abkommen<br />
über den freien Personenverkehr seit 2002 nicht zu einer Zunahme<br />
der Einwanderung von Arbeitskräften und hatte auch kaum Einfluss<br />
auf die Arbeitslosenquote. Erst die Einführung der zweiten Phase<br />
im Juni 2004 mit der Abschaffung der präventiven Kontrollen und den<br />
neuen, bewilligungsfreien Kategorien von Kurzaufenthaltern brachte<br />
vom Juni bis November 2004 eine Zunahme an kurzfristigen Arbeitsverhältnissen<br />
von Immigranten.<br />
Die ersten Erfahrungen mit der zweiten Phase der Freizügigkeit zeigten<br />
auf, dass die tripartiten Kommissionen in keiner Weise auf die zahlreichen<br />
bewilligungsfrei in die Schweiz kommenden Arbeitsimmigranten<br />
und entsandten Arbeitnehmenden aus den alten EU-Ländern vorbereitet<br />
waren. Von Juni bis November 2004 wurden den Arbeitsämtern<br />
rund 40’000 Personen gemeldet, die bewilligungsfrei entweder für drei<br />
Monate bei Schweizer Arbeitgebern, <strong>als</strong> Entsandte für ausländische Un-<br />
99 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Politische Ökonomie
Politische Ökonomie<br />
ternehmen oder zu einem kleinen Teil auch <strong>als</strong> selbständig Erwerbende<br />
in der Schweiz die Arbeit aufnehmen wollten. Hinzu kommt eine Dunkelziffer<br />
von Personen, die ungemeldet in der Schweiz die Arbeit aufnahmen.<br />
Wie zu erwarten war, ergab sich ein Schwerpunkt im Baugewerbe<br />
(vor allem Entsandte) und – von Experten weniger erwartet – bei<br />
Temporärfirmen (Personalverleih):<br />
Darstellung 2: Anzahl meldepflichtiger Personen nach Wirtschaftszweig und<br />
Ausländergruppe (Juni bis November 2004)<br />
Schon bald nach dem 1. Juni nahmen Missbräuche im Sinne von Lohnund<br />
Sozialdumping deutlich zu. Die Ergebnisse verschiedener kantonaler<br />
Kontrollorgane deckten sich dabei augenfällig. Von den kontrollierten,<br />
nach dem neuen Regime gemeldeten Arbeitsverhältnissen waren<br />
jeweils knapp die Hälfte nicht korrekt, das heisst, die entsprechenden<br />
Arbeitgeber hielten sich nicht an die Mindestlöhne, die vorgeschriebenen<br />
Zulagen oder an die Arbeitszeitbestimmungen. Dabei wurden fast<br />
ausschliesslich nur Arbeitsimmigranten im Baugewerbe kontrolliert, da<br />
dort die Kontrollorgane einigermassen funktionieren. Vor allem die<br />
Gewerkschaft UNIA hat dann einige spektakuläre Fälle aufgedeckt. Im<br />
Baugewerbe der deutschen Schweiz waren es insbesondere deutsche<br />
Unternehmen, welche die hohe Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland ausnützen<br />
und mit ostdeutschen Beschäftigten in die Schweiz kommen. In<br />
vielen Fällen wurden den Bauleuten rund 10 Euro pro Stunde bezahlt.<br />
<strong>Das</strong> entspricht zwar dem (ost-)deutschen Mindestlohn, ist aber nur<br />
knapp die Hälfte dessen, was der Schweizer GAV vorschreibt. Missbräuche<br />
gab es häufig auch bei den Zulagen und bei der Arbeitszeit.<br />
Deutsche Zimmereifirmen arbeiteten teilweise 12 Stunden im Tag und<br />
liessen die Arbeiter gleich auf der halbfertigen Baustelle schlafen.<br />
Auch Schweizer Temporärfirmen schalteten schnell: Seit dem Juni<br />
100 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
2004 lassen sie sich von Agenten im Ausland billige Arbeitskräfte vermitteln<br />
und verleihen diese an Schweizer Arbeitgeber, oft unter den<br />
ortsüblichen oder in GAV festgeschriebenen Löhnen. Teilweise vermitteln<br />
deutsche Arbeitsämter auch direkt an Schweizer Temporärfirmen!<br />
Ausserdem wurden Firmen kontrolliert, welche diese Verleiharbeiter<br />
sogar zu einem Stundenlohn von unter 10 Schweizer Franken beschäftigten…<br />
Die EU-Erweiterung und<br />
die flankierenden Massnahmen II<br />
Bereits 2002/2003 während der Verhandlungen mit der EU über die<br />
Ausdehnung des freien Personenverkehrs auf die neuen EU-Länder<br />
stellten die Gewerkschaften die Forderung nach einer längeren Übergangsphase<br />
mit Fortführung der Kontrollen der Arbeitsverträge. Diese<br />
Forderung wurde damit begründet, dass das Wohlstandsgefälle zwischen<br />
den meisten neuen EU-Ländern und der Schweiz noch um ein<br />
Vielfaches grösser sei <strong>als</strong> zwischen den alten EU-Ländern und der<br />
Schweiz. Zudem ist die Arbeitslosigkeit in diesen Ländern in der Regel<br />
höher und der soziale Schutz kleiner. Dies macht es für Firmen aus den<br />
neuen EU-Ländern attraktiv, mit eigenen Leuten und tiefen Arbeitskosten<br />
in die Schweiz zu kommen und ihre Dienstleistung anzubieten.<br />
Darstellung 3: Arbeitskosten in der Industrie in Euro im Jahr 2003<br />
Norwegen<br />
Dänemark<br />
Westdeutschland<br />
Schweiz<br />
Finnland<br />
Belgien<br />
Niederlande<br />
Schweden<br />
Österreich<br />
Luxemburg<br />
Frankreich<br />
USA<br />
Grossbritannien<br />
Japan<br />
Irland<br />
Ostdeutschland<br />
Kanada<br />
Italien<br />
Spanien<br />
Griechenland<br />
Portugal<br />
Tschechische Rep.<br />
Ungarn<br />
Polen<br />
Slowakei<br />
101 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
4.30<br />
4.04<br />
3.26<br />
3.22<br />
Politische Ökonomie<br />
7.00<br />
10.18<br />
28.15<br />
27.33<br />
27.09<br />
25.60<br />
24.03<br />
23.80<br />
23.20<br />
22.77<br />
21.32<br />
21.15<br />
20.15<br />
19.91<br />
18.72<br />
18.28<br />
18.11<br />
16.86<br />
16.83<br />
16.69<br />
15.97<br />
0 5 10 15 20 25 30
Politische Ökonomie<br />
Ein zusätzliches Problem ist, dass die Beschäftigten in den meisten neuen<br />
Ländern der EU wenig gewerkschaftliche Tradition haben und die<br />
gewerkschaftlichen Kontakte zu diesen Ländern wenig entwickelt sind,<br />
was eine Durchsetzung von GAV-Bestimmungen oder gar eine Koordinierung<br />
von tarifvertraglichen Bestimmungen, wie sie mit den Nachbarländern<br />
der Schweiz teilweise vorhanden ist, erschwert.<br />
Mit der Übergangfrist bis 2011/2014 und den relativ kleinen, allmählich<br />
ansteigenden Kontingenten wurde bezüglich der Fristen eine befriedigende<br />
Lösung gefunden. Der SGB hatte aber zusätzlich schon im<br />
Mai 2003 (nach monatelanger intensiver Diskussion, vor allem in der<br />
damaligen GBI) einen Forderungskatalog für die Verbesserung der flankierenden<br />
Massnahmen aufgestellt und dann in die von Bundesrat Deiss<br />
eingesetzte, tripartite Arbeitsgruppe unter Leitung des seco eingebracht.<br />
Daraus resultierten – nach langen und harten Verhandlungen zwischen<br />
den Sozialpartnern – die Verbesserungsvorschläge, welche im Sommer<br />
2004 vom Bundesrat in die Vernehmlassung gegeben wurden. In diesem<br />
Bericht waren bereits wesentliche Verbesserungen enthalten, wie<br />
darunter zum Beispiel die Verpflichtung für die Kantone, 150 Kontrolleure<br />
einzusetzen.<br />
Aufgrund der ersten, bereits geschilderten Erfahrungen mit der zweiten<br />
Phase des Abkommens über den freien Personenverkehr wurden<br />
dann vor allem innerhalb der Gewerkschaft UNIA die Stimmen lauter,<br />
die verlangten, das Paket der neuen flankierenden Massnahmen II noch<br />
nachzubessern, insbesondere wegen der offensichtlichen Lücken bei<br />
der Arbeitsvermittlung beziehungsweise dem Arbeitsverleih. Da sich<br />
viele Kantone bereits mit der Umsetzung der flankierenden Massnahmen<br />
I schwer taten, wurde zusätzlich verlangt, dass diese in allen Kantonen<br />
bis zum Frühjahr 2005 vollständig umgesetzt werden müssen.<br />
Die politische Konstellation mit dem drohenden und dann auch<br />
ergriffenen Referendum gegen die Vorlage stärkte die Position der Gewerkschaften<br />
und begünstigte die Verhandlungen in der vorparlamentarischen<br />
Auseinandersetzung und auch im Parlament. Den linken und<br />
gewerkschaftlichen Vertretern ist es dann im Rahmen der parlamentarischen<br />
Spezialkommissionen und anschliessend in den beiden Kammern<br />
gelungen, sowohl den ausgehandelten Kompromiss zwischen den Sozialpartnern<br />
unbeschadet über die parlamentarische Hürde zu bringen <strong>als</strong><br />
auch verschiedene Verbesserungen bei den flankierenden Massnahmen<br />
anzubringen.<br />
Die wichtigsten Verbesserungen gegenüber den flankierenden Massnahmen<br />
I von 1999 sind:<br />
• Verpflichtung für die Kantone, im Verhältnis zur Beschäftigungszahl<br />
102 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
genügend Inspektoren zur Überwachung des Arbeitsmarktes einzustellen<br />
oder zu finanzieren. Auf die ganze Schweiz bezogen, ergäbe dies<br />
rund 150 zusätzliche Kontrollstellen. 50% der Finanzierung übernimmt<br />
der Bund.<br />
• Verpflichtung für alle Arbeitgeber, die wichtigsten Arbeitsbedingungen<br />
schriftlich mitzuteilen, damit die Kontrolle erleichtert wird.<br />
• Verschärfung des Entsendegesetzes: Ausländische Arbeitgeber, die in<br />
der Schweiz arbeiten, müssen neu wie Schweizer Arbeitgeber paritätische<br />
Beiträge an die Weiterbildung, Kontrollkosten und Kautionen bezahlen,<br />
sofern diese in GAV vorgeschrieben sind. Selbständig Erwerbende<br />
haben zudem zukünftig ihren Status auf Verlangen nachzuweisen.<br />
• Verschärfung der Sanktionen: Eine fünfjährige Sperre vom Schweizer<br />
Markt kann gegenüber ausländischen Anbietern neu auch bei geringeren<br />
Verstössen verhängt werden, nämlich schon bei einer Verweigerung<br />
der Auskunftspflicht.<br />
• Neu gibt es auch Verbesserungen im Arbeitsvermittlungsgesetz, um<br />
Missbräuche mit Temporärarbeit zu verhindern. Auch Temporärfirmen<br />
müssen jetzt die in einzelnen Branchen vorgeschriebenen Weiterbildungs-<br />
und Vollzugskostenbeiträge sowie, bei längerfristigen Anstellungen,<br />
auch Beiträge an Systeme des frühzeitigen Altersrücktritts bezahlen.<br />
Zudem werden sie den Kontrollorganen und den Sanktionsmöglichkeiten<br />
der GAV-Partner der jeweiligen Branche unterstellt.<br />
• Noch einmal erleichtert wurde die Möglichkeit zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung<br />
von GAV bei festgestellten Missbräuchen. Neu<br />
gibt es nur noch die Bedingung, dass 50% der Arbeitnehmer der jeweiligen<br />
Branche dem bestehenden GAV unterstellt sein müssen. Bisher<br />
mussten auch 30 Prozent der Arbeitgeber dem GAV unterstellt sein.<br />
Kritik am freien Personenverkehr<br />
Zwar mussten die Gewerkschaften auf die Forderung nach präventiven<br />
Massnahmen gegen Lohndumping verzichten, aber mit der Lockerung<br />
der Bestimmungen für die Allgemeinverbindlich-Erklärung der GAV<br />
erfolgte ein kleiner Schritt in diese Richtung. Zudem konnten weder<br />
schärfere Massnahmen gegen Subunternehmer noch Verbesserungen<br />
der gewerkschaftlichen Rechte im Betrieb und des Kündigungsschutzes<br />
von Mitgliedern der Betriebskommissionen durchgesetzt werden.<br />
Insbesondere hier setzte die Kritik des linken Komitees gegen die<br />
Vorlage um das neotrotzkistische MPS/BFS ein: Neben polemischen<br />
Anwürfen gegen die »Gewerkschaftsbosse, die den Unternehmern die<br />
Hand reichen« konstatiert das Komitee zu Recht den teilweise ungenügenden<br />
sozialen Schutz, inklusive die schwachen gewerkschaftlichen<br />
103 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Politische Ökonomie
Politische Ökonomie<br />
Rechte in der Schweiz oder auch den mangelnden und im europäischen<br />
Vergleich unterdurchschnittlichen Abdeckungsgrad mit Kollektivverträgen.<br />
Richtig ist, dass die gewerkschaftlichen Rechte im Betrieb schlecht ausgebaut<br />
sind, vor allem im Bereich des Kündigungsschutzes. Der Erfolg,<br />
den der SGB mit seiner Klage bei der IAO wegen des fehlenden Kündigungsschutzes<br />
von Vertrauensleuten errungen hat, kann dabei hilfreich<br />
sein. Ebenfalls nötig ist die Übernahme diverser EU-Richtlinien<br />
im Sozial- und Arbeitsrecht, so etwa ein besserer Schutz bei Massenentlassungen/Betriebsübergängen,<br />
Mitwirkungsrechte auf Unternehmens-/Konzernebene,<br />
strengere Regeln gegen Diskriminierung am<br />
Arbeitsplatz etc. Wichtig für die Gewerkschaften ist auch eine noch<br />
engere Zusammenarbeit über die nationalen Grenzen hinaus, um Sozialund<br />
Lohndumping zwischen den Ländern zu verhindern.<br />
Unterschätzt hat das linke Gegnerkomitee aber die Verbesserungen,<br />
die bereits erreicht wurden, wie zum Beispiel die bis zu 150 zusätzlichen<br />
Inspektoren, welche die Arbeitsverhältnisse zukünftig kontrollieren<br />
sollen. Ein Vergleich mit den heutigen Realitäten zeigt, wie positiv dies<br />
einzuschätzen ist: Für den Vollzug und die Kontrolle aller Teile des<br />
Arbeitsgesetzes sind heute insgesamt nur 117 eidgenössische und kantonale<br />
Inspektoren tätig. Der Einsatz von neu 150 Inspektoren allein für<br />
den Vollzug des Entsendegesetzes und der flankierenden Massnahmen<br />
wäre <strong>als</strong>o mehr <strong>als</strong> eine Verdoppelung der Kontrollen in Betrieben und<br />
auf Baustellen für schweizerische Verhältnisse ein grosser Schritt.<br />
Verschiedene Verbesserungen bei den flankierenden Massnahmen<br />
betreffen zudem nicht nur Arbeitsimmigranten oder ausländische Unternehmen.<br />
So gilt zum Beispiel die Pflicht zur schriftlichen Mitteilung<br />
der Kernarbeitsbedingungen für alle Arbeitverhältnisse, wo diese nicht<br />
bereits jetzt durch GAV vorgeschrieben war. Auch die Verpflichtung von<br />
Temporärfirmen, die in GAV üblichen Weiterbildungs- und Vollzugskosten<br />
zu übernehmen, betrifft alle Arbeitsverhältnisse und nicht nur<br />
diejenigen von ausländischen Beschäftigten.<br />
Dank dieser Fortschritte befürworteten die Gewerkschaften schliesslich<br />
nach längeren internen Diskussionen die Ausdehnung des freien<br />
Personenverkehrs auf die neuen EU-Länder. Dies im Bewusstsein, dass<br />
ein nicht unbedeutender Teil der Mitglieder diesem Schritt immer noch<br />
skeptisch gegenüber steht.<br />
Neben den Fortschritten bei den flankierenden Massnahmen waren<br />
grundsätzliche Argumente für das Ja der Gewerkschaften ausschlaggebend.<br />
Der freie Personenverkehr, <strong>als</strong>o die Niederlassungsfreiheit und die<br />
freie Berufswahl, ist eines der grundlegenden Menschenrechte und<br />
104 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
ingt, vor allem auch in Verbindung mit dem Beitritt zu Schengen/Dublin,<br />
den in der Schweiz ansässigen MigrantInnen grosse Vorteile. <strong>Das</strong><br />
Verhältnis zur EU wird mit den bilateralen Abkommen geregelt und einen<br />
Schritt weiter gebracht. Ein Volksnein wird nicht nur den freien Personenverkehr,<br />
sondern auch die bilateralen Abkommen I gefährden, die<br />
von der EU gekündigt werden können. Diese Abkommen sind indessen<br />
für die Schweizer Wirtschaft von grosser Bedeutung, insbesondere<br />
für die Exportindustrie und die entsprechenden Arbeitsplätze.<br />
Eine solche Entwicklung würde der Isolationspolitik der Rechten Vorschub<br />
leisten. Nicht die teilweise berechtigte Kritik der Linken wegen<br />
des ungenügenden sozialen Schutzes würde wahrgenommen, sondern<br />
die isolationistischen, fremdenfeindlichen Argumente. Die Schweiz<br />
wäre unter 25 europäischen Ländern das einzige Land, das glaubt, mit<br />
dem freien Personenverkehr nicht umgehen zu können, obschon sie viel<br />
weniger exponiert ist <strong>als</strong> zum Beispiel Österreich mit seiner langen<br />
Grenzlinie gegen Osten. Auch von unseren gewerkschaftlichen Partnern<br />
in Europa kann eine solche Position nur <strong>als</strong> unsolidarische, fremdenfeindliche<br />
Einigelungspolitik verstanden werden.<br />
Ein Stopp des freien Personenverkehrs kann dem Risiko des Sozialdumpings<br />
zudem keinen Einhalt gebieten. In einer kapitalistischen und<br />
globalisierten Wirtschaft schützt auch ein Kontingentierungssystem<br />
nicht vor Schwarzarbeit und prekären Arbeitsverhältnissen, wie sie sich<br />
in ganz Europa ausbreiten. Auch mit der Schliessung der Grenzen können<br />
diese Probleme nicht gelöst werden. Legale Arbeitsverhältnisse sind<br />
auch unter schwierigeren Umständen immer noch besser handhabbar<br />
<strong>als</strong> illegale Arbeitsverhältnisse, insbesondere lassen sich die Rechte der<br />
Arbeitenden bei legalen Arbeitsverhältnissen besser durchsetzen. Die<br />
Gewerkschaften haben sich deshalb auch mehrm<strong>als</strong> für die Legalisierung<br />
der in der Schweiz lebenden Sans-papiers ausgesprochen.<br />
Aufgrund der jüngsten Erfahrungen in der Schweiz, aber auch der<br />
neuen Erfahrungen einiger Nachbarländer mit der erweiterten Personenfreizügigkeit<br />
darf man aber auch nicht davon ausgehen, dass die<br />
verbesserten flankierenden Massnahmen alle Probleme des Lohn- und<br />
Sozialdumpings automatisch lösen. Insbesondere die europäischen Länder,<br />
die gegenüber den neuen EU-Ländern keine Übergangsfrist ausgehandelt<br />
haben oder deren arbeitsrechtlicher Schutz nicht genügt, sind<br />
unter Druck gekommen. 1 Dies widerspricht deutlich der von den<br />
Arbeitgebern vorgelegten Studie des Professors Jäger, die sich von der<br />
erweiterten Personenfreizügigkeit ausschliesslich positive Wohlstandseffekte<br />
verspricht und das Problem des Lohn- und Sozialdumpings<br />
verniedlicht.<br />
105 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Politische Ökonomie
Politische Ökonomie<br />
Auch die auf dem Papier perfektesten Schutzmassnahmen sind kaum<br />
eine dauerhafte Lösung und ersetzen nicht die unablässige gewerkschaftliche<br />
Aufbauarbeit an den Arbeitsplätzen und die gewerkschaftliche<br />
Präsenz im ganzen wirtschaftlichen Gefüge. Letztlich können Lohn- und<br />
Sozialdumping und eine Wettbewerbspolitik zu Lasten der Lohnkosten<br />
nur durch eine Politik verhindert werden, die eine nach oben orientierte<br />
Harmonisierung der Lohn- und Arbeitsbedingungen innerhalb der<br />
europäischen Länder anstrebt.<br />
Schengen, freier Personenverkehr,<br />
Krise der EU – und wie weiter?<br />
Ein Ja der Gewerkschaften zum erweiterten freien Personenverkehr und<br />
zu den bilateralen Abkommen II bedeutet kein definitives Ja zum bilateralen<br />
Weg, aber auch kein bedingungsloses Ja zu allen weiteren Integrations-<br />
und Liberalisierungsbestrebungen zwischen der Schweiz und<br />
der EU. Den Schweizer Gewerkschaften wurde der bilaterale Weg von<br />
der Rechten aufgezwungen. Bei verschiedener Gelegenheit haben sie<br />
sich für einen Vollbeitritt der Schweiz zur EU ausgesprochen. Zuletzt<br />
anlässlich der Volksinitiative ›Ja zu Europa‹, die sofortige Beitrittsverhandlungen<br />
forderte und vom Volk 2001 abgelehnt wurde. Die bilateralen<br />
Abkommen II werden unter anderem auch deshalb befürwortet,<br />
weil der Beitritt zu Schengen/Dublin ein erster politischer Schritt in<br />
Richtung Europa ist und somit auch <strong>als</strong> eine Etappe zum Beitritt interpretiert<br />
werden könnte.<br />
<strong>Das</strong> Ja der Gewerkschaften und Linken zu einem möglichen EU-Beitritt<br />
ist aber weniger euphorisch <strong>als</strong> auch schon. Dies hat mit den neusten<br />
Entwicklungen in der EU zu tun und berührt auch das Problem des<br />
freien Personenverkehrs. Mittels der so genannten Lissabon-Strategie<br />
möchte die EU zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt<br />
werden. Dabei sind jene Kräfte immer stärker geworden, welche dies<br />
mit einem Deregulierungswettlauf erreichen und deshalb auch Sozialdumping<br />
und Steuerdumping in Kauf nehmen wollen.<br />
Jüngstes Beispiel ist der Entwurf für eine neue Dienstleistungsrichtlinie,<br />
nach dem ehemaligen zuständigen EU-Kommissar ›Bolkestein-<br />
Richtlinie‹ genannt, welche einen neuen Deregulierungsschritt für den<br />
wichtigen Dienstleistungssektor beinhaltet. Darin ist die strikte Anwendung<br />
des Herkunftslandsprinzips vorgesehen. Der Herkunftsmitgliedstaat,<br />
das heisst der Staat, in dem das Dienstleistungsunternehmen formal<br />
registriert ist, und der Staat, in dem die Dienstleistung tatsächlich<br />
erbracht wird (Erbringungsstaat), sollen sich dabei in gegenseitigem Vertrauen<br />
intensiv unterstützen und zusammenarbeiten. Mit dieser Richt-<br />
106 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
linie werden jedoch die Überwachungs-, Kontroll- und Durchsetzungsmechanismen<br />
der Erbringungsstaaten eingeschränkt und sogar verunmöglicht.<br />
Und darin liegt auch das Hauptproblem der geplanten Richtlinie: Der<br />
Entwurf stellt einen tiefen Eingriff in die Rechte jedes Mitgliedslandes<br />
der EU dar, die Tätigkeiten der Firmen im eigenen Land zu regeln. So<br />
kann zum Beispiel der Erbringungsstaat künftig nicht einmal mehr<br />
überprüfen, ob die Beschäftigten eines Dienstleistungsunternehmens,<br />
das in einem anderen Mitgliedsstaat niedergelassen ist, überhaupt eine<br />
Arbeitserlaubnis haben. Dafür ist der Herkunftsstaat zuständig.<br />
Die Entsenderichtlinie soll zwar formal weiter gültig bleiben, womit<br />
zum Beispiel für entsandte Bauleute weiterhin Tarifverträge und Arbeitsvorschriften<br />
des Ortes der Ausführung gelten sollen. Wenn jedoch die<br />
Kontroll- und Vollzugsmöglichkeiten am Ort der Ausführung eingeschränkt<br />
werden, wird die Umsetzung der Entsenderichtlinie noch<br />
schwieriger <strong>als</strong> heute.<br />
Die Schweiz kennt vorläufig nur eine begrenzte Dienstleistungsfreiheit<br />
mit der EU, nämlich im Bereich der öffentlichen Aufträge, im Land- und<br />
Luftverkehr und bei personenbezogenen Dienstleistungen während<br />
dreier Monate innerhalb des Abkommens über den freien Personenverkehr.<br />
Die Schweiz ist <strong>als</strong> Nichtmitglied der EU deshalb nicht direkt<br />
von dieser Richtlinie betroffen. Aber bei zukünftigen bilateralen Abkommen<br />
wird die Dienstleistungsfreiheit mit der EU ganz oben auf der<br />
Agenda stehen. Sollte ein solches Abkommen Wirklichkeit werden,<br />
müsste die Schweiz diese Richtlinie <strong>als</strong> geltendes Recht übernehmen,<br />
um sich einem gemeinsamen europäischen Binnenmarkt für Dienstleistungen<br />
nicht komplett zu verschliessen. Gilt diese Richtlinie ohne Ausnahmeregelung<br />
in der gesamten EU, so würde für die Schweiz auf die<br />
Dauer keine Sonderregelung toleriert werden. Im Moment machen<br />
nicht nur die europäischen Gewerkschaften, sondern auch einzelne<br />
Länder wie Frankreich und viele EU-Parlamentarier Druck gegen den<br />
Richtlinienentwurf. Es besteht deshalb eine gute Chance, dass dieser<br />
nochm<strong>als</strong> entscheidend abgeändert oder vom EU-Parlament gar abgelehnt<br />
wird.<br />
In Zusammenhang mit dem Diskurs über die Preisinsel Schweiz wird<br />
neuestens auch vorgeschlagen, dass die Schweiz das ›Cassis-de-Dijon-<br />
Prinzip‹ der EU im Warenverkehr übernehmen soll. Diese Forderung<br />
wird namentlich von Arbeitgeberseite vehement gestellt. Bei diesem<br />
Prinzip handelt es sich um die gegenseitige Anerkennung von Normen<br />
und Warenprüfungen. Vorgesehen ist, dass die Schweiz dieses Prinzip<br />
einseitig übernimmt, das heisst, dass jedes Produkt, das in einem EU-<br />
107 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Politische Ökonomie
Politische Ökonomie<br />
Land geprüft und zugelassen wird, automatisch auch in einem anderen<br />
EU-Land zugelassen werden muss.<br />
Selbst wenn es unsinnig erscheint, dass eine Zahnpastatube nicht<br />
direkt in die Schweiz importiert werden kann, weil darauf eine Deklaration<br />
fehlt und sie neu bedruckt werden muss – was am Cassis-de-Dijon-<br />
Prinzip wirklich nötig ist, sind gemeinsame Mindestbestimmungen im<br />
Arbeitsschutz, im Arbeitsrecht und im Umweltschutz. Nur zusammen<br />
mit einer gewissen Harmonisierung der Mindestvorschriften kann das<br />
Prinzip funktionieren. Diese Mindestbestimmungen sind aber zwischen<br />
der EU und der Schweiz in der Regel nicht harmonisiert, das heisst, es<br />
ist durchaus möglich, dass das Cassis-de-Dijon-Prinzip zu Sozial- oder<br />
Umweltdumping führen kann. Bei der Übernahme der Dienstleistungsfreiheit<br />
der EU ergäbe sich das gleiche Problem.<br />
Die Gewerkschaften können deshalb eine solche Rosinenpickerei im<br />
Verhältnis der Schweiz zur EU nicht mehr tolerieren. Sollte der Warenund<br />
Dienstleistungsverkehr zwischen der EU und der Schweiz weiter<br />
liberalisiert werden, müsste die Harmonisierung aller Mindestvorschriften,<br />
insbesondere auch jene des Sozial- und Arbeitsschutzes, <strong>als</strong><br />
absolute Bedingung gestellt werden. Klar ist allerdings auch, dass eine<br />
Übernahme der Mindestvorschriften mit politischer Mitbestimmung<br />
nur durch einen EU-Beitritt möglich sein wird. Etwas anderes wird die<br />
EU kaum zubilligen.<br />
Nach der positiven Abstimmung zum Schengen/Dublin-Abkommen<br />
hat die politische Rechte einmal mehr vehement gefordert, dass das EU-<br />
Beitrittsgesuch der Schweiz, das seit der negativen Abstimmung über<br />
den EWR-Beitritt von 1992 sistiert wurde, offiziell zurückgezogen wird.<br />
Als Alternative zum EU-Beitritt wurde der Abschluss eines Rahmenabkommens<br />
zwischen der Schweiz und der EU im Sinne eines Assoziierungsabkommens<br />
vorgeschlagen. Ein solcher Schritt hätte aus unserer<br />
Sicht einen praktisch endgültigen Charakter. Der Rückzug des Beitrittsgesuches<br />
mit dem gleichzeitigen Abschluss eines Rahmenabkommens<br />
wäre ein politisches Signal von grosser Tragweite. Der Sonderfall<br />
Schweiz mit dem bilateralen Weg würde zementiert und eine politische<br />
Integration in die EU wäre für lange Zeit, wenn nicht für immer ausgeschlossen.<br />
Eine volle wirtschaftliche Integration in die EU ohne politische<br />
Zusammenarbeit und die Übernahme aller politischen und sozialen<br />
Verpflichtungen kann niem<strong>als</strong> im Interesse der Gewerkschaften und der<br />
links-grünen Kräfte in diesem Land sein.<br />
Die EU steckt in einer Krise, und die Entwicklungen der letzten Jahre<br />
erfordern eine kritische Position zu diesem Gebilde. Alternativen zur<br />
grenzenlosen Globalisierung und zur neoliberalen Strategie können<br />
108 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
aber letzlich nur zusammen mit allen fortschrittlichen Kräften in der EU<br />
entwickelt und durchgesetzt werden. <strong>Das</strong> europäische Sozialmodell, so<br />
sehr es im Moment in Frage gestellt wird, ist eine echte Alternative zum<br />
anglikanischen oder ostasiatischen Modell. Die EU <strong>als</strong> eine der grössten<br />
Wirtschaftsmächte kann eine entscheidende Rolle spielen und ihre gewichtige<br />
Stimme in die Weltpolitik einbringen. <strong>Das</strong> europäische Modell<br />
muss deshalb im Grundsatz verteidigt und darf nicht zu Tode reformiert<br />
werden. Dies erfordert letztlich politische Entscheide, bei denen auch<br />
wir mitdiskutieren und mitentscheiden wollen. Deshalb muss der EU-<br />
Beitritt ein linkes politisches Ziel bleiben.<br />
Die Schweizer Stimmbürger haben das rechte Referendum gegen den<br />
freien Personenverkehr abgelehnt. Damit tritt der freie Personenverkehr<br />
auch mit den neuen EU-Ländern ab 2006 in Kraft. Ebenso die in diesem<br />
Artikel dokumentierten, neuen flankierenden Massnahmen gegen<br />
Lohndumping.<br />
109 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Politische Ökonomie<br />
Literatur und Anmerkung<br />
Baumann, Hans (1995) ›Für sozialen Schutz im freien Personenverkehr. Gewerkschaftspositiionen<br />
in den EU-Verhandlungen‹. In: Widerspruch, H. 29.<br />
Baumann, Hans (1999) ›EU und Sozialdumping in der Schweiz‹. In: Widerspruch, H. 37.<br />
Baumann, Hans (2005) ›Freier Personenverkehr und EU-Erweiterung. Genügen die flankierenden<br />
Massnahmen?‹. In: Widerspruch, H. 48.<br />
Bewegung für den Sozialismus, BFS/MPS (2005) ›Nein zu Lohn- und Sozialdumping, Nein<br />
zu wirkungslosen ‘flankierenden Massnahmen’!‹ Zürich (www.sozialismus.ch/Aktivitae<br />
ten/BroschDumping.pdf).<br />
Gewerkschaft Bau & Industrie (2001) ›Vom Händler-Europa zu einem sozialen, politischen<br />
und bürgernahen Europa‹. Zürich.<br />
Integrationsbüro EDA/EVD (2004) ›Die EU-Erweiterung und die Ausdehnung des Personen-<br />
Freizügigkeitsabkommens‹. Bern.<br />
Jäger, Franz (2005) ›Analyse der volkswirtschaftlichen Auswirkungen (Migration und Dirketinvestitionen)<br />
der EU-Erweiterung auf die Schweiz‹ (Provisorische Fassung). St. Gallen.<br />
Rennwald, Jean-Claude, Stephanie Lachat, Jean-Pierre Ghelfi, Jean-Claude Prince (2005)<br />
›Suisse – Union européenne. Les 44 questions qui irritent les Helvètes‹. Delémont.<br />
Schweizerischer Gewerkschaftsbund (2001) ›Ja zu Europa, Nach der wirtschaftlichen verlangen<br />
die Gewerkschaften die soziale Integration‹. Bern.<br />
Staatssekretariat für Wirtschaft seco, Direction du travail (2003) ›Analyse Droit communitaire<br />
– Droit Suisse du travail‹. Bern.<br />
Staatssekretariat für Wirtschaft seco (2004) ›Bericht über die Ergebnisse der Arbeitsgruppe<br />
‘Flankierende Massnahmen’‹. Bern.<br />
Staatssekretariat für Wirtschaft seco (2005) ›Bericht über die Umsetzung der flankierenden<br />
Massnahmen zur Freizügigkeit im Personenverkehr in der Zeitspanne 1.6.2004–31.12.<br />
2004‹. Bern.<br />
1 In Grossbritannien, das keine Übergangsfrist kennt, war der Zustrom von Arbeitsimmigranten<br />
aus den neuen EU-Ländern rund zehn Mal grösser, <strong>als</strong> dies von Experten<br />
erwartet wurde, wobei hier ein unbekannter Anteil von nach der EU-Erweiterung legalisierten<br />
Aufenthaltsverhältnissen enthalten ist. (siehe NZZ, 18.3.2005.)
Politische Ökonomie<br />
<strong>Das</strong> Problem hoher Gewinne<br />
Immerhin: Die Schweizer Wirtschaftsmedien haben sich dazu durchringen<br />
können, die inzwischen zweistelligen Millionen-Saläre der Top-<br />
Manager <strong>als</strong> Skandal zu bezeichnen. Die NZZ teilt die Empörung zwar<br />
noch nicht ganz, aber sie hat sie zur Kenntnis genommen. Deshalb erkennt<br />
sie in den hohen Managersalären immerhin eine »Gefahr für die<br />
Akzeptanz der Marktwirtschaft«.<br />
Solche Millionen-Saläre sind die Folge einer Beuteteilung, bei der die<br />
Manager am längeren Hebel sitzen <strong>als</strong> die Aktionäre. In der Regel werden<br />
ihre Gehälter auch unter diesem Aspekt diskutiert: Die Generalversammlungen<br />
der Aktionäre sollen über die Saläre, zumindest über<br />
die Salärpolitik mitreden können. Sogar die SP mischt in diesem Verteilkampf<br />
mit: Sie hat sich auf die Seite der Aktionäre geschlagen und<br />
will deren Rechte per Gesetz stärken.<br />
Die Manager kassieren aber nicht nur deshalb so hohe Saläre, weil sie<br />
bei der Beuteverteilung auf den vordersten Plätzen sitzen. Wichtiger ist<br />
vielmehr, dass die Beute überhaupt so fett ist. Darüber aber regt sich<br />
kaum jemand auf. »Gut gehaltene Ertragskraft der UBS«, lobt etwa die<br />
NZZ, <strong>als</strong> die grösste Schweizer Bank im ersten Quartal 2005 einen neuen<br />
Rekordgewinn von 2,6 Milliarden Franken auswies. (<strong>Das</strong> entspricht<br />
einer Eigenkapitalrendite von 32,4%. Zum Vergleich: Für eine 3-jährige<br />
Kassenobligation zahlt dieselbe UBS gerade mal 1%) Doch schon im<br />
ersten Abschnitt wies die NZZ kritisch darauf hin, dass die Abteilung<br />
Investment-Banking ihr Plansoll nicht erfüllt hat.<br />
Auch in weniger wirtschaftsfreundlichen Medien gilt die Devise, dass<br />
Gewinne eigentlich nie hoch genug sein können. Man darf zwar hohe<br />
Managerlöhne im Namen der Aktionäre kritisieren, doch jede Kritik am<br />
Gewinn an sich gilt <strong>als</strong> politisch unkorrekt.<br />
Dabei sind hohe Gewinne wirklich ein Problem – und zwar nicht nur,<br />
weil sie die Grundlage für die anstössigen Managersaläre bilden. Sie sind<br />
ein Zeichen dafür, dass das Kapital im Verteilkampf mit der Arbeit einen<br />
Kantersieg nach dem anderen feiert. <strong>Das</strong> wirkt sich nicht nur auf die<br />
Reallöhne aus, sondern auch auf die Beschäftigung, und zwar deshalb,<br />
weil der Rubel nicht mehr rollt.<br />
Nehmen wir <strong>als</strong> Beispiel Novartis, die Firma mit dem bestverdienenden<br />
Manager der Schweiz. Novartis hat 2004 Medikamente und Dienstleistungen<br />
im Wert von 28,3 Milliarden<br />
Dollar verkauft. Sie hat <strong>als</strong>o<br />
Werner Vontobel<br />
der Wirtschaft Kaufkraft im Wert Studium der Volkswirtschaft, ist Wirt-<br />
von 28,3 Milliarden Dollar entzo- schaftspublizist beim ›SonntagsBlick‹.<br />
110 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
gen. (Was ein Konsument für Novartis-Produkte ausgibt, kann er nicht<br />
mehr für andere Käufe verwenden.)<br />
Damit der Rubel weiter rollt, muss Novartis diese 28,3 Milliarden<br />
irgendwie wieder ausgeben. Wie dies passiert ist, steht auf der Ausgabenseite<br />
der Erfolgsrechnung, die sich ebenfalls auf 28,3 Milliarden<br />
Dollar summiert. Schliesslich leben wir in der Welt der doppelten <strong>Buch</strong>haltung.<br />
Schauen wir uns diese Ausgabenseite genauer an: Gut 13 Milliarden<br />
Franken gingen an Lieferanten und andere externe Dienstleister für<br />
Werbung, Forschung usw. 7 Milliarden Dollar wurden für das Personal<br />
aufgewendet. Vom Bruttogewinn von 7,9 Milliarden Dollar. wurden<br />
rund 1 Milliarde für Steuern, 2 Milliarden für die Dividende und 1,3 Milliarden<br />
für Investitionen verwendet. Es blieb ein Nettocashflow von<br />
rund 3,6 Milliarden Dollar. Für dieses Geld hat Novartis Wertpapiere<br />
gekauft, darunter nicht zuletzt eigene Aktien, die anschliessend vernichtet<br />
werden. Zur Zeit läuft das vierte Aktienrückkaufprogramm über<br />
3 Milliarden Franken.<br />
An dieser Stelle ziehen wir eine erste Zwischenbilanz: Novartis hat<br />
28,3 Milliarden Dollar eingenommen und davon 24,7 Milliarden wieder<br />
in den Wirtschaftskreislauf zurück fliessen lassen. 3,6 Milliarden<br />
Dollar wurden gespart. Sie befinden sich im Finanzkreislauf und fehlen<br />
<strong>als</strong> Nachfrage im Wirtschaftskreislauf. Diese 3,6 Milliarden Dollar entsprechen,<br />
zu den Personalkosten von Novartis gerechnet, rund 42’000<br />
Stellen.<br />
Hinter dieser Modellrechung steckt folgende Überlegung: Novartis<br />
hätte – bei etwas härterer Konkurrenz – seine Produkte statt für 28,3 für<br />
24,6 Milliarden Dollar verkaufen können und hätte dennoch sämtlich<br />
Kosten inklusive Steuern, Investitionen und Dividenden aus den laufenden<br />
Einnahmen decken können. Die Kunden hätten <strong>als</strong>o 3,6 Milliarden<br />
Dollar für andere Produkte und Dienstleistungen ausgeben und<br />
damit die erwähnten 42’000 Stellen schaffen können.<br />
<strong>Das</strong> gilt nicht nur für Novartis. Fast alle Grossunternehmen erzielen<br />
heute beträchtliche Nettoüberschüsse. Bei der Swisscom etwa waren es<br />
2004 rund 1,5 Milliarden Franken. Bei einem Umsatz von rund 10 Milliarden<br />
bedeutet dies, dass Swisscom alle Preise und Gebühren um 15%<br />
hätte senken können, ohne ihre Substanz anzutasten. Nestlé hätte bei der<br />
gleichen Rechung die Preise um 4% senken können. Die beiden Grossbanken<br />
UBS und CS hätten sämtliche Kundenausleihungen (Hypotheken<br />
und Firmenkredite) um gut 2 Prozentpunkte verbilligen können.<br />
Der Grund für diese Gewinnexplosion liegt einerseits in der abnehmenden<br />
Härte des Preiswettbewerbs. Die Einsparungen dank des tech-<br />
111 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Politische Ökonomie
Politische Ökonomie<br />
nologischen Fortschritts und der billigen Importe werden nur teilweise<br />
und zögerlich durch Preissenkungen an die Konsumenten weiter gegeben.<br />
Andererseits sind die Arbeitsmärkte insgesamt härter geworden.<br />
Beides erhöht die Gewinnspanne.<br />
Diese Entwicklung lässt sich an der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung<br />
ablesen: Noch 1990/1991 konnten die Unternehmen im<br />
Schnitt rund zwei Drittel ihrer Investitionen aus den laufenden Verkaufserlösen<br />
(bzw. aus dem Cashflow nach Steuern und Dividenden) finanzieren.<br />
Im Lauf der Neunzigerjahre änderte sich das rapide. 2002 hat<br />
der Unternehmenssektor einen Nettoüberschuss von gut 13 Milliarden<br />
Franken erzielt. <strong>Das</strong> entspricht einem Eigenfinanzierungsgrad von rund<br />
125%. Von 2002 bis 2004 haben sich die Gewinne der börsenkotierten<br />
Schweizer Unternehmen verdreifacht. Man kann deshalb davon ausgehen,<br />
dass der Netto-Finanzierungsüberschuss des Unternehmenssektors<br />
2004 bei mindestens 20 Milliarden Franken lag. Bei rund 60 Milliarden<br />
Franken Investitionen entspricht dies einem Eigenfinanzierungsgrad<br />
von 133%.<br />
Die Preiskalkulation des Unternehmenssektors sah damit wie folgt aus<br />
Laufende Kosten des Unternehmenssektors: 240 Mrd. Fr.<br />
(inkl. Löhne, Steuern, Dividenden usw.<br />
ohne Doppelzählung bzw. Vorleistung)<br />
Investitionen: 60 Mrd. Fr.<br />
Netto-Finanzierungsüberschuss 20 Mrd. Fr.<br />
(entspricht einem Eigenfinanzierungsgrad von 133%)<br />
Total Umsatz (Belastung für Konsumenten) 320 Mrd. Fr.<br />
Wenn nun aber, dank harter Preiskonkurrenz und normalen Arbeitsmärkten,<br />
der Eigenfinanzierungsgrad beispielsweise bei einigermassen<br />
›normalen‹ 80% läge, hätte die Preiskalkulation wie folgt ausgesehen:<br />
Laufende Kosten: 240 Mrd. Fr.<br />
Investitionen 48 Mrd. Fr.<br />
Netto-Finanzierungsdefizit 12 Mrd. Fr.<br />
(entspricht einem Eigenfinanzierungsgrad von 80%)<br />
Total Umsatz 288 Mrd. Fr.<br />
Die Differenz liegt bei 32 Milliarden Franken. <strong>Das</strong> entspräche einer<br />
Preissenkung respektive einer Kaufkraftsteigerung von rund 10%, beziehungsweise<br />
einer entsprechenden Zunahme der Gesamteinkommen.<br />
Nochm<strong>als</strong>: Der Haushaltssektor wäre unter ›normalen‹ Verhältnissen<br />
heute um 32 Milliarden Franken Kaufkraft reicher. Diese Kaufkraft wä-<br />
112 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
113 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Politische Ökonomie<br />
re den Haushalten teils in Form von höheren Löhnen, teils in Form von<br />
tieferen Preisen zugeflossen. Doch unsere Geschichte ist noch nicht zu<br />
Ende erzählt. Zwei Fragen bleiben offen: Was machen die Unternehmen<br />
mit den 32 Milliarden, die sie anstelle der Haushalte kassiert haben?<br />
Und was hätten die Haushalte mit der entgangenen Kaufkraft gemacht?<br />
Zu den Haushalten: Sie haben 2002 insgesamt 24 Milliarden Franken<br />
gespart. Der laufende Konsum der Rentnerhaushalte ist davon bereits<br />
abgezogen. Die Nettoersparnis ist mehr <strong>als</strong> genug, um den Lebensstandard<br />
der Haushalte auch in Zukunft zu sichern. Man kann <strong>als</strong>o davon<br />
ausgehen, dass die Haushalte die zusätzlichen 32 Milliarden Franken<br />
(unter normalen Umständen) konsumiert hätten. Mit diesem Mehrkonsum<br />
wären rund 500’000 Voll- und Teilzeitjobs geschaffen worden.<br />
<strong>Das</strong> ist bei insgesamt 220’000 Stellen Suchenden auf den ersten Blick<br />
eine wenig plausible Zahl, die sich aber leicht erklären lässt. Erstens<br />
beträgt das von der ETH-Konjunkturforschungsstelle errechnete Arbeitsmarkt-Ungleichgewicht<br />
(das der steigenden Bevölkerungszahl<br />
Rechnung trägt) gut 400’000 Stellen. Zweitens weist die Schweiz einen<br />
riesigen Leistungsbilanzüberschuss von rund 14 BIP-Prozent aus. Wenn<br />
wir mehr konsumieren, steigen die Importe und sinkt der Leistungsbilanzüberschuss.<br />
<strong>Das</strong> bedeutet, dass ein ansehnlicher Teil der (durch<br />
den Mehrkonsum) neu geschaffenen Arbeitsplätze im Ausland entstehen<br />
würden.<br />
So weit die Blütenträume. Nun fliessen die 32 Milliarden Franken ja<br />
eben nicht an die Konsumenten und Arbeitnehmer, sondern bleiben in<br />
den Unternehmen. Was bedeutet dies konkret?<br />
Wie wir im Fall von Novartis gesehen haben, bleiben die Nettoüberschüsse<br />
nicht einfach in Form von Bargeld in den Unternehmen liegen.<br />
Diese kaufen damit vielmehr Wertpapiere. Deren Verkäufer sind etwa<br />
Anlagefonds, die das Geld postwendend wieder für den Kauf anderer<br />
Wertpapiere verwenden. Auf diese Weise kann das Geld mehrere Runden<br />
auf den Finanzmärkten drehen. Es kommt erst wieder in den eigentlichen<br />
Wirtschaftskreislauf zurück, wenn Novartis seine Wertpapiere<br />
beispielsweise einem Rentner abkauft, der mit dem Erlös seinen Lebensunterhalt<br />
bestreitet, oder wenn ein Unternehmen neue Aktien (an<br />
Novartis) verkauft und mit dem Erlös Maschinen kauft, oder Werbekampagnen<br />
finanziert.<br />
Doch geschieht dies wirklich? Um diese Frage zu beantworten, muss<br />
man den gesamten Wirtschaftskreislauf, bestehend aus den Sektoren private<br />
Haushalte, Unternehmen, Staat und Ausland betrachten. Sie bilden<br />
zusammen die vier grossen Sammelkonten der volkswirtschaftlichen<br />
Gesamtrechnung. Dabei gilt nach den Regeln der doppelten <strong>Buch</strong>hal-
Politische Ökonomie<br />
tung, dass die Überschüsse des einen Sektors die Defizite aller anderen<br />
sind.<br />
Unter normalen Umständen ist es so, dass die privaten Haushalte per<br />
Saldo sparen, weil sie für das Alter vorsorgen müssen. (In einer überalterten<br />
Gesellschaft kann dies wegen dem Entsparen der Rentner anders<br />
sein.) Die Haushalte stellen ihre Überschüsse dem Unternehmenssektor<br />
zur Verfügung. Zu diesem Zweck muss dieser ein Netto-Finanzierungsdefizit<br />
aufweisen. Der Staat macht in konjunkturell guten Zeiten Überschüsse,<br />
in der Krise Defizite. Er gleicht damit die Konjunkturschwankungen<br />
aus. Die Rechnung mit dem Ausland sollte auf mittlere Sicht<br />
ausgeglichen sein. Dafür sorgen in der Regel die Schwankungen der<br />
Devisenkurse. Leistungsbilanzüberschüsse führen zu einer Aufwertung<br />
des Frankens, was wiederum die Exporte verteuert.<br />
In der Schweiz sind die Umstände schon lange nicht mehr normal:<br />
Alle wollen sparen, niemand will Schulden aufnehmen: Die Haushalte,<br />
weil sie Reserven für die alten Tage brauchen. Die Unternehmen, weil<br />
es Mode geworden ist und weil es der mangelnde Preiswettbwerb erlaubt.<br />
Der Staat, weil Schulden des Teufels sind. Der Schwarze Peter<br />
bleibt beim Ausland.<br />
Gemäss der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung für 2002 (neuere<br />
Zahlen liegen noch nicht vor) haben die verschiedenen Sektoren folgende<br />
Finanzierungsüberschüsse (Netto-Cashflow) ausgewiesen:<br />
Unternehmen (ohne Banken) 3,5 Mrd. Fr.<br />
Banken und Nationalbank 9,8 Mrd. Fr.<br />
Staat mit Sozialversicherungen 0,8 Mrd. Fr.<br />
Private Haushalte 22 Mrd. Fr.<br />
Total (ohne Doppelzählungen) 33 Mrd. Fr.<br />
Ausland (bzw. Leistungsbilanz) 33 Mrd. Fr.<br />
Ähnlich wie die Novartis hat <strong>als</strong>o auch die ›Schweiz AG‹ deutlich mehr<br />
Geld eingenommen – nämlich 33 Milliarden Franken –, <strong>als</strong> sie ausgegeben<br />
respektive in den Kreislauf zurückgepumpt hat. Für die übrig<br />
gebliebenen 33 Milliarden Franken haben wir – genau wie Novartis –<br />
ausländische Wertpapiere gekauft.<br />
Bleibt die grosse Frage: Wer hat all diese Wertpapiere verkauft? Irgend<br />
jemand auf dieser Welt muss auf Pump leben, <strong>als</strong>o Schuldscheine schreiben<br />
oder neue Aktien drucken, diese verkaufen und davon leben, beziehungsweise<br />
für das Entgeld Waren und Dienstleistungen kaufen. Nur<br />
so bleibt der Kreislauf der Waren und des Geldes geschlossen.<br />
Dieser Jemand sind die US-Amerikaner. Sie haben dem Rest der Welt<br />
2004 per Saldo für gut 600 Milliarden Dollar bunt bedruckte Papiere<br />
114 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
115 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Politische Ökonomie<br />
verkauft und dafür Waren und Dienstleistungen bezogen. Sie sind es, die<br />
letztlich den Kreislauf von Angebot und Nachfrage schliessen.<br />
<strong>Das</strong>s unser Sparüberhang letztlich irgendwo in der Welt eine entsprechende<br />
Nachfrage findet, liegt in der Logik der doppelten <strong>Buch</strong>haltung.<br />
Der Extrakonsum der USA löst unser Nachfrageproblem offensichtlich<br />
nicht, sonst gäbe es in der Schweiz nicht so viele Arbeitslose.<br />
Umgekehrt zeigt das Beispiel der USA, dass ein Handelsbilanzdefizit<br />
weder für die Beschäftigung noch für das Wirtschaftswachstum ein Problem<br />
sein muss. Und für den Konsum schon gar nicht. Die USA haben<br />
letztes Jahr für 600 Milliarden Dollar auf Pump konsumiert. Und so lange<br />
unsere Sparwut anhält respektive so lange die Unternehmen ihre<br />
überhöhten Preise auf uns abwälzen können, werden die USA ihre<br />
Schulden auch nie zurückzahlen müssen. Zu diesem Zweck müssten sie<br />
nämlich jahrzehntelang hohe Exportüberschüsse erzielen. Stattdessen<br />
werten sie einfach von Zeit zu Zeit den Dollar ab und lassen uns für sie<br />
arbeiten.
Politische Ökonomie<br />
Zur Wachstumsdebatte<br />
in der Schweiz<br />
Warum Wirtschaftswachstum?<br />
Seit der Debatte über das Nullwachstum in den 1970er-Jahren ist klar:<br />
Wirtschaftswachstum ist verbunden mit mehr Ressourcenverzehr und<br />
Umweltbelastung. Daran hat sich bis heute grundsätzlich nichts geändert.<br />
In der OECD haben Energieverbrauch und Belastung der Luft mit<br />
Stickoxiden und Schwefeloxiden seit 1980 zwar zugenommen, aber<br />
deutlich langsamer <strong>als</strong> die wirtschaftliche Produktion (gemessen am<br />
realen Brutto-Inlandprodukt BIP). Demgegenüber nahmen die CO2-<br />
Emissionen immer noch in etwa parallel zum realen BIP zu. Warum<br />
trotzdem Wirtschaftswachstum? Und warum auch in der Schweiz? Darauf<br />
gibt es im Wesentlichen drei Antworten:<br />
• Wachstum ist zur Erhaltung der Beschäftigung erforderlich. In der<br />
Schweiz muss das reale BIP im Minimum um etwa 1% pro Jahr zunehmen,<br />
wenn die Anzahl Arbeitsplätze nicht schrumpfen soll. Die Erklärung<br />
dafür ist einfach: Die Arbeitskräfte werden (bei konstanter Anzahl<br />
geleisteter Arbeitsstunden) jedes Jahr etwas produktiver aufgrund der<br />
besseren Ausstattung der Arbeitsplätze, aber auch von Lernprozessen<br />
und Erfahrungsgewinnen. Wenn diese Mehrproduktion nicht abgesetzt<br />
werden kann, nimmt die Anzahl Jobs entsprechend ab und die Arbeitslosigkeit<br />
steigt.<br />
• Die chronischen Defizite von Bund, Kantonen, Gemeinden, AHV,<br />
ALV und IV würden sich weiter verschärfen, falls die Wirtschaft nicht<br />
oder nur unzureichend wüchse. In diesem Fall würden die Einnahmen<br />
langsam abnehmen oder gar stagnieren, während gleichzeitig die Ausgaben<br />
(v.a. Sozialhilfe, ALV und IV) deutlich ansteigen. Wirtschaftswachstum<br />
führt dagegen zu zusätzlichen Einnahmen und tieferen Sozialausgaben<br />
und mildert so Finanzierungsengpässe der öffentlichen Hand.<br />
• Paradoxerweise hat es auch der Umweltschutz bei gutem Wirtschaftswachstum<br />
leichter. Denn in Rezessionen muss er politisch häufig gegenüber<br />
Beschäftigungszielen zurückstehen – die Diskussion um den Ausbau<br />
des Flughafens Kloten und die<br />
Lärmbekämpfungsmassnahmen<br />
Armin Jans<br />
ist geradezu exemplarisch. In ei- 1949, Dr. rer. pol., Professor für VWL an der<br />
ner Rezession fehlen zudem beim Zürcher Hochschule Winterthur; Interes-<br />
Staat wie in der privaten Wirtsenschwerpunkte: Wirtschaft, europäische<br />
schaft finanzielle Mittel für den Integration, Globalisierung, Wohnen und<br />
Umweltschutz.<br />
Mieten, Sozialpolitik.<br />
116 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
117 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Politische Ökonomie<br />
Messung des Wirtschaftswachstums mit dem BIP<br />
Traditionell wird die wirtschaftliche Leistung (und damit auch deren<br />
Wachstum) mit dem realen BIP gemessen. Grundsätzlich drückt dieses<br />
die Wertschöpfung (das heisst den Wertzuwachs aufgrund der mengenmässigen<br />
inländischen Produktion) im Marktsektor aus. Real bedeutet<br />
es, dass Preisveränderungen aus der Berechnung ausgeklammert werden.<br />
Unberücksichtigt bleiben ferner Selbstversorgung und unentgeltliche<br />
Leistungen (Haushalt, Kindererziehung, Vereine usw.), ebenso die<br />
Verteilung des Produktionsergebnisses auf die Individuen.<br />
Wie Tabelle 1 zeigt, hat die Schweiz, gemessen am Wachstum des realen<br />
BIP, gegenüber Westeuropa, den USA und Japan in den letzten 25<br />
Jahren schwach abgeschnitten.<br />
Tabelle 1: Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit seit 1980<br />
Entsprechend schwierig wurde die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Während<br />
in den 80er-Jahren die Arbeitslosenquote in der Schweiz unter 1%<br />
lag, schnellte sie in den 90er-Jahren hoch und erreichte 1997 einen Maximalwert<br />
von 5,2%. Momentan liegt sie offiziell bei knapp 4%. In Tabelle<br />
1 wird nicht diese, sondern eine von der OECD für internationale<br />
Vergleiche standardisierte Arbeitslosenquote ausgewiesen. Dabei wird<br />
auch ein Teil der Stellen Suchenden (in Beschäftigungsprogrammen,<br />
Weiterbildungskursen usw.) mitgezählt.<br />
In einer ähnlichen Lage wie die Schweiz befindet sich Japan, wo die<br />
Arbeitslosenquote 1990 noch bei 2% lag und heute mehr <strong>als</strong> doppelt so<br />
hoch ist. Umgekehrt haben Länder mit einem hohen Wirtschaftswachstum<br />
die Arbeitslosenquote seit 1993 stark reduzieren können, so Irland<br />
von 15% auf unter 5% und Grossbritannien von 10% auf 5%.<br />
Relativierung des realen BIP<br />
<strong>Das</strong> Wachstum der schweizerischen Wirtschaft wird allerdings durch das<br />
reale BIP unterschätzt. Dies deshalb, weil unberücksichtigt bleibt, dass
Politische Ökonomie<br />
die Preise der Exporte schneller stiegen <strong>als</strong> die der Importe. Diese Differenz<br />
macht seit 1991 0,94% pro Jahr aus. Es drückt einen Wohlstandsgewinn<br />
aus, weil wir für eine gegebene Menge an Importgütern dauernd<br />
eine etwas kleinere Menge an Exportgütern hergeben mussten. Die internationalen<br />
Tauschbeziehungen verbesserten sich <strong>als</strong>o dauernd leicht<br />
zu unseren Gunsten. Würde man dies im realen BIP berücksichtigen,<br />
wäre es seit 1991 nicht um 0,9%, sondern um rund 1,3% pro Jahr gewachsen.<br />
Wir hätten damit fast zu Deutschland aufgeschlossen, blieben<br />
aber immer noch Schlusslicht in Tabelle 1.<br />
<strong>Das</strong> reale BIP misst die Marktproduktion im Inland zu konstanten<br />
Preisen. Diese Grösse ist nicht identisch mit dem gesamten Einkommen<br />
(sog. Brutto-Volkseinkommen, früher BSP genannt). Dafür müssen zusätzlich<br />
die grenzüberschreitenden Arbeits- und Kapitaleinkommen<br />
berücksichtigt werden. Zwar arbeiten viele ausländische Grenzgänger in<br />
der Schweiz und ihre Leistung zählt zum BIP, aber nicht zum BSP der<br />
Schweiz. Gewichtiger sind aber die Nettoeinnahmen aus Kapitaleinkommen<br />
(Zinsen, Dividenden usw.), die vor allem der internationale Finanzplatz<br />
generiert. Insgesamt überstieg das nominelle BSP 1991–2004<br />
das nominelle BIP im Mittel um rund 5%.<br />
In den meisten Ländern liegen BIP und BSP nahe beieinander. Die<br />
Schweiz stellt einen (positiven) Ausnahmefall dar. Irland dagegen verzeichnet<br />
ein BSP, das um rund 14% tiefer liegt <strong>als</strong> das BIP. Ein Siebtel<br />
der Produktionsleistung fliesst ab in Form von Gewinnen und Zinsen der<br />
ausländischen Firmen, die in Irland stationiert sind.<br />
In der Schweiz stieg das reale BIP 1960–2000 um rund 170%. Gleichzeitig<br />
nahm die Anzahl der Erwerbstätigen um 50% zu, so dass im Jahr<br />
2000 pro Erwerbstätiger rund 80% mehr <strong>als</strong> 1960 produziert wurde.<br />
Interessant ist auch ein Blick auf die absoluten Grössen. Allerdings<br />
lassen sich nur Grössenordnungen angeben, da die Methodik der nationalen<br />
<strong>Buch</strong>haltung seit 1980 zweimal stark verändert wurde. Eine Zunahme<br />
des gegenwärtigen realen BIP um 1% entspricht etwa einer<br />
Mehrproduktion von rund 2,5% im Jahr 1960. Dam<strong>als</strong> wuchs die Wirtschaft<br />
allerdings mit rund 5% pro Jahr, so dass der Produktionszuwachs<br />
1960 (absolut) etwa doppelt so hoch ausfiel wie heute. Auch dies unterstreicht,<br />
dass die Schweizer Wirtschaft gegenwärtig wenig wächst.<br />
Wachstumsdiskussion in der Schweiz<br />
In der volkswirtschaftlichen Zunft ist weitgehend unumstritten, dass die<br />
Schweizer Wirtschaft ein Wachstumsproblem besitzt. Als Gründe dafür<br />
werden benannt:<br />
118 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
119 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Politische Ökonomie<br />
1. zu geringe Öffnung gegenüber der Weltwirtschaft<br />
2. zu wenig Wettbewerb in den binnenorientierten Branchen<br />
3. brach liegendes Arbeitskräftepotenzial von Müttern (zu geringe Arbeitspensen)<br />
4. zu hohe Ersparnis; die Sparüberschüsse müssen im Ausland angelegt<br />
werden und sind im Inland nicht nachfragewirksam<br />
5. verzerrende Wirkung des Steuersystems (Mehrwertsteuer, Doppelbesteuerung<br />
von ausgeschütteten Gewinnen).<br />
Die beiden ersten Ursachen sind denn auch hauptverantwortlich für die<br />
Tatsache, dass in der Schweiz die allermeisten Konsumgüter deutlich<br />
teurer sind <strong>als</strong> in den Nachbarländern sind.<br />
Kontrovers sind dagegen die folgenden Begründungen:<br />
• Reformblockade durch die direkte Demokratie (Referendum)<br />
• Zuwachs der Staatsquote<br />
• Erschwerung der Kreditaufnahme von KMU.<br />
Aus gewerkschaftlicher Sicht wird speziell auf die Nachfrageschwäche,<br />
die Unterbeschäftigung der Arbeitskräfte und die unausgelasteten Sachkapazitäten<br />
hingewiesen. Interessanterweise wenig diskutiert wird das<br />
›Übersparen‹: Da mehr gespart <strong>als</strong> im Inland investiert wurde, floss in<br />
den letzten fünf Jahren ein Sparüberschuss von rund 40 Milliarden pro<br />
Jahr ins Ausland ab.<br />
Wachstumsmedizin des Bundesrats<br />
Im vom Parlament veranlassten und 2002 erschienenen Wachstumsbericht<br />
werden die Ursachen der Wachstumsschwäche der schweizerischen<br />
Wirtschaft analysiert. Grundsätzlich kann eine Wirtschaft auf zwei<br />
Arten wachsen:<br />
1. durch einen stärkeren Einsatz von Arbeitskräften und Sachkapital;<br />
2. durch eine höhere Produktivität pro Arbeitsstunde, <strong>als</strong>o eine bessere<br />
Qualifikation der Arbeitskräfte, Produkt- und Prozessinnovationen sowie<br />
eine Umlagerung von Arbeitskräften aus Branchen mit tiefer Wertschöpfung<br />
(z.B. Landwirtschaft, Detailhandel, Gastgewerbe) in solche<br />
mit hoher Wertschöpfung pro Arbeitsstunde (z.B. Exportindustrie, Finanzsektor).<br />
Zwar lässt sich die Berufstätigkeit der Frauen erhöhen, wenn die Infrastrukturen<br />
für die Kinderbetreuung (Krippen, Tagesschulen usw.) landesweit<br />
ausgebaut werden. Zusätzliche Arbeitskräfte könnten durch eine<br />
Heraufsetzung des Rentenalters oder eine verstärkte Einwanderung<br />
gewonnen werden. Beides ist bekanntlich politisch sehr umstritten.
Politische Ökonomie<br />
Im Wachstumsbericht wird deshalb die Erhöhung der Arbeitsproduktivität<br />
<strong>als</strong> vorrangig bezeichnet. Dazu werden sowohl im Bericht <strong>als</strong><br />
auch im darauf aufbauenden Massnahmenpakte vom Februar 2004<br />
folgende sechs Ziele mit 17 Massnahmen genannt:<br />
Tabelle 2: Ziele und Massnahmen gemäss Wachstumspaket 2004<br />
Bis Ende 2006 will der Bundesrat dem Parlament für alle 17 Massnahmen<br />
entweder Gesetzesrevisionen vorschlagen oder mindestens Prüfungsberichte<br />
vorlegen.<br />
Wachstumspolitik aus Sicht des Autors<br />
Traditionellerweise krankte die schweizerische Wirtschaft daran, dass sie<br />
neben einem hochproduktiven und global wettbewerbsfähigen Exportsektor<br />
einen Binnensektor aufwies, der vor ausländischer Konkurrenz<br />
weitgehend oder ganz geschützt und weitgehend staatlich oder korporatistisch<br />
geprägt war. Die letzten zehn Jahre haben einen deutlichen<br />
Umschwung und wichtige Reformen gebracht, allerdings weniger aus<br />
eigener Kraft denn aufgrund des Anpassungsdrucks aus dem Ausland<br />
(europäische Integration, WTO, USA). Mit der gegenwärtigen Wachstumsdiskussion<br />
wurde denn auch ein für die Zukunft der Schweizer Wirtschaft<br />
sehr wichtiges Thema aufgegriffen. Neben berechtigten Punkten<br />
sind indessen drei Aspekte völlig in den Hintergrund getreten:<br />
120 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
121 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Politische Ökonomie<br />
• Die OECD schätzt, dass das gesamte Wachstumsprogramm des Bundes<br />
das reale BIP innerhalb der nächsten zehn Jahre um etwa 8% erhöhen<br />
dürfte. Dies gilt aber nicht für jede der vorgeschlagenen Massnahmen.<br />
So hat Sheldon für die Revision des Binnenmarktgesetzes nur<br />
minimale positive Effekte errechnet (siehe Literaturliste). Eine Konzentration<br />
auf das Wesentliche ist schon aus politischer Sicht unerlässlich.<br />
Bei den 17 oben angeführten Massnahmen fehlen indes Prioritäten.<br />
• Der Frage nach den Gewinnern und Verlierern des Wachstumsprozesses<br />
wird ausgewichen. Politisch unerwünscht ist offenbar ein politisches<br />
Konzept, das aufzeigt, wie die laufende Umverteilung von unten<br />
nach oben gestoppt und umgekehrt werden kann und welche Rolle das<br />
Wachstum dabei spielen kann. Gezielte Entlastungen für die untersten<br />
Einkommensschichten bei den Steuern und den Krankenkassenprämien,<br />
ergänzt um massiv erhöhte Kinderzulagen und die Abschaffung<br />
gewisser Steuerprivilegein für das Sparen (z.B. Säulen a und 3b, Eigenmietwertbesteuerung),<br />
würden nicht nur eine solche Umkehr auslösen,<br />
sondern das Wachstum auch nachfrageseitig dauerhaft abstützen.<br />
• Umweltprobleme werden weitgehend vernachlässigt. Nur schon die<br />
aktuellen Auseinandersetzungen über erneuerbare Energien und das Beschwerderecht<br />
der Umweltorganisationen bei grösseren Bauvorhaben<br />
zeigen aber, dass Wachstum nicht automatisch umweltverträglich (<strong>als</strong>o<br />
qualitativ) sein wird. Alle oben aufgeführten Massnahmen sind – sofern<br />
ihre Wirksamkeit erwiesen ist – einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu<br />
unterziehen, bevor sie umgesetzt werden. Ansonsten riskieren wir,<br />
Wachstum auf Kosten unserer natürlichen Lebensgrundlagen zu organisieren<br />
und kommenden Generationen neben den bereits bestehenden<br />
noch neue Hypotheken aufzubürden.<br />
Literatur<br />
Brunetti, Aymo (2004) ›Wachstum forever‹. In: Die Volkswirtschaft, Nr 5, 11–14.<br />
EVD (2002) ›Der Wachstumsbericht. Determinanten des Schweizer Wirtschaftswachstums<br />
und Ansatzpunkte für eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik‹ (Staatssekretariat<br />
für Wirtschaft seco). Bern.<br />
Gaillard, Serge (2005) Vortrag an der Wachstumskonferenz der Avenir Suisse vom 4. März<br />
2005 in Zürich (Manuskript).<br />
›Globale Trends (2003) Fakten, Analysen, Prognosen‹, Stiftung Entwicklung und Frieden (hg.<br />
v. Ingomar Hauchler, Dirk Messner, Franz Nuscheler). Bonn.<br />
Jans, Armin (2002) ›Zur Rolle des wirtschaftlichen Wettbewerbs‹. In: Rote Revue, Nr. 2.<br />
Jans, Armin (2004) ›Keynesianismus: Konjunktur und Sparen‹. In: Rote Revue, Nr. 2.<br />
OECD (2004a) ›Economic Outlook No. 76‹, December 2004. Paris.<br />
OECD (2004b) ›Quantitative Evaluation eines ehrgeizigen Reformprogramms‹. In: Die Volkswirtschaft,<br />
Nr. 12, 18–21.<br />
OECD (2005) ›Economic Outlook No. 77‹, June 2005. Paris.<br />
Sheldon, George (2004) ›Gesamtwirtschaftliche Kosten der unvollständigen Verwirklichung<br />
des Binnenmarktgesetzes‹. In: Die Volkswirtschaft, Nr. 12, 12–15.
Lohnpolitik<br />
Zur Mindestlohntagung<br />
Die Entwicklung sozialer Ungleichheit ist ein roter Faden, der die Diskussionen<br />
des <strong>Denknetz</strong>es prägt. Er führt unter anderem zur Analyse der<br />
Niedriglohnbereiche, die sich in vielen europäischen Ländern unter<br />
dem Einfluss der Deregulierung der Arbeitsmärkte ausdehnen. Wie ist<br />
diese Entwicklung zu verstehen? Welche Handlungsmöglichkeiten gibt<br />
es, um ihr zu begegnen? Diese Frage stand am Anfang der ersten länderübergreifenden<br />
Tagung, die das <strong>Denknetz</strong> gemeinsam mit dem WSI und<br />
in Zusammenarbeit mit dem IRES im April in Zürich veranstaltet hat.<br />
Die Kampagne ›Keine Löhne unter 3000 Franken‹ der Schweizer Gewerkschaften<br />
hatte die Niedriglöhne seit 1998 ins Zentrum des Interesses<br />
gerückt. Die Erfahrungen, die damit gemacht wurden, sind in<br />
Deutschland auf ein reges Interesse gestossen. <strong>Das</strong> dortige Tarifsystem<br />
ist in den letzten Jahren unter dem Druck der neoliberalen Offensive<br />
und der Massenarbeitslosigkeit stark erodiert, sodass sich erst die ForscherInnen<br />
des WSI, dann Teile der Gewerkschaft die Frage stellten, ob<br />
mit dem Tarifsystem allein die Niedriglöhne noch hinreichend bekämpft<br />
werden können. Von daher das Interesse an der öffentlichen Kampagne<br />
in der Schweiz, aber ebenso an der Erfahrung mit dem gesetzlichen Mindestlohn<br />
in Frankreich und England.<br />
Im Vorfeld der Tagung haben einige der Initiatoren zudem länderübergreifend<br />
Thesen zur Mindestlohnfrage erarbeitet, die in Deutsch,<br />
Französisch und Englisch zur Verfügung standen. Damit war für die Debatte<br />
an der Tagung ein guter inhaltlicher Boden geschaffen und darüber<br />
hinaus ein Impuls für die Fortsetzung der Diskussion auf europäischer<br />
Ebene gesetzt.<br />
Die ReferentInnen der Tagung deckten sowohl die wichtigsten analytischen<br />
Fragestellungen bezüglich den Niedriglöhnen <strong>als</strong> auch die Handlungsmöglichkeiten<br />
und Erfahrungen um Mindestlöhne ab.<br />
Die Tagung ist auf ein sehr grosses Interesse gestossen, insbesondere<br />
in Deutschland und der Schweiz, aber auch in sieben weiteren Ländern<br />
Europas. Rund 50 Personen haben daran teilgenommen, Gewerkschaftsverantwortliche,<br />
ForscherInnen und VertreterInnen staatlicher<br />
Institutionen. Diese Zusammensetzung hat sich für den Erfahrungsaustausch<br />
und die Debatte <strong>als</strong> äusserst fruchtbar erwiesen. Die Präsenz von<br />
ReferentInnen des europäischen Gewerkschaftsbunds und der europäischen<br />
Kommission war zudem hilfreich, um die Diskussion über die<br />
Bekämpfung von Niedriglöhnen und über eine Mindestlohnpolitik auf<br />
europäischer Ebene verstärkt weiterzuführen. Eine <strong>Buch</strong>publikation in<br />
deutscher und englischer Sprache ist geplant. Andreas Rieger<br />
122 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
123 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik<br />
Mindestlöhne in Europa<br />
– ein Überblick<br />
Für jede Beschäftigung ist ein gerechtes Entgelt zu zahlen. Zu diesem Zweck<br />
empfiehlt es sich, dass entsprechend den Gegebenheiten eines jeden Landes den<br />
Arbeitnehmern ein gerechtes Arbeitsentgelt garantiert wird, das heisst ein<br />
Arbeitsentgelt, das ausreicht, um ihnen eine angemessenen Lebensstandard<br />
zu erlauben.<br />
EU-Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989<br />
(Titel 1, Abs. 5)<br />
Soziale und politische Bedeutung von Mindestlöhnen<br />
Politische Regelungen zur Bestimmung von verbindlichen Mindestlöhnen<br />
finden sich in nahezu allen entwickelten kapitalistischen Gesellschaften.<br />
In der Regel wird im Rahmen von Kollektivverträgen für<br />
einzelne Branchen, Betriebe und/oder Berufe jeweils ein bestimmtes<br />
Mindestlohnniveau definiert, unter dem kein Arbeitnehmer (legal) beschäftigt<br />
werden darf. Wie bereits die Klassiker der politischen Ökonomie<br />
von Adam Smith bis Karl Marx erkannt haben, bilden kollektive<br />
Mindestlohnbestimmungen eine wichtige Vorraussetzung für die Funktionsfähigkeit<br />
von Arbeitsmärkten, da ohne solche Regelungen die Löhne<br />
aufgrund des strukturellen Machtungleichgewichtes zwischen Arbeit<br />
und Kapital permanent herabgedrückt würden. 1<br />
Allerdings weisen kollektivvertragliche Mindestlohn-Regelungen in<br />
vielen Ländern mehr oder weniger grosse Deckungslücken auf. Dies gilt<br />
insbesondere für die klassischen Niedriglohn-Branchen (z.B. im privaten<br />
Dienstleistungsgewerbe), in denen die Gewerkschaften aufgrund<br />
ihres eher geringeren Organisationsgrades oft keine angemessene Mindestlohn-Sicherung<br />
durchsetzen können. In diesen Fällen werden die<br />
kollektivvertraglichen Mindestlohn-Regelungen vielfach durch staatliche<br />
Regelungen ergänzt. Der Staat hat prinzipiell zwei Möglichkeiten,<br />
auf die Bestimmung von Mindestlöhnen Einfluss zu nehmen. Er kann<br />
zum einen kollektivvertragliche Mindestlohn-Regelungen für allgemeinverbindlich<br />
erklären und diese damit auf nicht tarifgebundene<br />
Unternehmen ausdehnen. Zum<br />
Thorsten Schulten anderen kann er durch die Ein-<br />
1966, Dr., wissenschaftlicher Referent beim führung gesetzlicher Mindestlöh-<br />
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen ne selber ein bestimmtes Mindest-<br />
Institut (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung lohnniveau festlegen.<br />
in Düsseldorf. Arbeitschwerpunkte: Ar- In der grossen Mehrzahl der eubeits-<br />
und Tarifpolitik in Europa.<br />
ropäischen Staaten und darüber
Lohnpolitik<br />
hinaus in den Staaten der OECD existieren neben kollektivvertraglichen<br />
Regelungen auch gesetzliche Mindestlöhne. 2 Damit wird anerkannt,<br />
dass es sich bei der Sicherung eines angemessenen Mindestlohnniveaus<br />
nicht allein um eine tarifpolitische, sondern auch um eine<br />
gesellschaftspolitische Aufgabe handelt. Mit der Festlegung eines allgemein<br />
gültigen gesetzlichen Mindestlohns wird eine universelle Norm<br />
definiert, die eine gesellschaftlich anerkannte Untergrenze darstellt,<br />
unterhalb derer eine Entlohnung nicht nur juristisch illegal ist, sondern<br />
auch von einer gesellschaftlichen Mehrheit <strong>als</strong> moralisch inakzeptabel<br />
angesehen wird. Die Schweiz bildet hier insofern einen Sonderfall, <strong>als</strong><br />
dort zwar kein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn existiert, es gleichzeitig<br />
den Schweizer Gewerkschaften mit ihrer Kampagne ›Keine Einkommen<br />
unter 3000 Franken‹ jedoch gelungen ist, eine gesellschaftlich<br />
weitgehend akzeptierte Mindestlohnnorm zu etablieren.<br />
Mit der Bestimmung von Mindestlöhnen ist immer auch eine normative<br />
Vorstellung von einer gerechten und fairen Entlöhnung verbunden,<br />
wie sie <strong>als</strong> soziales Grundrecht in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte<br />
von 1948 sowie in zahlreichen internationalen Vereinbarungen<br />
(z.B. der Sozialcharta des Europarates von 1961 oder der Gemeinschaftscharta<br />
der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer der Europäischen<br />
Union von 1989) festgeschrieben ist. 3 Als Kriterium für eine<br />
gerechte oder faire Entlöhnung werden in der Regel drei grundlegende<br />
Prinzipien sozialer Gerechtigkeit angeführt. 4 Zum einen geht es um das<br />
Prinzip der Leistungsgerechtigkeit, wonach der Lohn in einem angemessen<br />
Verhältnis zur geleisteten Arbeit stehen muss. Da die Frage nach<br />
einem leistungsgerechten Lohn immer auch im Verhältnis zu anderen<br />
Löhnen und Einkommen steht, wird zweitens das Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit<br />
berührt, das die gesamtgesellschaftliche Einkommensverteilung<br />
in den Blick nimmt.<br />
Schliesslich wird drittens das Recht auf einen gerechten und fairen<br />
Lohn mit dem Prinzip der Teilhabegerechtigkeit begründet, wonach die<br />
Lohnarbeit nicht nur ein bestimmtes physisches Existenzminimum<br />
garantieren muss, sondern darüber hinaus – wie es die englischen Begriffe<br />
›Decent Wage‹ oder ›Living Wage‹ zum Ausdruck bringen – eine<br />
angemessene Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen soll. Im<br />
Unterschied zur sozi<strong>als</strong>taatlichen Mindestsicherung (z.B. der Sozialhilfe)<br />
markiert der gesetzliche Mindestlohn den »ersten Grad der Zugehörigkeit<br />
zu einem Arbeitnehmerstatus, dank dessen der Lohn nicht nur<br />
eine Form ökonomischer Vergütung ist«. 5 Seine politische Legitimation<br />
erhält der Mindestlohn damit aus dem Anspruch, dass die Lohnarbeit<br />
einen bestimmten Lebensstandard ermöglichen muss, der den Arbeit-<br />
124 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
nehmer/innen eine angemessene gesellschaftliche Teilhabe und eine<br />
adäquate Reproduktion ihrer Arbeitskraft garantiert.<br />
Die inhaltliche Definition einer »angemessenen gesellschaftlichen Teilhabe«<br />
und mithin die konkrete Festlegung eines gesetzlichen Mindestlohnniveaus<br />
ist stets Gegenstand kontroverser gesellschaftlicher Auseinandersetzungen<br />
und letztlich das Ergebnis eines sozialen Aushandlungsprozesses,<br />
dem ein bestimmter sozialer und politischer Interessenskompromiss<br />
zugrunde liegt. Insofern ist der gesetzliche Mindestlohn<br />
keineswegs nur eine Angelegenheit des Staates, sondern begünstigt<br />
vielmehr eine Politisierung der Lohnfrage, die vor allem auch den<br />
Gewerkschaften über die Tarifpolitik hinaus gesellschaftspolitische Einflusschancen<br />
einräumt.<br />
Mindestlöhne in der ökonomischen Diskussion<br />
Über die ökonomischen Funktionen gesetzlicher Mindestlöhne existiert<br />
innerhalb der Wirtschaftswissenschaften eine breite internationale Debatte,<br />
in der je nach theoretischer Provenienz diametral entgegengesetzte<br />
Positionen vertreten werden. Für Vertreter einer neoklassischen<br />
Arbeitsmarkttheorie ist jede politische Bestimmung des Lohnes – sei es<br />
durch Tarifverträge oder einen gesetzlichen Mindestlohn – entweder<br />
wirkungslos oder schädlich. Liegt ein Mindestlohn unterhalb des auf<br />
dem ›freien‹ Arbeitmarkt durch Angebot und Nachfrage gebildeten<br />
›Marktlohns‹, so bleibt dieser ohne Wirkung, da die existierenden Löhne<br />
nicht tangiert werden. Liegt der gesetzliche Mindestlohn oberhalb des<br />
im neoklassischen Standardmodell unterstellten ›Marktlohns‹, so geht<br />
automatisch die Nachfrage nach Arbeit zurück und es kommt zu Arbeitslosigkeit.<br />
Die neoklassische Lehrbuchökonomie vertritt demnach<br />
die Position, dass gesetzliche Mindestlöhne gerade jenen Beschäftigtengruppen<br />
im unteren Lohnsegment schaden, die eigentlich von ihnen<br />
profitieren sollen. 6<br />
Der im neoklassischen Standardmodell unterstellte gegenläufige Zusammenhang<br />
zwischen der Höhe gesetzlicher Mindestlöhne und dem<br />
Ausmass der Beschäftigung ist seit jeher von nicht-neoklassischen Ökonomen<br />
kritisiert worden. Gerade in der neueren ökonomischen Literatur<br />
werden – nicht zuletzt vor dem Hintergrund neuerer empirischer<br />
Studien – vermehrt alternative theoretische Erklärungsansätze vertreten,<br />
die zu einer anderen ökonomischen Funktionsbestimmung von Mindestlöhnen<br />
gelangen. 7<br />
Im Mittelpunkt der Kritik steht die neoklassische Konstruktion des Arbeitsmarktes,<br />
der <strong>als</strong> ein Markt wie jeder andere gedacht wird und dem<br />
idealtypisch alle Attribute einer vollständigen Konkurrenz (wie vollkom-<br />
125 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik
Lohnpolitik<br />
mene Informationen, uneingeschränkte Mobilität usw.) zugeschrieben<br />
werden. Realistischere Vorstellungen gehen stattdessen davon aus, dass<br />
der Arbeitsmarkt mit zahlreichen Friktionen behaftet ist, die zu einer<br />
höchst unvollständigen Konkurrenzsituation führen. Hinzu kommt, dass<br />
aufgrund des besonderen Charakters der Ware Arbeitskraft von einer<br />
strukturellen Machtungleichheit zwischen Kapital und Arbeit auszugehen<br />
ist, die – zumal unter der Bedingung von Arbeitslosigkeit – den Prozess<br />
der Lohnfestsetzung determiniert.<br />
In der neueren ökonomischen Literatur ist vielfach der Versuch unternommen<br />
worden, den Arbeitsmarkt <strong>als</strong> ›monopsonistischen‹ Markt<br />
zu beschreiben. 8 Indem die Unternehmen tendenziell <strong>als</strong> Nachfragemonopolist<br />
(Monopson) agieren, sind sie zumeist in der Lage, Löhne<br />
durchzusetzen, die unterhalb des Marktlohnes liegen, der sich unter den<br />
Bedingungen vollständiger Konkurrenz herausbilden würde. Auf monopsonistischen<br />
Märkten lässt sich daher keine eindeutige Beziehung<br />
zwischen gesetzlichen Mindestlöhnen und Beschäftigung bestimmen.<br />
Solange die Festlegung beziehungsweise Erhöhung gesetzlicher Mindestlöhnen<br />
lediglich die Marktmacht des Unternehmens ausgleicht und<br />
dadurch die Entstehung eines ›Marktlohnes‹ erst ermöglicht, sind selbst<br />
in einem ansonsten neoklassisch definierten Arbeitsmarktmodell keine<br />
negativen Beschäftigungswirkungen zu erwarten. 9<br />
Folgt man darüber hinaus dem in den verschiedenen Effizienzlohntheorien<br />
behaupteten Zusammenhang zwischen Lohnhöhe und Produktivität<br />
10 , so kann eine Erhöhung von Mindestlöhnen theoretisch sogar<br />
positive Beschäftigungseffekte nach sich ziehen, wenn diese mit<br />
überproportionalen Produktivitätserhöhungen einhergehen. Bereits die<br />
ersten Bestimmungen zur Einführung gesetzlicher Mindestlöhne am<br />
Ende des 19. Jahrhunderts wurden ökonomisch vor allem mit den Verweis<br />
auf die zu erzielenden Produktivitätsgewinne legitimiert, die aus<br />
einer nach unten begrenzten Lohnkonkurrenz erwachsen. 11<br />
Schliesslich lassen sich aus keynesianischer Perspektive zwei für<br />
Wachstum und Beschäftigung positive ökonomische Funktionen gesetzlicher<br />
Mindestlöhne identifizieren 12 : Zum einen können gesetzliche<br />
Mindestlöhne zur Stabilisierung der Nachfrage beitragen, da gerade bei<br />
Niedriglohnbeziehern eine besonders hohe Konsumquote und geringe<br />
Sparneigung existiert. Zum anderen können gesetzliche Mindestlöhne<br />
insbesondere in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und hierdurch geschwächter<br />
Gewerkschaften eine Barriere gegen deflationäre Lohnkürzungen<br />
bilden.<br />
126 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Internationale Verbreitung<br />
von gesetzlichen Mindestlöhnen<br />
Historisch sind die ersten gesetzlichen Mindestlohn-Bestimmungen in<br />
der letzten Dekade des 19. Jahrhunderts entstanden. Gesetzliche Mindestlöhne<br />
werden erstm<strong>als</strong> 1894 in Neuseeland eingeführt. Zwei Jahre<br />
später kommt es zur ersten Mindestlohn-Gesetzgebung im australischen<br />
Bundesstaat Victoria. In Europa ist Grossbritannien das erste Land, das<br />
1908 gesetzliche Mindestlohn-Bestimmungen einführt. In den USA wird<br />
schliesslich erstm<strong>als</strong> 1912 im Bundesstaat Massachusetts eine Mindestlohn-Gesetzgebung<br />
verabschiedet. 13<br />
Nachdem die frühen Mindestlohnbestimmungen ursprünglich nur für<br />
bestimmte Branchen oder Berufsgruppen galten, führen in der zweiten<br />
Hälfte des 20. Jahrhunderts immer mehr Länder nationale gesetzliche<br />
Mindestlöhne ein, die über alle Branchen hinweg ein einheitliches Mindestlohnniveau<br />
festlegen. Eine Vorreiterrolle haben hierbei die USA<br />
eingenommen, die 1938 mit der Verabschiedung der Fair Labor Standards<br />
Act erstm<strong>als</strong> eine nationale Mindestlohn-Gesetzgebung eingeführt<br />
haben. Mittlerweile verfügt die Mehrzahl der OECD-Staaten –<br />
darunter die meisten Länder der EU sowie die USA, Kanada, Australien,<br />
Neuseeland, Japan und Südkorea – über nationale gesetzliche Mindestlöhne.<br />
15<br />
Innerhalb der EU haben 18 von 25 Mitgliedstaaten einen gesetzlichen<br />
Mindestlohn 16 (siehe Abbildung 1). Während einige EU-Staaten bereits<br />
seit mehreren Jahrzehnten über praktische Erfahrungen mit gesetzlichen<br />
Mindestlöhnen verfügen, haben Irland und Grossbritannien erst Ende<br />
der 1990er-Jahre nationale gesetzliche Mindestlöhne eingeführt. In den<br />
meisten Ländern aus Mittel- und Osteuropa (MOE) wurden im Rahmen<br />
der Transformationsperiode Anfang der 1990er-Jahre neue gesetzliche<br />
Mindestlohn-Regelungen geschaffen, die vor dem Hintergrund eher<br />
schwach entwickelter Tarifvertragssysteme seither für die gesamte Lohnentwicklung<br />
eine besonders wichtige Rolle spielen.<br />
Bezogen auf die absolute Höhe des nationalen Mindestlohns, lassen<br />
sich innerhalb der EU drei Ländergruppen identifizieren (siehe Abbildung<br />
1): Zur ersten Gruppe mit relativ hohen Mindestlöhnen zwischen<br />
1183 und 1467 Euro pro Monat gehören die Beneluxstaaten sowie<br />
Frankreich, Grossbritannien und Irland. Eine zweite mittlere Gruppe<br />
mit Mindestlöhnen zwischen 437 und 690 Euro pro Monat umfasst die<br />
südeuropäischen EU-Staaten Spanien, Portugal, Malta und Griechenland<br />
sowie Slowenien. Schliesslich finden sich in der dritten Gruppe mit<br />
relativ niedrigen Mindestlöhnen zwischen 116 und 239 Euro pro Monat<br />
ausschliesslich MOE-Staaten. Lediglich die EU-Bewerberländer Bulga-<br />
127 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik
Lohnpolitik<br />
Abbildung 1: GesetzlicheMindestlöhne pro Monat in Euro (Anfang 2005)<br />
rien und Rumänien haben ein noch niedrigeres gesetzliches Mindestlohnniveau.<br />
In den USA bewegt sich der gesetzliche Mindestlohn eher<br />
auf südeuropäischem Niveau und liegt damit deutlich unterhalb der<br />
westeuropäischen Spitzengruppe. Allerdings weisen eine Reihe von US-<br />
Bundesstaaten deutlich höhere gesetzliche Mindestlöhne auf. 17<br />
Die Schweiz nimmt mit dem von den Gewerkschaften anvisierten<br />
Mindestlohn von 3000 Schweizer Franken (= 1950 Euro) mit Abstand<br />
die europäische Spitzenposition ein. Allerdings spiegeln die unterschiedlichen<br />
Niveaus der nationalen Mindestlöhne zu einem bedeutenden<br />
Anteil die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in den einzelnen<br />
Ländern wider. Gemessen in Kaufkraftstandards reduziert sich das Verhältnis<br />
zwischen dem niedrigsten und dem höchsten gesetzlichen Mindestlohn<br />
in der EU von 1:12 (gemessen in Euro) auf etwa 1:4. 18<br />
Die Entwicklung der gesetzlichen Mindestlöhne wird schliesslich in<br />
hohem Masse durch die politisch-institutionelle Ausgestaltung beeinflusst.<br />
Bei der Festelegung und periodischen Anpassung des gesetzlichen<br />
Mindestlohns lassen sich idealtypisch vier unterschiedliche Verfahren<br />
identifizieren. 19 Bei dem ersten Typus handelt es sich um ein ›rein politisches‹<br />
Verfahren, bei dem die jeweilige nationale Regierung vollkommen<br />
eigenmächtig, ohne institutionalisierte Diskussions- und Konsultationsforen<br />
oder gesetzlich festgelegte Anpassungsregelungen, über die<br />
Höhe des gesetzlichen Mindestlohns entscheidet. Dieses ›rein politische‹<br />
Verfahren findet sich insbesondere in den USA und hat in den letzten<br />
Jahrzehnten oft dazu geführt, dass unter einer republikanischen Regierung<br />
der nationale Mindestlohn über mehrere Jahre hinweg nicht mehr<br />
erhöht wurde und damit in seinem Realwert deutlich gesunken ist. 20<br />
128 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
In den meisten europäischen Ländern existiert hingegen ein institutionalisiertes<br />
Konsultationsverfahren, in dem Arbeitgeberverbände und<br />
Gewerkschaften an der Entwicklung des Mindestlohns beteiligt werden<br />
und gegenüber der Regierung Empfehlungen für seine periodische Erhöhung<br />
aussprechen. Ein besonders entwickeltes Modell dieses zweiten<br />
Typus bildet die so genannte Low-Pay-Commission in Grossbritannien,<br />
die sich drittelparitätisch aus Arbeitgebern, Gewerkschaften und Wissenschaftern<br />
zusammensetzt und auf der Grundlage umfangreicher Studien<br />
jährlich Empfehlungen zur Erhöhung des Mindestlohns abgibt.<br />
In einigen Ländern wie Belgien, Irland und Griechenland sowie einigen<br />
MOE-Staaten findet sich ein dritter Typus, wonach der nationale<br />
Mindestlohn auf nationaler Ebene zwischen den Dachverbänden der<br />
Gewerkschaften und Arbeitgeber verhandelt wird und anschliessend<br />
durch den Staat Gesetzeskraft erhält. Schliesslich gibt es <strong>als</strong> vierten<br />
Typus in den Beneluxstaaten und Frankreich sowie neuerdings auch in<br />
Polen eine Indexierung der Mindestlöhne, wonach das jeweilige Mindestlohnniveau<br />
automatisch an die Preisentwicklung beziehungsweise –<br />
wie in den Niederlanden – an die durchschnittliche Lohnentwicklung<br />
angepasst wird. Die Indexierungsverfahren werden dabei in der Regel<br />
in Kombination mit politischen Verfahren angewandt. Insgesamt bietet<br />
dieser vierte Typus die grösste Gewähr, dass die Entwicklung der Mindestlöhne<br />
mit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung Schritt<br />
hält. 21<br />
Auswirkung von Mindestlöhnen auf<br />
Beschäftigung und Einkommensverteilung<br />
Die wissenschaftliche Debatte über die beschäftigungs- und verteilungspolitischen<br />
Auswirkungen von gesetzlichen Mindestlöhnen wurde<br />
lange Zeit von der US-amerikanischen Literatur dominiert. Bis in die<br />
1980er-Jahre hinein gelangten die meisten empirischen Untersuchungen<br />
für die USA zu dem Ergebnis, dass von den gesetzlichen Mindestlöhnen<br />
– insbesondere bei jungen Arbeitnehmern – tendenziell leicht negative<br />
Beschäftigungseinflusse ausgehen. Seither haben sich die Einschätzungen<br />
über die beschäftigungspolitischen Implikationen von gesetzlichen<br />
Mindestlöhnen allerdings stark gewandelt. Waren 1990 noch 63%<br />
der US-Ökonomieprofessoren der Meinung, dass gesetzliche Mindestlöhne<br />
die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen erhöhen, so waren es im<br />
Jahre 2000 nur noch 46%. 22<br />
Ausgelöst wurde dieser Meinungsumschwung vor allem durch die Studien<br />
von David Card und Alan B. Krueger, die unter der Verwendung<br />
neuerer empirischer Methoden zu dem Ergebnis kommen, dass kein<br />
129 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik
Lohnpolitik<br />
systematischer Zusammenhang zwischen Mindestlöhnen und Beschäftigung<br />
besteht. 23 Berühmt geworden sind vor allem ihre ›natürlichen<br />
Experimente‹, bei dem sie die Beschäftigungsentwicklung in Fast-Food-<br />
Restaurants in den benachbarten US-Bundesstaaten New Jersey und<br />
Pennsylvania untersuchten, wobei in New Jersey der gesetzliche Mindestlohn<br />
erhöht wurde, während er in Pennsylvania gleich blieb. Die<br />
Untersuchungen kommen eindeutig zu dem Ergebnis, dass die Erhöhung<br />
der Mindestlöhne keinen negativen Einfluss auf die Beschäftigung<br />
hat.<br />
Auch innerhalb Europas kommen neue Studien überwiegend zu dem<br />
Ergebnis, dass mit gesetzlichen Mindestlöhnen keine eindeutigen Beschäftigungseffekte<br />
verbunden sind. 24 Gesetzliche Mindestlöhne können<br />
im Gegenteil je nach ökonomischer Lage von Branche zu Branche sehr<br />
unterschiedliche Auswirkungen haben, wobei gesamtwirtschaftlich ihre<br />
Bedeutung eher gering ist. Besonders gut erforscht ist vor allem die<br />
Situation in Irland und Grossbritannien, wo die Einführung gesetzlicher<br />
Mindestlöhne seit Ende der 1990er-Jahre von zahlreichen Studien begleitet<br />
wurde. Dabei herrscht weitgehend Übereinstimmung, dass die<br />
Einführung in beiden Ländern insgesamt keine negativen Beschäftigungswirkungen<br />
nach sich gezogen hat. 25<br />
Im Hinblick auf seine einkommens- und verteilungspolitischen Implikationen<br />
begrenzt ein gesetzlicher Mindestlohn per definitionem das<br />
Absinken der Löhne unter ein bestimmtes Niveau und dichtet damit die<br />
gesellschaftliche Lohnstruktur nach unten hin ab. Für viele europäische<br />
Länder lässt sich nachweisen, dass in der Vergangenheit die gesetzlichen<br />
Mindestlöhne auf diese Weise eine potentielle Ausdehnung der Lohnspreizung<br />
verhindert oder gar zu ihrer Verringerung beigetragen haben.<br />
26 Umgekehrt kann etwa für die USA die starke Zunahme der Lohnspreizung<br />
in den 1980er-Jahren zu einem grossen Teil mit der mangelnden<br />
Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns an die allgemeine<br />
Lohn- und Preisentwicklung erklärt werden. 27<br />
Darüber hinaus haben sich gesetzliche Mindestlöhne <strong>als</strong> ein geeignetes<br />
Instrument zur Bekämpfung von Lohndiskriminierungen gegenüber<br />
Frauen und ethnischen Minoritäten erwiesen, da diese Beschäftigtengruppen<br />
in der Regel am unteren Rand der Lohnskala deutlich überrepräsentiert<br />
sind. 28 Schliesslich können gesetzliche Mindestlöhne auch<br />
einen Beitrag zur Verringerung von Armut leisten. Allerdings ist der hier<br />
wirksam werdende Zusammenhang insofern begrenzt, <strong>als</strong> dass er erstens<br />
nur arbeitende Arme betrifft (während ein hoher Anteil der Armen erwerbslos<br />
ist) und zweitens nicht alle Mindestlohnbezieher in von Armut<br />
betroffenen Haushalten leben.<br />
130 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Die Debatte um die Einführung<br />
eines gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland<br />
Deutschland gehört zu den wenigen Ländern innerhalb Europas, in denen<br />
kein gesetzlicher Mindestlohn existiert. Dies hat vor allem historische<br />
Gründe: Angesichts der negativen Erfahrungen mit staatlichen Interventionen<br />
in die Lohnpolitik zur Zeit der Weimarer Republik und des<br />
Nation<strong>als</strong>ozialismus ist der Gedanke der Tarifautonomie in Deutschland<br />
besonders ausgeprägt. Bis in die Gegenwart findet das Prinzip einer<br />
autonomen, <strong>als</strong>o von staatlichen Vorgaben weitgehend unabhängigen<br />
Bestimmung der Löhne und anderer Arbeitsbedingungen eine breite<br />
Unterstützung. Insbesondere die Gewerkschaften sehen in der Tarifautonomie<br />
den Garanten für eine demokratische Partizipation der Beschäftigten<br />
an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen, die zugleich die<br />
wichtigste Legitimationsquelle gewerkschaftlichen Handelns darstellt.<br />
Die übrigen europäischen Länder, in denen kein gesetzlicher Mindestlohn<br />
existiert, verfügen jedoch in der Regel über funktionale Äquivalente,<br />
die eine hohe Tarifbindung und damit ein funktionierendes System<br />
einer tarifvertraglichen Mindestlohn-Sicherung gewährleisten. 29 Zu<br />
dieser Gruppe gehören vor allem die skandinavischen Länder Dänemark,<br />
Schweden und Finnland, die aufgrund des so genannten Gent-<br />
Systems (in dem die Gewerkschaften die Arbeitslosenversicherung<br />
verwalten) einen sehr hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad<br />
aufweisen, der ihnen eine tarifvertragliche Deckungsrate von mehr <strong>als</strong><br />
90% garantiert. In Österreich, das ebenfalls über keinen gesetzlichen<br />
Mindestlohn verfügt, ist es die Pflichtmitgliedschaft der Arbeitgeber in<br />
der Wirtschaftskammer, die eine beinahe flächendeckende Tarifbindung<br />
sicherstellt. Italien verfügt wiederum über eine aus der Verfassung<br />
abgeleitete Lohngarantie, wonach de facto alle Arbeitnehmer die tarifvertraglich<br />
vereinbarten Mindestlöhne erhalten müssen. Schliesslich<br />
besteht in der Schweiz eine gesellschaftlich weitgehend anerkannte Mindestlohnnorm,<br />
die eine kollektivvertragliche Mindestlohn-Sicherung<br />
erleichtert und in bestimmten Bereichen durch staatliche Allgemeinverbindlichkeitserklärungen<br />
unterstützt wird.<br />
Einzig Deutschland verfügt über keines dieser funktionalen Äquivalente<br />
und weist deshalb immer gravierendere Lücken in der tarifvertraglichen<br />
Mindestlohn-Sicherung auf. So hat der Anteil der Beschäftigten<br />
im Niedriglohn-Sektor seit Mitte der 1990er-Jahre deutlich zugenommen.<br />
Davon betroffen sind nicht nur Arbeitnehmer in prekären Beschäftigungsverhältnissen,<br />
sondern auch eine wachsende Anzahl von<br />
Vollzeitbeschäftigten. 30 Nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt<br />
und Berufsforschung (IAB) arbeiteten im Jahre 2001 17,4% aller sozial-<br />
131 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik
Lohnpolitik<br />
versicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohn-Sektor,<br />
wobei die Niedriglohnschwelle bei 2/3 des Medianlohns angesetzt<br />
wurde. 31<br />
Die zunehmenden Lücken der tarifvertraglichen Mindestlohn-Sicherung<br />
in Deutschland können im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückgeführt<br />
werden. Zum einen ist die tarifvertragliche Deckungsrate in<br />
Deutschland seit Mitte der 1990er-Jahre deutlich zurückgegangen, so<br />
dass heute bereits 32% der Beschäftigten in Westdeutschland und sogar<br />
48% der Beschäftigten in Ostdeutschland keiner Tarifbindung mehr<br />
unterliegen. Dabei ist die Tarifbindung in vielen klassischen Niedriglohnbranchen<br />
des privaten Dienstleistungssektors besonders niedrig. 32<br />
Zum anderen sind in zahlreichen Tarifverträgen Niedriglohngruppen<br />
festgeschrieben, deren Höhe sich auf dem Niveau von Armutslöhnen<br />
bewegt. Nach einer Untersuchung des Bundesministeriums für Wirtschaft<br />
und Arbeit existieren mehr <strong>als</strong> 130 Tarifbereiche mit Stundenentgelten<br />
von sechs Euro oder weniger.<br />
Die deutschen Gewerkschaften sind in vielen Branchen offensichtlich<br />
nicht mehr in der Lage, existenzsichernde Mindestlöhne durchzusetzen.<br />
Dementsprechend plädieren sie einmütig dafür, die Mindestlohn-Sicherung<br />
durch staatliche Unterstützung zu stärken. Allerdings bestehen<br />
im Hinblick auf die konkreten Formen und Instrumente nach wie vor<br />
grosse Unterschiede, wobei idealtypisch drei Positionen unterschieden<br />
werden können. 33 Die erste Position, die vor allem von der IG BAU vertreten<br />
wird, plädiert für die Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung<br />
und die Ausdehnung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes<br />
über den Bausektor hinaus auf alle Branchen. In der Zwischenzeit<br />
hat sich auch die rot-grüne Bundesregierung diesen Vorschlag zu Eigen<br />
gemacht und dem Bundestag einen entsprechenden Gesetzesvorschlag<br />
vorgelegt. Die Ausdehnung des Entsendegesetzes würde sicherlich<br />
einigen Branchen helfen, branchenbezogene Mindestlöhne durchzusetzen.<br />
Dies gilt vor allem für jene Branchen, in denen – ähnlich wie in der<br />
Bauwirtschaft – auch die Arbeitgeber ein wettbewerbspolitisches Interesse<br />
an der Festlegung von Mindestlöhnen haben. Allerdings kann das<br />
Entsendegesetz nur dort wirksam werden, wo überhaupt flächendeckende<br />
Tarifverträge vorhanden sind, was in vielen Branchen nicht der<br />
Fall ist.<br />
Über eine Erweiterung des Entsendegesetzes hinaus hat deshalb die<br />
IG Metall ein System branchenbezogener gesetzlicher Mindestlöhne<br />
vorgeschlagen, wonach alle tarifvertraglich vereinbarten Mindestlöhne<br />
automatisch per Gesetz für die gesamte Branchen gelten sollen. 34 Für<br />
diejenigen Bereiche, in denen kein Tarifvertrag existiert, sollte nach<br />
132 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
dem Vorschlag der IG Metall der branchenübergreifende Tarifvertrag<br />
für die Zeitarbeit <strong>als</strong> Richtschnur gelten.<br />
Beide bislang erörterten Vorschläge setzen auf ein branchenbezogenes<br />
Mindestlohnmodell, in dem die Höhe der Mindestlöhne durch Tarifvereinbarungen<br />
festgelegt und mit Hilfe staatlicher Unterstützung allgemeinverbindlich<br />
erklärt wird. Problematisch sind diese Modelle allerdings<br />
in jenen Branchen, in denen es den Gewerkschaften nicht gelingt,<br />
für die unteren Lohngruppen Löhne oberhalb der Armutsschwelle<br />
durchzusetzen. Deshalb fordern die Gewerkschaft Nahrung Genuss<br />
Gaststätten (NGG) und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)<br />
darüber hinaus die Einführung eines allgemeinen, über alle Branchen<br />
hinweg geltenden gesetzlichen Mindestlohns von 1250 Euro (ver.di)<br />
respektive 1500 Euro (NGG) pro Monat. 35 Insgesamt würden je nach<br />
Niveau zwischen 2,4 und 3,4 Millionen Beschäftigte von einer gesetzlichen<br />
Mindestregelung profitieren.<br />
Plädoyer für ein europäische Mindestlohnpolitik<br />
<strong>Das</strong> in der Europäischen Sozialcharta und anderen internationalen Vereinbarungen<br />
postulierte Recht auf eine ›gerechte‹ Entlöhnung, die eine<br />
angemessene gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen soll, ist für viele Beschäftigten<br />
in den meisten europäischen Staaten nach wie vor nicht verwirklicht.<br />
In den letzten Jahren lässt sich im Gegenteil eher eine Ausdehnung<br />
des Niedriglohnsektors beobachten. Allein in den ›alten‹ EU-<br />
Staaten (EU 15) müssen mehr <strong>als</strong> 15% der Beschäftigten (d.h. mehr <strong>als</strong><br />
20 Millionen Lohnanhängige) zu den Niedriglohn-Empfängern gezählt<br />
werden. Diese Entwicklung ist auch durch eine neoliberale Wirtschaftspolitik<br />
in der EU befördert worden, die primär auf die Liberalisierung<br />
von Märkten und die Deregulierung von Arbeits- und Sozialrechten<br />
setzt. Hinzu kommt, dass aufgrund des nationalen Lohngefälles mit der<br />
Ausdehnung der Personenfreizügigkeit die bestehenden Lohnstrukturen<br />
insbesondere in grenznahen Regionen unter Druck gesetzt werden.<br />
Die derzeit existierenden Mindestlohnregelungen reichen in vielen<br />
Fällen nicht aus, um das zunehmende Phänomen der ›arbeitenden Armen‹<br />
(›working poor‹) zu verhindern. Von wenigen Ausnahmen abgesehen,<br />
liegen die gesetzlich festgelegten Mindestlöhne zum Teil deutlich<br />
unterhalb von 50% des jeweiligen nationalen Durchschnittslohnes und<br />
müssen damit <strong>als</strong> ›Armutslöhne‹ bezeichnet werden. 36 Vor diesem Hintergrund<br />
haben Wissenschaftler des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen<br />
Instituts (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung in Deutschland,<br />
des <strong>Denknetz</strong>es in der Schweiz und des Institut de Recherches Economiques<br />
et Sociales (IRES) in Frankreich gemeinsam Thesen für eine<br />
133 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik
Lohnpolitik<br />
europäische Mindestlohnpolitik entwickelt, in dem sie ein koordiniertes<br />
Vorgehen auf europäischer Ebene vorschlagen. 37 Demnach sollen sich<br />
alle Länder verpflichten, die Mindestlöhne schrittweise auf ein Niveau<br />
anzuheben, dass mindestens 50% – und perspektivisch 60% – des nationalen<br />
Durchschnittseinkommens entspricht.<br />
Ähnlich wie in anderen europäischen Politikfeldern könnte eine europäische<br />
Mindestlohnpolitik sich der ›Methode der offenen Koordinierung‹<br />
bedienen, wonach auf europäischer Ebene bestimmte konkrete<br />
Ziele und Umsetzungsfristen festgelegt werden, die dann im nationalen<br />
Rahmen mit den dort üblichen Institutionen und Verfahren realisiert<br />
werden. Je nach nationaler Tradition können dabei gesetzliche Mindestlöhne,<br />
allgemeinverbindlich erklärte Kollektivvereinbarungen oder<br />
Kombinationen von beiden Regelungsverfahren zur Anwendung kommen.<br />
Die europäische Ebene hat wiederum die Aufgabe, die Umsetzung<br />
auf nationaler Ebene zu überwachen und durch ein umfassendes Monitoring<br />
nationaler Mindestlohnpolitiken zur Verbreitung ›guter nationaler<br />
Praktiken‹ beizutragen. Eine so konzipierte europäische Mindestlohnpolitik<br />
könnte einen konkreten Beitrag zur Entwicklung eines<br />
sozialen Europas leisten, dass sich dem Grundsatz verpflichtet fühlt,<br />
»dass der Lohn jedem abhängig Beschäftigten ein Leben in Würde und<br />
finanzieller Unabhängigkeit ermöglichen muss.«<br />
134 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Literatur<br />
Akerlof, George, Janet Yellen (Hg.) (1986) ›Efficiency Wage Models of the Labour Market‹.<br />
Cambridge.<br />
Bispinck, Reinhard, Claus Schäfer (2005) ›Niedriglöhne? Mindestlöhne! Verbreitung von<br />
Niedriglöhnen und Möglichkeiten ihrer Bekämpfung‹. In: Sozialer Fortschritt, 54. Jg., 20-<br />
31.<br />
Bundesregierung (2004) ›Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion<br />
der CDU/CSU über den Wandel der Arbeitswelt und die Modernisierung des Arbeitsrechts‹.<br />
Deutscher Bundestag Drucksache 15/2932 vom 19. April.<br />
Burmeister, Kai (2004) ›Der gesetzliche Mindestlohn in den USA‹. In: WSI-Mitteilungen, 57.<br />
Jg., 603–609.<br />
Card, D. u. A. B. Krueger (1995) ›Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum<br />
Wage‹. Princeton.<br />
Castel, Robert (2000) ›Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine Chronik der Lohnarbeit‹.<br />
Kostanz.<br />
Daloz, Jean Pierre (1993) ›Research into a Method of Defining ‘decent’ and ‘fair’ Wages within<br />
the meaning of Article 4, Paragraph 1, of the European Social Charter‹, Mimeo, March.<br />
Däubler, Wolfgang, Michael Kittner, Klaus Lörcher (Hg.) (1990) ›Internationale Arbeits- und<br />
Sozialordnung‹. Köln.<br />
Ellguth, Peter, Susanne Kohaut (2005) ›Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung:<br />
Aktuelle Ergebnisse aus dem IAB-Betriebspanel‹. In: WSI-Mitteilungen, 58. Jg., 398–403.<br />
Europäische Kommission (2004) ›Employment in Europe 2004. Recent Trends and Prospects‹.<br />
European Communities.<br />
Fuller, Dan, Doris Geide-Stevenson (2003) ›Consensus among Economists: Revisited‹. In:<br />
Journal of Economic Education, vol. 34, 369-387<br />
Funk, Lothar, Hagen Lesch (2005) ›Minimum Wages in Europe‹. EIROnline (www.eiro.eurofound.eu.int/print/2005/07/study/tn0507101s.html).<br />
Herr, Hansjörg (2002) ›Wages, Employment and Prices. An Analysis of the Relationship between<br />
Wage Level, Wage Structure, Minimum Wages and Employment and Prices‹. Business<br />
Institute Berlin at the Berlin School of Economics (FHW-Berlin), Working Paper No. 15.<br />
Manning, Alan (2003) ›Monopsony in Motion, Imperfect Competition in Labour Markets‹. Princeton.<br />
Nolan, Brian, James Williams, Sylvia Blackwell (2003) ›New Results on the Impact of the Minimum<br />
Wage in Irish Firms‹. In: Quarterly Economic Commentary (ESRI, Dublin), December,<br />
1–10.<br />
OECD (1998) ›Making most of the Minimum: Statutory Minimum Wages, Employment and Poverty,<br />
in: Employment Outlook 1998‹, Paris, 31–79.<br />
Paternoster, Anne (2004) ›Mindestlöhne – EU-Mitgliedstaaten, Kandidatenländer, USA 2004‹.<br />
(Eurostat. Statistik kurz gefasst: Bevölkerung und soziale Bedingungen, Nr. 10). Luxemburg.<br />
Pesl, Ludwig Daniel (1914) ›Der Mindestlohn‹, München.<br />
Peter, Gabriele, Jörg Wiedemuth (2004) ›Tarifliche und gesetzliche Standards für ein Mindesteinkommen‹.<br />
in: A. Gerntke et al. (Hg.) ›Einkommen zum Auskommen‹. Hamburg, 9–19.<br />
Prasch, Robert E. (1996) ›In Defense of the Minimum Wage‹. In: Journal of Economic Issues,<br />
vol. 30, 391-397.<br />
Ragacs, Christian (2002) ›Warum Mindestlöhne die Beschäftigung nicht reduzieren müssen.<br />
Neoklassische Ansätze im Überblick‹, in: Wirtschaft und Gesellschaft, 28, 59–84.<br />
Ragacs, Christian (2003) ›Mindestlöhne und Beschäftigung: Die empirische Evidenz‹. In:<br />
Wirtschaft und Gesellschaft, 29. Jg., 215-246.<br />
Rhein, Thomas, Hermann Gartner, Gerhard Krug, (2005) ›Niedriglohnsektor. Aufstiegschancen<br />
für Geringverdiener verschlechtert‹. In: IAB Kurzbericht, Nr. 3, 10.03.<br />
Rubery, Jill (2003) ›Pay Equity, Minimum Wage and Equality at Work. International Labour<br />
Office (ILO), Working Paper Series of the InFocus Programme on Promoting the Declaration<br />
on Fundamental Principles and Rights at Work‹, WP No. 19. Genf.<br />
Samuelson, Paul, William D. Nordhaus (1998) ›Volkswirtschaftslehre‹ (15. Aufl.). Frankfurt.<br />
Schulten, Thorsten (2004) ›Solidarische Lohnpolitik in Europa. Politische Ökonomie der<br />
Gewerkschaften‹. Hamburg.<br />
135 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik
Schulten, Thorsten (2005) ›Politische Ökonomie gesetzlicher Mindestlöhne. Internationale<br />
Erfahrungen und Konsequenzen für Deutschland‹. In: Eckhard Hein, Arne Heise, Achim<br />
Truger (Hg.) ›Löhne, Beschäftigung, Verteilung und Wachstum. Makroökonomische Analysen‹.<br />
Marburg 2005, 185–208.<br />
Steward, M.B. (2004) ›The Employment Effect of the National Minimum Wage‹. In: Economic<br />
Journal, vol. 114, 110-116.<br />
Webb, Sidney (1912) ›The Economic Theory of a Legal Minimum Wage‹. In: The Journal of<br />
Political Economy, vol. 20, 973-998.<br />
Welzmüller, Rudolf (2004) ›Niedrige Arbeitseinkommen – ein wachsendes Problem. Sind<br />
Mindestlöhne die Lösung?‹ In: SPW, Nr. 5, 247-249.<br />
WSI/<strong>Denknetz</strong>/IRES (2005) ›Für eine europäische Mindestlohnpolitik: Thesen‹. In: Jahrbuch<br />
<strong>Denknetz</strong> 2005.<br />
1 vgl. Schulten 2004.<br />
2 vgl. OECD 1998.<br />
3 vgl. Däubler et al. 1990.<br />
4 vgl. Daloz 1993.<br />
5 vgl. Castel 2000, 333.<br />
6 vgl. z.B. Samuelson/Nordhaus 1998, 97.<br />
7 vgl. Ragacs 2002.<br />
8 vgl. Cord/Krueger 1995, Manning 2003.<br />
9 vgl. Ragacs 2002, 70.<br />
10 vgl. Akerlof/Yellen 1986.<br />
11 vgl. Webb 1912.<br />
12 vgl. Herr 2002, Prasch 1996.<br />
13 vgl. Pesl 1914.<br />
14 vgl. Burmeister 2004.<br />
15 vgl. OECD 1998.<br />
16 vgl. Funk/Lesch 2005.<br />
17 vgl. Burmeister 2004.<br />
18 vgl. Paternoster 2004, 2.<br />
19 vgl. OECD 1998, Funk/Lesch 2005.<br />
20 vgl. Burmeister 2004.<br />
21 vgl. OECD 1998.<br />
22 vgl. Fuller/Geide-Stevenson 2003.<br />
23 vgl. Cord/Krueger 1995.<br />
24 vgl. OECD 1998, Ragacs 2003.<br />
25 vgl. Nolan et al. 2003, Steward 2004.<br />
26 vgl. OECD 1998, Rubery 2003.<br />
27 vgl. Manning 2003.<br />
28 vgl. Rubery 2003.<br />
29 vgl. Schulten 2005.<br />
30 vgl. Bispinck/Schäfer 2005.<br />
31 vgl. Rhein et al. 2005.<br />
32 vgl. Ellguth/KKohaut 2005.<br />
33 vgl. Schulten 2005.<br />
34 vgl. Welzmüller 2004.<br />
35 vgl. Peter/Wiedemuth 2004.<br />
36 vgl. Paternoster 2004.<br />
37 vgl. WSI/<strong>Denknetz</strong>/IRES 2005.<br />
Lohnpolitik<br />
Anmerkungen<br />
136 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Die SGB-Mindestlohnkampagne<br />
– eine Evaluation<br />
Idee, Konzept und Durchführung<br />
Die Ausgangslage<br />
1998 hat der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) die Lohnpolitik<br />
zum Gegenstand seines Kongresses in Davos gemacht. Unter anderem<br />
beschloss er dam<strong>als</strong>, eine Kampagne gegen Löhne unter 3000 Franken<br />
zu lancieren. Die Lohnfrage sollte über die Verbandsebene hinausgehoben<br />
und ›politisiert‹ werden. 1 Zugleich entschied der Kongress, dass<br />
die Einführung der Personenfreizügigkeit mit den Ländern der EU nur<br />
unter der Bedingung unterstützt werde, dass Instrumente geschaffen<br />
würden, welche den Druck auf tiefe Löhne effizient verhinderten. 2<br />
Die Lancierung einer Kampagne gegen Löhne unter 3000 Franken<br />
und für Mindestlöhne wurde vom SGB mit folgenden Argumenten begründet:<br />
3<br />
1. Nach sechs Rezessionsjahren befand sich die Arbeitslosigkeit mit<br />
einer Quote von fast 5 Prozent auf einem Rekordniveau. Der SGB<br />
befürchtete, dass es trotz Aufschwung lange Zeit dauern würde, bis die<br />
Arbeitslosigkeit wieder deutlich gesenkt werden könne, und dass sie<br />
einen erheblichen Druck insbesondere auf die Löhne von Personen »in<br />
unstabilen Beschäftigungsverhältnissen […] und in privatwirtschaftlich<br />
organisierten Wirtschaftsbereichen ohne Gesamtarbeitsverträge« ausüben<br />
werde. Die Tieflohnkampagne sollte sicherstellen, dass auch die<br />
Bezüger und Bezügerinnen von tiefen Löhnen vom angekündigten Konjunkturaufschwung<br />
profitieren.<br />
Daniel Oesch<br />
2. Der SGB stellte zwar fest, dass<br />
in der Schweiz tiefe Löhne insbe-<br />
ist Zentr<strong>als</strong>ekretär des Schweizerischen<br />
sondere unter Frauen und Auslän-<br />
Gewerkschaftsbundes und Oberassistent<br />
der/innen bereits seit langer Zeit<br />
an der Universität Genf.<br />
verbreitet waren. In Folge der lan-<br />
Roman Graf<br />
gen Stagnationsperiode hätten<br />
1967, arbeitet <strong>als</strong> Forscher am Observatoire<br />
diese jedoch vermehrt zu Prekari-<br />
Universitaire de l’Emploi der Universität<br />
sierung und Armut geführt. Haupt-<br />
Genf. Er hat für den Schweizerischen Geursache<br />
war dabei die kontinuierwerkschaftsbund<br />
u.a. den Internetlohnliche<br />
Erhöhung von Gebühren<br />
rechner (www.lohn-sgb.ch) entwickelt.<br />
und indirekten Steuern seitens der<br />
Serge Gaillard<br />
öffentlichen Hand, um die Finan-<br />
(1955), Dr. oec, Leiter des SGB-Zentr<strong>als</strong>ezierung der krisenbedingten Mehrkretariats.ausgaben<br />
sicherzustellen. Zeit-<br />
137 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik
Lohnpolitik<br />
gleich stieg das Risiko, erwerbslos zu werden, enorm an – dies führte<br />
dazu, dass vermehrt befristete Arbeitsverträge abgeschlossen wurden<br />
und die unfreiwillige Teilzeitarbeit zunahmen. 4<br />
3. Der SGB musste feststellen, dass nur etwa 50% der privat angestellten<br />
Lohnabhängigen einem GAV unterstehen und nur etwa 40% einem<br />
GAV mit verbindlichen Mindestlöhnen. Einige dieser Mindestlöhne lagen<br />
zudem in den 1990er-Jahren deutlich unter 50% des Medianwertes. 5<br />
Insbesondere in den Tieflohnbranchen war das interne Kräfteverhältnis<br />
zu Ungunsten der Gewerkschaften, sodass eine Strategie, die rein branchenintern<br />
eine massive Erhöhung und Ausdehnung der Mindestlöhne<br />
erreichen wollte, <strong>als</strong> unrealistisch eingeschätzt werden musste.<br />
4. Der SGB befürchtete, dass sich diese Tieflohnsegmente mehr und<br />
mehr verbreiten würden, weil viele Grosskonzerne und privatisierte<br />
Unternehmen gezielt Tätigkeiten ausgliederten, die der Tieflohnkonkurrenz<br />
ausgesetzt werden konnten (unter anderem Reinigung und<br />
Transportdienstleistungen).<br />
5. Schliesslich ging der SGB davon aus, dass es nach sechs wirtschaftlichen<br />
und lohnmässigen Stagnationsjahren sehr schwierig sein würde,<br />
wieder zu einer Lohnpolitik zurückzukehren, bei der allgemeine Lohnerhöhungen<br />
gewährt würden. Diese Befürchtung rührte auch daher, dass<br />
während eines Jahrzehnts der Übergang zu einer leistungsorientierten<br />
und individuellen Lohnpolitik gepredigt worden war und viele Personalchefs<br />
darauf warteten, diese bei wieder wachsendem Verteilungsspielraum<br />
endlich umsetzen zu können.<br />
6. Zusätzlich befürchtete der SGB, dass die bevorstehende Personenfreizügigkeit<br />
mit den Ländern der EU einen zusätzlichen Druck auf die<br />
Löhne ausüben würde.<br />
Für die Lancierung der Mindestlohnkampagne waren noch weitere<br />
Gründe massgeblich, die in der Öffentlichkeit weniger diskutiert wurden.<br />
Die ›working poor‹ waren (aus den genannten Gründen) vermehrt<br />
in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen. <strong>Das</strong> gab allen Arten<br />
von Vorschlägen Auftrieb, welche staatliche Lohnzuschüsse propagierten.<br />
Der SGB befürchtete jedoch, dass mit staatlichen Lohnzuschüssen<br />
die Existenz von Wirtschaftsbereichen, deren Löhne nicht einmal zum<br />
Leben genügten, nicht nur akzeptiert, sondern gar noch gefördert worden<br />
wäre. In die gleiche Richtung ging dam<strong>als</strong> auch die Diskussion um<br />
die Zukunft der Sozialversicherungen. Diese befanden sich nach sechs<br />
Stagnationsjahren in einer finanziell schwierigen Situation, was dazu<br />
führte, dass sie vermehrt grundsätzlich in Frage gestellt wurden. Sie seien<br />
nicht effizient, da sie es nicht schafften, Armut zu verhindern. Deshalb<br />
138 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
auche es eine Abkehr vom so genannten Giesskannensystem (gemeint<br />
war das Sozialversicherungsprinzip) und die vermehrte Anwendung<br />
des Bedarfsprinzips. Demgegenüber betonten die Gewerkschaften<br />
die Notwendigkeit einer Vollbeschäftigungspolitik und von Löhnen, die<br />
zu einem würdigen Leben genügten. 6 <strong>Das</strong> Phänomen der ›working<br />
poor‹ sollte einerseits durch höhere Mindestlöhne, anderseits durch eine<br />
bessere Infrastruktur für die Fremdbetreuung von Kindern sowie durch<br />
eine bessere Aufteilung der ›Kinderkosten‹ bekämpft werden, insbesondere<br />
durch höhere Kinderzulagen.<br />
Die Umsetzung der Kampagne<br />
Umgesetzt wurde die Mindestlohnkampagne auf verschiedenen Ebenen:<br />
1. Öffentlichkeitsarbeit: Ein Hauptanliegen der Kampagne war, die<br />
Lohnfrage zu ›politisieren‹ und insbesondere das Problem von Tiefstlöhnen<br />
in die Öffentlichkeit zu tragen. 7 Um die Öffentlichkeit auf die<br />
Verbreitung der tiefen Löhne aufmerksam zu machen, gab der SGB bei<br />
Professor Yves Flückiger (Universität Genf) eine Analyse des Tieflohnbereiches<br />
in der Schweiz in Auftrag. 8 Eine grosse Sensibilisierung für<br />
diese Frage bewirkte auch die fast gleichzeitig erschienene Studie der Caritas<br />
zum Thema der ›working poor‹. 9 Die ›arbeitenden Armen‹ waren<br />
nicht nur zu einem verbreiteten, sondern auch zu einem gesellschaftlich<br />
wahrgenommenen Problem geworden.<br />
2. Brechen des dominanten Diskurses: Wirtschaftsprofessoren, Chefbeamte<br />
in den mit Wirtschaftspolitik befassten Bundesämtern sowie Wirtschaftsredaktoren<br />
der führenden Zeitungen hatten während mehr <strong>als</strong><br />
einem Jahrzehnt die These verbreitet, dass jeder Mindestlohn Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
verhindere und deshalb zu einer höheren Arbeitslosigkeit<br />
führe. Um die Dominanz dieser These zu brechen, verfasste der<br />
SGB gemeinsam mit anerkannten Wirtschaftsfachleuten und Arbeitsrechtsspezialisten<br />
einen ›Expertenbericht Mindestlöhne‹. Der Bericht<br />
erarbeitete Vorschläge für das Niveau eines allfälligen Mindestlohnes,<br />
fasste ausländische Studien über die volkswirtschaftlichen Auswirkungen<br />
von Mindestlöhnen zusammen und versuchte die Wirkungen eines<br />
Mindestlohnes auf die Wettbewerbsfähigkeit und die Absatzpreise in<br />
den Wirtschaftszweigen zu evaluieren. 10<br />
3. Druck in den Branchen: Die meisten Gewerkschaften setzten sich in<br />
den folgenden Jahren in den Vertragsverhandlungen stark dafür ein,<br />
Mindestlöhne, die unter 3000 Franken netto lagen, auf dieses Niveau zu<br />
erhöhen. Die Forderung nach existenzsichernden Mindestlöhnen wurde<br />
somit ein fester Bestandteil der GAV-Verhandlungen. 11 Darüber hi-<br />
139 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik
Lohnpolitik<br />
naus wurde versucht, die Reichweite durch eine breitere Unterstellung<br />
von Beschäftigungskategorien (TeilzeiterInnen, Aushilfspersonal) und<br />
den Abschluss neuer GAV zu vergrössern. 12 Insbesondere die 1996<br />
gegründete Dienstleistungsgewerkschaft UNIA führte parallel zu den<br />
Verhandlungen eine aktive Öffentlichkeitsarbeit gegen tiefe Löhne im<br />
Verkauf und Gastgewerbe. 13 In beiden Branchen wurden in der Folge<br />
die Mindestlöhne massiv angehoben. Die aus dem angelsächsischen<br />
Bereich übernommene Strategie des ›shaming und naming‹ – des öffentlichen<br />
Anprangerns von Unternehmen, die Tiefstlöhne bezahlen –,<br />
wurde insbesondere gegenüber den Grossbetrieben des Detailhandels<br />
(Migros und Coop) sehr erfolgreich angewandt.<br />
Der Entscheid für eine gesamtarbeitsvertragliche Mindestlohnstrategie<br />
Auf der politischen Ebene hatte der SGB zwar immer »mehr Gesamtarbeitsverträge<br />
und Mindestlöhne« propagiert. Zugleich hatte er es bewusst<br />
unterlassen, auf nationaler Ebene einen gesetzlichen Mindestlohn<br />
zu fordern. 14 Ein nationaler Mindestlohn müsste vom Parlament beschlossen<br />
werden. Dieses hätte in seinen Beratungen der wirtschaftlichen<br />
Tragbarkeit von Mindestlöhnen in der schwächsten Branche, der Landwirtschaft,<br />
ein grosses Gewicht beigemessen. Deshalb war abzusehen,<br />
dass auf nationaler Ebene ein äusserst tiefer Mindestlohn festgelegt<br />
worden wäre, der ausserhalb der Landwirtschaft kaum Wirkung erzielt<br />
hätte. Darum sollten die Mindestlöhne in erster Linie in den Gesamtarbeitsverträgen<br />
erhöht und später, bei günstigerem Kräfteverhältnis,<br />
branchenweise im Rahmen der flankierenden Massnahmen zur Einführung<br />
des freien Personenverkehrs zwischen der Schweiz und den Mitgliedstaaten<br />
der Europäischen Union eingeführt werden. 15<br />
Seit 1998 fanden bis zum heutigen Tag parallel zu den Diskussionen<br />
über Mindestlöhne Verhandlungen über die flankierenden Massnahmen<br />
statt. 16 Um wirksame Massnahmen durchsetzen zu können, mussten<br />
die Gewerkschaften dauernd auf die mit der Einführung der Personenfreizügigkeit<br />
verbundene Gefahr eines Druckes auf die tiefen Löhne<br />
und auf die Notwendigkeit von Gesamtarbeitsverträgen und Mindestlöhnen<br />
hinweisen.<br />
<strong>Das</strong> Zusammenspiel der öffentlichen Kampagne gegen tiefe Löhne,<br />
die Vertragsverhandlungen um Mindestlöhne in den Branchen, das Anprangern<br />
tiefer Löhne bei ausgewählten Betrieben in einigen Branchen<br />
und die ständigen Auseinandersetzungen über die flankierenden Massnahmen<br />
haben dazu geführt, dass die Lohnpolitik und die Mindestlöhne<br />
in den letzten sieben Jahren fast ständig auch in den Medien ein Thema<br />
waren. Daran dürfte sich auch in den nächsten Jahren nicht allzu viel<br />
140 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
ändern, da die flankierenden Massnahmen in allen Kantonen umgesetzt<br />
werden müssen. Mehr <strong>als</strong> acht Jahre nach dem Startschuss der Kampagne<br />
ist es nun möglich, mit Hilfe der Lohnstrukturerhebungen 1998,<br />
2000 und 2002 erste Resultate zu den Erfolgen und Misserfolgen der<br />
Mindestlohnkampagne vorzulegen.<br />
Die empirische Auswertung des Einflusses<br />
der Mindestlohnkampagne<br />
Es bieten sich verschiedene Vorgehensweisen an, um den Einfluss der<br />
Mindestlohnkampagne auf die Lohnstruktur zu untersuchen. Nachfolgend<br />
werden wir das Augenmerk auf folgende vier Indikatoren legen:<br />
1. Gesamtarbeitsvertraglich vereinbarte Mindestlöhne: Wie haben sich<br />
die GAV-Mindestlöhne in den Tieflohnbranchen entwickelt?<br />
2. Absoluter Anteil der Tieflöhne: Wie hat sich der Anteil der Löhne<br />
unter 3000 und unter 3500 Franken entwickelt?<br />
3. Relativer Anteil der Tieflöhne: Wie hat sich der Anteil der Löhne<br />
unter 50% und unter 66% des Medianlohnes entwickelt?<br />
4. Lohndisparität: Wie hat sich das Verhältnis zwischen hohen und tiefen<br />
Löhnen entwickelt?<br />
Die Berechnungen beruhen mit Ausnahme des ersten Indikators allesamt<br />
auf Daten der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE). Die<br />
LSE umfasst die Lohnangaben eines repräsentativen Querschnittes der<br />
Schweizer Privatwirtschaft. Sie wird alle zwei Jahre erhoben und beinhaltet<br />
zwischen 440’000 (LSE 1998) und 1’150’000 (LSE 2002) individuelle<br />
Lohndaten. Die vorliegende Auswertung bezieht die Datensätze<br />
der Jahre 1998, 2000 und 2002 mit ein. 17<br />
1. Die Entwicklung der GAV-Mindestlöhne in den Tieflohnbranchen<br />
Im Jahr 2002 gab das Bundesamt für Statistik an der Universität St.<br />
Gallen eine Studie in Auftrag, welche die Entwicklung der GAV-Mindestlöhne<br />
untersuchen sollte. Diese Auswertung aller Gesamtarbeitsverträge<br />
mit mehr <strong>als</strong> 1500 Unterstellten dokumentierte bereits 2002<br />
den Niederschlag der Kampagne. 18 Drei Beobachtungen wurden von<br />
den Autoren hervorgehoben:<br />
• Während die durchschnittliche Wachstumsrate der Mindestlöhne für<br />
Ungelernte zwischen 1999 und 2001 bei 7% lag, betrug die Wachstumsrate<br />
für Beschäftigte mit Berufsausweis nur 2.9% und für Beschäftigte mit<br />
höherem Fachausweis 3%. Die unteren Mindestlohnklassen wurden damit<br />
überproportional angehoben.<br />
141 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik
Lohnpolitik<br />
• Aus dem Vergleich der GAV-Mindestlöhne mit den Löhnen der Lohnstrukturerhebung<br />
(LSE) ging hervor, dass insbesondere die ungelernten<br />
Beschäftigten und damit die Tiefstlöhne den grössten Schutz durch gesamtarbeitsvertragliche<br />
Regeln erhielten. Dies zeigte sich unter anderem<br />
daran, dass unqualifizierte Arbeitnehmende mit Einzelarbeitsvertrag<br />
häufig weniger verdienten <strong>als</strong> den GAV-Mindestlohn. <strong>Das</strong> Anheben der<br />
GAV-Mindestlöhne führte somit in Tieflohnbranchen zu einer direkten<br />
Verbesserung der Effektivlöhne der Unterstellten.<br />
• Im Jahr 2001 wurden auffällig viele der tiefsten GAV-Mindestlöhne<br />
auf ein Niveau von 3000 Franken angehoben.<br />
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die konkrete Entwicklung der<br />
gesamtarbeitsvertraglichen Mindestlöhne in einer Reihe von Tieflohnbranchen.<br />
Daraus wird ersichtlich, dass zwischen 1998 und 2004 insbesondere<br />
die Mindestlöhne für un- oder angelernte Beschäftigte teils<br />
massiv angehoben wurden. Im Gesamtarbeitsvertrag des Gastgewerbes<br />
stiegen die Mindestlöhne für Arbeitnehmende ohne Lehre um rund<br />
33%. Auch in den beiden grössten Unternehmen des Detailhandels, Migros<br />
und Coop, wurden die tiefsten Mindestlöhne in den Betriebs-GAV<br />
um rund einen Drittel angehoben, andere Unternehmen mussten nachziehen<br />
(Denner, Manor). Diese Erhöhungen der Mindestlöhne sind von<br />
einiger gesamtwirtschaftlicher Bedeutung, denn der allgemeinverbindlich<br />
erklärte (AVE) Vertrag des Gastgewerbes ist der GAV mit der in der<br />
Schweiz höchsten Unterstelltenzahl von rund 150’000 Arbeitnehmenden;<br />
Migros und Coop zählen zu den grössten privaten Arbeitgebern<br />
der Schweiz mit 80’000 beziehungsweise 50’000 Angestellten. Zusammen<br />
beschäftigen das Gastgewerbe und die beiden Detailhandelsketten<br />
beinahe 10% der Lohnabhängigen der Schweiz.<br />
Tabelle 1: Beispiele einiger GAV-Mindestlöhne in Tieflohnbranchen (in CHF)<br />
142 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Auch in kleineren Wirtschaftssektoren wie der Textilindustrie wurden<br />
die GAV-Mindestlöhne merklich erhöht. Sie verharren jedoch weiterhin<br />
auf einem tiefen Niveau. In der grafischen Industrie (Druck) sowie der<br />
Kartonage und Verpackung blieben die Lohnerhöhungen bescheiden.<br />
Dafür konnte im Druck der GAV-Unterstellungsbereich auf die Spedition<br />
ausgeweitet werden. In den persönlichen Dienstleistungen wurden<br />
trotz eines schwachen gewerkschaftlichen Organisationsgrades Fortschritte<br />
erzielt: Zwischen 1998 und 2004 stiegen die Mindestlöhne für<br />
gelernte Coiffeure/sen um 15 Prozent. In der Reinigungsbranche der<br />
Deutschschweiz und der privaten Sicherheitsdienstleistungsbranche<br />
konnten 2004 erstm<strong>als</strong> Gesamtarbeitsverträge abgeschlossen werden,<br />
die für die jeweilige Branche allgemeinverbindlich erklärt wurden. Die<br />
Mindestlöhne für ungelernte Beschäftigte liegen bei 3140 Franken im<br />
Reinigungs-GAV sowie bei 4000 in der privaten Sicherheitsbranche.<br />
2. Entwicklung des Beschäftigtenanteils mit Löhnen unter CHF 3000/3500<br />
Ein genaueres Bild der Entwicklung der Tief- und Tiefstlöhne vermittelt<br />
die Analyse der Lohnstrukturerhebung (LSE). In Grafik 2 ist der Anteil<br />
der Beschäftigten ausgewiesen, die für eine Vollzeitbeschäftigung von 40<br />
Wochenstunden monatlich weniger <strong>als</strong> 3000 und 3500 Franken verdienen.<br />
19 Die linke Hälfte der Graphik zeigt klar, dass von Tiefstlöhnen in<br />
der Schweiz vor allem Frauen betroffen sind: 1998 verdienten mehr <strong>als</strong><br />
zehn Prozent aller erwerbstätigen Frauen weniger <strong>als</strong> 3000 Franken –<br />
und bezogen somit einen Lohn, der längerfristig nicht zum Lebensunterhalt<br />
reicht. Aufgrund dieser Ausgangslage ist es nicht verwunderlich,<br />
dass die Mindestlohnkampagne des SGB einen wesentlich grösseren<br />
Einfluss auf die Frauen- <strong>als</strong> die Männerlöhne hatte. Zwischen 1998 und<br />
2002 hat sich der Anteil der Frauen mit Salären unter 3000 Franken<br />
ziemlich genau halbiert von 11.3% auf 5.7%. Im Gegensatz dazu bezog<br />
bereits 1998 nur eine kleine Minderheit von 2.7% aller Männer Löhne<br />
unter 3000 Franken. Die Abnahme auf 1.5% bewegt sich folglich in<br />
einem wesentlich bescheideneren Rahmen.<br />
Während im Jahr 2002 nur noch eine kleine Minderheit der Beschäftigten<br />
Löhne unter 3000 Franken bezog, lag der Anteil der Lohnabhängigen<br />
mit Salären unter 3500 Franken immer noch bei 9%. Zwar scheint<br />
sich auch hier die Mindestlohnkampagne positiv ausgewirkt zu haben:<br />
Bei den weiblichen Beschäftigten ist ein deutlicher Rückgang des Anteils<br />
an Tieflohnbezügern festzustellen, von 26.5% auf 17.1%. Trotzdem verdiente<br />
2002 noch jede 6. Frau weniger <strong>als</strong> 3500 Franken pro Monat.<br />
Auch hier sind die Geschlechterunterschiede sehr ausgeprägt: Bei den<br />
Männern bezog nur jeder 23. einen Lohn unter 3500 Franken.<br />
143 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik
Lohnpolitik<br />
Grafik 2a: Beschäftigtenanteil mit Monatslöhnen unter CHF 3000/3500<br />
In den Grafiken 2b und 2c wird die Entwicklung für einige ausgewählte<br />
Branchen aufgezeigt, in denen der Tieflohnanteil 1998 überdurchschnittlich<br />
hoch war. Daraus wird ersichtlich, dass insbesondere in den<br />
traditionellen Tieflohnbranchen Textilindustrie, Detailhandel und Gastgewerbe<br />
der Anteil der Beschäftigten mit Tieflöhnen stark abgenommen<br />
hat. In diesen Branchen hat sich der Prozentsatz der Lohnabhängigen,<br />
die weniger <strong>als</strong> 3000 Franken monatlich verdienen, zwischen 1998 und<br />
2002 halbiert. Dieses Resultat ist insofern nicht erstaunlich, <strong>als</strong> sich die<br />
gewerkschaftlichen Aktionen (insbesondere jene der Dienstleistungsgewerkschaft<br />
UNIA) und die Medienkampagne stark auf den Verkauf und<br />
das Gastgewerbe ausgerichtet hatten. Dies hat gute Gründe: Die Entwicklungen<br />
in diesen zwei Bereichen ist von einiger gesamtwirtschaftlicher<br />
Bedeutung, da es sich beim Gastgewerbe mit über 200’000 Beschäftigten<br />
und dem Detailhandel mit über 300’000 Beschäftigten um<br />
zwei der grössten Wirtschaftssektoren der Schweiz handelt. Allerdings<br />
fällt auf, dass in diesen Branchen der Anteil der Beschäftigten mit Tiefstlöhnen<br />
(unter 3000 Franken) wesentlich stärker abgenommen hat <strong>als</strong> der<br />
Anteil der Beschäftigten mit Tieflöhnen (unter 3500 Franken): Der letztere<br />
verharrte 2002 auf einem relativ hohen Niveau von 20% in der Textilindustrie,<br />
18% im Detailhandel und gar 41% im Gastgewerbe.<br />
Ein deutlicher Rückgang der Tieflöhne konnte, wenn auch auf einem<br />
bescheideneren Niveau, ebenfalls in Branchen wie der Nahrungsmitteloder<br />
der Uhrenindustrie sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen festgestellt<br />
werden. <strong>Das</strong>s die Abnahme der Tieflöhne nicht automatisch<br />
stattfand, wird jedoch an den Beispielen der Maschinenindustrie und<br />
den Dienstleistungen an Unternehmen sichtbar – zwei Branchen, in<br />
denen der Anteil der tiefen Löhne zwischen 1998 und 2002 stabil geblieben<br />
ist. Die Mindestlohnkampagne hatte auf beide Branchen wenig<br />
Einfluss. In der Maschinenindustrie existiert zwar ein GAV, der jedoch<br />
keine Mindestlöhne enthält; diese werden dezentral auf betrieblicher<br />
144 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Ebene vereinbart. Die Branche ›Erbringung von Dienstleistungen an<br />
Unternehmen‹ umfasst sehr unterschiedliche Tätigkeiten wie Unternehmensberatung<br />
und Rechtsdienst einerseits, Reinigung und private<br />
Sicherheit andrerseits. In dieser Branche sind sowohl der gewerkschaftliche<br />
Organisationsgrad <strong>als</strong> auch der Abdeckungsgrad mit GAV sehr<br />
tief. 20<br />
3. Die Entwicklung des Beschäftigtenanteils mit Löhnen unter 50% und unter<br />
66% des Medianlohnes<br />
Grafiken 2a bis 2c legen den Schluss nahe, dass die BezügerInnen von<br />
tiefen Löhnen vom wirtschaftlichen Aufschwung mitprofitiert haben:<br />
Der Anteil der Beschäftigten mit Tieflöhnen hat zwischen 1998 und 2002<br />
abgenommen. Bei den Schwellen von 3000 und 3500 Franken handelt<br />
es sich jedoch um fixe Grenzwerte, die nichts aussagen über die Ent-<br />
145 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik<br />
Grafik 2b: Beschäftigtenanteil mit Monatslöhnen unter CHF 3000/3500 –<br />
Industriebranchen<br />
Grafik 2c: Beschäftigtenanteil mit Monatslöhnen unter CHF 3000/3500 –<br />
Dienstleistungsbranchen
Lohnpolitik<br />
wicklung des Tieflohnsektors im Vergleich zur Entwicklung der gesamten<br />
Lohnstruktur. Diese Schwellen kaschieren auch den Einfluss der (in<br />
diesen Jahren allerdings schwachen) Teuerung: Ein Lohn von 3500<br />
Franken war kaufkraftbereinigt 1998 mehr wert <strong>als</strong> 2002.<br />
Aus diesen Gründen wird die Entwicklung der tiefen Löhne in den folgenden<br />
Grafiken mithilfe einer relativen Schwelle untersucht. Grafik 3a<br />
zeigt den Anteil der Beschäftigten, die weniger <strong>als</strong> 50% beziehungsweise<br />
weniger <strong>als</strong> 66% des schweizerischen Medianlohnes (identischer<br />
Schwellenwert für alle Branchen) verdienten in jedem der drei Untersuchungsjahre.<br />
21 Auch aus dieser Aufstellung wird deutlich, dass sich der<br />
Prozentsatz der Beschäftigten mit Tief- und Tiefstlöhnen zwischen 1998<br />
und 2002 zurückgebildet hat. Bezogen auf den Referenzwert des Medianlohnes<br />
(welcher zwischen 1998 und 2002 um 6.4% gestiegen ist)<br />
ergibt sich jedoch ein wesentlich schwächerer Rückgang des Tieflohnsektors.<br />
Bereits 1998 verdienten nur 2% der Beschäftigten in der Schweiz<br />
weniger <strong>als</strong> die Hälfte des Medianlohnes. Dieser Anteil ist weiter geschrumpft<br />
auf 1.2%. 22 Diese Abnahme fand insbesondere bei den weiblichen<br />
Beschäftigten statt: Während 1998 jede 26. Frau weniger <strong>als</strong> die<br />
Hälfte des Medianlohnes erhielt, war es 2002 nur mehr jede 45. Frau auf<br />
dem Arbeitsmarkt. Auch für den (allerdings schwachen) Rückgang des<br />
Beschäftigtenanteils mit Löhnen unter 66% des Medianlohnes waren die<br />
Frauen verantwortlich. Zwischen 1998 und 2002 hat sich deren Anteil<br />
um 2.3 Prozentpunkte verringert (von 22.8% auf 20.5%). Der Anteil der<br />
Männer mit Löhnen unter 66% des Medianlohnes verharrte hingegen<br />
unverändert bei rund 5%. Trotzdem bleiben Frauen deutlich übervertreten<br />
unter den Beschäftigten mit Löhnen unter 66% des Medianlohnes.<br />
Hinter der relativen Stabilität der Grösse des Tieflohnsektors – wie sie<br />
in Grafik 3a ausgewiesen wird –, verbergen sich sehr unterschiedliche<br />
Entwicklungen in den Branchen.<br />
Grafik 3a: Beschäftigtenanteil mit Monatslöhnen unter 50% sowie 66% des<br />
Medianlohnes<br />
146 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
• In einer ersten Gruppe von Branchen kann eine generelle Abnahme<br />
des Anteils der Beschäftigten mit Löhnen unter 66% des Medianlohnes<br />
festgestellt werden. Dies trifft insbesondere auf die Uhren- und die Verpackungsindustrie<br />
(Papier und Kartonage) zu. Eine leichte Abnahme<br />
kann ferner auch im Gastgewerbe, dem Gesundheits- und Sozialwesen<br />
und der Branche Kultur, Sport und Unterhaltung beobachtet werden.<br />
Die Abnahme im Gastgewerbe ist wesentlich augenfälliger, wenn statt<br />
der Schwelle ›66% des Medianlohnes‹ die Schwelle ›50% des Medianlohnes‹<br />
herbeigezogen wird: Zwischen 1998 und 2002 hat sich der Beschäftigtenanteil<br />
im Gastgewerbe mit Löhnen unter 50% des Medianlohnes<br />
von 13% auf 5% verringert. Die Verbesserungen in dieser Tieflohnbranche<br />
haben sich <strong>als</strong>o weniger unter der 66%-Schwelle <strong>als</strong> unter<br />
der 50%-Schwelle abgespielt.<br />
• In einer zweiten Gruppe von Branchen beschränkt sich der Rückgang<br />
der tiefen Löhne auf die weiblichen Beschäftigten: Im Detailhandel, in<br />
der Textil- und der Nahrungsmittelindustrie hat sich der Beschäftigtenanteil<br />
mit Löhnen unter 66% des Medianlohnes bei den Frauen zurückgebildet.<br />
Bei den Männern blieb er stabil oder stieg sogar leicht an (feststellbar<br />
in der Textil- und Nahrungsmittelindustrie).<br />
• In einer dritten Gruppe ist der Anteil des Tieflohnsektors effektiv angewachsen<br />
zwischen 1998 und 2002. Dies trifft sowohl auf die Metallerzeugung<br />
und den Landverkehr (Strassentransport) <strong>als</strong> auch auf die<br />
Dienstleistungserbringung an Unternehmen zu. Diese Beobachtung bestätigt<br />
die oben gemachte Feststellung, dass der Anteil der tiefen Löhne<br />
im Zuge der Mindestlohnkampagne nicht automatisch zurückgegangen<br />
ist. In jenen Branchen, in denen über eine gewerkschaftliche Mobilisierung,<br />
öffentlichen Druck und Vertragsverhandlungen die GAV-Mindestlöhne<br />
angepasst werden konnten, ist eine Abnahme der Tieflöhne<br />
zu beobachten. In einigen Branchen, in denen keine eigentliche Kampagne<br />
geführt wurde oder das Instrument des GAV fehlte, blieb die<br />
Situation jedoch unverändert oder hat sich während des Wirtschaftsaufschwunges<br />
für die TieflöhnbezügerInnen gar verschlechtert.<br />
4. Die Entwicklung der Lohndisparität<br />
Ein letztes Unterkapitel ist der Analyse der Entwicklung der Lohndisparität<br />
gewidmet. Wie eingangs erwähnt, bestand 1998 die Gefahr, dass<br />
wenig qualifizierte Arbeitnehmende vom anlaufenden wirtschaftlichen<br />
Aufschwung lohnmässig nicht profitieren würden. Dafür sprach der (für<br />
schweizerische Verhältnisse ungewohnt grosse) Überhang an wenig qualifizierten<br />
Beschäftigten auf dem Arbeitsmarkt sowie die zunehmende<br />
Tendenz der Arbeitgeber, Lohnerhöhungen nur noch auf einer indivi-<br />
147 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik
Lohnpolitik<br />
Grafik 3b: Beschäftigtenanteil mit Monatslöhnen unter 66% des Medianlohnes<br />
– Industrie<br />
Grafik 3c: Beschäftigtenanteil mit Monatslöhnen unter 66% des Medianlohnes<br />
– Dienstleistungen<br />
duellen Basis gewähren zu wollen. Eine solche Entwicklung würde zu<br />
einer deutlichen Zunahme der Lohnungleichheit führen. Hier wollte die<br />
Mindestlohnkampagne Gegensteuer geben.<br />
Ob ihr dies (in der kurzen Periode unseres Untersuchungszeitraumes<br />
1998 bis 2002) gelungen ist, soll anhand der Entwicklung dreier verschiedener<br />
Indikatoren der Lohndisparität untersucht werden. Alle drei<br />
Indikatoren weisen in dieselbe Richtung: Die Lohndisparität ist leicht<br />
angewachsen zwischen 1998 und 2000. Zwischen 2000 und 2002 hat sie<br />
wieder leicht abgenommen, ohne jedoch auf das Niveau von 1998<br />
zurückzukehren (siehe Tabelle 4a). 23 Ein oft geäussertes Argument führt<br />
diesen leichten Anstieg der Lohndisparität auf die Explosion der Managergehälter<br />
zurück. Nach diesem Argument sollte der Anstieg der Lohndisparität<br />
verschwinden, wenn das oberste Prozent oder die obersten 5%<br />
– <strong>als</strong>o die absoluten Spitzenverdiener – aus der Datenstichprobe entfernt<br />
148 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
werden. Wir haben deshalb die Berechnungen auch mit einer reduzierten<br />
Stichprobe von nur 99% sowie 95% aller Lohndaten durchgeführt,<br />
die Entwicklung blieb jedoch identisch: Von 1998 bis 2000 hat die Lohndisparität<br />
zugenommen, diese Zunahme wurde zwischen 2000 und 2002<br />
zu einem Teil wieder rückgängig gemacht. 24<br />
Tabelle 4a: Entwicklung des Verhältnisses zwischen hohen und tiefen Löhnen,<br />
1998–2002<br />
Hinter der (schwachen) Zunahme der Lohnungleichheit auf gesamtwirtschaftlicher<br />
Ebene verbergen sich wiederum sehr unterschiedliche<br />
Entwicklungen auf der Branchenebene (siehe Grafik 4b). Eine deutliche<br />
Abnahme der Lohndisparität fand im Druck und Verlagswesen, der Verpackungsindustrie<br />
sowie der Nahrungsmittelindustrie statt. Auch im<br />
Gastgewerbe hat sich das Verhältnis zwischen hohen und tiefen Löhnen<br />
um fünf Prozent verringert. Stabil geblieben ist die Lohndisparität in<br />
Branchen wie der Textil- und Maschinenindustrie, dem Baugewerbe,<br />
dem Detailhandel sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen. Schliesslich<br />
kann eine (teils deutliche) Zunahme der Ungleichheit festgestellt<br />
werden in der chemischen Industrie, der Uhrenindustrie, bei den Banken<br />
und in der Nachrichtenübermittlung (Post und Telekom). Es fällt auf,<br />
dass es sich bei den Branchen mit wachsender Lohndisparität um wertschöpfungsintensive<br />
Wachstumsbranchen handelt (Chemie, Banken,<br />
Telekom). Im Gegensatz dazu handelt es sich bei den Sektoren mit<br />
abnehmender Ungleichheit um Branchen, die mit Strukturproblemen<br />
kämpfen (Druckindustrie, Gastgewerbe). Dies legt den Schluss nahe,<br />
dass in expandierenden Branchen die Lohnsumme überproportional für<br />
höher qualifizierte Beschäftigte verwendet wurde, während in schrumpfenden<br />
Branchen die hohen Löhne nicht stärker gestiegen sind <strong>als</strong> die<br />
tiefen Löhne. In der Zukunft wird sich die Beschäftigung weiter Richtung<br />
Wachstumsbranchen verschieben. In diesem Umfeld erhält der<br />
Kampf um gesamtarbeitsvertragliche Mindestlöhne eine wichtige Rolle.<br />
Er hat zu verhindern, dass die Löhne von niedrig qualifizierten Arbeitnehmenden<br />
von der allgemeinen Lohnentwicklung abgehängt werden.<br />
149 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik
Lohnpolitik<br />
Grafik 4b: Entwicklung der Lohndisparität 1998–2002 (Verhältnis des Lohns<br />
P90/P10)<br />
Fazit und Ausblick<br />
Die Erfolge der Kampagne<br />
Ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Mindestlohnkampagne<br />
war das positive Echo in der Öffentlichkeit: Die grosse Mehrheit der Bevölkerung<br />
unterstützte die Forderung, dass wer arbeitet, auch in Würde<br />
von seinem Lohn leben können soll. Dabei leistete die Einfachheit der<br />
Losung ›Keine Löhne unter 3000 Franken‹ einen wichtigen Beitrag. Die<br />
Forderung hatte (und hat noch immer) einen universellen Anspruch:<br />
Nicht eine einzelne gesellschaftliche Gruppe sollte vor Armut geschützt<br />
werden (wie es das bürgerliche Bedarfsprinzip in der Sozialpolitik verlangt),<br />
sondern alle Werktätigen sollten Anrecht auf einen anständigen<br />
Lohn haben. Obwohl in der Realität vor allem Frauen und Ausländer/innen<br />
von Tieflöhnen betroffen sind, erreichte die Kampagne dank<br />
der generellen Forderung eine gewisse Gültigkeit für alle Erwerbstätigen.<br />
Dies erlaubte es den Verbänden, über die Direktbetroffenen von<br />
Tieflöhnen hinaus grössere Beschäftigungsgruppen zu mobilisieren.<br />
<strong>Das</strong> positive Echo in der Öffentlichkeit war dem Image der Gewerkschaften<br />
zuträglich. 25 Vor allem half es, Unternehmen mit Tieflöhnen<br />
unter Druck zu setzen. In einigen Branchen schaffte das Medieninteresse<br />
einen ständigen Rechtfertigungszwang für Tiefstlöhne. Auch Konsumenten<br />
(u.a. im Detailhandel und Gastgewerbe) sowie öffentliche Auftraggeber<br />
begannen sich für Tieflöhne zu interessieren. Kombiniert mit<br />
gewerkschaftlichen Aktionen und Vertragsverhandlungen in den Branchen,<br />
konnte der Ausbreitung des Tieflohnsektors Einhalt geboten werden:<br />
Zwischen 1998 und 2002 verringerte sich die Zahl der Beschäftigten<br />
mit Monatslöhnen unter 3000 Franken um rund 100’000, die Zahl<br />
150 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
der Erwerbstätigen mit Monatslöhnen unter 3500 Franken nahm gar um<br />
200’000 ab. Davon waren die Mehrheit Frauen.<br />
Dank der Mindestlohnkampagne konnte auch eine weitere Spreizung<br />
der Lohnstruktur verhindert werden. Zumindest in Branchen mit einem<br />
hohen Tieflohnanteil sind die tiefsten Löhne mindestens proportional<br />
zur allgemeinen Lohnentwicklung angehoben worden. Dies trifft insbesondere<br />
auf die Nahrungsmittelindustrie, Textilindustrie, Papier und<br />
Verpackung, Druck, Bauindustrie, Detailhandel, Gastgewerbe, Gesundheits-<br />
und Sozialwesen zu. In diesen Branchen hat sich die Lohnschere<br />
nicht geöffnet. Wenig überraschend ist die fortlaufende Spreizung der<br />
Lohnstruktur in den Hochlohnbranchen Chemie und Banken. Im Gegensatz<br />
dazu ist die Öffnung der Lohnschere in den Branchen Landverkehr<br />
und Nachrichtenübermittlung überraschend. Sie muss wohl mit<br />
der Liberalisierung in den staatsnahen Betrieben (Post, SBB) und der<br />
Teilprivatisierung von Swisscom erklärt werden.<br />
Die Auseinandersetzung um tiefe Löhne fand nicht nur in den Betrieben<br />
und Branchen statt. Auch auf der Ebene der wirtschaftspolitischen<br />
Debatten hatte die Kampagne einen Nachhall. Ähnlich, wie es dem SGB<br />
in den 1990er-Jahren in der Geldpolitik gelungen war, den »monetaristischen<br />
Konsens« zu durchbrechen, 26 schaffte es die Kampagne, den<br />
Konsens zu schwächen, wonach jeder Arbeitnehmerschutz zulasten der<br />
Wirtschaftsentwicklung und der Beschäftigung gehe. Im Gegensatz zu<br />
Deutschland sind in der Schweiz jene Wirtschaftsjournalisten, die jahrelang<br />
Mindestlöhne <strong>als</strong> schädlichstes Mittel für die Beschäftigungsentwicklung<br />
gepredigt haben, leiser geworden. Die britischen Erfahrungen<br />
mit dem 1999 eingeführten Mindestlohn bestätigen die These, wonach<br />
Mindestlöhne nicht automatisch negative Auswirkungen auf die Beschäftigungsaussichten<br />
von wenig qualifizierten Beschäftigten haben:<br />
Zwischen 1999 und 2004 wurde der britische Mindestlohn schrittweise<br />
um 35% angehoben. 27 Trotzdem wuchs die Beschäftigung kontinuierlich.<br />
Im Herbst 2004 war die Arbeitslosenquote auf (für Grossbritannien)<br />
historisch tiefe 4.8% gefallen. 28<br />
In der Debatte über die ›working poor‹ hat die Kampagne mitgeholfen,<br />
die Arbeitgeber in die Pflicht zu nehmen: Von den Unternehmen<br />
sollen anständige Löhne statt vom Staat Lohnzuschüsse gefordert werden.<br />
<strong>Das</strong> Eintreten von Bundesrat Couchepin (<strong>als</strong> damaliger Wirtschaftsminister)<br />
2002 für Lohnzuschüsse verhallte ohne Folgen. 29 Sowohl<br />
der SGB <strong>als</strong> auch der Arbeitgeberverband lehnten diese (mit teils<br />
unterschiedlichen Argumenten) ab. 30 Es ist dem SGB klar, dass Mindestlöhne<br />
für sich allein das Problem der armen Arbeitenden nicht<br />
lösen, denn ein grosser Teil der Armut ist auf Familienlasten zurückzu-<br />
151 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik
Lohnpolitik<br />
führen. Abhilfe schaffen kann hier nur eine Vollbeschäftigungspolitik<br />
(Arbeitsplätze für alle) sowie ein massiver Ausbau der ausserhäuslichen<br />
Kinderbetreuung und der Kinderzulagen. Der Grundsatz des SGB<br />
bleibt bestehen, wonach sich Arbeit lohnen muss. Deshalb unterstützen<br />
die Gewerkschaften Lohnzuschüsse weiterhin nur dort, wo der Arbeitgeber<br />
nachweisbar eine Integrationsleistung erbringt.<br />
Offene Baustellen und Zukunftsperspektiven<br />
Druck in der Öffentlichkeit alleine genügt nicht, um tiefe Löhne auszumerzen.<br />
Dies zeigen beispielsweise die Zahlen für den Landverkehr<br />
(Strassentransport) oder die Dienstleistungen an Unternehmen. In beiden<br />
Branchen hat der Anteil der Beschäftigten mit Löhnen unter 3500<br />
Franken zwischen 1998 und 2002 bei 9% stagniert. Dies rührt möglicherweise<br />
daher, dass in diesen Branchen die Gewerkschaften nur sehr<br />
indirekten Zugriff auf die Lohnfestsetzung haben, und zwar deshalb,<br />
weil entweder keine eigentlichen Vertragsverhandlungen stattfinden<br />
(Strassentransport) oder Branchenverträge erst seit kurzem und nur in<br />
Teilgebieten existieren (Dienstleistungen an Unternehmen: Reinigung,<br />
Sicherheit). Zudem spielt in Branchen wie dem Strassentransport (Lastwagen)<br />
– ähnlich wie in der Exportindustrie – der Druck der Öffentlichkeit<br />
eine geringere Rolle: die Endabnehmer sind entweder im Ausland<br />
oder andere Betriebe im Inland. Im Gegensatz zu Detailhandelsketten<br />
und Putzinstituten sind Unternehmen in diesen Branchen weniger sensibel<br />
auf den negativen Marketingeffekt des ›naming and shaming‹.<br />
Dieser Lücke muss mit einer Ausweitung der GAV begegnet werden.<br />
Die Regelungsdichte der GAV soll erhöht, die Geltungsbereiche der<br />
GAV ausgedehnt und die Zahl der neuen GAV vergrössert werden.<br />
Diese Stossrichtung hat der SGB an seinem Kongress 2002 unter dem<br />
Titel ›GAV für alle!‹ beschlossen. 31 Bereits parallel zur Mindestlohnkampagne<br />
haben die Gewerkschaften seit 2000 damit begonnen, eine<br />
Wende zugunsten der GAV durchzusetzen. In mehreren Dienstleistungsbranchen<br />
sind seither neue GAV in Kraft getreten, so zum Beispiel<br />
in der Reinigungsbranche, bei den privaten Sicherheitsdienstleistungen,<br />
den Tankstellenshops, den Apothekenassistentinnen, der Textilpflege<br />
und Wäschereien, einigen (nicht direkt vom Staat getragenen) Spitälern.<br />
Der Bedarf an GAV-Mindestlöhnen wird insbesondere auch im Zusammenhang<br />
mit der Personenfreizügigkeit zunehmen. Zwar ist die<br />
Lohnfrage mit der Schaffung der kantonalen tripartiten Kommissionen<br />
zur Umsetzung der flankierenden Massnahmen institutionalisiert worden:<br />
Durch die systematische Auswertung der Lohnstrukturerhebung<br />
bleiben die Löhne ein Diskussionsthema. Zudem beginnen die Behör-<br />
152 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
den erstm<strong>als</strong> damit, die Arbeitsbedingungen in den Betrieben zu kontrollieren.<br />
Zugleich besteht jedoch die Gefahr, dass einige Branchen mit<br />
der Tradition weiterfahren, laufend billige und rechtlose Arbeitskräfte<br />
aus dem Ausland einzustellen, um diese nach einiger Zeit an die Sozialhilfe<br />
weiterzureichen. Deshalb braucht es auch aus ökonomischen Gründen<br />
Mindestlöhne.<br />
Immer wichtiger wird dabei, Mindestlöhne für verschiedene Kategorien<br />
von Lohnabhängigen innerhalb einer Branche oder eines Betriebs<br />
festzulegen. Denn es muss verhindert werden, dass die Mindestlohnkampagne<br />
bei 3000 Franken stehen bleibt. 3000 Franken netto haben<br />
sich <strong>als</strong> einprägsamer Slogan bewährt. Doch dieser Lohn genügt nur<br />
knapp, um den Lebensunterhalt einer Einzelperson zu decken. Deshalb<br />
müssen alle Mindestlöhne an die wirtschaftliche Entwicklung angepasst<br />
werden. Es muss auch der Eindruck vermieden werden, dass nur die<br />
tiefsten Löhne gesamtarbeitsvertraglich festgelegt werden müssen und<br />
die Löhne für qualifiziertere Tätigkeiten dem Markt überlassen werden<br />
können. Mindestlöhne sind auch notwendig für Tätigkeiten, die eine bestimmte<br />
Ausbildung oder Berufserfahrung erfordern. Nur solche bieten<br />
letztlich Schutz gegen Lohndruck im Rahmen der Personenfreizügigkeit.<br />
Aus diesen Gründen braucht die Mindestlohnkampagne einen zweiten<br />
Atem. Es ist kein Ende der ›Politisierung der Löhne‹ abzusehen.<br />
153 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik
Lohnpolitik<br />
Literatur<br />
Bauer, Tobias (1999) ›Lohnstruktur und Lohnentwicklung im Detailhandel und im Gastgewerbe.<br />
Eine Analyse der schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 1991–1998‹. Bern (Büro<br />
BASS).<br />
Ettlin, Franz, Serge Gaillard (2002) ›Die lange Krise der 90er-Jahre: Eine wettbewerbsfähige<br />
Wirtschaft braucht eine stabilisierende Geldpolitik‹. SGB-Dossier, Nr. 16, Schweizerischer<br />
Gewerkschaftsbund. Bern.<br />
Flückiger, Yves (1999) ›Tieflohnbezüger/innen und working poor in der Schweiz: Situation<br />
und Entwicklung von 1991 bis 1997‹. Observatoire Universitaire de l’Emploi, Universität<br />
Genf. Genf.<br />
Gaillard, Serge, Daniel Oesch [Redaktion] (2000) ›Expertenbericht Mindestlöhne‹. SGB-Dossier,<br />
Nr. 6, Schweizerischer Gewerkschaftsbund. Bern.<br />
Gaillard, Serge (1998) ›Vollbeschäftigung und gerechte Einkommensverteilung sind eine<br />
Frage des politischen Willens‹. Presseunterlagen Schweizerischer Gewerkschaftsbund,<br />
15. Oktober.<br />
Gaillard, Serge (1999) ›SGB bekämpft tiefe Löhne – Bemerkungen zur Studie Flückiger‹.<br />
Presseunterlagen Schweizerischer Gewerkschaftsbund, 6. Januar.<br />
Gaillard, Serge (2001) ›Mindestlöhne: Effizientes Mittel der Armutsbekämpfung‹. Soziale Sicherheit,<br />
Nr. 3, 129.<br />
Gerfin, Michael, Robert Leu, Stephan Brun, Andreas Tschöpe (2002) ›Armut unter Erwerbstätigen<br />
in der Schweiz: Eine Beurteilung alternativer wirtschaftspolitischer Lösungsansätze‹.<br />
Volkswirtschaftliches Institut Universität Bern. Bern.<br />
Liechti, Anna, Carlo Knöpfel (1998) ›Trotz Einkommen kein Auskommen – working poor in<br />
der Schweiz‹. Luzern.<br />
Low Pay Commission (2005) ›National Minimum Wage‹. Low Pay Commission Report 2005.<br />
London, Februar.<br />
Oesch, Daniel (2001) ›Kollektive Lohnverhandlungen: Neue Herausforderungen für die Gewerkschaften.<br />
Eine empirische Untersuchung aus 10 Branchen‹. SGB-Dossier, Nr. 11,<br />
Schweizerischer Gewerkschaftsbund. Bern.<br />
Piketty, Thomas (1997) ›L’économie des inégalités‹. Paris.<br />
Prey, Hedwig, Rolf Widmer, Hans Schmid (2002) ›Mindestlöhne in der Schweiz. Analyse der<br />
Mindestlohn- und Arbeitszeitregelungen in den Gesamtarbeitsverträgen von 1999–<br />
2001‹. Bundesamt für Statistik. Neuchâtel.<br />
Rieger, Andreas (1999) ›Löhne zum Politikum machen‹. In: MOMA, Nr. 5.<br />
Rieger, Andreas (2001) ›Offensive Gewerkschaftspolitik‹. In: Widerspruch 40.<br />
Schäppi, Hans (1998) ›Gewerkschaftliche Lohnpolitik‹. In: Input 3.<br />
SGB (1999) ›Kein Lohn unter 3’000 Franken‹. SGB-Dokumentation, Nr. 67.<br />
SGB-Frauen (1997) ›Ökonomie ist Frauensache. Ergebnisse des 6. Frauenkongresses‹. SGB-<br />
Dokumentation, Nr. 51.<br />
SGB-Pressedienst (2000) ›Zuerst ein günstiges Kräfteverhältnis – dann Mindestlöhne im<br />
Rahmen der flankierenden Massnamen‹. Pressedienst, 14. November.<br />
Trunz, Christian, Serge Gaillard (2005) ›Flankierende Massnahmen zum freien Personenverkehr‹.<br />
SGB-Dossier, Nr. 32, Schweizerischer Gewerkschaftsbund. Bern.<br />
Anmerkungen<br />
1 vgl. SGB-Frauen 1997, Rieger 1999.<br />
2 SGB (1998): ›Der 50. Kongress des SGB‹, SGB-Dokumentation Nr. 60.<br />
3 vgl. Gaillard Serge 1998, Schäppi 1998, Rieger 1999.<br />
4 vgl. Flückiger 1999, Gaillard 1999.<br />
5 vgl. Oesch 2001.<br />
6 vgl. Gaillard 2001.<br />
7 vgl. Rieger 1999, 2001.<br />
8 vgl. Flückiger 199.<br />
9 vgl. Liechti/Knöpfel 1998.<br />
10 vgl. Gaillard/Oesch 2000.<br />
11 vgl. SGB 1999.<br />
12 vgl. Schäppi 1998, Rieger 2001.<br />
154 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
13 Für eine Übersicht der Lohnsituation in diesen beiden Branchen in den neunziger Jahren,<br />
siehe Bauer (1999).<br />
14 vgl. SGB-Pressedient 2000.<br />
15 Die flankierenden Massnahmen wurden eingeführt, um zu verhindern, dass es in Folge<br />
der Personenfreizügigkeit zu einem Druck auf die Löhne kommt. Wo die orts- und berufsüblichen<br />
Löhne in missbräuchlicher Art unterboten werden, kann die tripartite Kommission,<br />
welche den Arbeitsmarkt beobachtet, der kantonalen Regierung den Erlass von<br />
Normalarbeitsverträgen mit verbindlichen Mindestlöhnen beantragen. Eine detaillierte<br />
Beschreibung der flankierenden Massnahmen findet sich in: Trunz und Gaillard (2005).<br />
16 1998/99 fanden die Verhandlungen zu den flankierenden Massnahmen 1 statt, welche im<br />
Rahmen der Personenfreizügigkeit gegenüber den ›alten‹ Mitgliedsländer der EU<br />
eingeführt wurden. Ab 2003 setzten dann die Verhandlungen über die flankierenden<br />
Massnahmen 2 ein, welche mit der Ausweitung der Personenfreizügigkeit auf die neuen<br />
Mitgliedsländer der EU eingeführt werden sollen.<br />
17 Die LSE 2004 wird für Forschungsinstitute nicht vor 2006 zugänglich sein.<br />
18 vgl. Prey/Widmer/Schmid 2002.<br />
19 Teilzeitbeschäftigte sind eingeschlossen in diesen Berechnungen: Alle Lohndaten werden<br />
hochgerechnet für eine Vollzeitbeschäftigung von 40 Wochenstunden. Der Anteil<br />
eines allfälligen 13. Monatslohn ist ebenfalls bereits berücksichtigt in diesen Monatslöhnen<br />
(rund zwei Drittel aller Beschäftigten erhalten in der Schweiz einen 13. Monatslohn).<br />
Durch die Mitberücksichtigung des 13. Monatslohnes wird der Prozentsatz der Beschäftigten,<br />
die monatlich weniger <strong>als</strong> 3000/3500 Franken verdienen, leicht unterschätzt.<br />
20 Dennoch konnten 2004 für die Reinigung sowie die privaten Sicherheitsdienste erstm<strong>als</strong><br />
Branchen-GAV unterzeichnet werden, die in der Folge vom Bundesrat allgemein verbindlich<br />
erklärt wurden. In der Reinigungsindustrie bestand seit längerem ein GAV für<br />
die Westschweiz. Neu hinzugekommen ist ein GAV für die Deutschschweiz.<br />
21 In absoluten Zahlen beliefen sich 50% des Medianlohnes 1998 auf 2555 Franken; im Jahr<br />
2000 auf 2627 Franken; 2002 auf 2720 Franken. 66% des Medianlohnes lagen 1998 bei 3406<br />
Franken; 2000 bei 3503 Franken; 2002 bei 3626 Franken.<br />
22 Der 1999 eingeführte britische Mindestlohn belief sich 2004 auf 48.9% des Medianlohnes<br />
(Low Pay Commission 2005). Die 50%-Schwelle entspricht deshalb in etwa der Grenze für<br />
Tiefstlöhne, die 66%-Schwelle der Grenze für Tieflöhne.<br />
23 Ein Vergleich mit Zahlen der OECD für 1990 deutet darauf hin, dass sich die Schweiz in<br />
Sachen Lohndisparität im Mittelfeld befindet (Piketty 1997). Gemessen am Verhältnis<br />
p90/p10 verfügen Norwegen, (2.0), Schweden (2.1), Dänemark (2.2) die Niederlande sowie<br />
Belgien (beide 2.3) über eine tiefere Lohndisparität. Deutschland (2.5) und Portugal<br />
(2.7) befinden sich auf einem ähnlichen Niveau wie die Schweiz (2.6). Frankreich (3.1),<br />
Grossbritannien (3.4) sowie die USA (4.5) haben eine ungleichere Lohnstruktur. Nimmt<br />
man statt der Lohnverteilung einen Indikator für die Einkommensverteilung, rückt die<br />
Schweiz zu den ungleichsten Ländern Europas.<br />
24 Wenn das oberste Prozent der Löhne (d.h. die absoluten Spitzenverdiener) aus der Stichprobe<br />
ausgeschlossen wird, beträgt das Verhältnis p90/p10: 2.48 (1998); 2.58 (2000); 2.55<br />
(2002). Werden die fünf obersten Prozent ausgeschlossen, beläuft sich p90/p10 auf: 2.31<br />
(1998); 2.38 (2000); 2.34 (2002).<br />
25 Der Vorwurf der neoliberalen Rechten, die Gewerkschaften seien die Organisation der<br />
Besitzstandwahrer und Rückwärtsgerichteten, verpuffte im Zusammenhang der Kampagne<br />
ins Leere.<br />
26 vgl. Ettlin/Gaillard 2002.<br />
27 Der Mindestlohn wurde schrittweise von 3.60£ pro Stunde (April 1999) auf 4.85£ pro Stunde<br />
(Oktober 2004) erhöht.<br />
28 vgl. Low Pay Commission 2005.<br />
29 Dies, obwohl eine Studie der Universität Bern aufzuzeigen versuchte, dass Lohnzuschüsse<br />
Mindestlöhnen aus wirtschaftstheoretischer Sicht überlegen sind (Gerfin et al.<br />
2002).<br />
30 vgl. ›Arbeit und Armut‹. Positionspapier des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes, Februar<br />
2002.<br />
31 SGB (2002) ›GAV für alle!‹, Positionspapier 6, SGB-Kongressdokumentation, Bern.<br />
155 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik
Lohnpolitik<br />
Die Löhne in der Schweiz<br />
sind nicht zu hoch<br />
Lohnabhängige verloren Verteilungskampf<br />
Die Löhne nahmen in den Jahren 2001 und 2002 noch deutlich zu, 2004<br />
jedoch stagnierten die realen Einkommen der meisten Arbeitnehmer-<br />
Innen, während Unternehmensgewinne und Managersaläre massiv zulegten.<br />
In den letzten Jahren stiegen die Löhne in der Schweiz zudem<br />
weniger <strong>als</strong> in den anderen Ländern Europas. Eine Politik der Preissenkungen<br />
würde den Druck auf die Realeinkommen nur noch verschärfen.<br />
In der Schweiz stagniert die Kaufkraft<br />
Gemäss Angaben des Bundesamtes für Statistik (BfS) haben die Nominallöhne<br />
im Durchschnitt aller Wirtschaftszweige 2003 um 1.4% und<br />
2004 um 0.9% zugenommen. Gewichtet man dies mit der Teuerung zum<br />
Zeitpunkt der Verhandlungen im Vorjahr (auf dieser Basis wird üblicherweise<br />
in der Schweiz über die Löhne verhandelt), ergibt sich für 2003<br />
noch eine Verbesserung der Kaufkraft um 0.5%, für 2004 nur noch um<br />
0.4%. Im industriell-gewerblichen Sektor stiegen die Reallöhne durchschnittlich<br />
um 0.2%, im Dienstleistungssektor um 0.7%. Misst man die<br />
Nominallöhne mit der Teuerungsentwicklung im gleichen Jahr, wie dies<br />
das BfS tut, ergibt sich eine noch ungünstigere Bilanz.<br />
Die grössten Lohnsteigerungen wiesen im sekundären Sektor mit real<br />
0.7% die chemische Industrie auf. <strong>Das</strong> Gastgewerbe, das 2003 von allen<br />
Branchen mit nominal 2.7% respektive real 1.8% noch am besten abschnitt,<br />
erlebte 2004 einen Einbruch und wies eine Reallohnsteigerung<br />
von nur mehr 0.6% auf. Nach der erfreulichen Entwicklung von 2003,<br />
die wie beim Detailhandel vor allem auf die Erhöhung der GAV-Mindestlöhne<br />
infolge der Mindestlohnkampagne des SGB zurückzuführen<br />
ist, schlug 2004 die Senkung der Massenkaufkraft in diesen Branchen negativ<br />
zu <strong>Buch</strong>e. Der vertragslose Zustand in diversen Branchen des Baunebengewerbes<br />
und im Holzbau sowie die Öffnung des Arbeitsmarktes<br />
im Rahmen der zweiten Phase des freien Personenverkehrs verursachten<br />
im Bausektor vermehrt Lohndruck.<br />
Über mehrere Jahre betrachtet,<br />
gingen die Reallöhne in der zwei-<br />
Hans Baumann<br />
ten Hälfte der 1990er-Jahre deut- 1948, lic. rer. pol. MAES, Ökonom der Gelich<br />
zurück. In den Jahren 2001 werkschaft Unia.<br />
156 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
1996 1997<br />
und 2002 hat sich die Kaufkraft dann erhöht. 2003 flachte sich diese Entwicklung<br />
wieder ab, um 2004 zu stagnieren.<br />
Nicht berücksichtigt sind bei dieser Darstellung die Steuerbelastung<br />
und die Zwangsabgaben wie die Krankenkassen- und Pensionskassenbeiträge,<br />
die sich in den letzten Jahren deutlich erhöht haben. <strong>Das</strong><br />
tatsächlich verfügbare Einkommen der Haushalte ist deshalb noch weniger<br />
angestiegen. Der jüngst erschienene Bericht der Eidgenössischen<br />
Steuerverwaltung über die Verteilung des Wohlstandes in der Schweiz<br />
zeigt auf, dass das tatsächlich verfügbare Einkommen in den letzten Jahren<br />
stagniert, für die meisten Haushalte der unteren und mittleren Einkommen<br />
sogar gesunken ist.<br />
Die Stagnation der Löhne kontrastiert markant mit der Entwicklung<br />
der Managergehälter in den höchsten Chefetagen von Schweizer Unternehmen.<br />
Laut einer Untersuchung der Handelszeitung verdienten die<br />
Mitglieder der Konzernleitungen 2004 im Durchschnitt 17% mehr.<br />
Die GAV-Abschlüsse für 2005 waren je nach Branche sehr verschieden<br />
und beliefen sich auf zwischen 1.0% und 2.3%, das heisst sie beinhalteten<br />
bei einer Teuerung von 1.3% in der Regel eine kleine reale Verbesserung.<br />
Insgesamt bleibt die Entwicklung in vielen Branchen unbefriedigend,<br />
so dass für dieses Jahr noch keine Trendwende in Sicht ist.<br />
Lohnentwicklung in Europa etwas besser<br />
In den letzten fünf Jahren nahmen in der alten EU die Reallöhne jedes<br />
Jahr um 0.8% bis 1.5% zu. Spitzenreiter war der ›keltische Tiger‹ Irland<br />
mit Reallohnsteigerungen von bis zu jährlich 5%. Die Daten für die<br />
Schweiz zeigen, dass die Schweizer Löhne erst in den Jahren 2001 und<br />
2002 nachziehen konnten und auch etwas stärker stiegen <strong>als</strong> in der EU,<br />
2003 und vor allem 2004 aber bereits wieder hinter der EU-Lohnentwicklung<br />
nachhinkten. Von unseren Nachbarländern weist nur Deutschland<br />
in den letzten Jahren regelmässig tiefere Reallohnverbesserungen<br />
auf, in den anderen Ländern war die Entwicklung ähnlich wie in der<br />
Schweiz. Die grössten Fortschritte machten in den letzten Jahren die neu-<br />
157 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik<br />
Industrie/Gewerbe<br />
Tertiär<br />
Ganzes Baugewerbe<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
Schätzung<br />
Nominale Lohnentwicklung gemäss BfS-Lohnindex. Reallöhne berechnet aufgrund<br />
des Konsumentenpreis-Indexes vom November des Vorjahres. (Quelle BfS)
en EU-Länder Mittel- und Osteuropas. Dies allerdings erst nach vielen<br />
Jahren mit stagnierender oder sogar sinkender Kaufkraft:<br />
Entwicklung der Reallöhne in Europa; Steigerung in % gegenüber Vorjahr<br />
Im Jahr 2000 hat der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) mit einer<br />
gewissen Koordination der Kollektivverhandlungen in Europa begonnen,<br />
dies nicht zuletzt auch <strong>als</strong> Reaktion auf die sinkende Lohnquote in<br />
den 1990er-Jahren. Dam<strong>als</strong> hatte sich die Verteilung zwischen Löhnen<br />
und Gewinnen deutlich zu Ungunsten der Lohnabhängigen verändert.<br />
Der Anteil der Löhne am Volkseinkommen ist in Europa markant gesunken,<br />
nämlich von rund 76% zu Anfang der 1980er-Jahre auf ca. 68%<br />
am Ende der 1990er-Jahre.<br />
Entwicklung der gewichteten Lohnquote in Europa<br />
(Quelle: ETUC-Report 2003)<br />
Lohnpolitik<br />
78<br />
76<br />
74<br />
72<br />
70<br />
68<br />
66<br />
64<br />
81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 2001<br />
Nach 2000 ist die Lohnquote wieder geringfügig angestiegen. Dam<strong>als</strong><br />
wurde innerhalb des EGB eine ›Koordinierungsregel‹ aufgestellt. Sie beinhaltet,<br />
dass die Lohnerhöhungen (inkl. qualitative Verbesserungen) in<br />
den einzelnen Ländern längerfristig mindestens der Formel ›nationale<br />
Teuerung plus Produktivitätsentwicklung‹ entsprechen sollten. Wird diese<br />
Formel eingehalten, bedeutet dies, dass die Verteilung zwischen Kapital<br />
und Arbeit (bzw. zwischen Gewinnen und Löhnen) konstant bleibt,<br />
<strong>als</strong>o die Arbeitnehmer ihren Anteil am Volkseinkommen verteidigen<br />
können.<br />
158 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Löhne hinken hinterher<br />
Im Durchschnitt aller EU-Länder konnte diese Richtlinie von 1999 bis<br />
2003 eingehalten werden. <strong>Das</strong> heisst, dass die Gewerkschaften zu Beginn<br />
dieses Jahrtausends die Verteilungsbilanz wieder etwas zu Gunsten<br />
der Lohnabhängigen korrigieren konnten. Dieser Trend scheint aber<br />
dieses Jahr gebrochen worden zu sein.<br />
Folgende Tabelle zeigt die ›Verteilungsbilanz‹: Ist die Zahl positiv, bedeutet<br />
dies, dass die Löhne um diesen Prozentsatz stärker gestiegen sind<br />
<strong>als</strong> die Formel ›Teuerung plus Produktivität‹. Ist die Zahl negativ, sind<br />
die Löhne um diese Zahl weniger angestiegen <strong>als</strong> die Formel. Allerdings<br />
können gewisse qualitative Verbesserungen, die in Kollektivverhandlungen<br />
erreicht wurden und die Lohnkosten erhöhen, wie etwa zusätzliche<br />
Urlaubstage, nicht in dieser einfachen Formel erfasst werden.<br />
Verteilungsbilanz ausgewählter Länder*<br />
*2005: Schätzung (Quellen: Schulten 2004). Für die Schweiz Lohnindex 2004<br />
des BfS/KOF. Verteilungsbilanz: Saldo des jährlichen Nominallohnzuwachses<br />
und dem neutralen Verteilungsspielraum (Summe aus Preis- und Arbeitsproduktivitätsentwicklung<br />
= Stundenproduktivität zu Preisen des Vorjahres).<br />
Von unseren Nachbarländern schneiden die deutschen Arbeitnehmenden<br />
deutlich schlechter ab <strong>als</strong> der EU-Durchschnitt. In der Schweiz haben<br />
die Reallöhne erst mit Verspätung angezogen. Deshalb haben die<br />
Unternehmer und Vermögensbesitzer auch bis zum Jahr 2000 noch<br />
massiv Einkommensanteile gewonnen. Dafür konnten die Arbeitneh-<br />
159 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik
Lohnpolitik<br />
menden dann 2001 und 2002 wieder etwas zulegen. Aber 2003 ist die<br />
Bilanz bereits wieder negativ, was bedeutet, dass im letzten Jahr der<br />
Lohnanteil am Volkseinkommen wieder gesunken ist.<br />
2004 hinkten die Löhne in der Schweiz 2% hinter der Arbeitsproduktivität<br />
her. Kumuliert über die letzten 5 Jahre, ergibt dies über 5%.<br />
Gemäss Prognosen der KOF/ETH über die Entwicklung von Produktivität<br />
und Lohnstückkosten dürfte sich dieser Trend auch 2005 fortsetzen.<br />
<strong>Das</strong> heisst, dass die langsame Erholung der Schweizer Wirtschaft mit einer<br />
weiteren Umverteilung von Lohnempfängern zu Unternehmern<br />
und Vermögensbesitzern einhergeht. Um diese Entwicklung zu stoppen,<br />
müssen die Gewerkschaften substanzielle Lohnforderungen durchsetzen.<br />
Der SGB hat deshalb für 2006 je nach Branche 1.5% bis 3% reale<br />
Lohnerhöhungen gefordert.<br />
Preisinsel Schweiz<br />
Trotz mässigem Wachstum der Wirtschaft und Stagnation der Löhne ist<br />
das Preisniveau in der Schweiz in den letzten Jahren immer noch angestiegen,<br />
allerdings mit relativ geringen Zuwachsraten von 1% bis 2% pro<br />
Jahr. <strong>Das</strong> für viele Produkte und Dienstleistungen höhere Preisniveau gegenüber<br />
den anderen Ländern Europas hat 2005 einen Diskurs ausgelöst:<br />
Bürgerliche Politiker und Unternehmer forderten eine Senkung<br />
des Preisniveaus über weitere Deregulierungen und mehr Wettbewerb.<br />
Auf diese Weise könnten dann auch die Löhne sinken, was ohne Wohlstandsverlust<br />
zu einer Kostensenkung und somit zu einer Verbesserung<br />
der Wettbewerbsposition der Schweizer Wirtschaft führen würde.<br />
Serge Gaillard hat dann die Diskussion auch innerhalb der Gewerkschaften<br />
mit einem Artikel im ›work‹ eröffnet und darauf hingewiesen,<br />
dass vor allem die Preise der landwirtschaftlichen Produkte, die Mietpreise<br />
und die Gesundheitskosten zum Wohle der Konsumenten sinken<br />
müssten. Darauf entwickelte sich eine rege Diskussion innerhalb der<br />
Linken, die im ›work‹ dokumentiert wurde 1 .<br />
Lebensqualität kostet<br />
Höhere Preise widerspiegeln zum Teil auch ein höheres Niveau an Lebens-<br />
und Umweltqualität. So hat die Schweiz nach den USA zwar das<br />
teuerste Gesundheitswesen der Welt und die ArbeitnehmerInnen bezahlen<br />
das durch immer höhere Krankenkassenprämien, welche die<br />
Haushalte belasten. Dies ist zum Teil auf ein hohes Lohnniveau und<br />
überhöhte Medikamentenpreise zurückzuführen. Wir haben aber auch<br />
ein qualitativ gutes Gesundheitswesen. Die Qualität und Dichte der<br />
ärztlichen Versorgung ist gut, die Krankenhäuser sind technisch und<br />
160 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
vom Komfort her gut ausgestattet. Und – verglichen mit den USA – haben<br />
wir vorläufig auch noch keine Klassenmedizin, sondern eine gute<br />
Grundversorgung für alle.<br />
Ein anderes Beispiel sind die Wohnungsmieten, ein Hauptfaktor für<br />
das höhere Preisniveau in der Schweiz. Sie liegen rund 70% über dem<br />
EU-Niveau und machen rund 20% des Warenkorbs einer Durchschnittsfamilie<br />
aus: <strong>Das</strong> liegt nicht an den Baupreisen, die seit Jahren stagnieren,<br />
sondern vor allem an den Bodenpreisen und der überdurchschnittlichen<br />
Wohnqualität. Baulobbyisten und bürgerliche Politiker<br />
möchten jetzt die Bauzonen ausdehnen sowie Baugesetze und Umweltauflagen<br />
verwässern, um die Bau- und Bodenpreise herunter zu holen.<br />
<strong>Das</strong> wäre zwar möglich, aber eindeutig nur auf Kosten des Umwelt- und<br />
Landschaftsschutzes.<br />
Aldi und Lidl produzieren Arbeitslose<br />
Mehr Wettbewerb, etwa durch Privatisierung des Energiesektors oder<br />
neue Detailhandelsanbieter wie Lidl und Aldi, bringt vielleicht kurzfristig<br />
tiefere Preise. Die ArbeitnehmerInnen sind aber oft die Leidtragenden.<br />
Denn mehr Wettbewerb durch Billiganbieter zeitigt Druck auf<br />
Löhne und Arbeitsbedingungen. Lohndruck ist aber nur ein Problem für<br />
die ArbeitnehmerInnen. <strong>Das</strong> Lohnkostenmanagement und die extreme<br />
Rationalisierung der Grossverteiler senken auch den Anteil der Arbeit<br />
in der Produktion. Die Eroberung des Einzelhandels durch die Wal-<br />
Mart-Kette hat hat in den USA massiv Arbeitsplätze vernichtet. Pro neu<br />
geschaffenen Arbeitsplatz im Wal-Mart-Shoppingcenter werden 1.5 Arbeitsplätze<br />
in anderen Läden und Shoppingcenters abgebaut! Auch die<br />
deutschen Unternehmen Aldi und Lidl arbeiten mit markant weniger<br />
Personal <strong>als</strong> Migros und Coop. Höhere Arbeitslosigkeit im Detailhandel<br />
ist die Folge.<br />
Preise stiegen, Löhne stagnierten<br />
Arbeitgeber und neoliberale Ökonomen möchten mehr Wettbewerb<br />
und Deregulierung. Dadurch könnten die Preise, Löhne und damit die<br />
Arbeitskosten gesenkt werden und die Schweiz würde <strong>als</strong> Wirtschaftsstandort<br />
wettbewerbsfähiger. So die Theorie. Im Moment sieht es wohl<br />
eher danach aus, dass die Arbeitgeber die Diskussion über die Preisinsel<br />
Schweiz dazu benützen, mehr Druck auf die Löhne zu machen. Baumeisterpräsident<br />
Messmer hatte 2005 gefordert, die Löhne für fünf Jahre<br />
einzufrieren, damit das Preisniveau gesenkt werden könne.<br />
Dabei ist das Preisniveau in den letzten Jahren weder in der Schweiz<br />
noch in anderen europäischen Ländern gesunken. <strong>Das</strong> Binnenmarkt-<br />
161 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik
Lohnpolitik<br />
programm und die Währungsunion mit dem forcierten Wettbewerb<br />
zwischen den Ländern haben in der EU nicht zu einem tieferen Preisniveau<br />
geführt. <strong>Das</strong> Resultat dieses Wettbewerbs waren 10 Jahre stagnierende<br />
Löhne, eine deutliche Umverteilung zugunsten der Reichen<br />
und eine Senkung der Lohnquote.<br />
Auch in der Schweiz sind nur die relativen Preise gesunken. Schaut<br />
man einzelne Warengruppen an, traf dies nur für den Kommunikationsbereich<br />
zu, wo die Preise seit 1990 um 23.7% zurückgingen. Insgesamt<br />
ist der Index aber um 24% gestiegen.<br />
Teuerung nach Warenkorbbereich 1990–2003 (Quelle BfS)<br />
Deflationsgefahr?<br />
Die einzigen Jahre, in denen die Konsumentenpreise in der Schweiz stagnierten<br />
oder in einzelnen Monaten sogar leicht zurückgingen, waren<br />
die Rezessionsjahre 1998 und 2003. Dam<strong>als</strong> kamen in der Schweiz, aber<br />
auch in Deutschland gleich Deflationsängste auf. Deflation entsteht,<br />
wenn die Nachfrage stagniert oder sinkt, ein Phänomen, das wir in der<br />
Schweiz wegen des Sparverhaltens der öffentlichen Hand und den stagnierenden<br />
Einkommen kannten und teilweise immer noch kennen. Die<br />
Produzenten und Detaillisten investieren dann nur noch in Rationalisierungsvorhaben<br />
und senken ebenfalls die Preise. Investoren und Konsumenten<br />
halten sich zurück, da sie auf tiefere Preise hoffen. So wird<br />
noch weniger ausgegeben, was zu einem Teufelskreis von Deflation und<br />
Rezession führt. So unbegründet sind diese Ängste nicht: Ab Mitte der<br />
1990er-Jahre litt Japan unter kaum noch steigenden, tendenziell sogar<br />
fallenden Preisen, verbunden mit einer starken Rezession und einem<br />
Anstieg der Arbeitslosigkeit, ausgelöst durch ein Platzen der Börsenbla-<br />
162 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
se. Dies führte zur grössten Nachkriegskrise mit einer anhaltenden Deflation,<br />
die erst im letzten Jahr zum Stillstand kam.<br />
Die Gleichung ›Mehr Wettbewerb = tiefere Preise und Löhne = bessere<br />
Wettbewerbsfähigkeit = mehr Arbeitsplätze‹ würde <strong>als</strong>o nur aufgehen,<br />
wenn die Kaufkraft der Arbeitnehmenden durch Preissenkungen<br />
gestärkt würde, um auch die Binnenwirtschaft zu stützen. Nach der Erfahrung<br />
der letzten Jahrzehnte wird dies aber nicht eintreffen. Vielmehr<br />
gibt es eine Umverteilung zugunsten von Profiten und Vermögensbesitzern.<br />
Im schlimmsten Fall droht gar Deflation und Krise.<br />
Produktiv und wettbewerbsfähig<br />
Abgesehen davon sind die Löhne in der Schweiz nicht zu hoch. Zwar<br />
rangiert die Schweiz unter den vier Ländern mit den höchsten Arbeitskosten.<br />
Da aber die Arbeitsproduktivität ebenfalls sehr hoch ist (die<br />
Schweiz rangiert an fünfter Stelle in der Welt), gleicht sich das insgesamt<br />
wieder aus. Vergleicht man die Lohnstückkosten, <strong>als</strong>o die Arbeitskosten<br />
pro produzierte Einheit, hat sich die Wettbewerbsposition der Schweiz<br />
seit Mitte der 1990er-Jahre gegenüber den EU-Ländern und den USA<br />
deutlich verbessert.<br />
130<br />
125<br />
120<br />
115<br />
110<br />
105<br />
100<br />
95<br />
Index 1990 = 100<br />
Lohnstückkosten (Quelle: Credit Suisse)<br />
Ohne eine gute Wettbewerbsposition wäre es kaum möglich gewesen,<br />
dass die Exporte im Jahr 2004 eine neue Rekordhöhe erreichten.<br />
Kaufkraft stärken, Arbeitsplätze erhalten<br />
Trotzdem setzt auch ein Teil der Linken auf mehr Wettbewerb und Preissenkungen.<br />
Strahm/Sommaruga bezeichnen in ihrem <strong>Buch</strong> ›Für eine<br />
moderne Schweiz‹ den mangelnden Wettbewerb und das ›Hochpreiseldorado‹<br />
<strong>als</strong> den Wachstumskiller Nr. 1. Selbst wenn es richtig ist, ein-<br />
163 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik<br />
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
Lohnpolitik<br />
zelne überhöhte Preise etwa durch die Zulassung von Parallelimporten<br />
zu senken – eine Strategie der allgemeinen Preis- und Lohnsenkung<br />
durch Wettbewerbsförderung wird keine Kaufkraft schaffen und keine<br />
Arbeitsplätze sichern.<br />
Kaufkraftmässig sind wir zwar nicht mehr die Nummer 1 in Europa,<br />
aber immer noch mit an der Spitze. Die Gewerkschaften müssen dafür<br />
sorgen, dass unsere realen Löhne erhalten bleiben, die Mindestlöhne angehoben<br />
werden und die Umverteilung zugunsten der Reichen gestoppt<br />
wird. Gegen Lohndumping in Folge der Personen- und Dienstleistungsfreiheit<br />
müssen die flankierenden Massnahmen zum freien Personenverkehr<br />
umgesetzt werden.<br />
Eine weitere Integration der Schweiz oder ein EU-Beitritt der Schweiz<br />
würde keineswegs bedeuten, dass sich Preise und Zinsen automatisch angleichen<br />
und damit der Druck auf die Löhne nochm<strong>als</strong> steigt. Innerhalb<br />
der EU gibt es grosse Unterschiede im Preisniveau, selbst innerhalb der<br />
Eurozone. Die Unterschiede bei den Lohnkosten und der Kaufkraft sind<br />
ebenfalls noch bedeutend, gleichen sich aber allmählich an. Gewerkschaften<br />
und Linke müssen sich viel mehr <strong>als</strong> bisher dafür einsetzen, dass<br />
diejenigen Länder, welche tiefe Löhne, Kaufkraft und Produktivität haben,<br />
auf das Niveau der reichen Länder angehoben werden und nicht<br />
umgekehrt. Dann können wir unsere Lebensqualität halten und auch ein<br />
höheres Preisniveau verkraften.<br />
Literatur und Anmerkung<br />
Ackermann, Ewald (2005) ›Vertrags- und Lohnverhandlungen 2004/2005‹. Publikation des<br />
Schweiz. Gewerkschaftsbundes SGB. Bern.<br />
BAK Basel Economics (2005) ›CH-PLUS. Analysen und Prognosen für die Schweizer Wirtschaft‹.<br />
Basel.<br />
Bundesamt für Statistik (2004) ›Gesamtarbeitsvertragliche Lohnabschlüsse 2004‹. Bern.<br />
Bundesamt für Statistik (2004) ›Lohnindex 2003‹. Bern.<br />
DGB Bundesvorstand (2003) ›Verteilungsbericht 2003‹. Berlin.<br />
Ecoplan (2004) ›Verteilung des Wohlstandes in der Schweiz‹, Bericht in Erfüllung des Postulates<br />
Fehr vom 9. Mai 2001. Bern.<br />
Eiroline (2003) Pay Developments 2003 (www.eiro.eurofound.ie/).<br />
ETUC (2003) ›Annual report on the coordination of collective bargaining in Europe‹. Brussels.<br />
Europäische Kommission (2005) ›European Economy. Economic Forcasts‹. Luxemburg<br />
(http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2005/ee2<br />
05en.pdf).<br />
KOF/ETHZ, ›Konjunktur Prognose 2005/2006‹.<br />
Schulten, Thorsten (2004) ›Europäischer Tarifbericht des WSI – 2003/2004‹. In: WSI Mitteilungen,<br />
Nr. 7.<br />
Schulten, Thorsten (2004) ›Solidarische Lohnpolitik in Europa‹. Hamburg.<br />
Sommaruga, S., R. H. Strahm (2005) ›Für eine moderne Schweiz‹. München-Wien.<br />
1 Bisher erschienen im ›work‹ Beiträge von folgenden AutorInnen: Serge Gaillard am<br />
28.1.05 und 27.5.05, Hans Baumann am 11.2.05, Andrea Hämmerle am 25.2.05, Erika<br />
Trepp am 11.3.05, Stefan Flückiger am 24.3.05, Rudolf Strahm am 8.4.05, Beat Ringger<br />
am 29.4.05 und Andreas Rieger am 13.5.05.<br />
164 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Lohnpolitik<br />
Thesen für eine<br />
europäische Mindestlohnpolitik<br />
Düsseldorf, Zürich, Paris, den 15. April 2005<br />
1. Der Lohn ist für die grosse Mehrheit der Beschäftigten die wichtigste<br />
Einkommensquelle. Die Lohnhöhe entscheidet wesentlich über den Lebensstandard<br />
und damit darüber, ob ein Leben in Würde möglich ist.<br />
Heute werden jedoch in Wirtschaft und Politik die Löhne zunehmend<br />
nur noch <strong>als</strong> blosse Kostenfaktoren und <strong>als</strong> Variable im internationalen<br />
Standortwettbewerb betrachtet. In den Hintergrund tritt damit auch die<br />
ökonomische Funktion des Lohnes <strong>als</strong> bedeutende Komponente der gesamtwirtschaftlichen<br />
Nachfrage, ohne die eine prosperierende wirtschaftliche<br />
Entwicklung nicht möglich ist.<br />
2. Seit mehr <strong>als</strong> zwei Jahrzehnten dominiert in Europa eine Politik der<br />
Liberalisierung der Märkte und der Deregulierung von Arbeits- und<br />
Sozialrechten. Dadurch werden die Löhne systematisch unter Druck<br />
gesetzt. In vielen europäischen Ländern ist zudem die gewerkschaftliche<br />
Schutz- und Gestaltungsmacht durch die Massenarbeitslosigkeit geschwächt<br />
worden. Immer mehr Unternehmen nutzen ihre dadurch<br />
gestärkte Macht- und Verhandlungsposition aus. Beschäftigte und ihre<br />
gewerkschaftlichen Vertretungen werden oft vor die erpresserische Wahl<br />
gestellt, entweder weitgehenden Zugeständnissen zuzustimmen oder<br />
Arbeitsplatzverluste zu riskieren. Zugleich bilden sich im Rahmen der<br />
Personenfreizügigkeit in immer mehr Branchen grenzüberschreitende<br />
europäische Arbeitsmärkte heraus, welche bestehende Lohn und Arbeitsstandards<br />
unterhöhlen. In Zukunft droht diese Entwicklung durch<br />
die geplante europäische Dienstleistungsrichtlinie<br />
noch weiter verstärkt<br />
zu werden.<br />
3. Seit den 1980er-Jahren ist die<br />
reale Entwicklung der Löhne in<br />
den meisten europäischen Staaten<br />
durch zwei grundlegende Trends<br />
gekennzeichnet. Zum einen sind<br />
die Löhne hinter der Produktivitätsentwicklung<br />
zurückgeblieben,<br />
so dass die Lohnquote fast überall<br />
eine rückläufige Tendenz aufweist.<br />
165 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Thorsten Schulten, Claus Schäfer,<br />
Reinhard Bispinck<br />
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches<br />
Institut (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung,<br />
Düsseldorf, Deutschland<br />
Andreas Rieger, Beat Ringger,<br />
Hans Baumann<br />
<strong>Denknetz</strong>, Schweiz<br />
Michel Husson, Antoine Math<br />
Institut de Recherches Economiques et Sociales<br />
(IRES), Paris, Frankreich
Lohnpolitik<br />
<strong>Das</strong> Ergebnis dieser Entwicklung besteht nicht nur in einer massiven<br />
Einkommensumverteilung zugunsten der Kapit<strong>als</strong>eite, sondern auch in<br />
einer Schwächung der privaten Konsumnachfrage, die ihrerseits in vielen<br />
europäischen Ländern zu der schwachen Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung<br />
beigetragen hat.<br />
4. Als zweiten grundlegenden Trend lässt sich für die Mehrzahl der<br />
europäischen Länder ein Anstieg der Lohnspreizung feststellen. Die<br />
Lohnunterschiede zwischen den einzelnen Beschäftigtengruppen haben<br />
immer mehr zugenommen. Dies liegt sowohl an einer überdurchschnittlich<br />
hohen Lohnentwicklung im oberen Lohnsegment (z.B. bei<br />
leitenden Angestellten, Managern usw.) <strong>als</strong> auch an einer massiven<br />
Ausdehnung des Niedriglohnsektors. Die Europäische Kommission hat<br />
unlängst berechnet, dass im Jahr 2000 allein in der alten EU (EU 15)<br />
mehr <strong>als</strong> 15% der Beschäftigten (d.h. mehr <strong>als</strong> 20 Millionen Lohnabhängige)<br />
zu den Niedriglohn-Empfängern gezählt werden müssen.<br />
5. Strukturell gesehen ist der Anteil der Niedriglohn-Empfänger bei den<br />
Frauen doppelt so hoch wie bei den Männern. Gleichzeitig arbeiten<br />
überdurchschnittlich viele Niedriglohn-Empfänger in prekären Beschäftigungsverhältnissen,<br />
deren Anzahl in Europa seit den 1990er-Jahren<br />
ebenfalls stark angestiegen ist. Zudem existiert in einigen Branchen<br />
(Landwirtschaft, Hotel und Gaststätten, Handel, private Dienstleistungen)<br />
eine besonders hohe Konzentration von Niedriglohn-Empfängern.<br />
Bei einem grossen Teil davon handelt es sich um ›arbeitende Arme‹<br />
(working poor), deren Lohn unterhalb von 50% des nationalen Durchschnittslohnes<br />
liegt.<br />
6. Die kontinuierliche Ausdehnung des Niedriglohnsektors bildet neben<br />
der Massenarbeitslosigkeit eine der zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen<br />
in Europa. Die sozialen, moralischen und ökonomischen<br />
Grundlagen des europäischen Sozialmodells drohen dabei untergraben<br />
zu werden. Während die Unternehmen sich durch die Zahlung von<br />
Niedrig- und Billiglöhnen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung entziehen,<br />
werden die sozialen Folgekosten der Allgemeinheit aufgebürdet<br />
und belasten zunehmend die Institutionen des Sozi<strong>als</strong>taates und der öffentlichen<br />
Fürsorge. Hinzu kommt, dass mit der Ausdehnung des Niedriglohnsektors<br />
die soziale Spaltung der Gesellschaft weiter vertieft und<br />
damit der Boden für chauvinistische, rechtspopulistische und nationalistische<br />
Kräfte bereitet wird. Deshalb ist eine progressive Politisierung der<br />
Lohnfrage, die sich an den grundlegenden Normen der Teilhabe- und<br />
Verteilungsgerechtigkeit orientiert, dringend geboten.<br />
166 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
167 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik<br />
7. Niedriglöhne, welche die Betroffenen von einer normalen gesellschaftlichen<br />
Teilhabe ausschliessen, stehen im krassen Gegensatz zu<br />
dem in vielen europäischen und internationalen Vereinbarungen festgeschrieben<br />
Recht auf einen ›angemessenen‹ oder ›gerechten‹ Lohn. Die<br />
1989 von der EU verabschiedete ›Gemeinschaftscharta der sozialen<br />
Grundrechte der Arbeitnehmer‹ (kurz: EU-Sozialcharta) beinhaltet den<br />
Grundsatz, dass »für jede Beschäftigung ein gerechtes Entgelt zu zahlen<br />
[ist]« (Titel 1, Abs. 5.). »Entsprechend den Gegebenheiten eines jeden<br />
Landes« soll deshalb »den Arbeitnehmern ein gerechtes Arbeitsentgelt<br />
garantiert« werden. Unter einem »gerechten Arbeitsentgelt« versteht die<br />
EU-Sozialcharta dabei einen Lohn, der ausreicht, um den Arbeitnehmern<br />
»einen angemessenen Lebensstandard zu erlauben«. Auch die ›Europäische<br />
Sozialcharta‹ des Europarates von 1961 enthält ausdrücklich<br />
ein »Recht auf ein gerechtes Arbeitsentgelt … welches ausreicht … einen<br />
angemessenen Lebensstandard zu sichern« (Artikel 4). Ähnliche Bestimmungen<br />
einer gerechten Entlohnung finden sich ausserdem in den<br />
nationalen Verfassungen zahlreicher europäischer Länder wie Belgien,<br />
Italien, Spanien, Portugal, Tschechien oder auch in den Landesverfassungen<br />
mehrerer deutscher Bundesländer (z.B. in Hessen oder Nordrhein-Westfalen).<br />
8. Ein wesentliches Instrument zur Sicherung eines angemessenen Arbeitsentgelts<br />
besteht in der Festsetzung von Mindestlöhnen. Bereits 1928<br />
wurde im Rahmen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) ein<br />
›Übereinkommen über die Einrichtung von Verfahren zur Festsetzung<br />
von Mindestlöhnen‹ (IAO-Konvention Nr. 26) verabschiedet. Später<br />
wurde in einem weiteren Übereinkommen von 1970 die Bedeutung von<br />
Mindestlöhnen noch einmal bekräftigt (IAO- Konvention Nr. 131). Nach<br />
Ansicht der IAO sollen alle Staaten ein nationales Mindestlohnsystem<br />
einführen, dass »den Lohnempfängern Schutz gegen unangemessen<br />
niedrige Löhne gewährt«. Entsprechend den sozialen und ökonomischen<br />
Rahmenbedingungen eines jeden Landes soll die Höhe des Mindestlohns<br />
»im Einvernehmen oder nach umfassender Beratung mit den<br />
… Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden« festgelegt werden.<br />
9. Nationale Regelungen zur Sicherung von Mindestlöhnen sind überall<br />
in Europa weit verbreitet. In der Mehrzahl der europäischen Staaten<br />
existieren gesetzliche Mindestlöhne, die über alle Branchen hinweg<br />
einen bestimmten Mindestlohnsatz festschreiben. In anderen Ländern<br />
werden die Mindestlöhne ausschliesslich durch Kollektivverträge festgesetzt,<br />
die teilweise darüber hinaus durch Allgemeinverbindlichkeitserklärungen<br />
ausgeweitet werden. In wieder anderen Ländern finden sich
Lohnpolitik<br />
Mischformen, bei denen die Mindestlöhne in einigen Branchen durch<br />
Kollektivverträge und in anderen Branchen durch gesetzliche Vorgaben<br />
reguliert werden. Unabhängig von ihrer jeweiligen nationalen Form<br />
steht die Mindestlohnsicherung jedoch – wie die Lohnpolitik insgesamt<br />
– unter massivem Druck.<br />
10. Vor dem Hintergrund eines gemeinsamen europäischen Binnenmarktes<br />
und einer zunehmend integrierten europäischen Wirtschaft ist<br />
eine europäische Mindestlohnpolitik dringend geboten. <strong>Das</strong> Ziel einer<br />
europäischen Mindestlohnpolitik besteht darin, die weitere Ausbreitung<br />
von Armutslöhnen und ein gerade im Niedriglohnsektor drohendes,<br />
grenzüberschreitendes Lohndumping zu verhindern. Damit leistet<br />
sie zugleich einen wichtigen Beitrag, den Grundsatz ›Gleicher Lohn für<br />
gleiche Arbeit am gleichen Ort‹ durchzusetzen. Darüber hinaus setzt<br />
eine europäische Mindestlohnpolitik auch positive Impulse für andere<br />
soziale Ziele wie die Verringerung der Lohnunterschiede zwischen Frauen<br />
und Männern oder die Verbesserung der Qualität und Produktivität<br />
der Arbeit. Schliesslich leistet eine europäische Mindestlohnpolitik<br />
gesamtwirtschaftlich einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der privaten<br />
Nachfrage und wirkt <strong>als</strong> Barriere gegen deflationäre Tendenzen.<br />
11. Zur Umsetzung des in der EU-Sozialcharta enthaltenen Rechts auf<br />
ein angemessenes Entgelt hat die Europäische Kommission bereits Anfang<br />
der 1990er-Jahre die Notwendigkeit einer europäischen Mindestlohnpolitik<br />
anerkannt. In einer Stellungnahme aus dem Jahre 1993 fordert<br />
sie die EU-Mitgliedsstaaten dazu auf, »geeignete Massnahmen zu<br />
ergreifen, um sicherzustellen, dass das Recht auf ein angemessenes<br />
Arbeitsentgelt geschützt wird.« <strong>Das</strong> Europäische Parlament hat sich im<br />
gleichen Jahr für die »Einführung eines gerechten Referenzentgelts auf<br />
nationaler Ebene, das <strong>als</strong> Grundlage für Tarifverhandlungen dient«, ausgesprochen<br />
und für »Mechanismen zur Festlegung von gesetzlichen<br />
Mindestlöhnen, bezogen auf den nationalen Durchschnittslohn« plädiert.<br />
12. Bei dem Konzept einer europäischen Mindestlohnpolitik handelt es<br />
sich demnach im Kern um die europaweite Festlegung bestimmter<br />
gemeinsamer Ziele und Kriterien, auf deren Grundlage dann die nationalen<br />
Mindestlohnpolitiken miteinander koordiniert werden können.<br />
Dabei kann angesichts der nach wie vor gravierenden ökonomischen<br />
Entwicklungsunterschiede in Europa und dem damit zusammenhängenden<br />
enormen Lohngefälle das Ziel nicht darin bestehen, einen einheitlichen<br />
Mindestlohnbetrag für ganz Europa festzusetzen. Es geht<br />
vielmehr darum, in jedem Land für die unteren Lohngruppen eine be-<br />
168 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
stimmte Mindestnorm festzulegen, die in einem bestimmten Verhältnis<br />
zum nationalen Lohngefüge steht. Als Zielmarke sollten alle europäischen<br />
Länder eine nationale Mindestnorm für Löhne anvisieren, die im<br />
Minimum 60% des nationalen Durchschnittslohns beträgt. Als kurzfristiges<br />
Etappenziel sollten alle Länder eine Mindestnorm einführen,<br />
die 50% des nationalen Durchschnittslohns entspricht.<br />
13. Ähnlich wie in anderen Politikfeldern, könnte eine europäische Mindestlohnpolitik<br />
nach der Methode der offenen Koordinierung verfahren.<br />
Demnach müssten auf europäischer Ebene bestimmte konkrete Ziele<br />
und Umsetzungszeiträume festgelegt werden, die dann im nationalen<br />
Rahmen mit den dort üblichen Institutionen und Verfahren realisiert<br />
werden. Dabei können je nach nationaler Tradition gesetzliche Mindestlöhne,<br />
allgemeinverbindlich erklärte Kollektivvereinbarungen oder<br />
Kombinationen von beiden Regelungsverfahren zur Anwendung kommen.<br />
Die europäische Ebene hätte wiederum die Aufgabe, die Umsetzung<br />
auf nationaler Ebene zu überwachen und durch ein umfassendes<br />
Monitoring nationaler Mindestlohnpolitiken zur Verbreitung ›guter<br />
nationaler Praktiken‹ beizutragen. Dazu gehört auch eine Verbesserung<br />
der statistischen Datenbasis über die Entwicklung der Niedriglöhne in<br />
Europa.<br />
14. Bei der Durch- und Umsetzung einer europäischen Mindestlohnpolitik<br />
kommt den europäischen Gewerkschaften eine herausragende<br />
Rolle zu. Diese sind gefordert, ein gemeinsames Konzept für eine europäische<br />
Mindestlohnpolitik zu formulieren. Ein solches Konzept wäre<br />
einerseits mit den aktuellen Ansätzen für eine europäische Koordinierung<br />
der Kollektivvertragspolitik zu verbinden. Andererseits würde das<br />
Konzept <strong>als</strong> Grundlage dienen, um auf europäischer Ebene für die Formulierung<br />
ambitionierter Ziele zu sorgen und auf nationaler Ebene<br />
deren Umsetzung voranzutreiben. Schliesslich besteht die ureigene Aufgabe<br />
der europäischen Gewerkschaften darin, ein grundlegendes Prinzip<br />
des europäischen Sozialmodells zu verteidigen, wonach der Lohn<br />
jedem abhängig Beschäftigten ein Leben in Würde und finanzieller<br />
Unabhängigkeit ermöglichen muss.<br />
169 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Lohnpolitik
Politique des salaires<br />
Thèses pour une politique<br />
européenne de salaires minimaux<br />
Düsseldorf, Paris, Zurich, le 15 avril 2005<br />
1. Pour la grande majorité des travailleurs, la rémunération salariale constitue<br />
la source principale de revenu. Dès lors, le montant du salaire ne<br />
fait pas que déterminer le niveau de vie individuel: il permet aussi de<br />
mesurer le respect qu’une société donnée accorde à la dignité humaine.<br />
Aujourd’hui, l’économie et le politique tendent à ne voir dans les salaires<br />
qu’un élément des coûts de production, et à les apprécier au regard<br />
de la compétitivité internationale. Cette approche unilatéralement centrée<br />
sur l’offre fait passer au second plan la fonction économique des<br />
salaires en tant que composante de la demande. Or c’est précisément la<br />
demande qui sous-tend tout développement économique qui se veut à<br />
la fois prospère et durable.<br />
2. Depuis deux décennies au moins, la politique de libéralisation des<br />
marchés et de déréglementation sociale fait rage en Europe et exerce une<br />
pression systématique sur les salaires. De plus, le chômage de masse qui<br />
affecte de nombreux pays européens réduit de manière alarmante la capacité<br />
des organisations syndicales à intervenir pour la défense des intérêts<br />
des salariés. Un nombre croissant d’entreprises n’hésitent pas à<br />
profiter de ce rapport de forces pour exercer un véritable chantage à<br />
l’égard d’une main-d’oeuvre désormais acculée au mur: ou bien les travailleurs<br />
et leurs organisations syndicales doivent se résoudre à faire de<br />
substantielles concessions au patronat, ou bien ils courent délibérément<br />
le risque de perdre leurs emplois. En même temps, le principe de la<br />
libre circulation des personnes conduit, dans de nombreux secteurs, à<br />
la création de marchés du travail<br />
transfrontaliers, de manière à<br />
exercer une pression supplémentaire<br />
sur les conditions d’existence<br />
des salariés. La prochaine promulgation<br />
d’une directive européenne<br />
sur les services pourrait<br />
aggraver encore ces évolutions<br />
dangereuses.<br />
3. Dans la plupart des pays européens,<br />
la dynamique salariale présente<br />
deux tendances majeures<br />
Thorsten Schulten, Claus Schäfer,<br />
Reinhard Bispinck<br />
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches<br />
Institut (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung,<br />
Düsseldorf, Deutschland<br />
Andreas Rieger, Beat Ringger,<br />
Hans Baumann<br />
Réseau de Réflexion, Suisse<br />
Michel Husson, Antoine Math<br />
Institut de Recherches Economiques et Sociales<br />
(IRES), Paris, France<br />
170 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
depuis les années quatre-vingt. En premier lieu, la progression des salaires<br />
n’a pas suivi celle de la productivité, à tel point que le pouvoir<br />
d’achat des salariés est presque partout à la baisse. Le résultat de cette<br />
évolution n’est pas seulement une redistribution massive des revenus en<br />
faveur du capital: elle conduit aussi à un affaiblissement considérable de<br />
la consommation des ménages, qui se répercute négativement sur l’activité<br />
économique et sur l’emploi.<br />
4. En second lieu, on enregistre, dans la plupart des pays européens, un<br />
accroissement des inégalités salariales. Les écarts entre les diverses catégories<br />
socioprofessionnelles ne cessent de se creuser, en raison à la fois<br />
d’une progression supérieure à la moyenne des salaires les plus élevés<br />
(notamment les rémunérations des cadres supérieurs et des dirigeants)<br />
et de l’extension massive des segments à bas salaire. Selon une étude réalisée<br />
en 2000 par l’Union européenne, plus de 15 % des salariés des quinze<br />
pays membres de l’époque – soit plus de 20 millions – se situaient<br />
dans les segments à bas salaires.<br />
5. La proportion de femmes recevant des bas salaires est deux fois plus<br />
élevée que celle des hommes. De même, il faut souligner que les bas salaires<br />
sont nettement sur représentés dans les secteurs à emplois précaires,<br />
en pleine essor partout en Europe depuis les années quatre-vingtdix.<br />
Certaines branches (agriculture, hôtellerie et restauration, commerce<br />
de détail, services aux particuliers) font apparaître une concentration<br />
particulièrement élevée d’emplois à bas salaires. De manière<br />
générale, la plupart des personnes recevant ces bas salaires entrent dans<br />
la catégorie des travailleurs pauvres (working poors), leur rémunération<br />
étant inférieure à la moitié du salaire moyen national.<br />
6. Dans ce contexte de chômage de masse, l’élargissement régulier des<br />
segments à bas salaires constitue un défi majeur pour l’ensemble de la<br />
société civile en Europe, dont les fondements sociaux, économiques et<br />
éthiques sont ainsi profondément remis en cause. En faisant ainsi baisser<br />
les salaires, les entreprises se soustraient à leurs responsabilités sociales,<br />
et les effets corrosifs de telles pratiques sont reportés sur la collectivité,<br />
et viennent peser de plus en plus lourdement sur les institutions<br />
de l’Etat social et de l’assistance publique. Ce développement des bas<br />
salaires vient creuser un peu plus la fracture sociale, et fraie la voie au<br />
populisme d’extrême droite et à un nationalisme aux accents xénophobes.<br />
Pour faire face à telle situation, il est impératif d’oeuvrer en faveur<br />
d’une politisation progressiste de la question salariale, en réaffirmant les<br />
principes fondamentaux de la démocratie sociale et participative.<br />
171 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Politique des salaires
Politique des salaires<br />
7. La généralisation des bas salaires conduit à la marginalisation économique<br />
et sociale des personnes concernées et entre en contradiction flagrante<br />
avec de nombreuses conventions européennes et internationales<br />
qui stipulent le droit à un salaire juste ou décent. Ainsi la Charte communautaire<br />
des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, entérinée<br />
par la Communauté européenne en 1989 – communément appelée<br />
Charte sociale de l’UE depuis 1993 – énonce le principe selon lequel<br />
»tout emploi doit être justement rémunér«é (titre 1er alinéa 5). Tous les<br />
travailleurs doivent recevoir une »rémunération équitable« en accord<br />
avec les données propres à chaque pays, c’est-à-dire »une rémunération<br />
suffisante pour leur permettre d’avoir un niveau de vie décent«. De même,<br />
l’article 4 de la Charte sociale européenne promulguée par le Conseil<br />
d’Europe en 1961 stipule que »tous les travailleurs ont droit à une<br />
rémunération équitable leur assurant, ainsi qu’à leurs familles, un niveau<br />
de vie satisfaisant«. Des dispositions semblables existent dans les Constitutions<br />
de nombreux pays européens (notamment la Belgique, l’Italie,<br />
l’Espagne, le Portugal et le République tchèque) ainsi que dans les<br />
constitutions de plusieurs Länder allemands (notamment la Hesse et la<br />
Rhénanie du Nord Westphalie).<br />
8. L’établissement de salaires minimaux constitue de toute évidence un<br />
instrument essentiel pour garantir un revenu décent. En 1928 déjà,<br />
l’OIT (Organisation internationale du travail) avait entériné la Convention<br />
n°26 sur l’instauration de procédures pour la fixation de salaires minimaux.<br />
La Convention n°131, entérinée en 1970, insiste à nouveau sur<br />
le rôle central qu’il convient d’attribuer aux salaires minimaux. L’OIT<br />
recommande à tous les Etats d’instaurer un système national de salaires<br />
minimaux qui protège les salariés de rémunérations exagérément basses.<br />
Le niveau du salaire minimum doit donc tenir compte des conditions<br />
économiques et sociales propres à chaque pays, et être fixé d’un<br />
commun accord entre les partenaires sociaux – employeurs et salariés –<br />
ou à l’issue d’une consultation exhaustive de ces derniers.<br />
9. En Europe, les réglementations garantissant l’existence de salaires minimaux<br />
sont largement répandues. Dans la plupart des pays est établi<br />
un salaire minimum légal qui s’applique à toutes les branches. Dans d’autres<br />
pays, les salaires minimaux font l’objet de procédures contractuelles<br />
qui peuvent prendre valeur légale. Enfin, certains pays font coexister<br />
selon les branches, les procédures contractuelles et les dispositifs réglementaires.<br />
Cependant, quelles que soient leurs formes juridiques, les réglementations<br />
portant sur les salaires minimaux se voient soumises aux<br />
mêmes pressions que la politique salariale dans son ensemble.<br />
172 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
173 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Politique des salaires<br />
10. Avec la formation du marché unique et l’intégration progressive de<br />
l’économie européenne, la mise en oeuvre d’une politique européenne<br />
de salaires minimaux devient un impératif catégorique. Son objectif premier<br />
devrait être évidemment de freiner une nouvelle extension des salaires<br />
de misère, ainsi que la précarisation transfrontalière qui menace<br />
tout particulièrement les segments à bas salaires. Une telle politique de<br />
salaires minimaux contribuerait grandement à l’application en Europe<br />
du principe »à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail«. Elle<br />
permettrait en outre de faire progresser d’autres objectifs sociaux comme<br />
la réduction des inégalités salariales entre les hommes et les femmes,<br />
ou encore l’amélioration de la qualité et de la productivité du travail. Enfin,<br />
une politique européenne de salaires minimaux représenterait un apport<br />
décisif à la recherche d’une stabilisation de la demande privée et<br />
ferait obstacle aux velléités d’une politique déflationniste.<br />
11. La Commission européenne avait, dès le début des années quatrevingt-dix,<br />
reconnu la nécessité d’une politique européenne de salaires<br />
minimaux calculés sur la base du salaire moyen national pour faire passer<br />
dans les faits le droit à une rémunération équitable énoncé par la<br />
Charte sociale de l’UE. Dans un avis datant de 1993, la Commission invitait<br />
les Etats membres de l’UE à prendre des mesures appropriées permettant<br />
de garantir le droit à un salaire décent. La même année, le Parlement<br />
européen se prononçait en faveur de l’introduction d’un salaire décent<br />
de référence défini au niveau national et servant de base aux négociations<br />
collectives. Il plaidait également en faveur de mécanismes<br />
permettant de déterminer les salaires minimaux légaux en fonction du<br />
salaire moyen de chaque pays.<br />
12. La mise en place d’une politique européenne de salaires minimaux<br />
passe de toute évidence par le choix d’objectifs et de critères communs<br />
qui puissent servir de cadre de référence à la coordination des politiques<br />
nationales. Compte tenu des disparités économiques et salariales majeures<br />
qui existent entre les différentes régions de notre continent, il est<br />
hors de question de fixer un salaire minimum uniforme pour l’ensemble<br />
de l’Europe. Il s’agit plutôt d’établir pour chaque pays une norme salariale<br />
minimale, qui soit adaptée à sa structure salariale. Les pays européens<br />
pourraient viser à l’instauration d’une norme salariale minimale<br />
équivalant à 60 % du salaire moyen national. A court terme, cette norme<br />
pourrait être au moins fixée à 50 % du salaire moyen national.<br />
13. Cette politique européenne de salaires minimaux pourrait être mise<br />
en oeuvre selon la méthode de la coordination ouverte, déjà utilisée dans<br />
d’autres domaines. Elle prévoirait la fixation, à l’échelle européenne,
Politique des salaires<br />
d’objectifs et de calendriers à respecter par chaque pays en fonction de<br />
leurs institutions et procédures propres. Ce cadre permettrait de respecter<br />
les spécificités institutionnelles de chacun des pays, qui pourraient<br />
procéder soit par la fixation de salaires minimaux légaux, soit par<br />
extension des conventions collectives en vigueur, ou encore par une<br />
combinaison de ces deux méthodes. L’échelon européen aurait quant à<br />
lui pour fonction de veiller à l’application par chaque pays de ces dispositions<br />
et de contribuer à la diffusion des meilleures pratiques à partir<br />
d’un suivi systématique des politiques nationales. Pour ce faire, une<br />
amélioration substantielle des bases de données statistiques sur l’évolution<br />
des bas salaires en Europe est indispensable.<br />
14. Le choix en faveur d’une politique européenne de salaires minimaux<br />
dépend au premier chef de l’intervention des syndicats européens. Il leur<br />
revient donc de définir une conception commune, qui synthétise les<br />
méthodes et expériences disponibles en matière de concertation européenne.<br />
Ce projet commun pourra servir de référence à la formulation<br />
d’objectifs ambitieux à l’échelle européenne, puis au choix des modalités<br />
nationales permettant de réaliser concrètement ces objectifs.<br />
C’est en fin de compte la mission première des syndicats que de défendre<br />
le principe essentiel du système social européen selon lequel le salaire<br />
doit permettre à tout travailleur – et à toute travailleuse – de mener<br />
une vie décente et en pleine autonomie économique.<br />
174 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Assurer la victoire du profit<br />
175 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Fiscalité<br />
Éclairages sur la politique helvétique<br />
en matière de finances publiques<br />
»Es ist einfach gefährlich, der öffentlichen Hand zu viel Einnahmen zu<br />
verschaffen.« 1 Cette phrase, prononcée en 1955 par Paul Haefelin, conseiller<br />
aux Etats radical soleurois proche des milieux patronaux de l’industrie<br />
des métaux et des machines, résume à elle seule l’attitude des<br />
milieux dirigeants helvétiques face aux questions de politique financière.<br />
Leur volonté de conserver à l’Etat un statut de ›nain financier‹ est en<br />
effet une constante séculaire.<br />
La crise économique qui touche l’Europe n’épargne pas la Suisse. Avec<br />
ses hauts et ses bas, elle est par sa durée et son intensité, d’une ampleur<br />
inconnue depuis l’entre-deux guerres. Lorsqu’elle survient, c’est en pleine<br />
conformité avec une tradition idéologique bien ancrée que la classe<br />
dominante helvétique pratique une politique consistant à faire maigrir<br />
l’Etat. Ténors politiques du bloc bourgeois ou capitaines des principales<br />
multinationales suisses, les voix se multiplient alors en effet depuis une<br />
vingtaine d’années avec une vigueur renouvelée pour réclamer – dans<br />
le sillage des politiques néolibérales inaugurées par Pinochet au Chili,<br />
puis Thatcher en Grande-Bretagne et Reagan aux USA – une accentuation<br />
de ce qu’on a appelé la »politique des caisses vides« 2 . Assurément,<br />
cette politique a contribué à renforcer la crise économique et à en<br />
reporter le poids sur les plus pauvres ainsi que, d’une façon générale sur<br />
les salariés.<br />
La politique des caisses vides: faire maigrir l’Etat<br />
Le principe de cette politique est simple. Il s’agit de demander des baisses<br />
d’impôt au nom de la compétitivité économique ou de la »santé de<br />
la place financière suisse«. Puis, une fois ces baisses d’impôt obtenues, il<br />
convient de pointer du doigt avec horreur les déficits fabriqués par le<br />
déséquilibre entre les recettes et les dépenses de l’Etat. Ceci permet d’imposer<br />
ensuite les coupes budgétaires ›nécessaires‹ au nom du principe<br />
selon lequel l’endettement de l’Etat serait synonyme d’une catastrophe<br />
collective.<br />
Selon leurs promoteurs, ces ra-<br />
Olivier Longchamp bais fiscaux seraient autant de re-<br />
est assistant en histoire à l’Université de mèdes nécessaires contre la crise:<br />
Lausanne. Il est aussi membre de la rédac- en assurant des ›conditions cation<br />
de ›Pages de gauche‹.<br />
dres‹ favorables aux entreprises,
Fiscalité<br />
on verrait les places de travail se créer en Suisse par milliers ou au moins<br />
parviendrait-on – version soft du même argument – à empêcher la disparition<br />
sous d’autres latitudes d’emplois tant convoités. C’est du moins<br />
ce que répètent inlassablement les hérauts de la science économique<br />
néolibérale. Un autre argument est encore avancé pour justifier ces baisses<br />
d’impôts. Il consiste à affirmer que l’argent ainsi ›économisé‹ par les<br />
ménages servirait à relancer une consommation gage de croissance.<br />
Dans les faits, on sait aujourd’hui que la diminution des charges fiscales<br />
pesant sur les plus aisés n’a pas favorisé la croissance promise, au contraire.<br />
3 Tant à l’échelle internationale qu’en ce qui concerne la Suisse, à<br />
l’échelle intercantonale, les exemptions accordées ont cependant contribué<br />
à une remarquable sous enchère fiscale. Chaque diminution<br />
d’impôt ici servant immédiatement de prétexte à une initiative visant un<br />
rabais fiscal de même ordre dans la collectivité territoriale adjacente. Et<br />
toujours au nom de la ›compétitivité‹ du contexte économique local!<br />
Sous le vernis de cette ›doxa‹ néolibérale, la politique des caisses vides<br />
vise en fait deux objectifs qui n’ont rien à voir avec les prétextes par<br />
lesquels on la justifie. D’une part, elle permet d’opérer une redistribution<br />
de la charge fiscale au bénéfice des plus riches, en diminuant les<br />
impôts qui frappent les capitaux et leurs revenus, en diminuant la progressivité<br />
des impôts directs et en augmentant à l’inverse les impôts indirects,<br />
la TVA, ou les diverses taxes qui grèvent particulièrement les<br />
revenus des moins aisés. D’autre part, en asséchant les caisses de l’Etat,<br />
cette politique vise à obtenir une diminution des dépenses étatiques qui<br />
ne sont pas directement utiles au patronat, et en particulier celles liées<br />
aux assurances sociales.<br />
Une redistribution de la charge fiscale<br />
des impôts directs vers les taxes indirectes<br />
Les baisses d’impôt direct consenties successivement au cours des<br />
années 1980 et 1990 ont contribué à déplacer la répartition de la charge<br />
fiscale en Suisse des riches vers les pauvres. Plusieurs indices concordants<br />
le montrent. Ainsi, selon l’administration fédérale, l’évolution<br />
de la charge fiscale directe de 1977 à 2001 en moyenne des chefs-lieux<br />
de canton, et compte tenu de la compensation du renchérissement (en<br />
% du revenu brut du travail) a ainsi passé de 7.07% en 1977 à 5.41% en<br />
2001 pour un contribuable gagnant 3900 francs par mois en 2001, soit<br />
un rabais de 1.6%. Un contribuable gagnant 31’000 francs par mois en<br />
2001 a vu par contre sa charge fiscale passer durant la même période de<br />
31.75% à 28.74%. 4 En d’autres termes, le rabais fiscal annuel consenti,<br />
durant la période 1977–2001 par le biais des impôts directs a été de 775.–<br />
176 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
177 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Fiscalité<br />
Fr. pour un contribuable gagnant 3900 francs par mois, tandis que pour<br />
un contribuable gagnant 31’000.– francs par mois elle a été de 11’238.–<br />
francs par an.<br />
Les diminutions du droit de timbre frappant les transactions financières<br />
consenties depuis 1993 ont en outre représenté 750 millions de francs<br />
par an de moins dans les caisses de la Confédération. Les diminutions<br />
d’impôt direct avaient déjà été fortes au cours des années 80. 5 Poursuivies,<br />
ensuite, elles ont de leur côté fait perdre 375 millions de francs<br />
par an à la Confédération depuis 1995, puis 835 millions par an dès<br />
1998. Autant de cadeaux fiscaux aux nantis. 6 De l’autre côté, la hausse<br />
de la TVA de 6.5 à 7.5% consentie pour le financement de l’AVS a à elle<br />
seule apporté 2.2 milliards par an à la Confédération, en pesant surtout<br />
de façon régressive sur les revenus des consommateurs.<br />
La concurrence fiscale intercantonale a, elle, occasionné d’importantes<br />
diminutions des impôts cantonaux sur les personnes morales. Le<br />
Département fédéral des finances a tenté de chiffrer les rabais fiscaux<br />
consentis entre 1977 et 2001 à une société anonyme dont le capital et les<br />
réserves se seraient élevés à 100’000 francs en 1977 et les bénéfices à<br />
30’000 francs pour différents chefs-lieux de cantons. Compte tenu de<br />
l’évolution du pouvoir d’achat, les rabais fiscaux consentis sur cette période<br />
se seraient ainsi élevés à 0.2% à Fribourg (le moins élevé), mais à<br />
7.6% à Genève, à 7.9% à Zoug, à 12.6% à Zurich, à 13.5% à Berne et à<br />
15% à Bellinzone. 7<br />
De plus, sous la pression de cette concurrence fiscale intercantonale,<br />
la plupart des cantons ont décidé de supprimer ou de diminuer fortement<br />
leurs impôts sur les successions en ligne directe. Or, de tels impôts<br />
touchent avant tout les très grosses fortunes. Dans le canton de Vaud par<br />
exemple, le Parti libéral a fait aboutir en décembre 2000 une initiative<br />
demandant la suppression de l’impôt sur les successions et donations en<br />
ligne directe. Repoussée en votation le 16 mai 2004 au profit d’un contre-projet<br />
›plus modéré‹ consentant une diminution substantielle des<br />
taux de cette contribution, l’initiative libérale profitait à une faible minorité<br />
très aisée de la population. Selon les statistiques cantonales publiées<br />
à ce sujet en effet, 81% des 4567 successions en ligne directe<br />
frappées par l’impôt entre juillet 2001 et juillet 2002 n’avaient acquitté<br />
qu’à peine 9,3% du produit total de l’impôt sur de telles successions. Au<br />
contraire, 1% de ces successions – portant sur des fortunes très élevées,<br />
d’en moyenne 17 millions chacune – avaient rapporté dans le même<br />
temps à elles seules 57% du produit total de l’impôt sur les successions<br />
en ligne directe, avec un taux d’imposition maximal de 3.5%! 8<br />
Les projets visant à accroître encore cette remise en cause du rôle re-
Fiscalité<br />
distributif de l’impôt ne manquent pas. Le rêve suprême en la matière<br />
est la suppression totale des taux progressifs de l’impôt direct et l’instauration<br />
de la fameuse flat tax que Ronald Reagan rêvait d’introduire<br />
aux Etats-Unis. Cet impôt proportionnel sur le revenu a ainsi été proposé<br />
à la sauce helvétique dans le troisième ›livre blanc‹ paru fin 2003<br />
sous la plume du journaliste Markus Schneider. Hans-Rudolf Merz a<br />
également lancé en août 2004 une étude censée analyser la possibilité<br />
de remplacer en Suisse les impôts directs par une flat tax favorable aux<br />
plus aisés. Dernièrement, c’est la gauche sociale-libérale, par les voix de<br />
S. Sommaruga et R. Strahm, qui a encore proposé pareille solution pour<br />
›moderniser‹ la Suisse.<br />
Du côté de l’austérité<br />
Mais la politique des caisses vides n’a pas seulement permis de diminuer<br />
la charge fiscale pesant sur les plus aisés. En asséchant les caisses de<br />
l’Etat au moment précis où la pire crise économique de l’après-guerre<br />
frappait la Suisse, elle a permis de justifier une austérité budgétaire sans<br />
précédent depuis un demi siècle. Les sphères dirigeantes du capitalisme<br />
helvétique sont ainsi parvenues à contenir étroitement les sommes<br />
allouées aux prestations sociales qui auraient pu exploser en période de<br />
crise.<br />
Il serait fastidieux d’énumérer toutes les réformes et les tentatives de<br />
révisions entreprises, depuis les débuts de la 10è révision de l’AVS en<br />
1990 jusqu’à la révision annoncée de l’AI qui, toutes, avaient en commun<br />
une diminution des prestations offertes aux salariéEs et assuréEs.<br />
De fait, l’austérité a donc servi de clé de voûte aux révisions législatives<br />
qui ont été effectuées dans le domaine des assurances sociales depuis une<br />
quinzaine d’années. Pour éviter leur prétendue ›faillite‹, il a fallu consentir<br />
ici un allongement de l’âge des cotisations, là une diminution des<br />
prestations ; des mesures présentées comme des nécessités inéluctables,<br />
en raison de la politique des caisses vides. Celle-ci a encore permis de<br />
mettre sur pied des programmes d’économie budgétaire désormais récurrents<br />
qui ont touché de plein fouet la fonction publique et contribué<br />
à supprimer des pans entiers du service public.<br />
A l’échelon fédéral, cette politique des caisses vides a aussi permis de<br />
légitimer les privatisations et libéralisations accomplies durant cette période.<br />
Au fur et à mesure des politiques d’austérité, le postulat selon lequel<br />
l’Etat serait moins efficace que ›le marché‹ est devenu une évidence.<br />
Logique, donc que l’Etat s’engage dans une série de privatisations,<br />
présentées par ailleurs comme des ›recettes miracles‹ capables d’augmenter<br />
les revenus fédéraux, de diminuer les charges de la Confédéra-<br />
178 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
179 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Fiscalité<br />
tion et de créer de l’emploi. Or, cette politique a en fait conduit à un vaste<br />
mécanisme de privatisation des profits (par exemple de ceux des télécommunications)<br />
et de socialisation des pertes (celles du service postal<br />
universel, par exemple, naguère précisément couvertes par les profits<br />
dégagés par le secteur télécommunications des PTT). Cette politique a<br />
contribué à la disparition de plusieurs centaines d’emplois en Suisse – et<br />
a en fin de compte elle aussi profité d’abord aux plus aisés. 9<br />
En outre, les caisses de pensions des régies privatisées ont dû être renflouées<br />
par la Confédération. Cette charge a ainsi gonflé les voiles de<br />
ceux qui exigeaient des allègements budgétaires au nom de la croissance<br />
des déficits – et qui se trouvaient bien souvent parmi les plus ardents défenseurs<br />
des privatisations en question.<br />
Les conséquences de la politique des caisses vides:<br />
croissance des inégalités sociales<br />
Résumons : Sous la pression des caisses vides, la politique pratiquée en<br />
matière de finances publiques depuis le début des années 1980 a permis<br />
d’obtenir une redistribution de la charge fiscale en direction des salariés<br />
et des couches les moins favorisées de la population et de contenir les<br />
dépenses sociales dans un contexte de crise économique. Cette politique<br />
a par ailleurs facilité un remodelage en profondeur des tâches de l’Etat,<br />
obtenu via des programmes d’allègements budgétaires ou des privatisations.<br />
En fait, sous le poids de la crise, des politiques d’austérité et des<br />
reports de charges accomplis en direction des salarié-e-s, les salaires disponibles<br />
n’ont pratiquement pas augmenté durant la dernière décennie<br />
en Suisse. 10 Cette décennie perdue pour les salarié-e-s a contribué à bloquer<br />
toute reprise de la consommation et a en fin de compte probablement<br />
accentué la crise économique.<br />
Pourtant, la crise n’a pas appauvri tout le monde. Plusieurs indices concordants<br />
montrent, au contraire, que du côté des plus riches les quinze<br />
dernières années ont été des années plutôt fastes. Selon une étude réalisée<br />
par le bureau Ecoplan à la demande de l’Administration fédérale<br />
des contributions et livrée en juin 2004, si les 25% des ménages les plus<br />
pauvres, ont vu leur ›revenu disponible« (c’est à dire leur revenu brut,<br />
moins cotisations sociales obligatoires, moins les impôts et les loyers) diminuer<br />
de 10 à 15% entre 1990 et 1998, les 10% des ménages les plus riches,<br />
au contraire ont vu leur ›revenu disponible‹ progresser de 12% durant<br />
la même période, et afficher sur la période 1990–2001 une croissance<br />
annuelle moyenne de 0.7% par an. 11 Encore convient-il de signaler<br />
que le découpage adopté ici n’est pas des plus fins. Pour les personnes<br />
détentrices de très hauts revenus (le 1% des plus riches), chez qui les
Fiscalité<br />
revenus sont constitués pour une part importante, ou très importante (de<br />
l’ordre de 30 ou 40%, voire plus…) de revenus de la fortune, la croissance<br />
des revenus a probablement été supérieure encore durant la période<br />
considérée. Mais des indications récentes relatives à l’évolution de<br />
la fortune en Suisse manquent pour le vérifier.<br />
Une enquête réalisée par le service de statistique de l’Etat de Vaud et<br />
publiée en juin 2004 montre cependant que le nombre de millionnaires<br />
vaudois a doublé entre 1991 et 2001 12 . Par ailleurs, elle précise qu’entre<br />
1981 et 2001 la fortune brute déclarée dans ce canton (la fraude reste très<br />
difficile à estimer) a été multipliée par 2 en francs constants, c’est à dire<br />
en tenant compte de l’érosion monétaire, pour atteindre 126 milliards<br />
de francs. Cette étude montre elle aussi des inégalités criantes: alors qu’une<br />
moitié des contribuables vaudois se partagent moins de 2% de ces 126<br />
milliards, 3200 contribuables (1% de l’ensemble) en détiennent le tiers.<br />
Et ça continue ! Jusqu’à quand ?<br />
La gauche helvétique saura-t-elle s’opposer enfin à cette politique financière<br />
qui sert de moteur aux sévères contre-réformes sociales récentes<br />
et développe une réelle fiscalité de classe ? Pour l’instant, cette politique<br />
anti-sociale se poursuit. Le paquet fiscal rejeté en votation populaire<br />
en juin 2004 était directement bâti selon le principe de la politique<br />
des caisses vides. Il offrait en effet de vastes rabais fiscaux aux nantis, par<br />
exemple par la suppression de la valeur locative consentie aux propriétaires.<br />
Pire encore, ce paquet si bien ficelé prévoyait l’introduction<br />
d’une possibilité de déduire des sommes affectées à l’entretien des propriétés<br />
dont la valeur locative était précisément fixée à zéro. En d’autres<br />
termes, ce paquet mal ficelé permettait aux propriétaires immobiliers<br />
d’obtenir des déductions fiscales pour l’entretien de biens dont la valeur<br />
fiscale était nulle!<br />
Le rejet du paquet fiscal le 16 mai 2004 aurait pu passer pour un démenti<br />
flagrant de la politique des caisses vides et on aurait pu s’attendre<br />
à un coup d’arrêt des politiques visant à creuser les déficits par le biais<br />
des exemptions fiscales. La droite bourgeoise ne l’a cependant pas entendu<br />
ainsi et elle a repris de plus belle, au mépris du verdict des urnes,<br />
sa politique de démantèlement fiscal, en optant, cette fois, pour la tactique<br />
du salami, consistant à présenter ses réformes fiscales en plus petites<br />
tranches. L’ancrage dans le droit ordinaire des allègements sur les<br />
droits de timbre consentis par voie urgente depuis 1999 qui figurait dans<br />
le paquet refusé en 2004 a été ainsi réintroduit isolément cette année.<br />
Un référendum lancé par la gauche romande contre cette décision n’a<br />
pas été soutenu par le Parti socialiste suisse (PSS) et a échoué avec à<br />
180 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
181 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Fiscalité<br />
peine 25’000 signatures au début du mois de juillet. La perte pour les<br />
caisses fédérales sera de 310 millions de francs qui profiteront une fois<br />
de plus aux actionnaires et aux banques.<br />
Quant à la prochaine réforme de l’imposition des entreprises (RIE II)<br />
déjà annoncée, 13 elle s’inscrit elle aussi dans une logique visant à pratiquer<br />
des cadeaux fiscaux aux plus riches. Théoriquement, les bénéfices<br />
des entreprises sont imposés en Suisse à la fois comme bénéfices auprès<br />
de l’entreprise et, lorsqu’ils sont distribués aux actionnaires, comme<br />
revenus des capitaux. Dans les faits, il existe plusieurs façons – légales<br />
pour certaines, moins pour d’autres – de contourner cette ›double<br />
imposition«. Il suffit par exemple aux dirigeants d’une entreprise désireux<br />
d’éviter celle-ci, plutôt que de distribuer des bénéfices réalisés, de<br />
les réinvestir dans leur entreprise. La valeur de leurs actions s’élèvera<br />
alors, permettant de récupérer les bénéfices réalisés sans avoir d’impôt<br />
à acquitter. 14 Prenant prétexte de cette double imposition théorique, la<br />
RIE II prévoit donc de libérer partiellement les dividendes de l’imposition.<br />
Prix estimé de ce cadeau fiscal aux actionnaires? 500 millions de<br />
francs par an. Autant en moins dans les caisses de l’Etat. Pourtant, comme<br />
le Conseil fédéral le souligne dès l’introduction de son message, différentes<br />
études »ont montré que l’imposition des entreprises pratiquée<br />
en Suisse, au niveau fédéral comme au niveau cantonal, est plus avantageuse<br />
que celle pratiquée par d’autres pays, les taux d’imposition marginaux<br />
effectifs pour l’impôt sur le bénéfice étant bien plus faibles que<br />
ceux de l’Allemagne ou de la France par exemple«. 15<br />
La politique des caisses vides se poursuit également au niveau des finances<br />
cantonales. Dans le canton de Fribourg, de grosses discussions<br />
sont en cours au sujet du budget de l’an 2006. En cause, les trois exercices<br />
comptables positifs de ces dernières années qui ont rempli les caisses<br />
cantonales. Il n’en a pas fallu plus pour que les députés cantonaux<br />
bourgeois déposent six interventions parlementaires (!) exigeant des<br />
baisses fiscales. Comme le rappelle le journal ›Le Temps‹ (27.05.2005),<br />
la fiscalité fribourgeoise a pourtant déjà été allégée ces dernières années.<br />
En 2002 l’impôt sur les personnes physiques avait déjà été abaissé de 3%<br />
et celui sur les entreprises de 25%. Le chef du groupe démocrate-chrétien<br />
Jean-Louis Romanens considère l’impôt cantonal comme trop lourd<br />
et demande par conséquent une diminution proportionnelle de celui-ci<br />
de 5%. Une telle mesure, précisons-le, arrangerait évidemment beaucoup<br />
les plus aisés, qui, du fait de la progressivité des impôts directs, se<br />
retrouveraient avec des rabais fiscaux de plusieurs milliers de francs,<br />
alors que les plus pauvres n’auraient que quelques dizaines de francs en<br />
plus à la fin de l’année.
Fiscalité<br />
Une politique fiscale alternative est possible<br />
Pourtant une politique financière alternative serait praticable. Elle consisterait<br />
d’abord à obtenir une harmonisation des impôts cantonaux sur<br />
le revenu et la fortune, de façon à limiter étroitement les différences<br />
d’imposition entre cantons, à empêcher ainsi la concurrence fiscale et<br />
l’émigration fiscale qui permet aux plus fortunés – contrairement aux salariés<br />
– de choisir comme lieu d’imposition celui qui leur est le plus favorable.<br />
Elle passerait ensuite notamment par l’introduction de déductions<br />
forfaitaires pour les enfants – et non croissantes en fonction du revenu.<br />
Il s’agirait ensuite d’inaugurer une lutte sérieuse contre la fraude<br />
fiscale et contre l’évasion fiscale profitant d’abord aux nantis des pays<br />
étrangers. Par ailleurs, il s’agirait de développer rapidement – et avec<br />
toutes les forces de la gauche européenne – des mesures légales permettant<br />
au fisc de saisir les bénéfices immenses qui sont aujourd’hui réalisés<br />
à partir de mouvements financiers spéculatifs. En outre, l’abolition<br />
récente de la plupart des impôts sur les successions ou les donations en<br />
ligne directe ouvre la voie à l’instauration d’un impôt fédéral sur les successions,<br />
dont il est d’ailleurs question depuis près d’un siècle.<br />
Références<br />
1 Archives fédérales à Berne, E 6300 (B) 1970/124, Bd. 11, PV de la Commission du Conseil<br />
des Etats pour la baisse des impôts, 07.11.1955 à Berne, 25.<br />
2 Sébastien Guex, ›L’argent de l’Etat. Parcours des finances publiques au vingtième siècle‹.<br />
Lausanne 1998.<br />
3 Une étude de l’institut économique Créa de l’Université de Lausanne réalisée pour le<br />
compte de l’Etat de Vaud en 2005 affirmait ainsi qu’une étude rétrospective de la politique<br />
fiscale vaudoise »contredi[t] la théorie qui prône que les allègements fiscaux stimulent<br />
entre autres la consommation privée et entraîner[ait] une augmentation des recettes fiscales<br />
par la suite«.<br />
4 DFF, ›Evolution de la charge fiscale en Suisse de 1970 à 2000‹. Rapport du Conseil fédéral<br />
en réponse au postulat Vallender du 14 décembre 1998 (98.3576), 38.<br />
5 Guex, op. cit., 82f.<br />
6 WoZ, 02.06.2005, 3.<br />
7 DFF, ›Evolution de la charge fiscale en Suisse de 1970 à 2000‹. Rapport du Conseil fédéral<br />
en réponse au postulat Vallender du 14 décembre 1998 (98.3576), 58.<br />
8 Numerus, No. 3, 2002.<br />
9 Voir à ce sujet la contribution d’Yves Steiner et de Philipp Müller, dans cet ouvrage.<br />
10 ›Pages de gauche‹ no. 19, janvier 2004.<br />
11 Voir à ce sujet la contribution d’André Mach, dans cet ouvrage.<br />
12 Numerus, No. 3, 2004.<br />
13 La RIE I, lancée en 1998, avait – entre autres – considérablement allégé l’imposition des<br />
sociétés holdings. Elle avait coût 450 mios de francs par an à la confédération.<br />
14 Il n’existe pas, en Suisse, d’impôt sur les gains en capital.<br />
15 MCF 22.06.2005 (version provisoire).<br />
182 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Die Unternehmenssteuerreform<br />
Steuergeschenke für Aktionäre und Mindereinnahmen<br />
für Bund, Kantone und Gemeinden<br />
Einleitung<br />
Der Bundesrat hat am 22. Juni 2005 die Botschaft zum so genannten Unternehmenssteuerreformgesetz<br />
II verabschiedet. Darin schlägt er den<br />
eidgenössischen Räten ein Bündel von Massnahmen vor, welche auf<br />
Stufe Unternehmer und auf Stufe Unternehmen zu einer steuerlichen<br />
Entlastung führen sollen. Dieses Gesetz ist aber tatsächlich kein Gesetz<br />
zur Reform der Besteuerung der Unternehmen, sondern zur Entlastung<br />
der Aktionäre. Es ist auch kein Gesetz zur Entlastung von so genannten<br />
›Business Angels‹, die jungen, innovativen Gesellschaften Kapital zur<br />
Verfügung stellen. Diese Vorlage entlastet schlicht alle Aktionäre nach<br />
dem Giesskannenprinzip.<br />
Nach Schweizer Recht wird eine Aktiengesellschaft <strong>als</strong> eingeständige<br />
Person mit Rechten und Pflichten angesehen. Daraus wird gefolgert,<br />
dass ein Gewinn sowohl bei der Gesellschaft <strong>als</strong> auch im Umfang seiner<br />
Ausschüttung beim Aktionariat zu besteuern ist. <strong>Das</strong> Bundesgericht hat<br />
in einer über hundertjährigen, konstanten Rechtsprechung diese zweifache<br />
Besteuerung <strong>als</strong> mit der Verfassung im Einklang angesehen. Zu beachten<br />
ist hier, dass in der Schweiz Kapitalgewinne im Privatvermögen<br />
nicht besteuert werden und die Vermögenssteuer relativ bescheiden ist.<br />
Die betroffenen Wirtschaftsteilnehmer können zudem die Wahl der<br />
Rechtsform ihres Unternehmens an die steuerlichen Gegebenheiten anpassen.<br />
Unter Umständen ist nämlich ein Personenunternehmen für ein<br />
kleines Unternehmen viel sinnvoller <strong>als</strong> eine Aktiengesellschaft. Aus<br />
diesem Grund hatte ein Aktionär die Dividende bislang in seiner Steuererklärung<br />
<strong>als</strong> Einkommen zu versteuern. Nach dem Willen des Bundesrates<br />
soll dies für die Bundessteuern nur noch im Umfang von 80% erfolgen,<br />
wenn die Aktien <strong>als</strong> Privatvermögen gelten. Sind sie im Geschäftsvermögen<br />
verbucht, müssen die Dividenden nur noch zu 60% versteuert<br />
werden. Wohlhabende Investoren werden somit besser behandelt <strong>als</strong><br />
Arbeiterinnen oder Rentner, die nur über ein Arbeitseinkommen oder<br />
eine Rente verfügen. Die steuerlichen Auswirkungen können leicht an<br />
zwei Beispielen aufgezeigt werden:<br />
Bruno Fässler<br />
1962, Dr. iur. und Rechtsanwalt, arbeitet Beispiel 1<br />
beim Steueramt der Stadt Zürich <strong>als</strong> Leiter Peter Meier hat ein Einkommen<br />
des Rechtsdienstes.<br />
von Fr. 300’000.— <strong>als</strong> Direktor der<br />
183 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Fiscalité
Fiscalité<br />
Bank AG. Er besitzt Aktien im Wert von 5 Mio. Franken, die Dividenden<br />
von Fr. 100’000.– abwerfen. Diese 100’000.– muss er nur noch zu<br />
80% versteuern und somit Fr. 80’000.– in seine Steuererklärung eintragen.<br />
Er spart <strong>als</strong>o Fr. 5’200.– Bundessteuern, und falls sein Wohnsitzkanton<br />
die gleiche Regelung einführt, nochm<strong>als</strong> Fr. 5’000.– Kantons- und<br />
Gemeindesteuern. Zusammen beträgt seine Steuerersparnis über Fr.<br />
10’000.–.<br />
Beispiel 2<br />
Fritz Huber ist selbständig und arbeitet <strong>als</strong> Unternehmensberater. Er hat<br />
Aktien im Wert von 5 Mio. Franken in seinem Geschäftsvermögen. Die<br />
Dividenden von Fr. 100’000.– hat er nur noch zu 60% zu versteuern. Er<br />
kann somit bis zu Fr. 20’000.– an Steuern sparen, wenn es nach dem Willen<br />
des Bundesrates geht.<br />
An der Steuerfreiheit der privaten Kapitalgewinne will der Bundesrat<br />
selbstverständlich festhalten. Verkauft zum Beispiel Peter Meier nach 5<br />
Jahren seine Aktien zu einem Preis von 6 Mio., so bleibt der Gewinn von<br />
1 Million weiterhin steuerfrei.<br />
Auswirkungen auf die Haushalte von Bund und Kantone<br />
Der Gesetzesentwurf sieht auch eine Revision des Steuerharmonisierungsgesetzes<br />
vor, das <strong>als</strong> Rahmengesetz die Steuergesetze der Kantone<br />
einigermassen vereinheitlichen sollte. Die Vorschläge des Bundesrates<br />
werden aber, so sie vom Parlament übernommen werden, im Gegenteil<br />
zu einem verschärften Steuerwettbewerb unter den Kantonen führen. Es<br />
ist nämlich geplant, dass die Kantone bei der Entlastung der Investoren<br />
frei sein sollen. Hier bedarf es wohl keiner grossen hellseherischen<br />
Fähigkeiten, um das künftige Feilschen der Steueroasen in der Innerschweiz<br />
um das günstigste ›Investitionsklima‹ vorherzusehen. <strong>Das</strong> Buhlen<br />
um die Reichen und Superreichen wird weiter gehen. Die Steuerausfälle<br />
haben die anderen zu tragen.<br />
Diese Steuerausfälle für die Kantone werden vom Bundesrat wohlweislich<br />
nicht beziffert. Sie können auch nicht beziffert werden, solange<br />
die Kantone keine eigenen Regelungen treffen.<br />
Da der Bundesrat selber davon ausgeht, dass die Kantone die 80%-Besteuerung<br />
unterbieten werden, ist mit massiven Steuerausfällen zu rechnen.<br />
In der Vernehmlassungsvorlage wurden diese auf über 700 Mio.<br />
Franken pro Jahr für die Kantone und Gemeinden geschätzt. Da in der<br />
damaligen Vorlage bedeutend weniger weit gehende Abzugsmöglichkeiten<br />
vorgesehen waren <strong>als</strong> in der Botschaft, ist mit der heute zur Dis-<br />
184 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
kussion stehenden Variante mit Ausfällen von 800 Mio. bis gegen einer<br />
Milliarde Franken jährlich für die Kantone und Gemeinden zur rechnen.<br />
Dies entspricht immerhin etwa einem Prozent des gesamten Haushaltes<br />
der Kantone und Gemeinden in der Schweiz. Für den Bund werden<br />
kurzfristige Mindererträge von rund 40 Mio. Franken berechnet. Der<br />
Bundesrat spekuliert zudem, dass sich langfristig Mehrerträge für den<br />
Bund von Fr. 55 Mio. ergeben sollen. Hier ist wohl eher der Wunsch der<br />
Vater des Gedankens. Eine volkswirtschaftlich überzeugende Begründung<br />
lässt sich in der Botschaft nicht finden.<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Vorlage den Steuerwettbewerb<br />
unter den Kantonen noch mehr anheizen wird und zu massiven<br />
Steuereinbussen führen wird. Angesichts der angespannten Finanzlage<br />
der meisten Kantone dürfte dies den Spardruck wesentlich erhöhen und<br />
mittelfristig zu Steuererhöhungen von ca. 2 Steuerprozenten führen, welche<br />
wiederum von allen Steuerzahlenden getragen werden müssten.<br />
Forcierte Gewinnausschüttung und Sozialwerke<br />
Der Bundesrat führt in seiner Botschaft aus, dass bei gewissen Firmen<br />
(vor allem Publikumsaktiengesellschaften, aber auch bei KMU) ein<br />
Überinvestitionsproblem bestehe. Er begründet dies damit, dass die<br />
Gesellschaften ihre Gewinne aufgrund der Steuerlast einbehalten. Hier<br />
sei eine forcierte Gewinnausschüttung angezeigt, damit die Mittel über<br />
den Kapitalmarkt profitabel in andere Firmen investiert werden. Diese<br />
Option sei steuerlich aber wenig attraktiv, so dass die Mittel einerseits<br />
in Projekte investiert würden, die aus volkswirtschaftlicher Sicht wenig<br />
rentabel seien. Andererseits werde versucht, den privaten Konsum der<br />
Anteilseigner über die Firma laufen zu lassen. Dem ist entgegen zu halten,<br />
dass bei Publikumsaktiengesellschaften, deren Anteile an der Börse<br />
gehandelt werden, die Entscheidungen über die Gewinnausschüttungen<br />
kaum an die schweizerische Steuergesetzgebung geknüpft werden, da<br />
die Aktionäre aus der ganzen Welt stammen. So sind zum Beispiel nur<br />
25% der eingetragenen Aktien der UBS AG im Besitz von Schweizer<br />
Staatsbürgern.<br />
Im Falle der KMU lässt sich die Gewinnausschüttung heute in der Regel<br />
über den Lohn der beteiligten Personen steuern. Da der Lohn die<br />
Erfolgsrechnung des KMU belastet, schmälert er den steuerbaren Gewinn.<br />
Die wirtschaftliche Doppelbesteuerung entfällt. Hingegen werden<br />
AHV und ALV-Beiträge auf den ausbezahlten Lohn erhoben. Ein weiteres<br />
Beispiel gemäss der geltenden gesetzlichen Ordnung soll die daraus<br />
resultierenden steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen<br />
Folgen aufzeigen:<br />
185 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Fiscalité
Fiscalité<br />
Beispiel 3<br />
Die Hans Muster AG erzielt einen Gewinn von 500’000.–. Peter Muster<br />
erhält <strong>als</strong> Direktor und Mehrheitsaktionär einen Lohn von Fr. 200’000.–<br />
Würde die AG diesen Gewinn ausschütten, fielen im Kanton Zürich<br />
Steuern von rund Fr. 90’000.– an. Peter Muster wiederum würde die Fr.<br />
500’000.- Dividenden zusätzlich zu seinem Lohn versteuern und müsste<br />
<strong>als</strong>o Fr. 183’400.– Steuern bezahlen. Insgesamt würden somit im Kanton<br />
Zürich Steuern von Fr. 273’400.– anfallen.<br />
Erhöht nun die Hans Muster AG den Lohn ihres ›Mitarbeiters‹ auf<br />
700’000.–, so entfallen die Fr. 90’000.– an Gewinnsteuern. An Sozialversicherungsbeiträgen<br />
fallen zudem Fr. 60’000.– an. Muster spart folglich<br />
Fr. 30’000.–.<br />
Als Folge einer ›forcierten Gewinnausschüttung‹ wäre mit massiven<br />
Mindereinnahmen bei den Sozialversicherungswerken (AHV, ALV,<br />
EO) zur rechnen. Der Bundesrat führt denn auch selber aus, dass bei<br />
einer gesamtschweizerischen Teilbesteuerung der Dividenden von nur<br />
noch 70% die Finanzierung der AHV gefährdet wäre. Aus verfassungsrechtlichen<br />
Gründen kann jedoch den Kantonen bei der Tarifgestaltung<br />
kein Rahmen vorgeschrieben werden. Da diese die Folgen einer Unterfinanzierung<br />
der AHV nicht direkt zu tragen haben, ist zu befürchten,<br />
dass dieses Argument in den kantonalen Parlamenten keine grosse<br />
Rolle spielen und die Steuerschraube munter nach unten gedreht wird.<br />
Dies alles unter dem Deckmantel des Steuerwettbewerbs. Bei der AHV<br />
könnte das zu einem bösen Erwachen führen.<br />
Reformansätze<br />
<strong>Das</strong> eigentliche Problem der wirtschaftlichen Doppelbelastung liegt darin,<br />
dass die Rechtsform der Aktiengesellschaft eigentlich nicht für die<br />
KMU gedacht ist. Der ursprüngliche Gedanke der Aktiengesellschaft<br />
war derjenige der Demokratisierung des Kapit<strong>als</strong>. Viele (kleine) Leute<br />
sollten Anteile an einer Gesellschaft erwerben, die mit dem zur Verfügung<br />
gestellten Kapital in der Folge grosse Projekte verwirklichen kann.<br />
Gedacht wurde hier beispielsweise an den Bau von Eisenbahnlinien<br />
oder Kraftwerken. Die grossen Gesellschaften sollten Abbild des demokratischen<br />
Staates sein, mit einer Generalversammlung, die – ähnlich<br />
einer Landsgemeinde – die Verwaltung wählt und die Rechnung abnimmt.<br />
Die Wirklichkeit sieht heute anders aus. So genannte Einmann-<br />
AGs und kleine Familien-AGs dominieren die schweizerische Aktienlandschaft.<br />
Einige Grosskonzerne werden zudem von wenigen Personen<br />
beherrscht (z.B. Roche, Holcim, Sereno). Anstatt über das Steuerrecht<br />
186 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
die Finanzierungsstrukturen der Aktiengesellschaften zu verändern,<br />
wäre es sinnvoller, die Mindestkapitalisierung so zu erhöhen, dass nur<br />
noch Grossunternehmen diese Rechtsform wählen können. Gleichzeitig<br />
müsste eine Höchstbeteiligungsquote eingeführt werden, welche die<br />
Beherrschung durch wenige Personen ausschliessen würde. Kleinere<br />
Unternehmen würden dann <strong>als</strong> Einzelunternehmen oder Personengesellschaften<br />
geführt, mittlere Unternehmen <strong>als</strong> GmbH und nur die grössten<br />
<strong>als</strong> Aktiengesellschaften.<br />
Rückblick auf den Kanton Zürich und Ausblick<br />
Es ist schliesslich noch darauf hinzuweisen, dass am 1. Januar 2005 eine<br />
vom Zürcher Kantonsrat beschlossene Änderung des Steuergesetzes in<br />
Kraft trat, welche die Unternehmen steuerlich massiv entlastet. Der<br />
Steuersatz wurde vom vorherigen Dreistufentarif auf einheitlich 8% des<br />
Reingewinnes festgelegt. Die Kapit<strong>als</strong>teuer wurde gleich halbiert. Im Ergebnis<br />
entsprechen diese Entlastungen einer Reduktion des Steuerfusses<br />
für die Gesellschaften um 20%! Die Folgen im Kanton Zürich sind<br />
Steuerausfälle von über 300 Mio. Franken für Kanton und Gemeinden.<br />
Im Vergleich dazu ist die Diskussion im kantonalen Parlament um eine<br />
allfällige Steuerfusserhöhung von 5% geradezu bescheiden.<br />
Mit der Unternehmenssteuerreform II wird erneut eine schon wohlhabende<br />
Klientel steuerlich und sozialversicherungsrechtlich begünstigt.<br />
Die Steuerausfälle hat aber die gesamte Bevölkerung über eine Erhöhung<br />
der Steuern und Abgaben oder über Kürzungen beim Service<br />
public zu tragen.<br />
Schlussbemerkungen zum Steuerwettbewerb<br />
Im internationalen Umfeld ist die Schweiz bezüglich der Steuerbelastung<br />
mehr <strong>als</strong> nur konkurrenzfähig. Ausser in ein paar Steueroasen wie<br />
Monaco und in neuen EU-Mitgliedsländern (Estland, Slowakei) ist die<br />
Steuerbelastung im gesamten OECD-Raum höher. Dies betrifft vor<br />
allem die grossen Wirtschaftsnationen USA, Deutschland, Frankreich,<br />
Italien. Viele bedeutende Grossfirmen und wohlhabende Europäer<br />
haben in der Vergangenheit ihren (Wohn)-Sitz in die Schweiz verlegt.<br />
Diese Entwicklung wird in der Europäischen Union mit Sorge verfolgt.<br />
Eine weitere Reduktion der Steuerbelastung wäre sowohl im internationalen<br />
wie auch im interkantonalen Kontext schädlich und würde die<br />
Staatsverschuldung noch verstärken.<br />
187 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Fiscalité
Fiscalité<br />
Zur Diskussion<br />
der Staatsverschuldung<br />
Sind Schulden etwas Verwerfliches?<br />
Grosse Teile der Öffentlichkeit betrachten Staatsschulden <strong>als</strong> etwas Verwerfliches.<br />
Wie ein gewissenhafter Familienvater sollte der Staat jeweils<br />
nur so viel ausgeben, wie er einnimmt. Diese Gleichstellung des Staates<br />
mit einem privaten Haushalt ist vernebelnd, denn der Staat ist eben<br />
gerade kein privater Haushalt, und Schulden haben bei ihm eine andere<br />
Bedeutung. Trotzdem soll hier zunächst die einzelwirtschaftliche<br />
Sichtweise eingenommen werden, weil sich zeigt, dass die Auffassung,<br />
Schulden seien etwas Schlechtes, nicht einmal für private Haushalte<br />
oder Unternehmen ökonomisch rational ist.<br />
Stellen Sie sich vor, Ihre Wohnung oder Ihr Haus brennt aus und Sie<br />
haben keine Versicherung. Würden Sie dann in den Trümmern leben,<br />
bis Sie genügend Geld gespart hätten, um die Renovation zu bezahlen?<br />
Oder sie könnten eine Ausbildung machen, mit der Sie nachher eine<br />
besser bezahlte Stelle kriegen. Würden Sie darauf verzichten, weil das<br />
Geld im Moment nicht reicht, oder würden Sie während der Ausbildung<br />
nur noch von Wasser und Brot leben und am Waldrand campieren?<br />
Wahrscheinlich nicht. Es gibt Situationen, in denen es für private Haushalte<br />
Sinn macht, sich zu verschulden. Dann nämlich, wenn der Nutzen<br />
aus einer jetzt getätigten Ausgabe die höheren Kosten aufgrund der Zinsen<br />
rechtfertigt. Dies kann schon in weniger gewichtigen Situationen wie<br />
dem Kauf eines Autos oder einer Stereoanlage der Fall sein. Und wenn<br />
die privaten Unternehmen sich nicht am Kapitalmarkt verschulden würden,<br />
hätten wir wirtschaftlich noch mittelalterliche Zustände.<br />
Es gibt <strong>als</strong>o in einer einzelwirtschaftlichen Optik gute Gründe, die<br />
dafür sprechen, Ausgaben über eine Neuverschuldung zu finanzieren:<br />
• Zum Ausgleichen von kurzfristigen Einnahmen- und Ausgabenschwankungen,<br />
damit sich die normale Lebenshaltung stetig entwickeln<br />
kann.<br />
• Wenn der Nutzenvorteil aus einer<br />
gegenwärtigen Konsumausga-<br />
Andres Frick<br />
be die Zinskosten aufwiegt.<br />
1947, Studium der Volkswirtschaftslehre in<br />
• Bei Investitionen ist eine Finan- Zürich und Bristol (UK), wissenschaftlicher<br />
zierung über Kredite besonders Mitarbeiter an der Konjunkturforschungs-<br />
angezeigt. In diesem Fall kommt stelle (KOF) der ETH Zürich; Forschungs-<br />
es nicht zu einer Verschlechterung schwerpunkte: Öffentliche Finanzen, Kon-<br />
der Vermögenssituation, weil den junktur und Arbeitsmarkt.<br />
188 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Schulden Vermögenswerte beziehungsweise den Zinsen und Amortisationen<br />
Erträge gegenüberstehen. Voraussetzung ist, dass der Wert der<br />
Investitionen (in Form zukünftiger Erträge) deren Kosten inklusive Zinsen<br />
aufwiegt. Zur Beurteilung der Vermögenssituation sollte <strong>als</strong>o stets die<br />
Nettoschuldenposition (<strong>als</strong>o Schulden unter Berücksichtigung der Vermögenswerte)<br />
betrachtet werden.<br />
Die Kreditfinanzierung von Ausgaben bedeutet bei Privaten einen<br />
zeitlichen Vorbezug zukünftiger Einkommen, womit der gegenwärtige<br />
Handlungsspielraum erhöht werden kann. Gleichzeitig wird der zukünftige<br />
Handlungsspielraum durch Zinszahlungen und Rückzahlungen der<br />
Schulden eingeschränkt. Der Entscheid, sich zu verschulden, sollte das<br />
Ergebnis eines rationalen Abwägens zwischen dem Nutzen einer im<br />
jetzigen Zeitpunkt getätigten Ausgabe und den in Zukunft anfallenden<br />
Kosten sein. Die Grenze der Verschuldungsmöglichkeit wird dabei<br />
durch das zukünftige Einkommen und die Höhe des Zinssatzes bestimmt,<br />
wobei das zukünftige Einkommen mit einer Investition erhöht<br />
werden kann.<br />
Die besondere Rolle der Staatsverschuldung<br />
<strong>Das</strong> Motiv der Glättung von Einnahmen- und Ausgabenschwankungen<br />
kann auch beim Staat <strong>als</strong> Begründung für eine Neuverschuldung 1 angeführt<br />
werden. Nehmen wir das Beispiel Einnahmenschwankungen: Bei<br />
einem Zwang zum Budgetausgleich müssten entweder die Ausgaben<br />
diesen Schwankungen angepasst oder die Steuersätze entsprechend<br />
variiert werden. Beides wäre mit Anpassungskosten beim Staat wie auch<br />
bei den privaten Wirtschaftsakteuren verbunden. Eine Kreditfinanzierung<br />
ermöglicht in diesem Fall die Verstetigung der Ausgabenentwicklung<br />
und der Steuerbelastung. (Auf einen wichtigen Grund für Einnahmenschwankungen<br />
– die Konjunkturentwicklung – soll weiter unten<br />
eingegangen werden.) Ähnliches gilt im Fall von ausserordentlichen<br />
Ausgaben. Dies betrifft vor allem grosse Investitionen, aber auch Situationen,<br />
in denen es zu ausserordentlichen laufenden Ausgaben kommt<br />
(zum Beispiel Naturkatastrophen). Die Alternativen, die Steuern zu<br />
erhöhen respektive die übrigen Ausgaben entsprechend zu kürzen, sind<br />
häufig kurzfristig nicht machbar und/oder werden nicht <strong>als</strong> sinnvoll<br />
erachtet.<br />
In zwei wesentlichen Punkten unterscheidet sich aber der Staat von<br />
einem privaten Haushalt oder Unternehmen:<br />
1. Er verdient sein Geld nicht selber, sondern beschafft es sich bei den<br />
Steuerzahlern, egal ob er Steuern erhebt oder Schulden macht. 2<br />
2. Der Staat übt mit seinen Ausgaben und Einnahmen einen bedeuten-<br />
189 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Fiscalité
Fiscalité<br />
den Einfluss auf die konjunkturelle Entwicklung aus und sollte diesen<br />
in einem stabilisierenden Sinne geltend machen.<br />
Die Konsequenz des ersten Punkts ist, dass sich die Steuerzahler sozusagen<br />
bei sich selbst verschulden, wenn der Staat Schulden macht. Für<br />
die zukünftigen Zinszahlungen, auf die sie <strong>als</strong> Eigentümer der Staatspapiere<br />
Anspruch haben, müssen die Steuerzahler selbst aufkommen. Der<br />
Staat wird <strong>als</strong>o nicht ›ärmer‹, wenn er Schulden macht, genauso wenig<br />
wie die Privaten dadurch ›reicher‹ werden. Wenn die Rede davon ist,<br />
dass eine Regierung ›Schuldenberge‹ hinterlässt, bleibt anzufügen, dass<br />
diesen gleich hohe ›Vermögensberge‹ in Form von Staatsobligationen im<br />
Besitz der Privaten gegenüberstehen. Finanziell betrachtet kommt es<br />
auch nicht zu einer Verlagerung von Lasten auf zukünftige Generationen.<br />
Der Transfer finanzieller Mittel von den Privaten zum Staat findet<br />
im Zeitpunkt der Verschuldung statt – so wie wenn Steuern erhoben<br />
worden wären. In den folgenden Perioden gleichen sich die Zahlungsströme<br />
zwischen Staat und Steuerzahlern aus. 3<br />
Nicht die eigene finanzielle Haushaltsituation des Staates (im Sinne<br />
einer ›Kässelimentalität‹) ist entscheidend für die Beurteilung der Staatsverschuldung,<br />
sondern die Auswirkungen, die der staatliche Finanzhaushalt<br />
auf die Gesamtwirtschaft hat. Dabei stellt sich die Frage, ob es<br />
überhaupt einen Unterschied macht, ob Staatsausgaben über Steuern<br />
oder über Kredite finanziert werden. Um diese Frage beantworten zu<br />
können, müssen die realwirtschaftlichen Auswirkungen der unterschiedlichen<br />
Finanzierungsformen auf das Verhalten der privaten Wirtschaftsakteure<br />
in die Betrachtung einbezogen werden.<br />
Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft<br />
Was die realen Auswirkungen der Kreditfinanzierung auf die Gesamtwirtschaft<br />
anbetrifft, sind die Meinungen in der wirtschaftswissenschaftlichen<br />
Literatur kontrovers. Dies geht allem auf unterschiedliche Verhaltensannahmen<br />
für die privaten Wirtschaftsakteure zurück. Eine<br />
prominente These – das Ricardianische Äquivalenztheorem – besagt,<br />
dass es gar keine Rolle spiele, ob sich der Staat über Steuern oder über<br />
Kredite finanziere. Die Argumentation lautet, dass sich die Steuerzahler<br />
bei einer Erhöhung der Staatsschuld auf die in Zukunft höhere<br />
Steuerbelastung einstellen, die zur Bedienung der Staatsschuld nötig ist.<br />
Entsprechend sparen sie mehr und kaufen mit den Ersparnissen die<br />
Anleihen, die der Staat herausgibt. Unter dem Strich hat sich nichts<br />
verändert.<br />
Diese These dürfte in dieser strengen Form in der Praxis kaum zutreffen.<br />
Die Annahme eines vollständig kompensierenden Verhaltens<br />
190 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
der privaten Akteure hat sich empirisch nicht belegen lassen, so dass<br />
durchaus mit unterschiedlichen Wirkungen von Schulden oder Steuern<br />
auf die Gesamtwirtschaft gerechnet werden kann. Diese können sowohl<br />
die Wirtschaftslage in der kurzen Frist (Konjunktur) <strong>als</strong> auch das Wirtschaftswachstum<br />
betreffen.<br />
Wenn davon ausgegangen wird, dass die privaten Akteure ihre laufenden<br />
Ausgaben nicht im Ausmass der staatlichen Neuverschuldung<br />
einschränken, sondern die Staatsanleihen aus Ersparnissen finanzieren,<br />
erhöht eine kreditfinanzierte Staatsausgabe die gesamtwirtschaftliche<br />
Nachfrage. Nach dem so genannten Haavelmo-Theorem hat zwar auch<br />
eine steuerfinanzierte Staatsausgabe einen positiven Nachfrageeffekt,<br />
weil die steuerbedingte Einkommensverminderung der Privaten zum<br />
Teil ebenfalls zu Lasten ihrer Ersparnisse geht; nur ist dieser Effekt kleiner.<br />
Was für Konsequenzen eine solche Erhöhung der Gesamtnachfrage<br />
hat, hängt vom konjunkturellen Zustand der Volkswirtschaft ab. Befindet<br />
sich diese in einer Situation von Vollbeschäftigung, kann sich die Zusatznachfrage<br />
des Staates nach realen Gütern nur über eine Verdrängung<br />
(›crowding out‹) von privater Nachfrage durchsetzen. Eine solche erfolgt<br />
entweder, indem es zu Preissteigerungen kommt, so dass für eine gegebene<br />
geldmässige Nachfrage weniger reale Güter erhältlich sind, oder<br />
indem die Kreditaufnahme des Staates zu Zinserhöhungen führt, was die<br />
Investitions- und die Konsumnachfrage (wie beim Ricardianischen<br />
Äquivalenzprinzip) dämpfen kann. Im Endeffekt führt die Staatsverschuldung<br />
<strong>als</strong>o genau gleich zu einer Verminderung der gesamten privaten<br />
Nachfrage, wie wenn der Staat den privaten Akteuren Kaufkraft<br />
mittels Steuererhöhungen entzieht. Allerdings kann das Verhältnis zwischen<br />
privaten Konsum- und Investitionsausgaben unterschiedlich beeinflusst<br />
werden, woraus sich eine andere Wirkung auf das längerfristige<br />
Wirtschaftswachstum ergibt. Führt eine höhere Staatsverschuldung<br />
dazu, dass vor allem die private Investitionsnachfrage zurückgedrängt<br />
wird, wird das längerfristige Wirtschaftswachstum negativ beeinflusst.<br />
Nur in diesem Fall findet eine ›Belastung zukünftiger Generationen‹<br />
durch Staatsverschuldung statt. Ansonsten führt auch eine kreditfinanzierte<br />
Staatsausgabe zum Verbrauch heutiger Ressourcen; diese lassen<br />
sich ebenso wenig von der Zukunft in die Gegenwart verschieben, wie<br />
es unmöglich ist, durch heutigen Verzicht (Sparen) Ressourcen von der<br />
Gegenwart in die Zukunft zu transferieren. 4 Der Effekt eines negativen<br />
Einflusses auf die privaten Investitionen kann aber kompensiert werden,<br />
wenn der Zweck der Staatsverschuldung staatliche Investitionen sind.<br />
Ob eine Staatsverschuldung zu einer Verringerung der Investitionen<br />
191 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Fiscalité
Fiscalité<br />
relativ zu den Konsumausgaben führt, hängt zudem – neben der Art<br />
der staatlichen Ausgabe – vom Steuersystem und den Reaktionen des<br />
Konsum- beziehungsweise Investitionsverhaltens auf die Steuerbelastung,<br />
die Höhe des Zinssatzes und auf Preissteigerungen ab, so dass sich<br />
keine allgemeine Aussage darüber machen lässt.<br />
Anders präsentiert sich die Situation, wenn die Wirtschaft in einer Rezession<br />
ist. Eine solche ist, nach üblichem keynesianischen Verständnis,<br />
durch eine unzureichende gesamtwirtschaftliche Nachfrage, <strong>als</strong>o durch<br />
ein Zuviel an Sparen gekennzeichnet (siehe Kasten). Mit einer kreditfinanzierten<br />
Ausgabe kann der Staat dem in einer Rezession herrschenden<br />
allgemeinen Sparüberschuss entgegenwirken und über seine Mehrausgaben<br />
eine Erhöhung von Produktion und Beschäftigung bewirken.<br />
Die zusätzliche staatliche Nachfrage lässt sich über eine höhere Auslastung<br />
der Produktionskapazitäten realisieren. Sie führt somit nicht zur<br />
Verdrängung privater Nachfrage, sondern regt diese im Gegenteil über<br />
den Einkommenseffekt der höheren Wirtschaftsaktivität noch an. Aus<br />
diesem Grund ist es nicht nur unbedenklich, sondern aus volkswirtschaftlicher<br />
Sicht sogar angezeigt, dass der Staat in einer Rezession Defizite<br />
macht, <strong>als</strong>o seine Schulden erhöht. Strebt er stattdessen angesichts<br />
des konjunkturbedingten Einnahmenrückgangs mittels Ausgabenreduktionen<br />
oder Steuererhöhungen ein ausgeglichenes Budget an, schwächt<br />
er damit die gesamtwirtschaftliche Nachfrage weiter. Als Gegenstück zu<br />
Defiziten in einer Rezession sollte der Staat in Zeiten konjunktureller<br />
Überhitzung Überschüsse machen, seine Schulden <strong>als</strong>o reduzieren.<br />
In den letzten Jahren haben einige Autoren auf die Möglichkeit hingewiesen,<br />
dass indirekte Effekte – namentlich auf die Erwartungen der<br />
Wirtschaftsakteure – nicht-keynesianische Wirkungen haben können,<br />
womit eine Reduktion von Staatsdefizit und Staatsschulden einen positiven<br />
Einfluss auf das Wirtschaftswachstum hätte. Solche Effekte sind allerdings<br />
an bestimmte Voraussetzungen gebunden (z.B. Vertrauensverlust<br />
der Finanzmärkte in die Bonität des Staates, Vorliegen einer Lohn-<br />
Preis-Spirale usw.), die eher <strong>als</strong> Ausnahmeerscheinungen gelten können.<br />
Politökonomische Überlegungen<br />
Auch wenn – in einer Situation der Vollbeschäftigung – eine Staatsverschuldung<br />
zur Verdrängung von Investitionen führt, könnte dies einem<br />
rationalen gesellschaftlichen Entscheid entsprechen, den gegenwärtigen<br />
Konsum höher zu bewerten <strong>als</strong> den zukünftigen. Allerdings stellen sich<br />
hier zwei Probleme: Ein erstes besteht darin, dass die Wirtschaftsakteure<br />
möglicherweise unter so genannten ›Finanzierungsillusionen‹ leiden,<br />
indem sie sich der vollen Kosten einer kreditfinanzierten staatlichen<br />
192 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Ausgabe nicht bewusst sind. <strong>Das</strong> zweite besteht darin, dass die zukünftigen<br />
Generationen von Konsumenten an den heutigen Entscheiden<br />
nicht beteiligt sind. Es müssen deshalb die Argumente der politischen<br />
Ökonomie, die auf den Zusammenhang zwischen Staatsverschuldung<br />
und dem Abstimmungsverhalten der Entscheidungsträger abzielen,<br />
berücksichtigt werden. Wenn die Wirtschaftsakteure kurzsichtig<br />
und/oder den zukünftigen Generationen gegenüber gleichgültig sind,<br />
können zwei mögliche Arten von Fehlentscheidungen (Politikversagen)<br />
vorkommen:<br />
• Zum einen besteht das Risiko, dass die Wirtschaftsakteure den gegenwärtigen<br />
Konsum aus einer längerfristigen Perspektive, <strong>als</strong>o unter<br />
Berücksichtigung auch der Interessen zukünftiger Generationen, zu<br />
hoch bewerten und somit ›auf Kosten‹ der Zukunft leben wollen. Dies<br />
hätte zur Konsequenz, dass ein höheres Niveau laufender Staatsausgaben<br />
beschlossen wird, <strong>als</strong> volkswirtschaftlich optimal ist (Politikversagen<br />
1).<br />
• Umgekehrt muss damit gerechnet werden, dass laufende Konsumausgaben<br />
gegenüber öffentlichen Investitionen vorgezogen werden.<br />
Somit besteht bei einer Finanzierung der öffentlichen Investitionen aus<br />
laufenden Steuereinnahmen die Gefahr, dass gemessen an den längerfristigen<br />
Erfordernissen zuwenig in die öffentliche Infrastruktur investiert<br />
wird (Politikversagen 2).<br />
Inwiefern diese theoretischen Risiken von praktischer Relevanz sind,<br />
müsste empirisch untersucht werden. Ein Indiz für das Vorliegen von<br />
193 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Fiscalité<br />
Sparen und Investieren<br />
Für eine Privatperson kann es aus Vorsichtsgründen sinnvoll sein, ein finanzielles<br />
Polster für unvorhergesehene Notsituationen zu bilden. Für eine<br />
Volkswirtschaft trifft dies nicht zu, sondern Einkommen und Ausgaben<br />
sollten ausgeglichen sein. Die Ersparnisse, das heisst die Einkommensteile,<br />
die nicht in den laufenden Konsum fliessen, müssen gänzlich für Investitionsausgaben<br />
verwendet werden. Ist dies nicht der Fall, dann ist die Nachfrage<br />
zu klein, um die ganze Produktion abzusetzen. In der Folge geht die<br />
Produktion zurück, was zu einer Abnahme der Beschäftigung und der Einkommen<br />
führt. Im Endeffekt führt so der Versuch, mehr zu sparen, <strong>als</strong><br />
volkswirtschaftlich notwendig ist, zu geringen Einkommen und geringeren<br />
Ersparnissen. Diese auf Keynes zurückgehende Erkenntnis, dass zu hohe<br />
Ersparnisse der Einzelpersonen in der Summe kontraproduktiv sind, führt<br />
zur Folgerung, dass der Staat in einer Rezession den Sparüberschuss der<br />
Privaten mit Defiziten auffangen muss, um Vollbeschäftigung zu gewährleisten.
Fiscalité<br />
Politikversagen 1 wäre eine systematische Zunahme des Defizits in der<br />
laufenden Rechnung, während eine systematische Unterversorgung im<br />
Bereich der öffentlichen Infrastruktur Indiz für das Vorliegen von Politikversagen<br />
2 wäre.<br />
Verschuldung gegenüber dem Ausland<br />
Wird, statt von einer geschlossenen, von einer gegenüber aussen offenen<br />
Volkswirtschaft – wie es die Schweiz in hohem Masse ist – ausgegangen,<br />
ergeben sich Modifikationen der bis jetzt gemachten Überlegungen, da<br />
sich die Möglichkeit der Verschuldung gegenüber dem Ausland ergibt.<br />
Dabei ist unerheblich, ob die Staatstitel von Ausländern erworben werden<br />
oder von Inländern, die stattdessen ihre Auslandanlagen verringern;<br />
massgebend ist auch hier wieder die gesamtwirtschaftliche Sicht,<br />
<strong>als</strong>o die Verschuldung der Volkswirtschaft gegenüber dem Ausland.<br />
Zwei Aspekte sind von Bedeutung, wenn die staatliche Neuverschuldung<br />
die Auslandschuld erhöht respektive die Nettovermögensposition<br />
gegenüber dem Ausland verringert:<br />
1. In diesem Fall kommt es tatsächlich zu einer zeitlichen Verlagerung<br />
der finanziellen Belastung in die Zukunft. Die an das Ausland zu leistenden<br />
Zinszahlungen vermindern in den Folgejahren das verfügbare<br />
Einkommen im Inland.<br />
2. Bezüglich der realwirtschaftlichen Auswirkungen verringert eine<br />
höhere Auslandverschuldung die Verdrängung (›crowding out‹) von privater<br />
inländischer Nachfrage. Der Effekt der höheren Nachfrage auf die<br />
inländische Produktion wird aber durch höhere Importe ebenfalls verringert.<br />
Per Saldo muss mit einer Abschwächung des konjunkturellen<br />
Stimulierungseffekts der Staatsverschuldung gerechnet werden.<br />
Je höher der Grad der Verflechtung mit dem geografischen Umfeld ist,<br />
umso eher besteht die Gefahr der Belastung zukünftiger Generationen<br />
von Steuerzahlern – wobei dies nicht nur im biografischen Sinne zu verstehen,<br />
sondern auch durch Zu- und Abwanderung bedingt ist – und umso<br />
geringer sind die konjunkturellen Effekte im eigenen Gebiet. Die<br />
Staatsverschuldung hat <strong>als</strong>o beispielsweise in einer kleinen Gemeinde einen<br />
anderen Stellenwert <strong>als</strong> auf der Ebene des Nation<strong>als</strong>taats, und ihre<br />
Verschuldungsbedingungen nähern sich denen eines einzelwirtschaftlichen<br />
Akteurs an (Privathaushalt bzw. privates Unternehmen).<br />
Kurz- versus längerfristige Optik<br />
Als Zwischenbilanz lässt sich festhalten, dass es sinnvoll erscheint, wenn<br />
sich der Staat nicht nur zur Glättung von Sondereinflüssen bei seinen<br />
194 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Einnahmen und Ausgaben, sondern insbesondere zum Ausgleich von<br />
Konjunktureinbrüchen kurzfristig verschuldet. Wenn sich die Phasen<br />
konjunktureller Unter- und Überauslastung im Zeitablauf aufwiegen,<br />
sprechen aber beide Argumente für einen Ausgleich des Staatshaushalts<br />
– und somit für einen konstanten Schuldenstand – in der längeren<br />
Frist.<br />
Von Bedeutung für die Beurteilung einer längerfristigen Erhöhung der<br />
Staatsschulden ist zudem, ob dadurch eine intertemporale Lastenverschiebung<br />
(Belastung zukünftiger Generationen) stattfindet oder nicht.<br />
Wie erwähnt, ist dies nur unter bestimmten Voraussetzungen überhaupt<br />
der Fall (Erhöhung der Auslandverschuldung, Verdrängung von privaten<br />
Investitionen). Sind diese gegeben und besteht das Risiko eines<br />
Vorliegens von Finanzierungsillusion respektive der unzureichenden<br />
Berücksichtigung der Interessen zukünftiger Generationen (Politikversagen<br />
1), spricht dies dafür, Defizite in der laufenden Rechnung in der<br />
mehrjährigen Frist zu vermeiden. Anders formuliert: Im Interesse der<br />
Transparenz hinsichtlich der effektiven Kosten der laufenden staatlichen<br />
Tätigkeit erscheint es sinnvoll, diese im Prinzip mit laufenden Einnahmen<br />
zu finanzieren. Bei den staatlichen Investitionen ist die Situation<br />
anders, da auch die zukünftigen Generationen von diesen profitieren,<br />
sofern sie rentabel sind. 5 Liegt das Risiko einer Unterversorgung mit<br />
öffentlichen Investitionen vor (Politikversagen 2), spricht dies erst recht<br />
für eine Kreditfinanzierung von Staatsinvestitionen. Werden das konjunkturpolitische<br />
Argument, das für einen längerfristigen Budgetausgleich<br />
spricht, und die Argumente für eine Kreditfinanzierung der Investitionen<br />
kombiniert, impliziert dies, dass in der laufenden Rechnung<br />
längerfristig ein Überschuss zu erzielen wäre.<br />
Nun ist aber keineswegs zwingend, dass sich der effektive Konjunkturverlauf<br />
symmetrisch um einen Vollbeschäftigungspfad bewegt, wie<br />
dies beispielsweise bei der Schuldenbremse des Bundes vorausgesetzt<br />
wird. Überwiegen die Rezessionsphasen über die Phasen der Überhitzung,<br />
ist aus konjunkturpolitischer Sicht auch längerfristig eine Zunahme<br />
der Staatsverschuldung angesagt, um der privaten Nachfrageschwäche<br />
entgegenzuwirken.<br />
Grenzen der Staatsverschuldung<br />
Nachdem nun Überlegungen zur staatlichen Neuverschuldung gemacht<br />
worden sind, die der Beurteilung ihrer Vor- und Nachteile dienen sollen,<br />
stellt sich die Frage nach den Grenzen des absoluten Niveaus der<br />
Staatsverschuldung.<br />
Wie erwähnt, unterscheidet sich der Staat von einem privaten Haus-<br />
195 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Fiscalité
Fiscalité<br />
halt, indem er über die Erhebung von Zwangsabgaben (Steuern usw.) auf<br />
das Einkommen der gesamten Volkswirtschaft zurückgreifen kann, die<br />
somit für die Staatsschulden bürgt. Aus diesem Grund ist nicht die absolute<br />
Höhe der Staatsschulden, sondern ihre Relation zur gesamtwirtschaftlichen<br />
Wertschöpfung, <strong>als</strong>o dem Bruttoinlandprodukt (BIP), ein<br />
relevanter Indikator. 6 Zudem ist, wie ebenfalls erwähnt, eine Nettobetrachtung<br />
angezeigt, wobei die Bewertung des Staatsvermögens allerdings<br />
einige Probleme aufwirft. 7<br />
Da der Staat keine begrenzte Lebensdauer hat, besteht für ihn in der<br />
Regel kein Zwang, seine Schulden zurückzuzahlen. Durch Umschuldungen<br />
kann er die Laufzeit seiner Verpflichtungen jeweils verlängern.<br />
Er muss somit lediglich in der Lage sein, die Zinsen zu bedienen. Eine<br />
ultimative Grenze der Staatsverschuldung, der Staatsbankrott, wird erreicht,<br />
wenn er dazu nicht mehr in der Lage ist; dann sind die privaten<br />
Akteure auch nicht mehr bereit, ihre Kredite an den Staat zu erneuern.<br />
Verschuldet sich der Staat ausschliesslich im Inland, gibt es dafür aber<br />
keine logisch zwingende Obergrenze. Wie oben ausgeführt, fliessen die<br />
Zinszahlungen ja <strong>als</strong> Einkommen in den privaten Sektor zurück.<br />
Grundsätzlich können die Zinsen der Staatsschuld auch jeweils mit<br />
neuen Schulden finanziert werden. Dieses, nach einem amerikanischen<br />
Financier <strong>als</strong> ›Ponzi-Spiel‹ bezeichnete Vorgehen ist vor allem dann<br />
unproblematisch, wenn der Zinssatz auf den Staatstiteln der Wachstumsrate<br />
des nominellen BIP entspricht. 8 In einem solchen Fall wächst<br />
der Schuldenstand mit gleicher Rate wie das BIP, die Schuldenquote<br />
bleibt somit konstant. Ist der Zinssatz dagegen höher <strong>als</strong> das BIP-Wachstum,<br />
kommt es bei einer Kreditfinanzierung des Zinsendienstes zu einer<br />
Schuldenspirale: Der Schuldenstand nimmt in Relation zum BIP immer<br />
mehr zu. Da es sich dabei um ein Nullsummenspiel handelt, die neuen<br />
Kredite <strong>als</strong>o immer gleich in den privaten Sektor zurückfliessen, ändert<br />
sich für diesen real gesehen zwar eigentlich nichts. <strong>Das</strong> Gleiche gilt,<br />
wenn der Zinsendienst über Steuererhöhungen finanziert wird. Trotzdem<br />
kann die Bereitschaft der privaten Akteure, einen immer höheren<br />
Anteil ihrer Einkommen in Form von Krediten oder Steuern an den<br />
Staat abzuliefern, irgendwann an Grenzen stossen.<br />
Dies ist insbesondere bei einer Verschuldung gegenüber dem Ausland<br />
der Fall. Die Zinszahlungen stellen dann effektiv eine Einschränkung des<br />
verfügbaren Einkommens in den Folgejahren dar, und das Vertrauen<br />
der Kreditgeber in die Bonität des Staates <strong>als</strong> Schuldner nimmt mit steigender<br />
Verschuldungsquote ab. 9 Dabei können für die Zukunft absehbare<br />
zusätzliche Belastungen, wie sie sich beispielsweise aus der Entwicklung<br />
in der Altersvorsorge abzeichnen, den Verschuldungsspiel-<br />
196 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
aum zusätzlich einschränken. Als zusätzliche Restriktion kommt eine<br />
ausreichende Verfügbarkeit von ausländischen Devisen hinzu. Dies<br />
hängt letztlich von der Exportfähigkeit eines Landes ab und kann vor<br />
allem für Entwicklungsländer zum Problem werden.<br />
Wo genau die Verschuldungsgrenze liegt, lässt sich theoretisch nicht<br />
bestimmen, sondern ist eine empirische Frage. Die Gefahr des Staatskonkurses<br />
kann für Industrieländer praktisch ausgeschlossen werden;<br />
wie die Gemeinde Leukerbad vorexerziert hat, ist das Problem der<br />
Zahlungsunfähigkeit auf der lokalen Ebene aber nicht auszuschliessen.<br />
Relevanter sind die Konsequenzen bezüglich einer sinkenden Kreditbereitschaft<br />
beziehungsweise der zukünftigen Steuerbelastung. Eine<br />
sinkende Bereitschaft, neue Kredite zu gewähren, äussert sich zunächst<br />
einmal darin, dass die Kreditgeber eine höhere Risikoprämie verlangen,<br />
der Zinssatz <strong>als</strong>o steigt; damit wird der Verschuldungsspielraum weiter<br />
eingeengt. Bei den Steuern kommen die Grenzen einerseits auf der politischen<br />
Ebene, anderseits <strong>als</strong> zunehmende Steuerwiderstände in Form<br />
von Steuervermeidung oder sogar –hinterziehung zum Ausdruck. 10<br />
Eine quantitative Obergrenze für die Staatschuld anzugeben, ist <strong>als</strong>o<br />
nicht einfach. Die wirtschaftswissenschaftliche Literatur enthält sich diesbezüglich<br />
einer Empfehlung. Festgestellt wird – trivialerweise – lediglich,<br />
dass die Staatsverschuldung dann nachhaltig ist (<strong>als</strong>o nicht zu einer<br />
Schuldenspirale führt), wenn die Quote zum BIP konstant gehalten<br />
wird. Auf welchem Niveau der Schuldenquote dies geschehen soll,<br />
bleibt dabei unbestimmt; eine Angabe dazu wäre allenfalls aufgrund<br />
einer detaillierten empirischen Abklärung möglich.<br />
Staatsverschuldung in der Schweiz<br />
In der Schweiz hat sich die Bruttoschuldenquote (<strong>als</strong>o ohne Berücksichtigung<br />
der den Schulden gegenüberstehenden Vermögenswerte) zwischen<br />
1990 und 2003 von 30% auf 56% deutlich erhöht. Auch Mitte der<br />
1970er-Jahre war es zu einer markanten Erhöhung gekommen, die<br />
danach aber wieder mehr <strong>als</strong> kompensiert wurde. Der jüngste Anstieg<br />
fiel jedoch noch kräftiger aus. Wesentlich dazu beigetragen haben die<br />
über Jahre schwache Konjunkturentwicklung und die über der Wachstumsrate<br />
des BIP liegenden Zinssätze. Trotzdem liegt der Wert der<br />
Schweiz noch im unteren Mittelfeld der OECD-Länder, und die Schuldengrenze<br />
von 60%, die der Maastricht-Vertrag für die Mitglieder des<br />
Euroraumes vorschreibt, ist nicht erreicht.<br />
Eine Berechnung der Nettoschuldenquote ist für den Staat insgesamt<br />
nicht möglich; dazu fehlen die Angaben der Gemeinden. Schon die Daten<br />
für den Bund und die Kantone zeigen aber, dass die Nettoschulden<br />
197 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Fiscalité
Fiscalité<br />
deutlich niedriger liegen <strong>als</strong> die Bruttoschulden; bei den Gemeinden<br />
dürfte dies noch verstärkt der Fall sein. Einen weiteren Hinweis gibt ein<br />
Vergleich zwischen Passivzinsen und Vermögenserträgen, für den auch<br />
Daten der Gemeinden verfügbar sind. Es zeigt sich, dass die Vermögenserträge<br />
seit Beginn der 1990er-Jahre jeweils 70% oder mehr der Passivzinsen<br />
abdeckten.<br />
Den Schulden des Staates stehen ausserdem Vermögenswerte der Pensionskassen<br />
gegenüber, die 2003 einen Stand von 108% des BIP erreicht<br />
haben. Und das Nettovermögen im Ausland erreichte gar einen Stand<br />
von 135% des BIP. Darin kommt ein seit Jahren anhaltender Sparüberschuss<br />
der Schweizer Volkswirtschaft zum Ausdruck. Die Vermutung ist<br />
nahe liegend, dass die seit Jahren dümpelnde Konjunktur in der Schweiz<br />
auch darauf zurückzuführen ist. Für die Behauptung, die Staatsschulden<br />
seien in der Schweiz bedenklich hoch, gibt es <strong>als</strong>o keine Anzeichen. Im<br />
Gegenteil: Angesichts des Sparüberschusses des privaten Sektors scheint<br />
eher eine stärkere staatliche Neuverschuldung angezeigt.<br />
Dem wird entgegengehalten, dass zukünftige Belastungen namentlich<br />
bei der Altersvorsorge ein noch stärkeres Sparen bedingen würden. Wie<br />
schon verschiedentlich erwähnt, führt aber ein rein geldmässiges Sparen<br />
volkswirtschaftlich gesehen nicht zu einer materiellen Verbesserung<br />
in der Zukunft. Wenn den Ersparnissen keine rentablen Investitionen<br />
gegenüberstehen, verschlechtern Sparen und Schuldenabbau lediglich<br />
die Situation der gegenwärtigen Generation, ohne diejenige der zukünftigen<br />
zu verbessern. Da die privaten Unternehmen offensichtlich nicht<br />
genügend im Inland investieren, um das bereits bestehende Sparvolumen<br />
zu absorbieren, müsste der Staat mittels Defiziten die mangelnde<br />
Nachfrage stützen. Wenn er dabei seine Investitionen in die öffentliche<br />
Infrastruktur verstärkt, profitieren davon auch die zukünftigen Generationen.<br />
Abschliessende Thesen<br />
Eine Verteufelung von Staatsschulden ist nicht rational. Um beurteilen<br />
zu können, ob der Staat Schulden abbauen sollte oder nicht, sind die damit<br />
verbundenen volkswirtschaftlichen Wirkungen zu berücksichtigen.<br />
Zwei Aspekte stehen dabei im Vordergrund: Die Wohlstandsverteilung<br />
zwischen den Generationen und die konjunkturelle Situation.<br />
Eine Besserstellung zukünftiger Generationen durch Konsumverzicht<br />
in der Gegenwart ist – falls überhaupt erwünscht – nur möglich, wenn<br />
damit das Niveau rentabler Investitionen erhöht wird. Andernfalls ergibt<br />
sich ein gegenteiliger Effekt, indem die geringere Güternachfrage<br />
das Wirtschaftswachstum schwächt.<br />
198 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Ist die Wirtschaft schon in einer Situation der Unterauslastung, verschlechtert<br />
ein Abbau der Staatsschulden in der Regel die Situation. Der<br />
Staat sollte dann mittels einer antizyklischen Defizitpolitik die Nachfrage<br />
stützen, <strong>als</strong>o seine Schulden erhöhen. Dies kommt nicht nur dann den<br />
zukünftigen Generationen ebenfalls zugute, wenn der Staat vorwiegend<br />
seine Investitionstätigkeit verstärkt, sondern auch, indem die konjunkturelle<br />
Stimulierung die private Investitionstätigkeit anregt.<br />
Bei den untergeordneten Gebietskörperschaften der Kantone und<br />
Gemeinden sind die Verschuldungsmöglichkeiten eingeschränkter <strong>als</strong><br />
beim Bund und der Einfluss auf die Konjunktur geringer. Da sie aber<br />
zwei Drittel der gesamten Staatsausgaben tätigen, sollten sie sich ebenfalls<br />
konjunkturgerecht verhalten. Um dies zu erreichen, ist wahrscheinlich<br />
eine koordinierende und motivierende Rolle des Bundes<br />
nötig. Ein Beispiel dafür ist das 1997 beschlossene Investitionsprogramm.<br />
Massnahmen dieser Art sollten zum Standardinstrumentarium<br />
der Konjunkturpolitik gehören.<br />
<strong>Das</strong> Niveau der Staatsverschuldung ist in der Schweiz keineswegs<br />
bedenklich hoch. Angesichts des chronischen Sparüberschusses der<br />
Schweizer Wirtschaft erscheint sogar eine höhere Verschuldung angezeigt.<br />
Würde es gelingen, damit die Wachstumsdynamik des privaten<br />
Sektors zu verstärken, liessen sich auch die zukünftigen Belastungen,<br />
zum Beispiel durch die Altersvorsorge, besser verkraften.<br />
Wenn Panikmache bezüglich der Staatsverschuldung keine faktische<br />
Grundlage hat, stellt sich die Frage, was damit beabsichtigt werden soll.<br />
Plausibel erscheint die Vermutung, dass mit dem populistischen Argument<br />
der ›Schuldenwirtschaft‹ ein anderes Ziel anvisiert wird, nämlich<br />
die Senkung der Staatsquote. Dies zu fordern, ist nicht illegitim, verlangt<br />
aber nach einer anderen Diskussion über die Vor- und Nachteile der<br />
Staatstätigkeit. Aus konjunkturpolitischer Sicht ist jedoch zu bedenken,<br />
dass angesichts des gegenwärtig nur schwachen Wirtschaftswachstums<br />
der Zeitpunkt dafür nicht günstig ist.<br />
199 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Fiscalité
Fiscalité<br />
Anmerkungen<br />
1 Unter Neuverschuldung ist eine Zunahme des Schuldenbestandes zu verstehen; sie entspricht<br />
in der Regel dem Defizit (Überschuss der Ausgaben über die Einnahmen) in der<br />
Staatsrechnung.<br />
2 Zur Vereinfachung der Diskussion wird zunächst von einer geschlossenen Volkswirtschaft<br />
ausgegangen; Transaktionen mit dem Ausland werden <strong>als</strong>o vernachlässigt. Eine<br />
Lockerung dieser Annahme erfolgt weiter unten. Auf die Diskussion der dritten (theoretischen)<br />
Möglichkeit der Finanzierung von Staatsausgaben, der Geldschöpfung, wird<br />
hier, auch weil sie aus rechtlich-institutionellen Gründen nicht praktizierbar ist, ebenfalls<br />
verzichtet.<br />
3 Auf allfällige interpersonelle Verteilungswirkungen, die dadurch entstehen, dass Staatstitel<br />
von den ›Reichen‹ gehalten, Steuern aber auch bei den ›Armen‹ erhoben werden,<br />
wird hier nicht näher eingegangen. Diese Frage müsste im Rahmen einer Gesamtschau<br />
der Verteilungswirkungen des Steuersystems und der Staatsausgaben diskutiert werden.<br />
4 Letztere intergenerationelle Verteilungsillusion ist vor allem für die Diskussion der Pensionskassen-Problematik<br />
von Bedeutung.<br />
5 In der Praxis ist die Feststellung der Rentabilität öffentlicher Investitionen nicht einfach,<br />
da die Erträge (z.B. von Schulhäusern oder Verkehrswegen) in der Regel nicht <strong>als</strong> Geldbeträge<br />
direkt an den Staat fliessen. Der Investitionsbegriff lässt sich auch nicht auf das<br />
beschränken, was in der staatlichen Rechnung <strong>als</strong> solches verbucht wird. So werden<br />
beispielsweise Bildungsausgaben in der laufenden Rechnung verbucht, obschon von<br />
diesen ein positiver Effekt auf das Wirtschaftswachstum zu vermuten ist.<br />
6 Streng genommen müssten die Staatsschulden in Relation zum Brutto-Nationaleinkommen<br />
(BNE), das neben der Wertschöpfung im Inland noch die Nettoeinkommen aus<br />
dem Ausland enthält, gesetzt werden. Internationale Vergleiche, z.B. der OECD, stellen<br />
aber traditionellerweise auf das BIP ab. Für die meisten Länder macht dies keinen grossen<br />
Unterschied, da die Differenz zwischen dem BIP und dem BNE gering ist. In der<br />
Schweiz liegt das BNE dagegen um gut 5% über dem BIP.<br />
7 Eine realistische Beurteilung der Verschuldungssituation setzt z.B. voraus, dass die Vermögenswerte<br />
des Staates nicht in einem finanzkonservativen Sinne zu niedrig bewertet<br />
sind.<br />
8 Für einen Privaten geht dieses Spiel natürlich auf die Dauer nicht auf, weshalb Ponzi auch<br />
<strong>als</strong> Finanzjongleur bezeichnet wird.<br />
9 Diese Argumente gelten analog für kleine Gebietskörperschaften wie z.B. eine Gemeinde,<br />
da deren Schuldtitel überwiegend durch Gebietsfremde gehalten werden.<br />
10 Eine Form der Steuervermeidung, die Abwanderung an einen steuergünstigeren Standort,<br />
ist umso wahrscheinlicher, je kleiner das betreffende Gebiet ist. Eine Gemeinde steht<br />
deshalb in einem stärkeren Steuerwettbewerb <strong>als</strong> der Nation<strong>als</strong>taat; zum Steuerwettbewerb<br />
gehört aber nicht nur die Höhe der Steuersätze, sondern auch der Umfang und<br />
die Qualität der dafür gebotenen staatlichen Leistungen.<br />
200 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Wie wirken Ideologien?<br />
Die Magie der Denkfiguren<br />
Jeder politisch interessierte Mensch ist damit konfrontiert, dass der<br />
politische Diskurs durchdrungen ist von ›Ideologie‹, von meinungsbildenden<br />
Leitideen und Ideenclustern. Diese Durchdringung ist so umfassend,<br />
dass auch das Trennen der Fakten von ihrer Interpretation nur<br />
beschränkt gelingt. Bereits die Auswahl und Darstellung der Fakten ist<br />
unweigerlich von den Vorkenntnissen, den Sichtweisen und den Interessen<br />
des Auswählenden geprägt. Niemand kann sich dieser Durchdringung<br />
entziehen: Wer es versucht, wird früher oder später verwirrt<br />
feststellen, dass sich auch in seine Darstellungen laufend Bewertungen<br />
einschleichen.<br />
Offensichtlich benötigen wir Orientierung, Zugehörigkeiten, Standpunkte,<br />
damit wir uns in gesellschaftlichen Zusammenhängen bewegen<br />
können. Unwillkürlich suchen wir dabei auch nach einem Mindestmass<br />
an Kohärenz. Wir brauchen Ideen-Sets, ›Ideologie‹. Deshalb ist eine kritische<br />
Auseinandersetzung mit diesen Ideensets für die politische Arbeit<br />
von grosser Bedeutung. Im folgenden Essay beschäftige ich mich mit einem<br />
zentralen Baustein ideologischer Einflussnahme, den ich Denkfigur<br />
nenne. <strong>Das</strong> Wort Denkfigur ist in den letzten Jahren zunehmend in den<br />
Sprachgebrauch eingegangen. Ich verwende es in einem spezifischen<br />
Sinn, den ich noch erläutern werde.<br />
Der Text entstand aus der eigenen politischen Praxis heraus, aus der<br />
täglichen Konfrontation mit ideologisch geprägten Argumenten. Sein<br />
Anliegen ist es, mit Hilfe des Denkfigur-Begriffes Struktur und Wirkungsweise<br />
ideologischer Muster herauszuarbeiten. Dadurch soll ein<br />
bewussterer und kritischer Umgang mit ideologisch geprägten Argumentationsweisen<br />
erleichtert werden, auch in der Selbstreflexion, <strong>als</strong>o<br />
in der Auseinandersetzung mit den eigenen Argumentationsmustern.<br />
Der Klarheit halber möchte ich anmerken, dass sich der Text nicht mit<br />
den gesellschaftlichen Hintergründen der Ideologiebildung beschäftigt.<br />
Beat Ringger<br />
1955, Zentr<strong>als</strong>ekretär vpod und geschäftsleitender<br />
Sekretär des <strong>Denknetz</strong>es. Interessensschwerpunkte:<br />
Gesundheits- und<br />
Sozialpolitik, politische Ökonomie, Psychologie<br />
und Fragen der Ideologiebildung.<br />
201 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Denken<br />
Was ist eine Denkfigur?<br />
Denkfiguren haben eine Wirkungskraft,<br />
die sich einer oberflächlichen<br />
Betrachtung gerne entzieht.<br />
Deshalb spreche ich im Titel<br />
von der Magie der Denkfiguren.<br />
Beginnen wir mit dem Beispiel ei-
Denken<br />
ner Denkfigur, die in der gegenwärtigen politischen Diskussion häufig<br />
angeführt wird und mit dem Begriff Reformstau umschrieben wird.<br />
Die Denkfigur besitzt einen generischen Kern, das heisst einen Kern, der<br />
sich auf ganz unterschiedliche Kontexte übertragen lässt. Er lautet: Jedes<br />
lebende System kennt Phasen erlahmender Vitalität. Die Aussenwelt<br />
verändert sich, während die inneren Strukturen des Systems gleich bleiben<br />
und nun nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprechen.<br />
Zudem lässt sich der Elan, der sich in Phasen des Aufbruchs und des<br />
Wachstums eines Systems einstellt, nicht beliebig aufrecht erhalten. Die<br />
überkommenen Strukturen müssen nun überwunden oder angepasst<br />
werden, um die Vitalität des Systems zu sichern.<br />
Diese Denkfigur lässt sich auf das System Gesellschaft übertragen.<br />
Wahlweise sind es dann die Globalisierung, die demographische Entwicklung,<br />
das Fortschreiten der Technologien oder die wachsende Entfaltung<br />
der Produktivkräfte, die einen äusseren Anpassungsdruck auf die<br />
gesellschaftlichen Strukturen ausüben. Die überkommenen Strukturen<br />
müssen nun überwunden werden, damit eine Gesundung der wirtschaftlichen<br />
und gesellschaftlichen Kräfte möglich ist. Dabei müssen<br />
träge, konservative Kräfte überwunden, Privilegien und Gewohnheiten<br />
in Frage gestellt werden, und dabei werden einige Bevölkerungsschichten<br />
vorübergehend auf der Verliererseite stehen.<br />
Während Jahrzehnten war es in aller Regel die politische Linke, die<br />
für eine Überwindung von unsozialen, repressiven und unökologischen<br />
gesellschaftlichen Verhältnissen eintrat und in der Öffentlichkeit <strong>als</strong><br />
gesellschaftsverändernde Kraft wahrgenommen worden ist. So wurde<br />
die oben angeführte Denkfigur von der systemkritischen Linken etwa<br />
wie folgt ins Feld geführt: Der Kapitalismus ist die Struktur, die es zu<br />
überwinden gilt, weil er zu unlösbaren Widersprüchen mit den Bedürfnissen<br />
der Menschen und mit den ökologischen Gegebenheiten führt.<br />
Dabei wird die kapitalistische Klasse, deren Macht auf dem Eigentum<br />
an den Produktionsmitteln gründet, auf der Verliererseite stehen,<br />
während die grosse Bevölkerungsmehrheit an Einfluss und Lebensqualität<br />
gewinnt.<br />
Die Figur wird jedoch in letzter Zeit weit häufiger von der politischen<br />
Rechten ins Feld geführt. Soziale Errungenschaften und Regulierungen<br />
des Arbeitsmarktes werden <strong>als</strong> Teil eines trägen Systems dargestellt, in<br />
dem die verschiedenen Bevölkerungsgruppen nur noch die eigenen<br />
Pfründe und Privilegien verteidigen und so eine <strong>als</strong> notwendig erachtete<br />
Erneuerung verhindern; ein Phänomen, an dem insbesondere die Länder<br />
Westeuropas kranken (›Eurosklerose‹). Eine Dynamisierung der<br />
Wirtschaft kann jedoch nur gelingen, wenn die überkommenen Struk-<br />
202 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
turen aufgebrochen werden. Im Wort Reformstau hat die Figur in neuester<br />
Zeit einen einprägsamen begrifflichen Anker erhalten.<br />
An diesem Beispiel lassen sich die Eigenheiten von Denkfiguren gut<br />
nachvollziehen:<br />
1. Eine Denkfigur ist ein Ensemble von Aussagen, die ein argumentatives<br />
Ganzes bilden.<br />
2. Denkfiguren stützen sich auf einen argumentativen Kern, der ein<br />
generisches, vielfach zu beobachtendes Wirkungsgefüge beschreibt. Dadurch<br />
erhalten sie argumentative Geschlossenheit und Überzeugungskraft.<br />
3. Dieser Kern lässt sich aus der Figur herauslösen und ist selbst auch<br />
noch keiner Ideologie verschrieben. Erst durch die Anbindung an bestimmte,<br />
nicht zu hinterfragende Axiome oder Werthaltungen (z.B. »Es<br />
gibt keine Alternative zur Globalisierung und zur zunehmenden Standortkonkurrenz«)<br />
erfolgt die Ideologisierung. Diese wird in der Regel<br />
abgesichert durch eine entsprechende Wahl der Begriffe, die mit einer<br />
impliziten Wertung einhergehen (z.B. Reformstau; wer steht schon gern<br />
im Stau?)<br />
4. Der Wirkungszusammenhang wird in einer Weise ausgedrückt, der<br />
sich einfach, aber nicht zu einfach nachvollziehen lässt und deshalb im<br />
Nachvollziehenden ein ›Denkerlebnis‹ auslöst. Denkfiguren werden nicht<br />
einfach geglaubt, sondern nachgedacht – und gewinnen dadurch wesentlich<br />
an Kraft und Plausibilität.<br />
Denkfiguren lösen beim Nachdenkenden <strong>als</strong>o die Empfindung einer<br />
eigenständigen intellektuellen Leistung aus, mit der er sich in der Folge<br />
einfacher identifizieren kann und die ihm Überzeugtheit verleiht. Der<br />
allgemeingültige Argumentationskern einer Denkfigur vermittelt die<br />
Empfindung einer Stimmigkeit, die sich an Beispielen überprüfen lässt.<br />
Dadurch heben sich Denkfiguren deutlich von reinen Behauptungen<br />
oder Deklamationen ab, und darauf beruht ein wesentlicher Teil ihrer<br />
Wirkung.<br />
Deshalb sind Denkfiguren besonders geeignet, gesellschaftliche Orientierung<br />
und politischen Halt zu vermitteln. Dieser Halt wird verstärkt,<br />
wenn die einzelne Denkfigur eingebettet ist in ein ganzes Set von<br />
kohärenten Denkfiguren, die <strong>als</strong> Ensemble einen wesentlichen Teil einer<br />
Ideologie ausmachen. Politische ExponentInnen können diese Denkfiguren<br />
wie Bausteine in den persönlichen Argumentationsbaukasten<br />
einfügen und bei Bedarf in den politischen Diskurs einfliessen lassen.<br />
Ideologisch geformte Denkfiguren bedienen gesellschaftliche Interessenlagen.<br />
Sie helfen, diese zu rechtfertigen oder mitunter auch zu verschleiern,<br />
indem sie sie <strong>als</strong> im Interesse aller liegend darstellen. Handelt<br />
203 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Denken
Denken<br />
es sich dabei um die Interessenlage sozialer Klassen, dann ist der Boden<br />
für die Ausbildung umfassender Ideologien gegeben. Besonders gut wirkende<br />
Figuren werden unter diesen Voraussetzungen immer und immer<br />
wieder angeführt.<br />
Denkfiguren erzielen dank ihrer Magie auch auf jene Menschen eine<br />
starke Wirkung, deren Interessen sie überhaupt nicht entsprechen. Dies<br />
erklärt zum Teil das Phänomen, das Marx in einem berühmten Diktum<br />
benannt hat: »Die herrschende Ideologie ist die Ideologie der Herrschenden.«<br />
In Anlehnung dazu kann man sagen, die herrschenden<br />
Denkfiguren seien die Denkfiguren der Herrschenden.<br />
<strong>Das</strong> zentrale Anliegen dieses Essays besteht darin, diese Magie der<br />
Denkfiguren, diese den Beobachtern häufig verborgene Wirkung aufzudecken.<br />
<strong>Das</strong> Erkennen dieser Wirkung erleichtert einen adäquaten<br />
und aufklärenden Umgang mit den Figuren.<br />
Neoliberale Denkfiguren<br />
Denkfiguren besitzen konstellierende Kraft: Ähnlich wie Melodien ein<br />
Musikstück zusammenhalten, verleihen sie einer Ideologie Eingängigkeit,<br />
Kohärenz und Überzeugungskraft. Zusammengehalten wird eine<br />
Ideologie von einigen wenigen Leitmelodien, die im politischen Diskurs<br />
situationsgerecht variiert werden.<br />
Im Neoliberalismus sind das die folgenden drei Leit-Denkfiguren:<br />
• Die erste Denkfigur beschwört die Magie des Marktes. Sie verwendet <strong>als</strong><br />
generischen Kern die Mechanismen der Selbstregulation. Der Markt<br />
wird <strong>als</strong> selbstregulierendes System darstellt, das aus eigener Dynamik<br />
die optimale Verteilung der ökonomischen Mittel bewirkt. Die Kunden<br />
wählen sich auf dem freien Markt diejenigen Produkte und Dienste aus,<br />
die das günstigste Preis-Leistungsverhältnis aufweisen. Dadurch werden<br />
jene Unternehmen bevorzugt, die effizient und kundenorientiert produzieren.<br />
Ihnen fliessen die meisten Mittel zu. Damit wird à la longue<br />
optimaler Wohlstand für alle erzeugt.<br />
• Die zweite Figur ist die ›Freiheit oder Sozialismus‹-Figur: Entweder stärkt<br />
man die Freiheit selbstverantwortlicher Akteure auf den ökonomischen<br />
und gesellschaftlichen Märkten, oder man macht diese Bürger zum Objekt<br />
bürokratisch-sozi<strong>als</strong>taatlicher Verwaltung und beraubt sie jeder Eigeninitiative.<br />
Die Märkte sind auch hier ein Segen: Sie wirken auf alle<br />
Marktteilnehmer in gleicher und unparteiischer Weise und sorgen dafür,<br />
dass bürokratische Machtzentren ständig in Bedrängnis geraten.<br />
• Die dritte Figur lautet: Ist die Eigendynamik des Marktes erst einmal<br />
genügend schwungvoll am Werk, dann gibt es für die Marktteilnehmer<br />
keine Alternative mehr zur möglichst radikalen Anpassung an die Anfor-<br />
204 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
derungen eben dieses Marktes. Dies gilt sowohl für Unternehmen <strong>als</strong><br />
auch für ganze Staaten. <strong>Das</strong> ist aber – ein Rückgriff auf die zweite Figur<br />
– kein ›Schaden‹, sondern ein ›Glück‹: Dank der globalisierten Kraft des<br />
Marktes können die staatlich-bürokratischen Machteliten zurückgebunden<br />
werden – das einzig wirksame Mittel, um totalitäre Herrschaftssysteme<br />
à la Stalinismus zu verhindern.<br />
Die ›Freiheit-oder-Sozialismus‹-Denkfigur ist gegenwärtig in den Hintergrund<br />
gerückt. <strong>Das</strong> hat mit dem Niedergang der ›real sozialistischen‹<br />
Regimes des Ostblocks zu tun, und damit, dass die Linken nur noch sehr<br />
zurückhaltend mit Systemalternativen argumentieren. Sobald aber die<br />
Systemdebatte wieder belebt wird, dürfte auch diese Figur wieder an<br />
Bedeutung gewinnen.<br />
Den Denkfiguren nicht erliegen<br />
Wie können wir die Wirkung neoliberaler Denkfiguren im politischen<br />
Diskurs auffangen und gegebenenfalls in ihr Gegenteil kehren?<br />
Weil Denkfiguren eine hohe innere Kohärenz aufweisen, ist eine<br />
blosse Relativierung nutzlos. Durch ein ›Ja-Aber‹ bleibt die Wirkung<br />
der Figur auf die Zuhörenden unangetastet; die differenzierte Argumentation<br />
kann die Wirkung der Figur nicht beeinträchtigen. Denkfiguren<br />
werden <strong>als</strong> Ganzes angenommen – oder <strong>als</strong> Ganzes hinterfragt. Differenzierte<br />
Betrachtungsweisen dringen in der Regel erst dann wieder<br />
durch, wenn bei den Zuhörenden die gesamte Denkfigur fragwürdig<br />
geworden ist.<br />
Will man dem neoliberalen Diskurs wirksam entgegentreten, so ist es<br />
deshalb ratsam, die neoliberalen Denkfiguren immer wieder <strong>als</strong> Ganzes<br />
aufzunehmen und zu entzaubern, das heisst ihrer verdeckten Wirkung<br />
zu berauben. Zum Beispiel die ›Der-Markt-macht-alles-am-besten‹-<br />
Denkfigur. Eine mögliche Form der Entmystifizierung lautet: Der Markt<br />
ist für ungefähr zwei Drittel der Menschheit ein miserabler Mechanimus<br />
für die Verteilung der Güter. Er gibt nämlich nicht denjenigen, die Bedarf<br />
haben, sondern denjenigen, die bezahlen können. Deshalb sind<br />
zwei Drittel der Menschen für den Markt vollkommen irrelevant, weil<br />
sie über keine nennenswerte Kaufkraft verfügen. Deshalb wird mehr in<br />
die Entwicklung von Kosmetika investiert <strong>als</strong> in die Bekämpfung von<br />
Tropenkrankheiten. Deshalb kann der Markt nicht verhindern, dass<br />
jedes Jahr 6 Millionen Kinder an Hunger sterben – in jeder Sekunde 11.<br />
In einem weiteren Schritt kann der generische Kern der Denkfigur –<br />
im vorliegenden Fall die Selbstregulation lebender Systeme – aufgegriffen<br />
und mit der ideologisierten Verzerrung konfrontiert werden: Eine<br />
nachhaltig erfolgreiche Selbstregulation zeichnet sich dadurch aus, dass<br />
205 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Denken
Denken<br />
stabilisierende Regelkreise gegenüber entstabilisierenden Wirkungen<br />
vorherrschen, weil das System sonst die Tendenz hat, sich selbst und<br />
seine Umwelt zu zerstören. Krebszellen zum Beispiel folgen sehr wohl<br />
selbstorganisierenden Mustern, haben sich allerdings von allen stabilisierenden<br />
Koppelungen mit ihrem Umfeld ›befreit‹ und bedrohen deshalb<br />
mit ihrem selbstsüchtigen Wachstum ihren Wirt – und damit auch<br />
sich selbst. Sie gleichen darin einem entfesselten, neoliberalen Kapitalismus,<br />
der sich weder im Hinblick auf sozialen Ausgleich noch im<br />
Hinblick auf einen nachhaltigen Umgang mit der Natur Regulierungen<br />
unterwirft.<br />
Gegenüber der ›Sozialismus oder Freiheit‹-Figur könnte die Entzauberung<br />
lauten: Die wirkliche Alternative heisst Neoliberalismus oder Freiheit.<br />
Der neoliberale Kapitalismus erhöht soziale Ungerechtigkeiten und<br />
Spannungen in der Gesellschaft. Je ungehemmter er dies tut, desto mehr<br />
gibt es Konflikte, Gewalt, Repression – und das ist das Ende der Freiheit.<br />
Nur eine ausreichend gerechte Gesellschaft ist in der Lage, dauerhafte<br />
Freiheit zu sichern.<br />
Als zweiten Schritt bietet sich an, den Begriff der Eigenverantwortung<br />
aufzunehmen und ihn in einen sozialen Kontext zu stellen: Natürlich<br />
wollen wir möglichst viel Eigenverantwortung. Wir wollen eine Gesellschaft,<br />
die jedem Menschen ermöglicht, seinen Lebensunterhalt in eigener<br />
Verantwortung selber bestreiten zu können. Wir wollen eine Wirtschaftsordnung,<br />
die Vollbeschäftigung zu fairen Löhnen sichert.<br />
Linke Denkfiguren – Populismus<br />
oder legitimes Mittel?<br />
Gesellschaftliche Macht stützt sich auf Besitzverhältnisse, auf Formen der<br />
Ausbeutung und der Ausgrenzung und in Konfliktfällen häufig auch auf<br />
physische Gewalt. Macht ist jedoch auf einen courant normal angewiesen,<br />
auf ein alltägliches Funktionieren, bei dem sich die Sohn-Mächtigen<br />
widerstandslos in die herrschenden Muster einfügen. Dies gelingt<br />
am Besten, wenn die Menschen aus freien Stücken in die herrschenden<br />
Muster einwilligen. Dazu dienen Ideologien.<br />
Die Opposition kann noch so klug reden und schreiben: Im gesellschaftlichen<br />
courant normal setzen sich in der Regel nicht die besseren<br />
Ideen, sondern die dickeren Geldbeutel durch. Definitionsmacht entsteht<br />
nicht losgelöst von realer Macht. Jedoch gilt es im Rahmen dessen,<br />
was wir <strong>als</strong> ›machtlose‹ oder ›machtarme‹ Kräfte tun können, das Beste<br />
herauszuholen. Und da die realen Gesellschaftsverhältnisse voller Widersprüche<br />
und voller Bedrängungen für die Ohn-Mächtigen sind,<br />
kämpfen wir auch keineswegs auf verlorenem Posten. Der wachsame<br />
206 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
und kluge Umgang mit Denkfiguren kann erheblichen Einfluss darauf<br />
haben, wie viel wir von unserer potentiellen Definitionsmacht einlösen<br />
können.<br />
Doch sind Denkfiguren überhaupt ein legitimes Mittel in der politischen<br />
Auseinandersetzung? Wer die Welt mit einfachen Denkmustern<br />
beleuchte, sei ein ›terrible simplificateur‹, ein Populist und Volksverführer,<br />
lautet ein weit verbreitetes Verdikt. Die Wirklichkeit sei derart von<br />
Komplexität geprägt, dass sie sich jeder einfachen Erklärung entziehe.<br />
Einziger Weg sei deshalb in jedem Fall die Suche nach einer möglichst<br />
sachgerechten, lösungsorientierten Vorgehensweise.<br />
Dieses Argument verkennt, dass Denkfiguren unabdingbarer Bestandteil<br />
von Politik und Gesellschaft sind. Menschen stellen mit ihrem<br />
Handeln die Reproduktion gesellschaftlicher Verhältnisse jeden Tag von<br />
Neuem sicher. Sie nehmen gleichzeitig auch Teil an Veränderungsprozessen.<br />
Woran sollen sich die Menschen dabei orientieren? Ohne Leitideen,<br />
ohne Ideologien und deren Denkfiguren wäre dies unmöglich.<br />
Kein System verkraftet ein Zuviel an Komplexität, ohne dem Zerfall<br />
preisgegeben zu sein. Systeme müssen sich ständig reproduzieren, ihre<br />
innere Ordnung Tag für Tag wiederherstellen. Zu diesem Zweck müssen<br />
die System-Bestandteile in taugliche Abläufe eingebunden sein, in<br />
denen klar ist, wer was wann zu tun hat, und deshalb kann die Komplexität<br />
der inneren Abläufe und Wechselbeziehungen ein gewisses<br />
Mass nicht überschreiten. Tut sie dies dennoch, dann nimmt der Aufwand<br />
zu, der für die Koordination im alltäglichen Funktionieren erforderlich<br />
ist – bis zu der Schwelle, an der das Chaos Überhand nimmt. <strong>Das</strong><br />
System gerät dann in tiefe Krisen, die bis zum Zerfall gehen können<br />
(oder aber zu einer Transformation führen).<br />
In Gesellschaften muss jeder Einzelne seine Verhaltensweisen laufend<br />
auf die gesellschaftlichen Erfordernisse einstellen können. Er ist dabei<br />
auf Orientierungsmuster angewiesen. Viele dieser Muster sind erzwungen.<br />
Die Verfügungsgewalt eines Adligen über seine Leibeigenen zum<br />
Beispiel, oder der Zwang, für Lohn arbeiten zu müssen, um den Lebensunterhalt<br />
bestreiten zu können. Dazu gesellen sich ideelle Muster, die<br />
die Menschen solche Verhältnisse akzeptieren lassen: Die Idee von der<br />
gottgewollten Ordnung einer sozialen Hierarchie im Feudalismus, die Vorstellung<br />
eines Marktes, der alles zum Besten regelt im Kapitalismus.<br />
Es ist kein Zufall, dass das Bürgertum systematische und hoch bezahlte<br />
Anstrengungen unternimmt, um ihm dienliche Denkfiguren zu entwickeln<br />
und im politischen Alltag zu platzieren. Die Welt neoliberaler<br />
Denkfabriken (think tanks), die beständige Bemühung, Forschung und<br />
Lehre zu beherrschen (insbesondere im Bereich der Ökonomie), und<br />
207 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Denken
Denken<br />
hohe Investitionen zur Sicherung einer systemkonformen Medienlandschaft<br />
bezeugen den Wert, den die Mächtigem, dem Kampf ums Denken<br />
beimessen. Die Frage ist <strong>als</strong>o nicht, ob gesellschaftliche Kräfte – und<br />
damit auch die Linke – sich an Ideensets orientieren sollen oder nicht.<br />
Die Frage ist vielmehr, welche Qualität diese Sets haben.<br />
Selbstverständlich erschöpft sich politische Arbeit nicht im Entwickeln<br />
guter Denkfiguren. Ohne das ständige Bemühen um eine möglichst<br />
treffende Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse und ihrer Wandlungen,<br />
ohne ein beständiges Abstützen auf die Empirie, auf das, was uns Beobachtungen<br />
und Sachverhalte zu sagen haben, ohne den hartnäckigen<br />
Aufbau gesellschaftlicher Gegenmacht – zum Beispiel in NGOs und<br />
Gewerkschaften – werden linke Politik und kluge linke Denkfiguren zur<br />
leeren Geste.<br />
Doch dies einmal vorausgesetzt, ist die sorgfältige Erarbeitung sozialkritischer<br />
Denkfiguren von grossem Wert – nicht zuletzt deshalb, weil<br />
der Aufwand für ihre Entwicklung und ihre Kommunikation vergleichsweise<br />
gering ist, verglichen mit der grossen Wirkung, die sie entfalten<br />
können. Denn wer gesellschaftliche Definitionsmacht an sich ziehen<br />
kann, hat in den sozialen Auseinandersetzungen schon viel gewonnen.<br />
Die gelungene Mindestlohnkampagne des SGB ist dafür ein beredtes<br />
Beispiel.<br />
Zur Illustration sei hier noch eine Denkfigur angeführt, die aus einem<br />
meiner Dossiers <strong>als</strong> Zentr<strong>als</strong>ekretär des vpod (der Gewerkschaft der öffentlichen<br />
Angestellten) entstanden ist, nämlich der Gesundheitspolitik.<br />
Die Denkfigur lautet: Wenn Sie zur Ärztin gehen, wollen Sie eines: möglichst<br />
gute Unterstützung, damit Sie möglichst rasch gesund werden. Was<br />
Sie nicht wollen ist, dass der Arzt Sie vor allem daraufhin untersucht, wie<br />
an Ihnen möglichst viel zu verdienen ist. Sie wollen keine unnötigen<br />
Therapien oder Operationen, und Sie wollen auch nicht, dass Ihnen das<br />
Nötige vorenthalten wird, weil es sich für die Ärztin, die HMO oder das<br />
Spital finanziell nicht rechnet, Sie zu behandeln. Wir haben heute schon<br />
genug, ja zuviel Gewinninteressen im Gesundheitswesen, etwa seitens<br />
der Pharmaindustrie oder seitens derjenigen ÄrztInnen, die ihren Verdienst<br />
an oberste Stelle setzen. Unser Gesundheitswesen muss deshalb<br />
wieder vermehrt am Bedarf der PatientInnen ausgerichtet werden, nicht<br />
am Geschäftssinn der Anbieter. Profitgier hat im Gesundheitsbereich<br />
nichts verloren.<br />
Die Wirkung dieser Figur ist beträchtlich. Sie leuchtet unmittelbar ein,<br />
und schafft in vielen, manchmal reichlich diffusen Gesundheitsdebatten<br />
einen klaren Bezugspunkt.<br />
Ich plädiere für einen selbstbewussten und gleichzeitig selbstkritischen<br />
208 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Umgang mit Denksets. Diese Sets sind immer ›Ideologie‹, sie gehören<br />
der Welt der Ideen an. Sie sind gleichzeitig in dem Masse Teil der Wirklichkeit,<br />
wie sie das Handeln der Menschen (mit)bestimmen.<br />
Gefordert ist ein (selbst)kritischer Umgang mit, nicht der Verzicht auf<br />
Denkfiguren. Gefordert ist ihre gezielte Erarbeitung und Verwendung.<br />
Eine (selbst)kritische Betrachtung stellt dabei insbesondere immer wieder<br />
die eine Frage: cui bono, wem nützt es? Und sie achtet darauf, ob<br />
die Denkfiguren den Menschen Ohn-Macht suggerieren oder sie einladen,<br />
auf die Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse Einfluss zu<br />
nehmen.<br />
209 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Denken
Denken<br />
Auf dem Pilgerberg oder:<br />
Dialektik der Freiheit<br />
Eine kurze Geschichte des Neoliberalismus<br />
Die Diskussion über Neoliberalismus und Globalisierung wird nach wie<br />
vor breit und kontrovers geführt. Dabei kann Dissens über die Bedeutung<br />
beider Begriffe sowohl in linken wie rechten Kreisen festgestellt<br />
werden. Basierend auf aktuellen Forschungen 1 und meinen eigenen<br />
Arbeiten, 2 werde ich die Geschichte des Neoliberalismus in elf Thesen<br />
präsentieren. Ein wichtiges Anliegen des Artikels ist es, die verschiedenen<br />
Phasen und die Entwicklungsdynamik des Neoliberalismus erkennbar<br />
werden zu lassen.<br />
1. In Anlehnung an Max Horkheimer ist daran zu erinnern, dass wer<br />
über den Kapitalismus nicht reden will, vom Neoliberalismus schweigen<br />
sollte. Von Anfang an war der Neoliberalismus ein Projekt, das Antworten<br />
auf die Krise des Kapitalismus zu geben versuchte. Die Krise des<br />
liberalen Kapitalismus in den 1920er- und 1930er-Jahren (u.a. mit der<br />
›Grossen Depression‹ von 1929 bis 1933) bildete den Ausgangspunkt<br />
dieser Bewegung, die in den ersten Jahrzehnten vor allem von Intellektuellen<br />
getragen wurde.<br />
2. Als einer der ersten dürfte der schwedische Ökonom Eli F. Heckscher<br />
in seinem <strong>Buch</strong> ›Gammal och ny ekonomisk liberalism‹ (›Alter und neuer<br />
ökonomischer Liberalismus‹) 1921 die Umrisse eines neoliberalen<br />
Programms skizziert haben: Oberste Priorität für Markt und Konkurrenzordnung<br />
und eine Neukonzeption des Staates, seiner Aufgaben und<br />
Funktionen. 1925 hat der Zürcher Ökonom Hans Honegger erstm<strong>als</strong><br />
den Begriff Neoliberalismus verwendet und ihm ein Kapitel in seinem<br />
<strong>Buch</strong> ›Volkswirtschaftliche Gedankenströmungen‹<br />
gewidmet. In<br />
Bernhard Walpen<br />
Wien war es Ludwig von Mises, 1959, Dr. soc. sc., arbeitet in der Abteilung<br />
der sich ausführlich mit dem aktu- Forschung und Grundlagen der Bethlehemellen<br />
Zustand von Kapitalismus Mission Immensee; Themenredakteur für<br />
und Liberalismus beschäftigte. In Wirtschaftsgeschichte und -theorie der<br />
seinem Privatseminar wurden die- Zeitschrift ›Sozial-Geschichte‹; Forschungsse<br />
Problemstellungen multi- und schwerpunkte: Wirtschaftsgeschichte und<br />
transdisziplinär erörtert. <strong>Das</strong> Se- -theorie, Neoliberalismus und kritische Sominar<br />
war zugleich eine zivilge- zialtheorie (Marxismus, bes. Gramsci).<br />
210 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
sellschaftliche Organisation, in der internationale Kontakte geknüpft<br />
wurden. So nahmen daran unter anderem der Brite Lionel Robbins<br />
(London School of Economics), der US-Amerikaner Howard S. Ellis,<br />
der Norweger Ragnar Nurske oder der Repräsentant der Rockefeller-<br />
Stiftung in Paris, John Van Sickle, teil. 3 In London bildete die London<br />
School of Economics einen Ort, wo unter der Ägide von Edwin Cannan<br />
entsprechende Diskussionen geführt wurden. In Deutschland waren<br />
besonders Walter Eucken, Alexander Rüstow und Wilhelm Röpke (die<br />
letzten beiden flohen 1933 aus dem nazistischen Deutschland) die treibenden<br />
Protagonisten eines ›neuen Liberalismus‹. In Chicago war Frank<br />
H. Night ein wichtiger Exponent. Aber auch Walter Lippmann in New<br />
York und der liberale ›Staatsfeind‹ Albert Jay Nock, der während 12 Jahren<br />
ordinierter Pfarrer der Episcopal Church war, beschäftigten sich ausführlich<br />
mit den Problemen des Kapitalismus und den Gefahren des Sozialismus<br />
und konkret mit dem Bolschewismus. Auch in Italien und der<br />
Schweiz fanden sich besorgte Zeitgenossen, so in Genf William Rappard,<br />
in Turin Luigi Einaudi und in Mailand Giovanni Demaria. Im Zentrum<br />
des Nachdenkens über die aktuelle Krisensituation standen vor allem<br />
Fragen zu Markt, Wettbewerb, Preisbildung und zu den Funktionen, die<br />
dabei dem Staat zukommen sollen oder nicht. Einigkeit herrschte darin,<br />
dass die naive Vision eines Laissez-faire unhaltbar geworden war. <strong>Das</strong><br />
Konzept des Nachtwächterstaats war nicht mehr länger haltbar. Die<br />
Krux bestand darin, eine Form von Intervention zu finden, die möglichst<br />
minim ist, dennoch aber die Möglichkeit bietet, ›sozialistische‹ und<br />
bürokratische Machtkonzentrationen zu verhindern und trotzdem mit<br />
einem Gewaltapparat die (neo-)liberale Ordnung gegebenenfalls zu<br />
sichern. Diese Überlegungen konkretisierten sich in den Konzepten von<br />
Rechtsstaat, rule of law oder starker Staat.<br />
3. Mitte der 1930er-Jahre wurde der Neoliberalismus-Diskurs vor allem<br />
in Frankreich relativ breit geführt. Der französische Wissenschaftsphilosoph<br />
Louis Rougier war eine treibende Kraft und organisierte das<br />
Colloque Walter Lippmann (26.–30. August 1938) in Paris. Dort wurde<br />
Lippmanns <strong>Buch</strong> ›The Good Society‹ (franz. ›Cité libre‹) <strong>als</strong> ein richtungsweisender<br />
Beitrag zur Erneuerung des Liberalismus diskutiert. <strong>Das</strong><br />
Spektrum der Teilnehmer war breit und erstreckte sich von Alexander<br />
Rüstow und Wilhelm Röpke bis zu Friedrich August von Hayek und Mises.<br />
Der Neoliberalismus war kein ›Einheitsdenken‹, sondern zeichnete<br />
sich durch einen gewissen Pluralismus aus. Während des Kolloquiums<br />
wurde auch über die Begrifflichkeit debattiert, mit der das neue Liberalismuskonzept<br />
zu fassen sei. Gegen Vorschläge wie ›Neokapitalismus‹,<br />
211 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Denken
Denken<br />
›positiver Liberalismus‹ oder ›sozialer Liberalismus‹ einigte man sich<br />
schliesslich auf ›Neoliberalismus‹. Der Begriff ist <strong>als</strong>o eine Selbstbezeichnung.<br />
<strong>Das</strong> Konzept umfasste auf dem Kolloquium folgende Punkte:<br />
• Vorrang des Preismechanismus <strong>als</strong> einem Mittel des Plebiszits mittels<br />
der Preise<br />
• freie Unternehmen<br />
• Wettbewerbssystem<br />
• ein starker und unparteiischer Staat.<br />
Schliesslich wurde eine Projektagenda Neoliberalismus aufgesetzt, die<br />
Gründung einer Zeitschrift, der ›Cahiers du Libéralisme‹, und die Bildung<br />
eines think tanks, des ›Centre International d’Études pour la Rénovation<br />
du Libéralisme‹ (CIERL) mit Hauptsitz in Paris (der erste Präsident<br />
war der Unternehmer Louis Marlio) und Büros in Genf (Röpke),<br />
London (Hayek) und New York (Lippmann) an die Hand genommen.<br />
Die Initianten richteten sich auf lange Fristen aus: Um das neoliberale<br />
Konzept durchzusetzen, sei eine Langzeitstrategie über Jahrzehnte notwendig.<br />
Ebenfalls musste, entgegen platter individualistischer Propaganda,<br />
der Individualismus kollektiv organisiert werden. Der Ausbruch<br />
des Zweiten Weltkriegs beendete jedoch diese ersten Bemühungen.<br />
4. Ab Ende 1943 nahmen einige Intellektuelle den Faden zu einer Erneuerung<br />
des Liberalismus wieder auf. Am 8. Dezember 1943 schrieben<br />
ein gewisser K. Brunner, der Schweizer Geschäftsmann Albert Hunold<br />
und der NZZ-Wirtschaftsjournalist Carlo Mötteli ein Papier ›Zur Frage<br />
der Gründung einer sozialwissenschaftlichen Studiengemeinschaft‹. In<br />
Cambridge präsentierte Hayek am 28. Februar 1944 seine Vorstellung<br />
über die Errichtung einer ›Acton Society‹. 4 Röpke stellte im August 1945<br />
seinen Plan für eine internationale Publikation vor. Aus all diesen<br />
Bemühungen ging schliesslich das erste Treffen in Mont Pèlerin, oberhalb<br />
Veveys, vom 1. bis 10. April 1947 hervor. Dieses internationale Treffen<br />
im Hôtel du Parc war möglich dank der finanziellen Unterstützung<br />
diverser Firmen und Stiftungen.<br />
Anlass für das Treffen waren die Isolierung der (Neo-)Liberalen und<br />
ihre geringe Zahl sowie der Aufstieg des Sozialismus (und damit der<br />
gesellschaftlichen Planung). Die dort begründete Mont-Pèlerin-Society<br />
(MPS) entwickelte kein detailliertes akademisches oder gar politisches<br />
Programm. Vielmehr wurden die Kernprinzipien in einer Absichtserklärung<br />
festgehalten. Dazu zählten:<br />
• Die Analyse und Erklärung der aktuellen Krise mit ihren ökonomischen<br />
wie moralischen Dimensionen.<br />
212 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
• Die Redefinition der Funktionen des Staates, um genauer zwischen<br />
totalitärer und liberaler Ordnung unterscheiden zu können.<br />
• Die Methode der Wiedereinsetzung einer ›rule of law‹, um die Freiheitsrechte<br />
von Einzelpersonen und von Gruppen zu sichern.<br />
• Die Möglichkeit der Errichtung minimaler sozialpolitischer Standards<br />
mittels nicht marktfeindlicher Mittel.<br />
• Die Bekämpfung der Missbräuche der Geschichte, die der Förderung<br />
freiheitsfeindlicher Vorstellungen dienen.<br />
• Die Schaffung einer internationalen Ordnung, mit der Frieden, Freiheit<br />
und harmonische internationale ökonomische Beziehungen gesichert<br />
werden kann.<br />
Es ist bemerkenswert, dass auf dieser Liste einige traditionell liberale<br />
Kernprinzipien fehlen, die mit grundsätzlichen demokratischen und<br />
Menschenrechten verbunden sind (u.a. das Recht auf kollektive Organisation<br />
und die Gleichheit in der politischen Teilnahme).<br />
<strong>Das</strong> Ziel der MPS bestand darin, die eigene Tradition zu sichern (»save<br />
the books«), neue Theorien und Analysen zu entwickeln und ein politisches<br />
Projekt im weiten Sinn zu entwerfen, das zur damaligen Zeit in<br />
einer gewissen Distanz zum hegemonialen politischen Feld stand. Die<br />
Aktivitäten der MPS sollten zunächst auf die Zivilgesellschaft einwirken<br />
(über die MPS <strong>als</strong> transnationales Netzwerk neoliberaler Intellektueller<br />
und über die think tanks auf die öffentliche Meinung) sowie über eine<br />
»liberale Utopie« (Hayek) entscheidenden Einfluss auf den Alltagsverstand<br />
gewinnen.<br />
5. In der MPS findet sich unter anderen ein Typus von Intellektuellen,<br />
der der herrschenden Klasse auf neue Weise zuarbeitet. Gramsci hat in<br />
der Beschäftigung mit Sinclair Lewis’ Roman ›Babbitt‹ festgestellt: »Die<br />
Intellektuellen lösen sich von der herrschenden Klasse ab, um sich mit<br />
ihr intimer zu verbinden, um eine wirkliche Superstruktur zu sein und<br />
nicht nur ein unorganisches ununterschiedenes Element der Struktur-<br />
Korporation.« 5 <strong>Das</strong> Sich-Ablösen der Intellektuellen bedeutet aber<br />
nicht, sie seien ›unabhängig‹, wie Gramsci in einer anderen Notiz anmerkte:<br />
»Es erweist sich hier die methodologische Konsistenz eines Kriteriums<br />
politisch-historischer Forschung: es gibt keine unabhängige<br />
Intellektuellenklasse, sondern jede gesellschaftliche Gruppe hat eine eigene<br />
Intellektuellenschicht oder tendiert dazu, sie sich zu bilden; aber<br />
die Intellektuellen der historisch (und realistisch gesehen) progressiven<br />
Klasse üben unter den gegebenen Umständen eine solche Anziehungskraft<br />
aus, dass sie sich schliesslich und endlich die Intellektuellen der an-<br />
213 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Denken
Denken<br />
deren gesellschaftlichen Gruppen unterordnen und folglich ein System<br />
der Solidarität aller Intellektuellen mit Bindungen psychologischer<br />
(Eitelkeit usw.) und häufig kastenmässiger (rechtlich-technischer, korporativer<br />
usw.) Art schaffen.« 6 Hayeks Ziel war es, dem Neoliberalismus<br />
»Anziehungskraft« zu verleihen, um Intellektuelle anderer Klassen zu<br />
gewinnen.<br />
6. Die ersten 15 bis 20 Jahre der MPS zeichnen sich durch vier wichtige<br />
Entwicklungen aus. Zunächst wurde die Mitgliedschaft zügig erweitert.<br />
Schon vier Jahre nach der Gründung waren Mitglieder aus allen Kontinenten<br />
zu finden. Obwohl der Schwerpunkt der Mitgliedschaft in Europa<br />
und den USA lag, bemühte man sich früh, in Lateinamerika<br />
(zunächst besonders in Argentinien) und ab 1960 in Japan eine stärkere<br />
Basis zu bilden.<br />
Als zweites war es eine Zeit der Such-, Klärungs- und »Reinigungs«prozesse.<br />
Die intellektuelle Vorrangstellung von Hayek, Friedman und<br />
anderen war keineswegs gegeben. Die teils heftigen Debatten über Gewerkschaften<br />
oder die Entwicklungstheorie 7 verdeutlichen das eindrücklich.<br />
Weitere teilweise gravierende Differenzen kamen in Fragen<br />
der Agrarwirtschaft oder im Zusammenhang mit der Rolle des Goldes<br />
auf. Entscheidend war, dass im Verlauf der Zeit eine Art ›Mainstreaming‹<br />
in diesen Fragen stattgefunden hat, ohne dass aber eine Einheitsdoktrin<br />
entstanden wäre. Die Konzentration auf den Bereich der Wissenschaften<br />
bot die Möglichkeit einer relativen Offenheit innerhalb des<br />
Rahmens, der durch die Prinzipien abgesteckt war. Die Abstinenz von<br />
direkter Einflussnahme auf politische Ereignisse bildete eine wichtige,<br />
wenn nicht die entscheidende Grundlage dafür, dass nicht allzu schnell<br />
Abgrenzungskämpfe entstanden, die für den Neoliberalismus schädlich<br />
geworden wären.<br />
Als drittes wichtiges Moment ist die publizistische Tätigkeit der MPS-<br />
Mitglieder zu erwähnen. Zahlreiche der bekannten Mitglieder verfassten<br />
wichtige Arbeiten: Hayek publizierte 1960 sein ›The Constitution of<br />
Liberty‹, der italienische Rechtsgelehrte Bruno Leoni 1961 ›Freedom<br />
and the Law‹, Friedman 1962 ›Capitalism and Freedom‹, die Begründer<br />
der ›Public Choice-Theorie‹ James M. <strong>Buch</strong>anan und Gordon Tullock,<br />
1962 ›The Calculus of Consent‹ und der Humankapital-Theoretiker<br />
Gary S. Becker 1964 ›Human Capital‹. Bis Mitte der 1960er-Jahre war<br />
die eigene Bibliothek immens angewachsen und im Bereich der Ökonomie<br />
und in den Sozialwissenschaften war die Präsenz neoliberaler<br />
Intellektueller nicht mehr zu ignorieren.<br />
Viertens schliesslich war die Schaffung von think tanks ein wichtiges<br />
214 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Mittel, um auf Publizistik und Ausbildung vermehrt einwirken zu können.<br />
Von 1950 bis 1969 wurden 14 think tanks (in Argentinien, Deutschland,<br />
Frankreich, Grossbritannien, Guatemala, Japan, Mexiko und den<br />
USA) im MPS-Umfeld errichtet.<br />
7. In der Krise des fordistischen Kapitalismus, die sich 1965 abzuzeichnen<br />
begann und bis 1980 dauerte, gelang es den neoliberalen Intellektuellen,<br />
insbesondere den Anhängern des Monetarismus, die in Gang<br />
gekommenen gesellschaftlichen und vor allem ökonomischen Entwicklungen<br />
aufzugreifen, theoretisch zu durchdringen und Lösungsvorschläge<br />
zu erarbeiten. Selbstbewusst wurde die »monetaristische Konterrevolution«<br />
verkündet und man trat aus dem »Schatten von Keynes«<br />
heraus, wie es der LSE- und Chicago-Ökonom Harry G. Johnson 8 proklamierte.<br />
9 Die monetaristische Theorie bot sich deshalb <strong>als</strong> eine Alternative<br />
zum keynesianischen Ansatz an, weil sie mit ihm wichtige<br />
Gemeinsamkeiten teilte: Beides waren Makro- und Geldtheorien und<br />
boten konkrete wirtschaftspolitische Rahmensetzungen, Messgrössen<br />
und Entscheidungswege. 10 Monetaristische Theorie war ohne einen radikalen<br />
Bruch umsetz- und anwendbar. <strong>Das</strong> jeweilige nationale Regierungspersonal<br />
und die Staatsbeamten konnten die neue Doktrin relativ<br />
leicht übernehmen. Wirtschaftspolitische Weichenstellungen erfolgten<br />
in zahlreichen Nationen Schritt für Schritt.<br />
Zur Popularisierung des Neoliberalismus trug in den 1970er-Jahren<br />
vor allem Milton Friedman bei, der seine monetaristische Theorie in<br />
Zeitschriftenartikeln und Interviews (von ›Newsweek‹ bis ›Playboy‹) popularisierte.<br />
Insbesondere versinnbildlichte er den Charme der neuen<br />
Warenwelt und ihrer Ästhetik im Bild des Supermarktes und verklärte<br />
die »ungeheure Warensammlung«. 11 Mit der Verleihung des schwedischen<br />
Reichsbankpreises (normaler- und fälschlicherweise <strong>als</strong> Wirtschaftsnobelpreis<br />
bezeichnet) an Hayek (sinnigerweise zusammen mit<br />
dem linken schwedischen Ökonomen Gunnar Myrdal) 1974 und an<br />
Friedman 1976 erlangten neoliberale Theorien ein enormes wissenschaftliches<br />
Renommee, was die MPS-Mitglieder unablässig betonten<br />
und immer noch betonen. 12<br />
8. Um 1970 herum wurde das von den in Netzwerken und think tanks<br />
organisierten Intellektuellen erarbeitete theoretische Programm von anderen<br />
gesellschaftlichen Gruppen aufgegriffen und zu einem politischen<br />
Programm umgearbeitet: Von transnationalen Konzernen, staatlichen<br />
Entscheidungsträgern, neokonservativen Parteien und Medien. Die Aktivitäten<br />
wurden ausgedehnt und auf eine direkte Einflussnahme auf den<br />
215 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Denken
Denken<br />
Staat gerichtet. Zur »Eroberung des Staates« hatte bereits Gramsci angemerkt,<br />
was »von grösster Bedeutung [ist]: dass nämlich nicht eine gesellschaftliche<br />
Gruppe die Führerin anderer Gruppen ist, sondern dass<br />
ein Staat, wenn auch <strong>als</strong> Macht eingeschränkt, der ›Führer‹ der Gruppe<br />
ist, die eigentlich die führende sein müsste, und dieser ein Heer und eine<br />
diplomatisch-politische Gewalt zur Verfügung stellen kann.« 13 Einige<br />
der neoliberalen und neokonservativen think tanks richteten ihre Aktivitäten<br />
konzentriert auf Regierungen, ihre Repräsentanten und ihre Politik<br />
aus (in den USA z.B. die Heritage Foundation, in Grossbritannien<br />
das Adam Smith Institute; letzteres lenkte die Anstrengungen zunächst<br />
auf die Regierung Thatcher und später auf jene von Blair).<br />
9. Um neoliberale Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik implementieren<br />
und erproben zu können, war ein »Laborexperiment« 14 notwendig, wie<br />
es unter der Diktatur von General Augusto Pinochet möglich war. Ein<br />
solches Schockprogramm wäre, wie es ein beteiligter chilenischer Unternehmer<br />
freizügig sagte, »schwer innerhalb einer Demokratie zu implementieren«<br />
15 gewesen. Weitere Experimente erfolgten in den 1970erund<br />
1980er-Jahren in zahlreichen andern lateinamerikanischen Ländern,<br />
stets im Rahmen von Militärdiktaturen und oft mit Unterstützung<br />
der CIA. Mochten einige neoliberale Intellektuelle auch noch staatsskeptisch<br />
bis gar staatsfeindlich eingestellt sein, so war doch offensichtlich,<br />
dass die Durchsetzung neoliberaler Politiken nicht ohne die staatliche<br />
Zwangsgewalt zu haben war. <strong>Das</strong> war die konkrete historische<br />
Form des »liberalen Interventionismus« 16 . Für Zehntausende von Frauen<br />
und Männern in Lateinamerika war es der neoliberale Weg zur Knechtschaft<br />
(Hayek) und in den Tod.<br />
10. 1979 in Grossbritannien und 1980 in den USA gelangte der Neoliberalismus<br />
auch in den kapitalistischen Metropolen an die Staatsmacht.<br />
Mit Margaret Thatcher und Ronald Reagan kamen eine Premierministerin<br />
und ein Präsident an die Staatsspitze, die entschieden neoliberale<br />
und neokonservative Ideologien vertraten. Beide Regierungsprotagonisten<br />
pflegten direkte Beziehungen mit bekannten MPS-Intellektuellen<br />
wie <strong>Buch</strong>anan, Friedman oder Hayek. Sie beriefen auch MPS-Mitglieder<br />
in Regierungsämter und nutzten ihre Möglichkeiten, um MPS-Intellektuelle<br />
mit Auszeichnungen zu überschütten. Bald nach den Wahlsiegen<br />
in Grossbritannien und den USA griffen auch sozialdemokratische<br />
Regierungen einzelne neoliberale Instrumente auf, vor allem wirtschaftspolitische<br />
(so schon 1982 der Partido Socialista Obrero Español<br />
PSOE in Spanien). Die Labour-Regierung in Neuseeland machte sich<br />
216 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
nach ihrem Wahlerfolg von 1984 sogar daran, ein umfassendes neoliberales<br />
Programm zu implementieren.<br />
Ab 1970 ist eine markante Zunahme neoliberaler think tanks im Umfeld<br />
der MPS auszumachen. Es war insbesondere der Brite Antony<br />
Fisher, der <strong>als</strong> ›Handelsreisender‹ an vielen think-tank-Gründungen beteiligt<br />
war. In allen Erdteilen entstanden solche Organisationen. Die<br />
1981 gegründete Atlas Economic Research Foundation in den USA<br />
übernahm die Aufgabe, neoliberale und neokonservative think tanks<br />
transnational zu vernetzen.<br />
11. Mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten 1989/90 erlangte<br />
der Neoliberalismus weltweit eine hegemoniale Position. Die<br />
neoliberalen Theorien und Utopien der Anfangsjahre wurden in der realen<br />
Umsetzung ›Opfer‹ des eigenen Erfolges. Die ständigen Wiederholungen<br />
der simplen oder gar simplizistischen neoliberalen Parolen durch<br />
think tanks und Medien fand den prägnantesten Ausdruck in den<br />
Schlagwörtern Deregulieren, Flexibilisieren und Individualisieren. Der<br />
nun vulgarisierte Neoliberalismus gewann so die »Festigkeit eines Volksvorurteils«.<br />
17<br />
Für die utopistischen Neoliberalen kann es nie genug Neoliberalismus<br />
geben. Für Andreas Winterberger etwa liegt die Krux darin, dass vielen<br />
Menschen das Verständnis für die gloriose freiheitliche Ordnungsidee<br />
fehle: »Eine grosse Gefährdung der liberalen Ordnung lag und liegt ferner<br />
darin, dass vielen Menschen das Verständnis dafür fehlt(e), dass die<br />
freiheitliche Ordnungsidee ganzheitlich Staat, Wirtschaft, Gesellschaft<br />
und den Kulturbereich prägt.« 18 Was soll man mit solch unverständigen<br />
Menschen tun, die an ihrer ›Schacherdemokratie‹ festhalten wollen? Wie<br />
soll Freiheit unter solchen Umständen durchgesetzt werden? »Es ist<br />
nach Ansicht von Anthony de Jasay offen, ob eine – ›Schacherdemokratie‹<br />
(Hayek) unter Verzicht auf autoritäre oder gar totalitäre Instrumentarien<br />
rein rechtsstaatlich überwunden und in liberale Bahnen gelenkt<br />
werden kann.« Was einst unter anderem mit der Warnung vor dem<br />
Totalitarismus begann, ist nun bei der Erwägung »totalitärer Instrumentarien«<br />
angelangt. Wer weiss, dass im neoliberalen Jargon ›autoritär‹<br />
für Diktaturen des Typs Pinochet steht, kann sich ausmalen, was ›totalitär‹<br />
bedeuten mag.<br />
Literatur<br />
Feichtinger, Johannes (2001) ›Wissenschaft zwischen den Kulturen. Österreichische Hochschullehrer<br />
in der Emigration 1933–1945‹. Frankfurt/M–New York.<br />
Fischer, Karin (2002) ›Neoliberale Transformation in Chile. Zur Rolle der ökonomischen und<br />
intellektuellen Eliten‹. In: Journal für Entwicklungspolitik, 18. Jg., Nr. 3, 225–248.<br />
217 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
Denken
Denken<br />
Gramsci, Antonio (1975) ›Quaderni del carcere‹. Valention Gerratana (Hg). Turin (zit. Gef).<br />
Johnson, Elizabeth u. Harry G. (1978) ›The Shadow of Keynes. Understanding Keynes‹,<br />
Cambridge and Keynesian Economics. Oxford.<br />
Marx, Karl, Friedrich Engels (1957ff) ›Marx-Engels Werke‹, 43 Bde. (zit. MEW).<br />
Plehwe, Dieter (2005) ›Origins of the Neoliberal Development Discourse. Mont Pèlerin<br />
Society Conferences (1951–1958)‹. Unveröffentlichtes Manuskript.<br />
Plehwe, Dieter, Bernhard Walpen, Gisela Neunhöffer (Hg.) (2005) ›Neoliberal Hegemony. A<br />
Global Critique‹. London (i.E.).<br />
Rüstow, Alexander (1932) ›Die staatspolitischen Voraussetzungen des wirtschaftspolitischen<br />
Liberalismus‹. In: Ders., Rede und Antwort. Ludwigsburg 1963, 249–258.<br />
Steiner, Yves (2005) ›The Mont-Pèlerin Society and Trade Unions: A Research Note‹. Unveröffentlichtes<br />
Manuskript.<br />
Walpen, Bernhard (2004) ›Die offenen Feinde und ihre Gesellschaft. Eine hegemonietheoretische<br />
Studie zur Mont Pèlerin Society‹. Hamburg.<br />
Winterberger, Andreas K. (1995) ›Von der liberalen Demokratiekritik zur liberalen Verfassungsreform<br />
– oder: Kann der Parteienstaat gebändigt werden?‹. In: Roland Baader (Hg.)<br />
›Wider die Wohlfahrtsdiktatur. Zehn liberale Stimmen‹. Gräfelfing, 191–215.<br />
Anmerkungen<br />
1 Kritische Neoliberalismus-Forschung erfolgte im Projekt ›buena vista neoliberal?‹ (2000-<br />
2002). Daraus ging eine erste internationale Konferenz in Berlin hervor (29.11. bis<br />
2.12.2001), die im Band Plehwe, Walpen und Neunhöffer (2005) dokumentiert ist. Eine<br />
weitere internationale Konferenz fand vom 28. bis 30.4.2005 am ›International Center for<br />
Advanced Studies‹ in New York statt. Zum Neoliberalismus liegen inzwischen zahlreiche<br />
Detail- und Länderstudien vor (vgl. hierzu Walpen 2004, 35f).<br />
2 vgl. Walpen 2004.<br />
3 vgl. Feichtinger 2001, 185–187.<br />
4 Benannt nach John Emerich Edward Dalberg-Acton (Lord Acton; 1834–1902), dem englischen<br />
liberalen Historiker und Katholiken.<br />
5 vgl. Gef, H. 5, Paragraph 105, 659.<br />
6 vgl. Gef, H. 19 §24, 1948; vgl. H 1, §44, 102.<br />
7 vgl. Steiner 2005, Plehwe 2005.<br />
8 In meiner Arbeit (Walpen 2004, 166) bezeichne ich Johnson ungenau <strong>als</strong> keynesianischen<br />
Ökonomen. <strong>Das</strong> ist irreführend. Er wäre zumindest <strong>als</strong> ein Rechtskeynesianer zu begreifen,<br />
der monetaristische Elemente aufgegriffen hat.<br />
9 vgl. Johnson/Johnson 1978.<br />
10 Der Monetarismus beschäftigt sich mit den makroökonomischen Auswirkungen in der<br />
Geldpolitik und mit der Funktion der Zentralbank. <strong>Das</strong> zentrale Ziel ist die Bekämpfung<br />
der Inflation. Diese lasse sich verhindern, wenn das Geldmengenangebot kontrolliert und<br />
eine exzessive Expansion vermieden werde. Zu achten sei darauf, das Angebot und<br />
Nachfrage von Geld in einem Gleichgewicht sind. Die Zentralbanken werden <strong>als</strong> Institutionen<br />
konzipiert, die von politischen Entscheidungen zum grössten Teil autonom sind.<br />
Ihre Aufgabe besteht darin, Preisstabilität zu gewährleisten. Keynes setzte den Schwerpunkt<br />
seiner Theorie darauf, die hohe Arbeitslosigkeit und die Deflation zu bekämpfen.<br />
Er bestritt auch, dass eine starke Gleichgewichtstendenz in der Ökonomie herrsche.<br />
11 vgl. Marx 1859, MEW 13, 15.<br />
12 Bis heute haben acht MPS-Mitglieder den Preis erhalten.<br />
13 vgl. Gef, H 15, §59, 1778.<br />
14 ›Business Week‹, 12.1.1976, 70.<br />
15 Zitiert in Fischer 2002, 230.<br />
16 vgl. Rüstow 1932, 253.<br />
17 vgl. Marx 1867, MEW 23, 24.<br />
18 vgl. Winterberger 1995, 2003, 205.<br />
Mein Dank für gemeinsames Forschen, für Diskussionen und Kritik geht an: Karin Fischer,<br />
Philip Mirowski, Dieter Plehwe, Beat Ringger, Yves Steiner und Rob Van Horn.<br />
218 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Definitionsmacht zurückgewinnen:<br />
Zur Gründung des <strong>Denknetz</strong>es<br />
»<strong>Das</strong> <strong>Denknetz</strong> ist den Grundwerten der Freiheit, der Gleichheit und der<br />
Solidarität verpflichtet. <strong>Das</strong> <strong>Denknetz</strong> konstatiert zunehmende soziale<br />
Ungleichheit und Entsolidarisierung in der Gesellschaft. Es will die<br />
Mechanismen dieser Dynamik besser verstehen sowie Alternativen<br />
erkunden und diskutieren.«<br />
Anfang 2004 riefen – nach Vorbereitung durch eine Initiativgruppe –<br />
zwölf Personen aus Wissenschaft, sozialen Bewegungen und Politik 1 zur<br />
Gründung eines <strong>Denknetz</strong>es auf. Dieses solle<br />
• den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen WissenschaftlerInnen,<br />
politischen und gewerkschaftlichen AkteurInnen sowie Institutionen<br />
im In- und Ausland fördern<br />
• Forschungsresultate mit der politischen Praxis zusammenführen<br />
• Impulse setzen für die politische Orientierung, ohne selbst in die politische<br />
Auseinandersetzung einzugreifen.<br />
Die Schaffung eines <strong>Denknetz</strong>es (www.denknetz-online.ch) entsprach<br />
zweifellos einem Bedürfnis. <strong>Das</strong> fortschrittliche Denken war und ist in<br />
der Schweiz durch starke Fragmentierungen geprägt: Während die einen<br />
im wissenschaftlichen ›Elfenbeinturm‹ forschen und lehren, sind die anderen<br />
im pragmatisch orientierten Alltag der Gewerkschaften, Parteien<br />
oder staatlichen Institutionen gefangen. Zwischen beiden kommt es nur<br />
selten zu einer fruchtbaren Diskussion. Fragmentiert sind ebenso die<br />
Disziplinen, die Historik und die Soziologie, die Sozialpolitik und die<br />
Wirtschaftspolitik.<br />
Dies wirkt sich umso negativer aus, <strong>als</strong> fortschrittliches, linkes Denken<br />
sich weniger denn je auf einen gesicherten gemeinsamen Rahmen oder<br />
gar auf eine gemeinsame Orientierung abstützen kann. Im Gegenteil<br />
besteht nach dem Wegbrechen bisheriger linker Konzepte ein umso<br />
grösseres Vakuum an Konzepten des Gesellschaftsverständnisses und<br />
der Handlungsmöglichkeiten, auch in Teilbereichen.<br />
Ein Arbeitspapier aus der Vorgründungszeit des <strong>Denknetz</strong>es formulierte<br />
die Fragestellung folgender-<br />
Andreas Rieger<br />
massen: Während ein Teil der<br />
1952, lic phil I, Gewerkschaftssekretär Unia, Köpfe ehemaliger Linker vom<br />
nationaler Verantwortlicher für den Sektor Neoliberalismus ›besetzt‹ wurde,<br />
Tertiär, Präsident des Vereins <strong>Denknetz</strong>.<br />
hat sich ein anderer Teil der »In-<br />
219 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
<strong>Denknetz</strong>
<strong>Denknetz</strong><br />
telligenz dem Mainstream nicht unterworfen. Sie kritisiert konstant die<br />
verheerenden Folgen der neoliberalen Politik und die zunehmende<br />
soziale Ungleichheit. Sie ist dazu in verschiedenen Netzen verbunden,<br />
welche allerdings sehr disparat funktionieren. Was diese Diskussion<br />
kennzeichnet, ist ihre starke Segmentierung in Subgruppen, die Ferne<br />
zu den Universitäten und anderen Forschungsstätten und die fehlende<br />
politikrelevante Bündelung. Es gelingt kaum je, WissenschaftlerInnen,<br />
PolitikerInnen, Gewerkschafts- und andere NGO-Verantwortliche für<br />
eine fundierte Diskussion und Vernetzung zusammenzubringen, geschweige<br />
denn in einem solchen Zusammenhang eine wissenschaftlich<br />
fundierte Erarbeitung von Positionen oder Konzepten zu schaffen. Genau<br />
dies wäre aber nötig.« 2<br />
Ein Ansatz in diese Richtung war die jährlich stattfindende Retraite<br />
von Rotschuo, an der sich WissenschaftlerInnen und Verantwortliche<br />
aus Politik, Gewerkschaft und sozialen Bewegungen zu einem freien<br />
Austausch von Kernfragen eines fortschrittlichen Gesellschaftsverständnisses<br />
trafen. Diese fruchtbare Erfahrung bildete einen der Ausgangspunkte<br />
für eine dichtere Vernetzung und für die Bildung der Initiativgruppe<br />
für das <strong>Denknetz</strong>.<br />
Der Aufruf von Anfang 2004 stiess auf ein gutes Echo und führte im<br />
September 2004 zur formellen Gründung <strong>als</strong> Verein, dem sich bis Ende<br />
2004 rund 300 Personen <strong>als</strong> Mitglieder anschlossen. 3 Derzeit finden Diskussionen<br />
mit verschiedenen Organisationen über den Anschluss <strong>als</strong><br />
Kollektivmitglieder statt.<br />
Seither befindet sich das <strong>Denknetz</strong> im schrittweisen und kontinuierlichen<br />
Aufbau:<br />
• Jährlich findet eine gesamtschweizerische Tagung statt: Im Juni 2004<br />
›Der neue Glanz der Gleichheit‹, im April 2005 ›Mindestlöhne in<br />
Europa‹; ein Teil der Tagungsbeiträge findet sich in diesem Jahrbuch<br />
wieder. Für 2006 ist eine Tagung zur Frage der Vollbeschäftigung in<br />
Planung.<br />
• Mehrere Fachgruppen arbeiten zu Themenbereichen (Gesundheitspolitik,<br />
Umverteilung, Alter, Demokratie und Wirtschaft usw.).<br />
• Eine Vernetzung über die Grenzen hinaus hat <strong>als</strong> erstes mit dem WSI<br />
(Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der Deutschen<br />
Gewerkschaften) in Deutschland intensivere Formen angenommen,<br />
insbesondere mit der Mindestlohntagung.<br />
• Ab 2005 erscheint regelmässig das Jahrbuch, um einen Teil der Diskussion<br />
auch in gedruckter Form zugänglich zu machen.<br />
Geplant ist ein regelmässiger Newsletter, der Hinweise, Resumées und<br />
220 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Links zu wissenschaftlichen Beiträgen und Diskussionen im Bereich der<br />
Kernthemen des <strong>Denknetz</strong>es umfassen wird.<br />
Aus diesen Tätigkeiten geht klar hervor, dass das <strong>Denknetz</strong> nicht ein<br />
think tank sein will, der im Interesse der Trägerschaft eigene Forschungen<br />
durchführt und diese dann kommuniziert und popularisiert. Vielmehr<br />
soll ein Netz geknüpft werden zwischen Forschenden, Denkenden<br />
und Handelnden.<br />
Ein Jahr nach der Gründung steht das <strong>Denknetz</strong> noch am Anfang, aber<br />
der eingeschlagene Weg der Vernetzung erscheint uns richtig.<br />
221 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
<strong>Denknetz</strong><br />
Anmerkungen<br />
1 Es waren dies namentlich Ruth Dreifuss, Therese Frösch, Anne Gurzeler, Ueli Mäder,<br />
René Levy, Vasco Pedrina, Paul Rechsteiner, Rita Schiavi, Doris Schüepp, Hans Schäppi,<br />
Walter Schöni und Willy Spieler.<br />
2 Andreas Rieger (2000) ›Für ein Denk-Netz gegen die soziale Ungleichheit‹ (Manuskript).<br />
3 Der Verein wird in den institutionellen Belangen von einem Vorstand geleitet, in den folgende<br />
Personen gewählt wurden: Urs Marti, Philosoph; Andreas Rieger, Gewerkschaftssekretär<br />
Unia; Beat Ringger, Gewerkschaftssekretär VPOD; Walter Schöni, Sozialwissenschafter;<br />
Rita Soland, Sozialwissenschafterin; Rolf Zimmermann, Gewerkschaftssekretär<br />
SGB. Neben dem Vorstand erarbeitet die ›Kerngruppe‹ die inhaltlichen<br />
Impulse für die Tagungen, das Jahrbuch usw.
<strong>Denknetz</strong><br />
Tätigkeiten und Projekte<br />
des <strong>Denknetz</strong>es<br />
<strong>Das</strong> <strong>Denknetz</strong> startete seine Aktivitäten im Frühling 2004 mit einer<br />
Tagung, der wir den Titel ›Der neue Glanz der Gleichheit‹ gaben. Der<br />
Titel ist Programm: Wir wollen einen Beitrag leisten zur Rehabilitierung<br />
des Orientierungswertes Gleichheit, nachdem der Begriff über Jahre<br />
eine beständige Abwertung erfahren hat und mit Gleichmacherei, Alltagsgrau,<br />
DDR-Bürokratie, Ersticken von Kreativität assoziiert worden<br />
ist.<br />
Gleichheit und Freiheit sind beides wesentliche Orientierungswerte<br />
für eine nachhaltig erfolgreiche Gestaltung demokratischer, republikanischer<br />
Gesellschaften. Die Gleichheit vor dem Gesetz ist Voraussetzung<br />
eines Rechtsstaates, der Willkür verhindert und die Freiheiten des Einzelnen<br />
sichert. Demokratische Rechte und Freiheiten stehen allen gleichermassen<br />
zu. <strong>Das</strong> Postulat der Gleichwertigkeit aller Menschen bedingt<br />
den gleichberechtigten Zugang zur Gesundheitsversorgung, zu<br />
Schulen und Universitäten für alle. Und was die materiellen Lebensverhältnisse<br />
betrifft: Unterschiede zwischen den geringsten und den<br />
höchsten Einkommen von 1:5, vielleicht auch noch von 1:10 mögen<br />
republikverträglich sein, solche von 1:300 oder gar 1:1000 sind es auf<br />
Dauer nicht. Vor allem dann nicht, wenn Niedriglohnjobs zunehmend<br />
prekarisiert werden und Langzeitarbeitslose gezwungen werden sollen,<br />
für ein Einkommen von 1000 Franken pro Monat zu arbeiten.<br />
<strong>Das</strong> Thema Gleichheit fand indirekt seine Fortsetzung in der Jahrestagung<br />
2005 zum Thema ›Mindestlohnpolitik in Europa‹, die wir zusammen<br />
mit dem deutschen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen<br />
Institut Düsseldorf (WSI) organisiert haben. Die anlässlich dieser Tagung<br />
formulierten Thesen wurden unter anderem in der ›Frankfurter<br />
Rundschau‹ integral publiziert und im europäischen Gewerkschaftsbund<br />
aufgenommen. Wir werden das Thema Löhne weiter verfolgen.<br />
<strong>Das</strong> Thema Gleichheit wird uns auch 2006 beschäftigen. <strong>Das</strong> Thema<br />
der nächsten Jahrestagung lautet ›Arbeit und Gleichheit‹. Stichworte<br />
dazu: Arbeit, Lohn und Existenzsicherung:<br />
Arbeit unter welchen<br />
Beat Ringger<br />
Bedingungen? Recht auf Arbeit 1955, Zentr<strong>als</strong>ekretär vpod und geschäfts-<br />
oder Zwang zur Arbeit? Abschied leitender Sekretär des <strong>Denknetz</strong>. Interes-<br />
von oder Erneuerung der Vollbesensschwerpunkte: Gesundheits- und<br />
schäftigung? Welche Arbeit hat Sozialpolitik, politische Ökonomie, Psycho-<br />
Zukunft: Mehr Service public, logie und Fragen der Ideologiebildung.<br />
222 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005
Pflege, Bildung, Kinderbetreuung, Kultur? Welche Anerkennung und<br />
Entlöhnung für welche Arbeit? Gesellschaftliches Grundeinkommen:<br />
ein Weg zur Solidarität oder zur Entsolidarisierung? Arbeit <strong>als</strong> Basis für<br />
Sozialversicherungsansprüche: unzeitgemäss und frauendiskriminierend?<br />
Die Jahrestagungen werden von der <strong>Denknetz</strong>-Kerngruppe verantwortet,<br />
die zudem die thematische Gesamtsicht betreut und damit innerhalb<br />
des <strong>Denknetz</strong>es die inhaltliche Gesamtverantwortung trägt. Sie<br />
wird vom Vorstand eingesetzt.<br />
Zusätzlich zur Kerngruppe arbeiten mittlerweilen vier <strong>Denknetz</strong>-Fachgruppen:<br />
• Die Fachgruppe ›Gesundheitspolitik‹ wird von Gesundheitsexpert-<br />
Innen gebildet, die die Grundlagen für eine kohärente, sozialpolitisch<br />
fortschrittliche Gesundheitspolitik erarbeitet haben (siehe die entsprechenden<br />
Artikel in diesem Jahrbuch).<br />
• Die Fachgruppe ›Gleichheit und Lohnpolitik‹ verfolgt die realen Entwicklungen<br />
zur gesellschaftlichen (Un)Gleichheit und wird dies mit einem<br />
neuen Gleichheitsmonitor für die Schweiz ab 2006 dokumentieren.<br />
<strong>Das</strong> Monitorkonzept wird in diesem Jahrbuch vorgestellt. Die Gruppe<br />
bleibt zudem am Ball beim Thema Löhne.<br />
• Die Fachgruppe ›Wirtschaftsmacht/Wirtschaftsdemokratie‹ beleuchtet<br />
Modelle und Erfahrungen zur demokratischen Einflussnahme auf<br />
wirtschaftliche Strukturen und Entscheide.<br />
• Die Fachgruppe ›Alter und Alterspolitik‹ nimmt sich dem Alter <strong>als</strong><br />
Phase der Biografie und <strong>als</strong> ›gesellschaftliche Existenz‹ an, und befasst<br />
sich mit der demografischen Entwicklung und der dazu laufenden Debatte,<br />
sowie mit der Ausgestaltung der Rentensysteme und des Pensionsalters.<br />
• Die Gruppe ›Rotbuch Schweiz‹ erarbeitet ein politisches Programm<br />
für eine soziale Schweiz – eine indirekte Antwort auf die neoliberalen<br />
Weissbücher der letzten Jahre. Diese Gruppe steht nicht unter der Verantwortung<br />
der <strong>Denknetz</strong>-Gremien, damit die für das Projekt nötigen<br />
inhaltlichen Freiheiten gewahrt sind.<br />
Ein wichtiges Ziel des <strong>Denknetz</strong>es ist es, WissenschafterInnen, Forscher-<br />
Innen einerseits, AkteurInnen aus NGOs, Verbänden und Politik andererseits<br />
zu vernetzen, dabei Synergien zu nutzen und gemeinsam im<br />
Denken weiter voranzuschreiten, was isoliert nur schwer möglich ist. Die<br />
Internet-Plattform des <strong>Denknetz</strong>es ist dafür ein Mittel, weil sie allen Mitgliedern<br />
<strong>als</strong> Publikations- und Kommunikationsplattform zur Verfügung<br />
steht.<br />
223 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005<br />
<strong>Denknetz</strong>
<strong>Denknetz</strong><br />
Zur Stärkung dieser Vernetzungsarbeit werden wir eine wissenschaftliche<br />
Redaktionsperson beauftragen, die aktuelle Forschung in den<br />
<strong>Denknetz</strong>-Themenfeldern zu verfolgen, wichtige Forschungsbeiträge zu<br />
rezensieren, die <strong>Denknetz</strong>-Site redaktionell zu betreuen und monatlich<br />
einen Mitglieder-Newsletter zu verfassen.<br />
Ab Herbst 2005 werden wir Interviews mit Fachleuten zu ausgewählten<br />
Themen durchführen, und zwar in einem für alle <strong>Denknetz</strong>-Mitglieder<br />
öffentlichen Rahmen. Kurze Artikel werden eine weitere Form<br />
sein, Themen und Debatten anzustossen. Die Interviews und Kurzartikel<br />
werden auf der Site publiziert und in einem Mitglieder-Newsletter<br />
annonciert.<br />
Diese beiden Formen erlauben uns, verschiedendste Themen rasch<br />
und unkompliziert aufzugreifen, zum Beispiel das geplante Freihandelsabkommen<br />
Schweiz–USA, finanzpolitische Themen, die ausserfamiliäre<br />
Kinderbetreuung usw. Sie sollen auch den Fachgruppen dienen, ihre<br />
Arbeit zu präsentieren und zu reflektieren – auch mal im Sinne eines<br />
›work in progress‹.<br />
In unseren inhaltlichen Aktivitäten beachten wir (nebst der Gleichheitsfrage)<br />
zwei weitere Transversal-Themen: Die Gendersicht und die<br />
Weltsicht. Es ist mittlerweilen common sense, dass geschlechtsspezifische<br />
Aspekte kein Spezialthema sind, sondern sämtliche Lebensbereiche<br />
betreffen und entsprechend transversal begriffen und bearbeitet<br />
werden müssen.<br />
Ähnliches gilt für die Ausweitung des Blicks auf den internationalen<br />
Kontext. Gerechtigkeit kann und soll nicht nur für die Schweiz bedacht<br />
werden, oder noch enger: nur für die SchweizerInnen in der Schweiz.<br />
Migrationsfragen, Nationalismen, die Rolle der Schweiz in der Welt –<br />
solche Aspekte sind in allen Themenfeldern wichtig.<br />
Selbstverständlich werden wir von nun an jedes Jahr ein Jahrbuch<br />
veröffentlichen, von dem wir uns zunehmend Wirkung gegen aussen<br />
erhoffen. Es soll einen festen Platz im politischen Diskurs der Schweiz<br />
gewinnen und in der Lage sein, Debatten zu beinflussen und Impulse zu<br />
setzen.<br />
All diese Aktivitäten sind nur möglich, weil die <strong>Denknetz</strong>-AktivistInnen<br />
ihr Wissen, ihre Denkkraft und ihre Zeit unentgeltlich einbringen.<br />
Ihnen allen sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt.<br />
224 <strong>Denknetz</strong> • Jahrbuch 2005