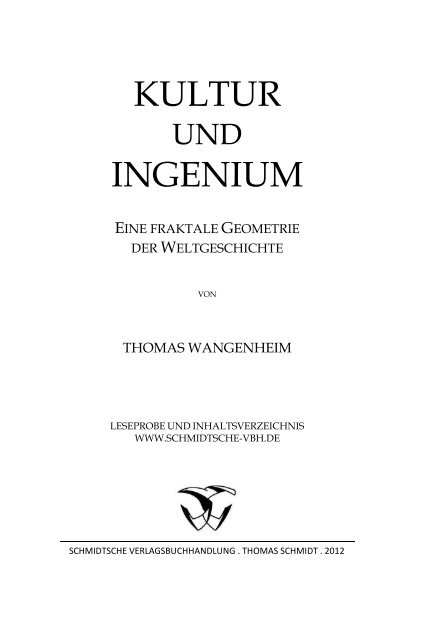Leseprobe - schmidtsche verlagsbuchhandlung
Leseprobe - schmidtsche verlagsbuchhandlung
Leseprobe - schmidtsche verlagsbuchhandlung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
KULTUR<br />
UND<br />
INGENIUM<br />
EINE FRAKTALE GEOMETRIE<br />
DER WELTGESCHICHTE<br />
VON<br />
THOMAS WANGENHEIM<br />
LESEPROBE UND INHALTSVERZEICHNIS<br />
WWW.SCHMIDTSCHE-VBH.DE<br />
SCHMIDTSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG . THOMAS SCHMIDT . 2012
SCHMIDTSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG . THOMAS SCHMIDT<br />
Alle Rechte an Bild und Wort, insbesondere der Übersetzung, vorbehalten.
INHALT
KAPITEL I<br />
EINLEITUNG
*<br />
In diesem Buch offenbart sich zum ersten Mal der Entschluß der<br />
Zeit, ihre Richtung umzukehren. Er stellt dem ewigen Altern die Verjüngung<br />
entgegen, dem Verfallsgedanken das Erwachen. Es ist der Wi ll<br />
e z u r B e h e r r s c h u n g d e r Z e i t , der sich in dieser neuen Schau<br />
seine Form verschafft.<br />
Die Zeit ist als Ausdruck des Werdens der Urstoff alles Geschichtlichen,<br />
alles Zukünftigen, des Lebens selbst. Das unmittelbare Erlebnis<br />
des Lebendigen lehrt uns ihren Wesenszug. Und doch sind wir darin einer<br />
großartigen Täuschung erlegen. Der absonderliche Charakter der<br />
Zeit – entgegen dem Körper im Raume – immerzu in ein und derselben<br />
Richtung dahinzuströmen, hat über Jahrtausende die Auffassung dieses<br />
merkwürdigen Fluidums bestimmt und uns damit seine eigenartige Natur<br />
des Unumkehrbaren aufgezwungen. Diese Philosophie hat zum letzten<br />
Ziele, die Zeit nun unter die Herrschaft des Denkens zu zwingen.<br />
So wie die mechanische Kraft den Körper im Raum aus der Bewegungslosigkeit<br />
befreit und ihm den Willen einer Richtung verleiht, so wird<br />
nun erstmals eine geistige Kraft erhoben, die Zeit umzukehren, die Richtung<br />
ihres Laufes in einem willentlichen Akt zu brechen. Ich diktiere<br />
mit dieser Schrift der Z e i t nach rückwärts zu gehen. Sie wird es widerstandslos<br />
hinnehmen, denn sie ist eine Schöpfung des Geistes erst.<br />
Es ist dieses freche Unterfangen bloß noch nie in Erwägung gezogen<br />
worden.<br />
In jenem Akte der Überwindung der Zeit wird es zugleich das Wesen<br />
des Jetzt sein, welches aus dem Strome des Daseins gerissen plötzlich<br />
nackt und in Scham, uns ewiglich getäuscht zu haben, darniederblickt.<br />
Wi r s i n d e s s e l b s t , die sich darin entkleiden, uns ehrlich<br />
gegenüberstehen, aus dem Flug durch Zeit und Raum endlich ruhig und<br />
reuevoll in die Beichte vor uns selbst treten. Denn Geschichte begreifen,<br />
verstehen was die Abfolge der Ereignisse, der Willensbekundungen<br />
jedes Zeitalters bedeutet, das wird erst möglich, wenn wir aus dem Jetzt,<br />
3
4<br />
EINLEITUNG<br />
dem sich verdunkelnden Gewordenen und dem geahnten Werden heraustreten<br />
und damit Zeit ansich schauen. Weil die Möglichkeit hierzu<br />
nie überhaupt nur in Betracht kam, ist auch noch keine von der Zeit losgelöste<br />
Anschauung des Historischen ausgesprochen worden. Man hat<br />
so niemals eine unpolitische, ohne Absichten und parteiische Gesinnungen<br />
durchtränkte Geschichtsphilosophie zu schreiben vermocht, sondern<br />
ohne Ausnahme die Anweisung, den Rat einer Zeit, ja eines gesellschaftlichen<br />
Willens aussprechen wollen. Die Vorstellung von einem Hohen<br />
und einem Niederen, von Gut und Böse mußte es bis in die letzten großen<br />
Entwürfe unseres Denkens tragen. In allen Äußerungen der Vergangenheit<br />
haben wir deshalb nichts als Vergangenes gesehen, manchmal im<br />
Schicksal der Kulturen etwas Zukünftiges für uns, sofern es die Zukunft<br />
der Alten war. D a ß a b e r u n s s e l b s t d i e Z u k u n f t Ve r g a ng<br />
e n h e i t i s t , daß es ein inhärentes Gebaren der Zeit ist, n i c h t f o r tz<br />
u s c h r e i t e n , sondern immer und immer wieder u m z u k e h r e n , das<br />
haben wir in unserem stetigen Eindruck vom Jetzt und der rein äußerlichen<br />
Täuschung des Alterns immer übersehen.<br />
Jenen Wechsel des Zeitlaufs in den Epochen, den Ständen, den<br />
Geschlechtern, den politischen Herrschaftsverhältnissen und ästhetischen<br />
Formensprachen, am Ende zwischen Realismus und Idealismus,<br />
Determiniertheit und Zufall – nämlich der vorliegenden Weltkonstruktion<br />
selbst – als Ausdrücke e i n e s Prinzips zu verstehen und damit uns<br />
selbst, ist diese G e o m e t r i e d e r G e s c h i c h t e geschrieben. Das<br />
Moment der Fraktalität, der Selbstähnlichkeit, die aus ihrer Systematik<br />
heraus doch zum Zufälligen gelangt, wird das Mittel sein, die bisherige<br />
Unvereinbarkeit des größten philosophischen Dualismus aufzuheben:<br />
Gesetz und Zufall, Schicksal und Wille. In dieser Vereinigung der<br />
schärfsten Widersätze eröffnet sich zugleich eine völlig neue Form der<br />
Toleranz des Blicks, welche vom Gang der Zeit losgelöst eine Geschichte<br />
des Menschengeschlechts ermöglicht, die bisher noch kaum<br />
geahnt werden konnte.<br />
Es ist ein Bild, das im Ganzen erst jetzt – die großen Kämpfe des<br />
Geistes und der Waffen unserer abendländischen Geschichte hinter uns<br />
– in reichlicher Beklemmung und doch zugleich gespannter Entschlossenheit<br />
zu Papier gebracht werden konnte, da wir jene Kämpfe bereits<br />
wieder herannahen sehen.<br />
*
EINLEITUNG<br />
Dem Licht stellt sich die Nacht entgegen, dem Schauen das Begreifen.<br />
Das Werden ahnungslos erblicken, heißt ihm dienstbar zu sein. In<br />
ihm den Ausdruck eines Gesetzes erkennen, heißt es beherrschen. Deshalb<br />
ist alle Geschichtsphilosophie verfehlte Beschaulichkeit, wenn nicht<br />
die Werkstatt der Geschichte aufgestoßen, dem Werden bei der Fertigung<br />
seines Meisterstücks – der Weltgeschichte – zugesehen, das Werkzeug<br />
selbst erschaut wird.<br />
Bereits die bloße Scheidung der historischen Gebilde, der Antike,<br />
Ägyptens oder des Abendlandes, des Barock oder der Romanik, hat uns<br />
überzeugt, daß Geschichte nicht beliebig verläuft, keine Ansammlung<br />
zufälliger Erscheinungen ist, sondern eine Struktur besitzt. Doch es heißt<br />
etwas Verschiedenes, eine Gestalt zu erkennen, und begreifen, wie sie<br />
zustande kommt. Was also bedeutet die Form der Kultur? Weshalb stehen<br />
das ägyptische, antike und das abendländische Wesen so deutlich<br />
voneinander geschieden vor uns? Warum erkennen wir zwischen ihnen<br />
Übergänge? Ist ihr Aufkommen zufällig? Gehorcht die Bildung der Kulturen<br />
einem Gesetz?<br />
Ist es eine Laune der abendländischen Geschichte, daß die Gotik<br />
auf die Romanik folgt? Hätte auch der Barock an die Gotik anschließen<br />
können? Wäre eine römische Geschichte unter Ausschluß der Republik<br />
möglich gewesen? Hätte die attische Tragödie oder der Armanastil des<br />
Neuen Reiches übergangen werden können? Unterliegen diese Formen<br />
des Daseins einer inneren Notwendigkeit ihrer Abfolge? Waren sie in<br />
einer strengen Beziehung zueinander unumgänglich? – Die Bedingtheit<br />
der Geschichte ist immer mit kurzgreifenden Kausalitäten der Fachwissenschaft<br />
beantwortet worden, manchmal mit großzügigen Stufen- und<br />
Alterstheorien. Nie hat man bemerkt, daß grundlegendere Gesetzmäßigkeiten<br />
bestehen, die jene Bedingungen des Historischen erst bestimmen.<br />
Die Versuche, Kultur als Organismus aufzufassen und unser Leben<br />
mit dem Werden der Kultur in eins zu setzen, hat dabei nur wenig mehr<br />
eröffnet, als eine allgemeine Analogie der Lebensalter jener Kulturen,<br />
und statt neuer Klarheit schließlich lediglich die gleichartige Frage aufgeworfen,<br />
welche Kräfte denn dieses Leben selbst, und damit eben auch<br />
den Verlauf der Geschichte zu begründen vermögen. Wir hatten eine<br />
Analogie entdeckt, welche jedoch keine Antwort auf unsere Frage nach<br />
dem P r i n z i p der Geschichte geben konnte, sondern uns das historische<br />
Rätsel mit dem des Lebens gleichsetzte. Wir waren keinen Schritt<br />
vorangekommen.<br />
5
6<br />
EINLEITUNG<br />
Ganz im Gegenteil! Im Glauben an biographische Stringenz mußte<br />
Spengler in seiner „Morphologie der Weltgeschichte“ gar ganz absonderliche<br />
Verfehlungen jenes lebendigen Organismus übertünchen.<br />
Da Antike und Abendland Ausdrücke verschiedener Biographien waren,<br />
verschiedenen „Ursymbolen“ entsprungen sein mußten, konnte jede antike<br />
Äußerung im Abendland, wie ebenso jede abendländische Äußerung<br />
in der Antike nur „Verirrung“ 1 sein. Aber im Leben gibt es keinen<br />
Irrtum, sondern nur Ausdrücke unserer Gemütsverfassung. Können wir<br />
sie nicht erklären, so ist dies kein Übel des Lebens, sondern der Theorie,<br />
die der Begründung des Lebens offenbar unfähig ist. Man hat bis<br />
heute nicht begriffen, wie eng diese strenge Festlegung auf das Ursymbol<br />
nichts weiter war, als der noch immer vorherrschende Glaube an das<br />
Gute, die Kultur, der Ekel aber vor dem Bösen und dem Untergang.<br />
Und bei Lichte betrachtet hat in dieser Einseitigkeit verharrend die<br />
Geschichtswissenschaft aus einem tiefen Mangel an wirklichen Begründungen<br />
zu a l l e n historischen Erscheinungen, allen Stilen und Epochen<br />
einen ebensolchen Ausspruch der Verirrung getan. Durch unzählige<br />
Kleinstabhängigkeiten übergeht sie dieses Problem bis heute in einem<br />
naiven Kausalitätsglauben und hat damit jeden historischen Blick, jedes<br />
geschichtliche Gespür verloren und unser innerstes Verlangen nach dem<br />
Verstehen schlichtweg unbefriedigt zurückgelassen. Deshalb bedeutet<br />
sie heute nichts mehr, ist seit 100 Jahren im Niedergang begriffen und<br />
zu einem Spiel unter Akademikern geworden, deren Geschichteleien<br />
keinem Mann fern des Faches zu lesen in den Sinn käme, sofern nicht<br />
wieder einmal ein Jubiläum die schon tausendfach geschriebenen Bücher<br />
wiederkäut. 2 Die Geschichtswissenschaft war aus dieser Froschperspektive<br />
nie in der Lage, das Aufkommen eines neuen Zeitalters tatsächlich<br />
zu m o t i v i e r e n – ganz wie Spengler auch, der die Wurzel<br />
1 so die Renaissance als eine Verirrung der abendländischen, der „faustischen“ Seele<br />
– ein Gedanke, der bereits in Chamberlains „Grundlagen des 19. Jahrhunderts“<br />
(1899) hervortritt: „Die angebliche Renaissance“, „der verderbliche Begriff der<br />
Renaissance“. Beide sprechen damit lediglich eine subjektive Abneigung gegenüber<br />
dem Antipoden des Mittelalters aus, welche noch aus der Romantik des frühen 19.<br />
Jahrhunderts herrührt. Eine weitere Verirrung hätte Spengler darin behaupten müssen,<br />
daß nach seiner Beobachtung der Höhepunkt abendländischer Architektur in die<br />
Gotik, derjenige der Literatur aber ins Jahr 1800 fällt – eine um 400 Jahre<br />
merkwürdig verfehlte Inzidenz.<br />
2 Einen Mann von Weitblick, der es wagen würde eine Weltgeschichte zu verfassen,<br />
einen Ranke oder Meyer, suchen wir heute vergebens.
EINLEITUNG<br />
jeder Kultur in einen unerklärlichen, göttlichen Funken, den Keim der<br />
Kultur, jenes „Ursymbol“ legen mußte. Wo aber keine Begründung ist,<br />
keine notwendige Folge, dort kann nur Zufall sein, Verirrung. So ist denn<br />
das Aufkommen eines jeden Ereignisses und jeder Struktur in der Geschichte<br />
am Ende doch nichts weiter als eine Ansammlung von faktischen<br />
Wissensbeständen, von Tatsachen geblieben.<br />
Man hat deshalb die Erscheinungen der Geschichte immer bloß enzyklopädisch<br />
diktieren können und geschichtliches Wissen für die Kenntnis<br />
von Fakten gehalten: Jeder mußte auswendig lernen, daß Aischylos,<br />
der erste weithin überlieferte Dichter altgriechischer Tragödien, in einer<br />
Revolution des Dramas im 5. Jh. v. Chr. einen zweiten Schauspieler auf<br />
die Bühne stellte. Doch hat bis heute jemand begriffen, warum es so unbedingt<br />
nötig war, ja d a ß es unbedingt nötig war, daß dies geschah? Es<br />
ist eben nicht bloß eine Tatsache der Geschichte, von der man Jahreszahl<br />
und Dichternamen auswendig lernt, ist nicht bloß die Geburt der<br />
klassischen Tragödie, ein Fortkommen der Literatur seit Homer, sondern<br />
ward aus einem P r i n z i p heraus geboren und mußte deshalb so<br />
notwendig erstehen, wie die Polis der Griechenwelt als neue politische<br />
Form nicht zu verhindern war. Nicht ihr paralleles Einsetzen als eine<br />
süffisante Analogie meine ich, sondern die Tatsache, daß sie überhaupt<br />
aus der archaischen Kultur des frühen Griechenland entkommen. Sie<br />
sind so folgerichtig, wie Vorzeichenwechsel in einer alternierenden mathematischen<br />
Reihe.<br />
Die kopernikanische Wende sollte eine Renaissanceidee der gerade<br />
erwachten Neuzeit sein, sollte als Befreiung aus der christlichen Naivität<br />
gelten dürfen. Und doch hat sich jene Idee des Thorner Astronomen<br />
Ende des 15. Jh. schließlich für fast 100 Jahre in Luft aufgelöst, um<br />
erst mit Galilei wieder diskutiert zu werden. Zugleich ist es das Jahr<br />
1500, mit welchem die Malerei der Renaissance jene Form erhält, die<br />
man immer so gern als den endgültigen Beweis für die hohe Meisterschaft<br />
dieser Epoche herangezogen hat, obgleich sich doch hier mit einem<br />
Schlage die eigentliche, nämlich die Renaissancemalerei des 15.<br />
Jahrhunderts, völlig umkehrt. Nicht nur, daß diese beiden deckungsgleichen<br />
Phänomene durchweg schlicht übergangen werden – wo eigentlich<br />
ein neuer Stilbegriff not täte – man hat gar, indem die Malerei seit 1500<br />
eben „venezianisch“, statt „florentinisch“ genannt wurde, ganz recht eine<br />
neue Wesensart der Malerei empfunden und doch keine Ahnung von<br />
7
8<br />
EINLEITUNG<br />
der eigentlichen Bedeutung dieses Wechsels verspürt. 1 Denn auch hier<br />
ist es nicht die bloße Parallelität der Erscheinungen, sondern die Tatsache,<br />
daß sie aus einem gemeinsamen Weltgefühl heraus entstehen – eines,<br />
das weder abendländisch noch antik ist, sondern wesentlich feineren,<br />
subtileren und zugleich brachial elementaren Gesetzen gehorcht.<br />
Das Interregnum des 13. Jh., jene Ausnahmeerscheinung im Römisch-Deutschen<br />
Reich des Mittelalters, in welchem die Königswürde<br />
nicht mehr aus dem deutschen Adel gestellt, sondern von fremden Titularkönigen<br />
Europas getragen wurde, ist am Ende ein ebenso unverstandenes<br />
Gebaren der Geschichte geblieben. Dabei ist es gerade kein Zufall,<br />
daß hier die Romanik in ihrem ideellen Höhepunkt austrägt, was<br />
sie seit dem Bußfall von Canossa schon erstmals angedeutet hatte. Und<br />
ebenso notwendig kehrt sich mit dem Ende des Interregnums die gesamte<br />
Herrschaftsform der Romanik in ihr Gegenteil um, als zugleich eine<br />
ganz neue, nämlich erstmals wieder christliche Religion im Wortsinne<br />
mit der ihr angehörigen Kunstauffassung hereinbricht, wie sie der alte<br />
Stil nie erlebt hatte.<br />
Daß der Realismus des späten 19. Jh. gerade keine künstlerische<br />
Fortentwicklung der Romantik ist, sondern ein Gegenentwurf und zugleich<br />
mit ihr als Einheit gegen die Frühe Neuzeit steht, gehört ebenso<br />
dazu, wie die Tatsache, daß Napoleon ein ungeheures Symbol der Moderne<br />
sein mußte, als er das Ancien Régime überwand. Es sind dieselben<br />
Verhältnisse, welche die Demokratie des 20. Jh. und ihre diktatorischen<br />
Antipoden hervorgebracht haben. Der Wechsel der alten<br />
Pharaonenherrschaft ins feudalistische Mittlere Reich des 18. Jh. v. Chr.<br />
sowie der Aufstieg ottonischer Herrschaft fast drei Jahrtausende später<br />
bedeutet das Ebengleiche.<br />
Nie hat man begriffen, warum der römische Senat 500 Jahre lang<br />
mit Entschiedenheit das Königtum abgelehnt hat und auch gegenüber<br />
Cäsar noch ebenso scharf verneint, schließlich aber Augustus nur wenige<br />
Jahre später fast wie selbstverständlich die Amtsmacht des Monarchen<br />
verlieh. Nie hat man begriffen, warum die Republik – ganz wie die<br />
attische Polis, der deutsche Reichsverband der Frühen Neuzeit und die<br />
Fürstenherrschaften des 12. Jh. – ausschließlich Kriege der Staatsraison<br />
geführt haben, die Kaiserzeit aber nach dem unfruchtbaren Britannien<br />
1 und auch die Bezeichnungen des Cinquecento und Quattrocento geben diese sehr<br />
richtig getroffene Scheidung, doch nie geschaute A b h ä n g i g k e i t jener Malstile an
EINLEITUNG<br />
ausgriff, die Kreuzzüge in ein zweitausend Kilometer entferntes heiliges<br />
Land drängten, Alexander und die Seefahrer um 1500 die Grenzen<br />
der Welt ausspähen wollten.<br />
Tausend Beispiele könnten nicht genügen, um die Blindheit des äußeren<br />
Wissens gegenüber dem inneren Verständnis vorzuzählen. All das<br />
wurde immer bloß auswendig gelernt, in Tabellen, Zeitleisten und Faktensammlungen<br />
eingetragen, ohne je an sich herangelassen zu haben,<br />
daß es einem Prinzip gehorcht – dem Prinzip des Wechsels. Nicht irgendeines<br />
Wechsels, wie man ihn gern heranzieht, um die Wendungen<br />
der Geschichte zu erklären, und schließlich nie scharf umrissen hat, sondern<br />
zweier e n g u m g r e n z t e r Z u s t ä n d e , deren Wirkung geradezu<br />
mathematisch g e s c h l o s s e n , n ä m l i c h v o r h e r g e s a g t u n d<br />
a b g e l e i t e t werden kann, statt dies alles bloß zu glauben und zu wissen.<br />
Ich behaupte deshalb, mit diesem Werk recht eigentlich ein L e h rbuch<br />
vorzulegen, das e r s t e Lehrbuch der Geschichte – eines das nicht<br />
aufzählt, sondern ein Prinzip lehrt, aus welchem Geschichte k o n s t r ui<br />
e r t w e r d e n k a n n , ohne von den Einzelerscheinungen überhaupt<br />
Kenntnis zu besitzen. Von der „Verirrung der Renaissance“, dem „Unverständnis<br />
des Abendlandes für die Antike“, über das Epochenjahr 1800,<br />
die religiöse Revolution des Echnaton, den Untergang der frühgriechischen<br />
Basileis, den Einbruch des Portraits in die römische Plastik und<br />
sein Verschwinden werden nun all diese scheinbar unabhängigen Erscheinungen,<br />
welche man nur immer ganz farblos zusammengehäuft<br />
hat, zum Ausdruck eines abstrakten Prinzips aufgerichtet. Daraus erst<br />
kann uns bewußt werden, was den eigentlichen Antrieb für die Formensprache<br />
des Barock gegeben hat, für die Geburt der Gotik, die Idee der<br />
Quantenmechanik und des kopernikanischen Weltbildes, den Untergang<br />
der Villikationsverfassung des Frühmittelalters, die römische Wandmalerei<br />
der Bürgerkriegszeit und des Prinzipats, das Wesen der Infinitesimalrechnung,<br />
die Bewegung in den spätscholastischen Voluntarismus,<br />
den modernen Roman um 1900, die Notwendigkeit des Wagnerschen<br />
Tristan, den Drang zur jugendlichen Tat, das Bedürfnis des Greises nach<br />
dem Schlaf.<br />
Man wird aus prinzipiellen Gründen entscheiden können, welche<br />
Herrschaftsform die Zeit der Römischen Republik besitzt, welcher Art<br />
die Literatur und Malerei des 19. Jh. ist oder auch der augusteischen<br />
Zeit, aus prinzipiellen Gründen erhält damit die musikalische Form des<br />
Barock ihre Prägung, wird das Geschlechterverhältnis und dasjenige der<br />
9
10<br />
EINLEITUNG<br />
Generationen bestimmt, aus prinzipiellen Gründen wird man die Gestalt<br />
des Dramas und den Stand der Kreditwirtschaft ablesen können – allesamt<br />
ohne auch nur ein einziges Faktum der Geschichte zu kennen.<br />
So kommt es, daß in diesem Buch die Anleitung gegeben wird, das<br />
Wissen der Geschichte zu e r r e c h n e n . So wie wir einen mathematischen<br />
Satz aus den Axiomen herleiten, so werden wir aus dem Prinzip<br />
der Geschichte die Grundströmungen der Zeiten, der großen Epochen,<br />
der Stile, hinab bis in die Generationen ableiten und gerade darin ihr<br />
Verhältnis untereinander begreifen können, die F o l g e d e r S t i l e .<br />
Gar das Wesen der Kulturen, der ägyptischen, der antiken und abendländischen,<br />
dieser ganze Jahrtausende umfassenden Entitäten selbst,<br />
wird aus diesem Prinzip verstanden ein erschreckend trivialer Vorgang<br />
sein – und darin die Ursymbole, welche Spengler einst als unbegründbare,<br />
wenn auch fein beobachtete Voraussetzung der Kultur genannt hat,<br />
Ergebnis jenes g e s c h i c h t l i c h e n G r u n d g e s e t z e s werden, welches<br />
in diesem Buche zur Darstellung kommt.<br />
So scheint aus jener elementaren Gesetzmäßigkeit der Abwechslung<br />
zweier Zustände ein streng kausales Walten in der Welt postuliert.<br />
Doch unter der fraktalen Behandlung jenes Kausalgesetzes geschieht eine<br />
recht wundersame Wendung: Indem der Wechsel nicht einem Pendel<br />
gleich in stetiger Einfalt eins zum andern tauscht, sondern – um bei jenem<br />
Bilde zu bleiben – zur Bewegung eines kleineren Pendels an einem<br />
größeren gerät, ja erst die Bewegung mehrerer, ja unendlich vieler aneinander<br />
aufgehängter Pendel bedeutet, welche allesamt für sich und<br />
unter der Bewegung der anderen durcheinanderschwingen, so ist, ohne<br />
doch von der strengen Berechenbarkeit des Pendels abgerückt zu sein,<br />
schließlich ein chaotisches, ja zufälliges Motiv in jene Maschine geraten,<br />
die wir doch so mechanisch entworfen hatten.<br />
Über das Moment der Vielheit für sich kausaler Vorgänge tritt immer<br />
mehr das Unüberschaubare in die Welt. In der unendlich fortgesetzten<br />
Konstruktion aber ist bereits der Zufall aufgerufen, und die Emergenz,<br />
das rauschende Chaos – unbeherrschbar mit dem Kausalgesetz –<br />
Tatsache geworden. Das Denkmoment des Fraktalen, welches uns in<br />
seiner vielleicht anschaulichsten Form – dem Geschichtlichen – noch<br />
gegenübertreten wird, ist so zum Mittler zweier bisher unvereinbarer<br />
Gegensätze erwachsen.<br />
So kommt es, daß an diesem Phänomen nun ganz unvermittelt die<br />
höchsten Fragen des menschlichen Denkens in Auflösung geraten. Denn
EINLEITUNG<br />
die Freiheit, der menschliche Wille, die potentia dei absoluta, all jenes,<br />
was immer schon gegen Kausalität und Gesetzhaftigkeit in der Geschichte<br />
gestanden hat und dagegen den Zufall und das Unvorhersehbare des<br />
Lebens setzte, ist im Fraktalbegriff ganz ebenso enthalten, wie der Glaube<br />
an strengsten Determinismus, an Vorbestimmung allen Tuns, an die<br />
potentia dei ordinata, wie Duns Scotus es nannte, der Glaube an die unumstößliche<br />
Ordnung in der Welt. Das Fraktal ist logisch-kausal erzeugt.<br />
Doch in der Masse dessen gibt es sich dem Zufall hin.<br />
Was über zweieinhalbtausend Jahre philosophischen Streit hervorrief,<br />
das vereinigt sich hier in e i n e m Begriff. Dieser wäre konturlos<br />
und nichtssagend, wenn er nicht i n s i c h eine neue Dimension eröffnen<br />
würde: Denn Fraktalität, Selbstähnlichkeit heißt sich selbst zu bespiegeln,<br />
heißt das Bild des Bildes schauen, heißt nach der Bedingung<br />
der Möglichkeit fragen, heißt reflektieren. Dies ein Vorgang, der beliebig<br />
oft auf sich selbst anwendbar ist, ohne aus der gegebenen Menge –<br />
denn sie bespiegelt sich selbst – herauszuführen. Der Begriff des Fraktalen<br />
ersetzt so die Spaltung in Determinismus und Zufall, in Ordnung<br />
und Wille, in Gesetz und Urteil, in System und Emergenz, in Wahrheit<br />
und Unbestimmtheit. Das ist es, was das Fraktale zu einer Denkgröße<br />
macht, welche das Ganze zu beherrschen in der Lage ist. Wir wollen<br />
diese Herrschaft nun antreten.<br />
Doch ehe die Fraktalität zum Prinzip erhoben werden kann, gilt es<br />
jene Zustände zu bestimmen, welche ihm unterliegen sollen. Diese allererst<br />
zu erschauen, treten wir nun in die Geschichte ein.<br />
*<br />
Dessen wir zu lang entbehren mußten, hegen wir einen heißen Durst.<br />
Was uns ununterbrochen begleitet, lernen wir tief zu verachten. Darin<br />
hassen wir schließlich uns selbst und kehren uns in das Vergangene, ernennen<br />
es zu unserer Zukunft. Das ist der tiefere Grund für alle Renaissancen<br />
und romantischen Bewegungen der Geschichte. Das Abendland<br />
hatte sich mit dem Ausklingen der Gotik erstmals satt 1 und ersann<br />
schließlich in den letzten beiden Jahrhunderten aus ebendiesem Gefühl<br />
neuerstanden d a s P r o b l e m d e r A n t i k e .<br />
Aus einer merkwürdigen Sicherheit heraus ist seitdem das bedeutendste<br />
Problem der Geschichtsphilosophie unser Verhältnis zu den Al-<br />
1 Es ist die Tragweite dieses Vorgangs jetzt noch ganz unverständlich.<br />
11
12<br />
EINLEITUNG<br />
ten geworden. Die Renaissance und der Klassizismus waren noch unreflektiert<br />
antikenbegeistert. Seit der Romantik, welche erstmals auch<br />
künstlerisch einen Hauch der Überzeugung in sich trug, dem klassischen<br />
Altertum nun eine ähnlich bedeutende Kunst entgegenzusetzen, ist der<br />
Widersatz aus Antike und Abendland zum führenden Problem des Geschichtsverständnisses<br />
geworden. Selbst Spengler, der ursprünglich sieben<br />
Kulturen gleichwertig nebeneinanderzustellen versprach, verliert<br />
sich letztlich nur in wenigen Andeutungen, was Ägypten, Mesoamerika<br />
oder China betrifft – dafür sprudelt es unaufhörlich zum Verhältnis<br />
der abendländischen zur antiken Seelenverfassung.<br />
Wir sind heute erstmals fähig, das Problem der Antike überhaupt<br />
als das ranghöchste Problem unseres historischen Sinns wahrzunehmen,<br />
es als unseren inneren Drang zu verstehen – und zwar, w e i l e r i n<br />
u n s a b g e s t o r b e n i s t . All die ferne Grandesse und fantasiegeschwängerte<br />
Idealgeschichte vom Weltreich Rom und den etwas einfältigeren,<br />
aber geistig um so höheren Griechen, ist uns mittlerweile fad<br />
geworden. Wir können die Begeisterung des 19. Jahrhunderts für diese<br />
Frage kaum noch nachempfinden. Und das ist keine zufällige Erscheinung,<br />
sondern liegt in einem schweren Verlust begründet. Wir haben<br />
verloren, was auch der Antike fehlte: unsere Religion. So wie wir dem<br />
Atheismus nicht mehr zustreben, sondern ihn e r r e i c h t haben, 1 und<br />
deshalb der unchristlichen Antike keine Träne mehr nachtrauern, so haben<br />
wir die Antikenbegeisterung als Vorbild ganz folgerichtig abgewählt<br />
und an ihre Stelle bereits seit 200 Jahren die Romantik gesetzt.<br />
Jene hehren Statuen aus der Hand Polyklets, Myrons oder des Lysippos<br />
ließen uns in sprachloser Andacht zurück, der Speerträger, der<br />
Augustus von Primaporta, der Diadumenos und die Nike von Samothrake<br />
konnten uns lediglich in schweigendes Staunen versetzen und<br />
schamvoll den Blick zu Boden sinken lassen; die feinen Proportionen<br />
des Parthenon, das erhabene Geleit des Zeus-Altars von Pergamon, die<br />
gemessene Sprache des dorischen Ornaments, die Klarheit der Formgebung<br />
griechischer Stadien und Theater, der römischen Rundtempel, der<br />
zum Initialproblem der Baukunst erhobene Triglyphen-Konflikt und die<br />
unscheinbare Bewegung vom ionischen zum korinthischen Kapitell über-<br />
1 Und das ist eben kein Ausdruck der Moderne und Aufklärung, sondern ein ganz<br />
natürlicher Gang der Kultur, wie ihn die Geschichte auch mit der Renaissance<br />
bereits erlebt hatte.
EINLEITUNG<br />
ragten das ewige architektonische Suchen des Abendlandes, als wolle<br />
es uns in stiller Weihe durch unser bloßes Betrachten an dieser Akkuratesse<br />
des Lebens teilhaben lassen; so wie wir seit dem 12. Jh. eifrig Aristoteles<br />
studierten, später Platon, die Neuplatoniker und dabei nicht anders<br />
konnten, als sie für „die Philosophen“ schlechthin zu erklären; wir<br />
waren uns immer bewußt, unsere gesamte Rechtsgelehrsamkeit den Römern<br />
zu verdanken; noch die Offiziersschulen des 19. Jh. lasen eifrig<br />
die Feldherrenkapriolen bei Leuktra, am Granikos und bei Cannae, um<br />
für ihre eigenen Heldenstücke zu lernen; kein abendländischer Dichter<br />
hatte es vermocht eine Ilias zu schreiben, kein Vergil war abzusehen,<br />
allerhöchstens ein paar Romanciers, die dem hellenistischen Verfallsbild<br />
nahekamen; ja, das schiere Format des Römischen Weltreiches, der<br />
gigantische Feldzug Alexanders: All dem hatten hunderte Jahre abendländischer<br />
Geschichte – im 19. Jh. war es ein Jahrtausend geworden –<br />
nichts Würdiges entgegenzusetzen. Es schien die Perfektion des zivilisierten<br />
Daseins gewesen zu sein, allein anschaulich zu machen in einer<br />
Flut fantastischer Historienmalerei, die jene Sehnsucht ins Unermeßliche<br />
entgleiten ließ. Träumer waren wir in ihrem Antlitz geworden.<br />
Und doch strotzte ein so offensichtlicher Makel aus der antiken<br />
Welt, frech lachend und unverhohlen hell, nichtssagend, geistlos, primitiv,<br />
barbarisch, ja unverständlich für unsere so treu schmachtenden Seelen,<br />
daß es in uns erst jene Ambivalenz erschuf, welche die alte Welt<br />
schließlich unbegreiflich machte – in Zuneigung, wie in Abscheu. Denn<br />
alle haben wir diesen Bruch der Begeisterung gespürt, nie aber ward er<br />
klar ausgesprochen und zugleich mußte er uns ständig schmerzlich begleiten:<br />
Niemand hatte sich ernstlich gefragt, wie die höchste Kultur,<br />
welche wir zu schauen in Dank so lang herniedersanken, nur eine d e ra<br />
r t p r i m i t i v e R e l i g i o n hervorbringen konnte! D a s war – heute<br />
erst ist der Blick darauf freigegeben – das eigentliche Problem der Antike.<br />
Es ist zugleich der Augpunkt, von welchem aus das Wesen der Weltgeschichte<br />
sich ganz ins Licht ergießt. Es ist ein schmerzlicher Blick, eine<br />
Wunde im Bild der Alten, die wir nun endgültig zu schließen fähig<br />
sind – denn es ist recht eigentlich die unsere. Wir haben es immer geahnt,<br />
nie hatten wir den Mut es auszusprechen, den Mut uns jene Frage<br />
zu stellen, welche so eng an unser Empfinden griff, daß wir die Zerstörung<br />
eines Ideals befürchten mußten – edle Einfalt, stille Größe.<br />
Es stand so ganz frei und unbetrübt, so klar und lebensbejahend vor<br />
uns, wie wir uns selbst gern erhoben hätten aus der ewig dunklen See-<br />
13
14<br />
EINLEITUNG<br />
lenwelt des Abendlandes. Unsere Religion – jene, welche die Antike nie<br />
ganz zu fassen vermochte, das Christentum – war der Kern der abendländischen<br />
Gefühlswelt geworden. 1 Sie stand nicht der Tat, sondern dem<br />
Gedanken nahe, nicht der Feier, sondern der Trauer, nicht dem Leben,<br />
sondern dem Tode, sie war nicht denkbar in der aufrecht die Arme gen<br />
Himmel reckenden Anrufung, sondern allein im Niederknien, im gedankenversunkenen<br />
Gebet. Wir hatten nie etwas Tieferes ersonnen, als diese<br />
eigentlich ausschließlich gotische Wesensform seelischen Leidensdranges.<br />
In der Selbstkasteiung wollten wir unseren sphärischen<br />
Übergang in den Tod vordenken, in einem fahlen Büßergemüt, in der<br />
Sehnsucht nach Schuld und Sühne für nie begangene Taten, nach<br />
Schmerzen schmachtend, in der Trauer den höchsten, in der Beweinung<br />
den edelsten Akt vor Gott erblicken, dem Gebot des reinsten Gewissens<br />
genügen. Das Ahnen des Himmelreiches, des Himmelreiches, das inwendig<br />
in uns war, jene seelische Entrückung äußerster Raumerfahrung<br />
i n u n s , konnte ein antiker Götterglaube nicht in den ungefährsten Umrissen<br />
ermessen. Die Gewalt des Inneren kannte der antike Mensch ebensowenig,<br />
wie der abendländische die äußerliche, die Gewalt des zivilisierten<br />
Lebens, die Erhabenheit einer Herrenklasse durch die Tat, eine<br />
Herrschaft der Tüchtigen nie recht empfunden hat – denn das mußte Verrat<br />
an Christus sein, der Sünden schwerste Sünde.<br />
Als die Römer 396 v. Chr. an einem Scheidepunkt ihrer italischen<br />
Machtausdehnung stehen und den Sturm auf die bereits seit Jahrhunderten<br />
blühende Stadt Veji vorbereiten, da bricht in einem schreienden Kontrast<br />
die ganze Primitivität der antiken Religion in ihrer absurden Einfältigkeit<br />
durch. Der römische Heerführer Camillus ist es, der vom<br />
Feldherrenhügel aus das Gebet nicht an die eigenen Götter, sondern die<br />
Juno Regina, die Stadtgöttin Vejis, richtet. Ihrer Gunst will man sicher<br />
sein, wenn zum Angriff geblasen wird. Dazu stellen sich die römischen<br />
Priester allen Ernstes vor die Mauern der Stadt, um die Juno herauszurufen.<br />
Und wie tut man das? Indem ihr ewige Verehrung und ein herrlicher<br />
Tempel in Rom versprochen wird. Dort soll sie einziehen dürfen,<br />
wenn sie den Eroberern beisteht. D a s ist antiker Götterglaube. 2 Man<br />
1 Es hat eine tiefe Bedeutung, daß das Christentum nur der Spätantike überhaupt<br />
etwas sagen konnte, zuvor aber unmöglich sein mußte.<br />
2 so Livius V, 21 – Alle Abweichungen davon in der vorsokratischen Philosophie und<br />
auch bei Aristoteles und in der Stoa unterliegen einem ebenso klaren Prinzip, wie auch<br />
das abendländische Verständnis über die Jahrhunderte schwankt. Es wird uns ein<br />
wesentliches Merkmal der Stilfolge werden.
EINLEITUNG<br />
mache sich das klar: eine Götterwerbung, Bestechung! Die Götter wenden<br />
sich tatsächlich dem Meistbietenden zu! Wer könnte nur ernstlich<br />
im Christentum auf eine solch abstruse Idee gekommen sein! Noch der<br />
erste christliche Kaiser des Römischen Reiches, Konstantin, der sich<br />
auch erst auf dem Sterbebett wird taufen lassen – gewissermaßen um<br />
bei allen Göttern versichert zu sein –, hat sein Bekenntnis zu Sol invictus<br />
nie abgelegt und Christus nur als weiteren Gott aufgenommen, welcher<br />
den Sieg an der Milvischen Brücke verleihen sollte. Und tatsächlich!<br />
Die Römer siegen 312 n. Chr. und auch 396 v. Chr.! Juno bekommt<br />
auf dem Kapitol ihren eigenen Tempel und das Christensymbol wird ab<br />
sofort auf die Legionärsschilde gepinselt. Und wenn ein paar Jahrhunderte<br />
nach Veji in den verstärkten Handelsbeziehungen zu Ägypten die<br />
Gottesmutter Isis zu verehren ist, so kommt auch das. Und wenn übermorgen<br />
der Kaiser anzubeten ist, dann kommt auch das. Die Römer hätten<br />
nicht einmal davor zurückgeschreckt einen Sesterz anzubeten. Für<br />
sie war das eine Frage von Erfolg und Niederlage, von Leistung und Gegenleistung,<br />
eine Frage des Handels.<br />
Deswegen haben die überlieferten Wunder der antiken Götterbilder,<br />
das Nicken oder Tropfen der Götterstatuen, nicht das geringste mit<br />
den blutenden Marien und Hostien seit dem 13. Jh. zu tun. Dem gotischen<br />
Menschen ist es die Offenbarung des Leides, ein Fanal des wiedergeborenen<br />
Schmerzes Christi, die griechischen Priester aber lesen<br />
daraus die Zustimmung des Götterrats zu einer Volksversammlung.<br />
Überhaupt wird mit den antiken Götterbildern wie mit Puppen umgegangen.<br />
Den Asklepios führte Sophokles, der große Dramatiker, in seinem<br />
Amt als Priester (sic!) persönlich nach Athen – und das hieß nichts<br />
anderes, als das lächerliche Bild eines hölzernen Karrens, den der Dichter<br />
der Antigone klappernd durch die Stadttore fuhr, um erstaunt festzustellen,<br />
daß seine Mitbürger es nicht vermochten, fristgerecht den Tempel<br />
des neuen Gottes fertigzustellen, woraufhin er die Statue bis zum<br />
Einzug in ihr neues Haus kurzerhand bei sich daheim aufnimmt. Was<br />
das Mittelalter vielleicht mit Reliquien, also faßlichen, wenn auch heilsgeschichtlichen<br />
Gegenständen hätte tun können, das besorgen die antiken<br />
Priester mit den Göttern selbst – denn die Statue, das i s t der Gott.<br />
An eine transzendente Form Gottes hat der antike Mensch nie gedacht.<br />
Und so wie die Statue – einmal im Tempel aufgestellt – die Jahrhunderte<br />
als materielle Form überdauerte, so ist die gesamte antike Religion<br />
ein derart Greifbares und in seiner Geistlosigkeit ewig Starres,<br />
15
16<br />
EINLEITUNG<br />
daß der pagane Glaube über tausend Jahre nicht die geringste Wandlung<br />
erfahren hat. Es hat deshalb noch niemand eine echte Religionsgeschichte<br />
der Antike geschrieben. Nicht weil das Thema übersehen wurde, sondern<br />
eben w e i l e s k e i n e g i b t . Von Hesiod an, der die Genealogie<br />
des Götterapparats niederschreibt, bis in den Hellenismus hinein, kann<br />
im Grunde nichts zu einer Entwicklung des Glaubens berichtet werden.<br />
Keine Laienbewegung, keine Priesterbewegung, keine Reformationen,<br />
kein einziger Konflikt um die Frage des Glaubens. Es ist ein ewiges<br />
Schweigen des Metaphysischen. Die ägyptische Geschichte ist von den<br />
frühen Dynastien bis über Echnaton hin voll davon, die abendländische<br />
Geschichte sucht seit den Ottonen bis Voltaire und Nietzsche hinauf gar<br />
überhaupt nach a-religiösen Bewegungen. Die Griechen und Römer haben<br />
sich darum nie gekümmert.<br />
Und damit hängt tief verbunden zusammen, daß es keine griechische<br />
Geschichte der Baukunst gibt. Es verhält sich mit der Religion der<br />
Griechen wie mit ihrer Architektur, die immer durch das Gotteshaus, an<br />
Grabstätten oder Tempeln ihren Ausdruck fand und deshalb über die<br />
Jahrhunderte ebenso unbeweglich bleibt, wie ihr Glaube selbst. Seit der<br />
dorische Tempel um 700 v. Chr. erstmals errichtet war, mußte sich seine<br />
Form im Wesentlichen bis in den Untergang der griechischen Kultur<br />
erhalten. Von der Baukunst weiß die Antike deswegen nichts zu berichten,<br />
was von weltgeschichtlichem Rang wäre, nichts, was nicht mit gleichem<br />
Recht schon den Ägyptern zugeschrieben werden könnte. 1 Und<br />
so wie es keine Revolution der Baukunst in Hellas oder Rom gegeben<br />
hat, so nie auch nur die geringste Reformation des paganen Glaubens. 2<br />
Eine einzige ketzerische Bewegung kennt die Geschichte Roms: den<br />
Bacchanalienskandal von 186 vor Christus. Doch der Aufruhr gegen die<br />
alten Dionysosrituale, die hier durch den Senat verboten wurden, war<br />
keineswegs fragwürdigen Anrufungen an die Götter geschuldet. Nein,<br />
es hatte sich unter dem Deckmantel des Mysterienkultes viel mehr eine<br />
Clique im Stile der Protagonisten de Sades oder wenigstens eine Art<br />
1 Technisch freilich haben die Römer Gewaltiges geschaffen. Bereits die griechischen<br />
Kanalisierungen zeugen von bautechnischem Genius, die römische Weltstadt mit<br />
ihren gewaltig aus dem einstigen Ackerboden aufragenden, in alle Himmelsrichtungen<br />
ausgreifenden Fangarmen der Aquädukte ist eine statisch-technische Meisterleistung.<br />
Aber den Formideen nach bieten sie nichts Neues – denn sie hatten keine.<br />
2 Die Restauration alter Kulte unter Augustus und freilich das Aufkommen des<br />
Christentums bis hin zum Streit um die Arianer im 4. Jh. n. Chr. ist von gänzlich<br />
anderer Art.
EINLEITUNG<br />
Zwangsbordell entwickelt, das allein dem senatorischen Ordnungswillen<br />
widersprach, nicht aber religiösen Frevel bedeutete. In ganz gleicher<br />
Weise ist Sokrates behandelt worden, dem schließlich der Schierlingsbecher<br />
gereicht wurde, als der Vorwurf der Blasphemie aus rein politisch-bürgerlichen<br />
Erwägungen erhoben wurde.<br />
In ähnlicher Verkennung der Tatsachen nennen wir vier Kriege der<br />
griechischen Poleis um die Kultstätte der Pythia, jener Priesterin im<br />
Apollontempel zu Delphi, „heilige Kriege“. Wollen wir davon absehen,<br />
daß sie getrost als für die Geschichte Griechenlands wohl unbedeutendste<br />
Kriege überhaupt bezeichnet werden können, so handelt es sich zudem<br />
durchweg um Fragen des Wegzolls und des Tempelschatzes. Selbst<br />
die deutlich weltlich bestimmten Glaubenskonflikte vom Thesenanschlag<br />
bis zum Augsburger Religionsfrieden oder – noch vehementer – des<br />
30jährigen Krieges hatten immerhin neben den rein äußerlichen Beweggründen,<br />
dem Ablaßhandel, der Frage der Bilder und etlicher reichspolitischer<br />
und dynastischer Differenzen doch immer auch ein wahrhaft<br />
religiöses Moment in sich, nämlich das Problem der Deutung der Schrift,<br />
der Reinheit des Gewissens vor Gott. In dieser Hinsicht ist der Hellene<br />
keinen Moment über die Frage hinausgelangt, ob denn genügend Dämpfe<br />
vom Opfertisch zu den Göttern aufgestiegen seien.<br />
Und so wundert es denn auch nicht, daß der Gottesdienst der antiken<br />
Welt ganz dem Wortlaut nach verstanden werden muß: Wir denken<br />
an eine Gefälligkeit, eine ganz weltliche Dienerschaft, ein Tieropfer für<br />
die Götter. Sprechen wir vom christlichen Gottesdienst, so ist der Begriff<br />
aller greifbaren Tätigkeit enthoben. Denn hier wird Gott nicht g ed<br />
i e n t . Es handelt sich nie um ein Vertragsverhältnis, wie es der antike<br />
Mensch in seiner Beziehung zu den Göttern allein zu denken fähig war.<br />
Seit dem Mittelalter wird der Gottesdienst immer mehr zu einer Weihe<br />
des Gewissens, einer gemeinschaftlichen Einkehr der Seelen – ineinander<br />
und in sich. Alle Christusbewegungen der mittelalterlichen Ketzer<br />
haben sie gar noch allen festlichen Pomps entkleidet, sodaß ein Niedersinken<br />
im Eselstall zum Gebet werden konnte. Der Grieche hat dagegen<br />
vom dionysischen Kult an alle religiösen Feiern eher mit Wein, Weib<br />
und Gesang verbunden.<br />
Deshalb ist auch die Pietà-Szene den Griechen ganz unbekannt. Das<br />
Bild der Rollenumkehr, nicht des körperlichen, sondern geistigen, nämlich<br />
beweinenden Schirms der Mutter über den Sohn – welche mit Isis<br />
und dem Horuskinde in Ägypten, mit Maria und dem Jesusknaben im<br />
17
18<br />
EINLEITUNG<br />
Abendland so wirkmächtig ins Gedächtnis der Kulturen eingebrannt ist<br />
– Spengler hat diese bedeutende Beobachtung mehrfach erwähnt –, war<br />
in der antiken Auffassung des Lebens als männlichem Tatendrang unmöglich.<br />
Der einzige Moment, in welchem eine griechische Frau ihren<br />
Mann zu beweinen hatte, ist weithin derjenige geblieben, den Sturzbetrunkenen<br />
aus dem Symposion heimzutragen. Selbst dieses Besäufnis<br />
war dem Griechen ein religiöses Ereignis, so wie das Theater ein religiöser<br />
Bezirk sein sollte – obgleich die Komödie auch vor der Blasphemie<br />
nicht haltmachte.<br />
Tiefes Schauen, Ahnen, seelische Entrückung, Transzendenz – das<br />
ist Religion u n s immer gewesen. Was dagegen hat noch Aristoteles mit<br />
„Seele“ gemeint! Wieviel tiefer hallte es im abendländischen Menschen<br />
nach, wenn dieses Wort bei den Mystikern, und wieder im 19. Jh. den<br />
vor solcher Nähe kraftlos niedersinkenden Menschen romantischer Prägung<br />
ergreift! — Eben dieses Gefühl war dem antiken Geist von den<br />
Sophisten an noch bis über Aristoteles hinaus ganz fremd. Die Äußerlichkeit<br />
ihrer Kunst, ihrer Dramen, ihrer politischen Staatsauffassung<br />
war es, die dem inneren Empfinden nur wieder jene Reflexion der Oberfläche<br />
zu entgegnen vermochte und damit eigentlich nichts hinzuzufügen<br />
hatte. Der gotische Mensch, die romantische Seelenverfassung, das<br />
Gemüt der Einkehr und innerlichen Schau steht jener Lebenswelt des<br />
Greifbaren so fern, daß es den abendländischen Menschen zur höchsten<br />
Sehnsucht nach dieser hellscheinenden Welt ziehen mußte. Er war nie<br />
recht bemüht sie zu erreichen. Er sah sie im Traum. Die Römer dagegen<br />
haben bis zur Zeitenwende kein auch nur ähnliches Gefühl verspürt,<br />
und nie recht eigentlich die ganze Umfassung jener Weltschau des Christentums<br />
in sich wahrgenommen, nicht einmal dumpf erahnt. Sie waren<br />
immer blind geblieben vor diesem inneren Schauspiel.<br />
Es ist erst eine kolossale Sattheit der senatorischen, klassischen<br />
Epoche, wenn um die Geburt Christi gegen diese äußerliche und geradezu<br />
technische Form antiker Götterverehrung die hellenistische Philosophie,<br />
der Vorbote des Christentums, als erstmalig verinnerlichte Religion<br />
ins Leben des antiken Menschen tritt. Dieselbe Umkehrung der<br />
Weltauffassung ergreift die mittelalterliche Zeit, als die Gotik hereinbricht,<br />
die untergehende Frühe Neuzeit mit dem Einbruch der Romantik,<br />
so wie es schon im 14. Jh. v. Chr. in Ägypten geschehen war, als der<br />
monotheistische Sonnenkult wiederkehrt.
EINLEITUNG<br />
Dieser scharfe Widersatz der Religionen ist vielleicht das deutlichste<br />
Zeichen der Abwechslung tiefen Fühlens durch faßliche Tätigkeit,<br />
von Äußerem durch Inneres: Die absoluten Kontradiktionen stehen sich<br />
einander unvereinbar gegenüber. Wir haben es nicht mit zwei Religionen<br />
– von dutzend Möglichen – zu tun, sondern mit den beiden äußersten<br />
Anschlägen des Denkbaren, zwei Weltauffassungen und n u r zweien.<br />
Der Widerstreit jener beiden Gemüter hat sich hier in Form der<br />
Religion ausgesprochen. Doch er ist der ungeheuerste Gegensatz in der<br />
Geschichte überhaupt und hat sich in allen übrigen Ausdrücken des Lebens<br />
ebenfalls geäußert: in Tat und Gedanke, in Haß und Versöhnung,<br />
in Raub und Gabe, in Krieg und Friede, in Form und Zahl, in Mitleid<br />
und Herrentum, in Furcht und Drang, in Apathie und Begehren, in Lebenslust<br />
und Müdigkeit. Er ist Ausdruck des fundamentalsten Widersatzes<br />
des Lebens, welcher unteilbar am Urgrund aller Dinge liegt, der<br />
Scheidung alles Faßlichen in zwei Momente. Wir haben damit einen ersten<br />
Blick auf die Zweiheit des Daseins getan.<br />
*<br />
Das Wiederkehrende ist dem Unendlichen nahe, das Fortschreitende<br />
im Moment, der Tat gefangen. Nur in der Wiederkehr des Immergleichen<br />
kann Unendlichkeit gedacht werden, als Abfolge, als Erneuerung<br />
des Alten, das nie aus dem bereits Gekannten herauszuführen droht. Die<br />
Idee des Fortschritts dagegen kann nur momenthaft sein. Er kommt aus<br />
dem Unendlichen und weist ins Unendliche, wächst über alle Maßen<br />
und ist so über die Gänze seiner Bewegung – was wir Geschichte und<br />
Zukunft nennen – jeder menschlichen Vorstellungskraft enthoben. Die<br />
zyklische Geschichtsauffassung und der Glaube an den Fortschritt haben<br />
sich immer in diesem Widersatz befunden und deshalb einander verneint<br />
und notwendigerweise ausgeschlossen.<br />
Wir bemerken hier bereits ein Moment größter Bedeutung, wenn<br />
die Unendlichkeit der Zeit im zyklischen Denken zwar möglich ist, jedoch<br />
dem Inhalt nach begrenzt, der Fortschritt hingegen immer der zeitlichen<br />
Beschränkung unterliegt, dafür aber die Potenz zur Unendlichen<br />
Ausdehnung besitzt. Was zyklisch Zeit, ist linear verstanden Raum, was<br />
zyklisch Raum, ist linear Zeit. Wir werden in dieser Verschränkung der<br />
Verhältnisse ein allgemeines Prinzip des Daseins wiedererkennen, welches<br />
als ein innerer Wechsel – entgegen dem Glauben sowohl der zykli-<br />
19
20<br />
EINLEITUNG<br />
schen, als auch linearen Theorie – die Zeit als zweite Entität neben dem<br />
Raum überhaupt erst zu schaffen fähig ist.<br />
Im Drang nach der Unendlichkeit erringt so das Bild des Kreises,<br />
die erste und letzte Formwerdung jedes Weltbildes, die Herrschaft zurück.<br />
Doch es ist keineswegs das zyklische Geschichtsbild, welches uns<br />
seit Hegels Kreismetapher immer mehr zu befallen sucht. Denn was die<br />
letzten 200 Jahre zyklisch genannt haben, das war nie dem Kreis verwandt,<br />
sondern immer ausschließlich die Wiederholung, das Durchleben<br />
eines Immergleichen. Hegels Idee der Selbstfindung und der Freiheit<br />
spricht so, Vollgraffs Altersbild ist es, so wie die Stufentheorie<br />
Breysigs. Spenglers Philosophie der ewigen Wiederkehr – eine Idee<br />
Nietzsches – unterliegt derselben Denkungsart. Alle beginnen sie immer<br />
und immer wieder neu. Sie durchlaufen keinen Kreis, sondern einen<br />
scharf begrenzten Ausschnitt – man könnte sagen ein Stück Fortschritt<br />
– immer wieder neu. Eine Rückkehr ist dabei nur insofern gedacht, als<br />
die Kultur ihren Höhepunkt überschreitet, sobald sie ihre Formreife erst<br />
einmal erreicht hat und sodann wieder zerfällt. Daß aber der exakte Ausgangspunkt,<br />
dieselben Bedingungen des Lebens wiederkehren, ist hier<br />
immer s t r e n g v e r m i e d e n worden. 1 Dieses Wiederfinden des Alten<br />
zu verstehen, um einen Durchlauf ganz identischer Art zu durchschreiten,<br />
ist nie die nötige Abstraktion gewonnen worden. Es hat deshalb im<br />
Grunde bisher noch k e i n e w a h r h a f t z y k l i s c h e Theorie der Geschichte<br />
gegeben.<br />
Indem wir sie nun wagen wollen, sind wir im Begriff, das Wesen<br />
nicht der Geschichte, sondern der Zeit selbst – und zwar als freie Bewegung<br />
– zu verstehen. Darin ist sie als eindimensionale Größe ein Umkehrendes.<br />
Es bleibt nichts als die Abwechslung zweier Zustände: vorwärts<br />
und rückwärts. Ich denke eindimensional. Man möge über diesen<br />
Rückgang lächeln, bis man begriffen hat, daß bisher in null Dimensionen,<br />
nämlich im Punkt gedacht wurde. Die erste Dimension eröffnet die<br />
Gerade, d. i. unendlich viele Punkte und zwei Richtungen. 2 Gerade daraus<br />
werden wir erkennen, daß nun die Zyklik der Geschichte nicht etwa<br />
eine Wahrheit ist und der Fortschritt eine Tölpelei, sondern daß beide<br />
lediglich Äußerungen eines grundlegenderen Wesens der Dinge sind,<br />
welche sich ganz unter dem Antrieb des Vor- oder Zurückschreitens der<br />
Zeit unaufhörlich gegeneinander tauschen.<br />
1 daher verstehen sich die Kulturen im System Spenglers auch nicht<br />
2 Der Punkt kennt keine Richtung.
EINLEITUNG<br />
Deshalb ist nicht das eine oder das andere, das Zyklische oder der<br />
Fortschritt je fähig gewesen, die Geschichte dem Verstande faßlich zu<br />
machen, sondern nur die Vereinigung aus beiden dazu imstande. Ich<br />
spreche nun aber nicht von jenem Ansatz, der die gesamte Wissenschaft<br />
des 20. Jh. bestimmt hat – nämlich eine ganze Unmenge von Kausalursachen<br />
zusammenzuhäufen, um nur ja keine konkrete Aussage treffen<br />
zu müssen und stattdessen in der Vielzahl der „Einflußfaktoren“ ganz<br />
trivialerweise immer recht zu behalten. Indem schließlich jede Regung,<br />
die uns überliefert ist, in einem Kausalwust des heutigen Wissenschaftsbetriebes<br />
eingelagert wird, entledigt sich das moderne Geschichtsbild<br />
jeder Entscheidung: aus Feigheit, aus Angst, aus Unfähigkeit zur Analogie,<br />
aus innerer Beschränkung des Geschichtsbildes als einer Flut von<br />
Ereignissen.<br />
Nein, hier gehen nun die beiden Grundanschauungen im Wechselgang<br />
miteinander einher. Denn in mancher Zeit konnte es nichts Einleuchtenderes<br />
geben, als die Geschichte für einen Aufbruch aus der Dunkelheit<br />
zu schauen, manche Zeit mußte an den Untergang glauben, am<br />
Umkehrpunkt dachte man über das Zyklische nach. Immer gab ihnen<br />
ihre Zeit recht, nie behielten sie es für all die übrigen Epochen, welche<br />
ganz andere Erfahrungen gemacht hatten. Es ist deshalb ein Moment der<br />
Befreiung aus dem subjektiven Gefangensein durch die Zeit, wenn wir<br />
zurücktreten und all diese perspektivischen Verzerrungen nun aus dem<br />
Fluge heraus betrachten, als Ausdrücke der Zeit, statt der Kausalität. Die<br />
Errichtung des römischen Senats, der Übergang in die Dunkelmalerei<br />
des Barock, die Entdeckung der nichteuklidischen Geometrie, die Begründung<br />
der attischen Komödie oder die finanzwirtschaftliche Heraufkunft<br />
des Kolonats der Spätantike werden darin nicht Ausdrücke einer<br />
politischen, künstlerischen oder wirtschaftlichen Entwicklung, sondern<br />
des Eintritts in eine neue Form des Daseins überhaupt. Sie können so<br />
nie eine Kausalfolge begrenzter Ereignisse sein, sondern entspringen einer<br />
substantiellen Formveränderung, die all diese Äußerungen erst in<br />
Bewegung setzt.<br />
Die Offenheit gegenüber jeder dieser Einseitigkeiten der Form ist<br />
mit der Überwindung der Zeit ein ebenso notwendiger Akt, wie die Aufgabe<br />
jedes Endziels der Geschichte, eines Untergangs oder eines Erhalts<br />
des Abendlandes. Es werden nun faßlichere Elemente zu Bedeutung gelangen.<br />
Doch gerade in dieser scheinbaren Loslösung vom Willen, u n-<br />
21
22<br />
EINLEITUNG<br />
s e r e m Willen wird der eigentliche Wi l l e d e r G e s c h i c h t e in gewaltigen<br />
Zügen vor uns erstehen. — Indem wir u n s willenlos machen,<br />
erschauen wir den Wi l l e n d e r We l t .<br />
Den Willen aber ablegen, heißt dem Guten zu entsagen. Ein Akt,<br />
der bisher oft gewollt, doch nie gänzlich gelungen ist. Man konnte sich<br />
nie dazu entschließen, hat sich statt dessen doch immer wieder nur dem<br />
Positiven zugewandt, der Kultur, der Hochkultur, und nur in dichterischen<br />
Momenten einen Blick auf das Primitive, das Häßliche getan. Deshalb<br />
ist auch niemandem dieser im Grunde reinen Kulturmenschen in<br />
den Sinn gekommen, in der Analogie zwischen Kulturgeschichte und<br />
Pflanzenleben etwas anderes zu begreifen, als das Wachsen, Blühen und<br />
Welken dieses Organismus. Es war bereits ein außergewöhnlicher Akt,<br />
überhaupt das Ve r g e h e n als etwas Reales zu begreifen. Doch auch<br />
hier ist ganz instinktiv an jenem Punkte haltgemacht worden, der wirklich<br />
etwas Neues hervorzubringen gedroht hätte. Über ihn hinaus hat<br />
sich die Geschichtsphilosophie nie gewagt. Es ist dem Kulturmenschen<br />
alles fremd, das nicht zum Leben gehört. Das „Ungeschichtliche“, die<br />
tatlose Zeit, diejenige der Unterwerfung unter Natur, Herr und Gott, haben<br />
sie immer übersehen, ja wollten sie nicht sehen, haben sie seit Nietzsche<br />
für willenlos, schwach, weibisch und damit bedeutungslos erklärt.<br />
Sie war keine Geschichte. Bis heute gilt so das Bekenntnis Treitschkes<br />
„Männer machen die Geschichte“. 1 Ganz in diesem Sinne waren es in<br />
der Lebensphilosophie Pflanzen, die Geschichte repräsentiert haben.<br />
Aber auch der Pflanze als greifbarem Objekt, als Ausformung einer Lebensstrategie,<br />
stellt sich ein Ungerichtetes, ein formloser Zustand gegenüber,<br />
der schlichtweg übersehen wurde. Es ist das Ve r w e s t e .<br />
Die Analogie der Lebensphilosophie schien schlagend. Aber mit<br />
dem Sterben der Pflanze ist der Kreislauf eben nicht geschlossen. Auf<br />
das Sterben folgt nicht die Geburt des Neuen, sondern der Rückgang in<br />
den Humus. Eine Trivialität! möchte man sagen. Aber sie hatten die<br />
Sprache des ruhig Darniederliegenden, die Sprache des Leblosen nie<br />
1 Man zitiert ungern den dazugehörigen Satz, welcher dem Dogmatismus, den man<br />
Treitschke noch heute gern andichtet, nicht gerecht werden will: „Dem Historiker<br />
ist es nicht gestattet, nach der Weise der Naturforscher das Spätere aus dem Früheren<br />
einfach abzuleiten.“ Daraus erhellt sich, daß Treitschke hier nichts anderes vertritt,<br />
als es die Historiker noch immer nachpredigen: Es gibt kein System der Geschichte.<br />
Und das bloß, um damit den Mythos zu wahren, Geschichtswissenschaft sei ein<br />
kurzbündiges Zusammenflechten der Fakten, statt wirklich tiefes Blicken in die<br />
Beweggründe des Werdens.
EINLEITUNG<br />
verstanden. Daß die verwelkte Pflanze nicht in einem Schritt wieder zu<br />
keimen beginnt, daß die Geburt nicht auf das Sterben folgt, daß es eines<br />
noch wesentlich zerstörerischeren Aktes bedarf, das Leben des saftenden<br />
Kelches erneut zu entfachen, ward – obgleich es in der Natur so<br />
offen liegt – immer übergangen. Das Vermoderte, das Aufgelöste, die<br />
dunklen Kräfte der Zersetzung des komplexen Körpers in die niedersten<br />
Bestandteile evolutorischer Urzeiten, das Werk der Mikroben und<br />
Würmer, der primitivsten Bausteine des Lebens, die Rückkehr in den<br />
Urstoff, wollte, ja konnte die Lebensphilosophie nicht ernsthaft als Teil<br />
des Lebens verstehen, wo ihr doch das Hohe erst Leben, das Gute und<br />
ganz offensichtlich Kraftvolle erst der Betrachtung wert erschien. —<br />
Der Tod heißt freilich das Ende alles Lebens. Er bedeutet aber nicht, daß<br />
damit die Geschichte des Seins überhaupt erzählt sei. Vielmehr ist dies<br />
wieder der Ausgangspunkt einer andersartigen Lebendigkeit.<br />
Was eben noch höchste Ordnung war, der Körper des Lebendigen,<br />
vergeht. Dasselbe, tot, ist noch immer von gleicher Masse, nichts ist der<br />
Sache nach verloren, doch die Form der Energie ist eine gänzlich andere.<br />
Die Ur- und Schlußform jedes Organismus ist eine reduzierte, nämlich<br />
bloße Masse, Erde. Der Körper liegt nun als Nahrung da, für neue<br />
Völker, Staaten, Religionen. 1 All der zentrierte Reichtum, im Hirn zusammengezogen,<br />
all der Energieverbrauch dieser Welthauptstädte, Theben,<br />
Rom, Paris, all das Verlangen des Priesters, Königs, Kaisers, Gottes<br />
beansprucht das ganze Reich, welches er nur durch die Versklavung<br />
der Organe erzwingt. Selbst völlig unfähig sich zu ernähren, steht das<br />
geistige Auge im Raum, aber im Besitz der unbändigen Macht, die Wille<br />
genannt wird, alles Fleisch zu unterwerfen, durch Raub an Boden und<br />
Sonnenwärme, über Feldfrüchte und Tiere, geraubt einem riesigen Reich,<br />
einer ausufernden Provinz, die ganze je bekannte Welt überziehend, alles<br />
an Brot und Fleisch verdichtet zu einem unermeßlichen Wirbelstrom,<br />
zu einem alles anziehenden Kraftzentrum, an dessen Grenzen sich die<br />
Welt spiegelt. Das P o m e r i u m , jene stadtrömische Grenze, über welche<br />
keine Waffen geführt werden durften, sodaß im Innersten, dem Sturmauge<br />
der Kultur, die Ruhe des höchsten Friedens herrschte, zerfällt mit<br />
dem Verwesen. Die Häufung des Reichtums, der sich über die Stadtmauern<br />
ergießt, ist jetzt der M a s s e a n I n d i v i d u e n preisgegeben.<br />
1 Das ist etwas gänzlich Neutrales, hier darf man nicht an moralische Fragen des<br />
Nerven-Schmerzes denken.<br />
23
24<br />
EINLEITUNG<br />
Bakterien und Milben beherrschen das neue Spiel, die züngelnden Mächte<br />
des Zufalls.<br />
Noch Mommsen hat es vermieden, seine Geschichte Roms auf die<br />
nachcäsarische Zeit auszuweiten. Heute versucht die Alte Geschichte<br />
krampfhaft die Spätantike zu einer nur etwas andersgearteten Blüte, gewissermaßen<br />
einer transformierten Klassik zu erklären, um die Beschäftigung<br />
mit ihr doch noch zu rechtfertigen. So war aller Lebenskreis nie<br />
tatsächlich geschlossen, sondern das Lebendige immer herausgezögert<br />
oder alles Tote für nichtswürdig erklärt. Wir wollen nun ertmals dieses<br />
Verweste betrachten.<br />
Nicht indem wir es in aller Verzweiflung in ein Positives zu heben<br />
suchen, die Spätantike zur Transformation erklären, das 20. Jahrhundert<br />
zur Postmoderne, überwinden wir diese Haltung – auch wollen wir es<br />
nicht als Negatives, als Entfernung von der Kultur verstehen, sondern<br />
als Hinwendung zu einem anderen, dem z w e i t e n Z u s t a n d e . Wir<br />
schließen damit den Kreis des Lebens. Wir stellen der feinen Struktur<br />
des Lebendigen das tiefe Wabern der Urkräfte gegenüber, den fruchtbaren<br />
Boden der Geschichte. Er ist ein gänzlich Anderes, als es der<br />
hochorganisierte Körper war. Er ernötigt einen neuen Begriff.<br />
*