Gott und Rilke
Der Weg zum Dinggedicht und dessen Überwindung
Du dunkelnder Grund
Du dunkelnder Grund, geduldig erträgst du die Mauern.
Und vielleicht erlaubst du noch eine Stunde den Städten zu dauern
und gewährst noch zwei Stunden den Kirchen und einsamen Klöstern
und lässest fünf Stunden noch Mühsal allen Erlöstern
und siehst noch sieben Stunden das Tagwerk des Bauern -:
Eh du wieder Wald wirst und Wasser und wachsende Wildnis
in der Stunde der unerfasslichen Angst,
da du dein unvollendetes Bildnis
von allen Dingen zurückverlangst.
Gieb mir noch eine kleine Weile Zeit: ich will die Dinge so wie keiner lieben
bis sie dir alle würdig sind und weit.
Ich will nur sieben Tage, sieben
auf die sich keiner noch geschrieben,
sieben Seiten Einsamkeit.
Wem du das Buch giebst, welches die umfasst,
der wird gebückt über den Blättern bleiben.
Es sei denn, dass du ihn in Händen hast,
um selbst zu schreiben.
Dieses Gedicht aus dem Stundenbuch von Rainer Maria Rilke entwickelt beinahe umfassend das ästhetische Programm, das der Rilke der Neuen Gedichte verwirklichen wird. Das Ganze, das Allgemeine, das die Phänomene verbinden muss, wenn kohärentes Denken möglich sein soll, der dunkelnde Grund also, den Rilke andernfalls oft Gott nennt, dies solle im Einzelnen aufgesucht und anvisiert werden:
„Gieb mir noch eine kleine Weile Zeit: ich will die Dinge so wie keiner lieben
bis sie dir alle würdig sind und weit. “.
Und mag dieses Projekt auch ein eitles Spiel sein, da der Grund sein Bildnis von den Dingen zurücknehmen kann, mithin also da die Abwesenheit Gottes in der Welt eine kaum mehr zu leugnende Möglichkeit ist, es soll versucht werden dennoch wie das Tagwerk des Bauern, Notwendigkeit wieder das Verhängnis.
„und lässest fünf Stunden noch Mühsal allen Erlöstern
und siehst noch sieben Stunden das Tagwerk des Bauern “.
Denn die Hoffnung bleibt, dass Gott den Dichter in den Händen hat, um selbst zu schreiben. Bleibt der Versuch aber aus, versiegte die Idee von Versöhnung endgültig. Schreiben als Flaschenpost, wie es Adorno auch formulierte.
Es ist Skeptizismus, nicht unerschütterter Glaube, was diesem Dichten zu Grunde liegt. Darum auch kann allein im Aussprechen dessen was getan werden soll nichts gewonnen werden. Formal wird Du Dunkelnder Grund dem Antizipierte nicht gerecht, bleibt Gerede. Im Gedicht Die Engel aus dem Buch der Bilder dagegen versucht Rilke bisher nur Formuliertes ästhetisch konsequenter umzusetzen:
Die Engel
Sie haben alle müde Münde
und helle Seelen ohne Saum.
Und eine Sehnsucht (wie nach Sünde)
geht ihnen manchmal durch den Traum.
Fast gleichen sie einander alle;
in Gottes Gärten schweigen sie,
wie viele, viele Intervalle
in seiner Macht und Melodie.
Nur wenn sie ihre Flügel breiten,
sind sie die Wecker eines Winds:
als ginge Gott mit seinen weiten
Bildhauerhänden durch die Seiten
im dunklen Buch des Anbeginns.
Hier scheinen die „sieben Tage, sieben / auf die sich keiner noch geschrieben, / sieben Seiten Einsamkeit“, anzubrechen, von denen im Stundenbuch gesprochen wurde. Die Schau des Allgemeinen wird im Besonderen evoziert, im Eindruck den die Engel- (Statuen?) hervorrufen, scheint das Göttliche auf. Ein lyrisches Ich, das es erlauben würde die Epiphanie als rein persönliche abzutun existiert nicht mehr. Der Leser tritt der intendierten Erfahrung ohne Filter gegenüber. Doch es stört die Anwesenheit Gottes im Wort, wenn er auch nur zum Vergleiche dient, ebenso wie das moralische Urteil im Text: „Und eine Sehnsucht (wie nach Sünde) / geht ihnen manchmal durch den Traum“. Da ist noch zu viel predigende Geste, die – ausgerechnet! – was geheiligt werden soll profanisiert. Verstärkt wird all das noch von den teils mühevollen Reimen, etwa „Alle-Intervalle“, und überhaupt ist die Omnipräsenz der christlichen Weltanschauung, wie in Stein gemeißelt in austauschbaren Symbolen, dem Text eher abträglich als zuträglich.
Um soviel sublimer behandelt dann „Die Fensterrose“ den noch immer nicht aufgegebenen gedanklichen Komplex in den Neuen Gedichten:
Die Fensterrose
Da drin: das träge Treten ihrer Tatzen
macht eine Stille, die dich fast verwirrt;
und wie dann plötzlich eine von den Katzen
den Blick an ihr, der hin und wieder irrt,
gewaltsam in ihr großes Auge nimmt, –
den Blick, der, wie von eines Wirbels Kreis
ergriffen, eine kleine Weile schwimmt
und dann versinkt und nichts mehr von sich weiß,
wenn dieses Auge, welches scheinbar ruht,
sich auftut und zusammenschlägt mit Tosen
und ihn hineinreißt bis ins rote Blut -:
So griffen einstmals aus dem Dunkelsein
der Kathedralen große Fensterrosen
ein Herz und rissen es in Gott hinein.
Auch hier ist Gott noch anwesend, jedoch doppelt entrückt, in der letzten Zeile. Er gehört einer vergangenen Zeit an und wird durch eine andere Ästhetik begriffen als die Katzen in ihrer Bewegung, und beide Erfahrungen sind einander doch vergleichbar, das Bewusstsein des Allgemeinen im Besonderen triumphiert in Analogie zum christlichen Denken ohne dass notwendig beide in Eins fallen müssten. Ich schrieb in einem anderen Artikel:
„In diesem Sonett stimmt jedes Wort. Die um sich kreisende, ausgreifenden Bewegung der Katzen findet sich in den langen, von Sprüngen durchzogenen Zeilen wieder. Die Verwobenheit dieser Bewegung mit dem Korpus der Kathedrale ebenso in den dicht ineinander verwobenen Wortfeldern, in Interlinearen- und Endreimen, sowie zahlreichen Assonanzen. Die oft spröde Wortwahl dagegen korrespondiert mit dem Unbeschreiblichen im Blick der Katzen, welches die Erfahrung einer vergangenen Zeit spiegelt, als die Fensterrose der Kathedrale, wie nun die lodernde Natur der Katzen dem lyrischen Ich, dem außenstehenden „Herz“ einen Blick auf das Allgemeine im Einzelnen gewähren: es in Gott hineinrissen.“
Doch im Moment seiner vollen Entfaltung stößt Rilkes ästhetisches Ideal auf eine innere Schranke. Schon Schlegel stieß in seinem durchaus nachvollziehbaren Versuch, die romantische Aporie der Gleichwertigkeit alles Einzelnen im Bezug auf ein allgemein gültig Göttliches aufzulösen auf das Problem, dass seine literarischen Bemühungen statisch, schematisch wurden. Auch der Rilke der Neuen Gedichte kapituliert oft vor der Allmacht des Allgemeinen. Etwa hier:
Der Ball
Du Runder, der das Warme aus zwei Händen
im Fliegen, oben, fortgiebt, sorglos wie
sein Eigenes; was in den Gegenständen
nicht bleiben kann, zu unbeschwert für sie,
zu wenig Ding und doch noch Ding genug,
um nicht aus allem draußen Aufgereihten
unsichtbar plötzlich in uns einzugleiten:
das glitt in dich, du zwischen Fall und Flug
noch Unentschlossener: der, wenn er steigt,
als hätte er ihn mit hinaufgehoben,
den Wurf entführt und freiläßt -, und sich neigt
und einhält und den Spielenden von oben
auf einmal eine neue Stelle zeigt,
sie ordnend wie zu einer Tanzfigur,
um dann, erwartet und erwünscht von allen,
rasch, einfach, kunstlos, ganz Natur,
dem Becher hoher Hände zuzufallen.
Aus dem schon oben zitierten Artikel:
„Nichts ist rund am Ball, das Thema ist überhaupt zu trivial als dass es die doch eifrig durchexerzierte äußerliche Vollendungen der Form, (die ja doch verlangt wäre) wiederum rechtfertigen würde, kurz: alles wirkt aufgesetzt. Grund ist der Rilkesche Stil, der gerade in der Zeit der neuen Gedichte, aus denen beide Beispiele entnommen sind, sich zu einer so intendierten Selbstständigkeit entwickelt hatte, dass er sich vielfach gewaltsam schematisch über den jeweiligen Stoff stülpt.“
Überzeugt war Rilke am Ende seines Lebens, zumindest formuliert es so der Protagonist im Malte Laurits Brigge, dass ein einzelner Mensch überhhaupt nur fähig sei nach langen Phasen der Einübung einige wenige große Gedichte zu schreiben. Man dürfte sich mit der Meinung des Verfassers im Einklang sehen, wenn man die Größe für die Duineser Elegien allein reserviert. Hier löst Rilke sich von seinem vormals noch stets positiv gedachten Gottesbegriff, und setzt Gott als das Unbestimmte und dennoch Wahre, das in Vom dunkelnden Grund bereits vorschien. Gleichzeitig wird Transzendenz in zuvor noch nicht bekannter Weise gesellschaftlich gedacht. Drei schritte weg von Gott führen hin zu einem Gott, der überhaupt wieder sein kann, eben weil er nicht mehr vom verzweifelten Wollen des Einzelnen in ein schematisches Dasein gezwungen wird.
„Die Duineser Elegien sind vielleicht der Höhepunkt des Werkes Rainer Maria Rilkes. Wie sonst ganz wenige deutsche Texte verbinden sie einen hohen Ton mit der zutiefst modernen Erfahrung des Geworfenseins „in der gedeuteten Welt”. Beinahe einzigartig sind sie darin, dass sie moderne Diskurse (etwa den Bereich der Psychoanalyse) nicht etwa als abgegrenzt, zum Beispiel qua Montage behandeln, wie es in der späteren Moderne und Postmoderne en vogue wurde, sondern diese sich sprachlich ganz zu eigen machen“.




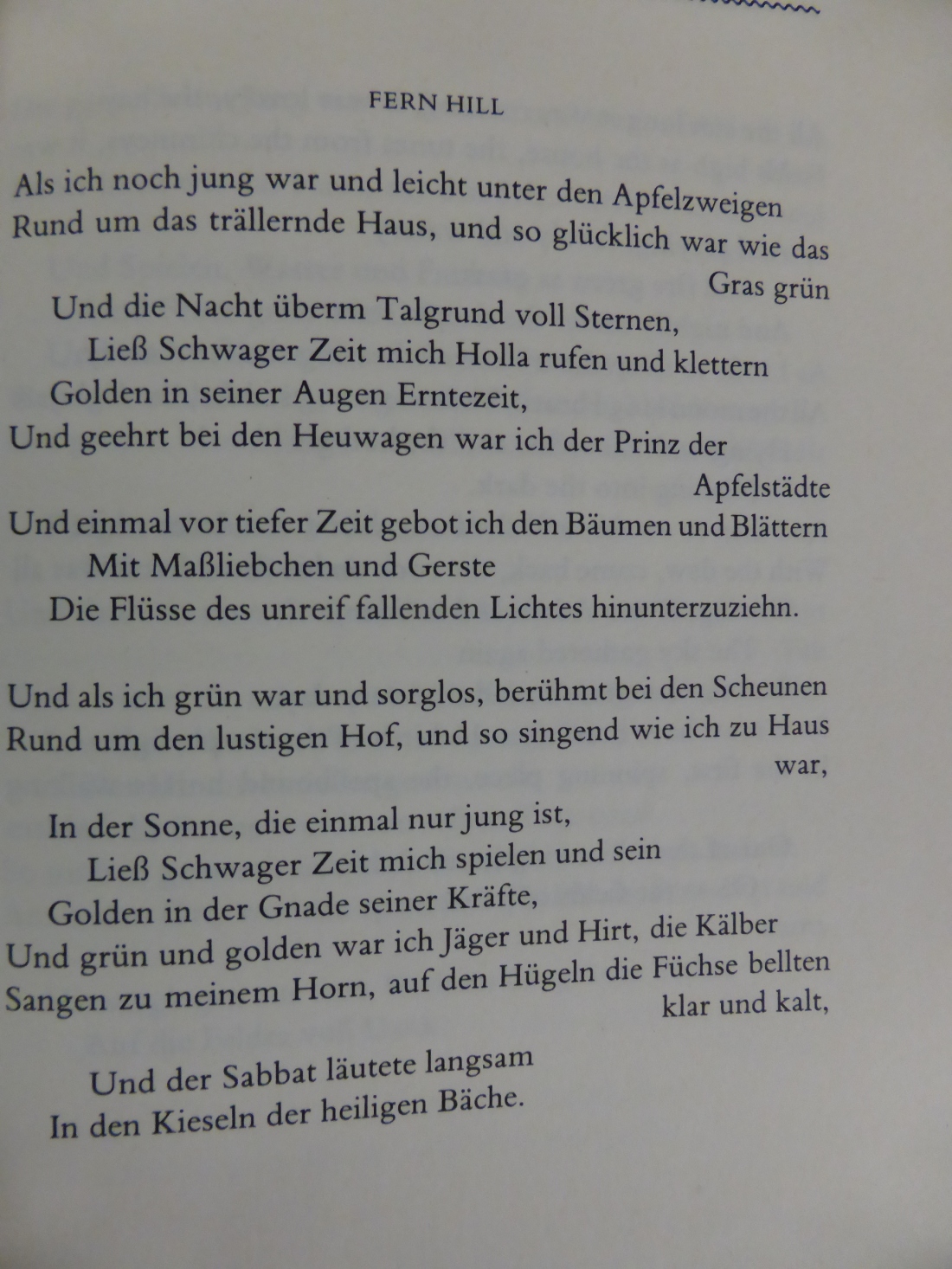



Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.