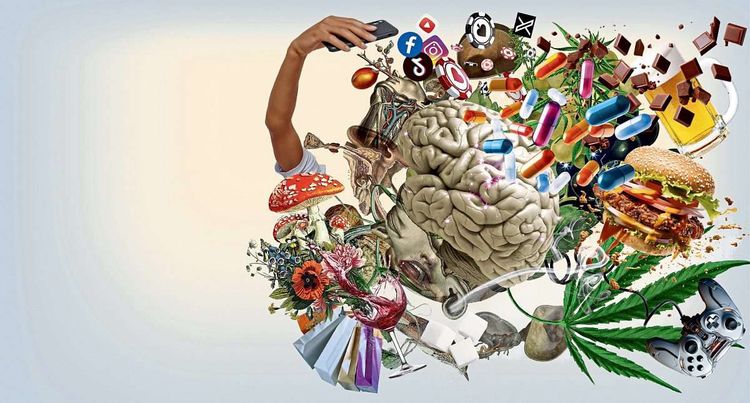
Immer mal wieder ein paar Gläser zu viel, die Zigarette, von der man einfach nicht loskommt, oder auch das unbändige Verlangen nach süßem oder fettigem Essen: All das sind unterschiedliche Formen von Sucht. Der Übergang von ab und zu ein bisschen zu viel zu der Tatsache, dass man ohne das Suchtmittel nicht mehr kann, ist dabei schleichend, deshalb merkt man die Abhängigkeit oft erst dann, wenn man schon tief drinsteckt.
Die Vorgänge, die dabei im Gehirn ablaufen, sind immer die gleichen. Deshalb sollte auch eine Therapie breit ansetzen. Sonst droht Suchtverschiebung, weiß die Psychiaterin Gabriele Fischer. Sie hat gemeinsam mit Arkadiusz Komorowski ein Standardwerk über Sucht und neue Behandlungswege geschrieben. Im STANDARD-Interview kritisiert sie, dass es in Österreich zu wenig Prävention gibt, und erklärt, was etwa ADHS mit Sucht zu tun hat.
STANDARD: Warum werden manche Menschen süchtig und andere nicht? Welche Mechanismen stecken da dahinter?
Fischer: Sucht ist eine multifaktorielle Erkrankung, wenn sie ausbricht, kommen fast immer mehrere Parameter zusammen. Es gibt eine genetische beziehungsweise familiäre Disposition, das bedeutet aber nicht, dass jeder und jede mit dieser Veranlagung suchtkrank wird. Ist allerdings ein Elternteil beispielsweise alkoholkrank, verdoppelt sich das eigene Risiko. Bei beiden Eltern verdreifacht es sich sogar. Und es gibt noch weitere Faktoren wie Traumata, Angststörungen, Depression oder auch die Aufmerksamkeitsdefizitstörung ADHS. In solchen Fällen scheint für die Betroffenen das Suchtmittel, Alkohol etwa oder auch Cannabis, bei der Bewältigung dieser Probleme zu helfen.
Und natürlich gibt es auch Menschen, die gerne Dinge ausprobieren, man nennt das Novelty Seeking Behaviour. Auch das kann eine Veranlagung zur Sucht so richtig durchbrechen lassen.
STANDARD: Und wie schnell wird man süchtig?
Fischer: Das kommt natürlich auf die Substanz an, aber bei den allermeisten passiert das schleichend. Ein klassisches Beispiel ist etwa eine Angststörung, die es einem erschwert, aus dem Haus zu gehen. Dann nimmt man ein Beruhigungsmittel, damit es leichter geht. Das macht man immer öfter, und irgendwann kann man nicht mehr ohne. Oder man trinkt ein, zwei Gläser, damit man in Gesellschaft lockerer wird. Und das steigert sich immer weiter. Frauen nehmen eher Tabletten, Männer neigen mehr zum Trinken. Kommt dann womöglich noch ein weiterer Faktor dazu, wie eben ein Trauma, nimmt die Suchtwahrscheinlichkeit stark zu.
STANDARD: Gibt es Unterschiede bei den einzelnen Süchten?
Fischer: Nicht wirklich. Neurobiologisch gesehen passiert im Gehirn immer das Gleiche, egal ob man an Spielsucht leidet, alkoholabhängig, süchtig nach Nikotin oder nach Essen ist. Die bildgebenden Verfahren zeigen die immer vergleichbare Imbalance der Neurotransmitter, unabhängig vom Suchtmittel.
Und auch gesellschaftlich macht es keinen Unterschied. Egal ob man heroinabhängig oder esssüchtig und deshalb schwer adipös ist, beide Betroffenen sind massiv stigmatisiert. Der einzige Unterschied ist, dass allein aufgrund der Anzahl der Betroffenen die Esssucht ein enormes gesellschaftliches Problem ist. 35 bis 40 Prozent der Bevölkerung sind übergewichtig, opiatabhängig sind dagegen 0,6 Prozent der Bevölkerung.
Unter anderem das hat uns dazu bewogen, ein Buch über Sucht zu schreiben. Das Fatshaming nimmt enorm zu, aber zeigt gleichzeitig, dass die wenigsten die Mechanismen verstanden haben, durch die es überhaupt zu Übergewicht kommt. Es sucht sich ja niemand aus, suchtkrank zu werden.
STANDARD: Sie haben auch ADHS angesprochen. Inwiefern kann das zu Sucht führen?
Fischer: Bei ADHS handelt es sich um eine Störung im Dopaminhaushalt, und das Suchtmittel setzt eben genau Dopamin frei. Dabei ist es übrigens egal, ob es sich um eine stoffgebundene Sucht handelt, also Alkohol, Nikotin und mehr, oder um eine nicht stoffgebundene Abhängigkeit wie Spiel- oder Kaufsucht. Mittlerweile weiß man, dass 50 Prozent der Personen mit ADHS eine Suchterkrankung haben, häufig ist das Kokain oder Cannabis, weil sie das Gefühl haben, das holt sie runter. Es kann aber auch Spielsucht sein. Dabei kann man ADHS sehr gut therapieren. Erkennt man den Zusammenhang, zeigt sich oft, dass der oder die Betroffene auf einmal mehr in sich "wohnt", das Suchtmittel ist als "Selbstmedikation" gar nicht mehr nötig.
STANDARD: Das heißt, man muss herausfinden, was der Sucht zugrunde liegt?
Fischer: Genau. Das passiert in Österreich aber viel zu wenig, weil es hierzulande in erster Linie eine Reparaturmedizin gibt und keine Vorsorgemedizin. Würde man hier umdenken, könnte man Betroffenen und auch ihren Angehörigen viel Leid ersparen und volkswirtschaftlich Geld einsparen. Denn egal welche Sucht, es wird irgendwann sehr teuer, für die Betroffenen und den Staat. Bei Letzterem sind es vor allem die indirekten Kosten, weil die Betroffenen neben der Suchterkrankung häufig noch andere Probleme haben und womöglich früher aus dem Berufsleben ausscheiden.
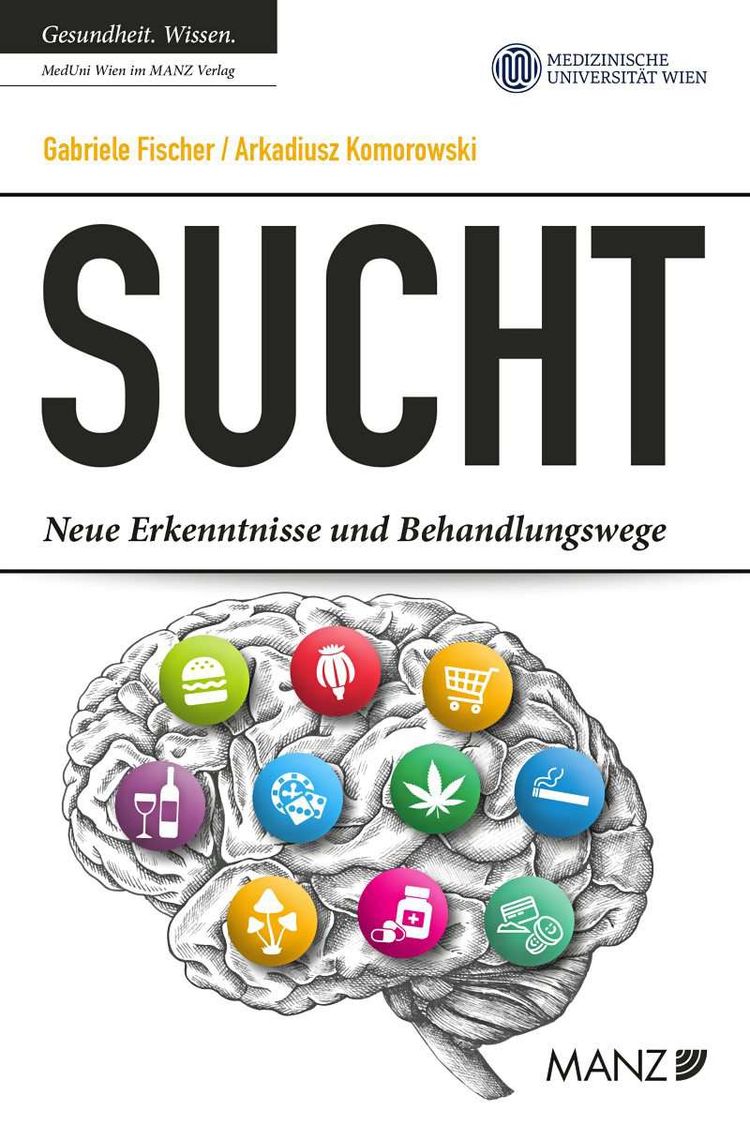
STANDARD: Wie kann man da gegensteuern?
Fischer: Auf mehreren Ebenen. Das beginnt schon sehr früh, in den Bildungseinrichtungen. Man muss unbedingt die Rolle der Pädagoginnen und Pädagogen aufwerten. Die bemerken ja meist, wenn Kinder und Jugendliche sozusagen auffällig sind. Ihnen müsste man Psychologinnen und Psychologen zur Seite stellen, damit man auffallendes Verhalten ehestmöglich klären und präventiv handeln kann. Nicht erst dann, wenn womöglich etwas passiert ist. Da hinkt Österreich leider sehr hintennach im internationalen Vergleich. Bei uns gibt es auch keinen nationalen Suchtplan, der klare Voraussetzungen schafft, wie man mit solchen Themen umgeht. Würde man bereits im Schulalter entsprechend ansetzen, würden viele Probleme erst gar nicht so gravierend.
Und es ist auch eine Frage der Steuerung. Wir wissen beispielsweise, dass dezentrale, wohnortnahe Psychiatrie bei Sucht extrem wichtig ist. Da ist etwa in der Steiermark die Lage ganz schlecht, weil praktisch alles in Graz gebündelt ist. Menschen aus dem Ennstal müssen dann dorthin pendeln. Da kann die Telemedizin enorm viel bringen, das hat die Pandemie gerade in diesem Fachbereich gezeigt.
STANDARD: Kann man überhaupt sagen, wie verbreitet Sucht in Österreich ist?
Fischer: Nicht wirklich. Vergleichende Untersuchungen der OECD innerhalb ihrer Mitgliedsländer zeigen, dass wir etwa bei Alkoholsucht im oberen Bereich liegen. Und auch bei den Drogentoten liegen wir weit vorn. EU-weit gibt es 18 Drogentote im Jahr auf eine Million Einwohner, in Österreich haben wir 39, also mehr als das Doppelte. Aber niemand kann seriös sagen, wie viele Menschen bei uns ein Suchtproblem haben, weil die entsprechenden Zahlen nicht wissenschaftlich erhoben werden. Wir können das immer nur im Vergleich sagen, etwa in Anlehnung an Deutschland oder im Vergleich zu internationalen Untersuchungen.
STANDARD: Wie kann man das ändern?
Fischer: Das ist eine gute Frage. Ein Thema, das wirklich viele betrifft, ist ja das Übergewicht. Da hätten wir theoretisch wirklich gute Daten, weil die Kinder und Jugendlichen jedes Jahr gemessen und gewogen werden. Die müsste man nur entsprechend auswerten. Aber mit diesen Daten, die wir seit Jahrzehnten generieren, passiert nichts Strukturiertes. Wir sehen dann erst im internationalen Vergleich, dass der Body-Mass-Index bei uns überdurchschnittlich ansteigt.
STANDARD: Und wie kann man an der Sucht direkt ansetzen? Also nicht nur den vorhandenen Tendenzen entgegensteuern?
Fischer: Mit Lebensstilveränderung und begleitender Medikation. Man lernt, das Craving, also die Gier, zu erkennen und entwickelt Strategien, wie man damit umgehen kann. Und die Therapie der spezifischen Sucht muss in ein Gesamtkonzept eingebettet sein, das am grundlegenden Auslöser und klinischen Merkmalen ansetzt. Es geht darum, den täglichen Rückfall zu brechen, den gibt es ja bei jeder Sucht, egal ob bei Essen oder bei Heroin. Beim Essen können wir uns das noch ganz gut vorstellen, jede Person, die schon einmal eine Diät gemacht und die nicht durchgehalten hat, weiß, wie schwierig das ist. Man hat einen Ausreißer, und danach fühlt man sich furchtbar schlecht. Und genauso ist es bei anderen Süchten wie Alkohol, Heroin oder Tabletten.
STANDARD: Warum reicht es nicht, die spezifische Sucht zu behandeln?
Fischer: Fokussiert man nur auf die Sucht alleine, beispielsweise das Essen, bekommt man die in den Griff, weicht dann aber womöglich auf ein anderes Suchtmittel aus. Das ist das Phänomen der Suchtverlagerung. Ich gebe ihnen ein Beispiel: Bei Adipositas etwa gibt es auch die bariatrischen Operationen, also Magenverkleinerung oder Magenbypass. Das hilft vielen sehr gut. Aber es gibt auch Betroffene, die dann vermehrt Alkohol zu trinken beginnen. Und Alkohol hat ja wahnsinnig viele Kalorien. Eine innovative Therapieneuerung ist auch die sogenannte Abnehmspritze. Unbedingt sollen übergewichtige Personen die bekommen, aber immer eingebettet in eine Veränderung des Lebensstils, damit sie langfristig hilft.
Natürlich ist eine anhaltende Änderungsmotivation wichtig. Es wird immer Menschen geben, die sagen, das mache ich nicht. Auch das muss man akzeptieren.
STANDARD: Suchtmittel, hat man den Eindruck, unterliegen auch einer gewissen Mode. Im Moment scheinen Psychedelika wirklich zu trenden. Wie sehen Sie das?
Fischer: : Ja, da wird gerade viel berichtet, und es gibt einige positive Berichte in der Alkoholabhängigkeit. Ich denke, es ist ein wirklicher Jammer, dass die Pharmaindustrie ihre Forschung vorwiegend auf Onkologie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen fokussiert und wenig auf die Psychiatrie. Das liegt wohl auch daran, dass das Gehirn so unglaublich kompliziert funktioniert. Wichtig ist, bei jeder Suchterkrankung die zugrunde liegende psychiatrische Erkrankung zu erkennen und behandeln.
STANDARD: Wäre so eine direkte Suchtbehandlung überhaupt möglich? Etwa eine Impfung gegen Sucht?
Fischer: Man hat in den USA Impfstudien mit Impfungen gegen Nikotin- und Kokainsucht durchgeführt, die sind aber alle gescheitert. Da wären neue Forschungsansätze im Bereich der Psychiatrie nötig. Wir haben ja auch bei Krebs mittlerweile die Immuntherapie, obwohl man sich lange nicht vorstellen konnte, dass so ein Ansatz neben der Chemotherapie bei einigen Tumoren gut funktioniert. Aber weil das Gehirn so kompliziert ist, haben wir noch nicht einmal ausreichend gute Medikamente gegen Demenz. Dabei gäbe es hier einen riesigen Markt.
STANDARD: Und warum trenden die Psychedelika so? Ist das Selbstmedikation?
Fischer: Weil die im Grunde genau dort ansetzen, wo es auch Suchtmittel tun. Das kann viel Potenzial haben, wobei die Studien, die derzeit durchgeführt werden, nicht explizit auf Suchtkranke fokussieren, sondern auch im Bereich von Depressionen und Schmerzzuständen stattfinden. In der Schweiz gibt es Teams, die dazu sehr spannende Studien durchführen, auf diese Ergebnisse warte ich wirklich ungeduldig. Klar ist aber, dass man Psychedelika nicht einfach so verschreiben kann. Dafür benötigt man ein kontrolliertes Setting, in dem die Menschen auch professionell begleitet werden. (Pia Kruckenhauser, 17.1.2024)