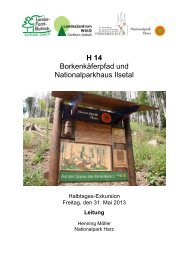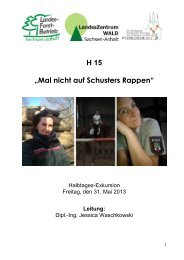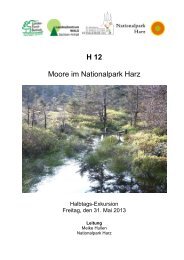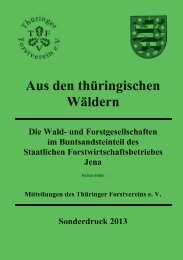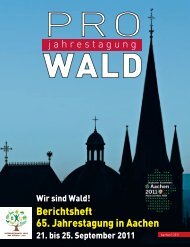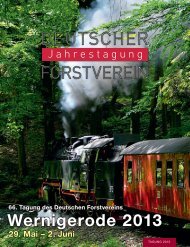G01 - Deutscher Forstverein
G01 - Deutscher Forstverein
G01 - Deutscher Forstverein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
G 01<br />
Kieferndauerwald im Waldschutzgebiet<br />
Bärenthoren<br />
Ganztags-Exkursion<br />
Samstag, 1. Juni 2013<br />
1
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
1. Überblick<br />
Leitung:<br />
Toren Reis, Revierleiter im Forstbetrieb Anhalt<br />
Tel: 0173 3714676<br />
Teilnehmer<br />
Betriebsleitung:<br />
Bernd Dost, Betriebsleiter Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt<br />
Programm:<br />
• Besuch der Grabstätte von Friedrich von Kalitsch<br />
• Besichtigung des Waldschutzgebietes Bärenthoren<br />
• Vorstellung des Projektes 49 Förster – 49 Arten<br />
• Versuchskonzept eines Buchenvoranbaus unter<br />
Kiefernschirm (Leitung durch NW-FVA) im WSG<br />
• Besichtigung einer ertragskundlichen Versuchsfläche<br />
aus dem Jahr 1900<br />
Zeitplan Samstag, 01.06.2013<br />
8:00 Uhr Abfahrt ab Katzenteichparkplatz, Wernigerode<br />
bis 10:00 Uhr<br />
Busfahrt ins Exkursionsrevier<br />
bis 11:00 Uhr<br />
Vorstellung des LFB; Geschichtsrückblick; Imbiss<br />
bis 13:30 Uhr<br />
Exkursionsteil I<br />
13:30 Uhr bis 14:30 Uhr Mittagessen<br />
bis 16:30 Uhr<br />
Exkursionsteil II<br />
16:30 Uhr bis 18:30 Uhr Rückfahrt nach Wernigerode<br />
1
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
2. Exkursionsbeschreibung allgemein<br />
Das Waldgebiet östlich der Ortschaft Bärenthoren ist untrennbar mit dem Namen<br />
Friedrich von Kalitsch verbunden. Sein waldbauliches Handeln vor 100 Jahren hat zu<br />
einer beispiellosen Diskussion in der forstlichen Fachwelt geführt. Zwischen<br />
Verfechtern der Reinertragslehre und den Befürwortern des Dauerwaldgedankens,<br />
allen voran Prof. Dr. Alfred Möller, schwelte ein jahrzehntelanger Streit, der bis in die<br />
heutige Zeit hineinreicht. Das Waldgebiet Bärenthoren gilt als Wiege des<br />
Kieferndauerwaldgedankens.<br />
Die eintägige Exkursion führt die Teilnehmer auf die Spuren des Kammerherrn<br />
Dr.h.c. Friedrich von Kalitsch. Anhand zahlreicher Waldbilder wird der Teilnehmer mit<br />
den vielfältigen waldbaulichen Schwierigkeiten konfrontiert, die die Kiefernwaldbewirtschaftung<br />
zu dauerwaldartigen Strukturen in der heutigen Zeit mit sich bringt.<br />
Sowohl für die Erhaltung dieser historisch bedeutsamen Waldbewirtschaftungsform<br />
als auch für Lehr- und Demonstrationszwecke wurde im Jahr 2009 das<br />
Waldschutzgebiet Bärenthoren ins Leben gerufen. In Zeiten des Klimawandels und<br />
der knappen finanziellen Ressourcen wird die Baumart Kiefer auch außerhalb des<br />
nordostdeutschen Tieflandes eine bedeutsame Rolle bei der Stabilisierung der<br />
Wälder übernehmen.<br />
Die Exkursion soll insbesondere den Praktiker ansprechen, der für sein<br />
Wirkungsgebiet Lösungsansätze und Bewirtschaftungsstrategien sucht.<br />
Friedrich v. Kalitsch Revier Bärenthoren (Krutsch 1924)<br />
⃰ 28.10.1858<br />
†08.01.1939<br />
2
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
3. Exkursion<br />
Exkursionspunkt 1<br />
• Vorstellung des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt<br />
→ siehe Anhang 1 (Kenngrößen Sachsen-Anhalt; LFB; BT Anhalt; Revier 10)<br />
3
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Exkursionspunkt 2<br />
• Geschichtsrückblick<br />
→ siehe Anhang 2 (Kalitsche Behandlungsgrundsätze)<br />
• Vorstellung des Waldschutzgebietes<br />
→ siehe Anhang 3 (Beschreibung des Dauerwaldgedankens)<br />
• Geschichtsrückblick<br />
Mit der Ortsbezeichnung Bärenthoren ist untrennbar der Name von Kalitsch<br />
verbunden. Die Familie von Kalitsch erwarb im Jahr 1843 das Rittergut Bärenthoren/<br />
Polenzko. Es war der gleichnamige Großvater des später forstlich bekannten<br />
Friedrich von Kalitsch, welcher Bärenthoren kaufte. Die Familie von Kalitsch kann als<br />
eine Familie mit forstlicher Tradition bezeichnet werden. Urgroßvater, Großvater und<br />
Onkel des Friedrich von Kalitsch waren forstlich tätig.<br />
Friedrich von Kalitsch wurde am 28.10.1858 in Dessau geboren. Seine forstliche<br />
Ausbildung begann er 1880 in der königlich preußischen Oberförsterei Jägerthal in<br />
Pommern. Nach einer einjährigen Lehrzeit studierte von Kalitsch an der<br />
Forstakademie Eberwalde. Sein Examen zum Forstassessor legte er 1884 ab und<br />
führte hierbei bei Prof. Ramann Untersuchungen über den Einsatz von Holzwolle als<br />
Streuersatz durch. Anschließend übernahm er bis 1892 die Verwaltung der<br />
damaligen Oberförsterei Magdeburgerfurth. Ab 1892 widmete er sich nun der<br />
Bewirtschaftung des ihm übertragenden Waldgutes. Im gleichen Jahr heiratete er<br />
Marie von Wedel und zog mit ihr in das neu errichtete Landhaus in Bärenthoren. Von<br />
nun an wirtschaftete er über 40 Jahre lang eigenständig in seinem Wald. Friedrich<br />
von Kalitsch starb am 8. Januar 1939 im Alter von 81 Jahren auf seinem Gut in<br />
Bärenthoren. Begraben wurde er auf dem nahegelegenen Waldfriedhof.<br />
Nachfolgend wird ein Überblick über die forstliche Ausgangssituation Bärenthorens<br />
gegeben:<br />
Eine erste „Einrichtung“ liegt als Wirtschaftsplan des Jahres 1872 vor. Dieser<br />
beschreibt, dass nur etwa 3 % der Kiefernbestände im Revier über 60 Jahre alt<br />
waren. Das durchschnittliche Alter über die gesamte Wirtschaftsfläche betrug 29<br />
Jahre. Es lässt sich leicht erkennen, dass die Bewirtschaftung des Waldes mittels<br />
Kahlschlag aufgrund der ungünstigen Altersklassenverteilung nicht möglich war.<br />
Friedrich von Kalitsch ging dazu über, seine Waldbestände jährlich zu durchforsten<br />
und zu pflegen (Vorratspflege). Auch stellte er die bis dahin übliche Streunutzung<br />
und Waldweide ein. Insbesondere der Verzicht auf Kahlschläge sollte das<br />
Fundament für den Gedanken des Kieferndauerwaldes werden.<br />
Das Revier Bärenthoren blieb bis zum Ende des II. Weltkrieges im Besitz der Familie<br />
von Kalitsch. Jedoch wurde es 1934 aufgrund hoher Verschuldung unter Kuratel<br />
(Zwangsverwaltung) gestellt. Nach der Enteignung im Jahre 1945 wurde das Revier<br />
durch den staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb Zerbst bewirtschaftet. Mit der<br />
Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten wurde das Revier Bärenthoren der<br />
Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH übergeben. Diese sollte die Waldflächen<br />
im Namen des Bundes privatisieren. In einem einmaligen freiwilligen Landtausch<br />
zwischen der BVVG und der Landesforstverwaltung Sachsen-Anhalt kam das Revier<br />
1998 in Landesbesitz.<br />
4
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
• Vorstellung des Waldschutzgebietes<br />
• Ausweisung im Jahr 2009<br />
• Fläche 240 ha<br />
• Vorrat durch Kyrillschäden von 200 Efm/ha 1998 auf 165 Efm/ha gesunken<br />
• Spätblühende Traubenkirsche auf 9% der Fläche bereits unterstandsbildend<br />
(1998 waren es 7%)<br />
• Eckdaten Forsteinrichtung „Waldschutzgebiet Bärenthoren“, Stichtag 1.1.2010<br />
– Vorrat: 165 Efm/ha<br />
– Zuwachs: 5,2 Efm/ha/a<br />
– Hiebssatz: 3,6 Efm/ha/a<br />
– Pflegefläche: 4 ha/a Ostd, 1 ha/a Ustd<br />
– Verjüngungsfläche: 3 ha/a<br />
5
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Grundsätze der Bewirtschaftung im Waldschutzgebiet<br />
• Erhalt und Weiterentwicklung von dauerwaldartigen Strukturen. Zulassen von<br />
„Hiebsopfern“ durch Entnahme qualitativ schlechter Bestandsglieder<br />
(Zielstärke
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Exkursionspunkt 3<br />
• Naturräumliche Eingliederung<br />
• Gefahren für das Waldschutzgebiet Bärenthoren; Prunus serotina<br />
• Naturräumliche Eingliederung<br />
Das WSG liegt am Südrand des Hohen Flämings und ist mit seiner Entstehung auf<br />
das Warthestadium in der Saale-Eiszeit zurückzuführen. Die Hauptbodenform im<br />
Untersuchungsgebiet ist die Nedlitzer Sandbraunerde (NeS). Es handelt sich hierbei<br />
nicht um reine Sande, sondern um anlehmige Sande, die in ihrer Ausprägung<br />
differenziert betrachtet werden müssen. Eine Sonderform der NeS ist die<br />
plaggenbeeinflusste Braunerde (pNeS), auch eschartige Sandbraunerde genannt.<br />
Diese entstand durch menschliche Bearbeitung. Kennzeichen hierfür ist eine deutlich<br />
braunschwarze Humusanreicherung im Oberboden. Die pNeS hat ein gutes<br />
Porenvolumen und verfügt dadurch über relativ viel pflanzenverfügbares Wasser. Sie<br />
ist im mittleren Bereich der Nährkraftstufe M einzuordnen.<br />
7
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
+ 9 cm L<br />
+ 6 cm Of<br />
+ 4 cm Oh<br />
- 17 cm Bv (Ap1)<br />
- 40 cm Bv (Ap2)<br />
- 55 cm (Bv)<br />
- 90 cm C 1<br />
- 130 cm C 2<br />
plaggenbeeinflusste Nedlitzer Sand-Braunerde<br />
(pNeS), Rev. Bärenthoren<br />
Der Hohe Fläming befindet sich im Großklimabereich Epsilon, dem Fläming-Klima.<br />
Hierbei handelt es sich um ein Übergangsklima zwischen dem ozeanischen und<br />
kontinentalen Typ. Die Durchschnittstemperatur in der Vegetationszeit (Mai-<br />
September) beträgt 15,4C° und die durchschnittlichen Niederschläge innerhalb<br />
dieser Periode liegen bei 258 mm (Jahresdurchschnitt ~ 620 mm).<br />
• Gefahren für das Waldschutzgebiet Bärenthoren; Prunus serotina<br />
Vorkommen der Spätblühenden Traubenkirsche im Revier Hoher Fläming<br />
8
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Eigenschaften von Prunus serotina<br />
• schnelles Wachstum<br />
• Verbissresistenz<br />
• geringer Lichtbedarf<br />
• frühe Fruktifikation<br />
• Samen sind über einen längeren Zeitraum keimfähig<br />
• seltener Schadorganismenbefall<br />
• Pioniergehölz<br />
• hohe Schockausschlagfähigkeit<br />
• allelopathische Wirkung<br />
Übersicht der Bekämpfungsmöglichkeiten<br />
9
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Versuchsanlage auf der Teilfläche 1352 a 2<br />
Bestandsdaten:<br />
Standort<br />
BA<br />
Alter<br />
Jahre EKL Vorrat/ ha<br />
Nutzung im<br />
Jahrzehnt<br />
je ha<br />
Tm TM2<br />
- Gemeine Kiefer<br />
- STK<br />
66<br />
30<br />
1,5<br />
2,0<br />
210 Efm<br />
15 Efm<br />
21 Efm<br />
0 Efm<br />
Im Rahmen einer Bachelorarbeit wurde die Fläche im Jahr 2012 mit Hilfe eines<br />
Seilschleppers gerodet und anschließend das Material mit einem Forwarder von der<br />
Fläche transportiert. Nachträglich wurde die Fläche mit Hand nachgearbeitet<br />
(Entfernung kleinerer STK-Pflanzen).<br />
Bestimmung der Biomasse (Ganzbaumnutzung) je Hektar<br />
(Volumen= WHD2*h*0,000179856)<br />
Probekreisfläche N/ ha Srm/ ha Fm/ ha<br />
1351 a4 6111 134 56<br />
1352 a2 3086 78 33<br />
1343 f 6286 210 88<br />
1342 a 7222 97 40<br />
Die Anerkennung der Maßnahme nach § 9 NatSchG LSA (Ökokonto) zur<br />
Kompensation von Eingriffsfolgen nach § 16 BNatSchG wurde im Jahr 2012<br />
durch die Untere Naturschutzbehörde positiv beschieden.<br />
Betriebswirtschaftliche Betrachtung<br />
Kosten für maschinelle Rodung und Bringung des STK-Materials<br />
Kosten für manuelle Nacharbeitung in den Folgejahren<br />
Gesamtkosten<br />
2600 €/ ha<br />
1050 €/ ha<br />
---------------<br />
3650 €/ ha<br />
Einnahmen aus dem Verkauf von Hackschnitzeln (~100 Srm/ ha)<br />
Einnahmen aus dem Verkauf der Ökopunkte (1 Punkt/ m2 zu 0,25 €)<br />
Gesamteinnahmen<br />
650 €/ ha<br />
2500 €/ ha<br />
---------------<br />
3150 €/ ha<br />
In die Kalkulation mit einzubeziehen sind: Kosten für die bisher praktizierten<br />
Bekämpfungsmaßnahmen, waldbauliche Vorteile, Aufwertung der Wälder aus<br />
der Sicht des Naturschutzes, etc.<br />
10
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Exkursionspunkt 4<br />
• Folgen des Orkantiefs Kyrill im Waldschutzgebiet Bärenthoren<br />
Kyrill<br />
18./19. Januar<br />
2007<br />
14.05.2009 FB Anhalt, Leiter FB W.Uschman<br />
Revier Hoher Fläming; Darstellung der zu 100% geschädigten Flächen.<br />
• Waldflächen im WSG, die zu 100% geworfen wurden:<br />
• Absenkung des Vorrates:<br />
• Gesamtmenge Sturmholz im WSG (auf 240 ha)<br />
• aktueller Hiebsatz im WSG:<br />
~ 32 ha<br />
von 200 Efm auf 165 Efm<br />
~ 11.000 Efm<br />
3,6 Efm/ ha/ a<br />
11
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Exkursionspunkt 5<br />
• Projekt 49 Förster – 49 Arten<br />
→ siehe Anhang 4<br />
Zur Förderung der Artenschutzbemühungen wurde vom LFB Sachsen-Anhalt im<br />
Jahre 2010 das Projekt "49 Reviere - 49 Arten" ins Leben gerufen. Für das Revier<br />
"Hoher Fläming" wurde der Raufußkauz Aegolius funereus als besonders<br />
schützenswerte Art ausgewählt und unter den Aspekten Dispersion, Erhaltung und<br />
Stabilisierung der kleinen Fläming-Population bearbeitet.<br />
Aktivitätsschritte: Auffinden der Käuze durch Verhören der balzenden Männchen und<br />
der brütenden Weibchen in den Schwarzspecht-Höhlen. Ausbringen von Nistkästen<br />
in suboptimalen Biotopen (fehlende Höhlenbäume). Einleitung spezifischer<br />
Maßnahmen zum Schutz der Höhlenbäume.<br />
Ergebnisse: Im gesamten Hohen Fläming wird 2012 von 15-20 Brutpaaren und einer<br />
maximalen Population von 50 Individuen ausgegangen. Die Höhlenbäume vom<br />
Schwarzspecht in den Rotbuchen-Abteilungen sind farblich gekennzeichnet und<br />
finden Beachtung bei Durchforstungen. Im hohen Maße einschlaggefährdet sind die<br />
Höhlenbäume in Altkiefern-Beständen wegen der schwierigen Auffindbarkeit und<br />
Lokalisierung. Die Nistkästen werden gut angenommen und ermöglichen<br />
Neubesiedlungen in Abteilungen ohne ausreichend alte Höhlenbäume.<br />
Der Brutbestand des Raufußkauzes steht in Abhängigkeit zu vorhandenen<br />
Schwarzspecht-Höhlen. Folglich besitzt die Erhaltung der Höhlenbäume oberste<br />
Priorität. Nistkästen sind keine Ersatzbrutplätze, sondern ermöglichen weitere<br />
Brutansiedlungen und damit Bestandsstabilisierungen.<br />
Der Ornithologe Hartmut Kolbe, Dessau-Roßlau, stellt am Beispiel der Abt. 1350 die<br />
Arbeit am praktischen Raufußkauz-Schutz vor.<br />
Aufnahmen April 2013<br />
12
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Exkursionspunkt 6<br />
• Schaffung von dauerwaldartigen Strukturen<br />
Bestandsdaten 1350 a1; 4,0 ha; Standort Tm TM2<br />
BA Alter Flächenanteil<br />
- Gemeine Kiefer<br />
- Gemeine Kiefer<br />
- Gemeine Kiefer<br />
26<br />
114<br />
185<br />
3,3 ha<br />
2,0 ha<br />
1,3 ha<br />
EKL<br />
2,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
Vorrat/ ha<br />
-<br />
51 Efm<br />
59 Efm<br />
Nutzung/<br />
Maßnahme im<br />
Jahrzehnt<br />
je ha<br />
Läuterung<br />
10 Efm<br />
30 Efm<br />
•Anteilfläche im Südosten<br />
- Gemeine Kiefer 65 0,7 ha 1,0 146 Efm 14 Efm<br />
Bestandsdaten 1340 a2; 6,9 ha; Standort Tm TM2<br />
BA Alter Flächenanteil<br />
65 4,3 ha<br />
123 2,2 ha<br />
185 0,4 ha<br />
- Gemeine Kiefer<br />
- Gemeine Kiefer<br />
- Gemeine Birke<br />
EKL<br />
2,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
Vorrat/ ha<br />
203 Efm<br />
180 Efm<br />
120 Efm<br />
Nutzung/ Maßnahme<br />
im Jahrzehnt<br />
je ha<br />
40 Efm<br />
36 Efm<br />
35 Efm<br />
•Restvorrat<br />
- Gemeine Kiefer 185 - 3,0 1,0 Efm 7 Efm<br />
Bestandsdaten 1341 a2; 5,7 ha; Standort Tm TM2<br />
BA Alter Flächenanteil<br />
- Gemeine Kiefer 64 2,7 ha<br />
- Gemeine Kiefer 105 2,5 ha<br />
- Gemeine Birke 64 0,3 ha<br />
- Gemeine Kiefer 182 0,2 ha<br />
EKL<br />
1,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
3,0<br />
Vorrat/ ha<br />
229 Efm<br />
223 Efm<br />
157 Efm<br />
210 Efm<br />
Nutzung/ Maßnahme<br />
im Jahrzehnt<br />
je ha<br />
69 Efm<br />
56 Efm<br />
80 Efm<br />
170 Efm<br />
13
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Exkursionspunkt 7<br />
• Herkömmliche Kiefern-NV-Verfahren<br />
• Festlegung und dauerhafte Markierung der Feinerschließungslinien<br />
• Herkömmliche Kiefern-NV-Verfahren<br />
Bestandsdaten 1331 a3; 4,8 ha; Standort Tm TM2<br />
BA Alter Flächenanteil<br />
- Gemeine Kiefer 95 3,6 ha<br />
- Gemeine Kiefer 195 1,1 ha<br />
- Rotbuche 95 0,1 ha<br />
EKL<br />
2,5<br />
2,5<br />
3,5<br />
Vorrat/ ha<br />
183 Efm<br />
215 Efm<br />
170 Efm<br />
Nutzung/ Maßnahme<br />
im Jahrzehnt<br />
je ha<br />
18 Efm<br />
151 Efm<br />
10 Efm<br />
Bestandsdaten 1340 a1; 2,3 ha; Standort Tm TM2<br />
BA Alter Flächenanteil<br />
- Gemeine Kiefer 130 2,3 ha<br />
- Gemeine Kiefer 49 2,3 ha<br />
(Unterstand)<br />
EKL<br />
2,5<br />
3,0<br />
Vorrat/ ha<br />
236 Efm<br />
22 Efm<br />
Nutzung/ Maßnahme<br />
im Jahrzehnt<br />
je ha<br />
35 Efm<br />
-<br />
14
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
• Festlegung und dauerhafte Markierung der Feinerschließungslinien<br />
Entsprechend der WSG-VO ist der Feinerschließungsabstand im WSG auf 40 m<br />
festgelegt.<br />
Um den Vorgaben der VO gerecht zu werden ist es unumgänglich, die Feinerschließungslinien<br />
dauerhaft festzulegen und zu markieren. Sie ist Voraussetzung<br />
für die einzelstammweise Nutzung und den Aufbau von mehrschichtigen Beständen.<br />
Die Markierung der Gassen erfolgt nach folgendem Schema:<br />
1. Rötung der Rinde<br />
2. Markierung des Gassenverlaufs mit dauerhafter Farbe ˃ ˂<br />
3. Digitalisierung der Gassenverläufe mit GNSS-Empfänger<br />
Dazu:<br />
Im Rahmen einer Bachelorarbeit wurden in den Abteilungen 1318 bis 1321 alte<br />
Befahrungslinien digitalisiert. Die Aufnahmedaten zeigen deutlich, dass in diesen<br />
Beständen ein unkoordiniertes Feinerschließungskonzept zur Anwendung kam.<br />
Negativfolgen:<br />
• Verstärkte Bodenverdichtung<br />
• Höhere Rückeschäden<br />
• Verlust an Produktionsfläche<br />
• Teilbereiche, die schlecht erschlossen sind<br />
15
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Exkursionspunkt 8<br />
• ehemaliger Truppenübungsplatz<br />
• Versuchsflächen<br />
Aufnahme vom 25.10.1953<br />
• ehemaliger Truppenübungsplatz<br />
Die Luftbildaufnahme aus dem Jahr 1953 zeigt die ehemalige Panzerschießbahn der<br />
russischen Streitkräfte. Das Gebiet umfasst eine Größe von rd. 120 ha.<br />
In den zwanziger Jahren traten im Revier Bärenthoren vermehrt Fraßkalamitäten<br />
verursacht durch Kiefernspanner, Kiefernspinner, Nonne und Blattwespe auf.<br />
Durch einen verheerenden Spinnerfraß 1920/21 wurden diese Flächen<br />
kahlgefressen und in den Folgejahren 1922/23 komplett abgetrieben.<br />
Zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges wurde dieses Gebiet dann als Übungsplatz für<br />
Bombenabwürfe (Betonkörper) der Junkers Werke in Dessau genutzt. Anschließend<br />
dienten diese Flächen als Übungsschießplatz für die russischen Besatzer.<br />
Erst durch die Einflussnahme der beiden Oberforstmeister Walter und Wuttky über<br />
die Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR konnten die Flächen 1954<br />
der forstlichen Bewirtschaftung wieder zugeführt werden.<br />
16
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
• Versuchsflächen<br />
Projekt „Nachhaltiges Landmanagement im Norddeutschen Tiefland; NaLaMa-nT“<br />
Ziel:<br />
Entscheidungsgrundlagen für ein nachhaltiges Landmanagement im<br />
norddeutschen Tiefland zu erarbeiten.<br />
Laufzeit: 2010 bis 2015<br />
Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.<br />
Im Untersuchungsraum wurden 4 Modellregionen ausgesucht:<br />
- Landkreis Diepholz<br />
- Landkreis Uelzen<br />
- Region Fläming<br />
- Landkreis Oder-Spree<br />
Eine Vielzahl von Projektpartnern ist bei diesem Forschungsvorhaben beteiligt:<br />
- Georg-August-Universität Göttingen<br />
- Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt<br />
- TU-Berlin<br />
- Uni Rostock<br />
- Landkreise<br />
- Helmholtz Institut ; Zentrum für Umweltforschung<br />
und viele andere….<br />
In diesem Rahmen werden in der Abteilung 1321 durch das Helmholtz-Zentrum<br />
Magdeburg Untersuchungen zu Fragen des Bodenwasserhaushalts durchgeführt.<br />
17
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Versuchskonzept „Buchenvoranbau unter Kiefernschirm“<br />
Vorgestellt durch Axel Noltensmeier; Mitarbeiter der Nordwestdeutschen<br />
Forstlichen Versuchsanstalt; Abteilung Waldwachstum, Sachgebiet<br />
Ertragskunde<br />
→ siehe Anhang 5<br />
Im nordwestdeutschen und nordostdeutschen Tiefland sollen beträchtliche<br />
Kiefernreinbestandsflächen in stabilere Laub- und Laub-Nadel-Mischbestände<br />
umgewandelt werden. Die Kiefer soll dort, wo es die Standortbedingungen zulassen,<br />
in ihrer führenden Position durch Eiche, Buche oder Douglasie ergänzt oder abgelöst<br />
werden. Neben ökologischen Vorteilen, wie der Verbesserung der Standorteigenschaften<br />
und der Reduzierung des Kalamitätsrisikos, versprechen sich die<br />
Forstbetriebe von den zu entwickelnden Beständen eine Ertragssteigerung.<br />
Ungeachtet dessen, dass der Voranbau in Abt. 1321a unabhängig von der<br />
Festlegung eines bestimmten Betriebszieltypen z.B. Douglasie-Buche (douglasienreiche<br />
u. douglasienärmere Variante) oder Kiefer-Buche verhältnismäßig früh, in<br />
einem Bestandsalter der Kiefer von nur 45 Jahren durchgeführt wurde, wird für die<br />
Buchenanteilflächen in Mischbeständen zunehmend gefordert, qualitativ hochwertiges<br />
Holz zu produzieren. Viele der bisherigen Untersuchungen zum Voranbau<br />
der Buche unter Fichten- oder Kiefernschirm haben gezeigt, dass ein Unterschreiten<br />
einer Mindestpflanzenzahl von rd. 5000 Pflanzen je Hektar weitgehend unabhängig<br />
vom Überschirmungsgrad zu Qualitätseinbußen in der Buche führt (vgl. LEONHARDT<br />
u. WAGNER 2006). Auf der Versuchsfläche liegt die durchschnittliche Pflanzenzahl mit<br />
6000 bis 6500 Pflanzen je Hektar (Pflanzverband 2 x 0,8 m) deutlich über diesem<br />
Schwellenwert.<br />
Daneben ist eine wesentliche Weichenstellung für das Wachstum und die qualitative<br />
Entwicklung des Buchenvoranbaus als auch für die Ertragsleistung des Kierfernbestandes<br />
über die Steuerung des Kiefernschirms zu erwarten. KÄTZEL et al. (2006)<br />
haben bei Untersuchungen zum Umbau von Kiefernreinbeständen in Brandenburg<br />
festgestellt, dass bei einer Absenkung des Bestockungsgrades im Kiefernschirm von<br />
1,0 auf 0,4 die Evapotranspirationsrate bereits um das Vierfache ansteigt, was<br />
möglicherweise zu periodischem Trockenstress für die Buche führen kann. Im<br />
vorliegenden Versuch wurde der Buchenvoranbau im Jahr 2002 mit zweijährigen<br />
Sämlingen unter durchweg geschlossenem Kiefernschirm durchgeführt. Bei<br />
Einrichtung der Versuchsvarianten im März 2008 schwankten die<br />
Ausgangsbestockungsgrade zwischen 0,96 und 1,17 (Ertragstafel WIEDEMANN 1943,<br />
mäßige Durchforstung).<br />
18
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Zur Klärung der Frage, bei welcher Schirmstellung Wachstum und Qualität des<br />
Buchennachwuchses optimiert und gleichzeitig Zuwachsverluste im<br />
Kiefernschirm minimiert werden können, sind in der Versuchsanlage folgende<br />
4 Zielbestockungsgrade (Ertragstafel WIEDEMANN, 1943) eingestellt worden:<br />
Ziel-B° 0,4<br />
Ziel-B° 0,6<br />
Ziel-B° 0,8<br />
Ziel-B° 1,0<br />
Es handelt sich um einen vollständig randomisierten Blockversuch mit zweifacher<br />
Wiederholung. Auf den insgesamt 8 ertragskundlichen Versuchsparzellen wurden je<br />
Parzelle 10 feste Probekreise mit einem Radius von 1,78 m eingerichtet auf denen<br />
die Entwicklung der Buchen erfasst werden soll. Die Ermittlung der<br />
Beleuchtungsverhältnisse soll über hemisphärische Fotos erfolgen (vgl. WAGNER<br />
1994). Im weiteren Verlauf des Versuches werden mit Einwachsen der Buchen in<br />
den Zwischen- und Oberstand Fragen der Konkurrenzsteuerung zwischen Kiefer<br />
und Buche zunehmend an Bedeutung erlangen.<br />
Der Versuch kann als Ergänzung der Versuchsanlage Unterlüß 1200 gesehen<br />
werden, wo die Buche unter Kiefer vergleichbaren Alters und mit Ausnahme des<br />
Ziel-B° 1,0 bei gleichen Zielbestockungsgraden ausgepflanzt wurde. Die<br />
Jahresniederschlagsmenge ist im Wuchsbezirk „Hohe Heide“ allerdings um 145 mm<br />
höher als im Wuchsbezirk „Nedlitzer Flämingrandplatte“ wenngleich die<br />
Niederschlagsmenge in der forstlichen Vegetationszeit mit 350 mm im Fläming<br />
sogar um 20 mm höher liegt.<br />
19
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Exkursionspunkt 9<br />
• Schwappach-Fläche<br />
Laubwälder im Fläming<br />
Vielen Dank für Ihren Besuch im<br />
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt<br />
20
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
4. Anhang<br />
Anhang 1<br />
Kenngrößen Sachsen-Anhalt; LFB; BT Anhalt; Revier Hoher Fläming<br />
Wald in Sachsen-Anhalt<br />
Gesamtwaldfläche: 492.000 ha<br />
Bewaldungsprozent: 24 %<br />
Eigentumsverteilung: 55 % Privatwald<br />
28 % Landeswald<br />
10 % Bundeswald<br />
7% Kommunal- und Kirchenwald<br />
Baumartenverteilung:<br />
67 % Nadelwald (45 % Gemeine Kiefer; 12 % Fichte)<br />
33 % Laubwald ( 11 % Eiche; 8 % Buche)<br />
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt<br />
Gesamtfläche:<br />
140.000 ha (HB 130.000 ha; NHB 10.000 ha)<br />
Anzahl der Mitarbeiter: ~ 240 (1,7 Mitarbeiter/ 1000 ha)<br />
Sitz der Betriebsleitung: Magdeburg<br />
Leiter des LFB:<br />
Bernd Dost<br />
Zertifizierung:<br />
PEFC (zwei Reviere nach FSC)<br />
Jahreseinschlag: 650.000 Efm/ Jahr (~ 5,1 Efm/ ha/ a)<br />
Betriebsteile: Altmark Leiter: Andreas Kriebel<br />
Anhalt Leiter: Wilhelm Uschmann<br />
Oberharz Leiter: Joachim Bauling<br />
Ostharz Leiter: Hans Schattenberg<br />
Süd Leiter: Holger Koth<br />
Reviere:<br />
49 (13300 Efm/Revier /a); RV-Größen: 2000 ha – 4000 ha<br />
Betriebsteil Anhalt<br />
Gesamtfläche:<br />
36.000 ha<br />
Jahreseinschlag: ~150.000 Efm/ Jahr<br />
Vorrat:<br />
184 Efm/ ha<br />
Zuwachs:<br />
6,4 Efm/ ha/ a<br />
Hiebssatz:<br />
4,2 Efm/ ha / a<br />
Baumartenverteilung: 62 % Gemeine Kiefer; 17 % Eiche; 6 % Buche; 10 % WLB<br />
Revier: 11<br />
Revier Hoher Fläming<br />
Gesamtfläche:<br />
Jahreseinschlag:<br />
Vorrat:<br />
Zuwachs:<br />
Hiebsatz:<br />
Baumartenverteilung:<br />
Aufforstungsfläche:<br />
2923 ha (davon NHB 41,2 ha)<br />
13500 Efm/ Jahr<br />
173 Efm/ ha<br />
6,5 Efm/ ha/ a<br />
4,7 Efm/ ha/ a<br />
59 % Kiefer; 8 % SNB; 15 % Eiche; 14 % Buche<br />
31 ha/ Jahr (davon 7 ha über NV)<br />
21
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Anhang 2<br />
Kalitsche Behandlungsgrundsätze<br />
(aus Bachelorarbeit von Johannes Ganzert; Jahr 2011)<br />
22
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
23
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Anhang 3<br />
Beschreibung des Dauerwaldgedankens<br />
(aus Bachelorarbeit von Johannes Ganzert; Jahr 2011)<br />
24
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
25
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Anhang 4<br />
26
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Anhang 5<br />
Versuchskonzept Buchenvoranbau unter Kiefernschirm<br />
Anhang 5.1:<br />
Parzellenplan von Abt. 1321<br />
Buchenvoranbau unter Kiefer<br />
27
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Anhang 5.2:<br />
Hemisphärische Fotos aus Parzelle Nr. 7, Verjüngungsplot Nr. 28 vor und nach der<br />
Durchforstung, Zielbestockungsgrad 0,4<br />
Anhang 5.3:<br />
Bestandesdaten Frühjahr 2013<br />
verbleibender Bestand<br />
ausscheidender Bestand<br />
Alter D100 H100 Dg Hg N G V B° Dg N G V<br />
[cm] [m] [cm] [m] [Stk./ha] [m 2 ] [m 3 ] [cm] [Stk./ha] [m 2 ] [m 3 ]<br />
Pz. 2 Ki 54 30,1 21,4 24,3 20,3 425 19,7 179 0,6 18,8 230 6,4 55<br />
Pz. 3 Ki 54 30,3 22,0 21,1 19,8 747 26,2 236 0,8 16,1 329 6,7 55<br />
Pz. 6 Ki 54 30,2 23,3 20,8 20,5 974 33,2 311 1,0 15,9 326 6,5 55<br />
Pz. 7 Ki 54 29,4 22,4 25,6 21,4 291 15,0 143 0,4 21,6 194 7,1 66<br />
Abkürzungen:<br />
Ki = Kiefer; D100 = mittlerer Durchmesser der 100 Stärksten; H100 = mittlere Höhe<br />
der 100 Stärksten; Dg = Durchmesser des Grundflächenmittelstammes; Hg = Höhe<br />
des Grundflächenmittelstammes; N = Stammzahl; G = Grundfläche;<br />
V = Vorrat/ Volumen; B° = Bestockungsgrad<br />
28
Stammzahl [N/ha]<br />
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Anhang 5.4:<br />
Durchmesser- und Volumenzuwachs in der Aufnahmeperiode 2007-2012 in<br />
Abhängigkeit vom Bestockungsgrad<br />
___________________________________________________________________<br />
Anhang 5.5:<br />
Stammzahlentwicklung bei der Kiefer in Abhängigkeit vom Bestockungsgrad<br />
Stammzahlentwicklung<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
B° 1,0<br />
B° 0,8<br />
B° 0,6<br />
B° 0,4<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
2002 2007 2013<br />
Jahr<br />
29
Vorrat [Vfm]<br />
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Anhang 5.6:<br />
Vorratsverteilung bei der Kiefer im Sommer 2013 in Abhängigkeit vom<br />
Bestockungsgrad<br />
Kiefernvorrat 2013<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
1,0 0,8 0,6 0,4<br />
Bestockungsgrad<br />
Anhang 5.7:<br />
Durchmesserdifferenzierung der Buche im Alter 13 in Abhängigkeit vom<br />
Bestockungsgrad der Kiefer<br />
30
66. Jahrestagung des Deutschen <strong>Forstverein</strong>s e.V. Exkursion G 01<br />
Anhang 5.8:<br />
Höhenentwicklung der Buche in Abhängigkeit vom Alter und Bestockungsgrad der<br />
Kiefer<br />
31


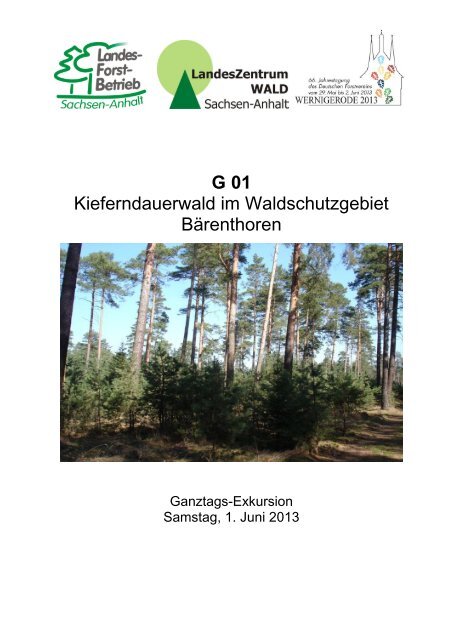
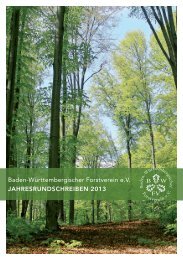
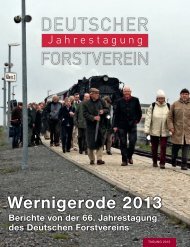
![Vortrag_Ullrich_warendorf_20130305 [Kompatibilitätsmodus]](https://img.yumpu.com/22691664/1/184x260/vortrag-ullrich-warendorf-20130305-kompatibilitatsmodus.jpg?quality=85)