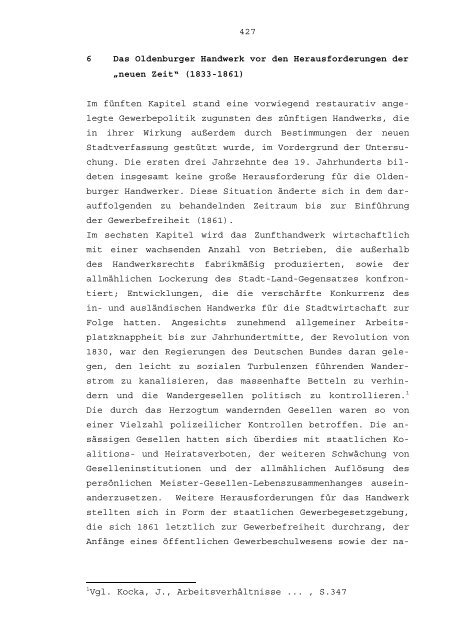Dokument 8.pdf - oops
Dokument 8.pdf - oops
Dokument 8.pdf - oops
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
427<br />
6 Das Oldenburger Handwerk vor den Herausforderungen der<br />
„neuen Zeit“ (1833-1861)<br />
Im fünften Kapitel stand eine vorwiegend restaurativ ange-<br />
legte Gewerbepolitik zugunsten des zünftigen Handwerks, die<br />
in ihrer Wirkung außerdem durch Bestimmungen der neuen<br />
Stadtverfassung gestützt wurde, im Vordergrund der Untersu-<br />
chung. Die ersten drei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts bil-<br />
deten insgesamt keine große Herausforderung für die Olden-<br />
burger Handwerker. Diese Situation änderte sich in dem dar-<br />
auffolgenden zu behandelnden Zeitraum bis zur Einführung<br />
der Gewerbefreiheit (1861).<br />
Im sechsten Kapitel wird das Zunfthandwerk wirtschaftlich<br />
mit einer wachsenden Anzahl von Betrieben, die außerhalb<br />
des Handwerksrechts fabrikmäßig produzierten, sowie der<br />
allmählichen Lockerung des Stadt-Land-Gegensatzes konfron-<br />
tiert; Entwicklungen, die die verschärfte Konkurrenz des<br />
in- und ausländischen Handwerks für die Stadtwirtschaft zur<br />
Folge hatten. Angesichts zunehmend allgemeiner Arbeits-<br />
platzknappheit bis zur Jahrhundertmitte, der Revolution von<br />
1830, war den Regierungen des Deutschen Bundes daran gele-<br />
gen, den leicht zu sozialen Turbulenzen führenden Wander-<br />
strom zu kanalisieren, das massenhafte Betteln zu verhin-<br />
dern und die Wandergesellen politisch zu kontrollieren. 1<br />
Die durch das Herzogtum wandernden Gesellen waren so von<br />
einer Vielzahl polizeilicher Kontrollen betroffen. Die an-<br />
sässigen Gesellen hatten sich überdies mit staatlichen Ko-<br />
alitions- und Heiratsverboten, der weiteren Schwächung von<br />
Geselleninstitutionen und der allmählichen Auflösung des<br />
persönlichen Meister-Gesellen-Lebenszusammenhanges ausein-<br />
anderzusetzen. Weitere Herausforderungen für das Handwerk<br />
stellten sich in Form der staatlichen Gewerbegesetzgebung,<br />
die sich 1861 letztlich zur Gewerbefreiheit durchrang, der<br />
Anfänge eines öffentlichen Gewerbeschulwesens sowie der na-<br />
1 Vgl. Kocka, J., Arbeitsverhältnisse ... , S.347
428<br />
tionalen Handwerkerbewegung und der politischen Verfas-<br />
sungsbewegung in Oldenburg 1848/49.<br />
6.1 Staatliche Aufsicht und Lebensverhältnisse der<br />
Handwerksgesellen<br />
Im folgenden werden einige grundsätzliche sozialhistorische<br />
Zusammenhänge, die die Situation der Gesellen in den ersten<br />
zwei Dritteln des 19. Jahrhunderts bestimmten, kurz skiz-<br />
ziert, um Wandlungen auf der zu untersuchenden regionalen<br />
Ebene besser erkennen und erklären zu können. Berufs-,<br />
branchen- und regionalspezifische, Stadt-Land typische Ent-<br />
wicklungen im Handwerk werden dabei nicht berücksichtigt.<br />
Als ein wesentliches Ergebnis in seiner Untersuchung über<br />
den Klassenbildungsprozeß in Deutschland im 19. Jahrhundert<br />
hebt Kocka die scharfe Trennung zwischen formal selbständi-<br />
ger und formal unselbständiger Arbeit hervor, die wesent-<br />
lich durch das Fortleben der Zunfttradition in asymmetri-<br />
scher Form, also dem einseitigen Abbau des Zunftsystems zu<br />
ungunsten der Gesellen, bewirkt wurde. 2 Der anwachsenden<br />
sozialökonomischen Differenzierung bei den Meistern, die<br />
nicht nur die Spannweite zwischen arm und reich erweiterte,<br />
sondern auch die Grenzen zwischen Selbständigkeit und Un-<br />
selbständigkeit infolge der allmählichen Durchsetzung des<br />
Marktprinzips in der Phase der Frühindustrialisierung (vgl.<br />
Meister, die im Verlagswesen arbeiteten) verwischte, stan-<br />
den nach wie vor die - wenn auch beschnittenen - zünftigen<br />
Regelungen bei Seite. Das (staatlich gesetzte) Handwerks-<br />
recht hatte den sozialen, ökonomischen und sich in der Le-<br />
bensführung niederschlagenden Unterschied zwischen Meistern<br />
und Gesellen seit jeher fixiert. Die Privilegierung der<br />
Meister gegenüber ihren Gehilfen wurde im 19. Jahrhundert<br />
2 Die zusammenfassenden knappen Bemerkungen folgen den Ausführungen<br />
des Kapitels über Gesellen und Meister bei Kocka,<br />
J., Arbeitsverhältnisse ... , S.297-358
429<br />
staatlicherseits noch fortgesetzt, indem ihnen weitere<br />
vielfältige Kontroll- und Aufsichtsrechte (z.B. Organisati-<br />
on und Kontrolle der Arbeitsvermittlung, Kontrolle der Ge-<br />
sellenkassen) zugesprochen, Innungen gefördert wurden. Der<br />
hierarchische Charakter der Zunftorganisation wirkte inner-<br />
halb der Meisterschaft zugleich einheitsstiftend. Er beein-<br />
flußte auch das Selbstverständis und Verhalten des an der<br />
Armutsgrenze lebenden Alleinmeisters; obwohl dessen ökono-<br />
mische Lage schon sehr der vieler Gesellen ähnelte, fühlte<br />
er sich den Meistern zugehörig.<br />
Im Gegensatz dazu schwächten obrigkeitsstaatliche Eingriffe<br />
und Kontrollen gegenüber den Gesellenverbindungen, der Wan-<br />
derschaft den berufsständischen Zusammenhalt der Gesel-<br />
len. 3 Ohne den staatlichen Schutz, der den Meistern auf der<br />
anderen Seite gewährt wurde, konnten Verlagswesen, Fabrik,<br />
der handwerkliche Großbetrieb die Arbeits- und Lebenssitua-<br />
tion der Gesellen ungehinderter verändern. Die Unterschiede<br />
in der Gesellenschaft vergrößerten sich: der Wechsel in die<br />
Fabrik als handwerklich qualifizierter Fabrikarbeiter sowie<br />
als angelernte oder ungelernte Hilfskraft, die Tätigkeit im<br />
handwerklichen Groß- oder Kleinbetrieb, als verlegter Heim-<br />
arbeiter wurden seit den 40er Jahren üblich. Neue Arbeits-<br />
formen beeinflußten die Lebensgestaltung der Gesellen: der<br />
Anteil der Gesellen, die bei ihrem Meister wohnten, nahm<br />
ab; immer mehr Gesellen heirateten und lösten sich damit<br />
aus der Junggesellenkultur der Herbergen und wandernden Ge-<br />
sellen. Das Ideal der Selbständigkeit verblaßte. 4 Mit dem<br />
3 Vgl. dazu die Definition der berufsständischen Tradition<br />
der Gesellen bei Kocka: „Dieser Zusammenhalt basierte auf<br />
gemeinsamen beruflichen Fertigkeiten und einigermaßen übereinstimmenden<br />
berufs- und stellungsbezogenen Interessen; zu<br />
ihm gehörten gemeinsame Formen der Lebensführung, Ehrbegriffe<br />
und Normen; in gegenseitigem Erkennen und verdichteter<br />
Kommunikation wurde er realisiert und duch Reste eines<br />
spezifischen gemeinsamen Rechts ebenso abgestützt wie durch<br />
Erwartungen Dritter, die die Gesellen sowohl von den Meistern<br />
wie auch von anderen Teilen der handarbeitenden Bevölkerung<br />
unterschieden.“ (Ebenda, S.345)<br />
4 Kocka weist nach, daß zwischen der Verheiratung und dem<br />
Auszug aus dem Meisterhaushalt kein zwingender Zusammenhang<br />
auszumachen ist. „[...] der Anteil der verheirateten Gesel-
430<br />
Auszug aus dem Meisterhaushalt setzte sich der Geldlohn und<br />
leistungsbezogene Entlohnung der Gesellen durch. Das Mei-<br />
ster-Gesellen-Verhältnis reduzierte sich zusehends auf den<br />
Tausch von Arbeit gegen Lohn. Der Prozeß der Aufspaltung<br />
der Meister und Gesellen in Selbständige und Lohnarbeiter<br />
ging auf die Frühindustrialisierung und staatliche Diszi-<br />
plinierungsmaßnahmen zurück, die in ihrer Kombination er-<br />
folgreich die alten ständisch-zünftigen Strukturen zurück-<br />
drängten; der Gegensatz erhielt seine spezifische Ausprä-<br />
gung gegenüber den Entwicklungen beispielsweise in Frank-<br />
reich und England dadurch, daß Zunftregelungen einseitig<br />
zuungunsten der Gesellen abgebaut wurden und dadurch die<br />
Klassenspannung verschärften. Der Meister-Gesellen-<br />
Unterschied im 19. Jahrhundert war sowohl ökonomischer wie<br />
auch rechtlicher Art.<br />
6.1.1 Heiratsverbot und politischer Ehekonsens<br />
Den thematischen Hintergrund bildet das Heiratsverhalten<br />
der Gesellen im 19. Jahrhundert. Ehelosigkeit und Einbin-<br />
dung in den Meisterhaushalt waren zentrale Merkmale, die<br />
len lag tiefer und wuchs langsamer als der Anteil der nicht<br />
mehr beim Meister lebenden Gesellen“ (Ebenda, S.331). Kocka<br />
führt dies auf das noch existierende unterschiedliche Heiratsverhalten<br />
von Fabrikarbeitern und Gesellen zurück:“Sei<br />
es aufgrund beengter ökonomischer Spielräume, sei es, weil<br />
die Vorstellung vom Zusammenhang zwischen Familiengründung<br />
und Selbständigkeit in den Köpfen der jungen Handwerker und<br />
ihrer möglichen Bräute die gesetzlichen und zünftigen Ehehindernisse<br />
überlebte, [...]“ (S.330f.). Daß sich überdies<br />
in einigen großen Handwerken auch noch am Ende des 19.<br />
Jahrhunderts ein durchschnittlicher Altersunterschied zwischen<br />
Meistern und Gesellen gehalten hatte, Gesellen im<br />
Durchschnitt jünger und häufiger unverheiratet als der<br />
Durchschnitt der Meister und der Fabrikarbeiter waren, erklärt<br />
Kocka mit dem Abwandern zahlreicher Gesellen in andere<br />
Bereiche. In der Fabrik, im Heimgewerbe und im Transportwesen<br />
war es längst keine Ausnahme mehr, in abhängiger<br />
Stellung verheiratet zu sein; andere machten sich nach wie<br />
vor selbständig.
431<br />
die zünftige Handwerksgesellenexistenz von der des Lohnar-<br />
beiters unterschied. Kocka spricht von einem zentralen<br />
Scharnier, das sich durch „[...] die weit über ein Ver-<br />
tragsverhältnis und übers ökonomische hinausreichende Mehr-<br />
dimensionalität des Meister-Gesellen-Verhältnisses,<br />
sein[en] lebensphasenspezifische..[n] Übergangscharakter,<br />
eine besondere Gesellenkultur“ auszeichnete. 5 Dieses Schar-<br />
nier verlor im 19. Jahrhundert wohl an Tragfähigkeit, die<br />
unterschiedlichen Interessen von Meistern, Obrigkeit und<br />
der Gesellen selbst an der Aufrechterhaltung dieser<br />
„sozialen Tradition“ standen einem rigorosen Auflösungspro-<br />
zeß jedoch entgegen. 6<br />
Ehmer geht von der Stärke sozialer Traditionen im Handwerk<br />
des 19. Jahrhunderts aus. Er definiert „soziale Traditio-<br />
nen“ als „[...] `reale´historische Verhaltensweisen und<br />
Vorstellungen, Regeln und Normen, Strukturen und Institu-<br />
tionen“. 7 Ein Verhalten begreift er wegen seiner histori-<br />
schen Dauer als traditional, und nicht, weil es einer vo-<br />
rindustriellen Periode entstammt. Ehmer bewertet Traditio-<br />
nen nicht als Hemmnisse, sondern als aktives, kreatives<br />
Verhaltens- und Denkpotential zur Gegenwartsbewältigung:<br />
wie wurden tradierte Werte, vertraute Verhaltensweisen und<br />
Institutionen benutzt, um mit neuen Anforderungen umzuge-<br />
hen? Wie erleichterten sie die Anpassung an neue Verhält-<br />
nisse? 8 Die Mischungsverhältnisse von alten und neuen Menta-<br />
litäten, Verhaltensweisen, Institutionen werden betont,<br />
nicht die Dichotomie von Tradition und Modernität, wie dies<br />
beispielsweise Kocka zur klareren systematischen Erfassung<br />
von bewegenden und retardierenden Kräften im Klassenbil-<br />
dungsprozeß tut, wenn er das „alte Handwerk“ idealtypisch<br />
im Gegensatz zur „Welt des Marktes, des Wachstums, der<br />
5 Kocka, J., Arbeitsverhältnisse ... , S.330<br />
6 Vgl. Ehmer, J., „Weiberknechte“ versus ledige Gesellen.<br />
Heirat und Familiengründung im mitteleuropäischen Handwerk,<br />
in: ders., Soziale Traditionen in Zeiten des Wandels ...,<br />
S.38ff<br />
7 Ebenda, Einleitung S.9<br />
8 Vgl. Ebenda, S.10
432<br />
Klassen und der Staatsbürgergesellschaft späterer Jahrzehn-<br />
te“ sieht. 9 Außerdem will Ehmer in dem Veränderungsprozeß<br />
sozialer Traditionen die bewußte Entscheidung der Handwer-<br />
ker, die Optionen jenseits aller Rahmenbedingungen, hervor-<br />
heben.<br />
Diese Überlegungen basieren auf der Untersuchung der Ent-<br />
wicklung des European Marriage Pattern (hohes Heiratsalter,<br />
hohe Ledigenquoten) in der Periode des Übergangs zur indu-<br />
striellen Gesellschaft. Die sozialregionale Differenzierung<br />
des Heiratsverhaltens in England und Mitteleuropa (Dt.<br />
Reich und österreichische Hälfte der Habsburger Monarchie)<br />
ergab eklatante Unterschiede. 10 Die englischen Befunde be-<br />
stätigten überall den langfristigen Trend vom Zusammenhang<br />
von Industrialisierung und niedrigem Heiratsalter. In Mit-<br />
teleuropa hingegen war die Beziehung zur Entfaltung des Ka-<br />
pitalismus vielschichtiger. Neben den Industriezonen Sach-<br />
sens und Thüringens und den von einer kapitalistisch ge-<br />
prägten Gutswirtschaft geprägten ostelbischen Gebiete, die<br />
ein niedriges Heiratsalter aufwiesen, gab es Regionen mit<br />
rückständiger Sozialstruktur sowie einer Gemengelage<br />
(beispielsweise Gebiete mit einer sich modernisierenden<br />
Landwirtschaft auf der Basis des bäuerlichen Familienbe-<br />
triebs oder kapitalistische Gewerbeproduktion in kleinbäu-<br />
erlich-handwerklichen Strukturen), in denen sich das früh-<br />
neuzeitliche Heiratsverhalten sogar stärker ausprägte. Be-<br />
sonders in den mitteleuropäischen Städten zeigte sich die<br />
soziale Autonomie und Tradition der Heiratsmuster anhand<br />
9 Vgl. Kocka, J., Traditionsbindung und Klassenbildung. Zum<br />
sozialhistorischen Ort der frühen deutschen Arbeiterbewegung,<br />
in: HZ Bd.243/1986, S.337; vgl. Ehmer,<br />
„Weiberknechte“ ... , S.13f.,16<br />
10 Vgl. Ehmer, J., Heiratsverhalten, Sozialstruktur, ökonomischer<br />
Wandel. England und Mitteleuropa in der Formationsperiode<br />
des Kapitalismus (Krit. Studien zur Gesch.wiss;<br />
Bd.92), Göttingen 1991; ders., Heiratsverhalten und sozialökonomische<br />
Strukturen: England und Mitteleuropa im Vergleich,<br />
in: Haupt, H.-G., Kocka, J., (Hg.), Geschichte und<br />
Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international vergleichender<br />
Geschichtsschreibung, Frankfurt/New York 1996,<br />
S.181-206
433<br />
der hohen Ledigenquoten. Im Gegensatz zu England unter-<br />
schied sich das Heiratsverhalten im städtischen Handwerk<br />
erheblich von dem anderer gewerblicher Arbeiter. Bis späte-<br />
stens zum 18. Jahrhundert hatten sich dort zwei Traditions-<br />
muster ausgebildet: in Handwerken, die auf Lohnarbeit be-<br />
ruhten oder in Verlagsbeziehungen eingebunden waren, wurde<br />
die Verehelichung von Gesellen prinzipiell gestattet; in<br />
den Betrieben der kleinen Warenproduktion hingegen nicht.<br />
Ursachen für die Persistenz der sozialen Tradition des Le-<br />
digenstandes innerhalb der mitteleuropäischen Gesellen-<br />
schaft im 19. Jahrhundert werden sichtbar, wenn Ehmer das<br />
unterschiedliche Heiratsverhalten in den beiden Untersu-<br />
chungsräumen auf die jeweilige Sozialverfassung des Hand-<br />
werks bezieht. 11 In England war beispielsweise um 1600 der<br />
verheiratete Handwerksgeselle, der einen eigenen Haushalt<br />
führte, gegen Lohn arbeitete und dessen Frauen und Kinder<br />
in anderen Branchen Verdienst suchten, keine Seltenheit.<br />
Die Auswertung von Daten ergab, daß um die Mitte des 19.<br />
Jahrhunderts Lehrlinge und Gesellen kaum bei ihren Arbeit-<br />
gebern mitwohnten. Die Handwerksausbildung bestand seit<br />
1563 („Statute of Artificers“) in einer siebenjährigen<br />
Lehrzeit. Der nicht vor dem 21. Lebensjahr zu erteilende<br />
Lehrabschluß war Voraussetzung für jedwede Gewerbeausübung<br />
und bedeutete zugleich den Eintritt in die Bürgerrechte der<br />
Stadt. Dem Handwerker war es freigestellt, sich als Meister<br />
oder als Geselle niederzulassen. Mit dem Ende der Lehrzeit<br />
wurde ihm die Reife zur Heirat und zur Gründung eines eige-<br />
nen Haushalts zuerkannt. Sowohl Meister als auch Gesellen<br />
durften Lehrlinge annehmen. Eine institutionalisierte, von<br />
der Obrigkeit gewährleistete Wanderpflicht hat es in Eng-<br />
land nie gegeben. Hier herrschte zwar auch eine hohe regio-<br />
nale Mobilität der Handwerksgesellen, die aber in einem di-<br />
rekten Zusammenhang mit Arbeitsmarkt und Arbeitskämpfen<br />
11 Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das Kapitel<br />
„Ledige Handwerksgesellen und proletarische Familienväter“,<br />
in: Ehmer, J., Heiratsverhalten, Sozialstruktur ... ,<br />
S.159-235
434<br />
stand und die gleichermaßen ledige wie auch verheiratete<br />
Gesellen erfaßte. Die englischen Zünfte waren keine Zwangs-<br />
genossenschaften: es gehörten ihnen weder alle Meister ei-<br />
nes Gewerbes an, noch waren Gesellen von der Teilnahme aus-<br />
geschlossen. „Meister“ und „Geselle“ waren in England keine<br />
rechtlichen, hierarchisch angeordneten Kategorien, ihr Ver-<br />
hältnis zueinander war wesentlich stärker auf die ökonomi-<br />
sche Beziehung von Arbeitsgeber und Arbeitnehmer festge-<br />
legt. Aus alldem folgert Ehmer, daß die Bindung der Heirat<br />
an die Meisterschaft keine soziale Logik enthielt. Die Be-<br />
deutung der sozialen Plazierung beeinflußte zwar auch die<br />
Planung einer Ehe, aber ausschlaggebend waren individuelle<br />
Strategien und nicht die institutionelle Bindung von Fami-<br />
lienstand und sozialökonomischer Position. Die traditionel-<br />
le Sozialverfassung des englischen Handwerks enthielt keine<br />
Mechanismen, die das Heiratsverhalten der Gesellen hätte<br />
beschränken können.<br />
Die Entstehung von Heiratsbeschränkungen im mitteleuropäi-<br />
schen Handwerk ist nicht genau zu ermitteln: Befunde für<br />
Spätmittelalter und frühe Neuzeit erweisen sich als wider-<br />
sprüchlich hinsichtlich des Anteils der verheirateten Ge-<br />
sellen und der Bestrebungen von Zünften und Stadtobrigkei-<br />
ten. Seit Ende des 16. Jahrhunderts gewannen sie allerdings<br />
zunehmende Bedeutung. Ehmer sieht dies in einem Zusammen-<br />
hang mit den Monopolisierungs- und Abschließungstendenzen<br />
der Zünfte vom späten 16. Jahrhundert bis zum 18. Jahrhun-<br />
dert, die im allgemeinen als Reaktion auf wirtschaftliche<br />
Schwierigkeiten interpretiert werden. Neben vielfältigen<br />
Bestrebungen, den Zugang zum Meisterrecht zu erschweren,<br />
wurde beispielsweise auch der Wanderzwang, der direkt eine<br />
Verzögerung der Eheschließung bewirkte, eingeführt und aus-<br />
gedehnt. Die Verfestigung von Ehebeschränkungen und eines<br />
bestimmten Heiratsverhaltens in den Gewerben mit Lohnarbeit<br />
sowie der kleinen Warenproduktion bis zur gesellschaftli-<br />
chen Norm infolge der oben beschriebenen Entwicklung ent-<br />
spricht, Ehmer folgend, der Logik eines von Klaus Bade ent-<br />
wickelten ökonomischen Modells für das mitteleuropäische
435<br />
Handwerk des 17. und 18. Jahrhunderts. Bade sieht die Lage<br />
der Gesellen „wesentlich dadurch bestimmt, daß die Nahrung<br />
der Meister im Handwerk bei starrem Marktgefüge und krisen-<br />
anfälliger Marktlage nur über flexible Beschäftigungspoli-<br />
tik und Nachwuchsrekrutierung zu sichern war.“ 12 Die unter<br />
den Bedingungen der agrarisch-gewerblichen Ökonomie des<br />
Mangels entstandene Zunftwirtschaft erforderte in der klei-<br />
nen Warenproduktion die Aufspaltung der handwerklichen Ar-<br />
beitskräfte in einen zahlenmäßig begrenzten Teil von seß-<br />
haften, verheirateten, mit Bürgerrecht ausgestatteten,<br />
selbständigen Meistern und einen flexiblen Teil mobiler,<br />
lediger, rechtlich und wirtschaftlich unselbständiger, d.h.<br />
im Meisterhaushalt wohnender, Gesellen. In den auf Lohnar-<br />
beit beruhenden Handwerken, in denen die Eheschließung mög-<br />
lich war, verlief die Trennungslinie quer durch die Gesel-<br />
len. Der Wanderzwang sowie der von den kommunalen Behörden<br />
praktizierte „politische Ehekonsens“ dienten hier dazu,<br />
12 zit.n. Ebenda, S.187: Bade, K.J., Altes Handwerk, Wanderzwang<br />
und Gute Policey. Gesellenwanderung zwischen Zunftökonomie<br />
und Gewerbereform, in: VSWG 69, 1982, S.7. Produktion<br />
und Absatz im städtischen Handwerk der Zunftperiode<br />
waren vielfältig differenziert, fest verteilt und in der<br />
Regel durch den lokalen Markt begrenzt. Der Kampf um die<br />
Sicherung der ehrlichen Nahrung im Alten Handwerk wurde<br />
nicht nur durch das „starre Marktgefüge“, sondern auch<br />
durch die „krisenanfällige Marktlage“ bestimmt. Bade weist<br />
hier auf aus anderen Bereichen der Wirtschaft übergreifende<br />
wie auch außerökonomisch bedingte Krisenerscheinungen hin,<br />
die jederzeit abrupt hereinbrechen und die Nachfrage am<br />
Markt für gewerbliche Güter empfindlich stören konnten<br />
(sog. Agrar- und Gewerbekrisen, Seuchen, Kriegseinwirkungen).<br />
Neben dem Kampf gegen die Marktkonkurrenz von außen und unten<br />
(Konkurrenz unzünftiger Pfuscher, Bönhasen etc.) trat<br />
der Kampf gegen potentielle Konkurrenz von innen: gegen die<br />
nachdrängenden Gesellen. Die Ambivalenz der Ausbildungsverordnungen<br />
zeige sich darin, daß das Interesse an Gewerbeförderung<br />
durch Nachwuchsqualifikation verbunden sei mit<br />
dem Selbstschutzinteresse der Meister, durch strenge Kontrolle<br />
die Zulassung zur Meisterschaft zu erschweren. Qualifikationsschwellen<br />
wurden erhöht, Ausbildungszeiten ausgedehnt.<br />
Bade geht es im folgenden dann darum, die soziale<br />
Logik der Spannung zwischen Ausbildungsförderung und von<br />
ökonomischen Zwängen diktiertem Selbstschutzinteresse der<br />
Zunftbürger bei der Einführung und Ausdehnung der Wander-
436<br />
Heiraten hinauszuschieben und die heiratswilligen Gesellen<br />
zu disziplinieren. 13<br />
Die Sozialverfassung des mitteleuropäischen Handwerks, die<br />
in der immer wieder, auch von Bade, zitierten „sittlichen<br />
Ökonomie des Alten Handwerks“ ihren Ausdruck findet, wird<br />
im folgenden von Ehmer noch einmal unter der Frage, inwie-<br />
weit sie die Persistenz des Ledigenstandes unter den Gesel-<br />
len förderte, in ihrem inneren Zusammenhang dargestellt. Er<br />
beschreibt die Vor- und Nachteile der Beschäftigung von<br />
verheirateten Gesellen aus der Sicht der Meister sowie die<br />
widersprüchliche Einschätzung ihres eigenen Familienstandes<br />
durch die Gesellen. Eindeutig überwog dabei das Interesse<br />
an der Aufrechterhaltung der Tradition der Ehelosigkeit. In<br />
der kleinen Gewerbeproduktion spielte die spezifische Ge-<br />
sellenkultur, die auf Familienlosigkeit zugeschnitten war,<br />
einen transitorischen Charakter hatte und als Basis für ei-<br />
ne starke Gruppenloyalität diente, die wiederum die Fähig-<br />
keit zur kollektiven Aktion verstärkte, eine wichtige Rol-<br />
le. Hinzu trat die Furcht des Einzelnen vor dem Verlust des<br />
Standes und darausfolgender sozialer Friktionen<br />
(Ausscheiden aus dem sozialen Netz und dem Statussystem der<br />
Zunft, mangelnde oder in ihren Augen minderwertige oder<br />
konfliktträchtige Beschäftigungsalternativen als Bönhasen).<br />
Die Gesellen kontrollierten daher die Einhaltung der Ehelo-<br />
sigkeit und diskriminierten jene Kollegen, die sich ihr<br />
jahre sichtbar zu machen. (vgl. Bade, K.-J., Altes Handwerk<br />
... , S.6ff).<br />
13 In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren die Obrigkeiten<br />
aus Furcht vor Überbevölkerung und Belastung der<br />
Armenkassen daran interessiert, die Heirat von Angehörigen<br />
der Unterschicht zu erschweren und sie nur unter bestimmten<br />
Bedingungen zuzulassen. Ehmer spricht in diesem Zusammenhang<br />
vom Aufbau eines Systems rechtlicher Ehebeschränkungen,<br />
dem „politischen Ehekonsens“. In diesen Rahmen stellt<br />
er auch die Heiratsverbote für Gesellen, die oftmals in den<br />
Gewerbeordnungen vorkamen. Die vielfältigen Bedingungen,<br />
die ein Geselle erfüllen mußte, um gemäß der Ausnahmeregelung<br />
einen Heiratskonsens zu erlangen, dienten als Mittel<br />
der Disziplinierung. Darüberhinaus wurde das Streben nach<br />
hausrechtlicher Einbindung und Kontrolle aus Angst vor revolutionärer<br />
Betätigung der Gesellen neu belebt (vgl. Ehmer,<br />
J., „Weiberknechte“ ..., S.42ff).
437<br />
entzogen hatten. In den Gewerben mit Lohnarbeit versuchten<br />
nun die verheirateten Gesellen, auf Kosten der ledigen so-<br />
ziale Sicherheit zu gewinnen. Sie wandten sich jedoch nicht<br />
nur gegen die Konkurrenz der Ledigen, sondern wollten ih-<br />
rerseits Ehebeschränkungen durchsetzen. Die Magistrate, die<br />
die Heiratskonsense erteilten, stützten die Norm des Ledi-<br />
genstandes.<br />
Im 19. Jahrhundert stärkte die kapitalistische Transforma-<br />
tion des Kleingewerbes in Mitteleuropa den Meisterhaushalt<br />
als Ort der Produktion sowie der Lebenssphäre der Lehrlinge<br />
und Gesellen, in England hingegen die Gesellenfamilie. Hier<br />
konnten zum einen Arbeitskräfte und Arbeitsorganisation der<br />
niedergegangenen protoindustriellen Textilerzeugung von<br />
Verlegern übernommen werden, um wiederum in Heim- und Fami-<br />
lienarbeit die Massenproduktion von Schuhen zu beginnen.<br />
Gestützt wurde der Übergang von der alten Hausindustrie zur<br />
neuen Heimarbeit durch entwickelte Infrastruktur, Trans-<br />
portsysteme sowie einem System von „middlemen“. Der Über-<br />
gang von den Werkstätten der Meister in die Familien der<br />
Gesellen andererseits vollzog sich, weil in diesen billiger<br />
produziert werden konnte. Daß traditionellerweise die Ge-<br />
sellen verheiratet waren und Familien hatten, erleichterte<br />
die Abwendung. In Mitteleuropa konnte sich der in seine<br />
spezifische handwerkliche Sozialverfassung eingebundene<br />
Meisterhaushalt behaupten, weil Arbeitsorganisation und Ar-<br />
beitskräfte sich ohne Schwierigkeiten den Bedingungen der<br />
Massenproduktion im Verlagswesen anpassen ließen. Hinzu kam<br />
der politische Einfluß der Zünfte. Auf dem Land anderer-<br />
seits wurde Hausindustrie meist nur als Zusatz zur land-<br />
wirtschaftlichen Beschäftigung betrieben; nur einzelne Fa-<br />
milienmitglieder waren protoindustriell tätig; Arbeitslo-<br />
sigkeit bewirkte daher nicht einen vollständigen Arbeits-<br />
ausfall für eine Region; einzelne, davon betroffene Famili-<br />
enangehörige wanderten in die prosperierenden Städte ab.<br />
Außerdem fehlten ausreichende Infrastruktur, Transportsy-<br />
steme und lokales Kapital, um Verleger mit dem Ziel, die
438<br />
Massenproduktion in den handwerklichen Branchen zu organi-<br />
sieren, auf das Land zu ziehen.<br />
Das unterschiedliche Heiratsverhalten in England und Mit-<br />
teleuropa führt Ehmer grundsätzlich erst einmal auf den un-<br />
terschiedlichen Entwicklungsstand der Industrialisierung in<br />
den beiden Untersuchungsräumen zurück. Lohnarbeit war in<br />
England weit verbreitet und stand in einem Zusammenhang mit<br />
der allgemeinen Freiheit der Eheschließung. Weder legte die<br />
handwerkliche Sozialverfassung den Ledigenstand nahe, noch<br />
war der Staat bestrebt, Heiraten zu beschränken. Werkstatt-<br />
arbeit im Handwerk wurde unrentabel; die Familienarbeit<br />
nahm dann im 18. und frühen 19. Jahrhundert an Bedeutung<br />
zu, wobei auf die Tradition der Gesellenfamilie zurückge-<br />
griffen werden konnte, und bewirkte sogar einen Zwang zu<br />
früher Eheschließung. In Mitteleuropa wurde das Heiratsver-<br />
halten durch die Dominanz der kleinen Warenproduktion ge-<br />
prägt. „Heiratsverhältnisse, die vor allem der sozialen Re-<br />
produktion und den arbeitsorganisatorischen Bedürfnissen<br />
der Bauernwirtschaft und des zünftigen Handwerks entspra-<br />
chen, waren gesellschaftlich prägender als solche, die auf<br />
Lohnarbeit beruhten.“ 14 Da sich im Handwerk außerdem der<br />
Meisterhaushalt mit den neuen ökonomischen Anforderungen<br />
vertrug, war die Festigung traditioneller Produktionsweisen<br />
als wünschenswerte und gangbare Alternative vorgezeichnet.<br />
Der Staat unterstützte die Heiratsbeschränkungen in glei-<br />
cher Weise wie der zum Habitus gewordene Ledigenstand der<br />
Unselbständigen selbst. Das Verhältnis von Industrieller<br />
Revolution zu sozialen Traditionen war im Fall der Heirats-<br />
muster dadurch geprägt, daß sie traditionelle Verhaltens-<br />
weisen und Institutionen bekräftigte.<br />
Unter dem Blickwinkel der vorliegenden Arbeit erklärt die<br />
Ehmersche Studie nicht nur die Stärke der Tradition des Le-<br />
digenstandes unter den mitteleuropäischen Gesellen, sondern<br />
weist darüberhinaus auf verschiedene Einflußfaktoren hin,<br />
14 Ehmer, J., Heiratsverhalten, Sozialstruktur ... , S.233
439<br />
die das Beharren zünftiger Mentalitäten im deutschen Hand-<br />
werk förderten.<br />
Für Oldenburg soll der Frage nach Veränderungen im Heirats-<br />
verhalten der Gesellen und damit nach der Stärke der noch<br />
vorhandenen Tradition der Ehelosigkeit nachgegangen werden.<br />
Heirateten Gesellen vermehrt? Welche Motive bewogen sie da-<br />
zu? Welche Rolle spielte die „Junggesellenkultur“ noch im<br />
Denken der Gesellen? Welche Haltung nahmen die staatlichen<br />
Behörden gegenüber dem in der HWO verankerten Heiratsverbot<br />
ein? Gab es unterschiedliche Positionen in der Auseinander-<br />
setzung um Umfang und Art von Beschränkungen des Gesellen-<br />
heiratens? Im Vordergrund der folgenden Ausführungen stehen<br />
die Reaktionen der Regierung und des Staatsministeriums auf<br />
das von Gesellen zunehmend praktizierte Umgehen des Hei-<br />
ratsverbots durch Verzicht auf ihre Handwerksrechte.<br />
1833 stellte die Regierung den Antrag, eine Verfügung zu<br />
erlassen, die das Heiraten von Gesellen, die ihr erlerntes<br />
Handwerk zu diesem Zweck aufgegeben hätten, beschränke, um<br />
die Armenkassen vor der Inanspruchnahme durch erwerbslose<br />
verheiratete Handwerker zu schützen. Großherzog Paul Fried-<br />
rich August ordnete daraufhin an, den Oldenburger Magistrat<br />
in dieser Angelegenheit zu befragen. Dieser stimmte grund-<br />
sätzlich der Ansicht der Regierung zu und schlug darüber<br />
hinaus vor, Steinhauergesellen und Buchdruckergehilfen die<br />
Heirat zu erlauben. Sie könnten den Maurergesellen gleich-<br />
gestellt werden, da es auch in den genannten Berufen<br />
schwierig sei, die Meisterschaft zu erlangen. Die Regierung<br />
erklärte sich mit dem ersten Punkt einverstanden, da der<br />
Hauptgrund, warum es Maurergesellen gestattet sei zu heira-<br />
ten,- daß sie nämlich nicht Kost und Logis im Haushalt des<br />
Meisters erhielten, sondern einen eigenen Haushalt führ-<br />
ten,- für die Steinhauergesellen zuträfe. Anders stelle<br />
sich die Situation der Buchdrucker dar. Da sie nicht zu den<br />
eigentlich zunftmäßigen Gewerben gehörten, würden sie gar<br />
nicht unter das in Art. 65 der HWO ausgesprochene Heirats-<br />
verbot für Gesellen fallen. Aus diesem Grunde habe es die<br />
Regierung auch nicht für verpflichtend gehalten, daß die
440<br />
Buchdruckergehilfen in Jever der Gesellenkrankenkasse bei-<br />
träten. Dem Schlußantrag des Magistrats, daß sich Steinhau-<br />
ergesellen, die sich verheiraten wollten, ihre Nichtbedürf-<br />
tigkeit gemäß Art. 12,2 der Gemeindeordnung nachweisen<br />
sollten, hielt die Regierung entgegen, daß die Maurergesel-<br />
len dieser Bedingung nicht unterworfen seien. 15<br />
Der Landesherr stimmte einer Beschränkung des Heiratens,<br />
indem der Geselle zuvor einen vom Magistrat vorgeschlagenen<br />
Nachweis über die zur Ernährung einer Familie ausreichenden<br />
finanziellen Mittel gemäß Art. 12,2 Gemeindeordnung bei-<br />
bringen mußte, zu. Es könne nur darum gehen, die Gemeinden<br />
vor den Folgen leichtsinnigen Niederlassens von Gewerbe-<br />
treibenden, die zu diesem Zweck ihr erlerntes Gewerbe auf-<br />
gegeben hätten, zu schützen und nicht darum, jemanden auf<br />
dem Verordnungswege zu zwingen, Geselle zu bleiben oder ihm<br />
die Heirat zu verweigern, wenn er dann Gemeindemitglied ge-<br />
worden sei. 16 In Reaktion auf die Aktennotiz des Großher-<br />
zogs, daß es nicht notwendig sei, die Heiratsbeschränkung<br />
der HWO als Zusatz anzufügen, bewilligte das<br />
„Staats=u.Cabinets=Ministerium“, den Antrag der Verordnung<br />
vom 29.3.1833, „über die Einschränkung der Ehen, wegen zu<br />
jugendlichen Alters und wegen Armuth“, beizufügen. Gleich-<br />
falls wurde der Regierung anbefohlen, die Buchdruckergehil-<br />
fen nicht als Handwerksgesellen anzusehen, die Steinhauer-<br />
gesellen jedoch den Maurer- und Zimmergesellen in bezug auf<br />
das Heiraten gleichzustellen. 17<br />
Beinahe drei Monate später beklagte sich die Regierung über<br />
die rechtliche Zuordnung der neuen Verfügung, auch Bedenken<br />
an deren Zweckmäßigkeit überhaupt wurden von einigen Mit-<br />
gliedern geäußert. Die Majorität sprach sich dafür aus, die<br />
Verfügung dem Art. 65 HWO anzuschließen, weil sie aus-<br />
15 Vgl. Verordnung v. 28.12.1831 (= Gemeindeordnung für das<br />
Herzogtum Oldenburg), in: OGS Bd.7 (1834), S.13f.; Regierungsbericht<br />
v. 28.2.1834, in: StAO Best. 31-13-68-1<br />
16 Vgl. Bericht des Staats-u.Cabinets=Ministeriums v.<br />
11.3.1834, in: Ebenda<br />
17 Vgl. Verordnung v.29.3.1833, in: OGS Bd.7 (1834), S.349-<br />
355; Resolution für die Regierung v.29.3.1834, in: StAO<br />
Best. 31-13-68-1
441<br />
schließlich die Umgehung dieses Artikels verhindern wolle,<br />
außerdem selbst kein Eheverbot enthielte und daher nicht<br />
als Zusatz der allgemeinen Verordnung, die Ehen wegen zu<br />
geringen Alters oder wegen Armut verbiete, behandelt werden<br />
könne. Angenommen man habe in diesem Gesetz alle Eheverbo-<br />
te, welche schon aufgestellt worden waren, zusammentragen<br />
wollen, dann hätten hier zu allererst der Art. 65 und die<br />
Bestimmung, daß Soldaten sich nicht ohne Erlaubnis verhei-<br />
raten dürfen, ihren Platz finden müssen. Dies dürfte aber<br />
nicht angemessen gewesen sein, da der Zweck der Gesetze<br />
ganz verschieden gewesen war. Das Heiratsverbot für Gesel-<br />
len und Soldaten war damals nicht aufgestellt worden, um<br />
dazu beizutragen, daß dadurch die Anzahl von Heiraten in<br />
den unteren Schichten allgemein vermindert werden würde.<br />
Die Heirat wurde als mit dem Stand der Gesellen und Solda-<br />
ten nicht vereinbar angesehen und sollte nur unter bestimm-<br />
ten Umständen gestattet werden. Die Regierung hielt sich<br />
also streng an den historischen Entstehungszusammenhang der<br />
einzelnen Verordnungen, ohne die gegebene Situation mitzu-<br />
bedenken, und favorisierte damit eine ständisch geprägte<br />
Sichtweise des Heiratsverbots für Gesellen.<br />
Ein Regierungsmitglied, dem sich einige andere anschlossen,<br />
meinte, daß die angestrebte neue Verfügung der bisherigen<br />
Gesetzgebung widerspreche. Mehrere Jahre habe man darüber<br />
debattiert, ob die Erlaubnis zum Heiraten überhaupt be-<br />
schränkt werden dürfe und hatte sich dann darauf geeinigt,<br />
ausschließlich die Verordnung von 1833 zu erlassen. Jetzt<br />
sollte nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, nämlich die<br />
Gesellen, gezwungen werden, prinzipiell vor einer Verheira-<br />
tung bestimmte Nachweise zu erbringen, um den Heiratskon-<br />
sens zu erhalten, wohingegen „jeder Blinde, Lahme oder<br />
Krüppel“, der nicht aus Armenmitteln unterstützt werden<br />
würde, ohne irgend einen Nachweis die Ehe eingehen könne.<br />
Ein derartiger Nachweis müsse entweder auch für Knechte,<br />
Tagelöhner etc., also allgemein für untere Schichten der<br />
Bevölkerung gelten, oder der Zusatz zu Art. 65 HWO müsse<br />
sich darauf beschränken zu bestimmen, daß ein Geselle im
442<br />
Fall der Verheiratung aus seinem Stand austrete und damit<br />
alle Ansprüche auf eine spätere Meisterschaft verliere. 18<br />
Der ständisch und der eher, wenn auch eingeschränkten,<br />
staatsbürgerlich geprägten Sichtweise setzte Hofrat Böde-<br />
ker 19 noch in einem ausführlichen Einzelvotum seine rein<br />
pragmatisch-konservativ ausgerichtete Ansicht über die<br />
Wirksamkeit der Gesetzgebung schlechthin hinzu. Es sei die<br />
Pflicht des Gesetzgebers ein Gesetz, das Übertretungen und<br />
Umgehungen Raum gewähre, auf der Basis der konkreten Um-<br />
stände nachzubessern, nicht aber darüber hinauszuge-<br />
hen. 20 Daß die Verordnung über die Beschränkung des Heira-<br />
tens, die als erste ihrer Art in Oldenburg erlassen wurde,<br />
einige Modifikationen erleiden würde, damit sei zu rechnen<br />
gewesen. Das Verhalten der Gesellen habe den Anlaß gegeben,<br />
eine auf sie zugeschnittene besondere Bestimmung zu dieser<br />
Verordnung zu formulieren. Zur Zeit gebe es keinen Grund,<br />
sie auch auf andere Personen auszudehnen; zumal, wenn man<br />
18 Vgl. Regierungsbericht v.11.6.1834, in: Ebenda<br />
19 Vgl. Votum des Geh. Hofrats Heinrich Friedrich Gerhard<br />
Bödeker im Anhang des oben genannten Regierungsberichts<br />
20 Vgl. dazu die Beschreibung konservativen Denkens bei<br />
Mannheim, K., Das konservative Denken. Soziologische Beiträge<br />
zum Werden des politisch-historischen Denkens in<br />
Deutschland, in: Schumann, H.G., (Hg.), Konservatismus<br />
(Neue wissenschaftl. Bibliothek Bd.68), Köln 1974, S.24-75;<br />
Mannheim hebt u.a. zwei grundsätzliche Merkmale, die konservatives<br />
von progressivem Denken unterscheiden, hervor:<br />
die Tendenz zum Konkreten, zum Einzelfall. „Einer der wesentlichsten<br />
Charakterzüge dieses konservativen Erlebens<br />
und Denkens scheint uns das Sichklammern an das unmittelbar<br />
Vorhandene, praktisch Konkrete zu sein [...] Der nichtromantisierte<br />
Konservatismus geht stets vom unmittelbaren<br />
Einzelfall aus und erweitert seinen Horizont nicht über die<br />
eigene besondere Umwelt hinaus. Er ist auf unmittelbares<br />
Handeln gerichtet, auf Veränderung der konkreten Einzelheiten,<br />
und kümmert sich deshalb eigentlich nicht um die<br />
Struktur der Welt, in der er lebt [...] Konservativer Reformismus<br />
besteht im Austausch (Ersetzung) der Einzeltatsachen<br />
durch andere Einzeltatsachen („Verbessern“). Progressiver<br />
Reformismus hat die Tendenz, um einer unliebsamen<br />
Tatsache willen die ganze Welt, die um diese Tatsache herumgebaut<br />
ist, in der eine solche Tatsache möglich ist, umzugestalten.<br />
Von hier aus, ist die Tendenz des Progressiven<br />
zum System, die Tendenz des „Konservativen“ zum Einzelfall<br />
verstehbar“. (Ebenda, S.33)
443<br />
allgemein das Heiraten von der Zusage der Behörde abhängig<br />
machen wolle, es an Kriterien mangele, inwieweit Beschrän-<br />
kungen auferlegt werden sollten. Das Mittel, das die Majo-<br />
rität der Regierungsmitglieder fordere, um die Umgehung des<br />
Heiratsverbots zu erschweren, sei angemessen. Handwerksge-<br />
sellen würden anders als Tagelöhner gleich nach der Heirat<br />
vor den Behörden erklären, daß sie nichts anderes als ihr<br />
Handwerk gelernt hätten, kein Auskommen finden könnten und<br />
infolgedessen als Meister aufgenommen werden müßten, wenn<br />
sie nicht der Armenkasse zur Last fallen sollten. Bödeker<br />
verwies hier auf zahlreiche Fälle aus der Praxis. Er hielt<br />
es für notwendig, gesetzlich gegen den Mißstand einzu-<br />
schreiten. Einerseits würden so die Armenkassen entlastet<br />
werden, andererseits bleibe es den Behörden erspart, unter<br />
Umständen gegen die Verordnung des Heiratsverbots zu han-<br />
deln, wenn sie Gesellen wieder in ihren Stand aufnäh-<br />
men. 21 Auf diese Weise würde auch ihr Ansehen erheblich ge-<br />
stärkt werden.<br />
Wie Bödeker, der allerdings die Gesellenklausel der Verord-<br />
nung von 1833 zuordnete, also anders als die Regierung ei-<br />
nen Zusammenhang zwischen den Heiratsverboten sah, hatte<br />
die Majorität Bedenken, die Beschränkung des Heiratens ge-<br />
mäß Art. 12,2 Gemeindeordnung auf größere Personenkreise<br />
auszudehnen. Es existiere zwar der Vorschlag, bei der Ver-<br />
heiratung eine generelle Abgabe zur Bildung von Armenunter-<br />
stützungsfonds zu fordern. Die Umsetzung solcher Gedanken<br />
könne jedoch nur unter ständischer Mitwirkung geschehen, um<br />
den „Schein der absoluten Willkühr“ zu vermeiden. Das<br />
Staatsministerium hielt die Erwägungen der Regierung für<br />
nicht unbegründet, aber doch von nur geringer praktischer<br />
Wichtigkeit. Wesentlich sei die Publikation dieser Verfü-<br />
21 Vgl. dazu z.B. die Verfügung des Staatsministeriums v.<br />
25.11.1857, die die Regierung anwies, die von F.G.Prüllage<br />
aus Dincklage erbetene Restitution (=Rückkehr eines verheirateten<br />
Gesellen in den Gesellenstand) gegen eine frühere<br />
Verzichtleistung auf das erlernte Tischlerhandwerk zu erteilen<br />
(Regierungsbericht v.14.1.1858, in: StAO Best. 31-<br />
13-68-1).
444<br />
gung überhaupt, nicht die Zuordnung zu einer gesetzlichen<br />
Bestimmung. Hinsichtlich ihrer von einigen Regierungsmit-<br />
gliedern in Frage gestellten Zweckmäßigkeit schloß man sich<br />
der Ansicht der Regierungsmajorität an. Paul Friedrich Au-<br />
gust vermerkte, daß die HWO eigentlich nicht der Ort für<br />
die Publikation sein könnte, da der verheiratete ehemalige<br />
Geselle von ihr nicht mehr erfaßt werden wür-<br />
de. 22 Schließlich ging er trotz seiner Bedenken auf den Vor-<br />
schlag der Regierung ein. 23<br />
Die Oldenburger Gesellen scheinen seit den 30er Jahren ver-<br />
mehrt geheiratet zu haben, obwohl alternative einträgliche<br />
Beschäftigungsmöglichkeiten kaum bestanden haben dürften.<br />
In den Augen der Regierung hofften sie entweder darauf, von<br />
dem gut funktionierenden Armenunterstützungssystem aufge-<br />
fangen zu werden oder doch wieder als vollwertige, aller-<br />
dings verheiratete, Gesellen arbeiten zu können. 24 In den<br />
22 Vgl. Stellungnahmen von Mitgliedern des<br />
Staats=u.Cabinets=Ministeriums v. 15./16.6.1834, Aktennotiz<br />
PFA´s v. 1.7.1834, in: Ebenda<br />
23 Vgl. Resolution für die Regierung v.2.7.1834, in: Ebenda;<br />
am 22.11.1834 wurde eine diesbezügliche Bekanntmachung der<br />
Regierung publiziert (vgl. OGS Bd.8, S.182f.). Später<br />
schien es Gesellen gelungen zu sein, sich ohne weiteren<br />
Nachweis trauen zu lassen. Die evangelischen Prediger wurden<br />
deshalb aufgefordert, sich genau nach der Herkunft des<br />
Gesellen zu erkundigen und für den Fall, daß dieser kein<br />
Maurer-, Zimmer- oder Steinhauergeselle sei, den amtlich<br />
bestätigten Nachweis über seine wirtschaftlichen Verhältnisse<br />
zu verlangen (vgl. Bekanntmachung des Konsistoriums<br />
v.24.1.1835, in: OGS Bd.8, S.202f.).<br />
24 Vgl. verschiedene Heiratsgesuche von Gesellen, in: StAO<br />
Best. 262-1 A, Nr.2082c (=Aufsicht über die Gesellen, das<br />
Wandern und Heiraten derselben) und StAO Best. 262-1 A,<br />
Nr.2083a (=Generalia). Um Näheres über die Gründe zu erfahren,<br />
die zu dem Anstieg der Heiraten unter den Gesellen<br />
führten, wäre erst einmal zu ermitteln, wie groß der Anteil<br />
heiratswilliger Gesellen im städtischen Handwerk oder in<br />
den einzelnen Berufen tatsächlich war und welcher Beschäftigung<br />
sie später nachgingen. Die Entwicklung der Meister-<br />
Gesellen-Zahlen seit den 30er Jahren würde einen Anhaltspunkt<br />
dafür geben, inwieweit sich die Chance, Meister zu<br />
werden ggf. verschlechtert hatte und sich Gesellen angesichts<br />
der mangelnden Zukunftsperspektiven in ihrem Beruf<br />
damit abfanden, als sog. lebenslängliche Gesellen zu arbeiten.<br />
Auch die Möglichkeiten, im erlernten Beruf als Geselle<br />
zu arbeiten, müßten eingeschätzt werden können. Leider
445<br />
konnte diesbezüglich außer vereinzelten Hinweisen kein Zahlen-<br />
oder Aktenmaterial aufgetan werden.<br />
-In der Literatur wird für die 30er und 40er Jahre vermutet,<br />
daß die Gesellen auf zunehmende Schwierigkeiten stießen,<br />
sich in der Stadt selbständig niederzulassen (vgl.<br />
Reinders-Düselder, C., Oldenburg im 19. Jahrhundert - Auf<br />
dem Weg zur selbstverwalteten Stadt 1830-1880, in: Geschichte<br />
der Stadt Oldenburg, Bd.2: 1830-1995, hg. von der<br />
Stadt Oldenburg, Oldenburg 1996, S.121). Die Entwicklung<br />
der Meister- und Gesellenzahlen im Tischlerhandwerk zwischen<br />
1834 und 1844 stellt sich folgendermaßen dar: 1834<br />
waren 29 Meister in der Stadt vorhanden; 1841 waren es 31<br />
Meister, 61 Gesellen und 35 Lehrlinge; 1844 umfaßte das<br />
Tischlerhandwerk 26 Meister, 78 Gesellen und 44 Lehrlinge.<br />
Tischlerbetriebe<br />
allein mit 1<br />
Gesellen<br />
mit 2<br />
Gesellen<br />
mit 3<br />
Gesellen<br />
mit 4<br />
Gesellen<br />
mit 5<br />
Gesellen<br />
mit 6<br />
Gesellen<br />
mit 7<br />
Gesellen<br />
1841 10 4 3 10 2 1 - - 1<br />
1844 3 3 3 7 7 1 - 1 1<br />
(Angaben aus StAO Best.262-1 A, Nr.2117)<br />
Auffällig ist, daß die Zahl der Alleinmeister zwischen 1841<br />
und 1844 abgenommen hat und die Betriebe mit 4 Gesellen zugenommen<br />
haben; nach Betriebsgrößen zusammengefaßt (allein,<br />
1 bis 3 Beschäftigte, 4 und mehr) ergibt sich ein Verhältnis<br />
von 10:3; 17:13; 4:10. Betrachtet man die Betriebsgröße<br />
im Tischlerhandwerk unter dem Merkmal der Beschäftigtenzahl,<br />
so kann ein signifikanter Rückgang der Zwergbetriebe<br />
festgestellt werden, während im gleichen Zeitraum ein eindeutiger<br />
Trend zu Werkstätten mit mehr Beschäftigten pro<br />
Betrieb zu verzeichnen ist.<br />
-Im allgemeinen wird davon ausgegangen, daß Arbeitslosigkeit<br />
unter den Gesellen auch in Krisenzeiten nicht sehr<br />
verbreitet war: „Aber für die große Mehrheit der Gesellen<br />
hielten sich die Zeiten der Beschäftigungslosigkeit und der<br />
vergeblichen Arbeitssuche doch sehr in Grenzen.“ (Kocka,<br />
J., Arbeitsverhältnisse ... , S.342). Das Wandern schien<br />
nur in Ausnahmefällen eine verdeckte Form von Arbeitslosigkeit<br />
gewesen zu sein (vgl. Lenger, F., Sozialgeschichte ...<br />
, S.59). Die Berechtigung der zeitgenössischen Klagen über<br />
sinkende Aufstiegschancen wird zumindest angezweifelt. Lenger<br />
meint, daß das schnellere Anwachsen der Gesellen- gegenüber<br />
den Meisterzahlen in den 30er und 40er Jahren zwar<br />
auf eine Verschlechterung der Aufstiegschancen der Gesellen<br />
hinweise, jedoch zu berücksichtigen sei, daß die Zahl der<br />
selbständigen Handwerker gleichzeitig kräftig anwuchs. Klar<br />
sei aber, daß das Anwachsen der durchschnittlichen Betriebsgrößen,-<br />
eine Entwicklung, die seit den 1830er Jahren<br />
einsetzte,- und wachsender Kapitalbedarf die Chancen der<br />
Gesellen verminderte, sich selbständig zu machen (vgl.<br />
Ebenda, S.62). Kocka weist auf die unterschiedlichen Verhältnisse<br />
in den Handwerksberufen hin und daß sich die<br />
Selbständigkeitschance in den Massenhandwerken beispielsweise<br />
kaum verringerte. Dort habe in den schlechten Jahren,<br />
mit 8<br />
Gesellen
446<br />
50er Jahren änderte sich die Situation. Gesellen, die auf<br />
ihr Handwerk verzichteten, arbeiteten beispielsweise in der<br />
Oldenburger Eisengießerei. 25<br />
In den Akten finden sich auch Hinweise auf Bedingungen, un-<br />
ter denen Hofhandwerker und Handwerksgesellen, die sich<br />
beim Militär eingeschrieben hatten, die Verheiratung in den<br />
30er Jahren gestattet wurde. 1832 wurde dem Garderobe-<br />
schneider Carl Schulz von der großherzoglichen Hofverwal-<br />
tung eine Bescheinigung ausgestellt, daß er als Hofschnei-<br />
der angestellt worden sei; aufgrund dieser Bescheinigung<br />
wurde er von einem Pastor getraut. Der Stadtmagistrat zwei-<br />
felte nun daran, daß Prediger befugt seien, auf Bescheini-<br />
gungen der Hofchefs, die sich ausschließlich auf das<br />
Dienstverhältnis bezögen, Trauungen von Ausländern vorzu-<br />
nehmen. Durch sie habe der Bittsteller noch keine Untertan-<br />
bzw. Bürgerrechte erworben. Diese Ansicht wurde bestätigt<br />
und der Regierung bemerklich gemacht, daß die Untertanen-<br />
rechte nur durch eine vorschriftsmäßige Amtsbescheinigung<br />
erworben werden könnten. 26 Ein Nachweis über die finanzielle<br />
1846-49, angesichts von Absatzstockung, Unterbeschäftigung<br />
und Entlassungen, geradezu eine Flucht in die Selbständigkeit<br />
eingesetzt. Das Problem in diesen und vielen anderen<br />
Handwerken bestünde eher in der Entwertung der Selbständigkeit<br />
durch indirekte Abhängigkeit, Unterbeschäftigung und<br />
Armut als in der Schwierigkeit, sich selbständig zu machen<br />
(vgl. Kocka, J., Arbeitsverhältnisse ... , S.353).<br />
25 Es handelte sich dabei um die 1847 begründete Eisengießerei<br />
des G.A.Meyer. Nach Schulze ergab sich hier für Oldenburg<br />
erstmals der Fall, daß ausgebildete Handwerker als<br />
Facharbeiter in die Fabrik eintraten (vgl. Schulze, H.-J.,<br />
Oldenburgs Wirtschaft ... , S.193). Vgl. Bericht des Amts<br />
Oldenburg v.29.4.1853, in: StAO Best. 70, Nr.6668 über das<br />
Heiratsgesuch des Tischlergesellen Unnau aus Osternburg,<br />
der auf sein Handwerk verzichten und als Tischler in der<br />
Eisengießerei arbeiten wollte; Heiratsgesuch und Verzicht<br />
auf Ausübung seines Handwerks seitens eines Tischlergesellen<br />
aus Zwischenahn v.18.3.1852: er wollte gleichfalls als<br />
Arbeiter in der Oldenburger Eisengießerei arbeiten (StAO<br />
Best. 262-1 A, Nr.2118/F.II).<br />
26 Vgl. Reskript an die Regierung wegen Kopulation von Ausländern<br />
v.20.2.1832, in: StAO Best.70, Nr.3503: Konv.III<br />
Führung der Zivilstandsregister, der Kirchenbücher etc./F.4<br />
(=von Seiten der Geistlichen aufgrund der von dem Militärkommando<br />
oder den verschiedenen Hofchefs erteilten Heiratskonsense<br />
vorgenommene Kopulationen 1832-1862)
447<br />
Unabhängigkeit des Bittstellers wurde nicht ausdrücklich<br />
gefordert, doch mit dem Erwerb des städtischen Bürgerrechts<br />
war dieser Nachweis ja verbunden. Leider wurde auch nicht<br />
deutlich, ob Schulz ein ehemaliger zünftiger Geselle oder<br />
von Haus aus unzünftiger Handwerker gewesen war. Gleich-<br />
falls wurden die durch das Militärkommando den beim Militär<br />
arbeitenden Handwerksgesellen erteilten Heiratskonsense an-<br />
gezweifelt. Auch hier wurde festgestellt, daß die diesbe-<br />
züglichen Bescheinigungen sich nur auf das Dienstverhältnis<br />
bezögen und anderweitige gesetzliche Vorschriften, die für<br />
Soldatenhandwerker den amtlich bestätigten Nachweis dar-<br />
über, daß die Heirat in ökonomischer Hinsicht für sie vor-<br />
teilhaft sei, erforderten, die Erlaubnis zur Verheiratung<br />
erst ermöglichten. 27 Das Soldatenhandwerk eröffnete also<br />
heiratswilligen Gesellen eine Möglichkeit, außerhalb des<br />
Zunfthandwerks in ihrem erlernten Beruf zu arbeiten; es<br />
reichte aber nicht aus, um eine Familie davon zu unterhal-<br />
ten. Der amtlich bestätigte Nachweis konnte anscheinend<br />
leicht erworben werden, da das Militärkollegium 1833 auf<br />
die in ihren Augen leichtfertige Vergabe durch Ämter und<br />
Magistrate hinwies und betonte, daß das Attest ausdrücklich<br />
die Funktion habe, „ungünstige Eheverbindungen“ zu verhü-<br />
ten. Zu diesem Zweck solle jetzt diese Beschränkung genauer<br />
gefaßt werden. Das Ziel sei, daß die Ehefrauen von<br />
„Personen vom unteren Range, nemlich die Unterofficiere,<br />
Gefreiten und Gemeinen“ mit den Kindern weder dem Staat<br />
noch der Armenkasse zur Last fallen sollten. Dies geschehe<br />
sonst leicht, wenn das Korps ausmarschiere und die Familien<br />
sich selbst überlassen seien. In Zukunft müsse angegeben<br />
werden, ob und wieviel Vermögen die zukünftige Frau besitze<br />
oder zu erwarten habe. 28<br />
27 Vgl. Resolution Paul Friedrich Augusts v.26.3.1832,<br />
Schreiben des Militärkommandos v.12.4.1832 an die Regierung,<br />
in: Ebenda<br />
28 Am 30.4.1831 wurden beschränkende Vorschriften zur Verheiratung<br />
von, den unteren Rängen zugehörigen, Militärpersonen<br />
seitens des Militärkollegiums bekanntgemacht, die<br />
1833, wie beschrieben, teilweise verschärft wurden. Vgl.<br />
dazu das Zirkular des Militärkollegiums v.14.2.1833 an
448<br />
Von dem Aufbau eines Systems rechtlicher Ehebeschränkungen<br />
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kann in Oldenburg<br />
nur in einem sehr beschränkten Maß gesprochen werden. Im-<br />
merhin gab es Einzelverordnungen, die die staatlichen Be-<br />
hörden,- mit einigen Ausnahmen allerdings -, unter dem Ge-<br />
sichtspunkt betrachteten, damit ein Mittel in der Hand zu<br />
haben, angesichts der allgemeinen Bevölkerungszunahme das<br />
Heiraten von Angehörigen der Unterschicht erschweren zu<br />
können. Andererseits schien es aber eine langanhaltende<br />
Diskussion innerhalb der Behörden über die Zulässigkeit von<br />
beschränkenden Heiratsvorschriften gegeben zu haben, die im<br />
Ergebnis auf möglichste Zurückhaltung staatlicher Bestre-<br />
bungen in dieser Sache hinauslief. Das in der HWO von 1830<br />
ausgesprochene Heiratsverbot für Gesellen bildete keine re-<br />
gionale Besonderheit. Im Königreich Hannover existierte ein<br />
diesbezügliches Verbot in der Gewerbeordnung von 1847 29 ; in<br />
den Handwerksordnungen für die Gesellen der Bremer Schmiede<br />
und Klempner fanden sich 1817 Heiratsverbote. 30 Das Verhal-<br />
ten der Obrigkeit gegenüber verheirateten Gesellen hatte<br />
sich im 19. Jahrhundert im allgemeinen verändert. Im<br />
Reichsabschied von 1731 wurde die Diskriminierung von ver-<br />
heirateten Gesellen verboten. Die Gewerbegesetzgebung des<br />
Reichs versuchte seit dem 17. Jahrhundert, die in lokalen<br />
Zunftrechten verfügten Ehebeschränkungen aufzuheben. 31 Die<br />
Oldenburger Zunftartikel des 18. Jahrhunderts enthielten<br />
weder ein explizites Heiratsverbot noch eine Erlaubnis zur<br />
Verheiratung. Das Verbot wurde durch Handwerkssitte auf-<br />
rechterhalten, wobei stillschweigend akzeptiert wurde, daß<br />
aus praktischen Erfordernissen heraus, wie in anderen Städ-<br />
sämtliche Ämter des Großherzogtums und an die Stadtmagistrate<br />
in Oldenburg, Jever und Delmenhorst, in: Ebenda.<br />
29 Vgl. Jeschke, J., Gewerberecht ... , S.252<br />
30 Vgl. Ehmer, J., „Weiberknechte“ ... , S.43<br />
31 Vgl. Ebenda, S.41f. Ehmer weist darauf hin, daß Gesellen<br />
ausdrücklich in Gewerbe- und Zunftordnungen die Heirat gestattet<br />
wurde. Ledige Gesellen, die sich weigern sollten,<br />
neben verheirateten zu arbeiten, wurden Strafen angedroht.<br />
Schutzdekrete und Gewerbebefugnisse sollten Verheirateten<br />
eine Arbeit außerhalb der Zünfte sichern. Ehmer gibt hier<br />
Beispiele aus der österreichischen Gesetzgebung an.
449<br />
ten auch, viele Maurer- und Zimmergesellen verheiratet wa-<br />
ren. Der Status des Gesellen wurde nur 1791 infolge des<br />
Maurergesellenaufstandes Thema staatlicher Erörterungen.<br />
Die oldenburgische Kammer entdeckte jedoch schnell hinter<br />
der Ablehnung eines fremden verheirateten Maurergesellen<br />
durch die einheimischen, die sich auf die Tradition, die<br />
für ihr Handwerk doch längst durch die reale Entwicklung<br />
außer Kraft gesetzt worden war, beriefen, tieferliegende,<br />
die Arbeitsqualität des hiesigen Maurerhandwerks insgesamt<br />
betreffende Motive. Um die Zünfte nicht herauszufordern,<br />
gab man zunächst der Forderung nach. Der betroffene Geselle<br />
wurde nicht eingestellt. Spezielle Schutzverordnungen oder<br />
Gewerbebefugnisse für Verheiratete wurden in Oldenburg<br />
nicht erlassen.<br />
1858 bildeten weitere Vorschläge der Regierung zur Be-<br />
schränkung der Gesellenheiraten den Anlaß für eine aberma-<br />
lige Auseinandersetzung zwischen den staatlichen Behörden.<br />
Das Staatsministerium verwahrte sich gegen die Ansicht, daß<br />
mit dem Verzicht auf das Handwerk auch die Möglichkeit<br />
schwinde, als Gehilfe die erlernten handwerklichen Fertig-<br />
keiten in einer fremden Werkstatt auszuüben. Aus der Sicht<br />
der Regierung schied der Geselle mit dem Verzicht aus sei-<br />
ner ganzen Stellung zu dem von ihm bisher betriebenen Hand-<br />
werk, also aus seinem Stand, aus. Außerdem dürften nur Mei-<br />
ster, Gesellen und Lehrlinge laut HWO in einem Handwerkbe-<br />
trieb arbeiten; der Meister sei nicht befugt, durch belie-<br />
bige Arbeitskräfte die zur Ausübung seines Handwerks gehö-<br />
renden Tätigkeiten vornehmen zu lassen. Nur, indem diese<br />
Grundsätze aufrechterhalten werden würden, könne das Umge-<br />
hen des Heiratsverbots sowie der den Gesellen Beschränkun-<br />
gen und Kosten auferlegenden Vorschriften (Beiträge zur Ge-<br />
sellenkasse etc.) eingedämmt werden. Ein Meister sei jedoch<br />
befugt, Tagelöhner zu den nicht „gewerbsmäßigen Arbeiten“<br />
in seiner Werkstatt zu beschäftigen. Daneben forderte die<br />
Regierung eine Revision der HWO, da das Staatsministerium<br />
bisher so zahlreiche Dispensationen ausgesprochen habe, daß<br />
Bevölkerung und Behörden unsicher darüber geworden wären,
450<br />
was denn eigentlich in Gewerbesachen gelte. 32 Aus der Sicht<br />
Buchholtz´, der sich das übrige Staatsministerium später<br />
anschloß, würde der Vorschlag nur neue erhebliche Beschrän-<br />
kungen in das gewerbliche Leben hineintragen. Der ehemalige<br />
Geselle müsse aber wie der einfache Arbeiter, für dessen<br />
Tätigkeit es keinerlei beschränkende Vorschriften in der<br />
HWO gebe, behandelt werden. Es sei vom Grundsatz der freien<br />
Bewegung der Arbeit auszugehen und nicht davon, daß alles,<br />
was nicht rechtlich fixiert und ausdrücklich erlaubt sei,<br />
zwangsläufig verboten sei. So stimme es nicht, daß nur Mei-<br />
ster, Gesellen und Lehrlinge handwerklich tätig sein dürf-<br />
ten. Der Meister sei in der Wahl seiner Arbeitskräfte kei-<br />
nen beschränkenden Vorschriften unterworfen. Auch würden<br />
seit jeher Familienangehörige, Hausgesinde und Tagelöhner<br />
im Handwerksbetrieb mithelfen. Die Rechte der Innungen<br />
richteten sich nur gegen das selbständige Arbeiten Dritter.<br />
Der Regierungsvorschlag führe darüberhinaus Konflikte her-<br />
bei, da die Arbeitsbefugnisse des Hausgesindes und der Ta-<br />
gelöhner einerseits und die der Lehrlinge und Gesellen an-<br />
dererseits auseinandergehalten und Überschreitungen gewer-<br />
bepolizeilich bestraft werden müßten. Die Amtmänner hätten<br />
sich entschieden gegen den Vorschlag ausgesprochen, nur der<br />
Oldenburger Magistrat scheine in diesem Punkt anders zu<br />
denken. 33<br />
Damit spielte Buchholtz auf das Gesuch des in der Stadt Ol-<br />
denburg geborenen Spenglergesellen Hinrichs an das Staats-<br />
ministerium um die Bewilligung zur Heirat und um die Beibe-<br />
haltung des Rechts, als Geselle oder Gehilfe in seinem<br />
Handwerk im Herzogtum Oldenburg arbeiten zu dürfen, an. Der<br />
Magistrat hatte die Heirat des seit fünf Jahren in Laibach<br />
für die österreichische Bahnhofsbehörde als Spengler arbei-<br />
tenden 52jährigen Petenten nur unter der Bedingung, darauf<br />
zu verzichten, gestatten wollen. Für Hinrichs stellte sich<br />
32<br />
Vgl. Regierungsbericht v.14.1.1858, in: StAO Best.31-13-<br />
68-1<br />
33<br />
Vgl. Votum des Ministerialrats Karl Franz Nicolaus Buchholtz<br />
v.9.2.1858, in: Ebenda
451<br />
das Verhalten des Magistrats als äußerst widersprüchlich<br />
dar: um die Armenkassen zu entlasten, sei es doch ratsamer,<br />
ihn in seiner Eigenschaft als Spenglergeselle heiraten zu<br />
lassen und nicht als gewöhnlichen Tagelöhner oder Fabrikar-<br />
beiter, der kaum ein vergleichbares Einkommen erzielen wür-<br />
de. 34<br />
Eine Revision der HWO hielt das Staatsministerium für<br />
längst überfällig, da die bestehenden Gesetze mit der fort-<br />
geschrittenen gewerblichen Entwicklung in vielfältigem Wi-<br />
derstreit lägen. Die Verantwortung dafür sei der bei der<br />
Regierung entstandenen Praxis zuzuweisen, die auf Innungen<br />
bezogene Vorschriften der HWO ohne nähere Regelung und Un-<br />
terscheidung auch auf das platte Land und auf jedes nicht<br />
innungsmäßig betriebene Handwerk auszudehnen. Das Staatsmi-<br />
nisterium warf der Regierung eine zu juristisch angelegte<br />
Handhabung des Handwerkwesens vor, die sich darauf be-<br />
schränke, die konkreten Fälle unter die Buchstaben des Ge-<br />
setzes zu subsumieren.<br />
Das Gesuch des Hinrichs gibt neben der faktischen Zunahme<br />
der Gesellenheiraten einen weiteren Anhaltspunkt dafür, daß<br />
die gesellenspezifische Lebensform, die „Junggesellen-<br />
kultur“, im Oldenburg der 50er Jahre im Denken der Betrof-<br />
fenen schon ziemlich zurückgetreten war. Anders als bei den<br />
Behörden, die vor dem Hintergrund des noch nicht hinter-<br />
fragten ständischen Gesellenheiratsverbots den vermehrten<br />
Heiratswünschen nur mit Restriktionen begegneten. Der Um-<br />
fang und die Art der zu treffenden Beschränkungen mit dem<br />
Ziel, Gesellenheiraten möglichst zu verhindern, standen im<br />
Zentrum der Überlegungen. Die Maßnahmen der Regierung ziel-<br />
ten darauf ab, die Folgen der Umgehung des Verbots -<br />
drohende Beschäftigungslosigkeit, Belastung der Armenkas-<br />
sen- dadurch zu bekämpfen, daß noch mehr beschränkende Vor-<br />
schriften das Leben des verheirateten Gesellen möglichst<br />
unattraktiv erscheinen lassen sollten. Man hoffte dadurch,<br />
eine Verhaltensänderung bei den Gesellen erzwingen zu kön-<br />
34 Vgl. Gesuch des Spenglergesellen Heinrich Christian Hinrichs<br />
v.30.1.1858, in: Ebenda
452<br />
nen. Falls diese Restriktionen jedoch nur wenige Gesellen<br />
von einer Verheiratung abschreckten, würden gerade sie das<br />
Problem der überlasteten Armenkassen noch verschärfen. Die<br />
Alternative, es Gesellen frei zu stellen sich zu verheira-<br />
ten, ohne ihnen ihr Handwerk und ihren Status abzuerkennen<br />
und ihnen damit zu besseren beruflichen Fortkommensmöglich-<br />
keiten zu verhelfen, wurde nicht bedacht. 35 Daß Hin-<br />
richs´Beschwerde schließlich für rechtens befunden, der Ma-<br />
gistrat seine Entscheidung zurücknehmen mußte 36 , lag an den<br />
gewerbefreiheitlichen Prämissen des Staatsministeriums,<br />
nicht an der Infragestellung des Heiratsverbots. Das neue<br />
Oldenburger Gewerbegesetz sollte Gewerbefreiheit zur Basis<br />
haben, die rechtlich beschränkenden Überlegungen der Regie-<br />
rung waren da nur hinderlich.<br />
Insgesamt bewirkten die skizzierten Zusammenhänge eine<br />
Schwächung des Gesellenheiratsverbots und wohl auch der so-<br />
zialen Tradition der Gesellenehelosigkeit in Oldenburg. Das<br />
Verbot war durch das Verhalten der Gesellen, aber auch<br />
durch die generellen Bedenken der Staatsbehörden, ein Sy-<br />
stem rechtlicher Ehebeschränkungen aufzubauen, schon ziem-<br />
lich ausgehöhlt worden. So konnten auch die seit den 30er<br />
Jahren von der Regierung vorgeschlagenen Maßnahmen zu des-<br />
sen Stärkung keine größere Wirksamkeit entfalten. Außerdem<br />
waren sie, wie gezeigt, in ihrer Intention problematisch.<br />
35 In Braunschweig schienen verheiratete Gesellen zwar ihren<br />
Gesellenstatus, also v.a. die Chance, sich als Meister<br />
selbständig zu machen, zu verlieren, sie durften aber weiterhin<br />
in Handwerksbetrieben ihre erlernten Fähigkeiten<br />
ausüben. Davon zu unterscheiden ist die sich für Gesellen<br />
bietende Möglichkeit des fortgesetzten Arbeitsplatzwechels<br />
zwischen Fabrik und traditionellem handwerklichen Kleinbetrieb,<br />
der im allgemeinen nicht die Aberkennung der Gesellenrechte<br />
nach sich zog. Die Unterscheidung zwischen Fabrikarbeiter<br />
und Handwerksgesellen wurde dadurch schwierig.<br />
(vgl. Schildt, G., Tagelöhner, Gesellen, Arbeiter. Sozialgeschichte<br />
der vorindustriellen und industriellen Arbeiter<br />
in Braunschweig 1830-1880 (Industrielle Welt<br />
hg.v.W.Conze;Bd.40), Stuttgart 1986, S.196)<br />
36 Vgl. Regierungsbericht v.25.2.1858 u. Verfügung des<br />
Staatsministeriums v.13.3.1858, in: StAO Best. 31-13-68-1
453<br />
6.1.2 Arbeit und Verpflegung, religiöse Zugehörigkeit<br />
Die traditionellen Geselleninstitutionen erfuhren eine wei-<br />
tere Schwächung. Schon 1819 und 1839 hatten Schlosser- und<br />
Schneidergesellen die Selbstverwaltung ihrer Kasse, letzte-<br />
re das Amt des Altgesellen eingebüßt. 37 1852 verloren jetzt<br />
auch die Altgesellen der Tischler ihre Funktion. Beide wur-<br />
den wegen des zwei Tage andauernden Aufstandes (9. u.<br />
10.8.1852) vom Magistrat vernommen. Sie hatten die<br />
Tischlergesellen an einem Sonnabend um 8.00 Uhr abends auf<br />
die Herberge bestellt, um diesen eine ihnen persönlich zu-<br />
erkannte Strafe seitens des Magistrats sowie die Niederle-<br />
gung ihrer Ämter bekannt zu machen. Die Versammlung hatte<br />
sich dann dazu bereiterklärt, Brüche und Kosten zu überneh-<br />
men. Einer der gewählten Nachfolger brachte im folgenden<br />
die abgeschaffte Begehrwahl der arbeitssuchenden Gesellen<br />
zur Sprache. Man hatte die Meister um ihre Wiederherstel-<br />
lung gebeten, war aber abgewiesen worden. Die Unzufrieden-<br />
heit unter den Gesellen wurde so groß, daß sie verabrede-<br />
ten, sich am Montag morgen ein weiteres Mal auf der Herber-<br />
ge zu versammeln. Zwei Polizeidiener erschienen und trugen<br />
ihnen im Auftrag des Magistrats an, sofort wieder zu ihren<br />
Meistern in die Arbeit zu gehen. Die Tischlergesellen ver-<br />
ließen sodann zwar die Herberge, begaben sich jedoch zum<br />
Wirt Harms im Stadtgebiet und blieben dort bis gegen<br />
6.00/7.00 Uhr. Es wurde verabredet, auch am nächsten Morgen<br />
die Arbeit noch nicht wieder aufzunehmen, sondern sich bei<br />
der Witwe Rosenbohm zur Wunderburg zu versammeln. Etwa 30<br />
Tischlergesellen trafen dort ein. Zwei Gesellen, darunter<br />
einer der ehemaligen Altgesellen, übernahmen es, mit den<br />
Meistern zu einer gütlichen Beilegung des Konflikts zu ge-<br />
langen. Zu diesem Zweck begaben sie sich zum Innungsvorste-<br />
her Welau, der versprach, noch am gleichen Nachmittag die<br />
Meister zusammenzurufen, und ihnen bedeutete, die Gesellen<br />
zu veranlassen, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Beide er-<br />
37 Vgl. dazu die Beschreibung des Schlosser- und des Schneidergesellenaufstandes<br />
in Kap.4.4.2
454<br />
klärten der Versammlung bei Witwe Rosenbohm, daß jeder, der<br />
nicht gleich aus der Arbeit treten und abreisen könne, zu<br />
seinem Meister zurückkehren und die 14-tägige Kündigungs-<br />
frist abwarten müsse, wenn er mit dem Beschluß der Meister<br />
nicht zufrieden sein sollte. Der Magistrat beschloß nach<br />
dem bisher Gesagten, das Altgesellenamt bei den Tischlern<br />
aufzuheben und die ehemaligen Altgesellen zu einer zweitä-<br />
gigen Gefängnisstrafe und zur Begleichung der gerichtlichen<br />
Kosten zu verurteilen. Von den 21 vorgeforderten Tischler-<br />
gesellen erschienen 17, -die übrigen waren abgereist,- und<br />
wurden verwarnt. 38<br />
Die Tischlergesellen beklagten sich wiederum ein Jahr spä-<br />
ter darüber, daß ihnen das übliche gemeinsame Abendessen<br />
mit dem Meister am ersten Weihnachtstag sowie an den übri-<br />
gen ersten Feiertagen entzogen worden sei. Sie empfanden<br />
dies als Kränkung, Herabsetzung und als Versuch der Mei-<br />
ster, sich von ihnen immer weiter zu entfremden. Arbeit er-<br />
hielt für sie Sinn im persönlichen Verhältnis zum Meister:<br />
„[...] als vielmehr aus Betrübniß darüber, daß unsere Mei-<br />
ster, für die wir doch streben sollen und streben wie für<br />
uns selbst, sich uns immer mehr zu entfremden suchen“. 39 So<br />
hatten sie das Bedürfnis, am Familienleben ihrer Meister<br />
weiterhin teilnehmen zu können und wollten gleichsam als<br />
Familienmitglied betrachtet werden. Denn sonst sei der<br />
fremde Geselle, der das gewohnte Familienleben entbehren<br />
müsse, in seinen Freistunden auf den Aufenthalt in Wirts-<br />
häusern beschränkt. Vor dem Hintergrund der schon skizzier-<br />
ten sozialgeschichtlichen Entwicklungen können die Aufhe-<br />
bung des Altgesellenamts wie auch die von den Gesellen emp-<br />
fundene persönliche Kluft zwischen ihnen und ihren Meistern<br />
als symptomatisch für den einseitigen Abbau des Zunftsy-<br />
stems und die allmähliche Aufspaltung der Meister und Ge-<br />
sellen in Selbständige und Lohnarbeiter angesehen werden.<br />
38 Vgl. Magistratsprotokoll v.10.8.1852, Forderungen der Gesellen<br />
an ihre Meister v.9.8.1852, Magistratsprotokoll<br />
v.27.8.1852, in: StAO Best. 262-1 A, Nr.2118<br />
39 Art. „Neuerung“, in: Der Beobachter v.30.12.1853, S.415
455<br />
Im Gegensatz zu Preußen, das erst durch eine Kabinettsorder<br />
vom 14.10.1838 die Stellung dort einwandernder jüdischer<br />
Handwerksgesellen verbesserte, indem ihnen gestattet wurde,<br />
in Zukunft bei einheimischen Meistern als Gesellen zu ar-<br />
beiten, gab es in Oldenburg keinerlei gesetzliche Vor-<br />
schriften, die die Gleichbehandlung von christlichen und<br />
jüdischen Gesellen beeinträchtigte. 1839 teilte der preußi-<br />
sche Gesandte von Canitz Geheimrat von Berg diese Neuerung<br />
mit und forderte das Land Oldenburg auf, ein gleiches preu-<br />
ßischen jüdischen Gesellen auf der Wanderschaft zu gewäh-<br />
ren. Er schilderte dann im folgenden die Beschränkungen,<br />
denen jüdische Gesellen bei der Arbeitssuche in Preußen<br />
nach wie vor unterworfen waren. Die örtliche Behörde bewil-<br />
ligte ihnen für den Fall, daß die allgemeinen Bedingungen<br />
für das Einwandern erfüllt waren und der Nachweis darüber,<br />
daß preußischen Gesellen jüdischer Religionsangehörigkeit<br />
die gleichen Rechte in ihren Herkunftsländern gewährt wur-<br />
den, vorgezeigt werden konnte, eine vorläufige sechswöchige<br />
Arbeitserlaubnis. Dann mußte die vorgesetzte Behörde be-<br />
nachrichtigt und die eigentliche Konzession zum Arbeiten<br />
innerhalb der preußischen Staaten beantragt werden. Sie be-<br />
lief sich im allgemeinen auf zwei Jahre und wurde auf<br />
Wunsch für ein Jahr verlängert. Der Geselle konnte jedoch<br />
vor Ablauf der zwei bis drei Jahre wegen gesetzwidrigen Be-<br />
tragens ausgewiesen werden. 40 Das Oldenburger Staats= u. Ca-<br />
binetsministerium forderte nun in Reaktion auf das Schrei-<br />
ben Canitz´die Regierung zur Berichterstattung auf. Diese<br />
beauftragte den Oldenburger Magistrat, die örtlichen Hand-<br />
werksmeister über die Lage jüdischer Handwerksgesellen in<br />
der Stadt zu vernehmen. 41 Der Magistrat wies in seiner ab-<br />
schließenden Stellungnahme darauf hin, daß weder die hiesi-<br />
gen Behörden noch die Meister christliche und jüdische Ge-<br />
sellen unterschiedlich behandeln würden. Da auch keine Kla-<br />
40 Vgl. Schreiben des kgl. preußischen außerordentlichen Gesandten<br />
u. bevollmächtigten Ministers von Canitz in Hannover<br />
v.6.2.1839, in: StAO Best. 31-13-68-1<br />
41 Vgl. Regierungsreskript an den Oldenburger Magistrat<br />
v.26.2.1839, in: StAO Best. 70, Nr.6685/F.12
456<br />
gen über Gesellen jüdischer Religion bisher vorgekommen<br />
seien, sei es nicht notwendig, diese einer besonderen poli-<br />
zeilichen Kontrolle zu unterwerfen. 42 Die größte Anzahl jü-<br />
discher Gesellen schien bei Kupfer- und Goldschmieden, Fär-<br />
bern und Malern vorhanden zu sein; insgesamt aber wander-<br />
ten, so der Eindruck mehrerer Innungsmeister, Gesellen jü-<br />
discher Herkunft nur selten nach Oldenburg. 43 Die Regierung<br />
schlug nun vor, die Gleichbehandlung jüdischer Handwerksge-<br />
sellen auch in den übrigen Teilen des Landes vorzuschrei-<br />
ben, falls dort nicht danach gehandelt werden würde, und<br />
den von Canitz geforderten Nachweis in die Wanderbücher der<br />
hiesigen Gesellen eintragen zu lassen. 44 Der Vorschlag wurde<br />
höheren Orts genehmigt sowie ein diesbezügliches Schreiben<br />
nach Hannover geleitet. 45<br />
6.1.3 Staatliche Kontrolle der Wanderschaft, Verbot der<br />
Gesellenverbindungen und Selbstorganisierung der<br />
Gesellen außerhalb der Zunft<br />
Mannigfaltige Übertretungen der vom Staat erlassenen Wan-<br />
dervorschriften (Bettelei, Vagabundieren, Abweichen von der<br />
Reiseroute, Mangel an Reisegeld, unerlaubtes Entfernen von<br />
der Arbeit, eigenmächtige Änderungen von Eintragungen im<br />
Wanderbuch) sowie Verbesserungen der Kontrolle kennzeichnen<br />
auch das zweite Drittel des 19. Jahrhunderts. 46 Wie schon<br />
42<br />
Vgl. Magistratsbericht v.19.4.1839, in: Ebenda<br />
43<br />
Vgl. städtisches Vernehmungsprotokoll der Vorsteher der<br />
Schuster- u. Schneiderinnung v.15.3.1839, der Vorsteher der<br />
Innungen der Kupfer-, Goldschmiede, Färber und Maler<br />
v.11.4.1839, in: Ebenda<br />
44<br />
Vgl. Regierungsbericht v.3.5.1839, in: StAO Best. 31-13-<br />
68-1<br />
45<br />
Vgl. Resolution für die Regierung v.26.6.1839, Schreiben<br />
des Geheimrats von Berg an den preußischen Gesandten von<br />
Canitz v.26.6.1839, in: Ebenda<br />
46<br />
Vgl. StAo Best. 70, Nr.3698/F.1: Bei Erteilung von Pässen<br />
und Ausgabe von Nachtzetteln zu beobachtende Verfahren<br />
1814-61; StAO Best. 262-1 A, Nr.2082c: Aufsicht über die
457<br />
1802, 1821/22 und 1829 wurde die Zunahme einreisender, im<br />
Herzogtum arbeitslos umherziehender Gesellen festgestellt.<br />
1831 erließ die Regierung eine Verordnung, die das Einwan-<br />
dern fremder Gesellen mit der Absicht beschränkte, das Bet-<br />
teln und die damit verbundene Belästigung der Einwohner zu<br />
unterbinden. 47 Auch jetzt war das staatliche Eingreifen<br />
durch rein sozialdefensive Erwägungen motiviert -in den<br />
vergangenen Jahren sollten die Armenkassen vor Überanspru-<br />
chung geschützt werden-, die Furcht vor Aktivitäten etwai-<br />
ger geheimer Gesellenverbindungen im Land oder Einflüssen<br />
aus den Auslandsvereinen auf dieselben spielte keine Rol-<br />
le. 48 Zu erinnern ist daran, daß in der HWO von 1830 die<br />
Position der Gesellen umfassend geschwächt wurde (Verbot<br />
von Gesellenverbindungen: sie durften keine Lade haben,<br />
kein Siegel führen, weder Aufsicht führen noch Strafgewalt<br />
ausüben über Mitgesellen, keine besondere Berechtigung bei<br />
der Aufnahme von Lehrlingen mehr beanspruchen; Verlust der<br />
Selbstverwaltung der Kranken- und Unterstützungsgelder,<br />
Verlust der Arbeitsvermittlung). Angesichts dieser, in po-<br />
litischer Hinsicht, entspannten Lage wollte sich Oldenburg<br />
auch nicht mit anderen norddeutschen Städten zwecks schär-<br />
feren Vorgehens gegen die Gesellenverbindungen zusammen-<br />
schließen. Mecklenburg-Schwerin hatte 1840 einen Maßnahmen-<br />
katalog zur Bekämpfung der Mißbräuche unter den Gesellen an<br />
das Großherzogtum geschickt und um eine Stellungnahme gebe-<br />
Gesellen, das Wandern und Heiraten derselben 1822-1852;<br />
StAO Best. 70, Nr.6685/F.17 Anträge einiger Gesellen auf<br />
Streichung von in ihren Wanderbüchern eingetragenen Visa u.<br />
sonst. Bemerkungen, 1853-1856; StAO Best. 70, Nr.3699/F.8:<br />
Visieren der Reisepässe und Wanderbücher 1852-1865; StAO<br />
Best. 70, Nr.3700/Konv. II: Erteilung einzelner Pässe, Wanderbücher<br />
etc. 1817-1863; StAO Best. 70, Nr.6671/Konv.V:<br />
Erteilung von Wanderbüchern, Lehrbriefen und Meisterbriefen.<br />
47<br />
Vgl. Regierungsbekanntmachung v.18.2.1831, in: OGS Bd.6<br />
S.524-527<br />
48<br />
Die Kontrollen schienen zu bewirken, daß weniger fremde<br />
Gesellen einwanderten, Oldenburg unter den Gesellen als gesellenfeindlich<br />
galt und Meister verschiedener hiesiger<br />
städtischer Handwerke sich über den Mangel an fremden Gesellen<br />
beklagten (vgl. Reinders-Düselder, C., Oldenburg im<br />
19. Jahrhundert ... , S.121f.).
458<br />
ten. Der von der Regierung zu einem Gutachten aufgeforderte<br />
Magistrat sowie die Handwerksmeister verneinten einstimmig<br />
die Existenz von Verstößen gegen die Handwerksordnung. Es<br />
würden auch keine nachteiligen Einwirkungen im Ausland be-<br />
stehender Verbindungen sich bemerkbar machen. Infolgedessen<br />
riet die Regierung, sich auf die Bekanntmachung des Bundes-<br />
beschlusses von 1840 im Land zu beschränken. 49 Diese Ein-<br />
schätzung entsprach dem im Vergleich mit anderen deutschen<br />
Staaten an sich ruhigem Verlauf der Gesellenaufstände Ende<br />
des 18. Jahrhunderts, zu dem ganz wesentlich das voraus-<br />
schauende konflikteindämmende Verhandlungsgeschick der Ol-<br />
denburger Behörden beigetragen hatte. 1853 bei den Beratun-<br />
gen zu dem Verbotsbeschluß für Arbeiter- und ähnliche Ver-<br />
eine im Deutschen Bundestag fällte der Gesandte Oldenburgs<br />
ein entsprechendes Urteil:<br />
49 Vgl. StAO Best. 70, Nr.6685/F.14; das einzelstaatliche<br />
Vorgehen der vergangenen Jahre gegen die Gesellenverbindungen<br />
hatte nicht die erwünschten Erfolge gezeigt.<br />
„Mißbräuche“, d.h. im Grunde alle Forderungen, Konflikte<br />
(Forderungen nach wirtschaftlicher Besserstellung, Einhaltung<br />
des Handwerksbrauchtums, Bewahrung der Funktionen und<br />
Aufgaben der Gesellenbruderschaften), die sich auf den berufsständischen<br />
Zusammenhalt der Gesellen stützen konnten<br />
und dadurch Unruhen mit dem Ziel, sich eigenmächtig Recht<br />
zu verschaffen, auslösten, wurden seit jeher umfassend bekämpft.<br />
Die Auflösung der Gesellenverbindungen wurde beispielsweise<br />
in Sachsen 1810, in Hannover 1817 angeordnet.<br />
„Mißbräuche“ im Sinn von Verstößen gegen die neuen Verordnungen<br />
mußten weiterhin geahndet werden. So einigten sich<br />
die Länder auf ein gemeinsames Vorgehen, das im Bundesbeschluß<br />
v.15.1.1835 seinen ersten Niederschlag fand (vgl.<br />
Wissell, R., Des Alten Handwerks Recht und Gewohnheit ...,<br />
Bd.3, S.198ff). Hauptsächlich sollte hier das Wandern deutscher<br />
Handwerksgesellen in Länder und Orte verboten werden,<br />
in denen „Associationen und Versammlungen“ derselben geduldet<br />
werden würden. Gesellen, die sich dort aufhielten,<br />
konnten zurückberufen werden. Im Dt. Bund wurden wandernde<br />
Gesellen einer besonderen polizeilichen Aufsicht unterstellt.<br />
Am 12.3.1835 wurde das Wanderverbot auf die Schweiz<br />
ausgedehnt. Bedenken gegenüber Einwirkungen sozialistischer<br />
oder kommunistischer Vorstellungen der Auslandsvereine auf<br />
dt. Gesellenverbindungen sowie die von Gesellen weiterhin<br />
gehandhabten Verrufspraktiken führten den Bundesbeschluß<br />
v.3.12.1840 herbei. Er war gegen die „Theilnahme an unerlaubten<br />
Gesellenverbindungen, Gesellengerichten, Verrufserklärungen<br />
u. dergl. Mißbräuchen“ gerichtet (Ebenda, S.219).
459<br />
die „Bundesbeschlüsse gegen Vereine und Versammlungen<br />
seien für das Großherzogtum sowohl wegen seiner Lage<br />
und wegen des Charakters seiner Bewohner, als wegen<br />
sonstiger Verhältnisse,von keinem Bedürfnis gefordert“.<br />
50 Polizeiliches Einschreiten sei weder vor noch<br />
nach 1848 gegen Vereine jemals erforderlich gewesen. 51<br />
Die oben erwähnte Verordnung von 1831 knüpfte die Erlaubnis<br />
für fremde Gesellen, die Grenzen des Herzogtums zu passie-<br />
ren, um dort zu arbeiten oder auf ihrer Wanderschaft durch-<br />
zureisen, an verschiedene Bedingungen. Der Geselle durfte<br />
kein sichtbares körperliches Gebrechen aufweisen, welches<br />
ihn zur Ausübung seines Handwerks untauglich machte. Außer-<br />
dem mußte er wenigstens 1 ½ Rt Reisegeld vorweisen. Anhand<br />
seines Wanderbuches oder Passes hatte er nachzuweisen, daß<br />
er nicht schon acht Wochen vor der Einreise in das Herzog-<br />
tum ohne triftigen Grund (Krankheit, Übersetzung des Hand-<br />
werks) arbeitslos gewesen war. Zugleich wurde ein ärztli-<br />
ches Attest darüber angefordert, daß er die Pocken oder ei-<br />
ne entsprechende Impfung erfolgreich überstanden hatte. Von<br />
der Vorweisung des Reisegeldes und des Arbeitsnachweises<br />
waren Gesellen ausgenommen, die von inländischen Meistern<br />
ausdrücklich angefordert worden waren; Maurer- und Zimmer-<br />
gesellen waren vom Arbeitsnachweis nur aufgrund der für sie<br />
typischen saisonalen Arbeitslosigkeit in den Wintermonaten<br />
befreit. Für Gesellen, die sich auf der Heimreise befanden<br />
und ihren Weg durch das Herzogtum nehmen mußten, galt die<br />
Verordnung nicht.<br />
Erst mit der Einführung der Gewerbefreiheit konnten Hand-<br />
werksgesellen an der Grenze nicht mehr wegen mangelnden<br />
Reisegeldes zurückgewiesen werden; in dieser Zeit wurden<br />
auch der Paßzwang und die Vorschriften über die Visierung<br />
von Reisepässen und Wanderbüchern aufgehoben. 52<br />
50 zit.n. Birker, K., Die deutschen Arbeiterbildungsvereine<br />
1840-1870 (Einzelveröff.d.hist.Kommission zu Berlin: Publikationen<br />
zur Geschichte der Arbeiterbewegung; Bd.10), Berlin<br />
1973, S.105<br />
51 Vgl. Ebenda<br />
52 Vgl. StAO Best. 70, Nr.6737 u. StAO Best. 70,<br />
Nr.3699/F.10: Aufhebung des Paßzwanges und der Vorschriften<br />
über Visierung von Reisepässen und Wanderbüchern, 1861-1869
460<br />
Trotz der schon skizzierten Auflösungserscheinungen im tra-<br />
ditionellen Meister-Gesellen-Verhältnis erfolgte der Durch-<br />
bruch zur Arbeiterbildungsbewegung in Oldenburg erst in den<br />
60er Jahren. Gesellen schlossen sich berufsübergreifend au-<br />
ßerhalb des Zunftwesens zusammen, um den persönlichen so-<br />
zialen Aufstieg mittels besonderer beruflicher Qualifikati-<br />
on und Bildung zu erreichen sowie ihrem Bedürfnis nach gei-<br />
stiger Orientierung, höherer Achtung seitens des Bürgertums<br />
und gehobener Geselligkeit nachzukommen. 53 Vorher gab es in<br />
der Stadt nur spärliche Ansätze zur Selbstorganisation, wie<br />
eine Invaliden-, Witwen- und Waisenkasse der Buchdrucker<br />
(1837), einen Gesellengesangverein (1843). 54 1846 stellte<br />
der Gewerbeverein den Gesellen ein Lokal zur Verfügung, das<br />
abends von 7 bis 10 Uhr und sonntagnachmittags Gelegenheit<br />
bot zum Lesen, Spielen und Schreiben. 1853 gründeten Gesel-<br />
len einen „Gesellen-Club“, der Tanzabende veranstaltete. 55<br />
1854 entstand in der Stadt ein Arbeiterbildungsverein, der<br />
von Kaufleuten und Fabrikanten finanziell gefördert wurde.<br />
Sie wollten durch den Verein die Gesellen aus der Welt der<br />
Innungen lösen. Die Handwerksmeister andererseits sahen in<br />
ihm nur einen Versuch der Gesellen, sich ihrem Einfluß zu<br />
entziehen und darüberhinaus einen Angriff auf ein durch In-<br />
nungen geregeltes Wirtschaftssystem. 56 In einem Zeitungsar-<br />
53 Vgl. Parisius, B., Vom Groll der „kleinen Leute“ zum Programm<br />
der kleinen Schritte. Arbeiterbewegung im Herzogtum<br />
Oldenburg 1840-1890 (Ol Studien; Bd.27), Oldenburg 1985,<br />
S.91f.<br />
54 Vgl. Schaer, F.-W., Eckhardt, A., Herzogtum und Großherzogtum<br />
Oldenburg im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus<br />
(1773-1847), in: Eckhardt, A.,Schmidt,H., (Hg.), Geschichte<br />
des Landes Oldenburg: ein Handbuch, 4.verbess. u. erweit.<br />
Aufl. 1993, S.324. Parisius gibt 1847 als Gründungsjahr für<br />
den Gesangverein an, jedoch wird der Verein schon 1844 in<br />
den Oldenburgischen Blättern erwähnt (vgl. Art. „Ueber Gesellen=Vereine“,<br />
in: Oldenburgische Blätter v.19.3.1844);<br />
1845 feierte der Verein sein zweijähriges Bestehen (vgl.<br />
„kleine Chronik“, in: Neue Blätter für Stadt und Land<br />
v.12.11.1845); in einer Übersicht der Ende des Jahres 1845<br />
in Oldenburg bestehenden Vereine und Klubs wird ein Gesellengesangverein<br />
genannt (vgl. Der Beobachter v.3.2.1846).<br />
55 Vgl. Parisius, B., Vom Groll ... , S.24 u. 68<br />
56 Vgl. Ebenda, S.81
461<br />
tikel wurde dargelegt, daß die Wünsche der Gesellen, ihre<br />
Kenntnisse in den Elementarfächern zu verbessern, eine Ver-<br />
einsbibliothek einzurichten sowie Möglichkeiten des gesel-<br />
ligen Zusammenseins zu schaffen, auch außerhalb des geplan-<br />
ten Vereins realisiert werden könnten. Der Artikel wies auf<br />
die Gefahr der Politisierung von Arbeiterbildungsvereinen<br />
und auf die sich daraus ergebenen Folgen für die sie beher-<br />
bergenden Städte hin. Da Gesellen, die dort gearbeitet hat-<br />
ten, mit einer verschärften polizeilichen Aufsicht rechnen<br />
mußten, mieden viele von ihnen solche Städte. Dies führe<br />
dann zu einem empfindlichen Mangel an Arbeitskräften. Im<br />
Herzogtum habe man dagegen politische Verbindungen nie ge-<br />
fürchtet und Gesellen ungeachtet ihrer Herkunft arbeiten<br />
lassen. Die Gründung eines Arbeiterbildungsvereins könnte<br />
allerdings die Aufmerksamkeit anderer Staaten wecken und<br />
das Herzogtum zu strenger Beaufsichtigung der hier gearbei-<br />
tet habenden Gesellen nötigen. Zusätzlich hob der Artikel<br />
noch das aus der Erfahrung bekannte Unruhepotential von Ge-<br />
sellenverbindungen hervor. Die Meister schienen die mit ei-<br />
nem Verein verbundene größere Effektivität bei der Durch-<br />
setzung ökonomischer Forderungen zu fürchten.<br />
„Jedoch auch sonst noch ist die Errichtung von Verbindungen<br />
unter Gewerbsgehülfen von je her immer nur<br />
zum Schlimmeren ausgeschlagen. Wie manche Erhebung in<br />
corpore um Lohnerhöhung, Arbeitsverminderung ... zu<br />
erzwingen, ist durch solche, im Anfange harmlose Verbindungen<br />
hervorgegangen, und von unendlichem Nachteil<br />
für Meister und Gesellen geworden“. 57<br />
Zunächst stagnierte der Verein. Parisius führt dies beson-<br />
ders auf die noch vorherrschende Regelung der Niederlassung<br />
durch Zunft und staatliche Behörde zurück. Gesellen durften<br />
weder auf eigene Rechnung arbeiten, noch sich verheiraten.<br />
Hinzu kam eine noch stark in den Traditionen der Handwerks-<br />
welt befangene Einstellung der Gesellen. Beides bewirkte,<br />
57 Art. „Arbeiter=Bildungs=Verein“, in: Der Beobachter<br />
v.13.1.1854, S.14; vgl. dazu eine Replik, die die Vorteile<br />
eines Arbeiterbildungsvereins herausstellt (Art. „Arbeiter-<br />
Bildungs=Verein“, in: Der Beobachter v.17.1.1854).
462<br />
daß die Hoffnung, durch besondere Tüchtigkeit sozial aufzu-<br />
steigen, eher gering war; damit entfiel ein wichtiger Im-<br />
puls, dem Verein beizutreten.<br />
„[...] einerseits protestierten sie zusammen mit den<br />
Meistern gegen die Zulassung von Fabriken und gegen<br />
die Zulassung nicht traditionsgemäß ausgebildeter Gesellen<br />
als Meister durch die Regierung, andererseits<br />
erkannten sie, daß sie selbst wegen der Überbesetzung<br />
der Gewerke kaum die Chance hatten, ein eigenes Geschäft<br />
zu betreiben. [...] Aber auch die Vorstellung,<br />
durch Organisierung für Gewerbefreiheit zu kämpfen,<br />
lag den meisten Gesellen noch fern, da ja Gewerbefreiheit<br />
immerhin eine gewisse Aufgabe der duch die<br />
Lehre erworbenen Rechte bedeutete, die zwar zur Zeit<br />
nicht voll realisierbar waren, aber prinzipiell den<br />
Gesellen doch noch vom Fabrikarbeiter unterschieden“.<br />
58<br />
Vor dem Hintergrund einer allgemeinen Verbesserung des Le-<br />
benshaltungsniveaus 1862-1864, einer entsprechend<br />
„optimistischer“ ausgerichteten Lebenshaltung der Gesellen,<br />
der Zunahme von Fabrikarbeitsplätzen, der Einführung der<br />
Gewerbefreiheit 1861 nahm der Verein unter dem Vorsitz Carl<br />
Thorades dann einen beachtlichen Aufschwung. Der Wegfall<br />
der von den Gesellen als Ursache ihrer schlechten Lage emp-<br />
fundenen starken Reglementierung durch das Zunftwesen sowie<br />
die vorherrschende kleinbetriebliche Struktur der Oldenbur-<br />
ger Wirtschaft ließen die Möglichkeit sozialen Aufstiegs<br />
günstiger erscheinen. Eine Rolle spielten auch die zuneh-<br />
mende Ausgliederung aus dem Familienleben der Meister und<br />
der mit der Gewerbefreiheit einhergehende - sich befreiend<br />
auswirkende -Verlust der Standesqualitäten der Gesellen.<br />
Parisius folgend, ist der Niedergang des Vereins mit der<br />
sich anschließenden Phase der Verschlechterung des Lebens-<br />
haltungsniveaus von 1865-1866 sowie der Verarbeitungsmög-<br />
lichkeiten der alltäglichen Lebenssituation in Verbindung<br />
zu bringen. 59<br />
58 Parisius, B., Vom Groll ... , S.82<br />
59 Parisius betont, daß bisher in der Forschung die Verbindung<br />
von wirtschaftlicher Entwicklung, den Verarbeitungsmöglichkeiten<br />
der alltäglichen Lebenssituation durch die<br />
Gesellen und Arbeiter und der Entwicklung der Arbeiterbil-
463<br />
In der Literatur wird festgestellt, daß Arbeiter aus Klein-<br />
betrieben in gewerblich relativ wenig entwickelten Gebieten<br />
das Rückrat der liberalen Arbeiterbewegung bildeten. Hand-<br />
werklich bestimmte Städte, wie Hannover und Oldenburg, wur-<br />
den zu Hochburgen derselben. Parisius stellt nun besonders<br />
das gemeinsame Interesse von Gesellen und freihändlerisch-<br />
liberalem Bürgertum an der von ihnen günstig eingeschätzten<br />
Möglichkeit der Integration der Gesellen in die bürgerliche<br />
Gesellschaft als wichtigen Impuls für die Stärke der Bewe-<br />
gung in Oldenburg heraus; ein noch zum großen Teil in In-<br />
nungen organisiertes, kleinbetrieblich strukturiertes Hand-<br />
werk, fehlende Industrie gab den Bezugsrahmen dieser Ein-<br />
schätzung ab. 60<br />
Festzuhalten ist, daß die Oldenburger Behörden keinen Anlaß<br />
sahen, schärfer gegen Gesellenverbindungen und deren Akti-<br />
vitäten im eigenen Land vorzugehen; die staatliche Kontrol-<br />
le der Wanderschaft war sozialdefensiv ausgerichtet, indem<br />
sie versuchte, der zunehmenden Anzahl einwandernder, ar-<br />
beitslos umherstreifender Gesellen Herr zu werden. Die Auf-<br />
lösung des berufsständischen Zusammenhalts der einheimi-<br />
schen Gesellen, die Herauslösung aus zünftigem Denken voll-<br />
zog sich sehr langsam.<br />
Erst in den 60er Jahren organisierten sich Gesellen der<br />
Stadt Oldenburg in größerem Ausmaß in Arbeiterbildungsver-<br />
einen. Die Lebenserinnerungen des Klempnergesellen Christi-<br />
an Mengers aus Atens in Butjadingen stützen die festge-<br />
stellte Langlebigkeit der Oldenburger Handwerkstradition.<br />
Allerdings ist die verklärende Sicht, aus der er 1910 rück-<br />
blickend die Jahre seiner Wanderschaft, 1860-67, als Klemp-<br />
nergeselle beschreibt, zu berücksichtigen. Sein Weg führte<br />
ihn von Elsfleth/Bremen über Hannover, Hildesheim, Braun-<br />
dungsbewegung als Erklärung für Auf- bzw. Niedergang derselben<br />
nicht genügend herangezogen worden sei. Gerade für<br />
Oldenburg, wo der Rückgang der Arbeiterbildungsbewegung<br />
nicht zeitgleich mit einem Übergang zur sozialdemokratischen<br />
Bewegung verlief, sei dieser Zusammenhang von einiger<br />
Plausibilität (vgl. Ebenda, S.93).<br />
60 Vgl. Ebenda, S.295f.
464<br />
schweig, Magdeburg nach Halle; er hielt sich dann vorwie-<br />
gend in Sachsen (Leipzig, Dresden, Chemnitz, Erfurt, Suhl,<br />
Gotha, Jena, Weimar, Eisenach) auf, machte einen Abstecher<br />
nach Böhmen, bevor er die Rückreise über Kassel, Hanno-<br />
versch-Münden, Göttingen antrat. Überall sah er noch die<br />
alten Gesellenbräuche im Schwange: in Bremen mußte er sich<br />
zunächst den Gesellen vorstellen (Umtrunk, Aufsagen be-<br />
stimmter Formeln), um vor offener Lade freigesprochen, also<br />
als zünftiger Geselle anerkannt zu werden. Ein Gesellen-<br />
schein wurde vom Altmeister, Altgesellen und den Beisitzen-<br />
den unterzeichnet, der ihm auf seiner Wanderschaft das Ge-<br />
sellengeschenk sowie Unterstützung und Pflege im Krank-<br />
heitsfalle zusichern sollte. Vor dem Hintergrund der seit<br />
den 50er Jahren in Bremen diskutierten Gewerbefreiheit, die<br />
dann auch 1861 eingeführt wurde, erscheint es fraglich, ob<br />
das Lossprechen durch die Gesellen sowie die offizielle<br />
Vergabe von Gesellenscheinen noch gestattet war. Form und<br />
Ablauf der Arbeitssuche auf seiner weiteren Reise entspra-<br />
chen dem handwerklichen Herkommen. Obwohl er sich in dem<br />
schon stark industrialisierten Sachsen, das ein Zentrum der<br />
Arbeiterbewegung war, aufhielt, finden deren Ideen und Or-<br />
ganisationen keine Erwähnung bei Mengers. Er spiegelt sein<br />
im Kaiserreich durch Beobachtung gesellschaftlicher Span-<br />
nungen gewonnenes Harmoniebedürfnis in gelungenen menschli-<br />
chen Begegnungen bzw. in noch intakten familiär engen Mei-<br />
ster-Gesellen-Verhältnissen seiner Jugendzeit.Er betont au-<br />
ßerdem die Achtung, die einem Handwerksgesellen überall<br />
entgegengebracht und den Schutz der Berufsgenossen, der ihm<br />
als Gesellen auf der Wanderschaft zuteil wurde. In einer<br />
Hotelküche hatte er zusammen mit anderen Gesellen Klempner-<br />
arbeiten zu verrichten. Die Beziehung zwischen Herrschaft<br />
und Hauspersonal beschreibt er als zuvorkommend und harmo-<br />
nisch: Erfrischungen und ein günstiger Mittagstisch wurden<br />
auch den Gesellen gewährt, man integrierte sie in ein<br />
abendliches Tanzvergnügen.<br />
„Ja, meine Lieben, in unserer heutigen, durch den<br />
krassen Klassengeist zerklüfteten Gesellschaft wäre
465<br />
so etwas wohl kaum denkbar. Eins muß ich jedoch feststellen,<br />
ich habe in vielen großen Hotels gearbeitet,<br />
nirgends aber habe ich ein so harmonisches, auf gegenseitige<br />
Achtung und Respekt aufgebautes Zusammenwirken<br />
gefunden, nirgends eine so konsequente, in<br />
einander greifende Ordnung und Sauberkeit wie grade<br />
in diesem stark frequentierten Hotel. Das war das Resultat<br />
eines echt liberalen Geistes, der in diesem<br />
Hotel herrschte, das Resultat der gegenseitigen Anerkennung<br />
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer“. 61<br />
Auch in Zwickau fällt ihm das einträchtige Verhältnis zwi-<br />
schen Meistern, Fabrikanten, Gesellen und Arbeitern auf:<br />
„Es waren Meister und Gesellen, Fabrikanten und ihre<br />
Arbeiter mitsamt ihren Frauen und Töchtern, die hier<br />
in schönster Harmonie das Fest der Handwerker feierten.<br />
Wirklich ein schönes Fest, welches in allen<br />
Schattierungen ein Bild der ungezwungenen freien Bewegung<br />
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer darstellte;<br />
ein Bild menschenwürdigen Einklangs“. 62<br />
Ein andermal äußert er sich begeistert über ein Zusammen-<br />
treffen in Leipzig mit einem Kaufmann aus Oldenburg, der<br />
die Messe besuchen wollte:<br />
„Das war wiederum ein Lebensbild echt sozialer Natur,<br />
dieses sonderbare Zusammentreffen eines reichen israelitischen<br />
Kaufmannes mit einem armen protestantischen<br />
Handwerksgesellen. Es zeigt uns allemal, wie<br />
die Menschheit auf einander angewiesen, und daß die<br />
sozialen Gegensätze nur durch ein gegenseitiges Entgegenkommen,<br />
durch freie Selbstbestimmung, durch Bildung<br />
und Überzeugungstreue zu überbrücken sind“ 63 .<br />
Er empört sich über den Kastengeist einiger adliger Studen-<br />
ten, schildert Schlägereien zwischen Handwerksgesellen und<br />
Korpsstudenten, aber auch sich anschließendes versöhnliches<br />
Beisammensein und gegenseitiges Verständnis für einan-<br />
der. 64 Auf seinem Weg nach Magdeburg begegnen ihm in einer<br />
kleinen Stadt noch Züge einer intakten Ständegesellschaft:<br />
die am Ort vorhandenen beiden Gasthöfe werden jeweils nur<br />
von einem bestimmten Publikum besucht, den bürgerlichen Ho-<br />
61 Mengers,C., Aus den letzten Tagen der Zunft ... , S.45<br />
62 Ebenda, S.83f.<br />
63 Ebenda, S.49<br />
64 Vgl. Ebenda, S.36 u. 49ff
466<br />
noratioren einerseits, den Dienstleuten andererseits. 65 Erst<br />
im hessischen Kassel wird er scheinbar das erste Mal mit<br />
den Auswirkungen der Gewerbefreiheit konfrontiert. Sehr ab-<br />
rupt und wohl eher des dramaturgischen Aufbaus seiner<br />
Schrift halber endet die Wanderschaft zeitgleich mit dem<br />
Zunftsystem. Die Gesellenlade ist aufgehoben, der Gesellen-<br />
schein unbrauchbar geworden, die Solidarität der Gesellen<br />
gesprengt, die Harmonie zwischen Meistern und Gesellen be-<br />
endet. 66<br />
6.2 Städtisches Handwerk, außerzünftige Wirtschaft und<br />
kommunale Gewerbeförderung<br />
6.2.1 Auseinandersetzungen um die Abgrenzung handwerkli-<br />
cher von industrieller Produktion, Anfänge einer<br />
Arbeitsgesetzgebung in den Fabriken<br />
6.2.1.1 Maschinenbau, Nagelproduktion<br />
Die 40er bis 60er Jahre des 19. Jahrhunderts stellten nach<br />
H.-J. Schulze die bedeutsamste Periode der stadtoldenburgi-<br />
schen Industriegeschichte dar: eine Reihe von fabrikmäßig<br />
produzierenden Betrieben entstand. Hieraus ergaben sich<br />
Konflikte mit den Innungen, die aus der Perspektive der Si-<br />
cherung der ehrlichen Nahrung um den lokalen Absatz ihrer<br />
Produkte fürchteten und versuchten, die neue unzünftige<br />
Konkurrenz zu begrenzen, wenn nicht auszuschalten. 67<br />
65 Vgl. Ebenda, S.15f.<br />
66 Vgl. Ebenda, S.110f.<br />
67 H.-J. Schulze spricht von der oldenburgischen Gründerzeit<br />
(vgl. ders., Oldenburgs Wirtschaft ... , S.192ff); C. Reinders-Düselder<br />
hingegen weist anhand der doch bescheidenen<br />
Anzahl von Industriebetriebsgründungen und der dort Beschäftigten<br />
auf „die schwache Industrialisierung der Stadt“<br />
hin. Von einem radikalen Wandel der städtischen Wirtschafts-<br />
und Sozialstruktur könne um die Mitte des 19.
467<br />
Die wirtschaftliche Entwicklung, mögliche Strukturwand-<br />
lungsprozesse im Handwerk angesichts der Industrialisierung<br />
für Oldenburg zu belegen, erweist sich als schwierig. Das<br />
Zahlenmaterial beschränkt sich auf die Wiedergabe der An-<br />
zahl der Betriebe und der Beschäftigten im jeweiligen Ge-<br />
werbe 1831 und 1875. 68 Möglichen Aussagen zur Entwicklung<br />
einzelner Handwerke und Branchen, des Handwerks insgesamt<br />
(Anzahl der Betriebe, durchschnittliche Betriebsgrößen,<br />
Meister-Gesellen-Relationen, Handwerkerdichte, Zusammenset-<br />
zung der Branchen) steht die mangelnde Vergleichbarkeit der<br />
beiden Tabellen entgegen. Im Gegensatz zu 1831 werden in<br />
der Statistik von 1875 Gewerbebetriebe nur noch nach Be-<br />
triebsgrößen (Betriebe ohne Hilfskräfte, mit eins bis fünf,<br />
mit sechs und mehr) unterschieden, eine ausdrückliche Zu-<br />
ordnung zum Handwerk findet nicht mehr statt. Betriebe mit<br />
bis zu fünf Hilfskräften werden dabei zum Kleingewerbe ge-<br />
rechnet. Die Unsicherheit, wie zwischen Klein- und Großbe-<br />
trieb zu trennen sei, spiegelt sich in den Erläuterungen<br />
zur Tabelle wider. Dort wird eingeräumt, daß die Unter-<br />
scheidung eigentlich schon bei zwei Gehilfen hätte beginnen<br />
müssen. In manchen Branchen, besonders im Handelsgewerbe,<br />
gehörten Betriebe mit drei, vier und fünf Beschäftigten<br />
schon zu den Großbetrieben, die für ein erweitertes Absatz-<br />
gebiet und mit Hilfe von Dampf- und Arbeitsmaschinen produ-<br />
zieren würden. Da nur die Geschäfte mit über fünf Beschäf-<br />
tigten nähere Angaben über den Einsatz von Maschinen hätten<br />
Jahrhunderts keine Rede sein. Innerhalb des produzierenden<br />
Gewerbes erwies sich das Handwerk, gemessen an der Anzahl<br />
der Beschäftigten, weiterhin als dominant. Zwischen 1830<br />
und 1850 ließen sich nach seinen Angaben in der Stadt fünf<br />
Industriebetriebe nieder, zwischen 1860 und 1870 waren es<br />
drei (vgl.ders., Oldenburg im 19. Jahrhundert ... ,<br />
S.123ff).<br />
68 Vgl. Verzeichnis der Gewerbetreibenden in der Stadt Oldenburg<br />
v. März 1831, in: StAO Best.70, Nr. 6685/F.8; Gewerbezählung<br />
v. 1. Dez. 1875, in: Statistische Nachrichten<br />
über das Großherzogthum Oldenburg, hg.v. Großherzoglichen<br />
Statistischen Bureau, Heft 17, Oldenburg 1877; die Gewerbezählungen<br />
von 1855 (Statistische Nachrichten ... Heft 3,<br />
Oldenburg 1858) und 1861 (Statistische Nachrichten ... Heft
468<br />
machen müssen, sei eine erhebliche Anzahl von Maschinen und<br />
Werkzeugen von der Erhebung ausgeschlossen gewesen. 69<br />
Die hier angesprochenen Kriterien zur Umschreibung des<br />
Großbetriebs - Betriebsgröße, Maschinenbesatz, Produktion<br />
für überlokale Märkte - verweisen auf die vielfältigen Be-<br />
mühungen der Behörden, das Handwerk vom Fabrikbetrieb be-<br />
grifflich abzugrenzen. Dabei spielten außerdem die Gegen-<br />
überstellung von zünftigem Handwerk und unzünftiger Fabrik,<br />
Arbeitsteiligkeit, Mitarbeit oder Nicht-Mitarbeit des Lei-<br />
ters, Qualifikation der Mitarbeiter eine Rolle. Die Verwen-<br />
dung dieser Merkmale schuf jedoch nicht Eindeutigkeit, zu-<br />
mal dann nicht, wenn durch Gewerbefreiheit die Zuordnung<br />
zum zünftigen Gewerbe nicht mehr möglich war oder Handwer-<br />
ker ähnlich wie Heimgewerbetreibende im Verlag arbeiteten.<br />
Ob ein Betrieb zum Handwerk oder zur Fabrikindustrie ge-<br />
rechnet wurde, blieb der Selbstzuweisung, der Enumeration<br />
des Gesetzgebers sowie richterlichem Urteil überlas-<br />
sen. 70 Behilft man sich damit, Kleinbetriebe bis zu fünf<br />
Personen als Handwerksbetriebe zu deuten, ohne weitere In-<br />
formationen zu Produktionsweise, Absatzverhältnissen, Ab-<br />
hängigkeiten, Geschäftsführer und Beschäftigten heranziehen<br />
zu können, verfehlt man die Eigenschaften, die das Handwerk<br />
ursprünglich ausmachten: „[...] wirklich selbständige, qua-<br />
lifizierte, nicht allzu arbeitsteilige Handarbeit mit enger<br />
Beziehung zu Haushalt und Familie, ohne scharfe Trennung<br />
von Disposition und Ausführung im Arbeitsvollzug“. 71<br />
Da die Verfasserin zumindest nicht auf eine Übersicht über<br />
das Gewerbe im Jahr 1875 verzichten wollte, orientierte sie<br />
7, Oldenburg 1865) enthalten keine Angaben zu den einzelnen<br />
Handwerken in der Stadt Oldenburg.<br />
69 Vgl. Gewerbezählung v. 1.Dez. 1875 ... , S.6f.<br />
70 J. Kocka beschreibt die Veränderungen der Kriterien, die<br />
die Behörden zur Beurteilung heranzogen, seit dem frühen<br />
19. Jahrhundert, die Ursachen für die Aufrechterhaltung des<br />
Handwerksbegriffs und die damit verbundenen Schwierigkeiten,<br />
Gewerbestatistiken zu erstellen und zu interpretieren<br />
(vgl. ders, Arbeitsverhältnisse ... , S.299ff). Für Oldenburg<br />
sind bei Schulze Hinweise auf Abgrenzungsmerkmale zu<br />
finden (vgl. ders. Oldenburgs Wirtschaft ... , S.182ff).<br />
71 Kocka, J., Arbeitsverhältnisse ... , S.302
469<br />
sich an den schon in früherer Zeit genannten Handwerkstä-<br />
tigkeiten und schloß solche Betriebe aus, die in der Tabel-<br />
le ausdrücklich als Fabriken bezeichnet wurden. Berufe, die<br />
ein Gewerbetreibender als Nebengewerbe in der Stadt oder<br />
dem Stadtgebiet ausübte, wurden nicht berücksichtigt; das<br />
gleiche gilt für Hauptgewerbe im Stadtgebiet. Darüberhinaus<br />
können die Beschäftigtenzahlen nicht mit den Gesellen- oder<br />
Lehrlingszahlen von 1831 verglichen werden, da sie Gesel-<br />
len, Lehrlinge und ungelernte Arbeiter nicht getrennt aus-<br />
weisen. 72 Wenn das Handwerk in seiner spezifischen Betriebs-<br />
form statistisch und real in den 70er Jahren nur noch<br />
schwer zu erfassen ist und quantitative Betrachtungen damit<br />
über lange Zeiträume hinweg kaum möglich sind, so könnten<br />
stattdessen die qualitativen Veränderungen, die einzelne<br />
Handwerke seit den 40er Jahren in Oldenburg durchmachten,<br />
untersucht werden. Wie stark und in welcher Form<br />
(Veränderung der Arbeitsgebiete, der Arbeitsorganisation<br />
etc.) wurden die einzelnen Handwerke von der Gründung von<br />
Industriebetrieben betroffen? 73<br />
72 Vgl. Tabelle 16 im Anhang<br />
73 K.-H. Kaufhold betont die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten,<br />
die dem Handwerk blieben bzw. die sich ihm<br />
durch Anpassung und Ausnutzung neuer Marktchancen eröffneten.<br />
Handwerksbranchen und -betriebe wurden vom ökonomischen<br />
Wandel sehr unterschiedlich betroffen: Verdrängung,<br />
unveränderte oder neue Absatzmöglichkeiten, notwendige Änderung<br />
der Produktionsweise und der -gegenstände, Entstehung<br />
neuer Berufe existierten als Perspektiven nebeneinander.<br />
Kaufhold geht allerdings anders als Kocka und ungeachtet<br />
der von ihm beschriebenen praktischen Schwierigkeiten<br />
der Behörden im 19. Jahrhundert, einzelne Betriebe dem<br />
Handwerk oder dem Fabrikbetrieb zuzuordnen, von dem Weiterleben<br />
der handwerklichen Betriebsform und wohl auch der,<br />
wenn auch abgeschwächten und veränderten, spezifischen<br />
Wirtschaftsgesinnung aus (vgl. Kaufhold, K.-H., Handwerkliche<br />
Tradition und industrielle Revolution, in: ders., Reimann,<br />
F., (Hg.), Theorie und Empirie in Wirtschaftspolitik<br />
und Wirtschaftsgeschichte (Gö Beiträge zur Wirtschafts- und<br />
Sozialgeschichte hg.v.K.-H.Kaufhold; Bd.11), Göttingen<br />
1984, S.178f.). Dies hängt mit dem unterschiedlichen Ansatz<br />
und der dafür entwickelten Definition von Handwerk zusammen.<br />
Kaufhold will das Handwerk in seiner wirtschaftlichen<br />
Entwicklung bis ins 20. Jahrhundert untersuchen, hebt dazu<br />
Merkmale der Produktionsform hervor, die auch heutige Betriebe<br />
aufweisen können. Er legt einen strukturellen Be-
470<br />
Im folgenden geht es eher darum, die Reaktionen der Meister<br />
und Gesellen angesichts der Fabrikkonkurrenz sowie die Kon-<br />
fliktregelungen der Behörden darzustellen. 74 Zunächst werden<br />
drei Fälle aus dem metallverarbeitenden Gewerbe ausführli-<br />
cher geschildert. Es geht dabei um den Umfang der Gewerbe-<br />
befugnisse eines zu bewilligenden Industriebetriebs sowie<br />
griff langfristiger Wirtschaftsentwicklung im Handwerk zugrunde:<br />
das Phänomen wird strukturell unter Absehung historischer<br />
Wandlungen erfaßt. Die Schwierigkeit der Vermittlung<br />
von typologischer Herangehensweise und sozialgeschichtlicher<br />
Realität, also die Zuordnung von Merkmalen<br />
und Betrieben, bleibt als solche dabei bestehen. Die Mentalitätsebene,<br />
die „sittliche Ökonomie des alten Handwerks“,<br />
spielt bei den Kaufholdschen Erwägungen eine untergeordnete<br />
Rolle. Anders Kocka, der Handwerk als ein sozialgeschichtliches<br />
Phänomen begreift. Handwerkliches Leben und Arbeiten<br />
machte im 19. Jahrhundert angesichts des Industriekapitalismus<br />
bestimmte Entwicklungen durch, die es etwa seit den<br />
60er Jahren seines spezifischen Charakters entkleideten.<br />
Kocka verwendet einen historisch enger gefaßten, an der sozialen<br />
Wirklichkeit orientierten Begriff. Als Beleg für<br />
seine Auffassung zieht er zeitgenössische Statistiken und<br />
Äußerungen von Behörden heran, die von der Unmöglichkeit<br />
der Aufrechterhaltung eines spezifischen Handwerksbegriffs<br />
ausgehen. - Die Auseinandersetzungen zwischen Innungen und<br />
Fabrikanten um Konzessionen, Arbeitskräfte beispielsweise<br />
könnten unter dem Gesichtspunkt der industriellen Beeinflussung<br />
ausgewertet werden. Allerdings ist einschränkend<br />
zu sagen, daß derlei Fälle nicht sehr häufig vorkamen; zu<br />
vermuten ist außerdem, daß die Betriebslage des betroffenen<br />
Handwerks kaum in aller Ausführlichkeit erörtert worden ist<br />
(z.B. Tischlerinnung wider den Vergolder Boschen: Anlegung<br />
einer Möbelfabrik 1849 [StAO Best.70; Nr.6616]; Schmiede-,<br />
Sattler-, Maler- und Stellmacherinnungen wider den Wagenfabrikanten<br />
Sturm 1853/57 [StAO Best.262-1 A,Nr.2037]; Tischler-,Sattler-,<br />
Schlosser- und Schmiedeinnungen wider den<br />
Kaufmann Ballin: Anlegung einer Möbelfabrik 1856/57 [StAO<br />
Best.70; Nr.6616]).<br />
74 Auf der Grundlage von H.-J. Schulzes Kapitel über die Fabrikgründungen<br />
wäre es auch interessant, die Herkunft der<br />
Fabrikanten systematischer zu erfassen. Schulze hebt hervor,<br />
daß die Bedeutung der „Gründerzeit“ in der Stadt Oldenburg<br />
durch die Leistung einer kleinen Gruppe von Unternehmern<br />
geprägt wurde und nennt J. Schultze, J.C.Hoyer,<br />
F.B.Hegeler (Kaufleute), W. Fortmann (Klempnermeister) und<br />
C.Thorade (Bankier) (vgl. ders., Oldenburgs Wirtschaft ...<br />
, S.201). Wieviele Meister und Gesellen ergriffen die Möglichkeit,<br />
Fabriken zu gründen und ließen damit die zünftige<br />
Handwerksmentalität hinter sich zurück? Wieviele Industriebetriebe<br />
gab es, die sich aus kleinen Handwerksbetrieben<br />
entwickelten?
471<br />
um die geregelte Zuordnung von Arbeitskräften an Handwerk<br />
und Industriebetrieb. Beide Streitpunkte, die Abgrenzung<br />
der Arbeitsgebiete und die Furcht vor dem Abwerben, dem<br />
„Abspenstigmachen“, von Gesellen, spielten seit jeher eine<br />
Rolle in den Auseinandersetzungen mit anderen ansässigen<br />
Zünften. Die Grundlage der Argumentation der Innungen<br />
selbst in ihren Protestschreiben bildete nach wie vor die<br />
Auffassung, daß Gewerbetätigung ein gewährtes Vorrecht vor-<br />
aussetzt, aus dem aber auch für den so Privilegierten ge-<br />
wisse Pflichten erwachsen (langjährige Ausbildung, Erwerb<br />
des Meisterrechts etc.); wird es verletzt, so erfordern<br />
„Recht und Billigkeit“ , auch besonders im Hinblick auf die<br />
Gefährdung der sozialen Lage der städtischen Handwerkerfa-<br />
milien durch die unlautere Konkurrenz, den Schutz der wohl-<br />
erworbenen Rechte oder Befugnisse des Handwerks durch den<br />
Staat. Industriebetriebe boten aber nicht nur alternative<br />
Arbeitsmöglichkeiten in Form abhängiger Lohnarbeit für<br />
Handwerksgesellen, sondern auch die Chance, sich außerhalb<br />
der beschränkenden Vorschriften der HWO (Bannmeile, Über-<br />
setzung) selbständig zu machen. Das Gesuch eines verheira-<br />
teten Schmiedegesellen, das abschlägig beschieden wurde,<br />
gibt Einblick in dessen Motive und Vorstellungen, die Na-<br />
gelproduktion fabrikmäßig zu betreiben. Aus dem Bemühen<br />
heraus, möglichst den handwerksmäßigen Betrieb unter dem<br />
Schutz der Fabrikkonzession zu unterbinden, prüfte die Re-<br />
gierung, der die höhere Gewerbepolizei oblag, ob die für<br />
eine Massenproduktion erforderlichen Grundlagen<br />
(Ausbildung, berufliche Erfahrung, Nachfrage, Betriebskapi-<br />
tal etc.) vorhanden waren. Die Proteste der Innungen zwan-<br />
gen die Behörden darüberhinaus den Begriff des Fabrikbe-<br />
triebes näher zu bestimmen. Die in dieser Richtung unter-<br />
nommenen Bemühungen gingen jedoch zunächst nicht über den<br />
Einzelfall hinaus. Der bisher von der Verwaltung prakti-<br />
zierte Grundsatz, daß die den Innungen erteilte Gerechtsame<br />
weder den Handels- noch den Fabrikbetrieb berühren und ein-
472<br />
schränken durften, wurde in den neuen Bestimmungen zur HW0<br />
von 1847 verfügt. 75 Die Regierung ließ sich bei der Regelung<br />
von Auseinandersetzungen zwischen Handwerk und Fabrik von<br />
der möglichst freien Entfaltung der „höheren Gewerbthätig-<br />
keit“ leiten. 76<br />
1847 richtete der Zimmermeister Anton Gerhard Meyer ein Ge-<br />
such an die Regierung, in dem er um die Konzession einer<br />
Eisengießerei und einer Nagelfabrik bat. Sie sollten später<br />
eine Ausdehnung zur Maschinenfabrik erfahren, wenn der<br />
Sohn, der augenblicklich in einer solchen der Firma Ege-<br />
storff in Linden bei Hannover arbeitete, die polytechnische<br />
Schule erfolgreich absolviert haben würde. 77 Zunächst habe<br />
er sich an den Magistrat gewandt und darum ersucht, daß er<br />
in der geplanten Fabrik die anfallenden Schmiede- und<br />
Schlosserarbeiten durch eigene Arbeiter ausführen lassen<br />
dürfe. Es wurde ihm aber keine Genehmigung erteilt, sondern<br />
nur auf die Artikel 33 und 34 der Stadtordnung verwiesen,<br />
die die Betreibung einer Fabrik als Bürgerrecht angaben,<br />
das einer Konzession nicht bedürfe. Außerdem zog der Magi-<br />
strat eine Regierungsverfügung heran, die der Vareler Ei-<br />
sengießerei u.a. die Beschränkung auferlegt hatte, nur Ge-<br />
genstände anzufertigen, die größtenteils aus Gußeisen und<br />
nur zum kleineren Teil aus Schmiedeeisen oder Eisenblech<br />
bestanden. Meyer hielt eine Konzession für notwendig, um<br />
sich vor Ansprüchen der Innungen schützen zu können. Die<br />
Beschränkungen für die Eisengießerei in Varel sah er als<br />
nicht auf die Nagel- und Maschinenherstellung anwendbar an.<br />
Besonders im Maschinenbau sei es angesichts der technischen<br />
Fortschritte und der Erfindungen unmöglich, im voraus Mate-<br />
75 Vgl. Art.12b:“Die für den Handwerks=Betrieb geltenden Beschränkungen<br />
sind auf Fabrik=Inhaber und deren Gehülfen<br />
rücksichtlich der zum Fabrikbetrieb erforderlichen Arbeiten<br />
nicht anwendbar“. (Regierungsbekanntmachung über<br />
„Erläuterungen und neue Bestimmungen zur Handwerks=Ordnung<br />
vom 28.Januar 1830“, 18.11.1847, in: OGBl Bd.11/1847,<br />
S.472)<br />
76 Vgl. Regierungsbericht v.22.2.1848 betr. Beschwerde der<br />
Schmiede. und Schlosserinnung,in: StAO Best.70, Nr.6612<br />
77 Vgl. Gesuch des Zimmermeisters A.G.Meyer v.8.3.1847, in:<br />
Ebenda
473<br />
rial und daran vorzunehmende Arbeiten festzulegen. Die<br />
Schlosser- und Schmiedeinnung hätte keine Nachteile zu er-<br />
warten, da die Fabrik größtenteils für den Export arbeiten<br />
würde. Meyer bat um die Bewilligung, Schmiede- und Schlos-<br />
serarbeiten innerhalb seiner Fabrik verfertigen und die Ge-<br />
genstände außerhalb derselben durch eigene Arbeiter auf-<br />
stellen oder zusammenzusetzen zu dürfen.<br />
Die Regierung forderte daraufhin ein Gutachten des Magi-<br />
strats darüber an, wie die Gewerbebefugnisse der Eisengie-<br />
ßerei gegenüber dem Handwerk festgelegt werden könnten. 78<br />
Die Stadt berichtete vier Monate später, daß es ihr nicht<br />
gelungen sei, eine Einigung zwischen Meyer und der Innung<br />
herbeizuführen. Die Ansichten über den Umfang der Beschrän-<br />
kungen für den Fabrikbetrieb mit Rücksicht auf das Handwerk<br />
seien geteilt. Der Gewerbe- und Handelsverein sprach sich<br />
grundsätzlich für die Förderung einheimischer Fabriken und<br />
gegen Beschränkungen im Interesse der Innungen aus. Bisher<br />
seien Nägel und gebrauchsfertige Eisengußwaren von hiesigen<br />
Kaufleuten und auswärtigen Fabriken in Oldenburg verkauft<br />
worden. Mit diesem Teil der beabsichtigten Fabrikanlage<br />
würde den Innungen also kein neuer bevorrechteter Mitbewer-<br />
ber erwachsen. Die Herstellung von Maschinen gehöre so gut<br />
wie nie zum Geschäftsbetrieb der hiesigen Handwerker. Der<br />
Verein befürwortete die Konzession für alle in der Fabrik<br />
vorgenommenen Schmiede- und Schlosserarbeiten. Außerhalb<br />
sollten aber nur Maschinen sowie Maschinenteile zusammenge-<br />
setzt und aufgestellt werden dürfen. 79<br />
Auch Stadtdirektor Wöbken und mit ihm die Mehrheit des Ma-<br />
gistrats sprach sich für die größtmögliche Freiheit des In-<br />
dustriebetriebs dergestalt aus, daß es möglich sein sollte,<br />
die dort hergestellten Produkte gebrauchsfertig zu kaufen.<br />
Andererseits müsse der Absatz des lokalen kleinbetriebli-<br />
chen Handwerks weiterhin gewährleistet sein. Wöbken stützte<br />
seine Ansicht, daß sowohl alle notwendigen Arbeiten in der<br />
78 Vgl. Regierungsreskript v.16.3.1847, in: Ebenda<br />
79 Vgl. Gutachten des Direktoriums des Gewerbe- und Handelsvereins<br />
v.30.4.1847, in: Ebenda
474<br />
Fabrik ausgeübt als auch außerhalb die produzierten Gegen-<br />
stände fertiggestellt werden dürften, u.a. auf den Artikel<br />
53 HWO. Der Fabrikbetrieb sei von dem Verbot, mehrere Hand-<br />
werke gleichzeitig zu betreiben, ausgenommen. 1834 wurde<br />
außerdem dem Tabakfabrikanten Schrimper erlaubt, durch ei-<br />
gene Arbeiter auch solche Handwerksarbeiten, die den Innun-<br />
gen zustanden, in seiner Fabrik ausführen zu lassen. 80 Im-<br />
gleichen bestünde der hier überall anerkannte Grundsatz,<br />
Fabriken unbeschränkt den Handel en gros und en détail mit<br />
den eigenen Produkten zu erlauben. Der Kleinverkauf auf Be-<br />
stellung von Produkten, die in den Arbeitsbereich der In-<br />
nungen fielen, sollte allerdings verboten werden. Eine Min-<br />
derheit der Mitglieder des Magistrats stellte die Angst der<br />
Innung vor Einbußen ihrer Arbeitsmöglichkeiten in den Vor-<br />
dergrund. Diese sah die Gefahr, daß die Herstellung aller<br />
Gegenstände aus Gußeisen von der Fabrik übernommen werde<br />
und den Meistern selbst nur noch Reparaturen verblieben,<br />
von denen sie nicht bestehen könnten. Schon jetzt sei es<br />
ein Zeichen für die verminderte Arbeit in dem Gewerbe, daß<br />
die Anzahl der dort beschäftigten Gesellen abgenommen habe.<br />
Es gebe Schlossermeister, die fast das ganze Jahr über kei-<br />
nen Gesellen anstellen könnten. Daher sollte es nicht er-<br />
laubt sein, außerhalb der Fabrik Gegenstände, die auch von<br />
Handwerkern angefertigt werden würden, fertigzustellen. Fa-<br />
brikprodukte, die unter einem Rt Courant das Stück koste-<br />
ten, sollten von der Fabrik nur im Dutzend und mehr an Per-<br />
sonen des Innungsbezirks verkauft werden, da sie die Haupt-<br />
produktionsgegenstände der Schmiede und Schlosser bildeten.<br />
Diese Beschränkungen seien durch die HWO legitimiert, die<br />
Meister in ihrem Betrieb schützen wolle. Auch sei bisher<br />
keine Fabrik mit der Absicht angelegt worden, die Tätigkeit<br />
80 Vgl. Gutachten des Stadtdirektors Wöbken, in: Ebenda; Resolution<br />
für die Regierung v.8.11.1834, in: StAO Best.70,<br />
Nr.6667. Schrimper wurde entgegen des Protests der Küpkerinnung<br />
gestattet, die für seine Produktion notwendigen<br />
Küpker- und Böttcherarbeiten durch einen als Fabrikarbeiter<br />
angestellten Küpker in seiner Fabrik ausführen zu lassen.
475<br />
der Handwerker zu beschränken. 81 Die Forderungen der Innung<br />
selbst gingen noch darüber hinaus, indem jegliche Ausfüh-<br />
rung handwerklicher Arbeiten in und außerhalb der Fabrik<br />
verboten werden sollte. 82<br />
Deutlich wurde, daß die unbeschränkte Produktion in der Fa-<br />
brik nur von der Innung in Frage gestellt wurde, dagegen<br />
aber die Fertigstellung von Gegenständen außerhalb der Fa-<br />
brik strittig war. In allen Gutachten außer in dem des Ge-<br />
werbe- und Handelsvereins, das diesen Punkt gar nicht er-<br />
wähnte, wurde eine Beschränkung des Detailverkaufs vorge-<br />
schlagen. Es folgte noch ein Gesuch der Innung, in dem<br />
nachdrücklich die Aufrechterhaltung ihrer wohlerworbenen,<br />
in der HWO fixierten Rechte (exklusive Ausübung ihres Hand-<br />
werks, Bannmeile), von den Behörden eingefordert wurde. Ei-<br />
ne Konzession für die Eisengießerei könne nur in der von<br />
ihr vorgeschlagenen Beschränkung erfolgen, da sonst die In-<br />
nungsbefugnisse verletzt und nur noch die damit verbundenen<br />
Pflichten bestehen würden sowie der Ruin des ohnehin schon<br />
von Arbeitsmangel gekennzeichneten Handwerks drohe. Meister<br />
könnten dann etwa nur noch als Altflicker arbeiten. Dar-<br />
überhinaus würde eine unbeschränkte Gewerbeausübung, eine<br />
zu große Konkurrenz und die Zulassung von Personen, die ihr<br />
Gewerbe ohne nachgewiesene Befähigung dazu betrieben, die<br />
Verschlechterung der Gewerbeerzeugnisse, die Verringerung<br />
tüchtiger Arbeiter und den Untergang der Gewerbe selbst zur<br />
Folge haben. Kein Sohn eines hiesigen Bürgers würde sich<br />
mehr der Mühe einer langandauernden Ausbildung unterziehen,<br />
wenn die Aussicht, sich als Meister mit einer Familie aus-<br />
reichend ernähren zu können, kaum gegeben sei und andere<br />
eine Gewerbekonzession erwarben, die ein gewisses Kapital<br />
nachweisen konnten. 83 Die Regierung schloß sich der Ansicht<br />
der Mehrheit des Magistrats an und sprach sich damit dafür<br />
81 Vgl. Gutachten des Stadtsyndikus Friedrich Theodor<br />
Burchard Scholtz, in: StAO Best.70, Nr.6612<br />
82 Vgl. Protokoll über die Vernehmung der Schlosser- und<br />
Schmiedeinnung v.16.4.1847, in: Ebenda<br />
83 Vgl. Vorstellung der Schlosser- und Schmiedeinnung<br />
v.14.8.1847, in: Ebenda
476<br />
aus, daß eine Fabrik nicht den Vorschriften der HWO unter-<br />
liegen solle. Der Unternehmer dürfe nur nicht in den Ar-<br />
beitsbereich der Innung fallende Produkte auf Bestellung<br />
der einzelnen Verbraucher anfertigen lassen. 84<br />
Die Schlosser und Schmiede ließen in ihrem Widerstand nicht<br />
nach und legten Rekurs ein. In ihrem Beschwerdeschreiben an<br />
den Großherzog drangen sie auf eine strikte Trennung hand-<br />
werklicher von industriemäßiger Tätigkeit und damit auf die<br />
Ausschaltung jeglicher Konkurrenz. Die Regierungsverfügung<br />
wurde abgelehnt, da durch sie sozusagen eine geregelte Kon-<br />
kurrenz bei Schutz des lokalen Absatzes der handwerklichen<br />
Kleinbetriebe zugelassen wurde. Die HWO, auf die sie sich<br />
beriefen, wurde von ihnen als Gerechtsame, Privileg, ähn-<br />
lich den früheren Zunftartikeln, verstanden. Aus der Sicht<br />
der Innung konnten ihre Mitglieder gegenüber der fabrikmä-<br />
ßigen Massenproduktion von Handwerksgegenständen nicht be-<br />
stehen. Denn darauf würden die von der Regierung gewährten<br />
Freiheiten hinauslaufen. Der Fabrikant dürfe dann die glei-<br />
chen Gegenstände wie das Handwerk verfertigen; es sei ihm<br />
ermöglicht, alle handwerklichen Arbeiten durch eigene Ar-<br />
beiter in und außerhalb der Fabrik ausführen zu lassen und<br />
die Produkte im kleinen und im großen zu verkaufen. Die Or-<br />
ganisation des innungsmäßig verfaßten Handwerks beruhe auf<br />
dem langjährigen Erwerb spezieller beruflicher Qualifika-<br />
tionen, die den so auf diese Art Ausgebildeten auf eine be-<br />
stimmte Tätigkeit festlege. Sie sei daher auf den Schutz,<br />
den die exklusive Betreibung des jeweiligen Handwerks ge-<br />
währe, angewiesen. Die meisten jungen Handwerker wären<br />
nicht in der Lage, einen Laden zum Verkauf ihrer Produkte<br />
zu eröffnen. Einem kapitalkräftigen Fabrikanten, wie Meyer<br />
es sei, stehe die Zunftökonomie sonst chancenlos gegenüber.<br />
Insgesamt spiegelt das Schreiben die ungetrübte Überzeugung<br />
der Innung wider, daß ihre Forderungen rechtlich und mora-<br />
lisch unanfechtbar seien. Einen weiteren Höhepunkt gewann<br />
diese Sichtweise in der Behauptung, daß die Entwicklung und<br />
84 Vgl. Regierungsreskript an Magistrat v.25.8.1847, in:<br />
Ebenda
477<br />
die Ausbildung des Handwerkerstandes doch eher im staatli-<br />
chen Interesse liegen müßte als das Gedeihen des Fabrikwe-<br />
sens. Der Erhalt einer zahlreichen selbständigen Mittel-<br />
klasse und des moralisch-sittlichen Einflusses der Ausbil-<br />
dung auf die Jugend, die durch die umfassende Aufsicht und<br />
Erziehung der Meister geprägt sei, müsse in gesellschaftli-<br />
cher und menschlicher Beziehung doch wünschenswerter sein<br />
als die Förderung einzelner wohlhabender Fabrikanten, die<br />
einem Heer von Lohnarbeitern vorstünden, und die aus-<br />
schließlich gewerblichen Interessen dienende Arbeits-<br />
kraft. 85<br />
Die Regierung legte daraufhin ausführlich ihre allgemeinen<br />
Grundsätze und die gesetzlichen Grundlagen der von ihr ge-<br />
troffenen Verfügung in einem Bericht dar. Die Auswirkungen<br />
der Existenz einer Eisengießerei auf das Schmiede- und<br />
Schlosserhandwerk wurden von ihr durchaus positiv gesehen.<br />
Die Nachfrage nach Eisengußwaren würde steigen und damit<br />
auch die Nachfrage nach Arbeiten, die dem Handwerker zufie-<br />
len und ihm verblieben. Die Regierung nannte als Beispiel<br />
für diesen fördernden Effekt die Einrichtung gußeisener<br />
Fenster im Großherzoglichen Bibliotheksgebäude.<br />
„Welche Menge von handwerklichen Schlosser- und<br />
Schmiede=Arbeiten hat z.B. die Einrichtung gußeisener<br />
Fenster im Großherzoglichen Bibliotheksgebäude zur<br />
Folge gehabt! Der Fabrikant, welcher seine Leute<br />
stückweise zu lohnen pflegt, kann sich mit der ersten<br />
Aptirung nicht immer befassen, und später daran vorzunehmende<br />
Arbeiten fallen in das dem Handwerker gesetzlich<br />
gesicherte Gebiet“. 86<br />
Prinzipiell seien aber die Nachteile, die ein Fabrikbetrieb<br />
der bisherigen Tätigkeit der Handwerker zufüge, nicht abzu-<br />
wenden. Die Entwicklung des Fabrikwesens auf der Basis im-<br />
mer neuer Erfindungen, größerer Kapitalkraft und Maschinen-<br />
einsatz könne schon mit Blick auf die industrielle Förde-<br />
85 Vgl. Rekurseinlegung der Schlosser- und Schmiedeinnung<br />
v.20.9.1847 und Rekursschrift derselben an den Landesherrn<br />
v.22.11.1847, in: Ebenda<br />
86 Regierungsbericht v.22.2.1848, in: Ebenda
478<br />
rung in den Nachbarländern nicht begrenzt werden. Der Re-<br />
kurs der Innung wurde im darauffolgenden Monat abgelehnt.<br />
Die Regierung erläuterte den ersten Punkt ihrer Verfügung<br />
dahingehend, daß der Fabrikant keine ausschließlich durch<br />
Handwerksarbeit hergestellte Artikel verkaufen dürfe. Bei<br />
jedem Gegenstand müsse eine Tätigkeit der Eisengießerei<br />
nachweisbar sein. 87 Meyer konnte schließlich die Eisengieße-<br />
rei unter nur wenigen Beschränkungen in Betrieb nehmen und<br />
entwickelte sich bald zu einem der größten Arbeitgeber in<br />
der Stadt. 88<br />
Sechs Jahre später wandte sich derselbe gegen eine Ent-<br />
scheidung des Magistrats, die die Möglichkeiten der Fabrik,<br />
Gesellen einzustellen, erheblich beschnitt. Einwandernde<br />
Gesellen mußten sich um Arbeit zunächst an den Zuschickmei-<br />
ster der entsprechenden Innung wenden. Wurde ihm dort keine<br />
Arbeit angeboten, so konnte er als Arbeiter in die Fabrik<br />
gehen. Ein Geselle, der vorher in Oldenburg gearbeitet hat-<br />
te, durfte nur dann außerhalb des Handwerks einer Tätigkeit<br />
nachgehen und verschrieben werden, wenn er mindestens für<br />
ein Vierteljahr die Stadt verließ. Im Klartext bedeutete<br />
dies, daß hiesige Gesellen nur schwer von dem Fabrikanten<br />
abgeworben werden bzw. selbst auf eigene Initiative vom<br />
Handwerksbetrieb in die Fabrik wechseln konnten. 89 Meyer er-<br />
suchte nun die Regierung, daß das Regulativ keine Anwendung<br />
auf die Eisengießerei finde. Einem bei Meyer u. Co. in Ar-<br />
beit tretenden Gesellen war die Aufenthaltskarte verweigert<br />
worden, weil er nicht nachweisen konnte, daß die Innung ihm<br />
keine Arbeit habe geben können. Er begründete seine Forde-<br />
rung damit, daß ihm infolge der Konzession das Recht ge-<br />
währt worden war, unbeschränkt Schlosser- und Schmiedege-<br />
sellen halten zu können. Jetzt solle er nur noch diejenigen<br />
87 Vgl. Bescheid der Regierung für die Schmiede- und Schlosserinnung<br />
sowie den Zimmermeister Meyer v.22.4.1848, in:<br />
Ebenda<br />
88 1855 beschäftigte er 90 Arbeiter (vgl. Reinders-Düselder,<br />
C., Oldenburg im 19. Jahrhundert ... , S.127)<br />
89 Vgl. Rekursschrift der Fabrikbesitzer Meyer u. Comp.<br />
v.25.9.1854, in: StAO Best.70, Nr.6668; Regulativ des Magistrats<br />
v.20.7.1854 im Anhang der o.g. Rekursschrift
479<br />
erhalten, die die Innungsmeister nicht gebrauchen könnten.<br />
Dies käme, bei einem Mangel an tüchtigen Schlossergesellen,<br />
einem Verbot gleich. Weiterhin beschwerte sich Meyer, daß<br />
sein zunächst an den Magistrat gerichteter Antrag, aus den<br />
oben erwähnten Gründen von der Anwendung der Bestimmung auf<br />
seinen Betrieb abzusehen, kein Gehör gefunden hatte. Er<br />
kritisierte die Art und Weise, wie die vom Magistrat deswe-<br />
gen anberaumte Verhandlung geführt worden war. Nicht die<br />
Rechtmäßigkeit der polizeilichen Bestimmungen des Regula-<br />
tivs wären vorrangig erörtert worden, sondern ob das Hand-<br />
werk gegenüber der Fabrik ausreichend geschützt sei. Der<br />
Magistrat begründete dann seine Entscheidung damit, daß das<br />
Regulativ den Artikeln über das Einwandern und die Arbeits-<br />
vermittlung in der HWO entspreche; dadurch auch die Inter-<br />
essen der Fabrik nicht gefährdet würden, weil ihnen frei<br />
stehe, sich jederzeit Gesellen zu verschreiben. 90 Diese Ar-<br />
gumentation lehnte Meyer ab. Durch schriftliche Anforderun-<br />
gen erhielte man im allgemeinen die schlechteren Arbeits-<br />
kräfte:<br />
„Allein es ist allerdings von großem Interesse, den<br />
Mann zu sehen und zu prüfen, dem man Arbeit geben<br />
will, während es bekannt ist, daß die auf Verschreibung<br />
Kommenden in der Regel die sind, die nirgends<br />
aushalten, weil die Meister sie thunlichst bald wieder<br />
fremd werden lassen, wohingegen die guten Arbeiter<br />
sich länger an die Werkstätten fesseln und nicht<br />
leicht, um oft vorübergehenden hohen Lohnes willen,<br />
den Arbeitgeber wechseln. Nicht minder erheblich ist,<br />
daß man einen verschriebenen Arbeiter entweder bestimmt<br />
auf längere Zeit annehmen, oder ihm doppeltes<br />
Reisegeld geben muß“. 91<br />
In den genannten Artikeln der HWO stehe nichts darüber, daß<br />
ein hiesiger Geselle erst nach einer 1/4jährlichen Abwesen-<br />
heit von der Fabrik verschrieben werden könne. Der Magi-<br />
strat überschreite seine Kompetenzen als örtliche Polizei-<br />
behörde, wenn er sich, wie hier geschehen, gesetzgebende<br />
90 Vgl. Resolution des Magistrats v.17.8.1854 im Anhang der<br />
o.g. Rekursschrift<br />
91 Rekursschrift ... , in: Ebenda
480<br />
Gewalt anmaße. Das Regulativ bedürfe einer Abänderung, um<br />
mit dem geltenden Gesetz in Einklang zu kommen. Davon abge-<br />
sehen sei die HWO aber gemäß einer Regierungsverfügung<br />
überhaupt nicht maßgebend für den Betrieb von Fabriken. In<br />
einem Nachtrag zu seiner Rekursschrift nannte Meyer weitere<br />
Fälle, in denen Gesellen durch das Regulativ gehindert wor-<br />
den seien, in der Fabrik zu arbeiten. 92<br />
Der Magistrat schilderte daraufhin das Problem der Zuord-<br />
nung von Arbeitskräften aus der Sicht der Innung, deren<br />
Klagen über Mangel an Gesellen die Abfassung des Regulativs<br />
bewirkt hatten. 93 Schon vor längerer Zeit beschwerten sich<br />
die Schmiede und Schlosser darüber, daß sie nicht genügend<br />
Gesellen bekommen könnten und daß die bei ihnen in Arbeit<br />
stehenden kündigten. Dies lag daran, daß die Eisengießerei<br />
kurzfristig die Löhne erhöhte und damit alle zureisenden<br />
Gesellen in die Fabrik zog, die hiesigen ihre Arbeit auf-<br />
kündigten, um gleichfalls dort zu arbeiten. Weiterhin ent-<br />
zogen die Gasanstalt und kleinere Fabriken, wie die der Ma-<br />
schinenbauer Stührmann und des Posthalters Ehlers<br />
(Wagenfabrik), der Innung Arbeitskräfte. Auf diese Weise<br />
wurde 1852 schon ein Regulativ erlassen, das zunächst nur<br />
das Vorrecht des Handwerks festlegte, einwandernde Gesellen<br />
zuerst in Arbeit nehmen zu können. Die Meister bestanden<br />
jedoch auf dessen Befolgung nur im Notfall. 1854 wurden er-<br />
neut Klagen über Mangel an Gesellen laut, strengere Vor-<br />
schriften wurden erbeten. Die ersten beiden Absätze des Re-<br />
gulativs von 1854 entsprächen der HWO und rechtfertigten<br />
sich aus der beschränkteren Lage des Handwerks: Meister er-<br />
hielten Gesellen nur nach der Reihenfolge, dürften keine<br />
verheirateten anstellen, Lohnerhöhungen im Ausmaß der von<br />
den Fabriken getätigten wären nicht möglich. Der dritte Ab-<br />
satz sei allerdings außerhalb des Gesetzes erlassen worden.<br />
Er sei deswegen dringend erforderlich, weil nur so verhin-<br />
dert werden könne, daß Fabrikanten dem Handwerk die tüch-<br />
92<br />
Vgl. Nachtrag zur Meyerschen Rekursschrift v.27.9.1854.<br />
in: Ebenda<br />
93<br />
Vgl. Magistratsbericht v.5.10.1854, in: Ebenda
481<br />
tigsten Gesellen entzögen. Diese schickten Verschreibungen<br />
nach Rastede u.a. benachbarten Orten, was zur Folge hätte,<br />
daß hiesige Gesellen bei ihren Meistern kündigten, dorthin<br />
wanderten, mit der schriftlichen Anforderung sofort zurück-<br />
kehrten und in der Fabrik arbeiteten. Der Art. 84 HWO über<br />
das Verbot des Abspenstigmachens reiche nicht aus, den eben<br />
geschilderten Mißbrauch zu unterbinden. Der Magistrat bat<br />
um die Bestätigung des Regulativs und darum, daß es auf die<br />
Eisengießerei anwendbar sei. Diesem Wunsch war nur ein<br />
Teilerfolg beschieden. Die Regierung sprach sich wenig spä-<br />
ter zwar für das Vorrecht der Meister auf einwandernde Ge-<br />
sellen aus, sah den dritten Abschnitt jedoch als Über-<br />
schreitung der Bestimmungen der HWO an. Der Schutz der In-<br />
nungsmeister würde dadurch erweitert werden, im Gegenzug<br />
die Rechte der Gesellen und der „[...] zum Halten von Ge-<br />
sellen im öffentlichen Interesse ermächigten Fabrikbesitzer<br />
[...]“ 94 geschmälert. Gesellen sollten nach wie vor nur dann<br />
die Stadt für einen bestimmten Zeitraum verlassen, wenn der<br />
Meister sie ohne Aufkündigung entlassen habe (Art.<br />
85f.HWO). Das Vorgehen des Magistrats sei deswegen zu kri-<br />
tisieren, weil er die Innungsmeister gegen die Konkurrenz<br />
der Fabriken in unzulässiger Weise habe schützen wollen.<br />
Fabriken könnten heutzutage nicht mehr entbehrt werden; sie<br />
würden zwar zeitweilig hinsichtlich der Gesellen den Hand-<br />
werkern unbequeme Konkurrenz machen, auf der anderen Seite<br />
aber auch einen größeren Zustrom an geschickten Arbeitern<br />
bewirken. 95<br />
1855 verstießen die Fabrikanten Stührmann gegen das Vor-<br />
recht der Innung, einreisende Gesellen anzustellen. Der<br />
Schlossergeselle Diedrich hatte seinem Meister gekündigt<br />
und war direkt in die Maschinenbaufabrik gegangen. Darauf-<br />
hin wurde er vom Magistrat angewiesen, sich entweder um Ar-<br />
beit bei der Innung zu melden oder abzureisen. Diedrich<br />
entschied sich für die Abreise, ging nach Rastede, fand<br />
94 Regierungsverfügung v.21.11.1854, in: Ebenda<br />
95 Vgl. Votum eines Regierungsmitgliedes v.9.11.1854, in:<br />
Ebenda
482<br />
dort einen Verschreibungsbrief der Gebrüder Stührmann vor,<br />
kehrte mit demselben nach Oldenburg zurück und ließ sich<br />
ein weiteres Mal in der Fabrik anstellen. Ihm wurde dann<br />
von der örtlichen Polizeibehörde bedeutet, daß die Verfü-<br />
gung weiterhin Geltung behalte, er also wiederum vor die<br />
Wahl gestellt werden würde, abzureisen oder sich nach Ar-<br />
beit bei der Schlosser- und Schmiedeinnung umzuschauen. Da-<br />
gegen legten die Fabrikanten Rekurs bei den Behörden ein.<br />
Es läge kein „Abspenstigmachen“ des Gesellen vor; im übri-<br />
gen sei die Beschwerde der Innung über das Entziehen von<br />
Arbeitskräften nicht zu erklären, da es an einwandernden<br />
Schlossergesellen nicht mangele. 96 Auf eine Anfrage der Re-<br />
gierung hin, erläuterte der Magistrat, daß es bei den<br />
Schlossern und Schmieden keine Begehrwahl wie beispielswei-<br />
se bei den Tischlern geben würde. Daher müsse der Geselle,<br />
der seinem Meister gekündigt habe und neue Arbeit suche,<br />
sich wiederum wie ein neu einreisender Geselle auf der Her-<br />
berge vom Zuschickmeister vermitteln lassen. Gegen diese<br />
Bestimmung sei zweimal verstoßen worden: einmal durch den<br />
unerlaubten Wechsel vom Handwerk in den Fabrikbetrieb, ein<br />
weiteres Mal durch den Verschreibungsbrief nach Rastede,<br />
der es ermöglichen sollte, Diedrich weiterhin entgegen der<br />
Magistratsverfügung in der Fabrik zu beschäftigen. 97 Auf die<br />
Frage hin, ob denn genügend Möglichkeiten für die Fabriken<br />
bestünden, einreisende Gesellen als Arbeitskräfte anzustel-<br />
len, wies der Magistrat darauf hin, daß die Zahl wandernder<br />
Gesellen, welche keine Arbeit bei den Innungen fänden und<br />
von den Fabriken daher sofort beschäftigt werden könnten,<br />
nicht gering sei (die Anzahl der in Oldenburg beschäftigten<br />
Schmiede- und Schlossergesellen im Jahr 1854/55 wurde auf<br />
etwa 500 geschätzt; 160 Schmiedegesellen und 81 Schlosser-<br />
gesellen hatten in diesem Jahr Visa erhalten; von den 160<br />
Gesellen seien nur 66, von den 81 Gesellen nur 30 bei<br />
96 Vgl. Rekursbeschwerde für die Fabrikanten F. und W.<br />
Stührmann wegen Beschränkung ihrer Fabrikrechte durch Wegweisung<br />
des Schlossergesellen Diedrich v.13.9.1855, in:<br />
Ebenda<br />
97 Vgl. Magistratsbericht v.18.10.1855, in: Ebenda
483<br />
Schmiede- und Schlossermeistern eingestellt worden; von den<br />
94 für die Fabriken disponiblen Schmiedegesellen stellte<br />
Meyer u. Comp. nur einen an; von den 50 Schlossergesellen<br />
[ein Geselle arbeitete bei einem Büchsenmacher] beschäftig-<br />
ten Meyer u. Co. 3, Stührmann 4). 98<br />
Obwohl nach den Aussagen der Fabrikanten und des Magistrats<br />
genügend Arbeitskräfte für Schlosser- und Schmiedearbeiten<br />
in Oldenburg zu diesem Zeitpunkt vorhanden waren, hielten<br />
die Innung und die städtische Polizeibehörde auf die Ein-<br />
haltung der HWO.<br />
Im gleichen Jahr wandte sich das Amt Oldenburg mit dem Ge-<br />
such eines Maschinistengehilfen, der um die Erlaubnis zur<br />
Anlegung einer Nagelfabrik in Osternburg bat, an die Regie-<br />
rung. Der 33jährige Johann Dirk Becker aus Tossens hatte<br />
das Schmiedehandwerk in Ruhwarden erlernt, dann als Geselle<br />
bei Meistern in Strohhausen, Brake und Absen gearbeitet.<br />
Später wurde er als Heizer auf den Dampfschiffen in Olden-<br />
burg und Minden bei Osnabrück beschäftigt und verheiratete<br />
sich 1848 in Osternburg. 99 Zum Zeitpunkt seines Gesuchs ar-<br />
beitete er als einfacher Arbeiter in der Meyerschen Eisen-<br />
gießerei. Sein Lohn reichte jedoch nicht aus, eine Familie<br />
davon zu ernähren. Becker hatte in Drielake ein Haus ge-<br />
baut, in dem er mit 10 bis 12 Gesellen die Nagelproduktion<br />
aufnehmen wollte. Das Amt befürchtete nun, daß dieser wegen<br />
mangelnden Vermögens gar nicht in der Lage sein würde, eine<br />
wirkliche Fabrik einzurichten. Daher war man sich nicht<br />
schlüssig darüber, welche Voraussetzungen für eine Konzes-<br />
sion in diesem Fall erforderlich waren und welchen Umfang<br />
diese gegenüber dem Handwerk erhalten sollte. War ein Nach-<br />
weis, daß Becker gelernter Schmied war, anzufordern, wenn<br />
eine Fabrik konzessioniert werden sollte? Das Amt befürch-<br />
tete, daß Becker auch andere Schmiedearbeiten verfertigen<br />
würde, wenn der Absatz von Nägeln stocke. Wie sollte es mit<br />
dem Nachweis der finanziellen Mittel gehalten werden? Die<br />
98 Vgl. Magistratsbericht v.5.12.1855, in: Ebenda<br />
99 Vgl. Gesuch Johann D. Beckers um die Erteilung des Heiratskonsenses<br />
v.10.7.1848, in: StA0 Best.70, Nr.6610
484<br />
Gemeinde wünschte sich vor aussichtslosen Betriebsgründun-<br />
gen durch Gesellen zu schützen:<br />
„Der Gemeinde liegt aber natürlich sehr daran, daß<br />
nicht auf Schwindeleien gebaut werde, die der Gemeinde<br />
sehr gefährlich werden können. Je mehr s.g. Fabriken<br />
entstehen, desto mehr vergrößert sich die Zahl<br />
der Gesellen, die auf ihr Handwerk verzichten und<br />
dann eigentlich doch in ihrem Handwerk fabrikmäßig<br />
fortarbeiten“. 100<br />
Ein weiteres Problem stellte sich dem Amt in Form des Pro-<br />
tests eines Nagelschmieds aus Osternburg gegen die Konzes-<br />
sionierung. Wie sollten die Betriebsgrenzen zwischen Fabrik<br />
und Handwerk festgelegt werden? Die Regierung ordnete an,<br />
daß Becker erst einmal die Notwendigkeit fabrikmäßiger Na-<br />
gelproduktion in Osternburg begründen und die Art und Weise<br />
der von ihm angestrebten industriellen Fertigung beschrei-<br />
ben solle. Dann habe er darzulegen, 101 welche Mittel ihm da-<br />
für zur Verfügung stünden. Da das Amt berichtete, daß kein<br />
eigentliches Betriebskapital vorhanden und die fabrikmäßige<br />
Fertigung von Nägeln auch nicht ausreichend begründet bzw.<br />
definiert worden sei, lehnte die Regierung das Gesuch Bek-<br />
kers ab. Es bestünde Grund zu der Annahme, daß von ihm eine<br />
über das handwerksmäßige hinausgehnde Verfertigung von Nä-<br />
geln nicht ausgeführt werden könne. 102 Der ehemalige Schmie-<br />
degeselle legte daraufhin Rekurs beim Staatsministerium ein<br />
und erklärte ausführlich, warum er durchaus dazu fähig sei,<br />
die industrielle Produktion aufzunehmen. Er hielt Räumlich-<br />
keiten sowie Betriebskapital für ausreichend vorhanden. Die<br />
hiesigen Eisenhandlungen befürworteten die Errichtung einer<br />
Nagelfabrik, da dieser Artikel bisher in großen Quantitäten<br />
aus dem Ausland bezogen werden mußte. Außerdem habe er den<br />
Betrieb derartiger Fabriken im Ausland kennengelernt. Das<br />
Nagelschmiedehandwerk in Osternburg sei nicht übersetzt.<br />
Neben dem Nagelschmied Rowold, der für den Handel arbeite<br />
100 Bericht des Amts Oldenburg v.25.7.1855, in: Ebenda<br />
101 Vgl. Regierungsreskript v.13.8.1855, in: Ebenda<br />
102 Vgl. Amtsbericht v.28.9.1855, Regierungsverfügung<br />
v.19.11.1855, in: Ebenda
485<br />
und nicht auf Einzelbestellung von Privatleuten, existiere<br />
nur noch die Werkstatt einer Witwe vor dem Heiligengeist-<br />
tor, die von einem Gesellen fortgesetzt werde. Die Zulas-<br />
sung als Handwerksmeister würde ihm nicht verweigert wer-<br />
den, jedoch müsse er mit Schwierigkeiten rechnen, da das<br />
von ihm erbaute Haus nicht außerhalb der Bannmeile stehe.<br />
Davon abgesehen sei nur die Massenproduktion rentabel und<br />
ernähre den Unternehmer. Als Merkmale für den fabrikmäßigen<br />
Betrieb nannte er die große Anzahl der Arbeitskräfte, die<br />
Produktion für den Handel. Beide würden für seinen Betrieb<br />
zutreffen. Im Herzogtum bestünden sogar Nagelfabriken sehr<br />
viel kleineren Zuschnitts, beispielsweise arbeite ein Kauf-<br />
mann in Westerstede mit nur drei Gesellen. Andererseits war<br />
in Beckers Augen der Einsatz von Nägelmaschinen kein we-<br />
sentliches Kriterium für den Fabrikbegriff. In Harpstedt<br />
arbeite man ohne Maschinen, in der Meyerschen Eisengießerei<br />
stünde die Maschine oft still, da sie nur spezielles Blech,<br />
das zur Zeit sehr teuer sei, verarbeiten könne. Er sei aber<br />
finanziell in der Lage, sich eine derartige Maschine anzu-<br />
schaffen, die übrigens keine Dampfkraft erfordere, sondern<br />
von einem Schwungrad bewegt werde. Endlich betonte Becker<br />
die Vorteile, die sich für die Handelstreibenden und für<br />
das Kirchspiel ergeben würden, wenn die Regierung sein Ge-<br />
such befürworte. Die Ausführungen in der Beschwerdeschrift<br />
erwiesen sich jedoch nicht als überzeugend. Die Regierung<br />
unterstrich noch einmal, daß der Bittsteller ihrer Ein-<br />
schätzung nach nicht in der Lage sei, eine wirkliche Nagel-<br />
fabrik einzurichten, die Einkäufe von Rohmaterial in großen<br />
Quantitäten tätige und ihre Fabrikate durch den Großhandel<br />
vertreiben lasse. 103 Zu erwarten sei, daß ein ganz gewöhnli-<br />
cher, auf den Absatz in der nächsten Umgebung berechneter<br />
handwerksmäßiger Betrieb entstünde. Für diesen Fall müßten<br />
dann aber die gesetzlichen Bestimmungen für die Niederlas-<br />
sung von Handwerkern in der Nähe von Städten berücksichtigt<br />
werden. Da in Osternburg kein weiterer Nagelschmied erfor-<br />
103 Vgl. Regierungsbericht v.7.1.1856, in: Ebenda
486<br />
derlich sei, solle dem Gesuch nicht stattgegeben werden.<br />
Weiterhin ging die Regierung noch auf die Begründung des<br />
Bedarfs einer Nagelfabrik von Seiten des Bittstellers ein.<br />
Daß Nägel von auswärts bezogen würden, zeige nur, daß die<br />
hiesigen im Lande bestehenden Nagelschmieden der kapital-<br />
kräftigeren Konkurrenz nicht gewachsen seien. Auch Beckers<br />
Betriebskapital reiche nicht aus, die Fabrikation mit 10<br />
bis 12 Gesellen aufzunehmen, die erforderlichen Räumlich-<br />
keiten, Werkzeuge und Rohmaterialien bereitzustellen bzw.<br />
anzuschaffen. Der Hinweis auf eine Nagelfabrik in Wester-<br />
stede, die mit nur drei Gesellen als ein die handwerksmäßi-<br />
ge Herstellung übersteigender Betrieb anerkannt werden wür-<br />
de und so auch zugelassen worden sei, treffe nicht zu. Ehe-<br />
mals wurde einem F. Müller aus Osnabrück die Errichtung ei-<br />
nes Fabrikgeschäfts dort erlaubt. Nach anfänglichem Erfolg<br />
vernachlässigte der Inhaber jedoch seinen Betrieb, der dar-<br />
aufhin verfiel. Später wurde einem Kaufmann und einem Gast-<br />
wirt aus Westerstede gestattet, ihn weiterzubetreiben, ohne<br />
daß die Fabrikation allerdings wieder einen größeren Umfang<br />
erreichte. Das Beispiel bestärke die Regierung nur in der<br />
schon angedeuteten Auffassung, daß eine Nagelfabrik im hie-<br />
sigen Land nicht mit den auswärtigen Unternehmungen konkur-<br />
rieren könne. 1846 wurde es einem Kaufmann in Jever aus dem<br />
gleichen Grund, der auch zur Ablehnung des Beckerschen Ge-<br />
suchs führte, nicht gestattet, eine Nagelfabrik anzulegen.<br />
Das Staatsministerium schloß sich der Ansicht der Regierung<br />
an und schlug den Rekurs des ehemaligen Schmiedegesellen<br />
ab. 104<br />
6.2.1.2 Möbelherstellung<br />
1846 versuchte der Magistrat, den Unterschied zwischen Fa-<br />
brikanten und Handwerkern allgemein zu bestimmen. Der Fa-<br />
104 Vgl. Resolution für die Regierung v.23.1.1856, in: Ebenda
487<br />
brikant sollte innerhalb seiner Fabrik unterschiedliche<br />
handwerkliche Tätigkeiten von Gesellen, die er als Arbeits-<br />
kräfte angestellt hat, ausführen dürfen lassen. Außerhalb<br />
des Betriebs war ihm dies nicht gestattet. Dem Handwerker<br />
war es dagegen verboten, Gesellen anderer Innungen in sei-<br />
ner Werkstatt zu beschäftigen; dafür durfte er außerhalb<br />
Arbeiten verfertigen. Indes war die mit der Begriffsbestim-<br />
mung verbundene Unsicherheit durch den Vorschlag des Magi-<br />
strats, als entscheidendes Kriterium die Ausdehnung des Ge-<br />
werbes innerhalb bzw. außerhalb des Betriebs zu wählen,<br />
nicht behoben und gab Anlaß zu weiterer Kritik. 105<br />
Der Fall des Kaufmanns Ballin, der um die Anerkennung sei-<br />
nes Möbelgeschäfts als Fabrikbetrieb bat und damit auf den<br />
Widerstand der Tischler-, Maler-, Sattler- und Schlosserin-<br />
nungen stieß, zeigt, wie schwierig es für die Behörden war,<br />
mit Hilfe idealtypisch festgelegter Merkmale Art und Weise<br />
der Produktion, des Absatzes eines speziellen Betriebs zu<br />
bestimmen. Die Regierung mahnte dann auch wiederholt eine<br />
anderweitige Ordnung des Gewerbewesens an, die nicht mehr<br />
zwischen Handwerk und Industriebetrieb unterschied. Das<br />
Haupthindernis, das sich Ballins Gesuch entgegenstellte,<br />
war, daß der Anteil an Eigenproduktion bei ihm verschwin-<br />
dend gering war. Tatsächlich bestand sein Geschäft aus ei-<br />
ner Kombination von Handel und Handwerk. Er ließ Möbel von<br />
Meistern in Oldenburg, Harpstedt und Liebenau anfertigen;<br />
bestellte bei ihnen auch Möbelteile, die er in seinem Be-<br />
trieb weiter verarbeitete, oder ließ sie die bei ihm herge-<br />
stellten Teile vollenden. Sodann verkaufte er die Produkte<br />
unter seinem Namen. 106 Auf diese Weise konnte Ballin Werk-<br />
zeug, Räumlichkeiten und Löhne einsparen und bei steigender<br />
Nachfrage - dies scheint der Fall gewesen zu sein, da viele<br />
Tischlerwerkstätten in der Zeit zur Lagerhaltung übergegan-<br />
gen waren und nicht nur einzelne Gegenstände auf Bestellung<br />
105 Vgl. Art. „Die Grenzen des Handwerks“, in: Neue Blätter<br />
für Stadt und Land v.10.6.1846, S.218f.<br />
106 Hinweise zu Umfang und Art der Produktion sowie zu den<br />
angefertigten Gegenständen bei Reinders-Düselder, C., Oldenburg<br />
im 19. Jahrhundert ... , S.131
488<br />
anfertigten - diese Form des Möbelhandels ausdehnen, indem<br />
er weitere selbständige Handwerksmeister für sich arbeiten<br />
ließ.<br />
1855 lehnte der Magistrat das Gesuch Ballins ab. Auf dessen<br />
Anfrage hin, welche Bedingungen er erfüllen müsse, damit<br />
sein Geschäft als Fabrikbetrieb anerkannt werden würde,<br />
entspann sich ein reger Gedankenaustausch innerhalb der Be-<br />
hörden über mögliche Abgrenzungskriterien. Für den Magi-<br />
strat war zum einen die Kombination verschiedener Handwerke<br />
zur Möbelherstellung innerhalb des Betriebs ausschlagge-<br />
bend; es sollte nur auf Bestellung von Wiederverkäufern<br />
oder für das eigene Verkaufslager produziert werden; Repa-<br />
raturen seien dem Handwerk vorzubehalten. 107 Das Staatsmini-<br />
sterium hob die Produktion in einem bestimmten Raum,<br />
gleichsam einer erweiterten Werkstatt, hervor, in dem Fa-<br />
brikarbeiter gegen einen bestimmten Tages- oder Wochenlohn<br />
beschäftigt werden würden; zum Wesen der Fabrik gehöre wei-<br />
terhin die Massenproduktion auf der Basis der Arbeitstei-<br />
lung; daraus folge wiederum, daß in der Regel nicht auf Be-<br />
stellung einzelner Privatpersonen gefertigt werde. 108 1857<br />
wies die Regierung einen Rekurs Ballins mit der Begründung<br />
zurück, daß nach den Kriterien der Ausdehnung des Geschäfts<br />
sowie der Anwendung der Arbeitsteilung sein Betrieb nicht<br />
als fabrikmäßig gelten könne. 109 Noch im gleichen Jahr dräng-<br />
te das Staatsministerium auf eine genauere Festlegung der<br />
Merkmale einer Möbelfabrik, um den zukünftigen Fabrikanten<br />
größere Sicherheit für ihre Kapitalanwendung gewähren und<br />
sie den Protesten der Innungen entheben zu können. Der Vor-<br />
schlag des Magistrats, darüber hinaus den Begriff einer Fa-<br />
brik im allgemeinen festzulegen, wurde von der Regierung<br />
107 Vgl. Resolution des Magistrats v.8.9.1855, in: StAO<br />
Best.262-1 A, Nr.2027<br />
108 Vgl. Verfügung des Staatsministeriums v.25.2.1856,<br />
„Entscheidungsgründe in Sachen der Vorsteher der Tischler-<br />
Innung hieselbst wider den Fabrikanten A. Ballin wegen Eingriffe<br />
in die Innungsrechte“, o.D., in: Ebenda<br />
109 Vgl. Regierungsverfügung v.14.3.1857, in: Ebenda
489<br />
unterstützt, vom Staatsministerium jedoch abgelehnt. 110 Der<br />
Magistrat forderte die protestierenden Innungen auf, Ab-<br />
grenzungsmerkmale zu benennen. Ihrer Ansicht nach bildete<br />
die fabrikmäßige Produktion den genauen Gegensatz zur hand-<br />
werklichen Herstellung. Handwerksordnung und Gewohnheits-<br />
recht bezeichneten den handwerksmäßigen Betrieb, woraus<br />
sich dann von selbst die Grenzen des fabrikmäßigen Betriebs<br />
ergeben würden. Im Einzelnen wurde der Nachweis von Geld-<br />
mitteln und Kenntnissen über die im Betrieb ausgeübten Ge-<br />
werbe vom Fabrikanten gefordert; bestimmte Werkstätten müß-<br />
ten in einer Möbelfabrik vereinigt sein und unter der spe-<br />
ziellen Aufsicht des Unternehmers stehen; Massenproduktion,<br />
eine genügende Anzahl an Arbeitern, Arbeitsteiligkeit wur-<br />
den als weitere Erfordernisse genannt; ein Hauptmerkmal der<br />
Fabrik sahen die Innungen im Absatz großer Quantitäten an<br />
den Handel oder für das eigene Lager; Reparaturen wurden<br />
dem Handwerk vorbehalten; Kleinverkauf war nicht er-<br />
laubt. 111 Das Staatsministerium verwies die Regierung wieder<br />
auf den Magistratsbescheid vom 8.9.1855, der durchaus als<br />
Grundlage für die Festlegung des Begriffs einer Möbelfabrik<br />
dienen könnte. Die zur Eigenproduktion von Möbeln aus Roh-<br />
material bis zur Vollendung erforderlichen Voraussetzungen<br />
(Werkzeuge; eigene Arbeitskräfte; zusammenhängende Werk-<br />
stätten der verschiedenen bei der Möbelherstellung tätigen<br />
Handwerker, wie Tischler, Sattler, Drechsler, Schlosser und<br />
Maler) müßten nachgewiesen werden. 112 Ballin selbst kriti-<br />
sierte die starre Begriffsbildung der Innungen. Die soge-<br />
nannte Massenproduktion müsse je nach Art und Gegenstand<br />
der Fabrikation näher bestimmt werden ( die Herstellung<br />
größerer Produkte in Maschinen- und Wagenfabriken würde<br />
110 Vgl. Regierungsverfügung v.12.6.1857, Magistratsbericht<br />
v.24.6.1857, Regierungsbericht v.11.7.1857, Verfügung des<br />
Staatsministeriums v.22.7.1857, in: StAO Best.70, Nr.6534<br />
111 Vgl. Eingabe der Schlosser-, Maler-, Sattler- und Tischlerinnungen<br />
betr. die Unterscheidung des fabrikmäßigen Betriebs<br />
eines Gewerbes v.15.7.1857, in: StAO Best.262-1 A,<br />
Nr.2027<br />
112 Vgl. Verfügung des Staatsministeriums v.22.7.1857, in:<br />
Best.70, Nr.6534
490<br />
doch begrenzt sein, ähnlich wie in Möbelfabriken die Her-<br />
stellung von Sofas etc.); eine Fabrik verkaufe nicht nur an<br />
Wiederverkäufer oder nur in größeren Quantitäten (die Bor-<br />
sigsche Maschinenfabrik in Berlin verfertige eine einzelne<br />
Maschine für jede beliebige Privatperson sogar auf Bestel-<br />
lung; Ackergeräte, Wagen, Waffen, auch Bier, Branntwein,<br />
Papier könnten in kleinster Verpackung direkt von den Fa-<br />
briken bezogen werden).Die technische Leitung durch den Un-<br />
ternehmer sowie die Produktion in einer Anstalt seien nicht<br />
erforderlich. Ballin sprach sich darüber hinaus gegen die<br />
Festlegung bestimmter Werkstätten innerhalb der Fabrik aus.<br />
Es müsse der freien Entscheidung des Unternehmers überlas-<br />
sen bleiben, welche Werkstätten er überhaupt einrichte -<br />
dies hänge davon ab, welche Gegenstände hergestellt werden<br />
sollten - und welche Arbeiter er zusammen arbeiten ließe,<br />
also wie er den Produktionsablauf gestalten wolle. Schlös-<br />
ser, Schlüssel und Beschläge seien fertig im Handel zu be-<br />
ziehen. Die einzige Schlosserarbeit, die bei der Anferti-<br />
gung von Möbeln vorkomme, „[...] auf kaltem Wege dünne Ei-<br />
senstangen zu Divan- und Stuhlgestellen zu biegen [...]“ 113 ,<br />
sei beispielsweise leicht in der Tischler- oder Drechsler-<br />
werkstatt durch einen beliebigen Arbeiter zu erledigen.<br />
Seine spezielle Produktionsweise rechtfertigte er damit,<br />
daß es jedem Bürger zustehen würde, bei einem Meister ar-<br />
beiten zu lassen. Wenn auch die auswärtige Arbeit seines<br />
Betriebes nicht als fabrikmäßig bezeichnet werden sollte,<br />
so sei sie doch erlaubt: Handel und Fabrik dürften nach der<br />
städtischen Gesetzgebung von jedem Bürger betrieben werden<br />
( bedürften also keiner Konzession). In Anspielung auf das<br />
Verbot, einzelne Produkte auf Bestellung von Privatpersonen<br />
herzustellen, nannte er hiesige Seifenfabriken und Bier-<br />
brauereien, die durchaus in sehr kleinen Mengen Privathaus-<br />
halte belieferten. Der ausschließliche Verkauf an Wieder-<br />
verkäufer und in großen Quantitäten sei kein wesentliches<br />
Merkmal der Fabrik. Weiterhin lehnte Ballin den Nachweis<br />
113 Erklärung A. Ballins v.31.7.1857, in: StAO Best.262-1 A,<br />
Nr.2027
491<br />
bestimmter finanzieller Mittel ab. Der Gesetzgebung stehe<br />
es nicht zu, Umfang und Art der Geldmittel zur Betreibung<br />
einer Fabrik festzulegen. Der Umfang der Investition hänge<br />
von der geplanten Ausdehnung des Betriebs bzw. diese von<br />
den vorhandenen Geldmitteln ab. Auch eine genaue Anzahl der<br />
erforderlichen Arbeiter zu bestimmen, sei nicht möglich. Im<br />
Ergebnis hielt Ballin viele der von den Innungen angespro-<br />
chenen Punkte für unpraktikabel und unnötig. Als wesentli-<br />
che Unterscheidungsmerkmale ließ er das Verbot von Repara-<br />
turen und die Verfertigung einzelner Gegenstände auf Be-<br />
stellung von Privatpersonen gelten; alles andere sei unzu-<br />
lässige Einmengung in rein betriebliche, also unternehmeri-<br />
sche Entscheidungen. Seiner Ansicht nach würde er automa-<br />
tisch eine Fabrik betreiben, wenn er nur die beiden genann-<br />
ten Grundbedingungen erfüllte. In der Eigenproduktion von<br />
Möbeln sah er dann folgerichtig keinen Eingriff in die Ge-<br />
rechtsame der Handwerker. Finanzierung, Leitung, Produkti-<br />
onsorganisation, ihr konkreter Ablauf und Umfang, die An-<br />
stellung von Arbeitskräften waren dem Fabrikanten zu über-<br />
lassen. Im Prinzip stellte er jedoch damit das Handwerk als<br />
eigene geschützte Betriebs- und Rechtsform in Frage: der<br />
von Ballin beschriebene Spielraum der Fabrik ließ nämlich<br />
auch handwerksmäßige Arbeit (kaum Arbeitsteilung, wenige<br />
Werkstätten, wenige Arbeiter, Einzelproduktion oder Her-<br />
stellung in geringen Quantitäten) zu. Zwar stand den Innun-<br />
gen nicht das ausschließliche Recht zu, ihr Handwerk in der<br />
Stadt zu betreiben, denn Fabriken durften die in den jewei-<br />
ligen Arbeitsbereich fallende Produkte herstellen. Dies<br />
sollte allerdings „fabrikmäßig“ geschehen. Ballin negierte<br />
eine spezielle industrielle Produktionsform.<br />
Der Magistrat versuchte indes vergebens eine Einigung zwi-<br />
schen den Innungen und Ballin herbeizuführen. Im August<br />
1857 wurden beide Parteien vorgeladen. Streitpunkte blieben<br />
die Forderung nach einer räumlich zusammenhängenden An-<br />
stalt, die ausdrückliche Benennung der Werkstätten in der<br />
Fabrik und die Vorgabe von Produktionszahlen (Möbel jeder<br />
speziellen Art, wie Sekretäre, Schränke, Sofas sollten je-
492<br />
weils in mindestens sechs Exemplaren - Stühle, Tische min-<br />
destens dutzendweise vorrätig sein). 114 In einem Berichtsent-<br />
wurf an die Regierung kommentierte der Magistrat die strit-<br />
tigen Punkte. Den von den Innungen geforderten Quantitäten<br />
sei zuzustimmen. Selbst die „hiesigen besseren Tischler“<br />
fertigten nie nur einzelne Stücke an. Außerdem diene die<br />
Vorgabe dazu, das von den Innungen am meisten gefürchtete<br />
Arbeiten auf Bestellung einzelner zu erschweren. Der Magi-<br />
strat stimmte auch einem räumlich zusammenhängenden Betrieb<br />
zu, weil dadurch eher gewährleistet sei, daß die Gegenstän-<br />
de durch eigene Arbeitskräfte hergestellt werden würden.<br />
Auf diese Weise könne keine auf fremde Rechnung betriebene,<br />
für die Fabrik arbeitende Werkstätte als ein Teil der Fa-<br />
brik ausgegeben werden.<br />
„Gerade von Ballin fürchten die Handwerker, daß er<br />
sich einen Malermeister, einen Schmiedemeister verschaffen<br />
wird, der für eine angemessene Vergütung<br />
oder aus brüderlicher Liebe angeben, daß ihre Werkstätte,<br />
ihre Gesellen für Ballin arbeiten, während<br />
sie in der That für des Meisters Rechnung arbeiten,<br />
der seinerseits Ballins Bestellungen ausführt“ 115 .<br />
Daß die einzelnen Werkstätten in einer Möbelfabrik im vor-<br />
aus festgelegt werden sollten, lehnte auch der Magistrat<br />
ab. Eine Möbelfabrik müsse nicht alle Arten von Möbeln her-<br />
stellen; spezialisiere sie sich auf Stühle, so seien<br />
Schlosser entbehrlich; produziere sie dagegen ausschließ-<br />
lich Sekretäre und Sofas, würden Maler bzw. Polsterer über-<br />
flüssig sein. Nachdem der Stadtsyndikus Verhandlungen und<br />
Entwurf gelesen hatte, legte er seine Ansicht schriftlich<br />
nieder. 116 Für ihn war wesentliches Merkmal einer Fabrik, daß<br />
die verschiedenen Gewerbe zur vollständigen Herstellung von<br />
Möbeln regelmäßig tätig waren. Doch auch einzelne Arbeiten<br />
dürften durch nicht der Fabrik angehörende Meister verfer-<br />
tigt werden. Die gewerblichen Tätigkeiten müßten näher<br />
114 Vgl. Magistratsprotokoll v.25.8.1857, in: Ebenda<br />
115 Berichtsentwurf des Magistrats o.D., in: Ebenda<br />
116 Vgl. Zirkularschreiben des Stadtsyndikus L. Strackerjan<br />
v.27.8.1857, in: Ebenda
493<br />
festgelegt werden. Tischler-, Maler-, Sattler- und Tapezie-<br />
rerarbeit rechne er dazu, nicht jedoch Schlosser- und<br />
Drechslerarbeit, die im Handel fertig gekauft und von hie-<br />
sigen oder auswärtigen Drechslern geliefert werden könnte.<br />
Strackerjan sprach sich für zusammenhängende Betriebsräume<br />
aus. Das Verbot, auf Bestellung zu arbeiten, hielt er für<br />
nicht durchführbar. Auch die geforderte Beschränkung, Repa-<br />
raturen ausschließlich durch Handwerker erledigen zu las-<br />
sen, beurteilte er skeptisch. Die Regierung habe eben dies<br />
erst der hiesigen Wagenfabrik gestattet. Der Ansicht, daß<br />
es Fabriken auferlegt werden müsse, ausschließlich in gro-<br />
ßen Quantitäten zu produzieren, schloß er sich nicht an.<br />
Dies würde zu sehr willkürlichen und beengenden Vorschrif-<br />
ten für die Fabrik führen. Die Positionen der Magistrats-<br />
mitglieder zu den zwischen Innungsvorstehern und Ballin<br />
verhandelten Punkten wichen im endgültigen Bericht an die<br />
Regierung von denen im Entwurf geäußerten noch einmal<br />
ab. 117 Nun meinte die Mehrheit des Magistrats, daß in einzel-<br />
nen Fällen der Fabrikant das Recht habe, nicht der Fabrik<br />
angehörende Handwerksmeister beispielsweise für Bildhauer-<br />
oder Vergolderarbeiten zu beschäftigen. Ein Teil dieser<br />
Mehrheit wollte im Einzelfall entscheiden, welche Arbeiten<br />
als der Fabrik zugehörig anzusehen seien; der andere Teil<br />
glaubte, um den sich wiederholenden Streitigkeiten vorzu-<br />
beugen, dies im voraus prinzipiell festlegen zu müssen. Ei-<br />
ne Minderheit sprach sich jetzt immerhin für Ausnahmerege-<br />
lungen vom Verbot des Verkaufs auf Bestellung von Einzel-<br />
personen aus. Von diesem Verbot sollten größere und kost-<br />
spieligere Produkte ausgenommen sein. Die Vorgabe von Pro-<br />
duktionsmengen wurde nicht mehr einstimmig bejaht. Eine<br />
Minderheit meinte, daß das Erfordernis zusammenhängender<br />
Betriebsräume nicht notwendig aus dem Begriff der Fabrik<br />
hervorgehe. Dieser Punkt sei genausowenig gerechtfertigt<br />
wie die Festlegung bestimmter Werkstätten im voraus.<br />
Schließlich mahnte der Magistrat, übereinstimmend mit der<br />
117 Vgl. Magistratsbericht v.12.12.1857, in: Ebenda
494<br />
Regierung, eine Revision der Gewerbeverfassung an, um der<br />
Diskussionen über Abgrenzungskriterien zukünftig enthoben<br />
zu sein. Ballin selbst mußte am Ende die Werkstatt im eige-<br />
nen Hause schließen, sein Geschäft war nicht als Fabrikbe-<br />
trieb anerkannt worden.<br />
6.2.1.3 Regelung der Arbeitsverhältnisse in Tabak- und an-<br />
deren Fabriken 1856/57<br />
Nachdem verschiedene Gesuche um Fabrikkonzessionen sowie<br />
die Zuteilung von handwerklich ausgebildeten Arbeitskräften<br />
an Industriebetriebe ausführlich behandelt worden sind,<br />
soll an dieser Stelle kurz ein Blick auf die spärlichen<br />
Hinweise staatlicher Überlegungen in den Akten zur Regelung<br />
der Binnenverhältnisse zwischen Arbeitgeber und Arbeitern<br />
geworfen werden.<br />
Das Augenmerk der oldenburgischen Behörden richtete sich<br />
zunächst auf „das Neue an der Fabrikarbeit“: die industri-<br />
elle Frauen- und Kinderarbeit war durch die Herauslösung<br />
der Arbeit aus dem Familienverband und der damit verbunde-<br />
nen Konstituierung der Arbeit als einer separaten und zu-<br />
gleich kollektiven Sphäre im zentralisierten Betrieb sicht-<br />
barer, auffälliger und eindimensionaler geworden. In der<br />
Zusammenarbeit von Frauen und Männern sahen die Zeitgenos-<br />
sen eine Gefährdung der Sittlichkeit. Daß Kinder der elter-<br />
lichen und der schulischen Erziehung durch die Fabrikarbeit<br />
entzogen wurden, bot Ansatzpunkte für moralisch und pädago-<br />
gisch gefärbte Kritik. Die Gefahr der Verwahrlosung und ho-<br />
her künftiger sozialer Kosten wurde in der Öffentlichkeit<br />
betont. 118<br />
118 Vgl. Kocka, J., Arbeitsverhältnisse ... , S.467ff. K.<br />
geht es, gemäß seines Ansatzes, bei der Schilderung der<br />
Entwicklung der industriellen Frauen- und Kinderarbeit darum,<br />
wie Lohnarbeit sich hier gestaltete, ob sie Geschlechts-<br />
und Lebensphasenunterschiede ausglich. Er kommt<br />
zu dem Ergebnis, daß beide Gruppen aus wirtschaftlichen Er-
495<br />
In einem Schreiben an die Polizeidirektion in Bremen erbat<br />
sich der Magistrat Auskunft darüber, ob die Beschäftigung<br />
von Wickelmacherinnen in Zigarren- und Tabakfabriken zu Un-<br />
zuträglichkeiten geführt habe. Da die Behörde sich in der<br />
Absicht, möglichen Unruhen oder Störungen in Oldenburger<br />
Fabriken vorzubeugen, über die Verhältnisse in anderen Län-<br />
dern informieren wollte, wurde auch nach gesetzlichen Maß-<br />
nahmen und ihrer Wirkung gefragt. Bremen antwortete, daß<br />
1842 eine Verordnung erlassen worden war, die nicht nur die<br />
Zusammenarbeit von Frauen und Männern in Tabakfabriken,<br />
sondern die Beschäftigung von Arbeiterinnen überhaupt in<br />
diesem Gewerbezweig verbot. Allerdings war die Anwendung<br />
wegen des Protests der Fabrikanten bis 1853 hinausgeschoben<br />
worden. Die Begründung für das Verbot erscheint besonders<br />
aus heutiger Sicht interessant: die Polizeidirektion pro-<br />
gnostizierte neben den Gefahren für die Sittlichkeit auch<br />
die Möglichkeit der Erwerbslosigkeit für Arbeiterinnen<br />
durch den dequalifizierenden Einfluß ihrer Tätigkeit in der<br />
Fabrik. Stocke einmal die Fabrikarbeit, so seien viele<br />
Frauen nicht mehr in der Lage, auf die „weiblichen Fertig-<br />
keiten“ zurückzugreifen, die ihnen sonst einen Zuverdienst<br />
und das Führen eines Haushalts ermöglicht hätten. Diese<br />
traditionelle Form privaten Wirtschaftens aus der Familie<br />
heraus wurde, so scheint es, als weit sicherer ökonomischer<br />
Rückhalt und als eine für weibliches Leben adäquatere Da-<br />
seinsform, weil wohl zu dieser Zeit allgemein verbreitet,<br />
eingeschätzt. 119 Wenig später lud der Magistrat die Tabakfa-<br />
fordernissen heraus zwar Erwerbsarbeit in der Fabrik aufnahmen,<br />
jedoch die überkommene Ungleichheit durch die Art<br />
der Beschäftigung und die Höhe der Entlohnung bestätigt<br />
wurde. Die spezifische Situation der Fabrikarbeiterinnen<br />
sowie die überwiegend ablehnende Haltung der männlichen Arbeiter<br />
erschwerte jede Solidarisierung oder Organisierung<br />
in der entstehenden Arbeiterbewegung.<br />
Frauen- und Kinderarbeit war schon vor der Industrialisierung<br />
in Landwirtschaft, Heimgewerbe und häuslichen Diensten<br />
weit verbreitet. Die Beschäftigung in diesen traditionellen<br />
Sektoren überwog auch später (vgl. Ebenda, S.466).<br />
119 Vgl. Schreiben des Magistrats an die Polizeidirektion in<br />
Bremen v.8.5.1856, Antwortschreiben der Polizeidirektion<br />
v.26.5.1856, in: StAO Best.262-1 A, Nr.1997
496<br />
brikanten Troebner und Schrimper vor. Der letztere arbeite-<br />
te ohne weibliche Hilfskräfte. Beide sprachen sich für die<br />
Beschäftigung von Wickelmacherinnen aus, um gegenüber der<br />
Konkurrenz in den umliegenden Staaten bestehen zu können,<br />
die es Frauen gestattete, in Tabakfabriken zu arbeiten. Ar-<br />
beiterinnen bekämen niedrigeren Lohn als ihre männlichen<br />
Kollegen, seien geschickter und akurater sowie folgsamer.<br />
Solange sich keine unsittlichen Folgen aus dem Arbeitsver-<br />
hältnis ergeben würden, sollte kein Verbot ausgesprochen<br />
werden. Solche Situationen würden jedoch nach ihrer Ein-<br />
schätzung schwerlich eintreten, da die Wickelmacher fleißig<br />
und sparsam seien, die freie Zeit zu häuslichen Arbeiten<br />
benutzten. Manche arbeiteten auch zusammen mit ihren Frau-<br />
en. 120<br />
Der Magistrat verfolgte die Sache weiter, indem er auch die<br />
Polizeidirektion in Hannover anschrieb und um Auskunft bat.<br />
Hier war die Verwendung weiblicher Arbeitskräfte, auch eine<br />
räumlich getrennte Beschäftigung in Fabriken wie in Olden-<br />
burg nicht verboten worden. „Grobe Unsittlichkeiten“, wie<br />
in Bremen, kämen nicht vor. Die geringe Anzahl der Zigar-<br />
renarbeiterinnen würde nicht dem Wickelmachen, sondern dem<br />
Zurichten der Blätter zugeteilt werden. Außerdem erhielten<br />
sie seit 1855 bei ihrem Abgang ein Zeugnis des Fabrikanten.<br />
Die Forderung nach Abschaffung der Wickelmacherinnen, wie<br />
sie 1848/49 von der Zigarrenarbeiterverbindung erhoben wur-<br />
de, sei in den letzten Jahren nicht mehr laut gewor-<br />
den. 121 Hannover hielt eigentlich die Trennung von Frauen und<br />
Männern bei der Arbeit für wünschenswert, stieß aber auf<br />
den Widerstand der Fabrikanten.<br />
Der Magistrat ließ es dabei bewenden und forderte von den<br />
Tabakfabrikanten, daß sie künftig jedes halbe Jahr ein Ver-<br />
120 Vgl. Magistratsprotokoll v.10.6.1856, in: Ebenda<br />
121 Vgl. Rückschreiben der Polizeidirektion Hanover<br />
v.7.7.1856, in: Ebenda; vgl. dazu Lenger, F., Sozialgeschichte<br />
der deutschen Handwerker ... , S.83; die Zigarrenarbeiter<br />
versuchten mit Forderungen nach Beschränkung der<br />
Lehrlingszahlen und der Abschaffung der weiblichen Hilfskräfte,<br />
ähnlich wie die Handwerksmeister, sich vor unliebsamer<br />
Konkurrenz zu schützen.
497<br />
zeichnis der bei ihnen beschäftigten Arbeiterinnen vorlegen<br />
sollten. In der Schrimperschen Fabrik arbeiteten 1856 acht<br />
Wickelmacherinnen. 122<br />
1858 sollte der Magistrat sich gutachtlich zu dem Antrag<br />
des Landgerichts in Varel, die Rechtsverhältnisse zwischen<br />
Arbeitern und Fabrikanten gesetzlich zu regeln, äußern. Im<br />
Vordergrund stand dabei, daß der Arbeitsvertrag der häufig<br />
in den hiesigen Fabriken arbeitenden minderjährigen Auslän-<br />
der bezüglich der eingegangenen Rechte und Verpflichtungen<br />
sowie des selbständigen Auftretens vor Gericht dem der<br />
Volljährigen gleichgestellt werden sollte. Hierzu wurde an-<br />
geregt, einige Bestimmungen der neuen Gesindeordnung auf<br />
die Fabrikarbeit anzuwenden. 123 Der Magistrat berichtete, daß<br />
auch in Oldenburg sich die Fälle häuften, bei deren<br />
Schlichtung der Mangel an einer den wirklichen Zuständen<br />
sich anschließenden Fabrikgesetzgebung deutlich empfunden<br />
werden würde. 124 Er stimmte zu, daß zunächst die Befähigung<br />
von Minderjährigen zum Abschluß verbindlicher Arbeitsver-<br />
träge sowie zur Klage und Verteidigung vor Gericht gewähr-<br />
leistet werden müsse. Dies könne aber nur in Verbindung mit<br />
der Einführung eines Arbeitsbuches geschehen, das es dem<br />
Arbeiter überhaupt erst gestatte, in der Fabrik Arbeit an-<br />
zunehmen und dort zu arbeiten. Der Magistrat sprach sich<br />
für die Anwendung der entsprechenden Artikel der Gesin-<br />
deordnung (Art.6 u.9) aus. Die vorgeschlagene Übertragung<br />
der Artikel 42 bis 46, die die Verpflichtung des Gesindes<br />
zum Schadenersatz regelten, erschien ihm weniger notwendig.<br />
Besonders den Artikel 44, der den Dienstboten im Fall, daß<br />
er in fremder Angelegenheit vor eine inländische Behörde<br />
geladen werden würde, davon entband, für eine Vertretung zu<br />
sorgen, wurde abgelehnt. Das Verhältnis zwischen Herrschaft<br />
122 Vgl. Magistratsverfügung v.26.7.1856 mit anliegendem Verzeichnis<br />
v.11.8.1856, in: Ebenda; zum Vergleich: in Hannover<br />
arbeiteten 34 Arbeiterinnen in sechs Zigarrenfabriken<br />
(vgl. Rückschreiben der Polizeidirektion Hannover ...).<br />
123 Vgl. Regierungsreskript v.18.6.1858, in: Ebenda; vgl. Gesindeordnung<br />
v.24.8.1853, in: OGBl. Bd.13/1853, S.627-657<br />
124 Vgl. Magistratsbericht v.3.9.1858, in: Ebenda
498<br />
und Dienstboten sei durch ein enges, dauerndes Zusammenle-<br />
ben bestimmt, das wechselseitige Zugeständnisse erfordere.<br />
Der Magistrat wies darauf hin, daß beispielsweise die Herr-<br />
schaft eine Krankheitswoche im Jahr bezahlen und für eine<br />
Vertretung selbst finanziell aufkommen müsse; der Dienstbo-<br />
te müsse im Gegenzug auch andere Arbeiten zu jeder Zeit<br />
übernehmen, die nicht zusätzlich bezahlt werden würden. Das<br />
Arbeitsverhältnis in der Fabrik sei eher durch die Ver-<br />
pflichtung des Arbeiters geprägt, seine Arbeitskraft für<br />
eine bestimmte Zeit täglich dem Fabrikanten zur Verfügung<br />
zu stellen. Da andere Verpflichtungen fehlten, müsse auf<br />
die genaue Einhaltung der Arbeitszeit geachtet werden. Der<br />
Magistrat sprach sich weiterhin für die Festsetzung einer<br />
beiderseitigen Kündigungsfrist aus, am angemessensten er-<br />
schien ihm die 14tägige Aufkündigung, die nach seiner<br />
Kenntnis besonders in Eisengießereien schon Verwendung ge-<br />
funden hatte. Neben Regelungen, die die Arbeitsaufnahme und<br />
den Arbeitsvertrag beträfen, müsse aber auch für die Ge-<br />
sundheit und Sittlichkeit der Arbeiter gesorgt werden. Vor-<br />
beugende gesetzliche Regelungen in dieser Richtung würden<br />
das erst im Entstehen begriffene hiesige Fabrikwesen wenig<br />
stören. Besonders jugendliche Arbeiter müßten vor der Aus-<br />
beutung ihrer Arbeitskraft durch Fabrikanten und Eltern ge-<br />
schützt werden. Daher war der Magistrat dafür, daß Kinder<br />
aus gesundheitlichen und erzieherischen Gründen vor vollen-<br />
detem 14. Lebensjahr überhaupt nicht in der Fabrik arbeiten<br />
dürften. Jugendliche von 15 und 16 Jahren sollten nicht<br />
über 10 Stunden täglich arbeiten; dies auch nur unter Aus-<br />
schluß der Nachtzeit und der Voraussetzung ausreichender<br />
Unterbrechungen. Das Zusammensein von Arbeiterinnen und Ar-<br />
beitern in der Fabrik könne nicht vollkommen vermieden wer-<br />
den; jedoch sollte Mädchen unter 16 Jahren Fabrikarbeit un-<br />
tersagt werden. Die Errichtung von Unterstützungskassen in<br />
Krankheitsfällen für alle Fabrikarbeiter wurde für wün-<br />
schenswert erklärt. Schließlich verwies der Magistrat noch<br />
auf die Gesetzgebung in anderen zumeist industriell fortge-<br />
schritteneren Ländern, von denen Teile den Oldenburger Ver-
499<br />
hältnissen leicht angepaßt werden könnten. Im Ganzen wollte<br />
der Magistrat seinen Bericht nur als Hinweis für die Ziel-<br />
richtung einer Fabrikgesetzgebung verstanden wissen; not-<br />
wendig sei aber ein schnelles Eingreifen, um Mißstände<br />
nicht erst zum Ausbruch kommen zu lassen. In der Glasfabrik<br />
zu Drielake würden jetzt schon Unbeteiligte über die langen<br />
Arbeitszeiten von dort beschäftigten Kindern klagen.<br />
Gesetzliche Maßnahmen ließen aber auf sich warten. In das<br />
Gewerbegesetz von 1861 wurde nur die Möglichkeit der Bil-<br />
dung von Unterstützungs- und Krankenkassen, einige sehr<br />
allgemein gehaltene Bestimmungen zur Beschäftigung von Kin-<br />
dern in Fabriken sowie zum Arbeitsbuch und zur Gleichstel-<br />
lung von minderjährigen Arbeitern aufgenommen. 125<br />
6.2.2 Der Stadt-Land-Gegensatz<br />
6.2.2.1 Einführung einer Gewerberekognition, Niederlas-<br />
sung von Handwerkern im Umkreis der Stadt<br />
1834 erhielt die Regierung den Auftrag, einen Entwurf zur<br />
Einführung der in der Stadtordnung angekündigten Gewerbere-<br />
kognition in den Kirchspielen Oldenburg und Osternburg<br />
abermals zu beraten. Erst im folgenden Jahr sah sich die<br />
Behörde wegen grundlegend voneinander abweichender Ansich-<br />
ten im Kollegium in der Lage, Bericht zu erstatten. 126<br />
125 Vgl. Gewerbegesetz für das Herzogthum Oldenburg<br />
v.11.7.1861 ... , S.744ff; Art. 43 sah vor, daß schulpflichtige<br />
Kinder im allgemeinen nicht in Fabriken arbeiten<br />
sollten. Ausnahmen wurden jedoch für die Beschäftigung von<br />
Kindern, welche das 12. Lebensjahr beendet hatten, gestattet.<br />
126 Vgl. Regierungsbericht v. 27.1.1835, in: StAO Best.31-13-<br />
72-10 IIIc; die Rekognition war als Entschädigung für das<br />
aufgehobene städtische Gewerbeprivileg festgesetzt worden<br />
(vgl. dazu Kap.5.3.3 Die Entschädigung für den Verlust des<br />
städtischen Gewerbeprivilegs in der Stadtordnung von 1833)
500<br />
Zunächst hatten sich Zweifel über den zur Abgabe heranzu-<br />
ziehenden Personenkreis ergeben. Die Regierung schlug vor,<br />
den erweiterten Begriff der bürgerlichen Nahrung (Art.34<br />
der Stadtordnung) auf den fraglichen Distrikt zu übertra-<br />
gen, um eine möglichst gleiche Besteuerung von Stadt und<br />
Umland herbeizuführen. Ausnahmen würden für diejenigen Be-<br />
wohner gemacht werden, die gemäß den vor der französischen<br />
Okkupation geltenden Vorschriften für den Bannbezirk ihr<br />
Gewerbe hätten ausüben dürfen.<br />
Problematisch sei dabei die Zulassung von sogenannten Bau-<br />
ernschustern und -schneidern. Seit 1814 hätten sich viele<br />
Schuster und Schneider im Umfeld der Stadt niedergelassen,<br />
die den größten Teil ihres Erwerbs aus der Stadt bezögen.<br />
Da sie aber auf dem Land wohnten, würden sie mit Hinweis<br />
auf das ehemalige Gewerbeprivileg fordern, von der Rekogni-<br />
tion befreit zu werden. Um nun die für die Landbevölkerung<br />
arbeitenden Bauernschuster und -schneider, die zumeist in<br />
den Häusern ihrer Kunden gegen Tagelohn arbeiteten, zu ent-<br />
lasten, sollten Alleinmeister oder Meister mit nur einem<br />
Lehrling nicht abgabenpflichtig sein.<br />
Über der Frage, ob es denjenigen, die die Abgabe zahlten,<br />
nicht auch gestattet werden müßte, für oder in der Stadt zu<br />
arbeiten, teilten sich die Ansichten der Mitglieder der Re-<br />
gierung. Die Majorität sprach sich mit dem Magistrat dage-<br />
gen aus. Solch eine Bestimmung würde der Intention der An-<br />
ordnung, nämlich einen Ausgleich für die ungleich verteilte<br />
Steuerlast zwischen Stadt und Land herzustellen, entgegen-<br />
stehen. Die Stadt müsse mit jährlich 4.600 Rt die Kaserne<br />
unterhalten, die Zinsen für 50.000 Rt, die zum Bau der Ka-<br />
serne und zur Anschaffung des Mobiliars dienten, zahlen.<br />
Die Kasernensteuer fiele hauptsächlich auf die Gewerbetrei-<br />
benden und bewirke neben den höheren Lebenshaltungskosten<br />
in der Stadt , daß sich die Produkte verteuerten. Die Folge<br />
sei, daß die Stadtbewohner auf dem Land Arbeiten bestellten<br />
bzw. daß sich Handwerker direkt vor der Stadt ansiedelten.<br />
Seit das Gewerbeprivileg aufgehoben worden sei, griffen die<br />
Konsequenzen der Steuerungleichheit immer weiter um sich.
501<br />
Mit Hilfe der Rekognition solle nun diese Entwicklung auf-<br />
gehalten werden. Wenn aber das Entrichten der Abgabe dazu<br />
verhelfe, in der Stadt arbeiten zu dürfen, so würden sich<br />
weiterhin viele Gewerbetreibende vor der Stadt wegen der<br />
dort immer noch geringeren Lebenshaltungskosten niederlas-<br />
sen. Auch habe die Regierung bei den Verhandlungen zur<br />
Stadtordnung die Ansicht der Vertreter der Stadt als zuläs-<br />
sig anerkannt, daß die Einführung einer Rekognition den au-<br />
ßerhalb der Stadt wohnenden Nichtbürgern zu keinerlei Be-<br />
rechtigung in der Stadt verhelfe. Nur das Recht, im ehema-<br />
ligen Banndistrikt zu bleiben, dürfte damit verknüpft sein.<br />
Auf der Grundlage dieses Einverständnisses sei die Stad-<br />
tordnung erlassen und mit ihr die Artikel 33(=Rechte der<br />
Bürger; umfaßte auch die ausschließliche Befugnis, bürger-<br />
liche Nahrung in der Stadt zu betreiben) und 105<br />
(=Einführung einer Gewerberekognition) publiziert worden.<br />
Zuletzt würden damit auch die Rechte der Innungen (Art.12<br />
HWO) verletzt sowie die Handhabung der gewerbepolizeilichen<br />
Aufsicht durch den Magistrat erschwert, wenn das Amt befugt<br />
wäre, Handwerker in der Nähe der Stadt zuzulassen, die in<br />
der Stadt die gleichen Gewerbsbefugnisse hätten wie die<br />
Bürger. Die Regierung sah voraus, daß die Stadt eher auf<br />
die Steuereinnahme verzichten würde, als daß sie die Aufhe-<br />
bung des ältesten Vorrechts der Bürger zum ausschließli-<br />
chen Gewerbebetrieb in der Stadt hinnähme.<br />
Einige Mitglieder der Regierung indessen hielten es nicht<br />
für notwendig, die Stadt zu entschädigen. Sie zweifelten<br />
daran, daß sich die Aufhebung des Gewerbeprivilegs für die<br />
Stadt und ihre Wirtschaft negativ ausgewirkt hätte und for-<br />
derten, daß zumindest die Landmeister, die der städtischen<br />
Innung beigetreten seien, auch in der Stadt arbeiten dürf-<br />
ten. Da sie die gleichen steuerlichen Verpflichtungen trü-<br />
gen wie die städtischen Meister: Einquartierungslast, Ser-<br />
vicegeld für das zweite Regiment und Landdragonerkosten,<br />
müßte ihnen auch die gleichen gewerblichen Rechte einge-<br />
räumt werden. Entgegen den Verteidigern der städtischen<br />
Vorrechte verfocht die Regierungsminorität die Befreiung
502<br />
der gewerblichen Wirtschaft von alten rechtlichen Bindun-<br />
gen. Ein Vergleich der Stadt, wie sie war, als sie noch das<br />
Gewerbeprivilegium besaß, mit ihrem jetzigen wirtschaftlich<br />
verbesserten Zustand, lasse Zweifel an den behaupteten<br />
Nachteilen der Entprivilegierung für die Stadt aufkommen.<br />
Außerdem sei Oldenburg dadurch, daß es Zentralort des Lan-<br />
des geworden sei (Sitz des Hofes und seiner Angestellten,<br />
des Militärs), längst indirekt entschädigt worden. Die er-<br />
höhte Schuldenlast der Stadt könne nicht, wie so oft getan,<br />
einfach dem Verlust des Gewerbeprivilegs zur Last gelegt<br />
werden. Hier müsse geprüft werden, ob dies nicht an einer<br />
unsachgemäßen Verwaltung liege. Auch gebe es Vorteile ge-<br />
setzgeberischer Art, die der Stadtkasse zu gute kämen: eine<br />
Abgabe, die fremde Kaufleute als Betrag zur städtischen<br />
Straßenbeleuchtung zahlen müßten, der Ertrag des Karten-<br />
stempels aus dem ganzen Land zu dem gleichen Zweck, das<br />
Octroi auf Fleisch und Torf. Anderen Städten, wie Delmen-<br />
horst, Wildeshausen oder Jever seien solche Vergünstigungen<br />
nicht zuteil geworden; im ganzen Land herrsche ohnehin die<br />
Meinung vor, daß Oldenburg sehr bevorzugt werden würde. 127<br />
Diese fortschrittlichen Stimmen fanden jedoch kein Gehör.<br />
Das Staatsministerium beharrte auf dem Entschädigungsprin-<br />
zip; Gewerbebefugnisse in der Stadt könnten durch die Ent-<br />
richtung der Abgabe nicht erworben werden. Entgegen dem<br />
Vorschlag der Regierungsmajorität sollten jedoch nur dieje-<br />
nigen Personen, denen erst die Aufhebung des Gewerbeprivi-<br />
legs es ermöglicht hatte, ihr Gewerbe im Umkreis der Stadt<br />
auszuüben, eine Entschädigung zahlen. Da die Genannten hin-<br />
sichtlich ihrer Gewerbebefugnisse nicht als gleichberech-<br />
tigt mit den gewerbetreibenden Bürgern der Stadt angesehen<br />
werden könnten, würde von ihnen auch nicht die volle Summe<br />
127 Vgl. Votum der Regierungsräte Hakewessell, Jürgens und<br />
von Lützow, in: Ebenda, Anhang C zum Regierungsbericht<br />
v.27.1.1835
503<br />
des Quartiergeldes verlangt werden. 128 Damit wurde die Reko-<br />
gnition 1835 in Kraft gesetzt.<br />
Die Gewerbetreibenden im Umkreis der Stadt wurden zu Beginn<br />
der 50er Jahre erneut Diskussionsgegenstand der staatlichen<br />
Behörden. Es ging darum, wie ihre Anzahl so zu vermindern<br />
sei, daß sie der Stadt keine Konkurrenz machten und die Be-<br />
dürfnisse des ehemaligen Bannbezirks dennoch ausreichend<br />
befriedigten. Die Befürworter einer Versorgung des Di-<br />
strikts dergestalt, daß sich Gewerbetreibende möglichst un-<br />
gehindert niederlassen könnten, sahen im unbeschränkten<br />
Austausch von Gütern die beste Möglichkeit, den Bedarf der<br />
Umwohner zu decken. Die Trennung von städtischer und länd-<br />
licher gewerblicher Wirtschaft hielten sie dabei für mög-<br />
lich. Anders die Verfechter traditionellen Wirtschaftens,<br />
die die Konzentration der Gewerbe auf die Städte, die Wah-<br />
rung ihrer Privilegien, den Austausch agrarischer Produkte<br />
des Landes gegen gewerbliche in der Stadt und die Zulassung<br />
von Gewerbetreibenden im Umland nur bei unmittelbarem Be-<br />
darf im Einzelfall befürworteten. Sie konnten sich mit ih-<br />
rer Ansicht jedoch nicht durchsetzen.<br />
Den Anlaß für eine nähere Untersuchung bildete die Inter-<br />
pretation des Art.10 HWO sowie dessen Erläuterung in der<br />
Regierungsbekanntnmachung von 1847. Die Zahl der Handwerker<br />
sollte danach im Umkreis einer halben Meile von den Städten<br />
möglichst verringert werden und hatte sich nach dem Bedarf<br />
der Bewohner des Distrikts zu richten. Das Staatsministeri-<br />
um folgerte aus dem Zusatz, daß die Behörden bei der Nie-<br />
derlassung von Handwerkern möglichst wenig eingreifen soll-<br />
ten. Nur die über den Bedarf der Umwohner hinausgehende ge-<br />
werbliche Produktion müsse verhindert werden. Da diesbezüg-<br />
lich eine Verordnung erlassen werden sollte, fragte das<br />
Staatsministerium bei der Regierung an, ob ihre Ansicht mit<br />
128 Vgl. Resolution für die Regierung v.28.2.1835, Verordnung<br />
wegen Einführung einer Gewerbs-Recognition in den Kirchspielen<br />
Oldenburg und Osternburg v.28.2.1835, in: Ebenda
504<br />
der Intention der Erläuterung übereinstimme. 129 Die Mehrheit<br />
der Regierung schloß sich der Auslegung des Art. 10 durch<br />
die vorgesetzte Behörde an. Die Minderheit sah in diesem<br />
Artikel zunächst ein althergebrachtes Privileg und wollte<br />
daran festhalten. Dieser gebe den Innungen zwar keinen<br />
Bannbezirk, aber er gewähre der Stadt und ihren Gewerbe-<br />
treibenden Schutz gegenüber der im Umland begünstigten Kon-<br />
kurrenz. Diese Gruppe wies nun auf die Schwierigkeiten hin,<br />
ländliches und städtisches Handwerk voneinander zu trennen<br />
sowie den Bedarf der Umwohner genau zu ermitteln und damit<br />
den Übergriff auf die Stadt zu verhindern. Nach den Grund-<br />
sätzen der Majorität müsse es mindestens einem Handwerker<br />
jeder Art erlaubt werden, sich in den Ortschaften des Di-<br />
strikts niederzulassen, um die angestrebte Selbstversorgung<br />
zu gewährleisten. Dabei würde nicht berücksichtigt werden,<br />
ob der Handwerker denn auch genügend Arbeit am Ort fände,<br />
um bestehen zu können. Schlösse er den Betrieb, so würden<br />
die Bewohner gezwungen sein, ihre Bedürfnisse in der Stadt<br />
zu befriedigen. Versuche er sein unzureichendes Auskommen<br />
aufzubessern, auch weil es vielleicht einheimische Konsu-<br />
menten aus Gründen der höherwertigen Qualität vorzögen, bei<br />
städtischen Handwerkern arbeiten zu lassen, werde er Ein-<br />
wohner der Stadt als Kunden gewinnen wollen. Weder das<br />
Kaufverhalten der Umwohner noch die Möglichkeit ländlicher<br />
Gewerbetreibender, mit der Stadt in Konkurrenz zu treten<br />
sei gesetzlich beschränkt bzw. verboten. Außerdem sei es so<br />
gut wie unmöglich, das Ausmaß des Bedarfs oder Verbrauchs<br />
an verschiedenen Handwerkserzeugnissen einer bestimmten<br />
Ortschaft des Distrikts sowie die Anzahl der dafür notwen-<br />
digen Handwerksmeister zu bestimmen. Der absolute Bedarf<br />
des Umlandes könne daher eigentlich nicht Maßstab für die<br />
Niederlassung von Handwerkern sein. Gestützt auf diese Ar-<br />
gumentation schlug die Minorität vor, die Zulassung im Di-<br />
strikt nur im Ausnahmefall zu bewilligen. 130 Die Mitglieder<br />
129 Vgl. Verfügung an die Regierung v.23.12.1850, in: StAO<br />
Best.31-13-68-1<br />
130 Vgl. Regierungsbericht v.19.5.1851, in: Ebenda
505<br />
des Staatsministeriums sprachen sich jedoch nach wie vor<br />
für die unbeschränktere Niederlassung aus. Buchholtz führte<br />
die auftretenden Schwierigkeiten auf die bisherige Praxis<br />
der Handwerksgesetzgebung zurück, Erzeugung und Verbrauch<br />
von Produkten möglichst durch Regulierung in Übereinstim-<br />
mung zu bringen. Schließlich sahen die Behörden aber von<br />
der Publikation einer Verfügung ab, da die künftige Gewer-<br />
beordnung auch diesen Punkt umfassen sollte. 131<br />
Schon 1835 waren bezüglich der Rekognition Stimmen laut ge-<br />
worden, die die städtischen Vorrechte, nämlich die positive<br />
Wirkung des Gewerbeprivilegs, den Anspruch auf Entschädi-<br />
gung, das exklusive Vorrecht der Bürger auf Gewerbebetäti-<br />
gung in der Stadt, in Frage stellten. Sechszehn Jahre spä-<br />
ter wurde der Rückzug des Staates aus der Wirtschaft am<br />
Beispiel der Niederlassung von Handwerkern im Umkreis der<br />
Stadt befürwortet. Der Prozeß der Deprivilegierung, der<br />
Minderung des Stadt-Land-Gegensatzes, gewann inmitten der<br />
zunehmenden gewerbefreiheitlichen Bestrebungen der Behörden<br />
Kontur. Allerdings wurde die Absicht der Regierung, Steuer-<br />
gleichheit zwischen Stadt und Umland herzustellen, nicht<br />
aufgegriffen. Anstatt, wie vorgeschlagen, die bürgerlichen<br />
Lasten auch von den Gewerbetreibenden der Kirchspiele Ol-<br />
denburg und Osternburg tragen zu lassen, wurde eine grob<br />
gestaffelte Abgabe für die Erlaubnis zum Gewerbebetrieb<br />
verlangt, die, so scheint es, als städtische Einnahmequelle<br />
kaum ins Gewicht fiel. 132 Ein darüber hinausgehendes Gewerbe-<br />
131 Vgl. Voten der Mitglieder des Staatsministeriums v.4.6.-<br />
17.6 1851, in: Ebenda<br />
132 Die Abgabe war in fünf Klassen unterteilt. In den Klassen<br />
eins bis vier mußten 1/6-4/6 des Betrags des für ein volles<br />
Haus zu entrichtenden Quartiergeldes gezahlt werden. Zusätzlich<br />
war eine fünfte Klasse eingerichtet worden, in der<br />
die Rekognitionspflichtigen nicht mehr als 36gr bis 1Rt<br />
Gold zahlten. Die Klassifikation der Gewerbetreibenden<br />
sollte sich an der „Beträchtlichkeit“ der „Ausdehnung“ ihres<br />
Gewerbes orientieren. Eine direkte progressive Besteuerung<br />
des erzielten Einkommens war somit nicht vorgesehen<br />
(vgl. Verordnung wegen Einführung eines Gewerbs-Recognition<br />
in den Kirchspielen Oldenburg und Osternburg v.28.2.1835,<br />
in: StAO Best.31-13-72-10; zur geringen Einnahme der Stadt<br />
aus der Gewerbeabgabe des Umlandes vgl. Art „Die Erweite-
506<br />
steuergesetz, das alle Gewerbetreibenden umfaßte und für<br />
das Maßstäbe der Steuergerechtigkeit oder -zumutbarkeit<br />
hätten entwickelt werden müssen, war nicht vorgesehen.Die<br />
Regierung hielt den Gegenstand für nicht wichtig genug. Den<br />
Forderungen nach rechtlichem und finanziellem Ausgleich für<br />
die Stadt hätte durch die Herstellung von mehr Steuer-<br />
gleichheit entgegengewirkt und die ländliche Gewerbeansied-<br />
lung verbunden mit mehr Freizügigkeit gefördert werden kön-<br />
nen. So aber blieben die Belange der Stadt als privilegier-<br />
ter Körperschaft weiterhin im Vordergrund der Auseinander-<br />
setzungen.<br />
6.2.2.2 Marktordnung, Mühlenzwang, „Bürgerliche Nahrung“,<br />
Besteuerung von Stadt und Umgebung<br />
Im folgenden soll anhand einiger in den Oldenburger Zeitun-<br />
gen besprochenen städtischen Belange der Frage nachgegangen<br />
werden, in welcher Form und wie stark das Bewußtsein von<br />
einem städtischen Sonderstatus gegenüber dem Umland noch<br />
ausgeprägt war. 133 Mit welchen Argumenten wurden städtische<br />
Interessen vertreten? Welche Gruppierungen innerhalb der<br />
Stadt meldeten sich zu Wort und welche Einzelinteressen<br />
spielten dabei eine Rolle? Ein besonderes Augenmerk wird<br />
darauf gerichtet werden, ob die Absicht, die Stadt als na-<br />
türlichen Mittelpunkt der Umgebung zu bewahren, schon ein-<br />
mal mit Gedanken des Gemeinwohls oder des möglichst unge-<br />
hinderten Güteraustausches über den Markt verknüpft wurde.<br />
rung der Stadtgrenzen“, in: Der Beobachter v.19.10.1849,<br />
S.358; Art. „Die Schulgeldserhöhung für das Stadtgebiet und<br />
die Osternburg“, in: Neue Blätter für Stadt und Land<br />
v.27.5.1846, S.199, Art. „Die Servicelast der Stadt Oldenburg“,<br />
in: Der Beobachter v.29.6.1849).<br />
133 Die Auswahl der in diesem Abschnitt behandelten Themen<br />
beruht auf einer systematischen Durchsicht der Jahrgänge im<br />
Zeitraum von 1833 bis 1861 und kann als repräsentativ für<br />
Auseinandersetzungen zwischen städtischen und ländlichen<br />
sowie städtischen und landesherrschaftlichen Interessen unter<br />
dem erläuterten Aspekt angesehen werden.
507<br />
Trat dagegen andererseits die bisher häufig vertretene An-<br />
sicht, daß städtische Privilegien und Institutionen in ih-<br />
rem Umfang nicht geschmälert oder verändert werden dürften,<br />
da sie quasi einen Ausgleich für die steuerliche Begünsti-<br />
gung sowie die niedrigeren Aufwendungen für den Lebensun-<br />
terhalt im Umland bildeten, zurück?<br />
Zunächst ging es darum, ob eine Verschärfung der Marktregu-<br />
larien, die den Zwischenhandel begrenzten, die Funktion des<br />
Oldenburger Wochenmarktes, den Stadtbewohnern eine große<br />
und preiswerte Auswahl landwirtschaftlicher Produkte anzu-<br />
bieten , wiederherstellen könne. Im Vordergrund steht ein<br />
Gutachten des Stadtrats M.Heinrich Rüder von 1847, in dem<br />
er die nachteiligen Folgen eines Verbots des Vorkaufs durch<br />
Händler oder Hausierer in der Stadt beschrieb. Er sprach<br />
sich dafür aus, die Attraktivität des Marktes durch mög-<br />
lichst geringe gewerbepolizeiliche Beschränkungen sowie<br />
praktische Annehmlichkeiten zu erhöhen, um möglichst viele<br />
Produzenten zu bewegen, ihre Waren in Oldenburg zu verkau-<br />
fen. 134 Ein Jahr früher hatte ein Verfechter städtischer<br />
Vorrechte für die Aufhebung des herrschaftlichen Mühlen-<br />
bannrechts in der Stadt plädiert. Im gleichen Jahr sah der<br />
Magistrat und eine Mehrheit im Stadtrat in der Beschränkung<br />
des Branntweinverkaufs einen Eingriff in das Recht des Bür-<br />
gers, Schenkwirtschaft und Kramhandel frei zu betreiben. 135<br />
Ein Streitpunkt zwischen Stadtrat und Vertretern des Stadt-<br />
134 Der Oldenburger Obergerichtsanwalt und später bekannte<br />
liberale Politiker Maximilian Heinrich Rüder gehörte seit<br />
1846 dem Stadtrat an. 1843 war er Mitbegründer der liberalen<br />
Zeitschrift „Neue Blätter für Stadt und Land“ gewesen,<br />
in denen das angesprochene Gutachten veröffentlicht wurde.<br />
Von 1844 bis 1851 leitete er die Redaktion als alleiniger<br />
Herausgeber (vgl. Friedl, H., Maximilian Heinrich Rüder,<br />
in: Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg<br />
... , S.614ff). Als Liberaler schien er sich auch<br />
an der Lehre der neuen Nationalökonomie Adam Smiths zu orientieren.<br />
135 Vgl. Regierungsbekanntmachung „betr.das Wirthschaftsgewerbe<br />
und die polizeiliche Beaufsichtigung der Wirthshäuser<br />
und Schenken, imgleichen die Einschränkung des übermäßigen<br />
Genusses des Branntweins und anderer geistiger Getränke“<br />
v.2.2.1846, in: OGBl. Bd.11/1846, S.187-197
508<br />
gebiets bildete 1846 der Plan, das Schulgeld für die höhere<br />
Bürgerschule für Auswärtige zu erhöhen. Dahinter verbarg<br />
sich die Ansicht, daß das Umland von den städtischen Ausga-<br />
ben besonders für die Verbesserung des Schulwesens profi-<br />
tiere, jedoch nicht entsprechend zu den kommunalen Steuern<br />
beitrage. Die Diskussion über die Beibehaltung oder Ab-<br />
schaffung des städtischen Octroi schlug sich in den Zeitun-<br />
gen seit 1846 nieder und zog sich hier etwa sieben Jahre<br />
hin. 136 Die Gegner der Aufhebung betonten, daß die Octroi<br />
136 Das Octroi wurde 1825 durch eine landesherrliche Verordnung<br />
als eine städtische Konsumsteuer auf Brennmaterial und<br />
Schlachtvieh eingeführt [die folgenden Ausführungen sind<br />
hauptsächlich einer Broschüre entnommen, die die Diskussion<br />
über das Für und Wider der Octroi in den 60er Jahren nochmals<br />
aufnahm und in der sich der Verfasser für die Aufhebung<br />
aussprach: vgl. Strackerjan, P.F.Ludwig , Die Consumtions-Abgabe<br />
(Octroi) der Stadt Oldenburg, Oldenburg 1865.<br />
Der Justizrat, der Mitglied des Stadtrates war und sich aktiv<br />
in der Landes- und Kommunalpolitik betätigte, hatte den<br />
Inhalt des Hefts bereits zuvor im Gewerbe- und Handelsverein<br />
vorgetragen ( vgl. Friedl, H., Peter Friedrich Ludwig<br />
Strackerjan, in: Biographisches Handbuch des Landes Oldenburg<br />
... S.711f.)]. Die Steuer auf das Schlachtvieh mußte<br />
von den Schlachtern gezahlt werden. Die Einführung frischen<br />
Fleisches in die Stadt war verboten. Den Bewohnern der<br />
Landgemeinde Oldenburg, mit Ausnahme der Bauerschaften Etzhorn,<br />
Wahnbek und Moorhausen, und der Gemeinde Osternburg<br />
war es untersagt, frisches Fleisch zum Verkauf anzubieten.<br />
1826 wurde den Städtern das Schlachten außerhalb der Stadt<br />
verboten, den Umwohnern das Schlachten für die städtische<br />
Bevölkerung untersagt. Weitere Verschärfungen folgten. Seit<br />
1854 war die Einfuhr frischen Fleisches unter bestimmten<br />
Bedingungen erlaubt; 1859 wurde das Verbot, im Umland frisches<br />
Fleisch zum Verkauf anzubieten, aufgehoben. Eine Kontrolle<br />
außerhalb des Abgabenbezirks fand somit nicht mehr<br />
statt. Die Steuer, die anfänglich zur Abtragung der Kirchenschulden<br />
verwendet werden sollte, war gegen den Widerstand<br />
der städtischen Behörden eingeführt worden. Die<br />
Schlachter baten wiederholt um die Aufhebung; 1846 erschien<br />
eine Broschüre, die sich unter dem Gesichtspunkt allgemeiner<br />
Steuergrundsätze (Allgemeinheit, Gleichmäßigkeit, Besteuerung<br />
nach dem „reinen Einkommen“ unter Abzug des Existenzminimums)<br />
für die Aufhebung des Octroi aussprach (vgl.<br />
Schmedes, L., Das Octroi in Oldenburg aus staatsrechtlichen<br />
und nationalökonomischen Gesichtspunkten beurtheilt; nebst<br />
einer Beleuchtung der daselbst bestehenden Armentaxe. Ein<br />
Vortrag, gehalten im Vereine zur Beförderung der Volksbildung<br />
in Oldenburg am 26.April 1846, Oldenburg 1846). Seit<br />
1843 sollte ein jährlicher Zuschuß aus der Octroikasse zu<br />
den Kosten der höheren Bürgerschule und der Vorschule ge-
509<br />
eine städtische Gerechtsame sei, die der Stadtkasse einen<br />
hohen Ertrag liefere sowie andererseits für den Einzelnen<br />
kaum fühlbar sei. Eine Abschaffung der indirekten Steuer<br />
käme überhaupt nur in Frage, wenn das Stadtgebiet dann zu<br />
der geplanten Einkommensteuer hinzugezogen werden würde.<br />
Auch hier herrschte die Meinung vor, daß die Bewohner des<br />
Umlandes zwar Leistungen der Stadt in Anspruch nähmen, je-<br />
doch unverhältnismäßig geringe Steuern zahlten. Die Vertre-<br />
ter des Stadtgebiets lehnten wiederum die Erweiterung der<br />
Stadtgrenzen aus Furcht davor ab, daß der wohlhabende Teil<br />
nur deswegen zur Stadt gezogen werden würde, um durch höhe-<br />
re Steuern dazu beizutragen, die städtische Abgabenlast zu<br />
erleichtern. Die Befürworter wiesen auf die ungerechte Be-<br />
steuerung und die nachteiligen Auswirkungen für die<br />
Stadtwirtschaft, insbesondere für den Fleischhandel, hin.<br />
Die Aufhebung des Octroi würde außerdem zu niedrigeren<br />
Fleischpreisen in der Stadt führen. Weitere Argumente hoben<br />
auf die Unkontrollierbarkeit von Übertretungen sowie auf<br />
die hohen Erhebungskosten der Octroi ab. Das waren die Dis-<br />
kussionsthemen, um die es ging.<br />
Rüder wies zunächst daraufhin, daß die Versorgung der Städ-<br />
te nicht mehr von den unmittelbar in ihrer Nähe angebauten<br />
Erzeugnissen abhängig sei. 137 In früheren Zeiten habe im In-<br />
leistet werden. 1845 wurde erstmals in der Bürgersammlung<br />
vorgeschlagen, anstelle des Octroi eine Vermögens- und Einkommensteuer<br />
einzuführen. Der Stadtrat wollte dies von der<br />
Erweiterung der Stadtgrenzen abhängig machen. Die Verhandlungen<br />
zogen sich lange hin. Weitere Gründe, die ein Hinauszögern<br />
der Aufhebung in den Augen der städtischen Behörden<br />
rechtfertigten, waren die in Aussicht gestellte Einführung<br />
einer staatlichen Einkommensteuer, nach der dann auch<br />
Gemeindesteuern bemessen werden könnten, sowie die Hoffnung<br />
auf eine Erleichterung der Servicelast, die alsdann eine<br />
neue direkte Steuer leichter ertragen lasse (anstelle der<br />
Servicelast war geplant, eine staatliche Grund- und Gebäudesteuer<br />
in Oldenburg einzuführen). Am 1.5.1856 wurden die<br />
Grenzen der Stadt erweitert; die Abgabe auf die Einfuhr von<br />
Brennmaterial wurde 1858 aufgehoben, die Fleischsteuer wie<br />
die Servicelast der Stadt bestanden noch in den 60er Jahren.<br />
137 Vgl. Art. „Vor- und Aufkäuferei in den Städten“<br />
(M.H.Rüder), in: Neue Blätter für Stadt und Land<br />
v.22.12.1847, S.441-444
510<br />
teresse der Bürger Vorsorge getroffen werden müssen, daß<br />
nicht durch Zwischenhandel das begrenzte Angebot an Lebens-<br />
mitteln verteuert oder Produkte in zu geringen Quantitäten<br />
in der Stadt angeboten wurden. Heute dagegen bewirkten die<br />
erweiterten Marktbeziehungen, daß landwirtschaftliche Pro-<br />
dukte in ausreichendem Maße aus entfernten Gegenden bezogen<br />
werden könnten. Eine Folge daraus sei aber auch, daß Pro-<br />
dukte des Umlandes auf anderen Wochenmärkten verkauft oder<br />
sogar exportiert würden. Niedrige Preise könnten nicht mehr<br />
über gesetzliche Beschränkungen erzielt werden; die Preis-<br />
bildung über den Markt verhelfe der städtischen Bevölkerung<br />
zu einer besseren und billigeren, auf Nachfrage beruhenden<br />
Versorgung. Um möglichst viele Produzenten nun dazu zu be-<br />
wegen, den Oldenburger Markt zu besuchen, müßte ihnen der<br />
Absatz erleichtert sowie die Möglichkeit, ihre Produkte mit<br />
Gewinn zu verkaufen, ermöglicht werden. Ein weiterer Nach-<br />
teil eines verschärften Vorkaufverbots sei, daß die Aufkäu-<br />
fer vermehrt die Erzeugnisse direkt beim Produzenten abneh-<br />
men und auf den ihnen am lukrativsten erscheinenden Märkten<br />
absetzen würden. Der Oldenburger Markt würde zum einen dar-<br />
unter leiden, daß die Produzenten der Stadt fernblieben,<br />
was vormals Krämern und Handwerkern zugute gekommen war;<br />
zum anderen würde das Angebot sinken und damit die Preise<br />
steigen, da viele Produkte exportiert würden. In Rüders Au-<br />
gen wogen diese Bedenken die Vorteile, die in der Beschrän-<br />
kung der Zahl der Hökerweiber lägen, mehr als auf. Gerade<br />
sie vermehrten die Zufuhr und beugten durch den ausglei-<br />
chenden Handel einem Schwanken der Preise vor.<br />
„Letztere Vermittler des Verkehrs sind in der That<br />
für die Verkäufer von unzweifelhaftem Nutzen. Sie sichern<br />
und erleichtern ihnen den Absatz, und wenn sie<br />
auch etwas von dem Preise der Waare, welchen diese<br />
hätten machen können, wenn sie unmittelbar an den<br />
Consumenten verkauft hätten, hinwegnehmen, so sind<br />
die Verkäufer gegen wirkliche Uebervortheilung doch<br />
durch die Existenz des Wochenmarktes und die Verstattung<br />
des eigenen Verkaufs vor den Häusern gesichert.<br />
Mittelbar verbessern jene auch den Marktpreis, weil<br />
sie ihn gleichmäßiger halten, indem sie nicht gerade<br />
an dem Tage des Einkaufs wieder zu verkaufen brau-
511<br />
chen, und auch weil ihre Concurrenz das Erkennen des<br />
richtigen Verhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage,<br />
wodurch ein natürlicher Marktpreis gebildet wird,<br />
erleichtert.“ 138<br />
Strenge Verbote würden, wie es die Erfahrung in Bremen,<br />
Hamburg, ganz Preußen gezeigt habe, die Aufkäuferei nur zu<br />
einem heimlichen Gewerbe machen und der polizeilichen Über-<br />
wachung entziehen. Die Polizei sollte sich darauf beschrän-<br />
ken, so Rüder, „unerlaubte Handlungen in ihrem Gewerbe“ so-<br />
wie „lästige Zudringlichkeit“ zu bestrafen. Er schloß sich<br />
dem Vorschlag an, die Zahl der Markttage um einen zu erhö-<br />
hen und während der Marktzeit das Verbot des Vorkaufs auf-<br />
rechtzuerhalten. 1848 wurde schließlich die Marktordnung<br />
aus dem Jahre 1801 mit dem darin vorgeschriebenen Markt-<br />
zwang aufgehoben und ein freier Marktverkehr gestattet. 139<br />
Aber schon 1854 war im „Beobachter“ die Rede von einer Pe-<br />
tition, in der 478 Einwohner ihre Wiedereinführung forder-<br />
ten. Der Verfasser des Artikels sah im Freihandel nicht das<br />
geeignete Mittel, den Markt einer kleinen Stadt, wie es Ol-<br />
denburg nun einmal sei, zu beleben. Oldenburgs Lage an der<br />
Hunte werde Kaufleute dazu verführen, Lebensmittel aufzu-<br />
kaufen und sie beispielsweise nach England zu exportieren.<br />
Um die Bürger zu schützen und die Funktion des Wochenmark-<br />
tes aufrechtzuerhalten, bedürfe es bestimmter Verbote und<br />
Bestimmungen. 140 Die Bestrebungen blieben jedoch erfolglos.<br />
In dem Artikel „Die oldenburgischen Bannmühlen“ warf der<br />
Verfasser dem Landesherrn vor, aus Gründen der finanziellen<br />
138 Ebenda, S.442f.<br />
139 Vgl. Knollmann, W., Das Verfassungsrecht der Stadt Oldenburg<br />
... , S.129; Art.14 der Marktordnung von 1801 hatte<br />
den Vorkauf sowohl an Markt- als auch an anderen Wochentagen<br />
an den Stadttoren sowie in einer Entfernung von ½ Meile<br />
von der Stadt verboten (vgl. Kammerordnung v.10.10.1801,<br />
wegen eines Wochenmarktes in der Stadt Oldenburg, in: Verzeichniss<br />
und summarischer Inhalt der in dem Herzogthum Oldenburg<br />
von 1775 bis 1811 ergangegen Verordnungen, Rescripte<br />
und Resolutionen (hg.v.Lentz), Bd.2, Oldenburg 1802,<br />
S.123).<br />
140 Vgl. Art. „Marktordnung“, in: Der Beobachter v.27.5.1854,<br />
S.167
512<br />
Einträglichkeit das herrschaftliche Mühlenbannrecht in der<br />
Stadt wiederhergestellt zu haben, obwohl die Behörden doch<br />
gegenwärtig bestrebt seien, das Wohl der ackerbau- und ge-<br />
werbetreibenden Bevölkerung zu befördern. Die drei frei be-<br />
triebenen Windmühlen würden durch das Bannrecht in ihrem<br />
Betrieb gehemmt werden. Die herrschaftliche Mühle genüge<br />
den Bedürfnissen der Einwohner durchaus nicht. 141 Die Forde-<br />
rung nach freier Konkurrenz im Müllergewerbe wurde nicht<br />
nur mit dem Hinweis auf die aktuellen Mängel der Versorgung<br />
begründet. Die Erklärung, daß auch die Ungleichmäßigkeit im<br />
Abbau von landesherrlichen und städtischen Privilegien zu-<br />
ungunsten der Stadt seit 1814 einen Ausgleich erfordere,<br />
zeugt von städtischem Selbstbewußtsein. In der unentgeldli-<br />
chen Aufhebung des Mühlenzwangs sah der Verfasser Vorteile<br />
für die bisher darunter leidenden Gewerbe, wie die der<br />
Brauer, Bäcker und Branntweinbrenner. Es sei ein Ausgleich<br />
für den aufgehobenen Bierzwang sowie für eine Bestimmung<br />
des städtischen Gewerbeprivilegs, die besagte, daß in einem<br />
bestimmten Umkreis sich diese Gewerbe nicht ansiedeln durf-<br />
ten. Die Aufhebung würde außerdem einen gewissen Ausgleich<br />
für die mit neuen staatlichen indirekten Steuern belasteten<br />
Einwohner bewirken.<br />
Eine gesetzliche Verordnung, die u.a. den Branntweinbren-<br />
nern und den Kaufleuten den Verkauf von Branntwein in<br />
kleinen Mengen nicht mehr gestatten, dies nur noch den Wir-<br />
ten erlauben wollte, wurde vom Magistrat mit der Begründung<br />
abgelehnt, daß diese Bestimmung einen Eingriff in<br />
„wohlerworbene“ Rechte der Kaufleute darstelle. 142 Ein Pro-<br />
141 Vgl. Art. „Die oldenburgischen Bannmühlen“, in: Neue<br />
Blätter für Stadt und Land v.2.9.1846, S.317-319<br />
142 Vgl. Art. „Die Regierungsbekanntmachung vom 2. Februar<br />
1846 vor dem Stadtrathe zu Oldenburg“, in: Ebenda<br />
v.28.3.1846, S.118-120; M. Heinrich Rüder, der die Beschränkung<br />
des Branntweinverkaufs als städtischen Vorrechten<br />
übergeordnete, dem Gemeinwohl verpflichtete staatliche<br />
Maßnahme verteidigte, engagierte sich in der Mäßigkeitsbewegung:<br />
von 1840 bis 1843 war er Herausgeber und Redakteur<br />
der Zeitschrift „Der Branntwein-Feind“, des Organs der<br />
nordwestdeutschen Mäßigkeitsvereine (vgl. Friedl, H., Maxi-
513<br />
tokoll, in dem verschiedene Modifikationen gefordert wur-<br />
den, lag dem Stadtrat vor, der sich nun die Frage stellte,<br />
ob Rechte der Stadt verletzt seien, ob die unter der Ver-<br />
ordnung leidenden Personen einen Anspruch auf Entschädigung<br />
geltend machen und ob die städtischen Behörden sogar den<br />
Erlaß ausgleichender Verfügungen erwirken könnten. Der Vor-<br />
stand schloß sich der Ansicht des Magistrats an, erblickte<br />
in der Verordnung darüber hinaus eine Einschränkung des<br />
Rechts aller Bürger, Schenkwirtschaft und Kramhandel zu be-<br />
treiben. Die Stadt müsse den Erhalt des Bestehenden im In-<br />
teresse ihrer gewerbetreibenden Bürger schützen. Jakob<br />
Christian Hoyer 143 sah darin, daß ein Gewerbe nicht allge-<br />
mein verboten, also der Branntweinverkauf beispielsweise<br />
den Apotheken gestattet sei, dem einen Bürger also das<br />
Recht dazu genommen und einem anderen übertragen werde, ei-<br />
ne Ungleichbehandlung vorliegen. Der Staat höre auf, die<br />
Bürger untereinander gleichzustellen. Außerdem käme das<br />
Verbot für Kaufleute, selbst unentgeldlich Branntwein aus-<br />
zuschenken, einem erheblichen Eingriff in die individuelle<br />
Freiheit gleich. Der Kaufmann verlöre eine direkte Einnah-<br />
mequelle und die Möglichkeit, andere Güter abzusetzen. Die-<br />
se Gelegenheit würde jetzt allein den Wirten verbleiben.<br />
Damit aber, daß den Kaufleuten ihr einträglichstes Geschäft<br />
genommen werden würde, sei eine Beschränkung der wirt-<br />
schaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten der Stadt verbunden.<br />
M.Heinrich Rüder übernahm die Verteidigung der Regierungs-<br />
bekanntmachung. Sonderrechte der Korporationen oder Privi-<br />
legien Einzelner könnten im Interesse des Gemeinwohls, das<br />
hier vorliege, durchaus vom Staat aufgehoben werden. Habe<br />
die Person oder Korporation für den Erwerb des Privilegs<br />
milian Heinrich Rüder, in: Biographisches Handbuch zur Geschichte<br />
des Landes Oldenburg ... , S.615).<br />
143 H. war ein angesehener und sehr umtriebiger Oldenburger<br />
Kaufmann. Er betätigte sich darüber hinaus als Fabrikant<br />
und war Mitbegründer der oldenburgischen Spar- und Leihbank<br />
1845, der Oldenburger Versicherungsgesellschaft von 1857<br />
und des Gewerbe- und Handelsvereins von 1840 (vgl. Haupt,<br />
P., Jakob Christian Hoyer, in: Biographisches Handbuch zur<br />
Geschichte des Landes Oldenburg ... , S.326f.).
514<br />
nichts gezahlt, ergebe sich auch kein Anspruch auf eine<br />
Entschädigung. Die Stadtverfassung sei nicht verletzt wor-<br />
den, da die HWO und die Stadtordnung von 1833 das sogenann-<br />
te Recht auf bürgerliche Nahrung schon beschränkt hätten. 144<br />
Dieser Ansicht schlossen sich zwei weitere Mitglieder des<br />
Stadtrats an. Gleichwohl gewannen die Verfechter städti-<br />
scher Vorrechte die Majorität im Stadtrat. Ausschlaggebend<br />
war das Argument, daß die städtischen Lasten nicht in einem<br />
entsprechenden Verhältnis zu den Rechten der Stadt stünden.<br />
Das Gewerbeprivileg sei nicht wieder hergestellt, dafür der<br />
Mühlenzwang wieder eingeführt worden, das Bürgerrecht würde<br />
mehr und mehr beschnitten werden. Folglich sei zu befürch-<br />
ten, daß die steuerlichen Belastungen zur Abwanderung er-<br />
heblicher Teile der Einwohnerschaft führten. Es wurde dar-<br />
aufhin ein Antrag an die Regierung formuliert, der auf den<br />
Schutz des Rechts auf bürgerliche Nahrung abzielte sowie<br />
die Erlaubnis für die Branntweinhersteller erbat, weiterhin<br />
ihre Spirituosen in kleinen Mengen verkaufen zu dürfen. Ob<br />
die Bestrebungen der Mehrheit des Stadtrates Erfolg hatten,<br />
konnte den Zeitungen nicht entnommen werden.<br />
Die Überlegung des Stadtrates, den Einwohnern des Stadtge-<br />
bietes und der Osternburg ein höheres Schulgeld für den Be-<br />
such der Vorschule und der höheren Bürgerschule abzuverlan-<br />
gen, beruhte darauf, daß besonders die Zunahme auswärtiger<br />
Schüler die Einrichtung einer neuen Klasse erforderte und<br />
entsprechende Folgekosten bewirkte. 145 Von der Erhöhung wür-<br />
den hauptsächlich wohlhabende Staatsbeamte betroffen sein,<br />
die aus der Stadt gezogen waren, da Gewerbetreibende ihre<br />
144 Art.54 verbot den Handwerksmeistern, Schenkwirtschaft und<br />
Kramhandel zu betreiben (vgl. landesherrliche Verordnung<br />
über die Handwerksverfassung v.28.1.1830 ... (HWO));<br />
Art.125 der Stadtordnung machte das Treiben solcher Gewerbe<br />
von einer Konzession abhängig (vgl. landesherrliche Verordnung<br />
über die Verfassung und Verwaltung der Stadt Oldenburg<br />
v.12.8.1833 ...).<br />
145 Vgl. Art. „Die Erhöhung des Schulgeldes für die Bewohner<br />
des Stadtgebiets und der Osternburg“, in: Neue Blätter für<br />
Stadt und Land v.9.5.1846, S.173-175
515<br />
Kinder kaum diese Schulform besuchen ließen. Für den Erhalt<br />
der Bürgerschule wurden Gelder aus der Octroikasse verwen-<br />
det, zu der die Bewohner des Umlandes aber nur wenig bei-<br />
steuerten. Um die mit vielfachen Steuern mehrbelasteten<br />
Bürger gegenüber den Umwohnern, denen darüber hinaus noch<br />
die Ausgaben der Stadt (für die Verbesserung der Schiff-<br />
fahrt, der öffentlichen Wege, der Schulen) zugute kämen, zu<br />
entlasten, sollte ein finanzieller Ausgleich geschaffen<br />
werden. Der Stadtrat erwartete allerdings von der ange-<br />
strebten Erweiterung der Stadtgrenzen, der Abschaffung des<br />
Octroi und der Einführung einer Einkommensteuer eine alle<br />
Beteiligten eher zufriedenstellende Lösung der Disparitäten<br />
zwischen Stadt und Umland. Die Vertreter des Stadtgebiets<br />
lehnten zunächst die Verantwortung für gestiegene städti-<br />
sche Ausgaben ab. 146 Es ginge ausschließlich darum, ob ein<br />
rechtlicher Grund vorhanden sei, der es rechtfertige, von<br />
Einzelnen höhere Schulbeiträge für ihre Kinder zu fordern.<br />
Von den städtischen Ausgaben würde den Umwohnern nichts zu-<br />
gute kommen. Was die städtischen Lasten anbetreffe, so<br />
zahlten die Handwerker als Ausgleich für das Servicegeld<br />
eine Rekognition. Das Octroi auf Brennmaterial würde inso-<br />
fern von den Umwohnern mitgetragen werden, als daß sie<br />
Feuerung aus der Stadt bezögen. Die Freiheit vom Mühlen-<br />
zwang nütze wenig, da Mehl und Brot in der Stadt gekauft<br />
würden. Der Beitrag der Umwohner zur Octroi auf frischge-<br />
schlachtetes Fleisch sei nicht, wie vom Stadtrat erklärt,<br />
unerheblich. Der einzige Vorteil, den die Bewohner der Um-<br />
gebung aus der Nähe der Stadt ziehen könnten, sei der Be-<br />
such der genannten Schule. Aber da die Bürgerschule keine<br />
ausschließlich städtische Institution, sondern gemäß ihrer<br />
Ablösung von dem hiesigen Gymnasium eine allgemeine Landes-<br />
anstalt sei, könne die Stadt daraus keine Forderung zu hö-<br />
heren Beiträgen ableiten. Die Schulrechnung erweise, daß<br />
die entstandenen Mehrkosten durchaus von den Schulgeldern<br />
bezahlt werden könnten. Wenig später erschien wiederum ein<br />
146 Vgl. Art. „Die Schulgeldserhöhung für Stadtgebiet und<br />
Osternburg“, in: Ebenda v.20.5.1846, S.187-189
516<br />
Beitrag des Stadtrates zu dem strittigen Thema, in dem die<br />
Behauptung, daß das Umland einen bedeutenden Anteil zu den<br />
städtischen Lasten beitrüge, entkräftet werden sollte. 147<br />
Der Ertrag der Rekognition sei gering, persönliche Dienst-<br />
leistungen, die die Bürger beispielsweise beim Dienst an<br />
den herrschaftlichen Spritzen unentgeldllich absolvierten,<br />
würde den Bewohnern des Stadtgebiets und der Osternburg<br />
gut bezahlt werden. Außerdem könnten die Krämer und Bäcker<br />
vor der Stadt ihr Mehl 8 bis 10% billiger haben als die in<br />
der Stadt. Schließlich forderte der Stadtrat das Umland für<br />
den Fall, daß es die gleichen Rechte bei der Nutzung der<br />
städtischen Schulanstalten beanspruchen wolle, auf, einen<br />
Antrag auf die Vereinigung von Stadt und Stadtgebiet zu<br />
stellen.<br />
Auch wenn die Octroifrage in Oldenburg nur eingeschränkt im<br />
Zusammenhang eines möglichen finanziellen Ausgleichs zwi-<br />
schen der Stadt und ihrem nächsten Umland diskutiert wurde<br />
und Lösungsversuche in den 40er bis 60er Jahren nicht über<br />
partielle Ausgleichszahlungen der Bewohner der Umgebung<br />
hinausgingen (Rekognition, höheres Schulgeld für den Besuch<br />
der Bürgerschule, so soll doch auf die weiterführende Di-<br />
mension dieser Steuerprobleme, wie sie im Preußen der Re-<br />
formzeit erwogen wurde, hingewiesen werden. Hier beabsich-<br />
tigte Hardenberg ländliche Verbrauchssteuern einzuführen,<br />
um Steuergleichheit in Stadt und Land, die er als wirt-<br />
schaftspolitische Notwendigkeit ansah, herzustellen. Das<br />
Edikt über die Konsumtionssteuern vom 28. Oktober 1810<br />
sollte die reformierte Wirtschaftsverfassung im Sinne der<br />
Gewerbefreiheit abstützen, indem damit eine wichtige Bedin-<br />
gung für die ländliche Gewerbeansiedlung geschaffen wurde.<br />
Für die städtischen Kommunen hätte dies eine steuerliche<br />
Entlastung bedeutet. 148<br />
147 Vgl. Art. „Die Schulgeldserhöhung für das Stadtgebiet und<br />
die Osternburg“ v.27.5.1846, in: Ebenda, S.199f.<br />
148 Vgl. Vogel, B., Allgemeine Gewerbefreiheit ... , S.174f.
517<br />
Die Verteidiger des Octroi betonten, daß die Verbrauchs-<br />
steuer das Fleisch und das Brennmaterial für den gewerbe-<br />
treibenden Konsumenten sowie für die ärmeren Teile der Ein-<br />
wohnerschaft kaum verteuerte. Daß besonders die Handwerker,<br />
die für die Abschaffung dieser Abgabe einträten, durch eine<br />
direkte Steuer höher belastet würden. Jetzt entrichte der<br />
Bürger etwa einen Pfennig pro Kopf (jährlich 1Rt 18gr, wenn<br />
er etwa ein halbes Pfund Fleisch täglich verzehre), später<br />
müsse er zwischen ½ % bis 2% seines Einkommens versteu-<br />
ern. 149 Der Unbemittelte könne auf steuerfreies geräuchertes<br />
Fleisch ausweichen. Das Octroi würde von den Schlächtern<br />
als eine Art Gewerbesteuer bezahlt und nicht auf den Preis<br />
umgelegt werden. Daher käme es bei der Aufhebung des Octroi<br />
kaum zu den von der Gegenseite erhofften Preisminderungen.<br />
Die Stadt hingegen müsse ihre Interessen wahren und dürfe<br />
eine Einnahme, die zugegebenermaßen ungleich erhoben würde,<br />
deswegen nicht aufgeben. Um die ärmeren Einwohner zu entla-<br />
sten, wurde in einem Artikel vorgeschlagen, das Octroi für<br />
Schweine, die von ihnen geschlachtet und selbst fett ge-<br />
macht worden waren, aufzuheben; den Betrag, von dem an Ar-<br />
149 Erläutert wurde dies folgendermaßen:<br />
Bei einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch von täglich<br />
½ Pfd.Fleisch (=180Pfd. jährlich) betrage die Steuer 1Rt<br />
18gr (=90gr). Selbst wenn der Verbrauch auf 1Pfd. täglich<br />
(=360Pfd. jährlich) steige, belaufe sich die Steuer auf weniger<br />
als 2Rt (=144gr). - Künftig müßten für 400 Rt Einkommen<br />
4Rt Steuern gezahlt werden. Für 4Rt Fleischsteuer aber<br />
könne man 864Pfd. jährlich (fast 2 ½ Pfd. täglich) Fleisch<br />
verzehren, eine Menge, die weit über dem Durchschnittsverbrauch<br />
liege. Noch deutlicher werde die Steuerlast bei einem<br />
Einkommen von 650Rt, die 9Rt betrage, wofür man 1944<br />
Pfd.Fleisch jährlich (fast 5 ½ Pfd. täglich pro Kopf) verbrauchen<br />
könne. Da aber niemand soviel Fleisch werde essen<br />
können noch brauche, sei die neue Steuer, gemessen am<br />
Durchschnittsverbrauch von Fleisch um das 5-10fache höher.<br />
- Ein Handwerker, der 12 Gehilfen beschäftige, zahle jährlich<br />
15Rt Octroi (1Rt 18gr jährlich pro Kopf), was, gemessen<br />
am Betriebsumfang, doch ein geringer Betrag sei. Der<br />
kleine Handwerker, der wenig Gehilfen beschäftige und nicht<br />
jeden Tag frisches Fleisch oder auch nur geräuchertes<br />
Fleisch kaufe, werde von der Verbrauchssteuer kaum bedrückt<br />
( vgl. Art. „Octroi“, in: Der Oldenburgische Volksfreund<br />
v.18.4.1849, S.126; Art. „Octroi“, in: Ebenda v.26.12.1849,<br />
S.424).
518<br />
mensteuer gezahlt werden mußte, zu erhöhen; das Schulgeld<br />
für die Volksschule und den Mühlenzwang aufzuheben bzw.<br />
aufheben zu lassen. 150 Befürworter des Octroi appellierten<br />
schließlich an den Gemeinsinn, an das lokale Interesse der<br />
Bevölkerung, insbesondere der sich nicht einsichtig zeigen-<br />
den Handwerker und Schlächter. Eine direkte Steuer würde<br />
die wohlhabenden Bürger stärker treffen, sie unter Umstän-<br />
den dazu verleiten, die Stadt zu verlassen. Die Stadt und<br />
ihre Gewerbetreibenden verlören Abgaben, Einkommen und Ver-<br />
mögen; der Wert der Häuser und Grundstücke sänken im Preis.<br />
Der Wohlstand der Stadt beruhe nun einmal auf den Einnahmen<br />
von den zahlreichen Staatsdienern, dem Militär und dem<br />
Hof. 151 Skepsis gegenüber der Aufhebung des Octroi regte<br />
sich auch im Hinblick auf die defizitäre Entwicklung des<br />
städtischen Haushaltsbudgets. 152 Wenn nicht nur der bedeu-<br />
150 Vgl. Art. „Die Abschaffung der Consumtions=Abgabe in Oldenburg“,<br />
in: Neue Blätter für Stadt und Land v.26.9.1846,<br />
S.355<br />
151 Seit 10 Jahren habe die Stadtbevölkerung nicht etwa zugenommen,<br />
sondern ca. um 80 Einwohner abgenommen. Der Verfasser<br />
rechnete dies den erhöhten kommunalen Abgaben zu, die<br />
sich jetzt auf 4Rt pro Kopf belaufen würden. Im Stadtgebiet<br />
bezahle man dagegen nicht einmal einen halben Rt (vgl. Art.<br />
„Octroi“, in: Der Oldenburgische Volksfreund v.18.4.1849,<br />
S.126f.).<br />
152 Die Fehlbeträge hatten sich seit 1847 wiederum vermehrt;<br />
eine ansehnliche Erhöhung der Ausgaben bei einer Verminderung<br />
der Einnahmen wurde für die nächsten Jahre erwartet.<br />
Der Mehrbetrag der Ausgaben sollte durch eine Einkommensteuer<br />
gedeckt werden. Die Stadtrechnung stellte sich<br />
1846/47 folgendermaßen dar:<br />
Ausgaben: Stadtkasse 22.255Rt 30gr (in Gold)<br />
Servicekasse 6.179Rt 34gr<br />
Octroikasse 10.800Rt 591/2gr<br />
Armenkasse 13.491Rt 471/2gr<br />
52.727Rt 36gr<br />
Einnahmen:Stadtkasse 8.069Rt 32gr<br />
Servicekasse 6.589Rt 2gr<br />
Octroikasse 5.525Rt 30gr<br />
Armenkasse __815Rt -_<br />
20.998Rt 64gr<br />
(bei Wegfall von Schulgeld für die Volksschulen<br />
des Stadtgebiets [1.350Rt] u. von Gerichtssporteln<br />
[2.000Rt])<br />
In Zukunft müßten außerdem 3.200Rt als Ausgleich für den<br />
Wegfall des Schulgeldes der städtischen Volksschulen er-
519<br />
tende Mehrbetrag der Ausgaben, sondern auch das Octroi ne-<br />
ben der Armenabgabe durch eine Einkommenssteuer finanziert<br />
werden sollten, sei dies unter Umständen eine zu hohe Bela-<br />
stung der Einwohner. 153 Viele würden die Stadt verlassen,<br />
was ihnen noch durch Umzugs- und Gewerbefreiheit künftig<br />
erleichtert werden würde. Da auch der Hauptzweck der Aufhe-<br />
bung, Lebensmittel des alltäglichen Bedarfs erschwinglich<br />
zu machen, wahrscheinlich nicht erreicht werde, sei es vor-<br />
zuziehen, eine Einnahme, an die sich die Bevölkerung ge-<br />
wöhnt habe, beizubehalten. 154 Außerdem fiele die ungerechte<br />
Verwendung von Octroigeldern für den Erhalt der höheren<br />
Bürgerschule (insges. 1.700Rt) demnächst, wenn diese vom<br />
Kreis getragen werden müßte, weg. Die Verwaltungskosten des<br />
Octroi (325Rt für den Octroidiener) wurden von den Vertei-<br />
digern für gering erachtet. 155<br />
Gegner der Erweiterung der Stadtgrenzen sprachen den städ-<br />
tischen Behörden das Recht ab, die Ausdehnung über einen<br />
Teil des Stadtgebiets zu fordern. Das Stadtgebiet habe im<br />
Hinblick auf Handel und Gewerbe weder ein städtisches Anse-<br />
hen, noch ziehe es größeren Nutzen aus städtischen Institu-<br />
wirtschaftet werden. Auch an Pacht, Spielkartenstempel,<br />
Hundesteuer etc. sei eine Verminderung der Einnahme zu erwarten;<br />
städtische Bauvorhaben (Bau von drei Brücken vor<br />
dem Haarentor, neue Brücken in der Mühlenstraße sowie vor<br />
dem Stautor; Bau von Schulgebäuden) würden die Ausgaben erhöhen.<br />
Das Defizit scheint bis auf einen Betrag von 2.000<br />
bis 3.000Rt durch außerordentliche Umlagen gedeckt worden<br />
zu sein. (Vgl. Art. „Die städtischen Gemeindelasten“, in:<br />
Neue Blätter für Stadt und Land v.4.4.1849, S.112; Art.<br />
„Octroi“, in: Der Oldenburgische Volksfreund v.18.4.1849,<br />
S.127; Art. „Octroi“, in: Ebenda v.9.5.1849, S.149f.)<br />
153 Gleichwohl gestand der Verfasser ein, daß die Erhöhung<br />
des Octroi mit dem Ziel, die Mehrausgaben auf diese Weise<br />
zu decken, eher zu einer Verminderung der Steuereinnahmen<br />
führen würde, wie es die Erfahrung in anderen Ländern gezeigt<br />
habe (vgl. Art. „Die städtischen Gemeindelasten“, in:<br />
Ebenda).<br />
154 In einem Artikel berechnete der Verfasser, daß bei einer<br />
angenommenen Octroieinnahme von 5.400Rt allein 3.400Rt vom<br />
Umland, Militär sowie Fremden, gezahlt würden. Diese bedeutende<br />
Summe dürfe nicht einfach aufgegeben werden (Vgl.<br />
Art. „Octroi“, in: Der Oldenburgische Volksfreund<br />
v.26.12.1849, S.425).<br />
155 Vgl. Ebenda
520<br />
tionen. Die Stadt hingegen würde durch den Bannbezirk für<br />
Handel und Gewerbe einen erheblichen Teil der Kaufkraft der<br />
Bewohner des Stadtgebiets an sich binden. Der Austausch von<br />
Arbeit gegen Lohn, viele Tagelöhner des Umlandes arbeiteten<br />
in der Stadt, würde sich die Waage halten. Der Umfang der<br />
kommunalen Steuern fiele allein in die Verantwortung der<br />
jeweiligen Kommune, die diese Gelder ja auch ausschließlich<br />
Gemeindebedürfnissen zugute kommen ließe. Die Klage über zu<br />
hohe staatliche Steuern sei berechtigt, wenn die Stadt im<br />
Vergleich zu anderen Landesteilen mehr zahlen müsse. Ebenso<br />
bräuchte sich das Stadtgebiet nur dann zu einer größeren<br />
Abgabenlast zu verpflichten, wenn es im Vergleich zu ande-<br />
ren Gemeinden des Landes zu niedrig besteuert sei. Auch sei<br />
es nicht richtig, daß Städter wegen der hohen Abgabenbela-<br />
stung in das Umland gezogen wären. 156 Der angestrebte An-<br />
schluß würde sich nachteilig auf die finanzielle Belastung<br />
des verbleibenden Teils des Stadtgebiets auswirken. Außer-<br />
dem würde sich in dem neuen Stadtteil wegen der abseitigen<br />
Lage nur wenig Handel und Gewerbe niederlassen. Der Verfas-<br />
ser befürwortete hingegen die eigenständige wirtschaftliche<br />
und politische Entwicklung der Stadtgebietsgemeinde, die<br />
durch die neue Gewerbeordnung sowie die revidierte Gemein-<br />
deordnung gestützt werden würde. Wenn erst einmal das Um-<br />
land den übrigen Gemeinden des Herzogtums in politischer<br />
Hinsicht gleichgestellt sein würde, entstehe auch mehr Ge-<br />
meinsinn unter den 2.000 Einwohnern. Der jetzige Gemeindes-<br />
ausschuß könne die Interessen des Stadtgebiets gegenüber<br />
den städtischen Behörden nicht wirkungsvoll vertreten.<br />
Sollte aber der wohlhabende Teil des Stadtgebiets abge-<br />
156 Seit den letzten 20 Jahren habe die Einwohnerzahl der<br />
Stadt sich erhöht; daß sich auch Städter außerhalb Oldenburgs<br />
angesiedelt hätten, sei auf die Zunahme der Bevölkerung<br />
und den naturgemäßen Druck der Ausdehnung zurückzuführen<br />
(vgl. Art. „Die Erweiterung der Grenzen der Stadt Oldenburg“,<br />
in: Neue Blätter für Stadt und Land v.11.8.1847,<br />
S.271).<br />
Die Bevölkerung der Stadt wuchs zwischen 1837 und 1855 von<br />
9.280 auf 11.370 Einwohner an (vgl. Hinrichs, E.,Krämer,R.,<br />
Reinders, C., Die Wirtschaft des Landes Oldenburg ... ,<br />
S.42).
521<br />
trennt werden, so würden diejenigen, die den Gemeinsinn<br />
fördern könnten, fehlen. Auch würde die Einbuße an Steuer-<br />
einnahmen es erschweren, notwendige Verbesserungen am<br />
Schulwesen des Umlandes vorzunehmen. Die Gegner einer Er-<br />
weiterung drangen sogar auf eine Entschädigung für die Hin-<br />
zuziehung zur Stadt und den städtischen Lasten:<br />
„Wenn auch dem Einzelnen ein Widerspruchsrecht gegen<br />
Anordnungen, welche zur Förderung des Gemein=Nutzens<br />
nöthig sind, nicht zusteht, so schließt doch diese<br />
nothwendige Unterordnung das Recht auf Entschädigung<br />
nicht aus, wenn der Einzelne zu Recht bestehende<br />
Freiheiten dem Gemein=Nutzen opfern soll.“ 157<br />
Zwei Jahre später erhielt die Diskussion über die Unver-<br />
hältnismäßigkeit der auf Stadt und Umland lastenden Gemein-<br />
deabgaben eine neue Wendung dadurch, daß der Magistrat auf<br />
Wunsch des Stadtrats eine kleine Schrift veröffentlichen<br />
ließ, in der die Ungerechtigkeit der allein auf der Stadt<br />
ruhenden Servicelast nachgewiesen wurde. Der Magistrat for-<br />
derte darin die Aufhebung der Servicelast der Stadt sowie<br />
die Vereinigung der „[...] ganz städtisch bebauten und le-<br />
diglich von Städtern bewohnten nächsten Umgebungen der<br />
Stadt (einen Theil des Stadtgebiets und des Kirchspiels<br />
Osternburg) mit der Stadt [...]“. 158 Die Anträge, die außer-<br />
dem noch die Forderung nach Abschaffung der geringen (etwa<br />
132Rt betragenden) Gewerberekognition des Stadtgebiets so-<br />
wie die nach gleicher Militärlast der Stadt mit dem Land<br />
umfaßte, sollten durch den Stadtdirektor Wöbcken im näch-<br />
sten Landtag vertreten werden. In einem Artikel versuchte<br />
nun ein Gegner der Erweiterung nachzuweisen, daß die Abga-<br />
benbelastung des Stadtgebiets im Vergleich zu der der Stadt<br />
nach Maßgabe der jeweiligen Steuerkraft nicht zu gering<br />
sei. 159 Die Stadt gebe außerdem 1.700Rt für die höhere Bür-<br />
157 Vgl. Art. „Noch ein Wort über die Ausdehnung der Oldenburger<br />
Stadtgrenzen“, in: Ebenda v.18.9.1847, S.321<br />
158 Vgl. Art. „Die Servicelast der Stadt Oldenburg“, in: Der<br />
Beobachter v.29.6.1849, S.207; auch Art. „Die Servicelast<br />
der Stadt Oldenburg“, in: Ebenda v.26.6.1849, S.204<br />
159 Der Verfasser hielt die vom Magistrat vorgenommenen Berechnungen<br />
der durchschnittlichen Pro-Kopf-Abgabenbelastung
522<br />
gerschule, 924Rt für Nachtwächter, 1.250Rt für Straßenbe-<br />
leuchtung und 1.528Rt für Straßenpflaster aus. Die Gemein-<br />
deabgaben des Stadtgebiets aber ermöglichten es nicht, Be-<br />
träge zu solchen Zwecken zu verwenden. Der Verfasser des<br />
Artikels sprach sich jedoch nicht prinzipiell gegen den An-<br />
schluß aus, sondern befürwortete ihn unter der Bedingung,<br />
daß die Stadt erst einmal ihren Haushalt mit den Vermögens-<br />
verhältnissen in Einklang und damit die Klagen der Einwoh-<br />
ner über zu hohe und ungerecht verteilte Steuern zum Ver-<br />
stummen bringen sollte.<br />
Die Befürworter der Aufhebung des Octroi monierten beson-<br />
ders die ungerechte Besteuerung, welche dem Grundsatz, wo-<br />
nach jeder nach seinen Kräften zum Gemeinwesen beizutragen<br />
habe, widerspreche. Sie besteuere die Reichen und die Armen<br />
gleich, wobei die finanzkräftigere Bevölkerung auf steuer-<br />
freies teures Fleisch ausweichen könne; die Größe der Fami-<br />
lien bzw. die Zahl der in einem Haushalt zu versorgenden<br />
Personen werde nicht berücksichtigt. Außerdem wirke sich<br />
das Octroi negativ auf den Fleischhandel und das Preisni-<br />
veau aus. Die auswärtige Kundschaft würde abnehmen und<br />
steuerfreies Fleisch außerhalb der Stadt kaufen, das Ange-<br />
bot sich dadurch in der Stadt vermindern und ein ungleicher<br />
Kampf in der Stadt gegen die Konkurrenten aus dem Umland<br />
entbrennen. Entweder würde Ware hereingeschmuggelt werden<br />
oder steuerfreie Produkte, wie Geräuchertes, in der Stadt<br />
zu einem Preis verkauft werden, den der hiesige Schlachter<br />
für Stadt und Stadtgebiet untereinander nicht für vergleichbar,<br />
da sie das Einkommen der Steuerzahler außer acht<br />
lasse. Er berechnete für das Jahr 1847/48 den Umfang der<br />
städtischen Gemeindeabgaben mit 16.746Rt 23gr; die des<br />
Stadtgebietes auf 2.165Rt 32 4/5gr. Um die Abgaben miteinander<br />
vergleichen zu können, müsse die Armensteuer, die<br />
nach dem Einkommen und nach denselben Grundsätzen in beiden<br />
Gebieten erhoben werden würde, als Maßstab herangezogen<br />
werden. Hiernach fielen 10.181Rt 52gr Armensteuer auf die<br />
Stadt, 1053Rt auf das Umland. Nach diesem Verhältnis habe<br />
das Umland, wenn die Stadt 16.746Rt 23gr zahle, 1.743 Rt<br />
44gr zu steuern. Es zahle aber sogar 2.165Rt 32 4/5gr, somit<br />
421Rt 60 4/5gr mehr als es seine Steuerkraft zulasse<br />
(vgl. Art. „Die Erweiterung der Stadtgrenzen“, in: Ebenda<br />
v.23.10.1849, S.362).
523<br />
nicht bieten könne. Die Preise für Fleisch würden sich nach<br />
der Verringerung der Unkosten durch die Aufhebung des<br />
Octroi gemäß Angebot und Nachfrage verringern. 160 Stracker-<br />
jan wies darauf hin, daß der Ertrag des Octroi im Verhält-<br />
nis zur Kopfzahl der Steuerpflichtigen und der Summe nach<br />
gesunken sei. 161 Auch im Verhältnis zum gesamten Haushalts-<br />
volumen sowie zur Steuerfähigkeit der Stadt sei die indi-<br />
rekte Steuer in ihrer Bedeutung gesunken. 162<br />
6.2.2.3 Handwerk auf dem äußeren Damm und in den Vechtaer<br />
Strafanstalten, Arbeitsbefugnisse der Maurer- und<br />
Zimmerleute sowie ausländischer Gewerbetreibender<br />
in der Stadt, die Konkurrenz ausländischer Hand-<br />
werker bei Ausschreibungen<br />
Zwei Konzessionsgesuche von Handwerkern auf dem äußeren<br />
Damm aus den Jahren 1847 und 1856 zeigen, daß die rechtlich<br />
in der HWO verankerten Abwehrmechanismen der Stadt gegen-<br />
160<br />
Vgl. Art. „Zur Octroifrage“, in: Ebenda v.25.9.1846,<br />
S.305f.; Art. „Die Octroi“, in: Ebenda v.29.9.1846,<br />
S.311f.; Art. „Die Aufhebung der Consumtions=Abgabe“, in:<br />
Neue Blätter für Stadt und Land v.30.9.1846, S.358f.; Art.<br />
„Die Octroi“, in: Der Beobachter v. 15.1.1850, S.20f.;<br />
Strackerjan, L., Die Consumtionsabgabe ... , S.18ff<br />
161<br />
1815-1832 : 4.105Rt 22gr, pro Kopf 23gr<br />
5,2sw<br />
1833-1856 (1.5.) : 4.475Rt 53gr, pro Kopf 22gr<br />
8,6sw<br />
1856-1858 (1.5-1.5) : 6.054Rt 12gr, pro Kopf 16gr<br />
9,1sw<br />
1859-1864 (1.5.-1.5.) : 5.641Rt , pro Kopf 14gr<br />
5,1sw<br />
(am 1.5.1856 fand die Erweiterung der Stadtgrenzen statt;<br />
1Rt= 72 Grote und 360 Schwaren [=sw])<br />
(vgl. Strackerjan, L., Die Consumtionsabgabe ... , S.7f.)<br />
162<br />
Vgl. Ebenda, S.24; um die Ursachen für die langwährende<br />
und hinderliche Steuerungleichheit zwischen Stadt und Umland<br />
gründlicher zu erhellen, müßte einmal gezielt das<br />
Steuersystem in städtischen und ländlichen Kommunen sowie<br />
die staatliche Steuerpolitik in Oldenburg zu dieser Zeit<br />
untersucht werden.
524<br />
über der Gewerbeansiedlung in der Umgebung noch erfolgreich<br />
angewandt wurden. 1847 bat der in der Stadt ansässige<br />
Tischlermeister Heinrich Welau darum, seine Werkstatt auf<br />
dem äußeren Damm beibehalten zu dürfen. Er habe daselbst<br />
einen Bauplatz nebst Garten erworben und ein Haus erbaut,<br />
in dem er sein Gewerbe künftig mit einem Gesellen und einem<br />
Lehrling betreiben wolle. Welau erbot sich, auch weiterhin<br />
die bürgerlichen Lasten der Stadt zu tragen. Der Magistrat,<br />
dem sich die Regierung anschloß, lehnte das Gesuch ab. Als<br />
Bürger und Mitglied der hiesigen Tischlerinnung müsse er im<br />
Innungsbezirk wohnen; Art. 10 HWO erlaube es Tischlern au-<br />
ßerdem nicht, sich im Umkreis einer halben Meile niederzu-<br />
lassen. Immerhin wurde ihm eine Frist von beinahe drei Jah-<br />
ren gewährt, nach der er erst seinen Gewerbebetrieb dort<br />
einstellen mußte. Dahinter stand die Hoffnung der Behörden,<br />
daß mit der bald zu erwartenden Erweiterung der Stadt, die<br />
dann auch den Damm umfassen würde, sich das Gesuch von<br />
selbst erledigen würde. 163 Das Konzessionsgesuch des Maurer-<br />
meisters Spieske gab den Anlaß für ein achtseitiges Schrei-<br />
ben der Regierung, in dem dem Magistrat die Gründe für des-<br />
sen Zulassung dargelegt wurden. Zunächst gebe es in der<br />
Stadtordnung kein Verbot, daß außerhalb der Stadt wohnende<br />
Personen, wie Kaufleute, Fuhrleute, Schiffer, Rechnungs-<br />
steller und Privatlehrer, in der Stadt nicht ihrem Beruf<br />
nachgehen dürften. Bürgerliche Nahrung in der Stadt zu be-<br />
treiben, sei eben nicht nur den mit dem Bürgerrecht verse-<br />
henen städtischen Einwohnern gestattet. Der Handwerksbe-<br />
trieb in der Stadt und der nächsten Umgebung hingegen werde<br />
durch die gewerblichen Berechtigungen und Privilegien der<br />
Innungen beschränkt. Auswärtigen Handwerkern sei es daher<br />
nicht erlaubt, in der Stadt zu arbeiten. Ein Ausnahme bilde<br />
jedoch das hiesige unzünftige Maurer- und Zimmergewerbe. 164<br />
163 Vgl. Magistratsbericht v.14.8.1847, Regierungsreskript<br />
v.25.8.1847, Resolution der Regierung für Heinrich Welau<br />
v.24.3.1848, Extrakt aus dem Protokoll des Stadtrats<br />
v.14.10.1848, in: StAO Best.262-1 A, Nr.2081<br />
164 Art.12,2 HWO verbot es Landmeistern, die der Innung beigetreten<br />
waren, in der Stadt zu arbeiten. Von dieser Rege-
525<br />
In den Jahren zwischen 1844 und 1855 nutzten Handwerker aus<br />
Oldenburg und Vechta die regionalen Zeitungen, um in ihren<br />
Beiträgen der Öffentlichkeit die unzulässige Konkurrenz aus<br />
den Vechtaer Strafanstalten darzulegen. 1848 wurde das The-<br />
ma von dem inzwischen gegründeten Handwerkerverein der<br />
Stadt aufgegriffen. 165 In dem an dieser Stelle zu beschrei-<br />
benden Zusammenhang trat der Verein als Organisation auf,<br />
die die lokalen wirtschaftlichen Interessen der städtischen<br />
Handwerksmeister wahrnahm. Beispielsweise wurde hier das<br />
Gesuch des Vergolders Boschen an den Magistrat, eine Möbel-<br />
fabrik zu errichten, besprochen und der Vorschlag gemacht,<br />
daß nur Gewerbetreibende zuzulassen seien, die sich der In-<br />
nung anschlössen. 166 Weiterhin wurde die mangelnde Berück-<br />
sichtigung des Oldenburger Handwerks bei Militäraufträgen<br />
in der Versammlung thematisiert. Die Behörden würden oft-<br />
mals Arbeiten im Ausland bestellen (genannt wurde die Fa-<br />
brikation von Militärschnallen in Berlin). Der Vorstand<br />
hatte ein Gesuch an das Staatsministerium gerichtet, zu-<br />
nächst das einheimische Handwerk von den erforderlichen Ar-<br />
beiten, den auswärtigen Proben und Preisen in Kenntnis zu<br />
lung waren Maurer- und Zimmerleute ausgenommen. „In den<br />
Städten giebt jedoch in der Regel, bey den daselbst früher<br />
zünftig gewordenen Handwerken, der Beytritt der Landmeister<br />
zur Gilde denselben keinesweges das Recht, auch daselbst<br />
arbeiten zu dürfen, welches nur den Maurern und Zimmerleuten<br />
ausnahmsweise zusteht“ (landesherrl. Verordnung über<br />
die Handwerks=Verfassung ... (HWO) , S.464). Vgl. Regierungsbericht<br />
v.11.2.1856, in: StAO Best.70, Nr.6668<br />
165 Das Gründungsdatum des Handwerkervereins konnte nicht genau<br />
ermittelt werden: in einem Überblick über das Vereinswesen<br />
der Stadt wurde ein Handwerkerverein (Meisterklub)<br />
für das Jahr 1845 erwähnt (vgl. Der Beobachter v.3.2.1846,<br />
S.39); zwischen 1848 und 1851 trat der Handwerkerverein als<br />
Forum vielfältiger (verfassungs-) politischer sowie wirtschaftspolitischer<br />
Aktivitäten der städtischen Handwerker<br />
hervor (vgl. Art. „Handwerker=Verein“, in: Ebenda<br />
v.26.9.1848, S.334; Art. „Der Handwerkerverein und die Gewerbeschule“,<br />
in: Ebenda v.2.9.1851, S.279).<br />
166 Die Meister hatten festgestellt, daß Fabriken eher von<br />
außerhalb der Innung stehenden Gewerbetreibenden errichtet<br />
wurden. Diese Entwicklung sollte gebremst werden (vgl. Art.<br />
„Im Handwerkerverein zu Oldenburg“ v.16.2.1849, in: Ebenda,<br />
S.54).
526<br />
setzen und möglichst den Auftrag an diese zu vergeben, auch<br />
wenn die Preise höher lägen. Nur wenn der Preisunterschied<br />
nicht in einem Verhältnis zu den Vorteilen stehe, die dem<br />
Herzogtum durch eine solche Beschäftigung erwüchsen, solle<br />
der Auftrag an auswärtige Gewerbetreibende vergeben wer-<br />
den. 167 Die Diskussion über die Vechtaer Strafanstalt wurde<br />
seitens der Handwerker von der Frage bestimmt, wie die Zie-<br />
le, die der Staat mit der anstaltseigenen Ausbildung und<br />
Beschäftigung der Sträflinge verband, mit den Erwerbsinter-<br />
essen des Handwerks in Einklang gebracht werden könnten.<br />
Daß Arbeit als Mittel eingesetzt wurde, um die Insassen mo-<br />
ralisch zu bessern und ihnen zugleich zu einem künftigen<br />
Lebensunterhalt zu verhelfen, wurde bejaht. Die Sträflinge<br />
dürften jedoch nicht zum finanziellen Nutzen der Anstalt<br />
herangebildet werden. Sie sei kein Gewerbebetrieb, sonst<br />
müßte sie es sich auch gefallen lassen, nach gewerberecht-<br />
lichen Maßstäben beurteilt zu werden. Die Kritik richtete<br />
sich dann auch hauptsächlich gegen die fabrikmäßige Betrei-<br />
bung verschiedener Handwerke in einer vom Staat betriebenen<br />
Institution. 168 1849 reichte der Handwerkerverein ein Gesuch<br />
167 Vgl. Art. „Vereine“, in: Ebenda v.27.10.1848, S.374; Art.<br />
„Handwererverein in Oldenburg“, in: Ebenda v.11.5.1949,<br />
S.151f.<br />
168 Vgl. Art. „Die Stellung der Vechtaer Strafanstalt hinsichtlich<br />
ihrer gewerblichen Thätigkeit zu dem Handwerksstande“,<br />
in: Ebenda v.28.2.1852, S.91f.<br />
Das Vechtaer Gefängnis profitierte zwar von einer Ausnahmeregelung<br />
der HWO, die besagte, daß Arbeiten, die in Strafanstalten<br />
oder öffentlichen Arbeitshäusern verfertigt würden,<br />
den ausschließlichen Berechtigungen der Innungen enthoben<br />
seien (vgl. Art.13b der Handwerksordnung von 1830),<br />
stellten jedoch zunächst wegen der Art der Beschäftigung<br />
der Gefangenen keine ernstzunehmende Konkurrenz für das<br />
Handwerk dar. Anfangs wurden die Insassen als Arbeitskräfte<br />
an Privatleute verdungen; die kurzfristigen Arbeitsverträge<br />
ließen es nicht rentabel erscheinen, Kapital in größerem<br />
Ausmaß zu investieren, um die notwendigen Werkzeuge für eine<br />
gewerbespezialisierte Produktion unter spezieller Beaufsichtigung<br />
und Unterweisung anzuschaffen. Da die Löhne vereinbart<br />
waren, konnten die Preise auch nicht erheblich gedrückt<br />
werden. Daher wurden die Gefangenen meistens zu einfachen<br />
Handarbeiten, wie Wollspinnen und Weben herangezogen.<br />
Später produzierte die Anstalt auf der Grundlage<br />
staatlichen Kapitals mit ihren eigenen Arbeitskräften (125
527<br />
bei der Regierung ein, daß doch in Zukunft keine Handwerks-<br />
gegenstände mehr in der Vechtaer Strafanstalt angefertigt<br />
werden sollten. 169 1850 wurde der Anstalt der Detailverkauf<br />
an Privatpersonen insbesondere an Einwohner der Stadt und<br />
des Amts Vechta untersagt. Der Kleinverkauf aus den Kommis-<br />
sionslagern wurde allerdings nur in Stadt und Amt Vechta<br />
verboten. Da die Anstalt von der Regierung als Fabrik ange-<br />
sehen wurde, sollten Produktion und Absatz nicht darüber<br />
hinaus beschränkt werden. 170 Das Handwerk sah diese Regelung<br />
nicht als ausreichend an: das Vechtaer Gefängnis sei in er-<br />
ster Linie eine Staatsanstalt, die der Bürger durch Steuern<br />
mitfinanziere. Der Staat habe die Aufgabe, seine Bürger in<br />
ihrem Erwerb zu schützen und sei daher nicht befugt, in<br />
Konkurrenz zu ihnen zu treten, also Handwerke zu betreiben<br />
oder Fabriken anzulegen. Die Oldenburger Handwerker monier-<br />
ten besonders, daß Kommissionslager in ihrer Stadt angelegt<br />
worden waren. 171 Ein weiteres Argument, das gegen die Ver-<br />
Gefangene, darunter 112 Männer) unter gewerbekundiger Anleitung<br />
und Aufsicht handwerkliche Gegenstände. Die Arbeitszeit<br />
betrug 14 Stunden (vgl. Art. „Ueber den Gewerbsbetrieb<br />
in den Vechtaer Strafanstalten“, in: Neue Blätter<br />
für Stadt und Land v.20.11.1844, S.438). Zehn gewerbliche<br />
Betätigungen wurden unterschieden: „1) Tuch=und Teppichweberei<br />
und Leistengarnspinnerei, 2) Leinen=und Baumwollweberei,<br />
3) Schusterei, 4) Schneiderei, 5) Tischlerei, 6) Faßbinderei,<br />
7) Kratzenmachen, 8) Seilerei, 9) Posamentirweberei,<br />
10) Drechslerei“ (Art. „Ueber den Gewerbsbetrieb in<br />
den Vechtaer Strafanstalten, in: Ebenda v.1.2.1845, S.41).<br />
Die Anstalt konnte ihre Produkte zu niedrigen Preisen verkaufen,<br />
übernahm auch Flickarbeiten und Reparaturen (vgl.<br />
Art. „Die Vechtaer Strafanstalt“, in: Der Beobachter<br />
v.17.2.1852, S.71). 1853 wurden folgende Tätigkeiten angegeben:<br />
Schuhmacher, Schmiede, Böttcher, Drechsler, Tischler,<br />
Korbmacher, Bürstenmacher, Schneider, Weber, Seiler,<br />
Holzschuhmacher, Zimmer- u. Maurerleute, Schlosser (vgl.<br />
Art. „Der Handwerksbetrieb in der Vechtaer Strafanstalt“,<br />
in: Ebenda v.23.9.1853, S.301).<br />
169 Vgl. Art. „Im Handwerkerverein zu Oldenburg“, in: Ebenda<br />
v.16.2.1849, S.54; Art. „In der Versammlung des Handwerkervereins<br />
am 26.Februar“, in: Ebenda v.9.3.1849, S.80<br />
170 Am 4.1.1850 teilte die Regierung dem Oldenburger Magistrat<br />
eine Resolution auf die Vorstellung des Vorstandes<br />
des Handwerkervereins, Tischlermeister Inhülsen und Klempner<br />
Fortmann, mit (vgl. StAO Best.262-1 A, Nr.2083e).<br />
171 Das Vechtaer Gefängnis schien besonders Aufträge des Militärs<br />
anzunehmen, z.B. die Verfertigung von Stiefeln (vgl.
528<br />
fertigung von Handwerksgegenständen in der Anstalt vorge-<br />
bracht wurde, war die vermeintlich aussichtslose Beschäfti-<br />
gungsperspektive für die in einem Handwerk ausgebildeten<br />
Sträflinge. Der ehemalige Sträfling könne weder einen Lehr-<br />
brief noch die anderen moralischen und berufspraktischen<br />
Nachweise einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung vor-<br />
weisen, um als Geselle oder Meister vom Handwerk aufgenom-<br />
men zu werden. Außerdem verletze es die Ehre des „freien,<br />
ehrlichen“ Handwerkers, wenn ausschließlich sein Stand aus<br />
der Vechtaer Strafanstalt rekrutiert würde. Eine handwerk-<br />
liche Ausbildung sollte nur denjenigen Sträflingen gewährt<br />
werden, die ein Handwerk bereits erlernt oder eine besonde-<br />
re Neigung dazu verspürten sowie Geschick dazu hätten. Al-<br />
lerdings müßten dafür keine anspruchsvollen Werkstätten<br />
eingerichtet werden; um unzulässige Konkurrenz zur bürger-<br />
lichen Gewerbstätigkeit zu beschränken, sei es ratsam, wenn<br />
der Sträfling sowohl für die Anstalt als auch außerhalb für<br />
Meister seines Handwerks arbeite. 172 Inmitten der zahlrei-<br />
chen Klagen meldete sich auch einmal eine Gegenstimme zu<br />
Wort. In einem Artikel wurde dargelegt, warum die Strafan-<br />
stalt nicht in die Arbeitsgebiete der Vechtaer Handwerker<br />
eingriffe. Sie produziere beispielsweise keine Schusterwa-<br />
ren für Privatleute, die Verwaltung beteilige sich hingegen<br />
bei öffentlichen Ausschreibungen. Die Schneiderei würde<br />
ausschließlich für die Anstalt betrieben werden. 173 Im Zu-<br />
sammenhang mit der Diskussion über die schädlichen Auswir-<br />
kungen des Gewerbebetriebs in der Vechtaer Strafanstalt<br />
wurde dann noch auf die Bedrohung durch Magazine und Fabri-<br />
Art. „Die Oldenburger Handwerker“, in: Ebenda v.3.1.1852,<br />
S.47).<br />
172 Vgl. Art. „Ueber den Gewerbsbetrieb in den Vechtaer<br />
Strafanstalten“, in: Neue Blätter für Stadt und Land<br />
v.13.3.1844, S.102f.; Art. „Die Stellung der Vechtaer<br />
Strafanstalt hinsichtlich ihrer gewerblichen Thätigkeit zu<br />
dem Handwerksstande“, in: Der Beobachter v.28.2.1852, S.91;<br />
Art. „Die Strafanstalt zu Vechta, in: Ebenda v.22.7.1853,<br />
S.230; Art. „Der Handwerksbetrieb in der Vechtaer Strafanstalt,<br />
in: Ebenda v.23.9.1953, S.302.
529<br />
ken im allgemeinen sowie durch den Deutschen Zollverein im<br />
besonderen hingewiesen, dem Oldenburg im März 1852 beige-<br />
treten war. 174<br />
Das städtische Maurer- und Zimmerhandwerk war, da beide<br />
nach 1830 keine Innungen begründet hatten, einer freieren<br />
Konkurrenz zwischen Stadt und Land ausgesetzt als die hie-<br />
sigen Zunfthandwerke. Dies drückte sich in Ausnahmeregelun-<br />
gen der HWO, die den Gesellen sowie den Landmeistern beson-<br />
dere Arbeitsbefugnisse in der Stadt einräumten. 175 Die Folge<br />
war, daß sich städtische Maurer- und Zimmermeister oft dar-<br />
über beschwerten, daß Gesellen Arbeiten ausführten, die ei-<br />
gentlich den Meistern vorbehalten waren, sowie daß sie zu<br />
mehreren Aufträge annahmen, was wiederum das ausschließli-<br />
che Recht der Meister, mit Gesellen, Lehrlingen u.a. Hilf-<br />
spersonen zu arbeiten, verletzte. Einige der zahlreichen<br />
Fälle sollen an dieser Stelle geschildert werden. 176<br />
1831 beschwerten sich auswärtige Maurergesellen, daß ihnen<br />
die Arbeit am Bau des hiesigen Bürgers Detmers untersagt<br />
worden war. Da die Handwerksordnung über die den Gesellen<br />
erlaubten Tätigkeiten keine Auskunft gab, wurde ihnen zuge-<br />
standen, die angefangene Arbeit zu beenden. Die Regierung<br />
173 Vgl. Art. „Ueber den Gewerbsbetrieb in den Vechtaer<br />
Strafanstalten“, in: Neue Blätter für Stadt und Land<br />
v.1.2.1845, S.41-43.<br />
174 Genannt wurde die „Herrn=Garderobe=Manufaktur“ in Hannover<br />
(vgl. Art. „Tages=Chronik: Handwerk hat einen goldnen<br />
Boden!“, in: Der Beobachter v.26.9.1855, S.307; Art.<br />
„Tages=Chronik: Handwerk hat goldenen Boden“ und „Handwerk<br />
sinkt! aber fällt nicht!“, in: Ebenda v.24.10.1855, S.340;<br />
Art. „Tages=Chronik: Die theure Zeit ...“, in: Ebenda<br />
v.31.10.1855, S.349).<br />
175 Maurer- und Zimmergesellen durften in der Stadt unabhängig<br />
von einem Meister selbstständig arbeiten (vgl. Art.63<br />
HWO); zu Art. 12,2 HWO, der den Landmeistern erlaubte, in<br />
der Stadt zu arbeiten vgl. Anm.164.<br />
176 Maurergesellen durften Häuser weißen sowie kleinere Reparaturen<br />
durchführen; es war ihnen aber nicht gestattet,<br />
sich zu mehreren zusammenzutun und Neubauten sowie größere<br />
Reparaturen anzunehmen (vgl. Art.3 des Maurerreglements<br />
v.21.3.1792, in: StAO Best.22, Nr.226). Selbständiges Arbeiten<br />
in der Stadt im größeren Umfang war damit an das<br />
Meisterrecht gebunden.
530<br />
bemerkte überdies kritisch, daß die Angebote der hiesigen<br />
Maurermeister für das Detmersche Haus sehr viel höher gele-<br />
gen hätten als die Kosten, für die die Gesellen den Bau nun<br />
fertigstellten. Der Magistrat wurde aufgefordert, für den<br />
Fall, daß die beschränkenden Vorschriften die Preise für<br />
Maurerarbeit in die Höhe trieben, für mehr Konkurrenz zu<br />
sorgen. 177 Im November desselben Jahres wurde das Gesuch des<br />
Maurergesellen Meiners, mit Gehilfen zu arbeiten, abge-<br />
lehnt. Meiners wandte sich daraufhin direkt an den Landes-<br />
herrn. Auch hier blieb sein Ansuchen erfolglos, jedoch wur-<br />
de ihm gestattet, einen Handlanger, also eine unqualifi-<br />
zierte Hilfskraft, anzustellen. 1835 wies die Regierung den<br />
Einspruch dreier Zimmermeister gegen eine Magistratsverfü-<br />
gung zurück, die es Landmeistern erlaubte, in der Stadt<br />
Zimmerarbeit zu verfertigen. Die dem Fall angelegten Unter-<br />
lagen zeigen, daß der Arbeitsbereich des städtischen Zim-<br />
meramts 1803 noch viel stärker gegenüber dem Landhandwerk<br />
abgeschirmt war. Ihr Privileg besagte, daß ausschließlich<br />
Bürger und Zimmeramtsmeister in der Stadt und auf dem äuße-<br />
ren Damm arbeiten durften. Landmeistern war es gestattet,<br />
bearbeitetes Bauholz in die Stadt zu liefern. Arbeiten<br />
durften im allgemeinen jedoch von ihnen nicht aufgestellt<br />
oder montiert werden; eine Ausnahme bildete das Montieren<br />
von sogenannten Kleinigkeiten. Auch war es den Einwohnern<br />
erlaubt, geringfügige Arbeiten von unzünftigen Handwerkern<br />
außerhalb der Stadt anfertigen zu lassen. 178 1844 versuchten<br />
die Maurermeister Weyhe, Högl, Spieske und Bunjes ihre<br />
177<br />
Vgl. Regierungsreskript v.28.6.1831, in: StAO Best.262-1<br />
A, Nr.2081<br />
178<br />
1793 bat das Zimmeramt, daß die ausschließliche Berechtigung<br />
seiner Mitglieder, Zimmerarbeit zu verfertigen auf den<br />
äußeren Damm ausgedehnt werde. In diesem Zusammenhang wurde<br />
außerdem ein Banndistrikt außerhalb der Stadt sowie eine<br />
genauere Regelung der Grenzen zwischen den Arbeitsbereichen<br />
der Tischler und Zimmermeister gefordert. Die Kammer bewilligte<br />
die Ausdehnung des Privilegs und erließ ein Regulativ<br />
über Zimmer- und Tischlerarbeit. Ein Banndistrikt wurde<br />
nicht gewährt (vgl. Kammerreskript v.25.6.1803, Kammerprotokoll<br />
v.24.10.1793, Regierungsresolution v.17.7.1835, in:<br />
Ebenda).
531<br />
Handwerksbefugnisse auf das Umland auszudehnen, was abge-<br />
lehnt wurde. Der Schutz beziehe sich nur auf die Stadt und<br />
die Vorstädte. Hier dürften allerdings nur Bürger und Mau-<br />
rermeister die Maurerprofession ausüben. Indem der Magi-<br />
strat das Recht auf bürgerliche Nahrung nur den Bürgern zu-<br />
gestanden wissen wollte, ließ er nicht nur die seit 1830<br />
geltende Bestimmung über das Arbeiten von Landmeistern des<br />
Maurerhandwerks in der Stadt außer acht, sondern schränkte<br />
Handel und Gewerbe auch unzulässig ein. Die Regierung<br />
schloß sich allerdings zu diesem Zeitpunkt der Interpreta-<br />
tion der Schutzbestimmungen durch den Magistrat an. 179 Die<br />
nicht abreißende Kette von Beschwerden zeigt, wieviel Unsi-<br />
cherheit sowohl bei den betroffenen Maurer- und Zimmerge-<br />
sellen über den Umfang ihrer Arbeitsbefugnisse, als auch<br />
bei den Behörden in bezug auf die rechtlichen Grundlagen<br />
ihrer Beurteilung herrschte. Daß oft die bürgerliche Rechte<br />
nicht genügend von den Innungsrechten getrennt wurden, war<br />
schon bei der Behandlung der Klagen über das Arbeiten von<br />
Landmeistern in der Stadt sichtbar geworden. Einige Bei-<br />
spiele zeigen dann auch, daß die Schutzbestimmungen für die<br />
beiden Handwerke gegenüber dem Land weiterhin mit der<br />
Stadt- wie auch mit der Handwerksordnung begründet wurden.<br />
1848 hatten die Maurergesellen Sanders „zum Eversten“ und<br />
Eiben vor dem Heiligengeisttor gegen die Arbeitsbeschrän-<br />
kung für Gesellen in der Stadt verstoßen. Ihre Beschwerde<br />
wurde mit Hinweis auf das noch geltende Maurerreglement so-<br />
179 1856, anläßlich des Gesuchs des Maurermeisters Spieske<br />
auf dem äußeren Damm, in der Stadt zu arbeiten, wurde klar<br />
festgestellt, daß bürgerliche Nahrung auch von Personen,<br />
die außerhalb der Stadt wohnten, betrieben werden durfte.<br />
Wer sich in der Stadt niederlassen wollte, mußte allerdings<br />
das Bürgerrecht erwerben (vgl. S.93f.). Nur das in der HWO<br />
verankerte Innungsrecht schränkte die handwerkliche Betätigung<br />
in der Stadt ein. Da Maurer- u. Zimmerhandwerk jedoch<br />
unzünftig waren, konnte daraus kein Anspruch der Oldenburger<br />
Meister auf alleiniges Arbeiten in der Stadt abgeleitet<br />
werden. 1844 zog der Magistrat für seine Argumentation den<br />
Art.33 der Stadtordnung von 1833 (Rechte der Bürger) sowie<br />
das Maurerreglement v.21.3.1792 (Meisterrecht ist erforderlich<br />
für die Betreibung des Maurerhandwerks in der Stadt)<br />
heran (vgl. Magistratsbericht v.3.4.1844, in: Ebenda).
532<br />
wie mit dem notwendigen Erwerb des Bürgerrechts als Voraus-<br />
setzung für das Arbeiten in der Stadt abgelehnt. 180 1851 be-<br />
schwerten sich die Zimmergesellen Wienken (Bürgerfelde),<br />
Gramberg (Lehmkuhle), Bode (Donnerschwee) über eine vom Ma-<br />
gistrat zudiktierte Geldstrafe für unbefugtes Arbeiten in<br />
der Stadt. Die Klage wurde zwar abgelehnt, aber die Regie-<br />
rung sah in diesem Fall die Begründung des Magistrats, daß<br />
die fraglichen Gesellen erst das Bürgerrecht hätten erwer-<br />
ben müssen, nicht für zulässig an. 181 Im August desselben<br />
Jahres erließ die Regierung eine Verfügung, in der der Um-<br />
fang der Arbeitsbefugnisse der Maurer- und Zimmergesellen<br />
ausdrücklich bestimmt wurde. 182<br />
Mit dem Gewerbegesetz von 1861 wurde der selbständige Be-<br />
trieb eines stehenden Gewerbes grundsätzlich jedem Staats-<br />
angehörigen gestattet. Angehörige fremder Staaten mußten<br />
nicht mehr wie noch in den 50er Jahren erst die Aufnahme<br />
als oldenburgischer Landesuntertan erwirken. Es genügte<br />
jetzt die Erlaubnis der Regierung, die allerdings davon ab-<br />
hängig gemacht wurde, daß durch die Gesetzgebung des frem-<br />
den Staates Gegenseitigkeit gewährt sein mußte. 183 In der<br />
180 Vgl. Regierungsreskript v.14.8.1848, in: Ebenda<br />
181 Im Fall der Zimmergesellen wurde der Art.33 HWO, der besagte,<br />
daß ausschließlich Meister befugt sein sollten, Gesellen<br />
und Lehrlinge zu beschäftigen, angezogen (vgl. Regierungsreskript<br />
v.25.7.1851, Regierungsresolution an die<br />
Zimmergesellen v.25.7.1851, in: Ebenda).<br />
182 Vgl. Regierungsverfügung v.25.8.1851, in: Ebenda; die<br />
Stadtordnung wurde in diesem Zusammenhang nicht mehr erwähnt.<br />
183 Vgl. Art.13 u. 14,2 des „Gewerbegesetzes für das Herzogthum<br />
Oldenburg“ v.11.7.1861 ... , S.732f.; vgl. auch ein<br />
Schreiben der preußischen Behörden aus Berlin an das Oldenburger<br />
Staatsministerium v.3.3.1852, in dem das Gesuch eines<br />
Schuhmachergesellen aus Oldenburg um Niederlassung als<br />
Meister in Berlin mitgeteilt und nachgefragt wurde, welche<br />
Bedingungen für die selbständige Betreibung eines Gewerbes<br />
in dessen Herkunftsland gelten würden (StAO Best. 31-13-68-<br />
1). - Das Prinzip der Gegenseitigkeit wurde von Regierung<br />
und Staatsministerium unterschiedlich aufgefaßt. Die Regierung<br />
begnügte sich damit zu fordern, daß einheimische wie<br />
fremde Gewerbetreibende in einem Land durch die Gesetzgebung<br />
gleichbehandelt werden müßten; die übergeordnete Behörde<br />
machte darüber hinaus die Gleichheit der gesetzlichen
533<br />
Praxis konnte der Antrag, in der Stadt ein Gewerbe zu be-<br />
treiben, schon am Magistrat scheitern, dem es oblag, über<br />
die Aufnahme des Bittstellers in den Gemeindeverband der<br />
Stadt zu entscheiden. Der Art.14,2 des Gewerbegesetzes sah<br />
eine weitere, jetzt überregionale Lockerung der rechtlichen<br />
Bedingungen gewerblichen Wirtschaftens vor, die zunächst<br />
teilweise noch durch die verschiedenartigen Gewerbegesetz-<br />
gebungen der Länder behindert wurde. Erst die Verfassung<br />
des Norddeutschen Bundes vom 16.4.1867 beseitigte diese<br />
Schwierigkeiten, indem die Gleichbehandlung fremder Staats-<br />
angehöriger unabhängig von differierenden gesetzlichen Re-<br />
gelungen angeordnet wurde. Für Oldenburg bedeutete dies,<br />
daß die Angehörigen der übrigen Norddeutschen Bundesstaaten<br />
ohne Erlaubnis der Regierung im Land ein Gewerbe betreiben<br />
konnten und damit den Einheimischen gleichgestellt wur-<br />
den. 184 Die Ausarbeitung einer gemeinsamen Gewerbeordnung<br />
zog sich noch bis 1869 hin. 185 Anhand von vier ausgewählten<br />
Bestimmungen in bezug auf den Betrieb jedes einzelnen Gewerbes<br />
geltend. Angehörige fremder Staaten sollten nur dann<br />
die Erlaubnis zum Betrieb eines Gewerbes erhalten, wenn die<br />
dortige Gesetzgebung das einzelne in Frage kommende Gewerbe<br />
nicht weiter beschränke als der oldenburgische Staat. Es<br />
müsse das Prinzip der Gewerbefreiheit gelten; beschränkende<br />
Bedingungen würden dann toleriert werden, wenn der Oldenburger<br />
sie unschwer erfüllen könne und im Zweifel für die<br />
Zulassung entschieden werde (vgl. Regierungsresolution<br />
v.2.12.1862, in: StAO Best.262-1 A, Nr.1999/Acta betr. die<br />
den Angehörigen fremder Staaten erteilte Erlaubnis zur Betreibung<br />
eines stehenden Gewerbes in hiesiger Stadt,<br />
Art.12,2 der Gewerbeordnung, 1861-1868).<br />
184 Der Art.3 der Verfassung des Norddeutschen Bundes besagte,“<br />
[...] daß alle Angehörigen in der Zulassung zum festen<br />
Wohnsitz, zum Gewerbebetriebe, zu öffentlichen Ämtern, zur<br />
Erwerbung von Grundstücken, zur Erlangung des Staatsbürgerrechts<br />
und im Genusse aller sonstigen bürgerlichen Rechte<br />
wie Einheimische zu behandeln seien“ ( zit.n. Steindl., Die<br />
Einführung der Gewerbefreiheit ... , S.3552).<br />
185 Am 27.7.1868 trat ein vorläufiges „Gesetz, betreffend den<br />
Betrieb der stehenden Gewerbe“ in Kraft: es beseitigte alle<br />
ausschließlichen Gewerbeberechtigungen, die Unterschiede<br />
zwischen Stadt und Land, Beschränkungen in der Lehrlingsund<br />
Gesellenzahl sowie den Befähigungsnachweis; die allgemeine<br />
im Norddeutschen Bund geltende Gewerbeordnung<br />
v.21.6.1869 galt seit dem 1.1.1873 im Gesamtgebiet des<br />
deutschen Reiches (vgl. Ebenda, S.3553).
534<br />
Konzessionsgesuchen soll ein Blick auf die Zulassungspraxis<br />
sowie insbesondere die Position des Magistrats geworfen<br />
werden, der die negativen Folgen der Ausweitung der außer-<br />
städtischen Konkurrenz für das hiesige Handwerk betonte.<br />
1862 wurde das Gesuch des Schlachtermeisters Moses Meyer<br />
Weinberg aus Leer abgeschlagen, in der Stadt Oldenburg zu-<br />
sammen mit seinem hier ansässigen Schwiegervater<br />
H.I.Steinthal ein Ledergeschäft zu eröffnen. Der Magistrat<br />
meinte die Bitte um Aufnahme in den Gemeindeverband ableh-<br />
nen zu müssen, da Steinthal sich schon zur Ruhe gesetzt ha-<br />
be und Weinberg nur dessen Namen nutze, um das Bürgerrecht<br />
zu erlangen und um später in Oldenburg sein eigentliches<br />
Handwerk betreiben zu können. 186 Die Zahl von Ausländern,<br />
die in Oldenburg ein Handwerk ausüben wollten, müsse be-<br />
grenzt werden, da die hiesigen Gewerbetreibenden schon die<br />
vermehrte Konkurrenz von einheimischen als Folge der Ein-<br />
führung der Gewerbefreiheit erlitten. Außerdem würde einer<br />
Erlaubnis zum Gewerbebetrieb die mangelnde Gegenseitigkeit<br />
in der hannoverschen Gesetzgebung entgegenstehen. Im glei-<br />
chen Jahr wurde das Gesuch des Tischlergesellen Friedrich<br />
Ernst Staats aus dem hannoverschen Amt Sulingen um Aufnahme<br />
als Gemeindemitglied und um Betreibung des Tischlerhand-<br />
werks in der Stadt abgelehnt. Der 32jährige Staats konnte<br />
eine zünftige Handwerksausbildung nachweisen, war als Ge-<br />
selle in das Gildebuch der Stadt Sulingen eingetragen wor-<br />
den. Seit 12 Jahren lebte er in der Stadt Oldenburg und be-<br />
trieb sein Handwerk zuletzt als „Werkführer“ bei der Witwe<br />
186 Der „Proprietair“ H.I.Steinthal wird als wohlhabend bezeichnet<br />
und schien vormals im Lederhandel tätig gewesen zu<br />
sein (vgl. Oldenburgischer Residenzkalender (1844), enthaltend<br />
ein Verzeichnis der Einwohner der Stadt Oldenburg, alphabetisch<br />
geordnet, nebst Angabe der Straßen und Haus-<br />
Nummern, in: Oldenburgischer Volksbote. Ein gemeinnütziger<br />
Volkskalender für den Bürger und Landmann des Großherzogthums<br />
Oldenburg auf das Jahr 1846, 9.Jhg., Oldenburg<br />
1846, S.193: dort wird ein gewisser Steindahl erwähnt,<br />
„Leder= und Productenhändler“, Achternstraße 55). - Vgl.<br />
Magistratsbericht v.10.5.1862, Regierungsresolution<br />
v.15.5.1862, in: StAO Best.262-1 A, Nr.1999
535<br />
eines Tischlermeisters. 187 Auch in diesem Fall wandte sich<br />
der Magistrat gegen die unbeschränkte Aufnahme ausländi-<br />
scher Gewerbetreibender und explizierte seine Ansicht aus-<br />
führlich. Besonders hervorgehoben wurde das Bedenken vor<br />
der Zuwanderung von Handwerkern aus dem Königreich Hanno-<br />
ver, wo noch Zunftzwang herrsche und daher die Niederlas-<br />
sung von Gewerbetreibenden sehr erschwert werde. Das Prin-<br />
zip der Gegenseitigkeit liege nicht vor und der Magistrat<br />
fühle sich in die Pflicht genommen, die hiesigen Handwerker<br />
vor diesem Zustrom nach besten Kräften zu schützen.<br />
Schließlich entkräftete die Behörde noch die von Staats ge-<br />
nannten beiden Beispiele für erfolgreich betriebene Gesuche<br />
von ausländischen Gewerbetreibenden. Der Tischler Schumann<br />
aus Lübeck sei schon 1860 aufgenommen worden, nachdem er<br />
auf die selbständige Ausübung seines Handwerks verzichtet<br />
habe, um hier als Fabrikarbeiter oder Geselle zu arbeiten.<br />
Das Gesuch wurde bewilligt, weil die Aufnahme von den<br />
stadtoldenburgischen Tischlermeistern befürwortet worden<br />
war und Schumann eine hiesige Gemeindeangehörige geheiratet<br />
hatte. Durch das Gewerbegesetz von 1861 erlangte er dann<br />
das Recht, sein Handwerk selbständig auszuüben. Jahnke aus<br />
dem Königreich Hannover wurde aufgenommen, weil er eine<br />
hiesige Tischlermeisterwitwe heiratete. Diese Möglichkeit<br />
habe auch vor Einführung der Gewerbefreiheit bestanden. 188<br />
Gegenüber dem Gesuch des Schlachters Gustav Moritz Gottlieb<br />
Gottfried Giehm aus Kölleda verhielt sich der Magistrat zu-<br />
rückhaltend. Er könne die Aufnahme nicht empfehlen, da er<br />
nicht, wie von der Regierung gefordert, in der Lage sei zu<br />
prüfen, ob wirkliche Gegenseitigkeit zwischen der Oldenbur-<br />
ger und der preußischen Gewerbegesetzgebung bezüglich des<br />
Schlachterhandwerks bestünde. Trotz teilweise unbefriedi-<br />
gender Zeugnisse über die Befähigung von Giehm, die<br />
Schlachterei selbständig zu betreiben, die die Regierung<br />
von den hiesigen Arbeitgebern des Bittstellers einholen<br />
187<br />
Vgl. Gesuch des F.E. Staats aus Wehrbleck v.5.6.1862, in:<br />
Ebenda<br />
188<br />
Vgl. Magistratsbericht v.14.7.1862, in: Ebenda
536<br />
ließ, wurde das Gesuch schließlich befürwortet. 189 Der<br />
Schuhmachergeselle Heinrich Köhter aus Schwarme, der seit<br />
1858 bei Meistern in Osternburg und Oldenburg gearbeitet<br />
hatte, erhielt noch 1867 eine Absage wegen immer noch be-<br />
stehender unzureichender Gegenseitigkeit zwischen der Ol-<br />
denburger und der hannoverschen Gewerbegesetzgebung. 190<br />
1849 wurde anläßlich der vom Militärkollegium üblicherweise<br />
auf dem Submissionswege vergebenen Lieferungen von Militär-<br />
zubehör für die Kavallerie Kritik laut, ob es denn recht-<br />
lich zulässig sei, daß in letzter Zeit meist Fabrikanten<br />
aus dem Königreich Hannover den Auftrag erhalten hätten. So<br />
geriet der Art. 18 HWO in den Blickpunkt, der inländischen<br />
Meistern das Recht zubilligte, sich an „öffentlichen Aus-<br />
verdingungen“ in Städten, wo Innungen bestanden, zu betei-<br />
ligen. Das Staatsministerium, das dem Militärkollegium die<br />
Möglichkeit, Waren ausländischer Fabrikanten zu beziehen,<br />
erhalten wollte, beauftragte die Regierung zu untersuchen,<br />
ob und in wie weit ausländische Konkurrenz zugelassen wer-<br />
den könne. 191 Die Regierung interpretierte nun den fragli-<br />
189 Vgl. Gesuch des G.M.G.G.Giehm v.18.10.1862, Magistratsbericht<br />
v. 22.11.1862, Magistratsbericht v.12.12.1862, Regierungsresolution<br />
v.20.12.1862, Magistratsprotokoll<br />
v.8.1.1863, Regierungsresolution v.15.1.1863, in: Ebenda.<br />
190 Seit 1866 wurden von seiten Preußens Übergangsverordnungen<br />
zur Anpassung der gewerberechtlichen Verhältnisse in<br />
den neu erworbenen Gebieten, in Hannover, Kurhessen, Homburg<br />
und Schleswig-Holstein vorbereitet, die den Zunftzwang<br />
beseitigten (vgl. Steindl, H., Die Einführung der Gewerbefreiheit<br />
... , S.3553); vgl. Gesuch des H.Köhter<br />
v.8.1.1867, Magistratsresolution v.11.1.1867, in: StAO<br />
Best.262-1 A, Nr.1999<br />
191 “Öffentliche Ausverdingung“ entspricht in etwa der heutigen<br />
Ausschreibung, Submission, Verdingung, also der öffentlichen<br />
Bekanntgabe von Bedingungen, zu denen ein Vertragsangebot<br />
erwartet wird (vgl. Art.„Ausschreibung“, in:<br />
Gablers Wirtschaftslexikon, hg.v. Sellien, R. u. H.,<br />
10.neubearb. Aufl., Wiesbaden 1979, S.398). Das Militärkollegium<br />
beschrieb das von ihr praktizierte Submissionsverfahren,<br />
das von ihm zu den „schriftlichen Ehrerbietungen“<br />
gerechnet wurde, folgendermaßen:<br />
„[...] daß zur Erlangung von Lieferungen auf diesem Wege<br />
die zu liefernden Gegenstände mit der Aufforderung öffentlich<br />
bekannt gemacht werden, bis zu einem bestimmten Termi-
537<br />
chen Artikel vor dem Hintergrund einer freiheitlichen<br />
Zunftverfassung, wie es in ihren Augen die HWO von 1830<br />
darstellte, und in Beziehung zu einzelnen Bestimmungen, die<br />
die Rechte der Konsumenten betrafen. Sie ging von der Frage<br />
aus, ob die HWO in ihrer Intention bzw. ob einzelne Arti-<br />
kel, die die Rechte der Innungen gegenüber denen der Konsu-<br />
menten festlegten, die Konkurrenz ausländischer Gewerbe-<br />
treibender bei öffentlichen Ausverdingungen ausdrücklich<br />
ausschlössen. Den Innungen sei nur das exklusive Recht, im<br />
Innungsbezirk zu arbeiten, verblieben. Die Einwohner dürf-<br />
ten hingegen Arbeit überall bestellen; Waren könnten auch<br />
überall eingebracht werden. Ausländische Meister könnten<br />
berufen werden, wenn Mangel an geschickten einheimischen<br />
bestünde oder die Preise der Innungen überhöht seien. 192 Der<br />
Art.18 nun solle nur ausdrücklich die inländischen Handwer-<br />
ker in einem weiteren Fall vom Zunftzwang befreien, dem sie<br />
sonst unterworfen seien, indem ihnen die Teilnahme an vor-<br />
her bekanntgemachten Ausverdingungen an Orten, wo Innungen<br />
bestünden, gestattet werde. Daraus folge, daß in diesem<br />
Fall neben der Annahme von Aufträgen in einem fremden In-<br />
nungsbezirk auch die für die Ausführung des Auftrags erfor-<br />
derlichen Arbeiten gegebenenfalls im Innungsbezirk verrich-<br />
tet werden könnten. 193 Ausländische Meister würden an dieser<br />
ne Forderungen in versiegelten Zetteln einzureichen, im<br />
Termine dann, nach Eröffnung der Zettel und nach dem die<br />
erschienenen Submittenten vorgerufen werden, die niedrigste<br />
Forderung verkündet und dem Befinden nach entweder auf solche<br />
der Zuschlag ertheilt oder verweigert wird.“ (Schreiben<br />
des Militärkollegiums v.30.7.1849 im Anhang des Regierungsberichts<br />
v.10.8.1849, in: StAO Best.31-13-68-1). Im Kgr.<br />
Hannover schien die Militärverwaltung, die für die Anschaffung<br />
von Militärzubehör zuständig war, der Gewerbeordnung<br />
nicht unterworfen und damit nicht durch den Zunftzwang beschränkt<br />
zu sein (vgl. Schreiben der kgl. hannoverschen Direktion<br />
des Armeematerials v.7.8.1849 im Anhang von Ebenda).<br />
Vgl. zum folgenden Regierungsbericht v.5.6.1849, in:<br />
StAO Best. 31-13-68-1.<br />
192 Vgl. Art.12 (Rechte der Innungen), 16, 17 und 60 (Rechte<br />
der Konsumenten und auswärtigen Handwerker) der Handwerksordnung<br />
von 1830.<br />
193 1847 wurde es Gewerbetreibenden erlaubt, Bestellungen<br />
grundsätzlich in einem fremden Innungsbezirk annehmen zu<br />
dürfen (vgl. Zusatz zu Art.12 der HWO, in: Regierungsbe-
538<br />
Stelle nicht genannt werden, da es der HWO darum ginge, die<br />
Ausnahmen vom Zunftzwang, der für die inländischen Handwer-<br />
ker gelte, zu bestimmen. Außerdem würde ein Verbot in Wi-<br />
derspruch zur Erlaubnis, überall Waren zu bestellen, gera-<br />
ten: die Art und Weise der Bestellung (einfache Bestellung<br />
- Bestellung infolge öffentlicher Ausverdingung) dürfe kei-<br />
nen Unterschied machen. Die Regierung war der Ansicht, daß<br />
der Ausschluß ausländischer Konkurrenz vom Gesetzgeber<br />
schon aus wirtschaftspolitischen Gründen nicht beabsichtigt<br />
sein konnte. Außerdem hätte das Verbot leicht durch die<br />
Wahl einer anderen Vertragsform bei der Bestellung von Ar-<br />
beiten umgangen werden und damit gemäß Art.16 und 17 doch<br />
eine umfassendere Konkurrenz erreicht werden können. 194 So<br />
plädierte also die Regierung für möglichst freie gewerbli-<br />
che Konkurrenz bei öffentlichen Ausverdingungen. 195<br />
Das Staatsministerium folgte dieser weiten Interpretation<br />
des Art.18 zunächst nicht, sondern hielt sich an den Wort-<br />
laut. Man suchte dort einen anderen Weg, um dem Militärkol-<br />
legium aus dem Problem herauszuhelfen. Die Mitglieder<br />
stellten sich die Frage, ob das Verfahren der Submission,<br />
so wie es auch vom Militärkollegium verwandt wurde, denn<br />
überhaupt unter den Begriff der Ausverdingung fiel und da-<br />
mit verboten war. Schloifer, Zedelius sowie Bucholtz sahen<br />
kanntnmachung, betr. Erläuterungen und neue Bestimmungen<br />
zur Handwerks=Ordnung vom 28. Januar 1830 ... , S.472).<br />
194 Ein erlaubtes Verfahren war beispielsweise „[...] wenn ..<br />
z.B. den geringsten inländischen Preis durch Submission<br />
ausmittelt, und dann durch Correspondenz mit Ausländern<br />
nicht öffentlich noch wohlfeilere Arbeit im Auslande sucht,<br />
[...]“ (Votum des Staatsrats und Vorsitzenden des neugebildeten<br />
Staatsministeriums Johann Heinrich Schloifer<br />
v.4.6.1849, in: StAO Best. 31-13-68-1).<br />
195 Noch 1843 interpretierte die Regierung den Art.18 im Sinne<br />
des Ausschlusses ausländischer Gewerbetreibender. Dem<br />
Amt Delmenhorst wurde befohlen, ausländische Handwerksmeister<br />
nicht bei öffentlichen Ausverdingungen zuzulassen mit<br />
der Begründung, daß dies auch den hiesigen Handwerkern im<br />
Ausland nicht erlaubt sei. Das Verbot müsse strikt befolgt<br />
werden, auch wenn dies der städtischen Bevölkerung zur Zeit<br />
vielleicht abträglich sei (vgl. Regierungsresolution<br />
v.3.11.1843 im Anhang der Voten der Mitglieder des Staatsministeriums<br />
v.4. - 11.6.1849, in: Ebenda).
539<br />
in der Submission eine Form der Ausverdingung. Die Teilnah-<br />
me an öffentlichen Ausverdingungen wiederum könne nicht mit<br />
dem bloßen Annehmen von Bestellungen gleichgesetzt werden,<br />
wie es die Verordnung von 1847 im fremden Innungsbezirk<br />
jetzt gestatte. Allerdings unterscheide sich die Submission<br />
von der Ausverdingung durch die Form des Schlußverfahrens.<br />
Letztere beinhalte einen absichtlich veranlaßten öffentli-<br />
chen Wettstreit, ein Bieten und Überbieten, der Bewerber um<br />
den Zuschlag. Zedelius wies darauf hin, daß die Behörde je-<br />
doch nicht gezwungen sei, die inländischen Angebote anzu-<br />
nehmen, wenn sie im Preis zu hoch erschienen. Die Verwal-<br />
tung könne die Arbeiten dort bestellen, wo sie am günstig-<br />
sten angeboten würden. 196 Bucholtz knüpfte hier an und un-<br />
terstrich, daß Bestellungen bei Ausländern sowie die Erkun-<br />
digung bei ihnen nach den niedrigsten Preisen, auch mittels<br />
Proklams, also auf dem Wege der Submission, erlaubt seien.<br />
Nur müsse das öffentliche Bieten zu einem festgesetzten<br />
Termin, das charakteristische Merkmal der Ausverdingung,<br />
vermieden werden. Auch wenn die Unterscheidung zwischen Be-<br />
stellung, Submission und öffentlicher Ausverdingung etwas<br />
künstlich anmute, so Bucholtz weiter, müsse im Zweifel der<br />
Ansicht, die die natürliche Freiheit am wenigsten beschrän-<br />
ke, der Vorzug gegeben werden. Das Militärdepartement solle<br />
angewiesen werden, zukünftig die Aufforderung zur Submissi-<br />
on so zu formulieren, daß sie nicht mit einer Ausverdingung<br />
verwechselt werden könne. Die Auftragsvergabe an den hanno-<br />
verschen Fabrikanten wurde für zulässig befunden. 197 Der<br />
Vorsitzende des Militärdepartements selbst, Römer, befür-<br />
196 Vgl. Votum des Staatsrats J.H.J. Schloifer v.4.6.1849,<br />
des Ministerialrats Christian Karl Philipp Wilhelm Zedelius,<br />
o.D., des Ministerialrats Carl Franz Nikolaus Bucholtz<br />
v.8.6.1849, in: Ebenda (in den Voten wird Bucholtz der Titel<br />
Ministerialrat zugelegt; bei Hartong ist er im Frühherbst<br />
1849 noch Ministerialassistent, nach Friedl wurde er<br />
erst 1851 zum Ministerialrat ernannt (vgl. Hartong, K.,<br />
Beiträge zur Geschichte des oldenburgischen Staatsrechts<br />
... , S.111; Friedl, H., Art.“ Carl Franz Nikolaus<br />
Bucholtz“, in: Biographisches Handbuch ... , S.99).<br />
197 Vgl. Votum des C.F.N. Bucholtz v.9.6.1849, in: StAO<br />
Best.31-13-68-1
540<br />
wortete das Vorgehen der Regierung, durch Interpretation<br />
„das Vernünftige“ zu erreichen. Eigentlich hätten seit dem<br />
Beitritt Oldenburgs zum Hannoversch-Braunschweigischen<br />
Steuerverein (1836) im Sinne des Vertrages dessen Mitglie-<br />
der im Bereich Handel und Verkehr nicht mehr als Ausländer<br />
angesehen werden sollen. Römer äußerte sich skeptisch ge-<br />
genüber den Erfolgschancen der von Bucholtz vorgeschlagenen<br />
Lösung. Demnächst könnten diese Fälle vor Gericht verhan-<br />
delt werden, und die „verklausulierte Submission“ würde<br />
dann sicherlich der öffentlichen Ausverdingung gleichge-<br />
stellt werden. 198 Die Regierung fand die begriffliche Tren-<br />
nung von Submission und Ausverdingung bedenklich. Sie<br />
schlug vor, den Art.18 doch lieber zunächst weiterhin wort-<br />
getreu anzuwenden. Bei einer künftigen Revision der Gewer-<br />
begesetzgebung sollte allerdings eine freiere Bewegung ge-<br />
stattet werden. 199 Wenig später schwenkte Bucholtz auf die<br />
Linie der Regierung um. Der Art.18 beziehe sich nur auf das<br />
Arbeiten im Innungsbezirk. Nach Art.12 sollten nur die In-<br />
nungsmeister im Innungsbezirk arbeiten dürfen. Der Art.13<br />
beschreibe Ausnahmen von dieser Regel. Der Art.18 nun er-<br />
laube es inländischen Meistern ausdrücklich in Veranlassung<br />
einer vorhergegangenen öffentlichen Ausverdingung mit den<br />
Innungsmeistern zu konkurrieren, also im Innungsbereich zu<br />
arbeiten. Das Bestellen fertiger Handwerkswaren hingegen,<br />
wie dies auch infolge einer Ausverdingung an ausländische<br />
Gewerbetreibende geschehe, sei etwas ganz anderes. Der Kon-<br />
sument könne frei entscheiden, von wem er Produkte beziehen<br />
wolle. Die endgültige Klärung dieser Frage sei für die Ge-<br />
werbetreibenden sowie die öffentliche Verwaltung sehr wich-<br />
tig. Bucholtz forderte daher ein weiteres Gutachten des<br />
stadtoldenburgischen Magistrats darüber an, wie er in ent-<br />
sprechenden Fällen geurteilt habe. 200 Die städtische Behörde<br />
nun lehnte in einem Schreiben die Zulassung ausländischer<br />
198 Vgl. Votum des Berthold Diedrich Römer, Vorstand des neu<br />
geschaffenen Militärdepartements im Staatsministerium,<br />
v.11.6.1849, in: Ebenda<br />
199 Vgl. Regierungsbericht v.10.8.1849, in: Ebenda<br />
200 Vgl. Votum des C.F.N. Bucholtz v.25.8.1849, in: Ebenda
541<br />
Gewerbetreibender bei Ausverdingungen in der Stadt ab. Bis-<br />
her sei solch ein Fall in ihrer Praxis auch noch nicht vor-<br />
gekommen. Der Magistrat befürchtete hauptsächlich, daß ,<br />
wenn man sie zuließe, einige eine Werkstatt in der Stadt,<br />
also im Innungsbezirk, errichten würden, um die vertraglich<br />
festgelegten Produkte herstellen zu können. 201 Wie die Dis-<br />
kussion über den Art.18 endete, war der Akte im weiteren<br />
nicht mehr zu entnehmen.<br />
Angesichts der in dem Zeitraum der 1830er bis 1860er Jahre<br />
auftauchenden und hier beschriebenen Auseinandersetzungen<br />
um die außerstädtische Konkurrenz des Handwerks: Niederlas-<br />
sung im Umkreis der Stadt (äußerer Damm), staatlich betrie-<br />
bene Fabrikation von Handwerksgegenständen in der Vechtaer<br />
Strafanstalt, die Arbeit von Landmeistern und -gesellen des<br />
unzünftigen Maurer- und Zimmerhandwerks in der Stadt, die<br />
Niederlassung von ausländischen Gewerbetreibenden in der<br />
Stadt sowie die Zulassung von letzteren bei Ausschreibungen<br />
in Städten, wo Innungen existierten, stellt sich die Frage<br />
nach der noch vorhandenen Bedeutung der stadtbürgerlichen,<br />
durch Stadtregiment und Innungen ausgeübten, Kontrolle über<br />
die Niederlassung oder Zulassung von Handwerkern in der<br />
Stadt. Wie stark höhlte liberale Wirtschaftspolitik der<br />
staatlichen Behörden den Gewerbelokalismus aus? An welchem<br />
Punkt wies auch der Magistrat die Forderungen des Handwerks<br />
zurück? Die Behandlung der dargestellten Fälle unter diesem<br />
Gesichtspunkt liefert Hinweise auf die beginnende Auflösung<br />
der alten Stadtbürgergemeinde sowie auf die Entwicklung hin<br />
zur Gewerbefreiheit. 202 Zunächst konnte das Handwerk auf die<br />
außerstädtische Konkurrenz seit den 40er Jahren mit Einga-<br />
201 Vgl. Magistratsbericht v.24.9.1849, in: Ebenda<br />
202 H.-U. Wehler beschreibt die strukturellen Antriebskräfte,<br />
die zur Erosion der alten Stadtbürgergemeinde sowie zum<br />
Aufstieg eines neuen Wirtschaftsbürgertums und Kleinbürgertums<br />
in den Jahren zwischen 1848 und 1871 führten, knapp<br />
und prägnant unter der Überschrift „Das Stadtbürgertum im<br />
Zerfall - Die Geburtsstunde des Kleinbürgertums“ im dritten<br />
Band seiner Gesellschaftsgeschichte (vgl. Wehler, H.-U.,<br />
Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd.3 ... , S.130-137).
542<br />
ben, die im Kreis einer weiteren, außerhalb der Innung ge-<br />
bildeten Interessenorganisation der Meister entstanden wa-<br />
ren, reagieren. Im Zusammenhang der Diskussion über die<br />
Handwerksausbildung in den Vechtaer Strafanstalten drohten<br />
die Meister, daß ohne innungsgemäße Ausbildung und Befähi-<br />
gungsnachweis kein ehemaliger Sträfling vom Handwerk aufge-<br />
nommen würde. Vor 1861 schienen ausländische Gewerbetrei-<br />
bende nur in den städtischen Gemeindeverband aufgenommen<br />
worden zu sein, wenn sie auf die selbständige Ausübung des<br />
erlernten Handwerks verzichteten, das Gesuch von den Mei-<br />
stern befürwortet wurde und /oder wenn sie außerdem eine<br />
Gemeindeangehörige heirateten. Eine andere Möglichkeit, die<br />
auch nach 1861 fortbestand, war, herkömmlicherweise eine<br />
Amtsmeisterswitwe des entsprechenden Handwerks zu heiraten.<br />
Das Zusammenspiel von Stadtbürgergemeinde und Zunftsystem<br />
zur Abwehr fremder Konkurrenz wird deutlich. Nach 1861 un-<br />
terstützte der Magistrat die Innungen weiterhin durch die<br />
restriktive Vergabe des Gemeindebürgerrechts an Ausländer.<br />
Die Forderung nach einem Bannbezirk für das Maurerhandwerk<br />
lehnte er ab. Allerdings stützte die städtische Behörde<br />
dessen Position in der Stadt, indem das Bürgerrecht neben<br />
dem Meistertitel als Voraussetzung für städtisches Arbeiten<br />
gelten sollte. Auch die Arbeitsbeschränkungen für die Mau-<br />
rer- und Zimmergesellen vom Lande, die unabhängig von einem<br />
Meister in der Stadt arbeiten durften, wurden u.a. mit dem<br />
fehlenden Erwerb des Bürgerrechts gerechtfertigt. Die Zu-<br />
lassung ausländischer Gewerbetreibender bei öffentlichen<br />
Ausverdingungen lehnte der Magistrat im Sinne der städti-<br />
schen Meister strikt ab, indem er sich auf den Wortlaut des<br />
Art.18 HWO berief. Damit unterstützte er die Klagen gegen<br />
Militäraufträge, die ins Ausland vergeben worden waren. An-<br />
ders das Verhalten der Regierung. Sie klärte die besonderen<br />
Arbeitsbefugnisse der Maurer- und Zimmerleute per Verord-<br />
nung und machte dem Magistrat deutlich, daß bürgerliche<br />
Nahrung auch von außerstädtischen Gewerbetreibenden ausge-<br />
übt werden dürfe. Nur das Innungsrecht könne hier Einhalt<br />
gebieten. Der oldenburgische Staat machte neben der wach-
543<br />
senden Anzahl von Fabriken durch die Produktion von Hand-<br />
werksgegenständen in der Vechtaer Strafanstalt dem Handwerk<br />
zusätzlich Konkurrenz. Die Zulassung ausländischer Gewerbe-<br />
treibender wurde zunächst durch das Gewerbegesetz von 1861<br />
erleichtert; die Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes<br />
setzte schließlich die Gleichbehandlung mit Einheimischen<br />
sowie den Wegfall wesentlicher Beschränkungen für die Nie-<br />
derlassung (z.B. den Befähigungsnachweis) durch. Schon vor-<br />
her hatte die Regierung den Versuch unternommen, den Art.18<br />
HWO einer Neuinterpretation zu unterziehen, die es erlaub-<br />
te, ausländische Gewerbetreibende an Ausschreibungen in<br />
zünftig organisierten Städten zuzulassen.<br />
6.2.3 Die Einführung berufsbegleitenden theoretischen Un-<br />
terrichts für Lehrlinge (sog. gewerbliche Sonntags-<br />
schule) sowie einer an den „Realien“ orientierten<br />
höheren Schulbildung für den Nachwuchs der Gewerbe-<br />
treibenden in Oldenburg (höhere Bürgerschule)<br />
In diesem Kapitel sollen gewerbefördernde Angebote und ihre<br />
Aufnahme durch das städtische Handwerk beleuchtet werden.<br />
Zunächst werden Ansätze zu einer direkten Gewerbeförderung,<br />
wie sie sich in selbstorganisierten Vereinen von Handel und<br />
Gewerbe darstellten, behandelt. Im Mittelpunkt stehen al-<br />
lerdings die durch Schulbildung vermittelten indirekten Be-<br />
strebungen, das Handwerk zu heben.<br />
In der Stadt wurde 1840 auf die Initiative von Gewerbetrei-<br />
benden und höheren Beamten hin ein Handels- und Gewerbe-<br />
verein für das Herzogtum Oldenburg gegründet und 1841 vom<br />
Landesherrn offiziell bewilligt. 203 Die Regierung hatte 1839<br />
203 Zu den Gründungsmitgliedern zählten hauptsächlich Stadtoldenburger,<br />
daneben waren aber auch einige aus Delmenhorst<br />
Hengstforde, Jever, Varel, Neuenburg, Bockhorn und<br />
Astede vertreten. Der Verein erhielt künftig 200 Rt Gold<br />
aus der Herrschaftlichen Kasse. (vgl. 125 Jahre Gewerbeund<br />
Handelsverein von 1840 e.V. Oldenburg, Jubiläumsschrift
544<br />
den Antrag auf Einführung einer Handelskammer abgelehnt und<br />
sich stattdessen für einen Gewerbeverein ausgesprochen, der<br />
in etwa die Stellung der Landwirtschafts-Gesellschaft ein-<br />
nehmen sollte. Die Beteiligung des Staates an den 1840 an-<br />
gestrebten gewerbefördernden Aktivitäten des neugegründeten<br />
Privatvereins wurde durch die Wahl von Bergs zum Präsiden-<br />
ten sowie weiterer Staatsbeamter in das Direktorium und die<br />
Ausschüsse erreicht. 204 Der Verein bildete in den folgenden<br />
Jahren Lokalvereine im Herzogtum aus und erreichte seine<br />
höchsten Mitgliedszahlen 1847 mit 820 Mitgliedern im Zen-<br />
tralverein sowie in sechs Lokalvereinen. 205<br />
Für Hannover wies nun Jörg Jeschke nach, daß es dem 1834<br />
dort gegründeten Gewerbeverein, der ähnlich wie der Olden-<br />
burger einen halbstaatlichen Charakter besaß, nicht gelang,<br />
kleingewerbliche und industrielle Gewerbeförderung ausgewo-<br />
gen nebeneinander zu betreiben. Die Zielsetzung des Vereins<br />
lag erklärtermaßen in der Förderung der industriellen Ent-<br />
wicklung, der Verbreitung technischer Kenntnisse kam dabei<br />
besondere Bedeutung zu. Die in einem Mitteilungsblatt des<br />
Vereins publizierten Beiträge beschäftigten sich nur sehr<br />
selten mit den Fragen der handwerklichen Produktion und<br />
setzten bereits einen hohen Stand an technischen Kenntnis-<br />
mit Chronik zum 10. April 1965, hg.v. Gew.-u. Handelsverein<br />
von 1840 e.V., Oldenburg 1965, S.30f.). Die Position der<br />
hauptstädtischen Wirtschaft war aufgrund der Vereinsstruktur<br />
(das Direktorium bestand aus sechs in und um Oldenburg<br />
wohnenden Personen; der 24köpfige Ausschuß mußte zur Hälfte<br />
aus Stadtoldenburgern bestehen; der engere Ausschuß wurde<br />
nur aus in Oldenburg wohnenden Mitgliedern gebildet) dominierend.<br />
Der Verein war trotz seiner Zuständigkeit für das<br />
ganze Herzogtum in erster Linie ein Verein der Hauptstadt<br />
(vgl. Schulze, H.-J., Oldenburgs Wirtschaft ... , S.130).<br />
204 Vgl. Ebenda, S.31f., 34ff; Günther Heinrich von Berg war<br />
von 1821 an bis zu seinem Tod 1843 Mitglied des Staats- und<br />
Kabinettsministeriums (vgl. auch Friedl, H., Art. „Günther<br />
H.v.Berg“, in: Biographisches Handbuch ..., S.68).<br />
205 Am Ende des Jahres 1840 hatte der Verein 504 eingetragene<br />
Mitglieder, 1841 waren es 585, 1843 668. 1848 lösten sich<br />
die Lokalvereine vom Zentralverein in Oldenburg (vgl.<br />
Schulze, H.-J., Oldenburgs Wirtschaft ... , S.131). Unter<br />
den Mitgliedern waren „[...] Handwerker, Fabrikanten, Krämer,<br />
Kaufleute, Künstler, Gelehrte, Staatsmänner, Militärs“<br />
Ebenda, S.37).
545<br />
sen voraus. Diese gewerbepolitische Ausrichtung stieß auf<br />
Skepsis und Abwehr bei den Handwerkern und spiegelte sich<br />
in ihrem nur geringen Mitgliederanteil wider. Zum endgülti-<br />
gen Bruch zwischen Gewerbeverein und Handwerkerschaft kam<br />
es 1860, als sich der hannoversche Lokalgewerbeverein für<br />
die Gewerbefreiheit aussprach. Das Handwerk organisierte<br />
sich daraufhin selbst in Form von lokalen, regionalen und<br />
über die Grenzen der Bundesstaaten hinausreichenden Inter-<br />
essenvereinigungen. 206 Bedeutsam an dem geschilderten Sach-<br />
verhalt ist, daß es offenbar nicht gelang, die traditionel-<br />
len wirtschaftlichen Kräfte für die neu aufkommenden Wirt-<br />
schaftsformen und gesellschaftlichen Vorstellungen aufzu-<br />
schließen, sie durch Mitarbeit in eine allgemeine Gewerbe-<br />
förderung zu integrieren und ihnen dadurch bei der Anpas-<br />
sung an die durch den Strukturwandel geschaffenen Verhält-<br />
nisse zu helfen. Diesem Scheitern stellt Jeschke exempla-<br />
risch die gelungene Entwicklung des Osnabrücker Handwerker-<br />
vereins von zünftig beeinflußten Vorstellungen zur koopera-<br />
tiven Selbsthilfe gegenüber. 207 Dem Verein traten zunächst<br />
überwiegend ortsansässige zünftige Handwerksmeister bei,<br />
die beschlossen, daß nur Gewerbetreibenden der Zutritt er-<br />
laubt werden sollte. Wurde anfangs noch die Einrichtung ei-<br />
ner Bannmeile gefordert, so trat bald das beherrschende In-<br />
teresse am Schutz der altbewährten Arbeitsweise vor indu-<br />
strieller Konkurrenz zurück. Fragen der Lehrlingsausbil-<br />
dung, die Einrichtung von Handwerkerläden sowie eines<br />
Schlosser-Magazins, die Vorbereitung einer Gewerbeausstel-<br />
lung standen auf der Tagesordnung der regelmäßig abgehalte-<br />
nen Versammlungen. 1840 wurde die „Technische Sektion“ des<br />
Vereins gegründet, die auch Nichtgewerbetreibenden offen-<br />
stand. Sie hatte sich zum Ziel gesetzt, neueren techni-<br />
206 Vgl. Jeschke, J., Gewerberecht und Handwerkswirtschaft<br />
... , S.174ff<br />
207 Der Verein wurde auf Initiative und Unterstützung des Osnabrückers<br />
Bürgermeisters Stüve 1838 gegründet und sollte<br />
„ein Organ zur Berathung gewerblicher Interessen und Verbreitung<br />
gewerblicher Kenntnisse, überhaupt in industrieller<br />
Anregung“ werden (zit.n. Ebenda, S.178; zum Handwerkerverein<br />
vgl. S.178ff).
546<br />
schen Entwicklungen zu größerer Publizität zu verhelfen. Im<br />
gleichen Jahr gründete der Handwerkerverein ein „Journal-<br />
Lese-Institut“ für Gesellen. Außerdem wurde ihm ermöglicht,<br />
kostenlos Aufsätze gewerblichen Inhalts in den „Osnabrücker<br />
Anzeigen“ abdrucken zu lassen. Angesichts der vielfältigen<br />
Aktivitäten und der günstigen Entwicklung des Vereins wur-<br />
den Verbindungen zu Handwerkern anderer Städte hergestellt,<br />
um die Bildung weiterer Vereine anzuregen. 1848 vereinigten<br />
sich der Handwerkerverein und seine technische Sektion zum<br />
„Industrieverein“. Die in der Satzung festgelegten Ziele<br />
des Vereins zeigten deutlich ein gewandeltes Verständnis<br />
von dem vom Handwerk zu beschreitenden Weg:“Der Industrie-<br />
verein will die bürgerlichen Gewerbe und Geschäfte heben<br />
und zu fördern suchen, und zwar vorzugsweise durch Verbrei-<br />
tung naturwissenschaftlicher, technischer und ökonomischer<br />
Kenntnisse“. 208 In den folgenden Jahren widmete der Verein<br />
sich insbesondere dem Aufbau einer Fachbibliothek, der<br />
Durchführung von Vorträgen sowie der Diskussion und Förde-<br />
rung genossenschaftlicher Einrichtungen. Jeschke schreibt<br />
dem Handwerkerverein einen großen Anteil an der Entwicklung<br />
zum handwerklichen, export-orientierten Großbetrieb in Os-<br />
nabrück zu. Das Beispiel zeige, daß bei entsprechender För-<br />
derung und Tolerierung kleingewerblicher Voraussetzungen<br />
auch das Handwerk während der Frühindustrialisierung im-<br />
stande und bereit gewesen sei, sich mit den neuen Entwick-<br />
lungen abzufinden und sie für sich zu nutzen. 209 Eine wich-<br />
tige Rolle spielte dabei die Haltung der städtischen Behör-<br />
den. In Städten allerdings, wo die Magistrate durch die Be-<br />
wahrung der städtischen Gewerberechte der Wirtschaft auf-<br />
helfen wollten, schlossen sich die Handwerkerzünfte dieser<br />
Argumentation an und hielten eher an den alten Zuständen<br />
fest. Auffällig sei, daß die Zünfte selbst nicht gewerbe-<br />
fördernd tätig wurden.<br />
Hinsichtlich der Oldenburger Entwicklung können nur einige<br />
Hinweise zu der Zielsetzung des Gewerbevereins, der Betei-<br />
208 zit.n. Ebenda, S.184<br />
209 Vgl. Ebenda, S.185
547<br />
ligung von Handwerkern sowie ihrem Verhältnis gegenüber der<br />
gewerbefördernden Praxis des Vereins zusammengetragen wer-<br />
den, die einer systematisch angelegten Untersuchung bedürf-<br />
ten. Sie lassen vermuten, daß hier schon wegen der Organi-<br />
sationsstruktur - der Verein gründete keinen Lokalverein<br />
für die Stadt - die Interessen des städtischen Kleingewer-<br />
bes nicht genügend berücksichtigt wurden. Einschränkend ist<br />
zu bemerken, daß anscheinend nur wenig Bestrebungen vorhan-<br />
den waren, einen stadtoldenburger Lokalverein ins Leben zu<br />
rufen. 210 Für den Handwerkerverein von 1848 konnte aufgrund<br />
seiner nur kurzen Tätigkeit ein direkt gewerbefördernder<br />
Effekt, ähnlich wie in Hannover, anhand des bearbeiteten<br />
Materials nicht erkannt werden.<br />
Der Gewerbe- und Handelsverein schien ähnlich wie in Hanno-<br />
ver Industrieunternehmungen fördern zu wollen. In den Sta-<br />
tuten wurden die Aufgaben des Vereins allerdings nur sehr<br />
allgemein umrissen: neben seiner Gutachtertätigkeit für den<br />
Staat sowie der Koordinierung und Weiterleitung der aus der<br />
Wirtschaft kommenden Anträge wollte der Verein die tech-<br />
nisch-gewerblichen Fähigkeiten verbessern und dazu beitra-<br />
gen, das Gewerbewesen zu heben. Um dies zu erreichen, soll-<br />
ten Gewerbeausstellungen stattfinden, Zeitschriften, Bü-<br />
cher, Modelle angeschafft, Vorträge gehalten und die neue-<br />
sten Vorschläge und Erfindungen in den regelmäßigen Ver-<br />
sammlungen besprochen werden. Auch die Förderung von Gewer-<br />
be- und Industrieschulen war vorgesehen. 211 Der Chronik zu-<br />
folge beteiligten sich Handwerker an den Aktivitäten des<br />
Vereins, indem sie Vorträge über technische Neuerungen<br />
hielten, Erfindungen und verbesserte Verfahren aus dem ei-<br />
genen Arbeitsbereich sowie neue Produkte vorstellten. Sie<br />
beteiligten sich an den Gewerbeausstellungen oder errichte-<br />
210 Vgl. 125 Jahre ... , S.60<br />
211 Vgl. 125 Jahre ... , S.37; Schulze, H.-J., Oldenburgs<br />
Wirtschaft ... , S.131; Hofrat Ernst Friedrich Otto Lasius<br />
hielt anläßlich der ersten Versammlung des Vereins am<br />
8.10.1840 den Eröffnungsvortrag. Er sprach hierin besonders<br />
die Förderung der im Herzogtum verbreiteten Folgeindustrien<br />
der Landwirtschaft an (vgl. 125 Jahre ... , S.33).
548<br />
ten wie in Jever Niederlagen für Handwerksprodukte. 1848<br />
übten Handwerker Kritik an der wettbewerbsorientierten<br />
Richtung des Vereins, die den unmittelbaren Schutz, dessen<br />
besonders das Handwerk bedürfe, zu sehr vernachlässige.<br />
1851 bat das Handwerk den Verein um Unterstützung bei sei-<br />
nen Bemühungen um die Beibehaltung der bestehenden Hand-<br />
werksverfassung. Ein Gewerberat, der die Innungsverhältnis-<br />
se besser kenne als die bisher dafür zuständige Behörde,<br />
solle zukünftig in Fragen der Handwerksordnung entscheiden.<br />
Der Verein stimmte diesem Antrag auf Selbstverwaltung der<br />
eigenen beruflichen Belange durchaus zu. Jedoch wurde in<br />
der sich anschließenden Debatte kritisiert, daß dieser den<br />
städtischen Interessen zu wenig Aufmerksamkeit schenke und<br />
dies ein Grund dafür sei, warum sich namentlich Handwerker<br />
aus dem Verein zurückgezogen hätten. 212 Ein städtischer Hand-<br />
werkerverein bildete sich zunächst 1848 anläßlich der Aus-<br />
einandersetzung um den von staatlicher Seite eingeführten<br />
Schulzwang an der Sonntagsgewerbeschule. Er vermittelte<br />
zwischen den widerstrebenden Meistern und den Behörden,<br />
wurde sogar vom Magistrat für zwei Jahre mit der Leitung<br />
der Schule betraut. Darüber hinaus nahm er sich der lokalen<br />
wirtschaftlichen Interessen der städtischen Handwerksmei-<br />
ster an und kümmerte sich um Entwicklungen der überregiona-<br />
len Wirtschaftspolitik. Aber schon 1851 hatte der Verein<br />
seine Tätigkeit eingestellt. Erst 1865 erfolgte eine Neu-<br />
gründung: der oldenburgische Handwerkerverein entstand.<br />
Die beiden Schulen (gewerbliche Sonntagsschule [gegr.1836],<br />
höhere Bürgerschule [gegr.1844] werden gleichfalls zur kom-<br />
munalen Gewerbeförderung gerechnet: die eine, weil sie die<br />
Möglichkeit bot, die bisher ausschließlich vom Handwerk be-<br />
triebene und sich in Auflösung befindene Lehrlingsausbil-<br />
dung 213 durch berufsbegleitenden theoretischen Unterricht zu<br />
verbessern; die andere, weil sie den Erwerb höherer Quali-<br />
212 Vgl. Ebenda, S.59f.<br />
213 Vgl. Blankertz, H., Die Geschichte der Pädagogik. Von der<br />
Aufklärung bis zur Gegenwart, Wetzlar 1982, S.172 ff
549<br />
fikationen für gewerbliche Berufe, die den neuen Anforde-<br />
rungen in Technik und Naturwissenschaften gerechter wurden,<br />
ermöglichte.<br />
Im folgenden soll zunächst der Frage nachgegangen werden,<br />
mit welchen Mitteln Magistrat und Handwerkerverein versuch-<br />
ten, Lehrlinge und Meister von der Notwendigkeit einer<br />
schulischen berufsqualifizierenden Fortbildung zu überzeu-<br />
gen, mithin eine größere Akzeptanz der bestehenden Sonn-<br />
tagsschule - in Oldenburg allgemein Gewerbeschule genannt -<br />
zu erreichen. Welche Schwierigkeiten waren dabei zu über-<br />
winden?<br />
Im Vordergrund steht die Entwicklung der Schule in den 40er<br />
bis 60er Jahren. Seit 1815 wurde in einigen deutschen Staa-<br />
ten damit begonnen, gewerbliche Sonntagsschulen einzurich-<br />
ten, allerdings ohne daß diesen eine staatliche Unterstüt-<br />
zung zuteil wurde. Im Verlauf der 30er Jahre begann der<br />
planmäßige Ausbau eines öffentlichen Gewerbeschulwesens.<br />
Ein geordnetes Berufsschulwesen, das auf einer Berufsbil-<br />
dungstheorie basierte und sich die Lehrlingsausbildung in<br />
Form des „dualen Systems“ mit den Unternehmen teilte, ent-<br />
stand erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 214 Im Herzogtum<br />
214 Vgl. Jeschke, J., Gewerberecht und Handwerkswirtschaft<br />
... , S.191; vgl. Blankertz, H., Die Geschichte der Pädagogik<br />
... , S.207ff. - Einen für das in der vorliegenden Arbeit<br />
gestellte Thema bedeutsamen Zusammenhang bildet das<br />
sozialpolitische Interesse des Staates und verschiedener<br />
Verbände Ende des 19. Jahrhunderts an einer Neuorganisation<br />
und Stärkung der handwerklichen Berufsausbildung. Infolge<br />
des Handwerkerschutzgesetzes von 1897 wurden den Innungen<br />
wieder Korporationsrechte eingeräumt, Handwerkskammern neu<br />
gegründet. 1908 wurde das Halten von Lehrlingen vom Nachweis<br />
einer Meisterprüfung abhängig gemacht. Eine industrietypische<br />
Lehrlingsausbildung entstand so zunächst nicht,<br />
das Modell für Berufsausbildung blieb das Handwerk<br />
„Das Handwerk mußte jetzt zum normierenden Charakter der<br />
gesamten gewerblichen Ausbildung werden, weil das Gesetz<br />
auch Bestimmungen für Industrielehrlinge enthielt, deren<br />
Prüfungswesen an die Handwerkskammern band und damit die<br />
Entwicklung industrietypischer Ausbildungsformen vorerst<br />
unmöglich machte“ (Ebenda, S.205).<br />
Kennzeichnend für die Entwicklung des Berufsschulwesens<br />
war, daß das Problem der beruflichen Ausbildung lange Zeit<br />
weder von der Industrie noch von der Pädagogik aufgegriffen<br />
wurde. Hier stand der erziehende, allgemeinbildende Unter-
550<br />
Oldenburg wurde im behandelten Zeitraum kein Gesetz zur Er-<br />
richtung eines öffentlichen landesweiten Gewerbeschulwesens<br />
erlassen. Pläne dazu existierten bei den Regierungsbehör-<br />
den, jedoch kam die Entwicklung zunächst nicht über den<br />
Versuch in der Stadt Oldenburg hinaus. Dieser war indessen<br />
mit zahlreichen, für Erstgründungen typischen Problemen be-<br />
haftet. Grundsätzlich geklärt werden mußte die Ausrichtung<br />
der Schule: erweiterte Elementarschule oder anspruchsvolle-<br />
re Fachschule für Lehrlinge, Anteile berufsorientierter so-<br />
wie allgemeinbildender Fächer, Schulplan und Unterrichts-<br />
zeiten, Finanzierung und Leitung der Schule etc. Hier ent-<br />
standen Spannungen mit den Meistern, die sich in ihren Be-<br />
dürfnissen übergangen fühlten. Das Thema Gewerbeschule er-<br />
langte öffentliches Interesse und füllte dann auch die Lan-<br />
deszeitungen. Der Handwerkerverein, der Stadtrat, Lehrer<br />
u.a. Personen aus der Stadtbevölkerung taten ihre Ansicht<br />
zu strittigen Punkten kund. Nach außen hin offenbarte sich<br />
der Unmut der Meister sowie das Desinteresse der Lehrlinge<br />
im unregelmäßigen Schulbesuch. Trotz vielfältiger Bemühun-<br />
gen gelang es nicht, diesem Problem Herr zu werden, und die<br />
Schule kämpfte fortwährend um ihr Bestehen.<br />
Seit 1836 existierte in der Stadt eine private Gewerbeschu-<br />
le, die durch Spenden, Zuschüsse der Innungen sowie des<br />
Landesherrn finanziert wurde. 215 Der Unterricht beschränkte<br />
richt im Vordergrund, da war nur geringes Interesse an eigenen<br />
Ausbildungsformen für den Facharbeiternachwuchs vorhanden<br />
(vgl. Ebenda, S.201f.).<br />
215 Am 10.2.1836 forderte Stadtdirektor Wöbken verschiedene<br />
Personen - insgesamt 17 an der Zahl -, die an einer Gewerbeschulgründung<br />
interessiert waren, auf, sich im Rathaus zu<br />
versammeln. Man beschloß einen Verein zu bilden sowie einen<br />
Ausschuß (Vorstand) zu wählen. Das Konsistorium gestattete,<br />
daß der Unterricht im Gebäude des Gymnasiums jeweils am<br />
Sonntag außerhalb des Hauptgottesdienstes erteilt wurde.<br />
Der Ausschuß kündigte am 31.8. die baldige Eröffnung der<br />
Schule öffentlich an und forderte zu freiwilligen Beiträgen<br />
auf. Am 10.9. wurde der Schulplan sowie Spendenlisten in<br />
den öffentlichen Lokalen ausgelegt. Definitiv sollte die<br />
Schule Anfang Oktober eröffnet werden (vgl. Abriß der Gewerbeschulentwicklung<br />
1836 bis Februar 1848 im Anhang des<br />
Magistratsberichts v.28.12.1848, in: StAO Best.70,<br />
Nr.6684/F.2).
551<br />
sich zunächst auf Zeichnen, Rechnen und Schreiben. Es wur-<br />
den jährlich etwa 40 bis 50 Schüler aus Stadt und Land -<br />
insbesondere Lehrlinge und Gesellen - unterrichtet, die mit<br />
Erfolg die Abschlußprüfung bestanden. 216 Schon ein Jahr nach<br />
der Gründung bemängelte der Ausschuß den unregelmäßigen Be-<br />
such der Schule. Es wurde beschlossen, eine Bekanntmachung<br />
zu erlassen, die es nur denjenigen gestatten sollte, die<br />
Schule zu besuchen, welche sich verpflichteten, regelmäßig<br />
am Unterricht teilzunehmen. Über den Schulbesuch der Lehr-<br />
linge sollte genaue Kontrolle geführt werden. Angesichts<br />
unveränderter Umstände beantragte der Magistrat 1839 bei<br />
der vorgesetzten Behörde die Erweiterung der Schule zu ei-<br />
ner öffentlichen Anstalt mit Schulzwang. Zu diesem Zweck<br />
würden eine größere Anzahl von Lehrern, umfangreichere<br />
Geldmittel sowie eine gesicherte Finanzierung der Schule<br />
benötigt. Die Regierung sicherte ihre Unterstützung des<br />
Plans zu. 217<br />
1844 erneuerte der Magistrat seine Vorschläge zur Erweite-<br />
rung der bestehenden Gewerbeschule. Stadtrat, Innungen so-<br />
wie Handels- und Gewerbeverein hatten zugestimmt, daß die<br />
Schule zu einer öffentlichen Anstalt erhoben, eine zweijäh-<br />
rige Schulzeit und eine Teilnahmeverpflichtung am Unter-<br />
richt für Lehrlinge, die bei einem hiesigen Handwerksmei-<br />
ster in der Lehre standen, eingeführt werden sollte. Der<br />
Magistrat unterstrich die Notwendigkeit der schulischen<br />
Fortbildung angesichts der gestiegenen Anforderungen an die<br />
Gewerbe sowie der gewerblichen Entwicklung in anderen Län-<br />
dern. Da die Wichtigkeit und der Nutzen der Schule von der<br />
Mehrzahl der Meister und Lehrlinge aber nicht erkannt wer-<br />
de, müsse eben „der Fortschritt zum Bessern“ zunächst durch<br />
Zwang herbeigeführt werden. 218 Der Stadtrat bewilligte au-<br />
216 Vgl. Magistratsprotokoll v.27.7.1843 im Anhang des Magistratsberichts<br />
v.24.2.1844, in: Ebenda<br />
217 Vgl. Abriß der Gewerbeschulentwicklung ...<br />
218 Vgl. Magistratsprotokoll v.27.7.1843 und Magistratsbericht<br />
v.24.2.1844, in: Ebenda; die Schule nahm nicht nur<br />
die Lehrlinge, sondern auch alle in Arbeit stehenden Gesellen,<br />
Gewerbsgehilfen u.a. Personen auf, die sich zum regelmäßigen<br />
Besuch des Unterrichts verpflichteten (vgl. Art.4
552<br />
ßerdem einen jährlichen Zuschuß von 50 Rt Gold zu den Ko-<br />
sten der Anstalt aus der Stadtkasse; der Handels- und Ge-<br />
werbeverein sicherte einen jährlichen Beitrag von 40 Rt<br />
Gold zu; desgleichen die Innungen. Alle drei Gremien hatten<br />
jedoch Bedenken, Unterricht auch an den Abenden der Wochen-<br />
tage stattfinden zu lassen. Einige Handwerke, wie die der<br />
Schneider, Schuster und Schlachter, merkten an, daß sie ih-<br />
re Lehrlinge auch am Sonntagmorgen nicht entbehren könnten.<br />
Die Unterrichtszeiten wurden daraufhin noch nicht festge-<br />
legt. Der Magistrat bat zusätzlich um einen jährlichen Zu-<br />
schuß von 100 Rt aus der herrschaftlichen Kasse sowie um<br />
die Billigung des neun Artikel umfassenden Entwurfs einer<br />
Rahmenverordnung für die Oldenburger Gewerbeschule. 219<br />
1847 wich der Stadtrat in einigen Punkten von seiner Zu-<br />
stimmung zum Entwurf ab. Er wandte sich gegen die geplante<br />
Bildung eines besonderen Schulvorstandes, der aus einem<br />
Mitglied des Magistrats, des Stadtrats, des Direktoriums<br />
des Handels- und Gewerbevereins sowie einem vom Magistrat<br />
zu wählenden Innungsmeister und des leitenden Lehrers der<br />
Schule bestehen sollte. Die Schule müsse den Charakter ei-<br />
ner städtischen Anstalt wahren, also vom Magistrat und dem<br />
Stadtrat unter Oberaufsicht der Regierung geführt werden.<br />
Ersterer könne nötigenfalls kundige Handwerker hinzuzie-<br />
hen. 220 Weiterhin sprach er sich für eine Gewerbeschule als<br />
des vom Magistrat eingereichten Entwurfs einer Gewerbeschulverordnung<br />
im Anhang des Magistratsberichtes<br />
v.24.2.1844). Keinem Lehrling sollte künftig nach beendeter<br />
Lehrzeit ein Lehrbrief, ein Wanderbuch oder ein Paß ausgestellt<br />
werden, der nicht eine Bescheinigung über den zweijährigen<br />
Besuch der Gewerbeschule sowie der erfolgreich bestandenen<br />
Abschlußprüfung vorweisen konnte. Jeder Meister<br />
war verpflichtet, den Lehrling zum Besuch der Schule anzuhalten<br />
(vgl. Art.5 Ebenda).<br />
219 Vgl. Anhang zum Magistratsbericht v.24.2.1844, in: Ebenda;<br />
dort befindet sich auch das badische Gewerbeschulgesetz<br />
v.15.5.1834, das als Vorlage diente.<br />
220 Die wenigen Ausführungen zur Aufsicht und Leitung der<br />
Schule im Magistratsentwurf lassen nicht mit Sicherheit erkennen,<br />
ob der Schulvorstand in Eigenverantwortung unter<br />
städtischer Beteiligung die Schule leiten, oder ob er in<br />
eine staatliche Aufsicht eingebunden werden sollte. Die<br />
Ausführungen des Stadtrats lassen die erste Möglichkeit
553<br />
Fachschule aus, in der die Fächer Mathematik, Physik, Che-<br />
mie und Zeichnen weiterhin unterrichtet und diese Wissen-<br />
schaften vorzugsweise in ihrer Anwendung auf die Gewerbe<br />
gezeigt und gelehrt werden. Eine Elementarschule für Lehr-<br />
linge, in der die Schüler versäumten Stoff nachholten, wur-<br />
de abgelehnt. Die Unterrichtszeit wollte der Stadtrat auf<br />
den Sonntag beschränkt wissen. 221<br />
Am 3. Februar 1848 empfahl die Regierung den Entwurf zur<br />
Gewerbeschulverordnung dem Landesherrn und begründete aus-<br />
führlich den Zweck und den zu erwartenden Nutzen der Schu-<br />
vermuten. Jedenfalls wurde im Entwurf nicht deutlich, wer<br />
die übergeordneten Behörden waren und welche Kompetenzen<br />
bzw. Aufgaben die jeweiligen Instanzen erhalten sollten.<br />
Nur bezüglich der Aufstellung des Voranschlages für die<br />
Schule wurde der Adressat genannt: die Regierung; unklar<br />
blieb beispielsweise, wer den Schulplan erstellen sollte<br />
und an wen der Bericht über den Zustand der Schule zu richten<br />
war. Der Schulvorstand schien Lehrer eigenständig einstellen<br />
zu dürfen. - Die Idee, einen besonderen Schulvorstand,<br />
dem Personen aus der örtlichen Verwaltung, aus Technik<br />
und Gewerbe sowie aus der Kirche und der Lehrerschaft<br />
angehörten, einzusetzen, stammte aus dem badischen Gewerbeschulgesetz;<br />
nur hier war der Instanzenweg geregelt und der<br />
Vorstand hing nicht quasi in der Luft. Das Innenministerium<br />
entschied über Festsetzung und Abänderung der Lehrpläne,<br />
die Wahl der Lehrbücher sowie über die Anstellung von Lehrern.<br />
Dem jeweiligen Schulvorstand oblag es in erster Linie<br />
die Schulpflicht und den Vollzug der Unterrichtspläne zu<br />
überwachen; unter Zuziehung der Lehrer sollte über zweckdienliche<br />
Verbesserungen beratschlagt und jährlich ein<br />
Hauptbericht über den Zustand der Schule an die Kreisregierung<br />
gesandt werden.<br />
221 Seit 1841 wurde die Stadtknabenschule reformiert: u.a.<br />
wurde Unterricht in Mathematik, Physik, in Zeichnen und<br />
Turnen eingeführt vgl. Art.“Das Bürgerschulwesen in der<br />
Stadt Oldenburg“, in: Neue Blätter für Stadt und Land<br />
v.8.5.1847, S.162). - Vgl. Abriß der Gewerbeschulentwicklung<br />
...; Art.“Kleine Chronik: Im Stadtrathe zu Oldenburg“,<br />
in: Ebenda v.3.7.1847, S.227f. - Die badischen Gewerbeschulen<br />
erteilten keinen Elementarunterricht; Lehrlinge, denen<br />
es an hinlänglichen Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und<br />
Rechnen fehlte, wurden zur sog. Fortbildungsschule verwiesen.<br />
Die Gewerbeschule ließ sie nur am Unterricht im Zeichnen<br />
zu. Der Unterricht war auf die Wochentage verteilt und<br />
gestattete es daher, den Hauptgottesdienst an den Sonntagen<br />
zu besuchen (an Sonn- und Feiertagen 2-2 ½ Stunden im Sommerhalbjahr<br />
bzw. 1-1 ½ Stunden im Winterhalbjahr, jeweils<br />
eine Stunde am Abend der Wochentage) (vgl. badisches Gewerbeschulgesetz<br />
v.15.5.1834 im Anhang des Magistratsberichts<br />
v.24.2.1844, in: StAO Best.70, Nr.6684/F.2).
554<br />
le. Jungen Handwerkern, die sich den Besuch einer höheren<br />
Schulanstalt nicht erlauben konnten, sollte eine über den<br />
Elementarunterricht hinausreichende Ausbildung ermöglicht<br />
werden. Die Schule setze einerseits den Elementarunterricht<br />
in deutscher Sprache, Schreiben, Rechnen fort, andererseits<br />
berücksichtige sie die von der Volksschule nicht erfaßten<br />
speziellen Bedürfnisse des Handwerkers (Zeichnen, Buchfüh-<br />
rung). Die Schule fördere damit auf breiter Grundlage befä-<br />
higte Handwerker, deren Talent sonst womöglich nicht zur<br />
Entfaltung gekommen wäre. Die heutigen Anforderungen an den<br />
Handwerkerstand würden größere städtische Gemeinwesen gera-<br />
dezu dazu verpflichten, eine diesen Anforderungen entspre-<br />
chende Ausbildung zu gewährleisten. Aus Gründen des Gemein-<br />
wohls sei es daher auch zu rechtfertigen, mit Hilfe eines<br />
jährlichen staatlichen Zuschusses der Schule zu einer soli-<br />
den finanziellen Grundlage zu verhelfen. Aus dem Bericht<br />
geht weiterhin hervor, daß die Ansicht des Stadtrats über<br />
die Art und Weise der Leitung der Schule übernommen worden<br />
war. Die Absicht, einen Schulvorstand zu begründen, der die<br />
Belange der Schule in Form eines Vereins selbständig regel-<br />
te, schien fallengelassen worden zu sein. Jetzt sollte sie<br />
als eine Gewerbesache, wie andere städtische Einrichtungen,<br />
unter Oberaufsicht der Regierung vom Magistrat geführt wer-<br />
den. Dem verwaltenden Magistratsmitglied würden dann als<br />
Beirat einige Personen zugeordnet werden, die eingewilligt<br />
hatten, die Schule durch jährliche Geldbeiträge zu unter-<br />
stützen. Dies stelle auch ein dauerndes Interesse für die<br />
Schule sicher. 222<br />
Am 25.2.1848 ließ die Regierung eine Bekanntmachung veröf-<br />
fentlichen, die den Entwurf des Magistrats zur Grundlage<br />
hatte. Außerdem wurden jährlich 120 Rt aus der herrschaft-<br />
lichen Kasse für den Fall weiterhin zugesichert, daß auch<br />
die anderen Zuschüsse gezahlt werden würden. 223 Diese Ver-<br />
222<br />
Vgl. Regierungsbericht v.3.2.1848, in: StAO Best.70,<br />
Nr.6684/F.2<br />
223<br />
Vgl. Regierungsbekanntmachung, betr. die Errichtung einer<br />
Gewerbeschule in der Stadt Oldenburg v.25.2.1848, in: OGBl.
555<br />
ordnung, insbesondere der dort angekündigte Schulzwang,<br />
stieß nun auf den Widerstand der Meister. Dieser resultier-<br />
te aus dem Verlauf der Verhandlungen um die Neueinrichtung<br />
der Schule, in denen in den Augen der Meister ihre Bedürf-<br />
nisse keine Berücksichtigung gefunden hatten.<br />
Einblick in die Ursachen des Zerwürfnisses gibt ein vom<br />
Stadtratsmitglied W. Fortmann verfaßter Artikel, in dem er<br />
sein vergebliches Bemühen um die Interessenwahrung der Mei-<br />
ster und Lehrlinge, das zunächst mit seinem Austritt aus<br />
dem neugewählten Schulvorstand endete, beschrieb. 224 Fort-<br />
mann meinte, sich auch im Interesse der Meister für den<br />
Schulzwang einsetzen zu müssen, jedoch hielt er es für nö-<br />
tig, daß der Schulvorstand, der diesen Zwang künftig aus-<br />
führte, dann hauptsächlich aus Handwerkern bestehen müsse.<br />
Dieser Antrag wurde von Regierung und Magistrat abgelehnt.<br />
Gemäß der Verordnung wurde nur ein Handwerker in den Beirat<br />
gewählt, was zur Folge hatte, daß sich die Handwerksmeister<br />
in der Frage der Gewerbeschule, die sie als zu ihren eige-<br />
nen Angelegenheiten gehörig erachteten, übergangen fühlten.<br />
Weiterhin berichtete Fortmann, daß bei der Vorberatung über<br />
die Einrichtung der Schule kein von den Handwerkern gewähl-<br />
tes Mitglied zugegen gewesen war. Vier Lehrer, zwei Mit-<br />
glieder des Magistrats sowie des Stadtrats stimmten über<br />
die vorrangigen Unterrichtsinhalte ab. Der Antrag Fort-<br />
manns, die Gewerbeschule ausschließlich als Fachschule zu<br />
betreiben, um so auch zwei, in seinen Augen eher überflüs-<br />
sige, „Zwangs=Stunden“ einsparen zu können, wurde abge-<br />
lehnt. 225 In der ersten Sitzung des Schulvorstandes stimmte<br />
er für den Vormittagsunterricht am Sonntag, obwohl einige<br />
Bd.11 (1848), S.541-543; vgl. Abriß der Gewerbeschulentwicklung<br />
... ,in: StAO Best.70, Nr.6684/F.2<br />
224 Vgl. Art. „Die Gewerbeschule“, in: Der Beobachter<br />
v.30.6.1848, S.232<br />
225 Art.2 der Regierungsbekanntmachung v.25.2.1848 bestimmte,<br />
daß der Unterricht den Elementaruntericht in Schreiben,<br />
deutscher Sprache, Rechnen fortführen und daneben Zeichnen<br />
(„freier Handzeichnen und Linearzeichnen“) sowie<br />
„industrielle Wirtschaftslehre mit Anleitung zur einfachen<br />
Buchhaltung“ umfassen solle.
556<br />
Meister erklärt hatten, ihre Lehrlinge auch zu dieser Zeit<br />
in der Werkstatt zu benötigen. Fortmann erklärte sein Ver-<br />
halten mit der Notwendigkeit, Rücksicht auf das Ruhebedürf-<br />
nis der Lehrlinge nehmen zu müssen. Wenn der Lehrling ge-<br />
zwungen sei, in der Woche bis acht Uhr abends sowie am<br />
Sonntag den Vormittag über zu arbeiten, könne er nicht zu-<br />
sätzlich am Nachmittag noch die Schule von zwei bis sechs<br />
Uhr besuchen. Unglücklicherweise wurde nur das Eintreten<br />
Fortmanns für den Schulzwang sowie den Vormittagsunterricht<br />
ohne weitere Erklärungen in einer Handwerkerversammlung<br />
mitgeteilt. Die Folge war, daß die Meister nun den Schul-<br />
zwang und damit die Verordnung, die eine öffentliche Gewer-<br />
beschule begründen sollte, ablehnten.<br />
Die Gewerbeschulangelegenheit geriet ins Stocken. Doch im<br />
Handwerk war man zu einem Ausgleich der verschiedenen An-<br />
sichten bereit und schien, da auch der Magistrat angesichts<br />
der politischen Ereignisse seit März 1848 zögerte, die Ver-<br />
ordnung mit Gewalt durchzusetzen, an einem verbesserten<br />
Fortbestand der Schule interessiert. Ein Handwerkerverein,<br />
der sich der Gewerbeschulangelegenheit annahm, wurde ge-<br />
gründet. In den Vorstand wurden Tischlermeister Inhülsen,<br />
Klempnermeister W.Fortmann und Kupferschmiedemeister Meyer<br />
gewählt. Der Verein wählte außerdem einen Ausschuß, in dem<br />
die ersten Vorsteher der örtlichen Innungen vertreten wa-<br />
ren. Dem Magistrat bot sich damit die Gelegenheit, den Kon-<br />
flikt zu entschärfen, indem er die Neuordnung der Gewerbe-<br />
schule in die Hände des Vereins mit der Beteuerung legte,<br />
bei seinem Vorgehen niemals an eine Bevormundung der Hand-<br />
werker gedacht zu haben Die plötzliche Sinnesänderung der<br />
Meister gegenüber dem Schulzwang konnte sich der Magistrat<br />
jedoch nicht erklären.<br />
„Der Magistrat konnte sich zur Erreichung des durch<br />
die Gewerbeschule beabsichtigten Zweckes keinen günstigen<br />
Erfolg versprechen, wenn er die Ausführung jener<br />
Verordnung bei der allgemeinen Aufregung und bei<br />
dem, an sich zwar unbegründeten, Widerstande der<br />
Mehrzahl der hiesigen Handwerker mit Gewalt hätte<br />
durchsetzen wollen. Es konnte ihm daher nur willkommen<br />
seyn, daß der hiesige Handwerkerverein sich mit
557<br />
dieser Angelegenheit beschäftigte, da er hoffen durfte,<br />
daß auf diese Weise die Mehrzahl der hiesigen<br />
Handwerker sich am besten davon überzeugen werde, wie<br />
durch die gedachte Verordnung lediglich eine dem hiesigen<br />
Handwerkerstande zum Vortheil gereichende und<br />
dessen Hebung bezweckende Einrichtung beabsichtigt<br />
werde ...“. 226<br />
Am 4.10. wurden die Meister in einer Versammlung des Hand-<br />
werkervereins über gewünschte Unterrichtszeiten gehört; au-<br />
ßerdem wurde eine Schulkommission gewählt, die in Verbin-<br />
dung mit Lehrern einen Schulplan entwerfen und diesen dem<br />
Verein vorlegen sollte. 227 Außerdem beriet die Kommission<br />
Abänderungen der Verordnung vom 25. Februar, die vom Verein<br />
einstimmig angenommen und dem Magistrat vorgelegt wurden.<br />
Der Antrag hob hervor, daß die Meister den Schulzwang als<br />
226 Magistratsbericht v.28.12.1848, in: Best.70, Nr.6684/f.2;<br />
vgl. Art. „Handwerker=Verein“, in: Der Beobachter<br />
v.26.9.1848, S.334<br />
227 Vgl. Art.“Vereine“, in: Ebenda v.6.10.1848, S.349; am<br />
5.10. trat die Kommission erstmals zur Beratung zusammen.<br />
Ein vorläufiger Plan sah Unterricht am Sonntag Vormittag (4<br />
Stunden), am Nachmittag (2 Stunden) sowie am Montag Abend<br />
(2 Stunden) vor. Es sollte eine „Elementar-“ und eine<br />
„Oberklasse“ eingerichtet werden. Am Vormittag erhielt nur<br />
die Oberklasse 2 Stunden Unterricht im Zeichnen. Sonst wurde<br />
Schreiben, Rechnen, deutsche Sprache und Aufsatz, Geographie<br />
und Geschichte erteilt. Am Nachmittag wurde in der<br />
Elementarklasse Handzeichnen, in der Oberklasse Geometrie,<br />
Naturlehre und Technologie gegeben. Am Montag abend erfolgte<br />
nur Elementarunterricht in den Fächern deutsche Sprache,<br />
Rechnen und Schreiben. Der Plan wurde nochmals dahin geändert,<br />
daß auf Wunsch des Vorstandes des Handwerkervereins,<br />
der stärker den Fachschulcharakter hervortreten lassen<br />
wollte, dieser Unterricht um vier Stunden gekürzt wurde.<br />
Die „Unterklasse“ erhielt jetzt auch am Vormittag einen<br />
zweistündigen Unterricht im Zeichnen, die „Oberklasse“ wurde<br />
im Zeichnen vier Stunden unterrichtet. Der Schulplan<br />
wurde am 16.10. in der Versammlung des Handwerkervereins<br />
einstimmig angenommen. Die Meister wurden aufgefordert zu<br />
erklären, an welchen der Stunden sie ihre Lehrlinge teilnehmen<br />
lassen wollten. Die Kommission betonte, daß der vorliegende<br />
Schulplan die Lehrlinge nicht hindere, die Kirche<br />
zu besuchen, da jeweils Parallelstunden zu anderen Zeiten<br />
angeboten würden (vgl. Art.“Gewerbeschule“, in: Neue Blätter<br />
für Stadt und Land v.11.10.1848, S.415-418; vgl.<br />
Art.“Plan der Gewerbeschule“, iin: Ebenda v.21.10.1848,<br />
S.431). Doch kurz darauf wurde genau dies von der Synode<br />
kritisiert (vgl. Art.“Die Gewerbeschule“, in: Ebenda<br />
v.28.10.1848, S.439).
558<br />
Eingriff in ihre bürgerlichen Rechte auffaßten, da nur die<br />
Handwerker der Stadt Oldenburg von ihm erfaßt werden wür-<br />
den. In ihren Augen sei nur ein allgemeiner Schulzwang, der<br />
sich auf alle Lehrlinge der übrigen Städte des Landes aus-<br />
dehne, gerechtfertigt. Die Kommission folgerte nun daraus,<br />
daß der hiesige Schulzwang nur dann von den Meistern akzep-<br />
tiert werden würde, wenn den Handwerkern selbst die Handha-<br />
bung der Verordnung übertragen werde. Der Schulvorstand,<br />
der dem Magistrat auch weiterhin unterstellt sein sollte,<br />
müsse künftig von fünf Handwerkern gebildet werden, die von<br />
sämtlichen Meistern der Stadt zu wählen seien. Zwei Lehrer<br />
der Schule stünden ihm als stimmführende Mitglieder zur<br />
Seite. 228<br />
Der Magistrat befürwortete die vorgeschlagenen Abänderun-<br />
gen, wollte jedoch zunächst geklärt wissen, ob die Zuschüs-<br />
se auch weiterhin gezahlt werden würden und damit die fi-<br />
nanzielle Grundlage der Schule gesichert sei. 229 Der Regie-<br />
rung gegenüber machte er die Annahme der Abänderungswünsche<br />
davon abhängig, ob in nächster Zeit eine allgemeine Verord-<br />
nung zur Errichtung und Unterhaltung von Gewerbeschulen im<br />
Land oder sogar überregional erlassen werde, oder ob es<br />
einzelnen Städten, Gemeinden oder Innungen überlassen blei-<br />
be, nach ihren Bedürfnissen Gewerbeschulen einzurichten. 230<br />
Im Februar des folgenden Jahres teilte die Regierung dem<br />
Handwerkerverein mit, daß sie es für ratsam halte, das Ge-<br />
such zum jetzigen Zeitpunkt abzulehnen. Das demnächst er-<br />
scheinende Staatsgrundgesetz sehe vor, in jedem Kreis des<br />
228<br />
Vgl. Gesuch des Handwerkervereins v.8.11.1848, in: StAO<br />
Best.70, Nr.6684/F.2; der Antrag enthielt noch drei weitere<br />
Wünsche nach Abänderungen, die sich auf den Zeitpunkt des<br />
Unterrichts während der Lehre, die Voraussetzungen dafür,<br />
daß Lehrbrief, Paß oder Wanderbuch ausgegeben wurden sowie<br />
auf die Begrenzung des Unterrichts auf den Abend eines<br />
Werktages bezogen. Der Antrag des Handwerkervereins wurde<br />
wenig später in den Neuen Blättern veröffentlicht (vgl.<br />
Art.“Für die Gewerbeschule“, in: Neue Blätter für Stadt und<br />
Land v.15.11.1848, S.461).<br />
229<br />
Vgl. Magistratsprotokoll v.16.11.1848, in: StAO Best.70,<br />
Nr.6684/F.2<br />
230<br />
Vgl. Magistratsbericht v.28.12.1848, in: Ebenda
559<br />
Landes Gewerbeschulen errichten zu lassen. Die Angelegen-<br />
heit müsse bis nach geregelter Gesetzgebung auf sich beru-<br />
hen. Der Magistrat fügte ergänzend hinzu, daß er gern be-<br />
reit sei, die Leitung der Oldenburger Gewerbeschule bis zur<br />
endgültigen Regelung des gesamten Schulwesens etwa in einem<br />
Jahr dem Handwerkerverein zu übertragen. 231 Am 22.4.1849<br />
wurde die Gewerbeschule dann neu eröffnet. 232<br />
Rekapituliert man die bisherigen Ereignisse und fragt da-<br />
nach, was die Handwerker in der Gewerbeschulangelegenheit<br />
erreicht hatten, so fällt das Ergebnis gering aus. Die<br />
Schule wurde zwar vorläufig von Handwerkern geführt, dies<br />
aber ohne eine, eigentlich von allen Gruppierungen als not-<br />
wendig erachtete, gesetzliche Begründung. Die vorgeschlage-<br />
nen Abänderungen der Regierungsbekanntmachung waren abge-<br />
lehnt, der staatliche Zuschuß seit dem Ausscheren der Mei-<br />
ster eingestellt worden. 233<br />
Schon im März 1850, kurz vor Ende des Wintersemesters,<br />
schien die Schule ihre Tätigkeit einstellen zu müssen. Um<br />
dies abzuwenden, hatte die Kommission für den 27. März eine<br />
Handwerkerversammlung einberufen, in der jetzt über die An-<br />
nahme oder Ablehnung der ursprünglichen Regierungsbekannt-<br />
machung mit einer Abänderung - drei Handwerksmeister soll-<br />
ten in den Schulvorstand gewählt werden - abgestimmt werden<br />
sollte.<br />
Dieses Vorgehen, durch Abkehr von den eigenen Forderungen<br />
doch noch eine gesetzliche Ordnung für die Schule zu erhal-<br />
231<br />
Vgl. Art. „Im Handwerkerverein zu Oldenburg“, in: Der Beobachter<br />
v.16.2.1849, S.54f.; konkret übergab der Magistrat<br />
dem Verein die Leitung vorläufig von Ostern 1849 bis Ostern<br />
1850. Die bisherige Schulkommission des Vereins wurde in<br />
einer Handwerkerversammlung bestätigt; zwei Lehrer traten<br />
hinzu, von denen einer, Dr. Günther, die Leitung übernahm<br />
(vgl. Art.“In der Versammlung des Handwerkervereins am<br />
26.Februar“, in: Ebenda, S.80; Gesuch des Handwerkervereins<br />
v.13.4.1849, in: StAO Best.70, Nr.6684/F.2).<br />
232<br />
Vgl. Art.“Die Gewerbeschule“, in: Ebenda v.24.4.1849,<br />
S.131f<br />
233<br />
Vgl. Gesuch des Handwerkervereins v.13.4.1849, in: StAO<br />
Best.70, Nr.6684/F.2; in dem Gesuch bat der Verein den Landesherrn<br />
darum, erneut einen jährlichen Zuschuß aus der<br />
herrschaftlichen Kasse zu bewilligen.
560<br />
ten, nahm C.Harms, Lehrer an der höheren Bürgerschule, zum<br />
Anlaß, das ablehnende Verhalten der Handwerker gegenüber<br />
dem Schulzwang seit Beginn des Jahres 1848 sowie ihre Be-<br />
strebungen nach mehr Beteiligung an der inneren und äuße-<br />
ren Verwaltung der Schule zu kritisieren. 234 Harms stellte<br />
die Forderungen der Meister in einen Zusammenhang mit den<br />
demokratischen Bewegungen seit der Pariser Februarrevoluti-<br />
on. Erst die bevorstehende Abstimmung in der Handwerkerver-<br />
sammlung zeuge von einem erneuerten Realitätssinn. Die An-<br />
gelegenheiten der Schule müßten zu ihrem Besten vom Magi-<br />
strat geführt werden, da nur so die Schulpflicht wirksam<br />
durchgesetzt werden könne. Wichtiger als die Anzahl der<br />
Handwerker im Beirat sei außerdem die Sorge um einen fähi-<br />
gen Direktor und ein fachlich und pädagogisch kompetentes<br />
Kollegium. Die Meister im Beirat könnten wohl Unstimmigkei-<br />
ten mit dem Handwerk zugunsten der Schule ausräumen, sie<br />
sollten jedoch keinen Einfluß auf die inneren Angelegenhei-<br />
ten der Schule, insbesondere auf den Unterricht, gewinnen.<br />
Die richtige Einsicht erwachse nicht aus der Menge - Anzahl<br />
der Handwerker im Beirat -, sondern aus der persönlichen<br />
Entscheidung des Lehrers.<br />
Daraufhin meldete sich im „Beobachter“ eine Gegenstimme zu<br />
Wort, die die Arbeit der Schule würdigte und das Urteil<br />
Harms´für arrogant und autoritär erachtete. Auch der Vor-<br />
stand des Handwerkervereins ließ einen Artikel veröffentli-<br />
chen, in dem er nochmals die Position der Meister hinsicht-<br />
lich des Zusammenhanges zwischen Schulzwang und Beteiligung<br />
234 Vgl. Art. „Auszug aus der Regierungsbekanntmachung betreffend<br />
„die Errichtung einer Gewerbeschule in der Stadt<br />
Oldenburg““, in: Neue Blätter für Stadt und Land<br />
v.23.3.1850, S.105-107; Johann Caspar Christian Georg Harms<br />
war Lehrer an der höheren Bürgerschule. Seit 1845 studierte<br />
er Mathematik und Naturwissenschaften. 1847 bestand er die<br />
Prüfung für das höhere Lehramt und wurde 1852 zum Oberlehrer,<br />
1873 zum Professor ernannt. Harms war für die Schule<br />
in vielfältiger Weise wirksam. Er verfaßte wichtige Arbeiten<br />
zur Entwicklung des Oldenburger Schulwesens, zu Fragen<br />
der Schulreform sowie zu naturwissenschaftlichen Themen<br />
(vgl. Klattenhoff, K., Art. „Johann Caspar Christian Georg<br />
Harms“, in: Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes<br />
Oldenburg ... , S.283).
561<br />
der Handwerker an der Leitung der Schule erläuterte. Die<br />
Mitsprache gewährleiste, daß Interessen und Bedürfnisse der<br />
Meister berücksichtigt werden würden. Die Verpflichtung zum<br />
Unterrichtsbesuch könne dann als notwendiges Opfer für die<br />
Fortbildung der Lehrlinge erbracht werden. Außderdem be-<br />
stünden keine Berührungspunkte zwischen dem Verfahren des<br />
Handwerkervereins und „demokratischen Bewegungen“ des Jah-<br />
res 1848. 235<br />
Im April fand nun die angekündigte Handwerkerversammlung<br />
statt. Aus verschiedenen Vorträgen ging hervor, daß die<br />
Schule nicht den erwarteten Erfolg gehabt hatte und die<br />
Redner sich von der Einführung des Schulzwangs das ent-<br />
scheidende Mittel gegen den endgültigen Niedergang dersel-<br />
ben versprachen. Die Gewerbeschulverordnung mitsamt der ge-<br />
wünschten Abänderung wurde dann auch gegen vier Stimmen an-<br />
genommen. 236<br />
Magistrat und übergeordnete Behörden schienen jedoch das<br />
Versäumen der Schulpflicht nicht systematisch sanktioniert<br />
zu haben. Die unregelmäßige Teilnahme am Unterricht blieb<br />
bestehen. Der Widerwille der Meister und Lehrlinge gegen-<br />
über der Schule war in den Augen des Handwerkervereins, der<br />
sich inzwischen aufgelöst hatte, deswegen geblieben, weil<br />
weder der gewöhnliche Elementarunterricht noch der Unter-<br />
richt am Abend abgeschafft worden war. Eine fachlich ge-<br />
zielter ausbildende Gewerbeschule, die den Vorstellungen<br />
des Staats, der Stadtgemeinde und des Gewerbevereins von<br />
der Wirksamkeit einer Institution eher entspräche, wäre au-<br />
ßerdem kontinuierlich finanziell unterstützt worden. 237<br />
Der Zustand der Schule besserte sich auch in den folgenden<br />
Jahren nicht. 1861 fiel zunächst mit der Einführung der Ge-<br />
235 Vgl. Art. „Herr Christian Harms, Lehrer an der höheren<br />
Bürgerschule hieselbst“, in: Der Beobachter v.26.3.1850,<br />
S.101f.; Art. „Eine Erwiederung, die Gewerbeschule betreffend“,<br />
in: Neue Blätter für Stadt und Land v.30.3.1850,<br />
S.119<br />
236 Vgl. Art. „Handwerker=Versammlung im „Neuen Hause““, in:<br />
Der Beobachter v.2.4.1850, S.110<br />
237 Vgl. Art. „Der Handwerkerverein und die Gewerbeschule“,<br />
in: Ebenda v.2.9.1851, S.279f.
562<br />
werbefreiheit der Schulzwang erneut weg. 1863 stellte der<br />
Magistrat wiederum fest, daß der Schulbesuch zu wünschen<br />
übrig lasse, hoffte aber auf die Einsicht der Eltern, daß<br />
besonders unter der Gewerbefreiheit die gezielte Fortbil-<br />
dung der Handwerker nötig sei. Den Meistern sollte es in<br />
den Lehrverträgen ausdrücklich zur Pflicht gemacht werden,<br />
den Lehrling zum Gewerbeschulbesuch anzuhalten. 238<br />
Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Möglichkeiten<br />
der Weiterqualifikation durch berufsbegleitenden theoreti-<br />
schen Unterricht in der von der Gewerbeschule präsentierten<br />
Form vom Handwerk nur zögernd genutzt wurden. Obwohl 1850<br />
definitiv die Schule in staatliche Schulträgerschaft über-<br />
führt, Zweck, Unterrichtsinhalte und die Verpflichtung zum<br />
Schulbesuch auf dem Verordnungsweg geregelt worden waren,<br />
erhoben sich weiterhin Klagen über die fluktuierende Unter-<br />
richtsteilnahme der Lehrlinge. Das Vorgehen des Magistrats<br />
sowie des Handwerkervereins war in den Verhandlungen immer<br />
wieder durch das Bemühen geprägt, die Meister zu konstruk-<br />
tiver Mitarbeit heranzuziehen und die Fronten nicht verhär-<br />
ten zu lassen. Die unmittelbaren Streitpunkte, die den Mei-<br />
stern den Gewerbeschulbesuch beschwerlich erscheinen lie-<br />
ßen: Unterricht an den Wochenabenden, Elementarunterricht,<br />
lokaler Schulzwang und wirksame Beteiligung von Handwerkern<br />
an der Leitung der Schule, könnten teilweise mit schulorga-<br />
nisatorischen Problemen erklärt werden. Die badischen Ge-<br />
werbeschulen beispielsweise waren in der Lage, sich auf um-<br />
fassenden Fachunterricht zu konzentrieren, denn Lehrlinge,<br />
denen ausreichende Kenntnisse in den elementaren Fertigkei-<br />
ten fehlten, wurden auf, den Volksschulen nachgeordnete<br />
Fortbildungsschulen verwiesen. Da Unterricht auch an den<br />
Werktagen stattfand, konnten die Stunden über mehrere Tage<br />
verteilt angeboten werden. Die Schule geriet so nicht in<br />
Auseinandersetzungen mit der Kirche darüber, ob es den<br />
Lehrlingen auch möglich sein werde, den sonntäglichen Got-<br />
tesdienst zu besuchen. Die Oldenburger Gewerbeschule war<br />
238 Vgl. Magistratsbericht v.24.1.1863, in: StAO Best.70,<br />
Nr.6684
563<br />
ein erster Versuch dieser Art im Herzogtum, vieles an ihr<br />
war noch provisorisch, sie war nicht eingebunden in ein öf-<br />
fentliches flächendeckendes Gewerbeschulwesen. Eine allge-<br />
meine Neuordnung des Schulwesens war erst in Aussicht ge-<br />
stellt worden. Hinzu trat, daß das Oldenburger Handwerk,<br />
wie schon oben gezeigt, noch kaum vom wirtschaftlichen Wan-<br />
del erfaßt worden war. Viele Meister, die in Kleinbetrieben<br />
produzierten, verspürten in ihrem unmittelbaren Umfeld kei-<br />
nen direkten Druck, sich an neue Erfordernisse anzupassen<br />
und sich umzustellen. Daher war es für die Behörden, die<br />
die Entwicklung in anderen Ländern beobachteten und den<br />
Nachwuchs des Oldenburger Gewerbes darauf vorbereiten woll-<br />
ten, schwierig, sie von der Bedeutung schulischer Fortbil-<br />
dung zu überzeugen. 239<br />
Das Bedürfnis der Gewerbetreibenden nach einer allgemeinen<br />
wissenschaftlich orientierten, auf Realien basierenden<br />
Schulbildung für ihre Söhne, die durch berufsbezogene Fä-<br />
cher ergänzt werden sollte, schien hingegen größer zu sein.<br />
Die höhere Bürgerschule sollte besonders den Handwerkern<br />
Gelegenheit geben, sich über den Unterricht der Stadtschule<br />
hinaus die für ihre Ausbildung notwendigen Kenntnisse zu<br />
erwerben. Daher waren viele Gewerbetreibende dem Aufruf des<br />
Stadtrats gefolgt, durch Spenden die neue Schule zu unter-<br />
239 Um den Ursachen für das nicht geringe Desinteresse der<br />
Meister und Lehrlinge näher auf die Spur zu kommen, böte<br />
sich die Möglichkeit, die tatsächliche Verwertbarkeit des<br />
schulischen Bildungsangebotes für die einzelnen Handwerksberufe<br />
zu untersuchen. Mit Hilfe von Angaben zur sozialen<br />
Lage der Handwerksmeister und zur inhaltlichen Unterrichtsarbeit<br />
der Schule könnte der Frage nachgegangen werden, ob<br />
das jeweilige Fach tatsächlich in Form und Inhalt den Bedürfnissen<br />
eines bestimmten Handwerksberufs in Oldenburg<br />
entsprach. Anders ausgedrückt: „Konnten die .. Handwerker<br />
angesichts der städtischen Sozial- und Marktstrukturen tatsächlich<br />
im Bildungsangebot eine Verbesserung ihrer Situation<br />
als kleine Warenproduzenten erblicken?“ (Rezension von<br />
Toni Offermann u. Kall-Wallenthal über Huge, W., Handwerkerfortbildung<br />
im 19. Jahrhundert. Zum Widerstand Osnabrükker<br />
Handwerksmeister und Gesellen gegen neuzeitlichmodernes<br />
Bildungs- und Berufswissen, Bad Heilbrunn/Obb.<br />
1989, in: Archiv für Sozialgeschichte Bd.31/1991, S.704)
564<br />
stützen. 240 Daß mit Billigung der Schulkommission und des<br />
Konsistoriums Latein in den Lehrplan aufgenommen worden war<br />
und der Magistrat das Schulgeld erhöht hatte, werteten<br />
Handwerker und Stadtrat nun als ein Unterlaufen der ur-<br />
sprünglichen Zielsetzung der Bürgerschule. Ca. 30 Handwer-<br />
ker übergaben dem Stadtrat eine Petition, in der sie fest-<br />
stellten, daß die Aufnahme von Schülern aus der Stadtschule<br />
dadurch, daß man Lateinkenntnisse voraussetze, sehr er-<br />
schwert werde. Die Schule scheine überdies eher als Vor-<br />
schule für das Gymnasium eingerichtet worden zu sein, da<br />
mit Hilfe des eingeführten Lateinunterrichts der Übergang<br />
auf dasselbe ermöglicht werden sollte. Im weiteren fehle<br />
die Zeit, die auf den Unterricht in Latein verwendet würde,<br />
bei der Vermittlung der für die Gewerbetreibenden notwendi-<br />
gen Gegenstände. Buchführung und Schönschreiben seien noch<br />
gar nicht, die neueren Sprachen nur sehr eingeschränkt un-<br />
terrichtet worden. 241<br />
Zwischen 1844 und 1847 spiegelte sich der Disput über die<br />
Lateinfrage auch in den Oldenburger Zeitungen wider. Der<br />
Stadtrat als Sprachrohr der Gewerbetreibenden plädierte für<br />
die Abschaffung des Lateinunterrichts an der Bürgerschule,<br />
erwog andernfalls aber auch die Errichtung einer besonderen<br />
Realklasse in der Stadtknabenschule. 242<br />
240 Vgl. Art. „Höhere Bürgerschule - Stadtschule“, in: Neue<br />
Blätter für Stadt und Land v.10.8.1844, S.296<br />
241 Vgl. Art. „Die lateinische Frage (Vorstellung des Stadtraths<br />
zu Oldenburg an das Großherzogliche Consistorium)“,<br />
in: Ebenda v.4.6.1845, S.206<br />
242 Vgl. Art. „Stadtrathsverhandlungen in Oldenburg“, in:<br />
Ebenda v.8.5.1844, S.174. - Der Vorschlag, die Stadtknabenschule<br />
zu erweitern, konnte zunächst nicht weiterverfolgt<br />
werden. Im August 1844 teilte der Stadtrat dann einen Beschluß<br />
der Schulkommission und des Vorstandes der Stadtschulen<br />
mit, demzufolge „[...] die älteren Schüler der ersten<br />
Classe der Stadtschule von den für die Chemie und Physik<br />
bestimmten Lehrern der höheren Bürgerschule in diesen<br />
Wissenschaften unterrichtet werden, und soll in der Stadtschule<br />
der Unterricht im Zeichnen auf eine gründlichere und<br />
umfassendere Weise [...] ertheilt werden.“ (Art. „Höhere<br />
Bürgerschule - Stadtschule“, in: Ebenda, S.296). Im Februar<br />
1847 unterzeichneten 89 Bürger eine protokollarische Erklärung,<br />
in der um die Bewilligung von jährlich 800 Rt Gold<br />
aus der Stadtkasse für die Einrichtung einer „Oberklasse
565<br />
Es ging dabei hauptsächlich um zwei Streitpunkte. Einmal<br />
wurde von den Befürwortern der Einführung von Latein die<br />
Bildungsfähigkeit der Naturwissenschaften angezweifelt.<br />
Hingegen gewährleistete in ihren Augen besonders die ver-<br />
tiefte Behandlung der alten Sprachen im Unterricht das an-<br />
gestrebte Maß an menschlicher Allgemeinbildung. Die Be-<br />
schäftigung mit den Naturwissenschaften wurde der Berufs-<br />
vorbereitung zugeordnet. Sie verschaffe allenfalls Kennt-<br />
nisse, ohne Einblick in größere Zusammenhänge zu geben, sei<br />
auf Nützlichkeit und Verwertbarkeit hin angelegt und för-<br />
dere überdies den Hang zu Materialismus sowie die Tendenz<br />
zu geistiger Verarmung. Am Maßstab der neuhumanistischen<br />
Bildungstheorie gemessen wurden aus der postulierten Tren-<br />
nung von Bildung und Ausbildung sowie dem Vorrang der all-<br />
der Knabenschule“ gebeten wurde. Die Vorstellung ging davon<br />
aus, daß die Bürgerschule nicht der für das Gewerbe bestimmten<br />
Jugend entspreche, das Schulgeld zu hoch sei und<br />
deshalb eine Klasse für 14jährige Schüler ohne Schulzwang<br />
auf der Stadtschule einzurichten sei. Hier waren, so<br />
scheint es, Handwerker initiativ geworden, deren Söhne mit<br />
15 Jahren eine Handwerkslehre beginnen sollten (die Bürgerschule<br />
entließ ihre Schüler erst mit 16 oder 17 Jahren).<br />
Den „Candidaten des gewöhnlichen industriellen bürgerlichen<br />
Geschäftslebens und der Kunst“ sollte ein erweiterter Unterricht<br />
im Zeichnen, Modellieren, in Mathematik, Chemie,<br />
Technologie und Naturkunde erteilt werden. Der Magistrat<br />
lehnte im März diesen Vorschlag mit der Begründung ab, daß<br />
er nicht dem Zweck der bisherigen Schulreform, die den Kindern<br />
aller Bewohner der Stadtgemeinde durch öffentliche<br />
Schulen eine den Bedürfnissen und Anforderungen der Zeit<br />
entsprechende allgemein-menschliche Bildung sowie einen für<br />
den künftigen Beruf vorbereitenden Unterricht zuteil kommen<br />
lassen wolle, entspreche. Hier werde eine besondere Fachbildung<br />
für angehende Handwerker durch einen einjährigen<br />
Schulbesuch, der zumal auf freiwilliger Basis erfolgen<br />
sollte, angestrebt, ohne daß die neue Klasse in einem inneren<br />
Zusammenhang mit der Stadtschule stehe. Der Vorschlag<br />
bezwecke eigentlich die Einrichtung einer Gewerbeschule.<br />
Daher könnten die Gelder, falls sie bewilligt werden sollten,<br />
besser für deren Ausbau verwendet werden (vgl. Art.<br />
„Das Bürgerschulwesen in der Stadt Oldenburg“, in: Ebenda<br />
v.8.5.1847, S.161-163). Auch der Stadtrat lehnte daraufhin<br />
im Interesse der Gewerbetreibenden den Plan ab (vgl. Art.<br />
„Das Bürgerschulwesen in der Stadt Oldenburg (Beschluß)“,<br />
in: Ebenda v.12.5.1847, S.165). Die Absicht, eine Einrichtung<br />
neben der Bürgerschule einzuführen, die dem angehenden<br />
jungen Handwerker eine weiterführende Schulbildung vermittelte,<br />
wurde damit fallengelassen.
566<br />
gemeinen Menschenbildung fälschlicherweise die Diskriminie-<br />
rung der Berufsausbildung abgeleitet. Außerdem war das Ziel<br />
einer allgemeinen Menschenbildung nicht an bestimmte Inhal-<br />
te geknüpft, sondern ergab sich aus der Methode, einen Ge-<br />
genstand gründlich systematisch zu vermitteln. Ausschlagge-<br />
bend war die Intentionalität der pädagogischen Vermittlung.<br />
Dieser Argumentation folgten dann auch die Gegner des La-<br />
teinunterrichts. 243 Zum anderen wurde Latein für die Bürger-<br />
schule mit der Begründung reklamiert, daß sie allen Schü-<br />
lern, die kein Studium anstrebten, offen stehe und nicht<br />
speziell eine Schule für die Söhne von Gewerbetreibenden<br />
sei. Auch Beamtensöhnen, die Handel und Gewerbe treiben<br />
243 Vgl. Blankertz, H., Die Geschichte der Pädagogik ... ,<br />
S.119f., 141, der sehr deutlich die Unterschiede zwischen<br />
den bildungstheoretischen Prämissen und den sozialgeschichtlichen<br />
Wirkungen des Neuhumanismus herausarbeitet. -<br />
Heinrich Hoyer wandte sich 1844 mit einer Flugschrift an<br />
die Öffentlichkeit, in der er eindringlich und ausführlich<br />
die Notwendigkeit, Bürgerschulen angesichts der fortschreitenden<br />
Industrialisierung zu errichten, vor Augen stellte.<br />
Er forderte dazu auf, den Gewerbetreibenden, die sich dem<br />
Handel, Handwerk, Landbau, den technischen Fächern widmen<br />
wollten, anhand von Gegenständen, die ihnen nützliches Wissen<br />
für ihren zukünftigen Beruf vermittelten, eine wissenschaftlich<br />
orientierte, zugleich allgemeine Menschenbildung<br />
zu gewähren (vgl. Hoyer, H., Der Gewerbestand und die höhere<br />
Bürgerschule. Ein Wort an meine Mitbürger, Oldenburg<br />
1844). Auch der Stadtrat ging auf die Verbindung nützlicher<br />
Kenntnisse für den Beruf mit dem Ziel allgemeiner Menschenbildung<br />
ein und strich die Notwendigkeit von Latein für gelehrte<br />
Berufe im Gegensatz zu bürgerlichen Tätigkeiten heraus<br />
(vgl. Art. „Die lateinische Frage“, in: Neue Blätter<br />
für Stadt und Land v.4.6.1845, S.207). Zwei Jahre später<br />
wies er nochmals auf die Bildungsbedürfnisse des Gewerbetreibenden<br />
hin. Gerade der Erwerb naturwissenschaftlicher<br />
Grundlagen mache „[...] seine mechanische Beschäftigung zur<br />
geistigen [...]“, erhebe „[...] den Menschen über den<br />
Standpunkt eines todten Werkzeugs [...]“ und wirke zugleich<br />
„[...] den zerstörenden Einflüssen auf die äußere Existenz<br />
des Gewerbstandes, durch die Concurrenz etc., am sichersten<br />
und würdigsten [...]“ entgegen (vgl. Art. „Das Bürgerschulwesen<br />
in der Stadt Oldenburg (Beschluß)“, in: Ebenda<br />
v.12.5.1847, S.166). - Den Verlauf der Diskussion über die<br />
Einführung von Latein an der Bürgerschule bis zur Abschaffung<br />
des Fachs im Oktober 1848 schildert Hillje, B., Humanistische<br />
Bildung oder realistische Bildung? Die Auseinandersetzungen<br />
um das mittlere Schulwesen in der Stadt Oldenburg<br />
im 19. Jahrhundert, Staatsexamensarbeit (ms.), Oldenburg<br />
1989, S.36-40.
567<br />
oder in den Staatsdienst gelangen wollten, stehe es frei,<br />
diese Schule zu besuchen. 244 Gegner des Lateinunterrichts,<br />
die die Eigenständigkeit der Schule bewahren wollten, wie-<br />
sen auf die kritischen Äußerungen Magers über die Entwick-<br />
lung des preußischen Realschulwesens hin. Der Staat habe<br />
dort durch die Einsetzung von Prüfungsordnungen, Lehrpla-<br />
nänderungen und die Vergabe von Berechtigungen für den<br />
Staatsdienst sich die Schulen, die ursprünglich bürgerliche<br />
Bildung vermittelten,für die Ausbildung des eigenen Nach-<br />
wuchses dienstbar gemacht. 245<br />
Im Gegensatz zur Entwicklung der Gewerbeschule, die eher<br />
darunter litt, daß eine Berufsbildungstheorie sowie Rege-<br />
lungen zur Einführung eines landesweiten Gewerbeschulwesens<br />
noch nicht existierten, mußte sich die Bürgerschule mit den<br />
Ansprüchen des allgemeinbildenden öffentlichen Schulwesens<br />
auseinandersetzen. Die Diskussion über das Für und Wider<br />
von Lateinunterricht an der Bürgerschule läßt erkennen, daß<br />
244 Vgl. Art. „Ist der über die höhere Bürgerschule in Oldenburg<br />
ausgesprochene Tadel begründet?“, in: Ebenda<br />
v.14.6.1845, S.217-219: - 1846 erhielt die Bürgerschule die<br />
ersten Berechtigungen. Wer die Prima erreicht hatte, konnte<br />
in die neu eingerichtete Militärschule oder in den höheren<br />
Forstdienst eintreten. 1858 erhielt derjenige, der ein Abschlußzeugnis<br />
vorwies, Zugang zu den mathematischtechnischen<br />
Fächern des Staatsdienstes (vgl. Hillje, B.,<br />
Humanistische Bildung ... , S.41f.).<br />
245 Vgl. Art.“Ist der über die höhere Bürgerschule in Oldenburg<br />
ausgesprochene Tadel begründet?“, in: Ebenda<br />
v.30.7.1845, S.273f. - Dieser Streitpunkt verdeutlicht die<br />
zweispältige Lage, in der sich die neu gegründeten Realschulen<br />
befanden: einmal wollten sie ihre Eigenständigkeit<br />
bewahren, andererseits wurden sie durch die Erfordernis,<br />
weiterführende Abschlüsse für den mathematischnaturwissenschaftlich<br />
vorgebildeten Nachwuchs zu ermöglichen,<br />
in den Kampf um staatlich vergebene Studienberechtigungen<br />
hineingezogen. Ein Teil der Realschulen wurde zu<br />
neunklassigen Höheren Schulen ausgebaut, wobei den sog.<br />
Realschulen I.Ordnung Latein als Pflichtfach aufgezwungen<br />
wurde. Erst seit 1900 wurden alle drei Formen der Höheren<br />
Schule - humanistisches Gymnasium, Oberrealschule, Realgymnasium<br />
- als gleichberechtigte Gymnasien anerkannt (vgl.<br />
dazu Blankertz, H., Die Geschichte der Pädagogik ... ,<br />
S.166ff) - B. Hillje schildert die Entwicklung der höheren<br />
Bürgerschule in Oldenburg zur Oberrealschule mit weitreichenden<br />
Berechtigungen (1885/86) vor dem eben skizzierten<br />
Zusammenhang (vgl. Hillje, B., Humanistische Bildung ... ).
568<br />
die neuen Realschulen es schwer hatten, eine eigenständige<br />
höhere Schulbildung, die mittels der Naturwissenschaften,<br />
der Mathematik sowie moderner Fremdsprachen die allgemeinen<br />
Grundlagen zu gewerblichen Berufen wissenschaftlich vertie-<br />
fend legen wollte, gegenüber den humanistisch geprägten<br />
Gymnasien zu entwickeln und zu behaupten. Bis 1844 wurde<br />
die bürgerliche Bildung in Oldenburg zumal vom Gymnasium<br />
der Stadt geleistet. Zunächst war eine Bürgerklasse, auch<br />
deutsche Klasse genannt, eingerichtet worden, welche Bür-<br />
gersöhnen die Möglichkeit bot, nützliche Kenntnisse für ihr<br />
zukünftiges Berufsleben zu erwerben. Vom Lateinunterricht<br />
waren sie befreit. 1836 wurde die Bürgerklasse aufgelöst<br />
und die Schüler auf die anderen Klassen verteilt. Sie er-<br />
hielten an Stelle von Griechisch und Latein Unterricht in<br />
Buchhaltung, Technologie und Mechanik. Englisch wurde wahl-<br />
weise angeboten. 1841 endlich wurden die Pläne von Stadtrat<br />
und Magistrat, eine vom Gymnasium unabhängige Schule zu<br />
gründen, angenommen. 246<br />
Die weitere Entwicklung der Bürgerschule zeigt, daß erst<br />
nach der Abschaffung des Lateinunterrichts sich der Anteil<br />
der Söhne von Handel- und Gewerbetreibenden gegenüber jenen<br />
aus Beamtenfamilien deutlich erhöhte. 247 Berufsbezogene Fä-<br />
cher, wie Buchführung, nahm der Lehrplan nicht auf, alle<br />
246 Vgl. Hillje, B., Humanistische Bildung ... , S.29ff<br />
247 1845 bildeten Söhne, deren Väter Beamte waren oder anderen<br />
Berufen mit akademischer Vorbildung angehörten, nahezu<br />
die Hälfte aller Schüler, die Gruppe der Handel- und Gewerbetreibenden<br />
stellte nur ein Drittel. Der Anteil der Oberbeamten<br />
betrug 12,1%. Zehn Jahre später hatte sich der Anteil<br />
der Schüler aus Beamtenfamilien fast um die Hälfte<br />
verringert, wogegen sich die Zahl der Söhne aus Kaufmannsfamilien<br />
sowie von Landwirten mehr als verdreifacht hatte.<br />
Der Anteil der selbständigen Handwerker blieb in den 40er<br />
bis 60er Jahren kontinuierlich bei 16-17%.- 1845/46 bildeten<br />
sie nach den mittleren und unteren Beamten (25,7%) die<br />
größte Gruppe, es folgten die Kaufleute mit 13,5%. 1855/56<br />
entsandten sie eine gleich hohe Anzahl wie die mittleren<br />
und unteren Beamten (16,4%), die Kaufleute stellten nun mit<br />
22,6% die stärkste Gruppe. In den 60er Jahren waren alle<br />
drei Gruppen in etwa ausgewogen vertreten (16-17%). Hinzu<br />
traten allerdings mit 8,6% kaufmännische und technische Angestellte<br />
(vgl. Hillje, B., Humanistische Bildung ... ,<br />
S.44f.).
569<br />
unmittelbar anwendbaren Lerninhalte innerhalb der Unter-<br />
richtsfächer wurden allmählich herausgenommen. Charakteri-<br />
stisch für die Schule in den 40er bis 60er Jahren war, daß<br />
nur wenige Schüler die Prima erreichten, also die meisten<br />
vorher abgingen. 64% aller Abgänger traten unmittelbar in<br />
das Berufsleben ein. Sie wurden Kaufmann, Techniker oder<br />
Handwerker. Der übrige Teil ging auf weiterführende Schu-<br />
len. 248 Insgesamt bleibt festzustellen, daß die Bürgerschu-<br />
le als Möglichkeit, sich durch allgemeinbildenden, auf Rea-<br />
lien basierenden, weiterführenden Unterricht höher zu qua-<br />
lifizieren, trotz anfänglicher Klagen vom Handwerk angenom-<br />
men wurde.<br />
6.3. Die Handwerksgesetzgebung bis zur Einführung der<br />
Gewerbefreiheit (1861)<br />
6.3.1 Phasen der Handwerkerbewegung, Gewerbegesetz-<br />
gebung als politischer Prozeß<br />
Im folgenden soll die Entwicklung der Gewerbegesetzgebung<br />
in Oldenburg bis 1861 näher betrachtet werden. In dem hier<br />
behandelten Zeitraum von etwa 30 Jahren vollzog sich ein<br />
Wandel der Einstellung gegenüber der Gewerbefreiheit in ei-<br />
ner breiteren Öffentlichkeit, der sich auch in Teilen der<br />
Handwerkerschaft widerspiegelte. Nach der Jahrhundertsmit-<br />
te war sie kein wirklich kontroverses Thema mehr. Sowohl<br />
248 Hillje stellt fest, daß von den 308 Schülern, die in den<br />
ersten zehn Jahren des Bestehens die Bürgerschule verließen,<br />
lediglich 58 die Prima erreichten. Von ihnen traten 11<br />
in die Militärschule ein, einer entschied sich für das<br />
Forstwesen. Die durchschnittliche Abgänger-Quote betrug<br />
27,3% je Schuljahr. Die Fluktuation nahm allerdings ab: in<br />
den 50er Jahren verließ noch etwa jeder dritte Schüler die<br />
Schule vorzeitig, in den späten 60er Jahren war es nur noch<br />
jeder fünfte (vgl. Hillje, B., Humanistische Bildung ... ,<br />
S.42 f.).
570<br />
liberale als auch konservative Autoren sahen in genossen-<br />
schaftlichen Verbindungen jenseits der Zunft und einer be-<br />
gleitenden (Berufs-)bildung die Möglichkeit, die Zukunft<br />
des Handwerks zu sichern. Handwerker kritisierten zwar öf-<br />
ters die Gewerbefreiheit, doch blieben die Proteste, gemes-<br />
sen an der Petitionsbewegung der Revolutionsjahre, schwach.<br />
Die meisten von ihnen nahmen die Gewerbefreiheit hin, nicht<br />
wenige begrüßten sie sogar ausdrücklich. 249<br />
Die ältere Forschung war zunächst aufgrund kritischer Äuße-<br />
rungen liberaler Zeitgenossen von einem zünftlerischen oder<br />
sogar reaktionären Handwerk zwischen Revolution und Reichs-<br />
gründung ausgegangen. Die neuere Forschung kommt hingegen<br />
zu einer anderen Einschätzung und spricht von einer gerade-<br />
zu liberalen Phase des Handwerks in den 50er und 60er Jah-<br />
ren, die vom wirtschaftlichen Aufschwung getragen wurde.<br />
Sie begründet dies sowohl mit der sehr schmalen Basis der<br />
organisierten Handwerkerbewegung, gemessen am Umfang der<br />
Petitionsbewegung 1848/49, als auch mit ihrer inneren Zer-<br />
rissenheit gegenüber gewerbefreiheitlichen Vorstellungen.<br />
Handwerksmeister spielten überdies in den zahlreichen Hand-<br />
werker- und Arbeiterbildungsvereinen eine beträchtliche<br />
Rolle. Zu einer Zusammenarbeit größeren Umfangs zwischen<br />
Liberalismus und Handwerk kam es darüber hinaus in den Ge-<br />
werbevereinen und Genossenschaften. Besonders in Süd-<br />
deutschland traten viele Handwerker in liberale und demo-<br />
kratische Parteien ein. Auch die sozialistischen Parteien<br />
und Gewerkschaften hatten unter ihren Mitgliedern zahlrei-<br />
che Kleinmeister. 250 Erst seit dem Ende der 50er Jahre führte<br />
249 Vgl. Lenger, F., Sozialgeschichte ... , S.88f.<br />
250 Vgl. dazu Haupt, H.-G./Lenger,F., Liberalismus und Handwerk<br />
... , S.315ff; Lenger, F., Sozialgeschichte ... ,<br />
S.109; auch T. Offermann geht von einer liberalen Meisterund<br />
Gesellenbewegung in den 50er und 60er Jahren aus. Er<br />
stellt fest, daß „die dem wirtschaftlichen (und politischen)<br />
Liberalismus verbundenen mittelständischkleingewerblichen<br />
Leitbilder .. in den 1850/60er Jahren unter<br />
den Handwerkern und handwerklich sozialisierten Arbeitern<br />
starken Anklang fanden [...]“ (Offermann, T., Mittelständisch-kleingewerbliche<br />
Leitbilder in der liberalen<br />
Handwerker- und handwerklichen Arbeiterbewegung der 50er
571<br />
die intensivierte Agitation für Gewerbefreiheit und Freizü-<br />
gigkeit des ersten Volkswirtschaftlichen Kongresses sowie<br />
die Einführung der Gewerbefreiheit in verschiedenen deut-<br />
schen Bundesstaaten zu Beginn der 60er Jahre zum Wiederauf-<br />
leben einer zunftfreundlichen Handwerkerbewegung besonders<br />
in Nord- und Mitteldeutschland. 251 Insgesamt wird sie jedoch<br />
und 60er Jahre des 19. Jahrhunderts, in: Engelhardt, U.,<br />
(Hg.), Handwerker in der Industrialisierung ... , S.528).<br />
Speziell versucht er den Ursachen des Erfolgs der in Vereinen<br />
und von politischen Organisationen mittels Versammlungen,<br />
Presseberichten etc. propagierten liberalen Genossenschaftsidee<br />
Schulze-Delitzschs auf die Spur zu kommen. Delitzsch<br />
ging es wie zahlreichen anderen Vertretern des liberalen<br />
Bügertums darum, die Handwerker mit der kapitalistischen<br />
Produktionsweise auszusöhnen. Die erforderliche<br />
Anpassung an die veränderten Produktionsbedingungen sollte<br />
dabei auf die materiellen und psychologischen Bedürfnisse<br />
des klein- und mittelständischen Gewerbes abgestimmt werden.<br />
Die propagierten Leitbilder des nach kapitalistischen<br />
Prinzipien wirtschaftenden Handwerks knüpften, so Offermann,<br />
sowohl an tradierte handwerkliche Wertvorstellungen<br />
als auch an Forderungen und Konzeptionen, wie sie in der<br />
Handwerker- und Arbeiterbewegung der Revolutionsjahre erstmalig<br />
massiv vertreten wurden, an (vgl. Ebenda, S.528, 538,<br />
539f.).<br />
251 In der Literatur werden zumeist zwei Ereignisse genannt,<br />
die die Handwerkerbewegung in den 60er Jahren kennzeichneten.<br />
Der preußische Landes-Handwerkertag wurde 1860 zum<br />
Zweck der Verteidigung der preußischen Gewerbenovelle von<br />
1849 einberufen. Handwerker forderten den Befähigungsnachweis<br />
und die Zwangsinnung und versuchten, sich den Konservativen<br />
als Bündnispartner anzudienen, was scheiterte. 1862<br />
wurde der Deutsche Handwerkerbund in Weimar gegründet. Er<br />
hielt mehrere Versammlungen ab und verfaßte verschiedene<br />
Denkschriften, konnte sich aber auf Dauer nicht halten. Die<br />
Spannungen zwischen den die Gewerbefreiheit grundsätzlich<br />
hinnehmenden preußischen Handwerkern und den auf Heiratsverbote<br />
udgl. drängenden Hamburgern und Mecklenburgern waren<br />
nicht zu überbrücken. Zu erneuten Protestversammlungen<br />
norddeutscher Handwerker in Dresden, Hannover und Halle kam<br />
es anläßlich der Diskussionen um die Einführung einer freiheitlichen<br />
Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund (vgl.<br />
Ebenda, S.530f.; Haupt, H.-G./Lenger,F., Liberalismus und<br />
Handwerk ... , S.316f.). Erst seit den 70er Jahren, die<br />
wirtschaftlich von der „großen Depression“ sowie massenhafter<br />
wirtschaftspolitischer Verbandsbildung geprägt war,<br />
gründete das Handwerk zahlreiche berufsständische Organisationen<br />
auf regionaler und nationaler Ebene. Staatliche Behörden<br />
sowie die Konservativen, Teile der Nationalliberalen<br />
und auch das Zentrum hatten aus sozialpolitischen Erwägungen<br />
heraus ein offenes Ohr für die Forderungen des Handwerks<br />
nach Revision der liberalen Gewerbeordnung von 1869.
572<br />
als schwach eingeschätzt. Die liberale Orientierung breiter<br />
Der allgemeine Innungszwang und der große Befähigungsnachweis<br />
wurden zwar abgelehnt, öffentlich-rechtliche Handwerkskammern<br />
und Zwangsinnungen (Verpflichtung zum Beitritt,<br />
wenn in dem betreffenden Gewerbe sich eine Mehrheit<br />
für die Gründung einer Zwangsinnung ausgesprochen hat und<br />
dies von der Behörde genehmigt worden ist) hingegen eingeführt<br />
(Handwerkergesetz von 1897). Seit etwa 1900 begann<br />
sich die Handwerkerpolitik unter Führung der Handwerkskammern<br />
jedoch zu ändern. Sie wollten das Handwerk in vielfältiger<br />
Weise auf der Grundlage des Handwerkergesetzes praktisch<br />
fördern, Schädigungen verhüten und waren nicht grundsätzlich<br />
für die Beseitigung der Gewerbefreiheit und für<br />
die Rückkehr zur Zunftverfassung, wie dies die Handwerkerbünde<br />
im 19. Jahrhundert vertreten hatten. Auf dem deutschen<br />
Handwerks- und Gewerbekammertag 1905 in Köln gelang<br />
es dann den Kammern, den großen Befähigungsnachweis, den<br />
viele Handwerker noch immer forderten, zu Fall zu bringen,<br />
stattdessen wurde der von ihnen favorisierte kleine Befähigungsnachweis<br />
von der Versammlung angenommen. 1919 vereinigten<br />
sich die Handwerkerbünde mit den Kammern zum Reichsverband<br />
des Deutschen Handwerks (Genaueres über Ziele, Organisationen<br />
und Versammlungen im Handwerk bieten Wilden,<br />
J., Art. „Handwerk“, in: HdStW Bd.5, 4. Aufl., Leipzig<br />
1919, S.130-145; Stieda, W., Art. „Handwerk“, in: Ebenda,<br />
3.Aufl., Leipzig 1910, S.377-393; Goldschmidt, E.F., Die<br />
deutsche Handwerkerbewegung bis zum Sieg der Gewerbefreiheit,<br />
München 1916). H.-A. Winkler betont, daß sich trotz<br />
der rationaleren Tendenzen im Kleingewerbe nichts an der<br />
konservativen Grundhaltung des gewerblichen Mittelstandes<br />
geändert habe. Der Mittelstandspolitik des Kaiserreichs gelang<br />
es, Schwerindustrie, Großagrarier sowie Handwerk und<br />
Detailhandel zu einer defensiven Interessenkoalition gegenüber<br />
Sozialdemokratie und Bankkapital zu verschmelzen. In<br />
der Übertragung von staatlichen Kompetenzen an privatwirtschaftliche<br />
Körperschaften (Innungen, Handwerkskammern)<br />
sieht Winkler eine „Refeudalisierung“: der absolutistische<br />
Dualismus von Staat und Gesellschaft wurde nicht wie in anderen<br />
westeuropäischen Ländern zugunsten der parlamentarischen<br />
Legitimation der Exekutivgewalt aufgegeben, sondern<br />
es entstand eine Verflechtung zwischen einem von parlamentarischen<br />
Mehrheiten unabhängigen Staatsapparat und privilegierten<br />
gesellschaftlichen Machtträgern. Diese Politik<br />
bewirkte die Restauration ständischer Organisationsformen<br />
und Privilegien. Die staatlicherseits garantierten Unterstützungen,<br />
die das Handwerk vom kapitalistischen Wettbewerb<br />
abschirmen sollten, förderten die Konservierung einer<br />
vorindustriellen, an der sittlichen Ökonomie des alten<br />
Handwerks orientierten Wirtschaftsgesinnung ( vgl. Winkler,<br />
H.-A., Kap. Der rückversicherte Mittelstand: Die Interessenverbände<br />
von Handwerk und Kleinhandel im deutschen Kaiserreich,<br />
in: ders., Liberalismus und Antiliberalismus<br />
(Krit. Studien zur Gesch.wiss.; Bd.38), Göttingen 1979,<br />
S.83-98).
573<br />
Handwerkerkreise zeige sich vor dem Hintergrund einer noch<br />
nicht ausgebildeten Arbeiterbewegung sowie einer schwachen<br />
Handwerkerbewegung im Erfolg des liberalen Genossenschafts-<br />
und Vereinswesens und darüber hinaus v.a. im Wahlverhalten<br />
der Handwerker. 252 Diese Bewertung wird von Georges auf der<br />
Grundlage der Protokolle des Deutschen Handwerkerbundes mit<br />
nicht überzeugenden Argumenten angezweifelt. Die Handwer-<br />
kerbewegung habe in dieser Zeit nur wenig Chancen gehabt,<br />
ihre Interessen durchzusetzen und weise daher kaum politi-<br />
sche Erfolge vor. Trotz des Angebots der liberalen Genos-<br />
senschaften, dem Mitglieder der erfolgreich an der Indu-<br />
strialisierung partizipierenden Handwerksbranchen folgten,<br />
existierte aber noch ein äußerst virulentes und interessen-<br />
politisch leicht mobilisierbares Handwerkerpotential. Der<br />
Mitte der 50er Jahre sprunghafte Anstieg von Eingaben habe<br />
aufgrund der heterogenen interessenpolitischen Zielsetzun-<br />
gen der Handwerker in den einzelnen deutschen Bundesstaa-<br />
ten, der sozialen Differenzierung in Verlierer und Gewinner<br />
des Strukturwandels sowie ausbleibender staatlicher Rücken-<br />
deckung nicht zur Erfüllung der dort angemahnten Forderun-<br />
gen geführt. Als Nachweis für die Stärke und Kontinuität<br />
der zünftlerischen Forderungen der Handwerkerbewegung führt<br />
Georges den 1862 gegründeten Deutschen Handwerkerbund an.<br />
Im Ergebnis kann er jedoch nichts Konkretes über den Um-<br />
fang und die Stärke der Handwerkerbewegung im Verhältnis<br />
zur gesamten Handwerkerschaft aussagen, das eine Revidie-<br />
rung der obengenannten Einschätzung herbeiführen müßte. 253<br />
Für Oldenburg können zwei Schlaglichter auf die dort beste-<br />
hende Handwerkerbewegung geworfen werden. Für 1848 ist<br />
festzustellen, daß sie keine Petitionsbewegung war, um hie-<br />
sige gewerberechtliche Verhältnisse zu ändern. 254 Im wesent-<br />
252 Vgl. Haupt, H.-G./Lenger, F., Liberalismus und Handwerk<br />
... , S.317; Lenger, F., Sozialgeschichte ... , S.109<br />
253 Vgl. Georges, D., Zwischen Reaktion und Liberalismus. Die<br />
Organisation handwerkspolitischer Interessen zwischen 1849<br />
und 1869, in: Puhle, H.-J., Bürger in der Gesellschaft der<br />
Neuzeit, Göttingen 1991, S.223-237<br />
254 M.Wegmann-Fetsch erwähnt zwar Petitionen an den Vereinbarenden<br />
Landtag im Herbst 1848, die Gewerbeschutz forderten
574<br />
lichen waren die Handwerker mit der HWO von 1830, die einen<br />
ausreichenden Schutz durch Zwangsinnung und Befähigungs-<br />
nachweis zu versprechen schien, zufrieden. Hauptsächlich<br />
wurde die bevormundende und oft nicht einsichtige Handha-<br />
bung der Handwerksgesetzgebung durch die Behörden kriti-<br />
siert, die den städtischen Handwerker gegenüber dem auf dem<br />
Lande wohnenden oft benachteilige sowie nicht ausreichend<br />
vor der Konkurrenz von in den Kleinhandel gelangenden Fa-<br />
brikerzeugnissen schütze. Daher befürworteten sie die Bil-<br />
dung eines selbstgewählten Gewerberats, der bei der Frage<br />
der Übersetzung hinzugezogen werden müßte und dem unter der<br />
verbleibenden Oberaufsicht des Magistrats die Aufsicht über<br />
die Innungen obliegen würde. Außerdem sollte ihm künftig<br />
der Nachweis über die Qualifikation zur selbständigen Nie-<br />
derlassung zuerst vorgelegt werden. Zusätzlich wurde bean-<br />
tragt, daß die Landhandwerker sich Innungen anzuschließen<br />
hätten und damit dann allen Bestimmungen über Lehrlinge,<br />
Gesellen, das Meisterstück etc. in vollem Umfang unterlie-<br />
gen würden. Auch ein Verbot für Maurer- und Zimmermeister<br />
vom Land, in der Stadt zu arbeiten, wurde gefordert, im-<br />
gleichen wünschten die städtischen Handwerker, daß gewerb-<br />
(vgl. Wegmann-Fetsch, M., Die Revolution von 1848 im Großherzogtum<br />
Oldenburg (Ol Studien; Bd.10), Oldenburg 1974,<br />
S.161), jedoch wurde in den Berichten über die Sitzungen<br />
des Landtags im „Beobachter“ keine Handwerkerfrage erwähnt.<br />
Über die Einführung der Gewerbefreiheit sowie deren mögliche<br />
Auswirkungen in Oldenburg schien sich zu diesem Zeitpunkt<br />
keine Debatte entsponnen zu haben. Auch bei der Revision<br />
des Staatsgrundgesetzes wurde der Artikel 52, der die<br />
Gewerbefreiheit für Oldenburg im Grundsatz einführte, die<br />
Bestimmungen der HWO jedoch bis auf weiteres gelten ließ,<br />
unverändert und unkommentiert übernommen (vgl. Art.<br />
„Landtagsverhandlungen“ v.10.Oktober, in: Neue Blätter für<br />
Stadt und Land v.14.10.1848, s.422f; vgl. Art. 52 des am<br />
18.2.1849 verkündeten Staatsgrundgesetzes für das Großherzogtum<br />
Oldenburg, in: OGBl. 1849-1851, Bd.12, S.70 und<br />
Art.56 des am 22.11.1852 verkündeten revidierten Staatsgrundgesetzes,<br />
in: Ebenda, 1852, Bd.13, S.156). Es wurden<br />
allerdings auch Petitionen, die sich für Einführung der Gewerbefreiheit<br />
parallel zur Einführung einer Verfassung aussprachen<br />
und nicht von Handwerkern verfaßt worden waren, im<br />
Frühjahr 1848 an den Großherzog geschickt (vgl. Art. „Ueber<br />
Gewerbefreiheit“, in: Der Beobachter v.30.5.1848, S.191f.).
575<br />
liche Erzeugnisse öffentlicher Strafanstalten sowie Arbei-<br />
ten für Hof und Militär nicht mehr vom städtischen<br />
Zunftzwang ausgenommen werden sollten. Alle Handwerkerar-<br />
beiten dürften nur von Innungsmeistern oder unter ihrer<br />
Aufsicht verfertigt werden. Die Begründung einer Selbst-<br />
verwaltung des Handwerks sollten dann auch die Oldenburger<br />
Deputierten dem „Vorkongreß Norddeutscher Handwerker“ in<br />
Hamburg vorschlagen. Das Verhältnis der Handwerksmeister in<br />
den Städten und auf dem Land sowie das Ineinandergreifen<br />
der Fabrik- und Handwerksbefugnisse würden weitere Diskus-<br />
sionspunkte bieten. 255 Ende November 1848 stimmten 450 Gewer-<br />
betreibende aus dem Herzogtum für die Genehmigung des Ent-<br />
wurfs des „Deutschen Handwerker- und Gewerbekongresses“,<br />
der in Frankfurt a.M. von Juli bis August getagt hatte. Sie<br />
sprachen sich damit für Zwanginnungen, Selbstverwaltung in<br />
Form von Innungsvorständen, Gewerberäten und Gewerbekam-<br />
mern, den Lehr- und Wanderzwang sowie den großen Befähi-<br />
gungsnachweis aus; weiterhin für die Ausübung eines einzi-<br />
gen Handwerks (ein Wechsel sollte nur bei Nachweis der Be-<br />
fähigung möglich sein), die Möglichkeit, die Meisterzahl an<br />
einem Ort zu beschränken, die Begrenzung der Zahl der Lehr-<br />
linge in einem Betrieb sowie für verschiedene Bestimmungen,<br />
die Industrie, Handel und Landhandwerk, städtische oder<br />
staatliche Konkurrenz beschränkten. Allerdings waren in dem<br />
Entwurf auch Artikel enthalten, die das Zunftwesen refor-<br />
mierten. 256 Die Oldenburger Handwerkerbewegung wurde im we-<br />
255 Vgl. Hoyer, J.H., Art. „Bürgerversammlung (Oldenburg, den<br />
18. Mai 1848, im Hause des Hrn. Almers)“, in: Der Beobachter<br />
v.23.5.1848, S.185f.; vgl. Art. „Oldenburgs Schritte<br />
für eine reichsgesetzliche Gewerbeordnung (Verhandlungen<br />
des Gewerbe= und Handels= Vereins im Mai 1848)“, in: Neue<br />
Blätter für Stadt und Land v.31.5.1848, S.232f.)<br />
256 Vgl. Art.“In der Versammlung des Handwerkervereins, am<br />
18.December“,in: Der Beobachter v.29.12.1848, S.445. Vgl.<br />
dazu auch das Regest der Petition vom 29.11. aus den Akten<br />
des Volkswirtschaftlichen Ausschusses der Nationalversammlung<br />
bei Simon, M., Handwerk in Krise und Umbruch ... ,<br />
S.466; dort sind noch zwei weitere Petitionen aus dem Herzogtum<br />
an die Nationalversammlung angegeben: 1. die Petition<br />
der Vorsteher der Schneiderzunft in Oldenburg<br />
v.16.8.1848 (Schneider treten der Petition des Central-
576<br />
sentlichen durch die Bestrebungen der überregionalen Hand-<br />
werkerkongresse in Hamburg und Frankfurt bestimmt. Die Ar-<br />
beit an einer Reichsgewerbeordnung mobilisierte die Hand-<br />
werker, an der gewerbepolitischen Diskussion mit dem Ziel,<br />
das Zunftwesen beizubehalten, teilzunehmen. Dies geschah in<br />
Versammlungen und Vereinen vor Ort sowie in Form von Peti-<br />
tionen an die Nationalversammlung und Sendung von Deputier-<br />
ten zu den großen Handwerkerkongressen. Auf lokaler Ebene<br />
wurden die Handwerkerinteressen durch die vielfältigen Ak-<br />
tivitäten des Handwerkervereins jetzt verstärkt im Rahmen<br />
der geltenden HWO wahrgenommen.<br />
In Kap.6.3.3.3 wird anhand von zeitgenössischen Zeitschrif-<br />
tenartikeln versucht, den Verlauf der Oldenburger Handwer-<br />
kerbewegung unter Einschluß allgemein politischer Betäti-<br />
gung hiesiger Handwerker in der Revolution zu skizzieren<br />
und sie außerdem, wo es nötig ist, mit den für sie relevan-<br />
ten außeroldenburgischen Handlungsebenen sowie der wirt-<br />
schaftlichen Entwicklung seit dem Vormärz in Beziehung zu<br />
Comités der Schneiderinnungen Deutschlands an die Nationalversammlung<br />
bei), 2. die Petition einer Handwerkerversammlung<br />
in Westerstede v.27.9.1848, die sich auch wie die 450<br />
Gewerbetreibenden für die Übernahme des Frankfurter Entwurfs<br />
aussprach. Ausgenommen wurden davon aber die Bestimmungen<br />
über das Landhandwerk. Vgl. Stieda, W.,<br />
Art.“Handwerk“ ... , S.379; vgl. Lenger, F., Sozialgeschichte<br />
... , S.76. P.John nennt bezüglich des Frankfurter<br />
Entwurfs partielle Verbesserungen bei der Regelung der Berufsausbildung<br />
und auf dem Gebiet des Arbeitsrechts, wie<br />
die schriftliche Abfassung von Lehrverträgen, die Verpflichtung<br />
des Meisters, dem Innungsvorstand halbjährlich<br />
ein Zeugnis über die Fortschritte des Lehrlings zu überreichen<br />
sowie ihn zum Besuch von „Fortbildungsanstalten“ anzuhalten,<br />
die Aufnahme eines stimmberechtigten Vertrauensmannes<br />
der Gesellen in die Gesellenprüfungskommission, die<br />
Festlegung der Prüfungsgegenstände in den Spezialstatuten<br />
der Innungen. Das Meisterstück sollte nicht kostspielig und<br />
verkäuflich sein, die Abnahme der Meisterprüfung wurde<br />
stärker objektiviert und kontrollierbar gemacht (vgl. John,<br />
P., Handwerk im Spannungsfeld zwischen Zunftordnung und Gewerbefreiheit.<br />
Entwicklung und Politik der Selbstverwaltungsorganisationen<br />
des deutschen Handwerks bis 1933 (WSI-<br />
Studie zur Wirtschafts- und Sozialforschung Nr.62, hg.v.<br />
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut des<br />
Deutschen Gewerkschaftsbundes), Köln 1987, S.254f.)
577<br />
setzen. 257 Indem zusätzlich Zeitschriftenartikel, die sich<br />
mit dem Phänomen des sogenannten Pauperismus in der handar-<br />
257 In diesem Zusammenhang ist die Arbeit von M.Simon<br />
(Simon,M., Handwerk in Krise und Umbruch ... ) hilfreich,<br />
der auf der Grundlage von 1200 Handwerkerpetitionen an die<br />
Nationalversammlung und der Verhandlungen und Beschlüsse<br />
der beiden überregionalen Handwerkerkongresse wirtschaftsund<br />
sozialpolitische Grundvorstellungen sowie die Hauptforderungen<br />
der Handwerkerbewegung 1848/49 herausarbeitet. Die<br />
Petitionen spiegeln andererseits die Vielfalt der Vorstellungen<br />
und gewerberechtlichen Verhältnisse in den Einzelstaaten<br />
wider, der Simon ein eigenes Kapitel widmet. Außerdem<br />
beschreibt er die Initiativen der Nationalversammlung<br />
und seines Volkswirtschaftlichen Ausschusses zur Gestaltung<br />
einer Reichsgewerbeordnung. Simon wirbt dabei für mehr Verständnis<br />
gegenüber der Selbsteinschätzung der Lage der Betroffenen,<br />
den Auswegen, die sie suchten sowie ihrer Interessenpolitik;<br />
dies vor dem Hintergrund ihrer wirtschaftlichen<br />
und sozialen Lage, aber auch angesichts des Grundtenors<br />
ihrer Vorstellungen und Forderungen. Die Handwerkerbewegung<br />
sei, an diesem Maßstab gemessen, nicht reaktionär<br />
gewesen, da sie weder die alten städtewirtschaftlichen<br />
Zunftzustände mit Privilegien und Vetternwirtschaft restauriert<br />
haben wollte, noch sich auf eine simple antigewerbefreiheitliche<br />
Position beschränkte. Es ging auch um Vorstellungen<br />
über eine Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft,<br />
die dem Handwerk darin einen angemessenen Platz sichern<br />
sollte. Simon betont die fortschrittlichen Veränderungen,<br />
die zur Verbesserung des Qualitätsniveaus des Handwerks,<br />
zur Verbesserung seiner Wettbewerbsfähigkeit angestrebt<br />
wurden. Vom Staat seien außerdem soziale Vorsorgeeinrichtungen<br />
für alle Erwerbstätigen, Arbeitslosen und Erwerbsunfähigen<br />
gefordert worden. Dies alles sollte die Polarisierung<br />
der Gesellschaft verhindern und einer möglichst<br />
großen Zahl selbständiger Gewerbetreibender Sicherheit gewähren<br />
sowie möglichst breit Wohlstand und Einkommen streuen.<br />
- Gleichwohl könnte man sich von einer weiteren Gesamtdarstellung<br />
aus sozialgeschichtlicher Perspektive eine kritischere,<br />
analytisch-kategoriale Würdigung und Einordnung<br />
der Vorstellungen und Forderungen wünschen, die auch die<br />
weitere Geschichte der Handwerkerbewegung berücksichtigt.<br />
Die politikwissenschaftliche Studie von P.John beispielsweise<br />
bewertet die Ergebnisse des Frankfurter Handwerkerkongresses<br />
vor dem seit Begründung der Zünfte bestehenden<br />
Doppelcharakter der handwerklichen Selbstverwaltungsorganisationen.<br />
Dieser zeige sich in dem aus öffentlichrechtlicher<br />
Aufgabenstellung und erwerbswirtschaftlich motivierter<br />
Interessenvertretungsfunktion der Betriebsinhaber<br />
erzeugten Spannungsfeld (vgl. John, P., Handwerk im Spannungsfeld<br />
... , S.13,21). Daher fragt John u.a. auch danach,<br />
inwieweit Tradition und berufsständische Ideologie<br />
das Verhältnis der organisierten Handwerksmeister zu Staat,<br />
Gesellschaftsform und Wirtschaftsordnung prägten. Eine gemeinsame<br />
Basis fanden die Meister in der Ablehnung der Ge-
578<br />
beitenden Bevölkerung und seinen Ausprägungen im Oldenbur-<br />
gischen, etwaigen Ursachen sowie Maßnahmen zur Vorbeugung<br />
bzw. Abhilfe im Zeitraum von 1843 bis 1849 beschäftigten,<br />
herangezogen werden, soll der Rolle der „sozialen Frage“,<br />
wie sie sich vor Ort und überregional darstellte, für Anlaß<br />
und Zielsetzungen der Oldenburger Bewegung nachgegangen<br />
werbefreiheit, einem latenten Antikapitalismus (man führte<br />
einen Kampf „gegen das Kapital und die Herrschaft des Geldes“,<br />
zit.n. Ebenda, S.196) sowie der Wiederbelebung und<br />
Bestätigung tradierter handwerklicher Leitbilder der Zunftzeit<br />
(dies zeigte sich im Verhältnis der Handwerksmeister<br />
zu den Lehrlingen und Gesellen, in der Frage der Arbeitsteilung<br />
zwischen Stadt- und Landhandwerk, im Verbot des<br />
Handelns mit Handwerkserzeugnissen außerhalb des Handwerks,<br />
der Abwehr der Fabrik durch die enge Bestimmung der Geschäftsgrenzen).<br />
Nachdem John die einzelnen Bestimmungen<br />
des Frankfurter Entwurfs daraufhin kritisch und ausführlich<br />
dargestellt hat, prüft er dann in einem zusammenfassenden<br />
Vergleich, ob und inwieweit programmatischer Wandel, wie er<br />
als Anspruch verschiedentlich von Handwerksmeistern geäußert<br />
wurde, oder kontinuierliches Festhalten an althergebrachten<br />
ordnungspolitischen Grundpositionen die Ergebnisse<br />
des Kongresses kennzeichnete. Er stellt dabei die wirtschafts-<br />
und berufsordnungspolitische Orientierung an alten<br />
Zunftnormen ( z.B. Egalisierung der Produktionsbedingungen<br />
- Ablehnung der Konkurrenz von Staats- und Kommunalwerkstätten,<br />
Verlagen - Ablehnung der Gesellenforderungen nach<br />
Liberalisierung der Zugangsvoraussetzungen zur Meisterprüfung,<br />
nach einem Mitwirkungsrecht in den Innungen und überörtlichen<br />
Selbstverwaltungsinstitutionen des Handwerks) sowie<br />
die Aufrechterhaltung des Anspruchs auf die rechtspolitische,<br />
sozialpolitische und politisch-kulturelle Funktion<br />
der neu zu bildenden Handwerksorganisationen fest. Deutlich<br />
tritt in den Augen Johns zudem das Bestreben zur Durchsetzung<br />
einer ausschließlich den Interessen der Meister dienenden,<br />
mit hoheitlichen Vollmachten ausgestatteten Selbstverwaltung<br />
hervor. Kontinuität zeichne Forderungen und Programmatik<br />
der Handwerksmeister aus. - Die Beschäftigung mit<br />
der Handwerkerbewegung auf der Ebene der Einzelstaaten erhält<br />
durch die inhaltliche Systematisierung der Forderungen<br />
gegenüber der Nationalversammlung durch M.Simon und P.John<br />
einen Orientierungsrahmen, der ihr im interregionalen Vergleich<br />
eher noch fehlt. In einer Studie über die Handwerkerbewegung<br />
im Herzogtum Braunschweig werden die Forderungen<br />
an die Regierung weder deutlich in Bezug zu den Ergebnissen<br />
Simons gesetzt, noch vor dem Hintergrund der spezifischen<br />
Entwicklung des Braunschweiger Zunfthandwerks näher<br />
interpretiert und damit bewertet (vgl. Traupe, K., Die<br />
deutsche Handwerkerbewegung 1848/49 im Herzogtum Braunschweig,<br />
(ms. Handwerkskammer Braunschweig), Braunschweig<br />
1986).
579<br />
werden. Wie wurde die wirtschaftliche Lage im Herzogtum<br />
überhaupt eingeschätzt? Wie wirkte sich der Pauperismus<br />
speziell im hiesigen Handwerk aus? Darüberhinaus werden die<br />
verfügbaren Artikel aus den beiden Revolutionsjahren auf<br />
entsprechende Äußerungen durchgesehen. Die Analyse der Bei-<br />
träge zur Diskussion über Freizügigkeit, Gewerbefreiheit,<br />
Zunftwesen und Konzessionssystem in Kap.6.3.3.2, die die<br />
Handwerkerbewegung zeitlich gleichsam einrahmen, dient der<br />
genaueren Erfassung der gewerbepolitischen Vorstellungen im<br />
Handwerk und in der Öffentlichkeit.<br />
1860 hingegen kam es anläßlich des Kommissionsentwurfs zum<br />
Gewerbegesetz, der Gewerbefreiheit einführen wollte, zu ei-<br />
ner Petitionsbewegung. Gesuche von Handwerkern aus der<br />
Stadt Oldenburg, aus Brake, Elsfleth, Westerstede, Rastede,<br />
Loy und Barghorn, Varel, Jever und Apen, die von insgesamt<br />
403 Personen unterschrieben worden waren, richteten sich an<br />
das Staatsministerium mit der Bitte, auf dieses Vorhaben zu<br />
verzichten. Andernfalls solle mit der Einführung wenigstens<br />
solange gewartet werden, bis die Nachbarstaaten vorangegan-<br />
gen sein würden. Bestimmte Lehr- und Wanderjahre sowie die<br />
Meisterprüfung müßten aber auf jeden Fall beibehalten wer-<br />
den. Die Petitionsbewegung war eindeutig gegen Gewerbefrei-<br />
heit gerichtet, jedoch schien der größere Teil der Handwer-<br />
kerschaft im Herzogtum diese Position nicht zu vertreten<br />
und den Wegfall der Regelungen über erforderliches Be-<br />
triebskapital und Übersetzung zu befürworten. Auch den<br />
Zunftzwang hielten sie nicht mehr für erforderlich. Der<br />
Übergang von einem Gewerbe zum anderen sollte erleichtert<br />
werden. 258 1865 erhielt das Staatsministerium, wie andere Re-<br />
gierungen auch, ein Schreiben des Präsidiums des Deutschen<br />
Handwerkerbundes aus Hamburg. Übermittelt wurde eine Denk-<br />
258 Der Landtagsausschuß zur Begutachtung des Gewerbegesetzentwurfs<br />
äußerte sich in einem Bericht in der eben beschriebenen<br />
Weise. Da der Inhalt der Petitionen nicht mehr<br />
der zur Zeit verbreiteten Auffassung der hiesigen Handwerker<br />
entspreche, sehe der Ausschuß keinen Anlaß, sich mit<br />
den Klagen und Befürchtungen hinsichtlich der Auswirkungen<br />
von Gewerbefreiheit näher zu beschäftigen (vgl. Bericht des<br />
Landtagsausschusses v.29.4.1861, in: StAO Best.31-15-43-1).
580<br />
schrift, die sich gegen Gewerbefreiheit wandte, sowie<br />
Grundzüge einer Handwerksordnung. Der Vorstand bat die Ol-<br />
denburger Regierung, an der Ausgestaltung der Grundzüge zu<br />
einer allgemeinen deutschen Handwerksordnung mitzuarbeiten,<br />
was jedoch keine Zustimmung fand. 259<br />
Die oldenburgische Gewerbepolitik rang sich, zeitgleich mit<br />
vielen anderen Ländern des Deutschen Bundes, zu Beginn der<br />
60er Jahre zu einer gewerbefreiheitlichen Gesetzgebung<br />
durch. Vor dem Hintergrund ihrer Entwicklung bis 1830, die<br />
durch Mangel an wirtschaftspolitischen Zielsetzungen und<br />
einer abwartenden, zögernden Haltung der sich mit der Mate-<br />
rie befassenden Beamnten sowie des Landesherrn gekennzeich-<br />
net war, soll sich das Augenmerk besonders auf das Zustan-<br />
dekommen dieses, sich doch auf der Höhe der Zeit befinde-<br />
nen, Ergebnisses richten. Wieviel genuin Oldenburgisches,<br />
wieviel eher passive und bürokratische Anpassung an die Ge-<br />
setzgebung anderer Länder drückte sich in ihm aus? Setzte<br />
ein Umdenken in maßgeblichen Beamtenkreisen dergestalt ein,<br />
daß die bisher ausgeübte Praxis der Aufsicht über die Ge-<br />
werbe, also der Verwaltung von Wirtschaft 260 , als unzurei-<br />
259 Die Denkschrift wurde kommentarlos wie eine schon zuvor<br />
eingegangene Petition des Handwerkerbundes zu den Akten gelegt.<br />
(vgl. Petition des Deutschen Handwerkerbundes vom Januar<br />
1863 (=Beschluß des 1. Dt. Handwerkertages, der am 5.-<br />
8-9-1862 in Weimar abgehalten wurde) in: Ebenda; vgl.<br />
Schreiben des Vorstandes des Dt. Handwerkerbundes<br />
v.30.1.1865, anliegend: Denkschrift sowie Grundzüge zu einer<br />
allg. dt. Handwerkerordnung vom Dezember 1864<br />
(=Beschlüsse des 2. Dt. Handwerkertages vom<br />
25.26.u.28.9.1863 in Frankfurt a.M.), in: Ebenda). Zumindest<br />
1863 schien das Programm des Handwerkerbundes bei den<br />
Städten des Herzogtums Oldenburg auf Entgegenkommen gestoßen<br />
zu sein. Zusammen mit braunschweigischen und württembergischen<br />
Städten beabsichtigten sie, dem Bund beizutreten.<br />
Ob sie es tatsächlich taten, war dem vorliegenden<br />
Quellenmaterial nicht zu entnehmen (vgl. Georges, D., Zwischen<br />
Reaktion und Liberalismus ... , S.234).<br />
260 Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts erschöpfte sich<br />
die Oldenburger Gewerbepolitik in der Regelung zur selbständigen<br />
Niederlassung. Es ging um die Frage, welche Gewerbe<br />
zünftig, konzessioniert oder frei sein sollte. Damit<br />
blieb sie hinter den preußischen Vorstellungen weit zurück,<br />
die einen den Stadt-Land-Gegensatz sowie die Trennung von
581<br />
chend erkannt wurde und eine eher theorieangeleitete ge-<br />
staltende Wirtschaftspolitik bevorzugt wurde? Gab es dezi-<br />
dierte Meinungen über die anzustrebende wirtschaftliche<br />
Entwicklung in Oldenburg? Konnte gar darin eine Herausfor-<br />
derung gesehen werden, in Oldenburg eine industrielle Ent-<br />
wicklung in Gang zu setzen und damit den Anschluß an die<br />
weiterentwickelten Regionen zu erreichen? Vergrößerten sich<br />
die Handlungsspielräume für die Durchsetzung eigener Ideen<br />
gegenüber dem Landesherrn seit der Einführung des konstitu-<br />
tionellen Systems? Welchen Einfluß übte der Landtag bei der<br />
Konzeption des Gewerbegesetzes aus? Auf städtischer Ebene<br />
ist danach zu fragen, welche Position Magistrat und Stadt-<br />
rat gegenüber gewerbefreiheitlichen Bestrebungen einnahmen?<br />
Welche Bedeutung wurde dabei dem gewerblichen Bürgerrecht,<br />
das noch in den 40er Jahren konkurrenzaussschließend gegen-<br />
über dem Land interpretiert wurde, zugemessen? 261 Die Ent-<br />
zünftigem Handwerk und anderem Gewerbe überwindenden Markt<br />
herstellen wollten (vgl. Kap.5.1.2).<br />
261 Die die Konkurrenz des Landhandwerks beschränkende Konstruktion<br />
beruhte nicht, wie oft vom städtischen Handwerk<br />
angeführt, auf dem gewerblichen Bürgerrecht, sondern auf<br />
Bannmeile und Zunftzwang. Fielen die letzteren beiden Bedingungen<br />
fort, so war es dem Landhandwerk, wie anderen außerhalb<br />
der Stadt wohnenden Gewerbetreibenden auch, deren<br />
Tätigkeit in der Stadt nicht beschränkt wurde, freigestellt,<br />
dort zu arbeiten. Anlaß, immer wieder das exklusive<br />
Recht auf freie „bürgerliche Nahrung“ für ansässige Gewerbetreibende<br />
mit Bürgerrecht zu fordern, gab die höhere finanzielle<br />
Belastung durch Steuern, Abgaben sowie Lebenshaltungskosten.<br />
Durch die allmähliche Lockerung der Zwangsbestimmungen<br />
im Handwerk erfuhr das Bürgerrecht in seinem<br />
Kern eine wesentliche Veränderung: sein Erwerb bot nicht<br />
mehr die Möglichkeit eines vor der Konkurrenz des Landhandwerks<br />
relativ geschützten Arbeitens. Die Verpflichtung, in<br />
Städten ein besonderes städtisches Bürgerrecht zu erwerben,<br />
um bürgerliche Gewerbe betreiben zu können, wurde auch noch<br />
in die Gemeindeordnung von 1855 übernommen ( vgl.<br />
Art.252ff, in: „Gemeindeordnung für das Herzogtum Oldenburg“<br />
v.1.7.1855, in: OGBl.Bd.14/1855, S.1029ff). Erst 1861<br />
wurde diese Bestimmung ausdrücklich aufgehoben (vgl.<br />
Art.12, in: „Gewerbegesetz für das Herzogtum Oldenburg“<br />
v.11.7.1861 ... , S.731). Bis zu diesem Zeitpunkt stützte<br />
das in der HWO existierende Zunftrecht das gewerbliche Bürgerrecht<br />
ab. Der Magistrat konnte jedoch den Zuzug von<br />
Handwerkern sogar noch nach Einführung der Gewerbefreiheit<br />
erschweren, indem er ihnen die Aufnahme in den Gemeindeverband<br />
verweigerte (vgl. die Ausführungen zur Aufnahme von
582<br />
wicklung des Gewerbegesetzgebungsprozesses soll beschrie-<br />
ben, seine Bestimmung durch eher bewegende oder retardie-<br />
rende Kräfte als „politischer Prozeß“ in drei Phasen<br />
(6.3.3.1; 6.3.3.4; 6.3.4) herausgearbeitet werden. Dies ge-<br />
schieht mit dem Ziel, politisches Handeln einer eigenen<br />
kritischen Bewertung zu unterziehen und es nicht wirt-<br />
schaftsstrukturell, d.h. aus dem agrarisch bestimmten,<br />
kleinstaatlichen Charakter des Landes abzuleiten und damit<br />
zu rechtfertigen.<br />
6.3.2 Revision der Handwerksordnung (1839-1847)<br />
Die Ergänzung und Modifikation einiger Punkte der HWO ver-<br />
tagte die Aufgabe, eine umfassende Gewerbeordnung zu konzi-<br />
pieren, die von freiheitlicheren Grundsätzen aus Fabrikwe-<br />
sen, Handel und Handwerk gleichermaßen berücksichtigte und<br />
der willkürlichen Einteilung in freie und dem Konzessions-<br />
zwang unterworfene Gewerbe ein Ende bereitete. Im Februar<br />
1839 wurde der Regierung aufgegeben, eine Bekanntmachung<br />
auszuarbeiten, welche eine zweite Prüfung des Meister-<br />
stücks, nachdem das erste abgelehnt worden war, gestattete.<br />
ausländischen Gewerbetreibenden; Ende der 40er Jahre wandte<br />
er sich gegen deren Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen<br />
der Stadt, dazu Kap.6.2.2.3). Bis 1861 wurde einheimischen<br />
Handwerkern trotz der durch das Staatsgrundgesetz von<br />
1849 eingeführten Freizügigkeit der Erwerb der Gemeindezugehörigkeit<br />
der Stadt erschwert. Der Art.68 sowie die Umzugsverordnung<br />
vom März 1849 knüpften an den Umzug nur den<br />
Erwerb der Mitgliedschaft des neuen politischen Gemeindeverbandes,<br />
also der staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten<br />
eines solchen Mitglieds. Das Recht zur Betreibung eines bestimmten<br />
Gewerbes wurde dadurch nicht vergeben und unterlag<br />
weiterhin den Beschränkungen der HWO (Voraussetzungen zum<br />
Erwerb des Meisterrechts, staatliche Genehmigung der Niederlassung<br />
nur bei Nichtübersetztsein des städtischen Handwerks).<br />
Diese Konstruktion wurde auch in die Gemeindeordnung<br />
von 1855 übernommen (vgl. Art. „Die (Umzugs-<br />
)Verordnung vom 5./8.März d.J.“, in: Neue Blätter für Stadt<br />
und Land v.13.10.1849, S.339f.; Art.28, in:<br />
„Gemeindeordnung für das Herzogtzum Oldenburg“ v.1.7.1855<br />
...).
583<br />
Diese schlug nun vor, bei der Gelegenheit einige weitere<br />
Abänderungen der HWO zu erlassen. Ein erster Entwurf wurde<br />
dem Magistrat der Stadt Oldenburg und dem Landesherrn zuge-<br />
leitet. Im Dezember des Jahres befürwortete Paul Friedrich<br />
August, daß die neue Bestimmung zugleich mit weiteren Modi-<br />
fikationen getroffen werden sollte. 262 Erst 1847 sah sich die<br />
Regierung in der Lage, einen kommentierten zweiten Entwurf,<br />
der aus Verhandlungen mit dem Magistrat und anschließender<br />
Beratung im Kollegium hervorgegangen war, vorzulegen. In<br />
ihrem Bericht betonte sie, daß es sich bei den Abänderungs-<br />
vorschlägen nicht um eine vollständige Revision, bei der<br />
auch die Grundprinzipien der HWO überprüft und die seit<br />
1830 ergangenen Zusatzregelungen sowie Einzelfallentschei-<br />
dungen eingearbeitet werden müßten, handele. Die Vorschläge<br />
seien der mehrjährigen Praxis der Gewerbeaufsicht entsprun-<br />
gen und knüpften als „aushelfende Bestimmungen“ in den mei-<br />
sten Fällen an das Bestehende an; nur einige Punkte würden<br />
ein wenig darüber hinaus gehen, was der Regierung aber<br />
vollkommen unbedenklich erschien. Die gegenwärtige Regelung<br />
der fraglichen Punkte entspreche aber nicht nur den Erfor-<br />
dernissen der Praxis, sondern empfehle sich auch als Über-<br />
gangsregel bei der eventuellen Ausarbeitung einer freiheit-<br />
lichen Gewerbeordnung. 263 Es handele sich insgesamt um vier-<br />
zehn Erläuterungen der 115 Artikel umfassenden Handwerk-<br />
sordnung. Eine wirkliche Neuerung stellten nur die Ergän-<br />
zungen zu dem Artikel über die Rechte der Innungen dar. Der<br />
Fabrikbetrieb sowie der Handel mit fertigen Handwerkswaren<br />
wurden ausdrücklich von Zunftbeschränkungen befreit er-<br />
klärt. Tatsächlich mußten sich Betreiber von Fabriken je-<br />
doch wiederholt mit den Forderungen des Handwerks nach Be-<br />
schränkung ihrer Gewerbetätigkeit auseinandersetzen. Auch<br />
die Zuordnung von Arbeitskräften war Anlaß zahlreicher Kon-<br />
flikte. Dadurch, daß die Bestimmungen über das Handwerk die<br />
262 Vgl. Regierungsbericht v.13.12.1839, Resolution für die<br />
Regierung v.23.12.1939, in: StAO Best.31-13-68-1<br />
263 Vgl. Regierungsbericht v.15.4.1847, in: Ebenda (im Anhang<br />
A befindet sich der Entwurf)
584<br />
Grundlage der Gewerbeordnung bildeten, das Fabrikwesen hin-<br />
gegen nur ausnahmsweise davon abgehoben wurde und so<br />
gleichsam darin einen Fremdkörper bildete, blieb die Ab-<br />
grenzung zwischen Fabrik- und Handwerksbetrieb weiterhin<br />
ein Problem. Die Versuche der Behörden es mittels Definiti-<br />
on des Fabrikbegriffs zu lösen, trugen auch nicht recht<br />
weit. 264 Einige kleinere Nachbesserungen betrafen die Zulas-<br />
sung von Handwerksberufen auf dem Land, die Berufsausübung<br />
handwerklich ausgebildeter ehemaliger Sträflinge, die Er-<br />
laubnis, ein abgelehntes Meisterstück erneut begutachten zu<br />
lassen, den Befähigungsnachweis von sogenannten Meisterge-<br />
sellen, den Handel der Handwerker mit Industrieerzeugnis-<br />
sen, die Lehrzeit und Prüfung von Lehrlingen, deren Meister<br />
keiner Innung angehörten, die Anerkennung der in Strafan-<br />
stalten verbrachten Lehrzeit. Die Fragen der Übersetzung,<br />
der Betriebsgrenzen im Handwerk sowie der Wanderzeit der<br />
Landhandwerker wurden hingegen ausführlicher und kontrover-<br />
ser innerhalb der Regierung erörtert. Die Stellungnahmen<br />
waren von der Sorge bestimmt, daß die durch die Vorschläge<br />
eingeleiteten Veränderungen zu weit gehen und die Grundsät-<br />
ze der HWO unterhöhlen könnten. Es wurden aber auch einige<br />
wenige Stimmen laut, die im Fall der Wanderschaft die et-<br />
waige neue Regelung ausdrücklich als Erfüllung der derzei-<br />
tigen Prinzipien der HWO begrüßten. In einem Einzelvotum<br />
wurde der Gesamtentwurf sogar als darüber hinausgehend ein-<br />
gestuft und weitere konsequente Schritte in Richtung Gewer-<br />
befreiheit in Form einer grundlegenden Revision, ohne wei-<br />
terhin Rücksicht auf den Stand der Gewerbegesetzgebung in<br />
den Nachbarländern zu nehmen, gefordert.<br />
Die Regierung konzedierte, daß es keine eindeutigen Krite-<br />
rien gebe, die es erlaubten zu beurteilen, ob ein Handwerk<br />
in einer Stadt, wo Innungen bestünden, übersetzt sei oder<br />
nicht. Weder könne die Nachfrage mittels der Kopfzahl der<br />
264 Vgl. Ergänzungen zu Art.12, in:<br />
„Regierungsbekanntmachung, betreffend Erläuterungen und<br />
neue Bestimmungen zur Handwerks=Ordnung vom 28.Januar 1830“<br />
... , S.472; zu den Auseinandersetzungen um die Abgrenzung<br />
handwerklicher von industrieller Produktion vgl. Kap.6.2.1
585<br />
städtischen Bevölkerung ermittelt werden, da der Absatz der<br />
Handwerkserzeugnisse sich meist über den Stadtdistrikt hin-<br />
aus erstrecke, noch sei es möglich, die Verarmung unter den<br />
Meistern eines Handwerks auf Gewerbeüberfüllung zurückzu-<br />
führen. Daher hätten schon vor längerer Zeit mehrere Innun-<br />
gen verabredet, es Gesellen, die der hiesigen Gemeinde an-<br />
gehörten und das 30. Lebensjahr überschritten hätten, nicht<br />
aufgrund des Arguments der Übersetzung zu verwehren, sich<br />
in der Stadt selbständig niederzulassen. Diese Regelung<br />
wurde seither von Magistrat und Regierung in der Praxis an-<br />
gewandt. Die Regierung wollte diese Lockerung, die sie mit<br />
dem Prinzip der geregelten Freiheit noch für vereinbar<br />
hielt, allerdings nur Gesellen zugestehen, deren Eltern Ge-<br />
meindemitglieder waren. Damit war die Absicht verbunden,<br />
den Andrang der Gewerbetreibenden nach den Städten trotzdem<br />
auch weiterhin zu verhindern. Staatsrat Bödeker ging diese<br />
Ausnahmereglung bereits zu weit. Er sah darin schon den er-<br />
sten Schritt zur Gewerbefreiheit und befürchtete, daß es<br />
genügend ansässige Gesellen eines Handwerks gebe, die aus<br />
Bequemlichkeit, ohne vertiefte Kenntnisse an anderen Orten<br />
gewinnen zu wollen und ohne die Möglichkeit, sich anderswo<br />
niederzulassen, ernsthaft zu prüfen, in Oldenburg bleiben<br />
und so Überfüllung herbeiführen würden. Der Vorschlag der<br />
Regierungsmehrheit wurde schließlich in den Entwurf über-<br />
nommen. 265<br />
Unterschiedliche Ansichten zeigten sich weiterhin bei der<br />
Frage, ob das in der HWO ausgesprochene Verbot für Meister,<br />
mehrere Handwerke gleichzeitig auszuüben, gelockert oder<br />
sogar abgeschafft werden sollte. Die Regierung hielt es<br />
zwar für außerordentlich schwierig, die Betriebsgrenzen je-<br />
des Handwerks genau zu bestimmen, konnte sich aber mit dem<br />
von Magistrat und Innungen favorisierten Vorschlag nicht<br />
anfreunden, es jedem Meister frei zu stellen, Gesellen an-<br />
derer Gewerke in seiner Werkstatt arbeiten zu lassen. Au-<br />
ßerhalb der Werkstätte sollte dies nicht geschehen dürfen.<br />
265 Vgl. Regierungsbericht v.15.4.1847, in: StAO Best.31-13-<br />
68-1
586<br />
Die Absicht des Magistrats, die Handwerker allmählich zu<br />
einem fabrikmäßigen Betrieb hinzuleiten, wurde von der Re-<br />
gierung mit der Begründung abgelehnt, daß damit eine we-<br />
sentliche Grundlage der HWO, nämlich die geregelte Arbeits-<br />
teilung, auf der das Gesetz die Vervollkommnung der Gewerbe<br />
sowie besonders die stufenweise Ausbildung junger Handwer-<br />
ker in einem bestimmten Gewerk anstrebe, verletzt werde.<br />
Der Vorschlag, es der Regierung zu überlassen, die Tätig-<br />
keitsbereiche der Handwerker in einzelnen Fällen zu erwei-<br />
tern, wurde in den Entwurf übernommen.<br />
Darüber, ob die Wanderschaft für Landhandwerker zwingend<br />
vorgeschrieben werden solle, gingen die Meinungen innerhalb<br />
des Kollegiums der Regierung auseinander. 1831 hatte die<br />
Regierung zunächst durch ein Circular bestimmt, daß der<br />
Nachweis der Wanderschaft für die selbständige Niederlas-<br />
sung von Landhandwerkern „[...] nicht unumgänglich nöthig<br />
erachtet werden solle“. 266 1843 erbat sich der Kreis Jever<br />
die Genehmigung für eine Verordnung, die die Wanderschaft<br />
gemäß Art.67 HWO auch für das dortige Landhandwerk geltend<br />
machen sollte. Dadurch würde die mangelnde Befähigung vie-<br />
ler Landhandwerker verbessert werden. 1844 erließ die Re-<br />
gierung aus dem gleichen Grund ein Circularreskript an alle<br />
oldenburgischen Ämter, daß ein angehender Landmeister zu-<br />
mindest zwei Jahre als Geselle außerhalb des Kreises seines<br />
Geburtsortes sowie des Ortes, an dem er seine Lehrzeit ver-<br />
bracht habe, arbeiten müsse. Doch wurden Ausnahmen zugelas-<br />
sen, um größere Härten besonders in den ersten zwei Jahren<br />
zu verhindern. Bald erwies sich aber auch diese Regelung<br />
als unzureichend, da augenscheinlich der eigentliche Zweck<br />
der Wanderschaft dadurch nicht erreicht wurde. Oft hätte<br />
der Geselle im heimatlichen Kreis eine bessere Ausbildung<br />
erhalten können als die, die er gezwungenermaßen außerhalb<br />
absolvierte. Da außerdem die beiden Reskripte von 1831 und<br />
1844 bisher nicht publiziert worden waren und manche Gesel-<br />
266 Ebenda, S.40; das Circular regelte den Art.11 der HWO<br />
über die erforderliche Qualifikation von Landhandwerkern,<br />
die keiner Innung beigetreten waren, näher.
587<br />
len erst bei der Prüfung ihrer Qualifikation von den Be-<br />
stimmungen erfuhren, sollte jetzt eine gesetzliche Vor-<br />
schrift Klarheit verschaffen.<br />
Zwei Mitglieder des Kollegiums wollten das Landhandwerk<br />
nicht von der Wanderpflicht ausgenommen wissen. Dieses Er-<br />
fordernis sei Teil der Vorschriften zur Erlangung der Mei-<br />
sterschaft, die dem Hauptanliegen der HWO gemäß, die Quali-<br />
tät der handwerklichen Arbeit zum Wohl der Handwerker<br />
selbst als auch besonders zum Wohl der Bevölkerung sichern<br />
sollten. Da im Herzogtum die Güte der Produkte nicht über<br />
den freien Wettbewerb gewährleistet werde, müsse dafür dann<br />
aber die andere Möglichkeit dieses Ziel zu erreichen, näm-<br />
lich durch die Bedingungen der Konzessionierung, konsequent<br />
verfolgt werden. Als weiteres Argument wurde vorgebracht,<br />
daß sich Stadt und Land hinsichtlich der Anforderungen an<br />
Güte, Dauerhaftigkeit und Eleganz der Produkte immer weiter<br />
anglichen und deswegen ein gleicher Qualitätsmaßstab und<br />
damit gleiche Vorschriften gelten müßten. Es sei auch ge-<br />
samtwirtschaftlich wichtig, das Landhandwerk zu fördern,<br />
indem die Qualifikation seiner Meister gehoben werde. Dane-<br />
ben würde durch die Wanderpflicht der Andrang zu den Hand-<br />
werken auf dem Land zu Lasten des landwirtschaftlichen Be-<br />
triebes vermindert werden. Viele Gesellen betrieben ein von<br />
den Heiratsbeschränkungen der HWO ausgenommenes Handwerk,<br />
um möglichst schnell eine Familie gründen zu können. Außer-<br />
dem sei jetzt auch der Landhandwerker durch den verbesser-<br />
ten Schulunterricht sowie die fortschreitende Bildung eher<br />
in der Lage, die Wanderschaft nutzen und Arbeit finden zu<br />
können. Die Mehrheit der Regierungsmitglieder lehnte die<br />
Wanderpflicht für Landhandwerker ab, da sie im Widerspruch<br />
zu einem der Fundamente der HWO, dem Gegensatz zwischen<br />
Stadt und Land, stehe. Gewerbe sollten gemäß der Absicht<br />
der HWO möglichst nur in den Städten und ihnen gleichge-<br />
setzten Orten, Landwirtschaft hingegen vorzugsweise auf dem<br />
Land betrieben werden. Daher sollten sich nur in Städten<br />
Zünfte bilden und nur hier die Handwerker eine zunftgemäße<br />
Ausbildung erhalten können. Dieselben Anforderungen an
588<br />
Stadt- und Landhandwerk zu stellen, bedeute diesem Prinzip<br />
zufolge eine Anomalie. Die Wanderschaft sei von jeher ein<br />
Attribut der zunftgemäßen Ausbildung gewesen; Gesellen, die<br />
nicht zünftig gelernt hatten, wurde die Arbeitssuche in<br />
Ländern, in welchen Zünfte bestanden, sehr erschwert. Au-<br />
ßerdem könnten selbst beim besten Willen nicht alle Land-<br />
handwerker bei den wenigen Zünften in die Lehre gehen. Die<br />
schlechtere Qualität gewerblicher Produkte sowie die meist<br />
kümmerliche Existenz von Handwerkern auf dem Land entsprin-<br />
ge den Verhältnissen und sei als unabänderlich hinzunehmen.<br />
Das Gewerbe in den Städten ringe erfolgreich darum, sich<br />
vom Landbau zu befreien, um so zu größerer Blüte zu gelan-<br />
gen. In der Stadt Oldenburg sei dies bereits geschehen. Das<br />
Handwerk auf dem Land werde hingegen immer in Verbindung<br />
mit Landwirtschaft betrieben werden und sich kaum entwik-<br />
keln können. Würden die Gesellen auf dem Land gezwungen<br />
sein, im Ausland zu wandern, so bestünde bei ihrer Rückkehr<br />
die Gefahr, daß sie als besser ausgebildete Handwerker ver-<br />
suchten, in den Städten zu arbeiten und damit die Konkur-<br />
renz vervielfachten. Die Regierungsmehrheit riet, nicht in<br />
die bisherige Regelung der Ausbildung von Stadt- und Land-<br />
handwerk einzugreifen. Die Konkurrenz sei hier im Land auch<br />
ohne Gewerbefreiheit groß genug, um zu Weiterbildung und<br />
freiwilliger Wanderschaft im gesetzlichen Rahmen der HWO<br />
anzuspornen. Gute Handwerker würden sich außerdem auch<br />
dorthin begeben, wo sie größeren Absatz vermuteten. Aller-<br />
dings müßte Gewerbetreibenden mehr Freizügigkeit gewährt<br />
werden. Die Verpflichtung zur Wanderschaft von Landhandwer-<br />
kern wurde entsprechend den Mehrheitsverhältnissen dann<br />
nicht in den Entwurf übernommen. Allerdings durften jetzt<br />
Landhandwerker, die keinen Nachweis der Wanderschaft vorle-<br />
gen konnten, nicht mehr einer Innung beitreten.<br />
Regierungsassessor von Berg, der den Entwurf als weit über<br />
die ursprüngliche Absicht hinausgehend ansah und daher die,<br />
ohnehin bald erforderliche, Konzipierung einer das Handwerk<br />
integrierenden allgemeinen Gewerbeordnung forderte, stellte
589<br />
in einem Einzelvotum seine Überlegungen dazu vor. 267 In den<br />
Augen Bergs lag der HWO aufgrund der Tatsache, daß ge-<br />
schlossene Zünfte in Oldenburg nicht existierten, das Prin-<br />
zip der Gewerbefreiheit zugrunde, das durch die Unterschei-<br />
dung von Stadt- und Landhandwerk, der Beibehaltung einer<br />
Bannmeile, bestimmter Zunftrechte sowie spezieller Vor-<br />
schriften für die selbständige Niederlassung beschränkt<br />
wurde. An die Stelle des ursprünglichen Zunftwesens war das<br />
Konzessionswesen, die staatliche Genehmigung, getreten, die<br />
sowohl das Wohl der Handwerker wie auch das Wohl der Bevöl-<br />
kerung im Auge habe. Jede vorgeschlagene Modifikation nun<br />
bringe die HWO der unbeschränkten Gewerbefreiheit näher;<br />
daher sei es ratsam, noch einen Schritt weiterzugehen und<br />
das ganze Gesetz dem Prinzip der Gewerbefreiheit zu unter-<br />
werfen. Der Vorschlag beispielsweise, der die Situation von<br />
Gesellen, die das 30 Lebensjahr überschritten haben, behan-<br />
dele, mache deren Niederlassung nur noch von der Qualifika-<br />
tion abhängig (das Argument der Übersetzung spiele hier<br />
keine Rolle mehr). Berg sah darin eine wesentliche Verände-<br />
rung des herkömmlichen Zunftwesens. Die letzten auschlie-<br />
ßenden Befugnisse würden den Zünften genommen, sie seien<br />
jetzt auf ihre ursprüngliche Aufgabe, die Vervollmommnung<br />
der Gewerbe, beschränkt worden. Dieser Zweck könne aber,<br />
wenn man dem Prinzip der Gewerbefreiheit konsequent folge,<br />
auch ohne Zünfte erreicht werden. Allgemeine Vorschriften<br />
über die nachzuweisende Qualifikation, die nicht zunftmäßig<br />
erworben sein müsse, würden genügen. Wolle man dann dennoch<br />
Zünfte aufrechterhalten, so entsprächen sie Handwerkerver-<br />
einen zur Beförderung und Erhaltung des Gemeinsinns sowie<br />
zur gegenseitigen Unterstützung im Fall von Krankheit oder<br />
Tod. Die Vorschriften einer freiheitlichen Handwerksordnung<br />
reduzierten sich für Berg auf den Qualifikationsnachweis<br />
und die Begrenzung des Zunftwesens in Schranken von Hand-<br />
werkervereinen. Stadt und Land könnten gleich behandelt<br />
267 Vgl. Votum des Regierungsassessors Karl Heinrich Ernst<br />
von Berg v.10.11.1846, Anlage B des Regierungsberichts<br />
v.15.4.1847 ...
590<br />
werden; die Regierung würde weiterhin Nachweise überprüfen<br />
und Konzessionierungen vornehmen. Gewerbefreiheit könne<br />
auch als Grundsatz der gesetzlichen Behandlung aller übri-<br />
gen Gewerbe vorangestellt werden. Bisher sei das Konzessi-<br />
onswesen ohne ein festes Prinzip gehandhabt worden, indem<br />
einfach die Praxis festgehalten wurde. Dies führte dazu,<br />
daß mit wenigen Ausnahmen jedes Gewerbe einer obrigkeitli-<br />
chen Genehmigung, sei es aus polizeilichen, sei es aus fi-<br />
nanziellen Gründen, bedurfte. Nun gehe die Gesetzgebung<br />
grundsätzlich von der freien gewerblichen Betätigung aus,<br />
jede Beschränkung müsse in Zukunft ausdrücklich gerechtfer-<br />
tigt werden. So entstünde die größere Gruppe der freien Ge-<br />
werbe, die keiner obrigkeitlichen Erlaubnis bedurfte und<br />
die kleinere Gruppe der nicht freien Gewerbe, deren Betrei-<br />
bung entweder aus allgemein polizeilichen Gründen oder weil<br />
eine Rekognition zu zahlen war, eine gewerbspolizeiliche<br />
Erlaubnis erforderte.<br />
In einem weiteren Einzelvotum kritisierte auch Regierungs-<br />
rat Erdmann, daß der Entwurf weder eine Revision sei, noch<br />
sich auf die Regelung der notwendigsten Dinge beschränke.<br />
Es fehle der leitende Grundgedanke. 268 Doch anders als Berg<br />
hielt er mit Blick auf die bevorstehende gänzlich neue Ge-<br />
staltung des Gewerbewesens die Ansicht der Regierung für<br />
richtiger, zum jetzigen Zeitpunkt nur geringe Modifikatio-<br />
nen der HWO zuzulassen. Für dringend einer gesetzlichen Re-<br />
gelung bedürftig befand er vier Punkte. Die Verhältnisse<br />
der Landhandwerker müßten umfassend und gesondert von der<br />
HWO, die lediglich ein Gesetz über die Bildung und Verfas-<br />
sung der an bestimmte Orte gebundenen Zünfte sei, behandelt<br />
werden. Mit der angemessenen Berücksichtigung fabrikartiger<br />
Betriebe im Entwurf war Erdmann einverstanden. Die Regelung<br />
in der Übersetzungsfrage ging ihm dagegen nicht weit genug.<br />
Sie mildere nur Härten. Außerdem müsse die Bannmeilenbe-<br />
stimmung wegfallen. Die Berücksichtigung der Lehrzeit in<br />
268 Vgl. Votum des Regierungsrats Albrecht Johannes Theodor<br />
Erdmann v.27.12.1846, Anlage C des Regierungsberichts<br />
v.15.4.1847 ...
591<br />
Strafanstalten könne dahin erfolgen, daß sie jener bei ei-<br />
nem hiesigen Zunftmeister absolvierten gleichkomme. Im Ent-<br />
wurf wurde vorgeschlagen, sie nur derjenigen bei einem<br />
nicht zu einer Innung gehörenden Landmeister gleichzustel-<br />
len. Dies solle auch dann der Fall sein, wenn der Lehrmei-<br />
ster einer landesfremden Innung entstamme. Alle übrigen<br />
Punkte des Entwurfs seien entweder eher unerheblich oder<br />
bedürften allenfalls instruierender Regierungsreskripte an<br />
Magistrate und Ämter.<br />
Weder die gewerbefreiheitlichen Vorstöße Bergs noch die be-<br />
scheideneren Vorschläge Erdmanns, die zu einigen, obwohl<br />
von diesem scheinbar nicht intendierten, Neuerungen im Ver-<br />
hältnis von Stadt- und Landhandwerk und bezüglich der Nie-<br />
derlassungsbestimmungen führen konnten, stießen beim Lan-<br />
desherrn auf Zustimmung. Paul Friedrich August wollte sich<br />
auch zukünftig auf den Boden der herkömmlichen Zunftverfas-<br />
sung stellen, da er in ihr das beste Mittel sah, der Verar-<br />
mung im Handwerk vorzubeugen. So strich er auch den Vor-<br />
schlag zur Lockerung der Übersetzungsregelung im Regie-<br />
rungsentwurf, den er ansonsten akzeptierte.<br />
„[...], daß Wir uns für die Aufrechterhaltung einer<br />
vernünftigen Zunftverfassung als das beste Mittel,<br />
dem Proletariat im Handwerksstand entgegen zu wirken,<br />
entschieden haben; dieser Gesichtspunkt ist bei der<br />
Beurtheilung des vorliegenden Gegenstandes festzuhalten<br />
und muß auch bei der zu erlassenden Gewerbe=Ordnung<br />
Anwendung finden.“ 269<br />
Insgesamt zeigte bei aller auferlegten Zurückhaltung die<br />
Diskussion einzelner Punkte der HWO sowie die Stellungnah-<br />
men zum Gesamtentwurf, daß es durchaus gedankliche Ansätze<br />
zu freiheitlicheren Bedingungen gewerblichen Wirtschaftens<br />
gab, die als förderlich und der Entwicklung der oldenburgi-<br />
schen Wirtschaft angemessen betrachtet wurden. Zu nennen<br />
ist dabei das Arbeiten von Handwerkern über die herkömmli-<br />
chen Betriebsgrenzen hinweg oder die Förderung des Land-<br />
269 Resolution für die Regierung v.4.11.1847, in: StAO<br />
Best.31-13-68-1
592<br />
handwerks. Die Chancen, sie und weiterführende Überlegungen<br />
in nicht allzu ferner Zeit im Rahmen einer umfassenden Ge-<br />
werbeordnung zu realisieren, schienen allerdings unter der<br />
Regierung Paul Friedrich Augusts nur gering zu sein. Hinzu<br />
kam die von Berg in seinem Votum kritisierte zögerliche<br />
Haltung vieler Regierungsmitglieder selbst gegenüber einer<br />
Gewerbepolitik, die in den Nachbarländern noch keine Ent-<br />
sprechung fand.<br />
6.3.3 Innerbehördliche Diskussion über Umfang und<br />
Beschränkungen der künftigen Gewerbeordnung -<br />
Positionen zur Gewerbefreiheit in der Öffent-<br />
lichkeit sowie in Teilen des Handwerks<br />
6.3.3.1 Regulierung des Konzessionswesens oder allgemeine<br />
Gewerbeordnung (der Umfang der Gewerbeordnung,<br />
1829-1858)?<br />
Der Regierungsantritt Paul Friedrich Augusts 1829 in Olden-<br />
burg machte es erforderlich, einen größeren Teil der unter<br />
dem Vorgänger erteilten Gewerbskonzessionen zu bestätigen.<br />
Die Regierung nahm dies zum Anlaß, eine Revision des Kon-<br />
zessionswesens dergestalt vorzuschlagen, daß eindeutige<br />
Kriterien bzw. ein leitendes Prinzip für die Vergabe von<br />
obrigkeitlichen Genehmigungen auf gesetzlicher Grundlage<br />
festzulegen waren. 270 1831 begründete sie ihre bisherige Un-<br />
tätigkeit in dieser Sache damit, daß erst die Regelung des<br />
Konzessionswesens in Hannover abgewartet worden war. Der<br />
Plan war dort dann einstweilen aufgegeben worden, doch<br />
Staatsrat Suden habe sich die entsprechenden Vorschläge aus<br />
Hannover zuschicken lassen. Außerdem habe sich die Regie-<br />
270 Vgl. Regierungsbericht v.11.7.1829, in: StAO Best.31-13-<br />
68-32
593<br />
rung weder aus den eigenen noch aus den älteren Akten der<br />
Kammer eine ausreichende Übersicht der bisher ausgegebenen<br />
Arten von Konzessionen und der dafür bezahlten Rekognitio-<br />
nen verschaffen können. Diese müsse aus den Amtsrechnungen<br />
zusammengestellt werden. 271 Erst 1839 lieferte die Regierung<br />
einen Bericht ab. Zunächst wurden die Gewerbe aufgezählt,<br />
die schon reguliert worden waren und nicht unter die neue<br />
Gesetzgebung fallen sollten. Dazu gehörte auch das Hand-<br />
werk. In den Augen der Regierung würde eine zukünftige Ge-<br />
werbeordnung über das Handwerk nichts anderes enthalten<br />
können, als was schon bisher in der HWO bestimmt worden<br />
war. Allerdings wurde die Schwierigkeit erkannt, genau zu<br />
bestimmen, welche Gewerbe unter die HWO fielen und welche<br />
nicht. Angesichts der raschen Entwicklung der Industrie und<br />
der Gewerbetätigkeit im allgemeinen, sei es aber nicht rat-<br />
sam, einen bestimmten Begriff von „Handwerk“ und<br />
„Industriebetrieb“ zugrunde zu legen, um Betriebsgrenzen zu<br />
bestimmen. Der Bericht gab 17 konzessionspflichtige Gewerbe<br />
an, die Rekognitionen zahlen mußten und 12, bei denen dies<br />
nicht erforderlich war. In der Stadt Oldenburg mußte die<br />
obrigkeitliche Genehmigung im allgemeinen nicht nachgesucht<br />
werden. Konzessionen, hier auch Privilegien genannt, wurden<br />
dennoch für größere Anlagen, wie Buchdruckereien und Apo-<br />
theken, nachgesucht und vergeben. Ob dies vorgeschrieben<br />
war, hatte die Regierung nicht ermitteln können. Unstrittig<br />
war, daß aus der Stadt mitsamt ihrem früheren Gebiet nie<br />
eine Gewerbsrekognition in die herrschaftliche Kasse be-<br />
zahlt worden war. Sie übte seit jeher selbst das Recht der<br />
Konzessionsvergabe aus und diesbezügliche Abgaben flossen<br />
in die Stadtkasse. An die neue Gesetzgebung könnte nun ent-<br />
weder das Prinzip der Gewerbefreiheit oder das der Konzes-<br />
sionspflichtigkeit aller Gewerbe angelegt werden. Im ersten<br />
Fall sei es erforderlich, eine begründete Übersicht über<br />
diejenigen Gesuche aufzustellen, die ausnahmsweise einer<br />
Konzession bedürften; im anderen Fall müßten die von einer<br />
271 Vgl. Regierungsbericht v.18.1.1831, in: Ebenda
594<br />
Genehmigung befreiten Gewerbe erfaßt werden. Gewerbefrei-<br />
heit sei der preußischen, Konzessionspflichtigkeit der bay-<br />
rischen und württembergischen Gewerbeordnung zugrunde ge-<br />
legt worden. Die Regierung hielt die Anwendung der Genehmi-<br />
gungspflicht bei den städtischen Handwerken für angemessen.<br />
Bei allen übrigen Gewerben hingegen sei es angesichts der<br />
raschen Entwicklung der Industrie kaum möglich, ein voll-<br />
ständiges Verzeichnis der erlaubten Gewerbe zu führen.<br />
Zweifel sowie in der Folge unnütze Schreibereien würden im-<br />
merfort darüber entstehen. Außerdem befürchtete die Regie-<br />
rung, daß die allzu wörtliche Befolgung dieses Prinzips die<br />
industrielle Entwicklung hemmen könnte. Aufgabe des Staats<br />
sei es, die Erwerbsmöglichkeiten seiner Untertanen auf jede<br />
Weise zu fördern und sie nur dort zu beschränken, wo es von<br />
allgemeinem Nutzen oder zur Abwendung unmittelbarer Gefah-<br />
ren, die mit der Betreibung des Gewerbes verknüpft wären,<br />
nötig sei. 272 1844 wurde ein Entwurf zur „Regulierung des<br />
Concessionswesens“ vorgelegt. 273 Im Oktober desselben Jahres<br />
fragte das Staats- und Kabinettsministerium in Berlin an,<br />
272 Vgl. Regierungsbericht v.2.8.1839, in: Ebenda; dem Bericht<br />
lag eine „Übersicht des Concessions=Wesens im Herzogthum<br />
Oldenburg und in der Erb=Herrschaft Jever“ an. In<br />
den neun Punkte umfassenden Vorbemerkungen wurde die bisherige<br />
gesetzliche Grundlage für Konzessionserteilungen dargelegt.<br />
Die Regierung beanstandete, daß sich meist der gesetzliche<br />
Ursprung der Konzessionspflichtigkeit im Einzelfall<br />
nicht nachweisen ließe. Eine allgemeine Regel darüber,<br />
welcher Gegenstand, welches Gewerbe einer Konzession bedürfe,<br />
gebe es überhaupt nicht. Auch existierten keine festen<br />
Grundsätze über die Höhe von Rekognitionen. Nirgendwo sei<br />
begründet worden, warum in den Konzessionen verschiedene<br />
Bestimmungen darüber, ob und in welchem Fall eine Bestätigung<br />
erforderlich sei, getroffen worden waren. Gewerbeprivilegien,<br />
Bann- und Zwangsberechtigungen kämen nur noch in<br />
einzelnen, früher genehmigten Fällen vor, besonders bei<br />
Apotheken. Dort, wo die Berechtigung auf einen bestimmten<br />
Zeitraum beschränkt worden war, wurde sie späterhin aufgehoben.<br />
1816/17 wurde bestimmt, daß Konzessionen im Gegensatz<br />
zu Privilegien von dem jeweiligen Ressort innerhalb<br />
der oberen Staatsbehörden zu erteilen waren. Die erste Konzession<br />
jeder Art mußte im Entwurf dem landesherrlichen Kabinett<br />
zur Prüfung vorgelegt werden. Außerdem sollten Konzessionen<br />
nur noch befristet oder unter Vorbehalt der Zurücknahme<br />
erteilt werden.
595<br />
ob die preußische Staatsregierung tatsächlich vorhabe, eine<br />
Gewerbeordnung auszuarbeiten und zu welchem Zeitpunkt diese<br />
dann voraussichtlich erlassen werden würde. Etwa vier Mona-<br />
te später forderte sie die Regierung auf, die Ordnung des<br />
Konzessionswesens wiederaufzunehmen und weitere Vorschläge<br />
einzubringen, da die preußische Gewerbeordnung inzwischen<br />
veröffentlicht worden sei. 274 1848 bat der schweizerische<br />
Bundesrat um Zusendung der in Oldenburg gültigen Gewerbe-<br />
ordnungen. Sie sollten als vergleichbare Gesetzesgrundlage<br />
bei der Regelung der schweizerischen Gewerbeverhältnisse<br />
herangezogen werden. 275 Als Mitglied der Erfurter Union hatte<br />
sich auch Oldenburg verpflichtet, Materialien zum Zweck der<br />
Vorbereitung einer allgemeinen Gewerbeordnung an das provi-<br />
sorische Fürstenkollegium in Berlin zu senden. 276 Das Staats-<br />
ministerium hob in einem Exposé, das zusammen mit entspre-<br />
chenden Verordnungen im August 1850 verschickt wurde, knapp<br />
die Charakteristika der Regelung des oldenburgischen Gewer-<br />
bewesens hervor: Zunftrecht für das städtische Handwerk,<br />
allgemeiner Konzessionszwang für alle übrigen Gewerbe, von<br />
dem allerdings einige Städte ausgenommen waren. Gewerbliche<br />
273 Vgl. Entwurf zur „Regulierung des Concessionswesens“<br />
v.3.8.1844, in: Ebenda<br />
274 Vgl. Anfrage des Staats- und Kabinettsministeriums Oldenburg<br />
an Oberst von Röder zu Berlin v.7.10.1844, Resolution<br />
für die Regierung v.18.2.1845, in: Ebenda<br />
275 Vgl. Schreiben des Schweizerischen Bundesrats<br />
v.12.12.1848, Rückschreiben des Staats- und Kabinettsministeriums<br />
v.19.1.1849, in: StAO Best.31-13-68-1<br />
276 Von Manteuffel hatte das Fürstenkollegium auf den Art.31<br />
der Reichsverfassung (Verabredung einer Reichsgewerbeordnung)<br />
hingewiesen. Daraufhin wurde in der 10. Sitzung des<br />
prov. Fürstenkollegiums beschlossen, alle Unionsregierungen<br />
zu ersuchen, die bei ihnen bestehenden Gewerbeordnungen<br />
u.a. gesetzliche Bestimmungen in dieser Beziehung durch ihre<br />
Bevollmächtigten im Fürstenkollegium mitteilen zu lassen.<br />
Außerdem wünschte von Manteuffel, daß zu diesem Zeitpunkt<br />
kein Land neue Gewerbeverordnungen erließ (vgl. Extrakt<br />
aus einem Bericht des Oberst Mosle an das Staatsministerium,<br />
Berlin 12.7.1850, in: Ebenda). Zum Zeitpunkt des<br />
Berichts war der Beitritt zum Berliner Bündnis allerdings<br />
noch nicht ratifiziert. Dies geschah am 10. September (vgl.<br />
Eckhardt, A., Der konstitutionelle Staat (1848-1918). Die<br />
bürgerliche Revolution im Großherzogtum Oldenburg (1848-
596<br />
Exklusiv-, Bann- und Zwangsrechte seien inzwischen durch<br />
das Staatsgrundgesetz von 1849 vollkommen abgeschafft wor-<br />
den. Es enthielte darüber hinaus den Grundsatz der Gewerbe-<br />
freiheit. 277 Nachdem die preußischen Unionspläne gescheitert<br />
waren, wandte sich Oldenburg 1851 wieder verstärkt der Vor-<br />
bereitung einer eigenen Gewerbeordnung zu. Das Staatsmini-<br />
sterium ernannte eine Kommission, die zunächst sich gut-<br />
achtlich über den geplanten Umfang der Gesetzgebung äußern<br />
sollte. War es ratsam, eine allgemeine Gewerbeordnung, ähn-<br />
lich wie in Preußen und Hannover, für das gesamte Gewerbe-<br />
wesen, die dann aber eine Revision der bestehenden Hand-<br />
werksgesetze erfordern würde, auszuarbeiten? Die zweite<br />
Frage, welches leitende Prinzip der Gewerbeordnung zugrunde<br />
zulegen war, sollte zusammen mit einem sachverständigen<br />
Beirat, der aus drei vom Handels- und Gewerbeverein vorzu-<br />
schlagenden Gewerbetreibenden der Stadt Oldenburg bestehen<br />
würde, geklärt werden. 278 Die personelle Zusammensetzung der<br />
Kommission bewirkte, daß sich verschiedene Innungen an den<br />
Stadtdirektor mit der Bitte wandten, doch auch Handwerker<br />
dieser Arbeitsgruppe beitreten zu lassen. In einem Zei-<br />
tungsartikel wurde die Kompetenz der nur aus Beamten beste-<br />
henden Kommission, eine zeitgemäße Gewerbeordnung auszuar-<br />
beiten, angezweifelt. Zugleich wurde aber auf die Unfähig-<br />
keit der Handwerker, sich selbst Gesetze zu geben, ingewie-<br />
sen. Der Entwurf einer Handwerks- und Gewerbeordnung für<br />
Oldenburg, der in Anlehnung an den Frankfurter Entwurf von<br />
1848 von einer Kommission des damaligen Handwerkervereins<br />
vorbereitet werden sollte, war niemals fertiggestellt wor-<br />
1851), in: ders.,Schmidt, H., (Hg.), Geschichte des Landes<br />
Oldenburg ... , S.345<br />
277 Vgl. Schreiben des Staatsministeriums an Oberst Mosle in<br />
Berlin v.7.8.1850, in: Ebenda<br />
278 Vgl. Reskript des Staatsministeriums v.14.6.1851, in:<br />
StAO Best.70, Nr.6736; in die Kommission wurden gewählt:<br />
Ministerialrat von Berg als Vorsitzender, Ministerialrat<br />
Buchholtz, Stadtdirektor Wöbcken, Amtmann Greverus (vgl.<br />
Reskript an den Magistrat v.26.6.1851, in: StAO Best.262-<br />
1A, Nr.1997). In den Beirat wurden drei Handwerker gewählt<br />
(vgl. Bericht des Direktoriums des Gewerbe- und Handelsvereins<br />
v.24.7.1851, in: StAO Best.70, Nr.6736).
597<br />
den. Das Beitrittsgesuch der Innungen wurde jedoch abge-<br />
lehnt. 279<br />
Erst 1858 kam wieder Bewegung in die Revisionsbestrebungen.<br />
Der Magistrat forderte öffentlich eine grundlegende Überar-<br />
beitung der Handwerksverfassung dergestalt, daß aller<br />
Zunftzwang aufgehoben werden sollte, da er nicht mehr den<br />
heutigen Gewerbeverhältnissen entspreche. Etwa gleichzeitig<br />
erteilte Berg Buchholtz die Aufgabe, möglichst rasch eine<br />
Kommission neu zu bestellen, um dem nächsten Landtag einen<br />
Gewerbegesetzentwurf präsentieren zu können. Dies bedeute-<br />
te, daß die 1851 ins Leben gerufene Arbeitsgruppe bestätigt<br />
werden und ihre Arbeit diesmal ohne Zuziehung eines Beirats<br />
zügig aufnehmen sollte. Allenfalls könne ein Gutachten des<br />
Gewerbe- und Handelsvereins heraugezogen werden. Die weite-<br />
re Entwicklung der Gewerbegesetzgebung in anderen Bundes-<br />
staaten wollte das Staatsministerium jetzt nicht mehr ab-<br />
warten. 280 In einem Bericht äußerte sich der Magistrat aus-<br />
führlicher zu dem von ihm gegenüber der Regierung schon oft<br />
geäußerten Wunsch nach einer Revision. Die HWO kranke seit<br />
ihrer Einführung an Rechtsunsicherheit. Erstreckten sich<br />
beispielsweise die Bestimmungen der HWO nur auf die Zünfte<br />
der Städte oder auf die Handwerker im ganzen Land? Außerdem<br />
bestünde eine erhebliche Diskrepanz zwischen der Gesetzge-<br />
bung an sich, die auf den Grundlagen der alten Zunftverfas-<br />
sung beruhe, und ihrer Anwendung im eher liberalen Geist<br />
durch die Beamten. Auf diese Weise würden eine große Anzahl<br />
von Streitigkeiten der Handwerker untereinander sowie gegen<br />
Dritte verursacht werden. Die alten Grundlagen müßten nun<br />
bei einer Revision ganz verlassen werden und den Resultaten<br />
neuerer Wissenschaft Einlaß gegeben werden. Dann hielt der<br />
279 Vgl. Bericht des Magistrats v.2.7.1851, Schreiben des Regierungspräsidenten<br />
Mutzenbecher v.16.8.1851, Schreiben des<br />
Stadtdirektors an verschiedene Innungen v.22.8.1851,<br />
Schreiben Mutzenbechers an Wöbcken v.24.9.1851, in: StAO<br />
Best.262-1A, Nr.1997; vgl. Art. „Einige Betrachtungen“, in:<br />
Der Beobachter v.11.7.1851, S.221f.<br />
280 Vgl. Oldenburgisches Gemeindeblatt v.12.1.1858, in: StAO<br />
Best.262-1A, Nr.1998; Schreiben von Bergs an Buchholtz<br />
v.20.1.1858, in: StAO Best.31-15-43-1
598<br />
Magistrat ein Plädoyer für die Befreiung der Industrie von<br />
allen nicht dem Gemeinwohl dienenden Beschränkungen, die<br />
Berechtigung jeder Person, seine erlernten Fähigkeiten, wie<br />
und wo sie es kann, anzuwenden; er lehnte weiterhin die<br />
scharfe Abgrenzung der einzelnen Handwerke untereinander<br />
ab, sprach sich für die Abschaffung der Übersetzungsrege-<br />
lung sowie des Zunftzwangs aus. Vereine, die die Interessen<br />
der Handwerker zu vertreten beabsichtigten, sollten nur auf<br />
freiwilliger Basis begründet und ohne Beitrittspflicht so-<br />
wie ausschließenden Vorrechten geführt werden dürfen.<br />
Schließlich betonte der Magistrat, daß er sich mit seiner<br />
Einschätzung und seinem Anliegen nicht nur im Einklang mit<br />
den Regierungsbehörden, sondern auch mit größeren Teilen<br />
der Bevölkerung sowie der Gewerbetreibenden selbst fühle.<br />
Einen Hinweis darauf gebe das Abstimmungsergebnis im Stadt-<br />
rat. Sechs Handwerker (darunter vier Innungsmeister), vier<br />
Kaufleute und drei Staatsdiener hätten sich einstimmig für<br />
eine freiheitliche, auch das Handwerk umfassende Gewerbe-<br />
ordnung ausgesprochen. 281 Die Regierung befürwortete die in<br />
dem Bericht dargelegte Ansicht und drang selbst gegenüber<br />
dem Staatsministerium darauf, mit der Revision rasch zu be-<br />
ginnen. 282 Etwa zwei Monate später begründete Buchholtz ge-<br />
genüber seinen Kollegen im Staatsministerium die auch in<br />
seinen Augen für Oldenburg erforderliche freiheitliche Ge-<br />
werbeordnung und skizzierte die notwendigen Arbeitsschrit-<br />
te. 283 Daß 1851 die Gewerbesache nicht weiter verfolgt worden<br />
wäre, habe daran gelegen, daß zunächst die Revision des<br />
Staatsgrundgesetzes zu erledigen war. Der Umfang der Gewer-<br />
begesetzgebung wurde von Buchholtz nicht mehr diskutiert.<br />
Es stand jetzt fest, daß die Revision das Handwerk nicht<br />
aussparen und sich auch auf bisher nicht erfaßte Bereiche,<br />
wie den Marktverkehr, Taxen, das Patentwesen erstrecken<br />
281<br />
Vgl. Magistratsbericht v.7.2.1858, Stadtratsprotokoll<br />
v.5.1.1858 (im Anhang), in: StAO Best.262-1A, Nr.1998<br />
282<br />
Vgl. Regierungsbericht v.25.2.1858, in: StAO Best.31-15-<br />
43-1<br />
283<br />
Vgl. Vortrag des Ministerialrats K.F.N.Buchholtz<br />
v.12.4.1858, in: Ebenda
599<br />
würde. Für Gewerbefreiheit spreche die rasche Entwicklung<br />
der Industrie, die Ausbreitung volkswirtschaftlichen Den-<br />
kens; beides lasse auch im Herzogtum die Beschränkungen<br />
durch das Zunftwesen immer obsoleter erscheinen. In wirt-<br />
schaftlicher sowie technischer Hinsicht könne die unbe-<br />
schränkte Gewerbebetätigung eindeutig größere Resultate<br />
aufweisen als das Zunftsystem. Doch müsse auch die soziale<br />
Seite des Innungswesens in Betracht gezogen werden, die den<br />
jungen Handwerker davon abhielte, sich zu früh zu verheira-<br />
ten; ihn erziehe, indem er zunächst im Dienst Anderer stün-<br />
de, fremde Verhältnisse und Gehorsam kennenlerne, die Zeit<br />
der Wanderschaft nutzen müsse, um die Meisterprüfung beste-<br />
hen zu können. Hinzu kämen die wohltätigen Einrichtungen,<br />
wie Krankenkassen und Unterstützungskassen für zünftige<br />
Handwerker. Weiterhin unterstellte Buchholtz Magistrat und<br />
Stadtrat, daß sie ihren Antrag nicht in allen seinen Konse-<br />
quenzen durchdacht hätten. Denn Gewerbefreiheit ermögliche<br />
es jedem Handwerker des Herzogtums, sich unter denselben<br />
Bedingungen, wie ein gewöhnlicher Tagelöhner, in der Stadt<br />
niederzulassen. Der Betrieb eines Gewerbes könne dann nicht<br />
mehr vom vorgängigen Erwerb des Bürgerrechts abhängig ge-<br />
macht werden. Auch Ausländern würde die selbständige Nie-<br />
derlassung in Stadt und Land erleichtert werden müssen.<br />
Trotz dieser Einwände und Fragen, die sich aus der Auflö-<br />
sung des Zunftwesens ergeben konnten, sah Buchholtz in der<br />
Einführung der Gewerbefreiheit in Oldenburg angesichts der<br />
geringen Konkurrenz im Gewerbe, der wenigen Industriean-<br />
siedlungen sowie dem eher verhaltenen Pioniergeist der Be-<br />
völkerung ein Mittel der wirtschaftlichen Förderung des<br />
Landes.<br />
„Ich bin vielmehr überzeugt, daß im hiesigen Herzogthum,<br />
welches nicht an würgender Concurrenz der<br />
Gewerbtreibenden laboriert, dessen Boden noch Raum<br />
für die mannigfachste Entwicklung der Kräfte gewährt<br />
und dessen Bewohnern nach ihrem Temperamente eine<br />
größere gegenseitige Anregung dienlich sein mag, die
600<br />
Einführung der Gewerbefreiheit mehr vortheilhaft als<br />
nachtheilig sein werden.“ 284<br />
Bevor die dem Staatsministerium direkt unterstellte Kommis-<br />
sion mit der Ausarbeitung einer freiheitlichen Gewerbeord-<br />
nung beginne, riet Buchholtz, sich zu vergewissern, ob Ge-<br />
werbefreiheit auch tatsächlich von größeren Teilen der Be-<br />
völkerung gewünscht werde. Um dem Gesetzentwurf eine breite<br />
Grundlage zu sichern, sollte sich die Regierung im Plenum<br />
mit der Frage beschäftigen, ob es dem Gemeinwohl förderlich<br />
sei, vom Prinzip der Gewerbefreiheit auszugehen oder ob es<br />
aufgrund der besonderen Verhältnisse im Herzogtum nahelie-<br />
gender sei, die bisherigen im Konzessionszwang liegenden<br />
gewerblichen Beschränkungen aufrechtzuerhalten. 285 Buchholtz<br />
schlug vor, dazu Gutachten des Gewerbe- und Handelsvereins,<br />
der Ämter und Magistrate sowie eventuell auch der Innungs-<br />
vorsteher anzufordern. Die Mitglieder der Kommission soll-<br />
ten zu den Plenarsitzungen der Regierung außerdem eingela-<br />
den werden. Später konnte der fertige Entwurf, ehe er an<br />
den Landtag gelangte, dann der Öffentlichkeit durch Abdruck<br />
in den Landeszeitungen präsentiert werden. Parallel zur<br />
Klärung der Frage über die Angemessenheit von Gewerbefrei-<br />
heit in Oldenburg würde sich die Kommission, die das Ergeb-<br />
nis der Diskussion abwarte, schon einmal mit der Gesetzge-<br />
bung anderer Bundesstaaten vertraut zu machen haben.<br />
Bis 1858 schien die Mehrheit in den Regierungsbehörden noch<br />
nicht von der Notwendigkeit überzeugt, Gewerbefreiheit als<br />
leitendes Prinzip einer auch das Handwerk umfassenden all-<br />
gemeinen Gewerbeordnung voranzustellen. Es wurde abgewar-<br />
tet, vertagt, und man widmete sich anderen Aufgaben. Erst<br />
1858 schien ein Umdenken in weiten Kreisen staatzufinden,<br />
das auch Rückhalt in der Bevölkerung und insbesondere bei<br />
den Gewerbetreibenden fand. Magistrat, Stadtrat und Regie-<br />
284 Ebenda<br />
285 Vgl. dazu auch die Verfügung an die Regierung<br />
v.26.4.1858, in: Ebenda; als Mitglieder der Kommission wurden<br />
diesmal ernannt: Ministerialrat Buchholtz, Regierungsrat<br />
Strackerjan sowie Regierungsassessor Mutzenbecher.
601<br />
rung machten sich jetzt stark für eine allgemeine freiheit-<br />
liche Gewerbeordnung. Buchholtz, der maßgeblich die Arbei-<br />
ten am Gesetzentwurf bestimmte, führte dies auf das wach-<br />
sende Bewußtsein der Rückständigkeit im eigenen Land zu-<br />
rück, das die Unzulänglichkeiten und Beschränkungen der<br />
zünftigen Handwerksordnung immer stärker zum Vorschein kom-<br />
men ließe. Buchholtz selbst sah in der Einführung der Ge-<br />
werbefreiheit ein Mittel, Gewerbe und Industrie im agra-<br />
risch bestimmten Kleinstaat Oldenburg zu fördern.<br />
6.3.3.2 Freizügigkeit, Gewerbefreiheit, Zunftwesen und<br />
Konzessionssystem - Oldenburger Zeitschriften-<br />
stimmen (1846-1856)<br />
Die Behandlung gewerbepolitischer Vorstellungen im Handwerk<br />
sowie in der Öffentlichkeit um 1848 und in der darauffol-<br />
genden Reaktionszeit soll einerseits die Position der Hand-<br />
werkerbewegung der Revolutionsjahre näher beleuchten und<br />
andererseits Anhaltspunkte für die wachsende Unzufrieden-<br />
heit in der Bevölkerung mit dem unveränderten obrigkeitli-<br />
chen Konzessionssystem sowie der zünftigen Handwerksordnung<br />
geben. Welche Positionen wurden gegenüber der Idee der Ge-<br />
werbefreiheit im allgemeinen sowie deren möglicher Einfüh-<br />
rung in Oldenburg eingenommen? Was wurde an der hiesigen<br />
Wirtschaftsordnung im einzelnen kritisiert und was sollte<br />
verändert werden? Wie weit sollte eine Reform reichen?<br />
1846 hielt Revisor Knauer ein Plädoyer für Gewerbefreiheit<br />
im Volksbildungsverein, indem er beispielhaft die ruinösen<br />
Folgen der zünftigen Niederlassungsbeschränkungen für die<br />
Gesellen den Zuhörern vor Augen führte. Knauer schlug dann<br />
vor, die Ausbildungszeit, vornehmlich die Wanderschaft, zu<br />
kürzen. Hiergegen wandte sich ein Handwerker, der in einem<br />
Zeitungsartikel besonders die Bedeutung der praktischen Er-<br />
fahrung nach der Lehre hervorhob. Er befürchtete, daß die
602<br />
Verkürzung der vorschnellen Niederlassung ohne ausreichende<br />
Geldmittel Vorschub leisten würde. Daraus entstünde dann<br />
vermehrte Konkurrenz, die zu niedrigen Preisen, schlechter<br />
Arbeit und schließlich zum Ruin der Handwerkerfamilien füh-<br />
ren würde. Sein Unmut richtete sich besonders gegen Ver-<br />
fechter gewerbefreiheitlicher Vorstellungen aus anderen Be-<br />
rufen, die von den Folgen ihrer propagierten Überzeugungen<br />
persönlich nicht betroffen werden würden. 286<br />
Im gleichen Jahr wurde Landgerichtsassessor Scholtz vorge-<br />
worfen, im Volksbildungsverein eine Lobrede auf die hiesige<br />
Handwerksordnung gehalten und dabei auf die preußische Ge-<br />
werbeordnung von 1845 verwiesen zu haben, die angeblich<br />
auch einer Rückkehr zum Zunftwesen gleichkomme. Der Verfas-<br />
ser vertrat die Ansicht, daß diese immer noch die freiheit-<br />
liche Entwicklung der Gewerbe gewährleiste. Die Einführung<br />
einer Gewerbeordnung anstelle des Patentscheinsystems<br />
schütze die Allgemeinheit besser vor Mißbrauch. Auch die<br />
Beschränkungen, denen die Ausübung eines Gewerbes jetzt un-<br />
terliege, seien mit Blick auf das Gemeinwohl und nicht mehr<br />
im Sonderinteresse einer bestimmten Gruppe von Gewerbetrei-<br />
benden erlassen. Innungen würden als freiwillige Vereini-<br />
gungen ohne auschließende Vorrechte nur noch den sozialen<br />
Zusammenhalt, die moralische und technische Ausbildung der<br />
Handwerker fördern. Schließlich hielt er die allumfassende<br />
staatliche Regelung von Erzeugung, Verbrauch und Erwerb für<br />
nicht realisierbar. Es sei aber auch ungerecht, ausschließ-<br />
lich eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zu versorgen und un-<br />
zeitgemäß, der industriellen Entwicklung auf dem Verwal-<br />
tungsweg die Richtung vorzuweisen.<br />
„Es ist unmöglich, daß eine Staatsregierung Erzeugniß<br />
und Verbrauch regele, den Erwerb beherrsche und sichere;<br />
es ist ungerecht und unpolitisch, für Diejenigen<br />
zu sorgen, welche in der Zunft sind, und Diejenigen<br />
brodlos zu machen oder brodlos zu lassen, welche<br />
draußen stehen, und so mit der einen Hand die Arbeit<br />
286 Vgl. Art. „Verein“, in: Der Beobachter v.3.2.1846, S.39;<br />
Art. „Der Volksbildungsverein“, in: Ebenda v.17.2.1846,<br />
S.56; Art. „Gewerbefreiheit“, in: Ebenda v.24.3.1846,<br />
S.94f.
603<br />
zu verbürgen und mit der andern sie zum Untergange zu<br />
zwingen; es ist vollends thöricht zu wähnen, daß es<br />
in jetziger Zeit der Erfindungen, der Eisenbahnen und<br />
zahlreichen Fortschritte auch nur möglich ist, der<br />
Industrie Grenzen und Bahnen vorzuzeichnen, in denen<br />
sie sich, ohne rechts oder links abzuweichen, bewegen<br />
soll.“ 287<br />
Innungstischlermeister Inhülsen widersprach der oben geäu-<br />
ßerten Einschätzung des Scholtzschen Vortrages sowie der<br />
preußischen Gewerbeordnung. Scholtz habe sich gegen die un-<br />
beschränkte Gewerbefreiheit absetzen wollen und sich für<br />
die Betreibung eines Gewerbes unter einem möglichst freien,<br />
doch geordneten Zunftwesen zum Besten des Gemeinwohls aus-<br />
gesprochen. Die preußische Gewerbeordnung stimme deswegen<br />
in etwa mit der HWO in Oldenburg überein, weil es ihre Ab-<br />
sicht sei, das Innungswesen als eine notwendige Ordnung des<br />
Gewerbebetriebs allmählich wieder herbeizuführen. Die Ge-<br />
setzgebung habe zunächst auf weitere bindende Vorschriften<br />
verzichtet, damit der Übergang ohne größere Störungen in<br />
der Führung der bestehenden gewerblichen Betriebe erfolgen<br />
könne. Außerdem sei es so möglich zu prüfen, in welcher<br />
Weise freiwillige Zusammenschlüsse das Gewerbe zum Wohl der<br />
Allgemeinheit sowie der Gewerbetreibenden entwickeln und<br />
auch erhalten könnten. Inhülsen zweifelte nicht daran, daß<br />
die Erfahrung, was am förderlichsten für die Entwicklung<br />
der Gewerbe sei, durch freiwillige Innungsbildung gemacht<br />
werden würde. Er hielt den vom Verfasser monierten Bei-<br />
trittszwang sowie die exklusiven Zunftberechtigungen in Ol-<br />
denburg für Preußen nicht unbedingt erforderlich. Jeder,<br />
der dort ein Gewerbe selbständig ausüben wolle, müsse dis-<br />
positionsfähig sein und seine Befähigung nachweisen können.<br />
288 Nicht die Konkurrenz geprüfter Meister müsse das Handwerk<br />
287 Art. „Zunftwesen und Gewerbefreiheit (Die neue Gewerbe=Ordnung<br />
in Preußen)“, in: Neue Blätter für Stadt und<br />
Land v.2.9.1846, S.313f.<br />
288 Vgl. Art. „Zunftwesen und Gewerbefreiheit (Die neue Gewerbe=Ordnung<br />
in Preußen)“, in: Ebenda v.11.11.1846, S.413-<br />
415; die Aussage Inhülsens stimmt nicht so ganz: nur wer<br />
einer Innung beitrat, mußte seine Befähigung nachweisen;
604<br />
scheuen, sondern nur die der Pfuscher. In Oldenburg gebe es<br />
eine solche allgemeine Bestimmung für Gewerbetreibende in<br />
Stadt und Land nicht, daher sei hier der Beitrittszwang zu<br />
den städtischen Innungen erforderlich. Grundsätzlich zog<br />
Inhülsen die preußische Lösung vor. Für noch erstrebenswer-<br />
ter mit Blick auf Oldenburg hielt er die allmähliche Aus-<br />
dehnung des Innungswesens auf das ganze Land. In Preußen<br />
könne sich der Gewerbetreibende der Verpflichtung, Lehrlin-<br />
ge und Gesellen auszubilden sowie in Kranken-, Sterbe- und<br />
andere Unterstützungskassen einzuzahlen, entziehen. Neben<br />
der sozialen und der berufsordnenden Funktion spreche auch<br />
die Aufgabe, gute und preiswerte Arbeit sicherzustellen für<br />
die Verbesserung des Gewerbewesens im vorgeschlagenen Sin-<br />
ne. Dann könnten auch die exklusiven Berechtigungen und<br />
Schutzmittel der städtischen Innungen in Oldenburg abge-<br />
schafft werden. Scholtz und Inhülsen traten also für eine<br />
Reform der bisher geltenden Handwerksordnung mit dem Ziel,<br />
das Gemeinwohl mit dem Wohl der Gewerbetreibenden durch<br />
Ausdehnung des Innungswesens auf das Land besser zu verbin-<br />
den, ein. Zwar sollte kein allgemeiner Innungszwang einge-<br />
führt werden und zünftige Vorrechte abgeschafft werden, der<br />
Wunsch aber nach Beitrittszwang und großem Befähigungsnach-<br />
weis reihte sich ein in die Hauptforderungen der Handwer-<br />
kerbewegung im 19. Jahrhundert.<br />
In einem Artikel von 1847 wurde u.a. die Willkür des Amt-<br />
manns gegenüber Niederlassungsgesuchen von Landhandwerkern<br />
kritisiert. Angesichts der Unsicherheit für die Kinder,<br />
einst in ihrem Kirchspiel ein Gewerbe selbständig ausüben<br />
zu dürfen, selbst bei Nachweis der erforderlichen Voraus-<br />
setzungen, wanderten viele Eltern nach Nordamerika, wo Ge-<br />
diese Bestimmung konnte jedoch von der Gemeinde aufgehoben<br />
werden. Insgesamt waren Befähigungsnachweis und Innungszugehörigkeit<br />
bei 43 Handwerken dann notwendig, wenn der angehende<br />
Meister Lehrlinge halten wollte. Erst 1849 wurde<br />
für etwa 70 gewerbliche Berufe Meisterprüfung und Innungsmitgliedschaft<br />
obligatorisch (vgl. Steindl, H., Die Einführung<br />
der Gewerbefreiheit ... , S.3566ff). Inhülsen hatte<br />
jedoch mit seiner Prognose, daß Preußen ein ausgedehntes<br />
Innungswesen wiedereinführen wollte, Recht.
605<br />
werbefreiheit herrsche, aus. Der Verfasser schloß mit einem<br />
Plädoyer für die Einführung der Gewerbefreiheit in Olden-<br />
burg. 289<br />
Seit 1848 wurde die Diskussion über die herrschenden re-<br />
striktiven Niederlassungsbestimmungen zunehmend politisch<br />
geführt. Im Juli des Revolutionsjahres forderte der Verfas-<br />
ser eines Artikels, daß die Entwicklung der staatsbürgerli-<br />
chen Freiheit in Oldenburg Hand in Hand mit der freien Be-<br />
wegung im gewerblichen Leben gehen müsse: Zunft- und Kon-<br />
zessionszwang müßten als Relikte vergangener Zeiten abge-<br />
schafft werden. Handwerker könnten sich durchaus frei asso-<br />
zieren. Die Zulassung gewerblicher Betätigung dürfe nicht<br />
mehr in das Ermessen der Obrigkeit gestellt werden. Die<br />
Aufgabe eines Gewerbegesetzes bestünde darin, die allgemei-<br />
nen, äußerlich erkennbaren Tatumstände festzulegen, bei de-<br />
ren Vorhandensein jedermann befugt sei, ein Gewerbe zu be-<br />
treiben. Ein Handwerkersonderrecht dürfe es nicht mehr ge-<br />
ben. Die Befreiung der wirtschaftlichen Tätigkeit von Pri-<br />
vilegien bewirke, daß der einzelne in seiner Leistungsfä-<br />
higkeit angespornt werde und damit die gewerbliche Entwick-<br />
lung zum Besten des Gemeinwohls fördere. 290 Auch in einem<br />
weiteren Artikel vom Mai des gleichen Jahres wurde ein Zu-<br />
sammenhang zwischen der Einführung einer Verfassung und ei-<br />
ner freiheitlichen Gewerbeordnung gesehen. In verschiedenen<br />
Petitionen an den Großherzog schien die Einführung von Ge-<br />
289 Vgl. Art.“Einiges über Auswanderungssucht“, in: Ebenda<br />
v.26.6.1847, S.217-219; die bevormundende und oft nicht<br />
einsichtige Handhabung der Handwerksgesetzgebung durch die<br />
staatlichen Behörden bildete 1848 einen Hauptkritikpunkt<br />
der Oldenburger Handwerkerbewegung (vgl. dazu Kap.6.3.1);<br />
1858 beklagte der Magistrat die Rechtsunsicherheit der HWO.<br />
So war nicht klar, ob deren Bestimmungen nur auf die Zünfte<br />
der Städte oder auch auf die Handwerker im ganzen Land sich<br />
erstreckten (vgl. dazu Kap.6.3.3.1). In Art.11 wurde von<br />
Landhandwerkern, die keiner Innung beigetreten waren, gefordert,<br />
ihre Qualifikation gegenüber der Obrigkeit nachzuweisen.<br />
Die Kriterien bzw. das dabei anzuwendende Verfahren<br />
wurde in das Ermessen der Obrigkeit gestellt.<br />
290 Vgl. Art.“Die Verfassung und der gewerbliche Fortschritt“,<br />
in: Ebenda v.19.7.1848, S.307
606<br />
werbefreiheit gefordert worden zu sein. 291 Der Verfasser be-<br />
merkte dann, daß demgegenüber die Stadt Oldenburg besonders<br />
am Zunftsystem festhalten wolle: Ratsherr Hoyer sowie<br />
Tischlermeister Inhülsen hätten sich in einem Vortrag vehe-<br />
ment gegen unbeschränkte Gewerbefreiheit ausgespro-<br />
chen. 292 Außer im Handwerk, wo Wanderschaft und Meisterstück<br />
für die Niederlassung nützlich seien, sollten seiner Mei-<br />
nung nach jedoch keinerlei Beschränkungen aufrechterhalten<br />
werden. Den Handwerkern der Stadt Oldenburg warf er vor,<br />
daß sie das alte uneinsichtige bürokratische System bei der<br />
Entscheidung über Niederlassungen, das durch einseitige Be-<br />
richte der zuständigen Behörde sowie Resolutionen an der<br />
Stelle von Angaben über die Entscheidungsgründe gekenn-<br />
zeichnet sei, offenbar beibehalten wollten. Dann wandte er<br />
sich besonders gegen die in den Vorträgen vorkommende Be-<br />
hauptung, daß die Gewerbetreibenden das Fundament im Staat<br />
bilden würden, folglich besonderen Schutz erwarten könnten,<br />
und plädierte für die Einführung einer allgemeinen Gewer-<br />
besteuer. Den tragenden Mittelstand bildeten in seinen Au-<br />
gen eigentlich die Bauern, die vielfältige Abgaben an die<br />
Landeskasse zahlten. Fabrikanten, Kaufleute und Handwerker<br />
entrichteten hingegen nur Beiträge an die staatliche Armen-<br />
kasse und teilweise geringe erwerbsunabhängige Gewerbereko-<br />
gnitionen. Einige Abgeordnete hätten daher in den Sitzungen<br />
der „Vierunddreißiger“ den Antrag gestellt, die Gewerbe-<br />
treibenden im Land mitzubesteuern. 293 In mehreren Artikeln<br />
wurde 1849 Gewerbefreiheit als konsequente Folge der durch<br />
das Staatsgrundgesetz sowie die Umzugsverordnung eingeführ-<br />
ten Freizügigkeit gefordert. Erst die Abschaffung der Nie-<br />
derlassungsbestimmungen der HWO und des Konzessionszwangs<br />
291 Vgl. Art. „Ueber Gewerbefreiheit“, in: Der Beobachter<br />
v.30.5.1848, S.191f.<br />
292 Hoyer und Inhülsen hielten diese Vorträge am 11.5.1848 in<br />
einer Bürgerversammlung (vgl. Art.“Auszug aus den Verhandlungen<br />
der Bürgerversammlung im Almers´schen Hause<br />
(Oldenburg den 11.Mai, Abends 8Uhr)“, in: Der Beobachter<br />
v.16.5.1848, S.175f.)
607<br />
ermögliche es dem Gewerbetreibenden, von dem Recht des<br />
freien Umzugs von einer Gemeinde in eine andere Gebrauch zu<br />
machen. 294 Die drei folgenden Artikel aus den 50er Jahren<br />
kritisierten die Allmacht der Bürokratie im Landtag, im<br />
Verkehr der Behörden untereinander, bei der Niederlassung<br />
von Akademikern, Handwerkern und anderen Gewerbetreibenden.<br />
Dies Unbehagen an der zünftigen Handwerksordnung und dem<br />
Konzessionszwang verstärkte sich vor dem Hintergrund der<br />
Reaktionszeit und entwickelte sich zur Kritik am Obrig-<br />
keitsstaat schlechthin. 1853 erschien dem Verfasser der be-<br />
stehende Gewerbezwang als Ausfluß obrigkeitlicher Bevormun-<br />
dung des alten Polizeistaats. 295 Die unter der französischen<br />
Okkupation eingeführte Gewerbefreiheit sei in erster Linie<br />
deshalb wieder abgeschafft worden, weil es darum gegangen<br />
wäre, die Errungenschaften der Revolution auszumerzen.<br />
Wirtschaftspolitisch könne diese Entscheidung nicht begrün-<br />
det werden. Die Bevölkerung habe weder unter der angebli-<br />
chen Überfüllung der Gewerbe gelitten noch vermehrt über<br />
schlechte Arbeit geklagt. Auch das von den Franzosen einge-<br />
führte mündliche und öffentliche Rechtsverfahren mußte aus<br />
dem obengenannten Grund weichen. Einrichtungen, die der<br />
Staat den Märzerrungenschaften des Jahres 1848 zurechne,<br />
ereile jetzt dasselbe Schicksal. 296 Der Verfasser wandte sich<br />
293 Am 27.4.1848 traten die 34 gewählten Abgeordneten des<br />
Landes zur Beratung des Verfassungsentwurfs zusammen (vgl.<br />
Wegmann-Fetsch, M., Die Revolution von 1848 ... , S.130).<br />
294 Vgl. dazu einige Ausführungen in Kap.6.3.1; vgl. Art.<br />
„Das Umzugsrecht und das Recht, ein Handwerk auszuüben“,<br />
in: Neue Blätter für Stadt und Land v.28.3.1849, S.106;<br />
Art.“Freizügigkeit“, in: Ebenda v.7.4.1849, S.116; Art.<br />
„Die (Umzugs=)Verordnung vom 5./8.März d.J.“, in: Ebenda<br />
v.13.10.1849, S.339f.<br />
295 Vgl. Art. „Revolutionshaß-Franzosenhaß-Gewerbszwang“,<br />
Tl.1, in: Volkszeitung für Oldenburg v.16.9.1853, S.1f.;<br />
Tl.2, in: Ebenda v.21.9.1853, S.1f.<br />
296 Dieser pessimistischen Einschätzung angesichts der Möglichkeit,<br />
liberale Ideen seit der Aufhebung der französischen<br />
Okkupation zu bewahren und durchzusetzen, ist zumindest<br />
entgegenzuhalten, daß die seit 1849 konstitutionelle<br />
Monarchie Oldenburgs zu den wenigen Staaten gehörte, die<br />
die Reaktion behutsam und kaum spürbar durchsetzte. Infolge<br />
der Beschlüsse des im Frühjahr 1851 wiedererstandenen Deutschen<br />
Bundes mußte auch Oldenburg seine Verfassung dem vor
608<br />
dann der Handwerksordnung zu. Die Begründung des in dem Ge-<br />
setz von 1830 realisierten Gewerbezwangs müsse kritisch be-<br />
leuchtet werden. Es sei da die Rede von der Erfordernis ei-<br />
ner „geregelten Freiheit des Gewerbes“ gewesen; bedürfe<br />
aber die Freiheit wirklich der Regelung? Er wies darauf<br />
hin, daß die vielfältigen Regelungen sich nicht zum Wohl<br />
der Bevölkerung auswirkten, was oberstes Gebot sei, sondern<br />
eher der Sicherung der Existenz der Handwerksmeister dien-<br />
ten. Gewerbefreiheit führe eben nicht dazu, daß die Konsu-<br />
menten mit Pfuscherarbeit überhäuft würden. Die Anstrengung<br />
des Einzelnen unter den Bedingungen der freien Konkurrenz<br />
bewirke bessere Qualität und größere Vielfalt der Produkte.<br />
Bei dem Tüchtigeren kaufe dann auch die Bevölkerung. Daß<br />
weniger tüchtige Handwerker dann nur ein dürftiges Auskom-<br />
men fänden, müsse in Kauf genommen werden. Sodann bezwei-<br />
felte der Verfasser die Fähigkeit der Behörden, über Nie-<br />
derlassungsanträge auch nur annähernd gerecht zu entschei-<br />
den zu können. Amtmänner, Stadtdirektoren, Bürgermeister,<br />
Juristen, die allesamt nicht vom Fach seien, müßten nur den<br />
Innungsvorstand, der wiederum jedes Gesuch als Schmälerung<br />
des eigenen Erwerbs betrachtete, hinzuziehen, um ein Urteil<br />
zu fällen. Da die Beamten selbst sich in Befürworter von<br />
eher gewerbefreiheitlichen Verhältnissen oder Anhänger des<br />
alten Zunftsystems spalteten, würde die Entscheidung von<br />
Wohlwollen und Zuneigung, Widerwillen und Abneigung stark<br />
beeinflußt werden. Zuletzt wandte sich der Verfasser den<br />
einzelnen Niederlassungsbestimmungen der HWO zu. Der Nach-<br />
weis der Befähigung durch ein Meisterstück sei mit zu hohen<br />
Kosten für den Gesellen verknüpft. Der Nachweis tadellosen<br />
Betragens könne gerade in heutiger Zeit leicht politisch<br />
der Revolution gültigen Bundesrecht wieder anpassen. Das<br />
Ergebnis von 1852 blieb trotz der in ihm enthaltenen Stärkung<br />
des monarchischen Prinzips ein liberales Verfassungswerk.<br />
Das neue restriktive Bundespressegesetz wurde in Oldenburg<br />
nur widerstrebend eingeführt. Auch die übrigen Reaktionserlasse<br />
des Bundestages stießen hier auf Bedenken;<br />
sie wurden im Land durch Verordnung erlassen, spielten aber<br />
in der Praxis kaum eine Rolle ( vgl. Eckhardt,A., Der konstitutionelle<br />
Staat (1848-1918) ... , S.348f., 353f.).
609<br />
interpretiert werden. Österreich, Preußen und andere Staa-<br />
ten erklärten es für tadelnswert, wenn der Geselle in die<br />
Schweiz wandere oder sich Gesellenverbindungen anschließe.<br />
Gefragt sei dann also regierungskonformes Verhalten. Die<br />
Verpflichtung,ein gewisses Betriebskapital nachzuweisen,<br />
verhindere, daß ein tüchtiger aber mittelloser Geselle die<br />
Chance erhalte, seinen Beruf auszuüben. Die Übersetzungs-<br />
klausel, die eine Entscheidung sowohl im Interesse der Be-<br />
völkerung als auch zum Wohl der ansässigen Meister herbei-<br />
führen solle, bilde in sich einen Widerspruch. Alles in al-<br />
lem sei also die staatliche Regelungsallmacht keinesfalls<br />
förderlich für die gewerbliche Entwicklung.<br />
Anläßlich der bevorstehenden Landtagswahlen wandte sich ein<br />
Artikel im Herbst 1854 an die Wähler, die den Glauben an<br />
Fortschritt und Fortentwicklung noch nicht verloren hätten,<br />
und stellte ihnen eindringlich vor Augen, daß der Landtag<br />
nicht mehr wie noch in der Revolutionsphase 1848 bis 1851<br />
gemäß seiner Bestimmung als Volksvertretung zusammengesetzt<br />
sei. Der Beamtenschaft, die mit 22 Abgeordneten zur Zeit<br />
dort vertreten war und die für den Verfasser Ausdruck der<br />
konservativen regierungskonformen Mehrheit seit 1851 war,<br />
lastete er die Einführung der scheinbar verklausulierten<br />
neuen Geschäftsordnung sowie des indirekten Dreiklassen-<br />
wahlrechts von 1852 an. Damit der Landtag wieder zum Leben<br />
erweckt, auf Wünsche der Bevölkerung besser eingegangen so-<br />
wie auch gegebenenfalls Oppositionspolitik betrieben werden<br />
könne, müsse das bürokratische Element zurückgedrängt wer-<br />
den. Es sei unabdingbar, wieder freiere und unabhängigere<br />
Männer in ihn hinein zu wählen. 297<br />
297 Vgl. Art. „Landtag und Bureaucratie“, in: Volkszeitung<br />
für Oldenburg v.1.9.1854, S.1. In der frühen Zeit des Oldenburger<br />
Landtags gab es nur politische Gruppierungen,<br />
keine festen Parteien und Fraktionen. Bis 1851 konnten die<br />
Demokraten mit wechselnden Mehrheiten (Abgeordnete des Zentrums;<br />
Abgeordnete, die sich weder den Demokraten noch den<br />
Konstitutionellen/Konservativen angeschlossen hatten) Oppositionspolitik<br />
betreiben. 1851 erfolgte angesichts des Erfordernisses,<br />
das Staatsgrundgesetz zu revidieren, ein<br />
Rechtsruck in der Bevölkerung: es wurden Männer in den<br />
Landtag gewählt,von denen man annahm, daß sie den Gesetzes-
610<br />
In die Kritik am Obrigkeitsstaat wurde auch die Regelung<br />
des Gewerbewesens durch Handwerksordnung und Konzessions-<br />
zwang einbezogen. Durch bürokratische Vorgaben oder will-<br />
kürliche Entscheidungen bei Niederlassungsgesuchen würden<br />
Gesellen und andere Gewerbetreibende entmündigt und erheb-<br />
lich behindert werden. Auch die Niederlassung von Personen,<br />
die einen wissenschaftlichen Beruf oder eine „Kunst“ aus-<br />
üben wollten, werde auf diese Weise erschwert. 1856 beklag-<br />
te ein Artikel das verbreitete Desinteresse der Bevölkerung<br />
an politischen, auf das Wohl des Ganzen hin ausgerichteten<br />
Belangen. Dieser Zustand sei auf das in alle Bereiche der<br />
Gesellschaft hineingreifende bevormundende Konzessionssy-<br />
stem zurückzuführen. Ohne eine gewisse soziale Unabhängig-<br />
keit in seinem Lebensumfeld, könne der Einzelne kein poli-<br />
tisches Bewußtsein entwickeln. 298<br />
Die Niederlassungsbestimmungen im Handwerk sowie Umfang und<br />
Handhabung der Konzessionserteilung durch die Behörden bei<br />
allen übrigen beruflichen Tätigkeiten gerieten in dem Zeit-<br />
raum zwischen 1846 und 1856 immer stärker in die Kritik. Es<br />
wurden nicht nur speziell die negativen Folgen der HWO für<br />
die Chance der Gesellen, ihr erlerntes Handwerk selbständig<br />
zu betreiben, und für die Qualität und Vielfalt der Versor-<br />
gung der Bevölkerung mit gewerblichen Produkten hervorgeho-<br />
ben; hinzu trat die Anklage, daß die neue konstitutionelle<br />
Monarchie das Erwerbsleben ihrer Staatsbürger nach wie vor<br />
vorlagen der Regierung zustimmten. Die neue konservative<br />
Mehrheit sprach sich dann 1852 für die Annahme des<br />
Dreiklassenwahlrechts aus, das die regierungsfreundliche<br />
Konstellation für die Zukunft stabilisierte. Dies führte<br />
u.a. in der folgenden Zeit dazu, daß das öffentliche Interesse<br />
am Landtag erlahmte (vgl. Eckhardt, A., Abstimmungsverhalten,<br />
politische Gruppierungen und Fraktionen im Landtag<br />
des Großherzogtums Oldenburgs 1848-1918, in: Hinrichs,E./Saul,K./Schmidt,H.,<br />
(Hg.), Zwischen ständischer<br />
Gesellschaft und „Volksgemeinschaft“. Beiträge zur norddeutschen<br />
Regionalgeschichte seit 1750 (Oldenburger Schriften<br />
zur Gesch.-wiss.Heft 1) Bibliotheks- u. Informationssystem<br />
der Universität Oldenburg, S.79ff); vgl. Eckhardt, A.,<br />
Der konstitutionelle Staat (1848-1918) ... , S.351,354).<br />
298 Vgl. Art. „Das Concessionswesen“, in: Volkszeitung für<br />
Oldenburg v.13.2.1856, S.1
611<br />
allumfassend und nach eigenem Ermessen regulierte und damit<br />
die Entwicklung zu politischer Selbständigkeit hemmte. Auch<br />
die Verhältnisse im Landtag wurden als Ausdruck des nach<br />
kurzer Phase wiedererstarkten Obrigkeitsstaates begriffen.<br />
Die Gewerbefreiheitsdiskussion erhielt durch die Einführung<br />
einer Verfassung und der Freizügigkeit 1848 sowie durch die<br />
konservative Wende der nachfolgenden Reaktionszeit in der<br />
Öffentlichkeit zusätzliches Gewicht. Selbst die Handwerker-<br />
bewegung wünschte 1848, sich von dem bevormundenden staat-<br />
lichen Zugriff bei der Regelung der Übersetzung, der Ober-<br />
aufsicht über die Innungen sowie der Begutachtung der Qua-<br />
lifikationsvoraussetzungen für die Niederlassung durch mehr<br />
Selbstverwaltung in Form eines Gewerberats abzuschirmen.<br />
Jedoch waren ihre Träger grundsätzlich mit der HWO zufrie-<br />
den. Allerdings sollte sie, wie dies von einem Exponenten<br />
der Bewegung gewünscht wurde, auf das Herzogtum ausgedehnt<br />
werden. Das Innungswesen wurde hier in seinem traditionel-<br />
len sozialen, berufs- und wirtschaftsordnenden Funktionen<br />
für zukunftfähig gehalten.<br />
6.3.3.3 Pauperismus, gewerbliche und politische Aktivitä-<br />
ten der städtischen Handwerker im Umfeld der<br />
überregionalen Handwerkerbewegung und der Olden-<br />
burger Verfassungsbewegung 1848/49<br />
Angesichts zunehmender Hilfsbedürtigkeit wurde 1843 eine<br />
Sitzung der „Special=Armen=Inspection“ und des Kirch-<br />
spielausschusses von Hohenkirchen im Jeverland mit der Ab-<br />
sicht anberaumt, Möglichkeiten, die der Verelendung unter<br />
weiten Teilen der Landarbeiter sowie der Handwerker im<br />
Amtsdistrikt abhelfen könnten, zu erörtern. In einem Vor-<br />
trag beschrieb der Amtmann die Gefahren der Armut, die er<br />
in dem Verfall einer den Lebenswandel steuernden sittlichen<br />
Moral ausmachte und in dem er gleichzeitig die eigentliche
612<br />
selbstverschuldete Ursache für die Verschärfung von Not und<br />
Verarmung erblickte. „Gedankenlosigkeit“, „Entfremdung vom<br />
kirchlichen Leben“, „Hang zu mühelosen Erwerbe und eitlen<br />
Genuß“ sowie der Konsum von Branntwein breiteten sich aus.<br />
Die Klage der Landarbeiter, daß Erwerbsnot und niedrige<br />
Löhne hauptsächlich durch die Konzentration des Grundbesit-<br />
zes in den Händen der großen Bauern, die Dreschmaschinen<br />
benützten, keine festen Tagelöhner mehr beschäftigten, son-<br />
dern die Arbeit vorzugsweise von ihrem Gesinde verrichten<br />
ließen und ausländische Hilfskräfte den einheimischen vor-<br />
zögen, herbeigeführt worden seien, wiegelte er ab. Die<br />
Herrschaft Jever sei auf ausländische Arbeitskräfte in der<br />
Landwirtschaft angewiesen. Im hiesigen Amtsdistrikt be-<br />
schäftigten die Bauern insgesamt 861 Dienstboten, von denen<br />
369 Ausländer seien. Sie müßten hinzugezogen werden, weil<br />
es an einheimischen Dienstboten fehlte. Auch der hier le-<br />
benden 100 fremden Arbeiterfamilien würden die Bauern wahr-<br />
scheinlich bedürfen und sie nur wohlbegründet als Arbeits-<br />
kräfte den einheimischen vorziehen. Auf ähnliche Weise be-<br />
handelte der Vortragende die Klage der hiesigen Handwerker<br />
über Übersetzung ihrer Gewerbe. Er stellte pauschal ein et-<br />
wa ausgeglichenes Verhältnis zwischen dem Anwachsen der<br />
Handwerkerschaft, der Bevölkerung sowie der Zunahme des Lu-<br />
xusbedarfs und der allgemeinen Nachfrage her. Die Kapitali-<br />
sierung der Landwirtschaft, die die traditionelle Arbeits-<br />
ordnung auflöste und sich in Form von Bevölkerungsrückgang,<br />
erhöhten Pachtgebühren wohl auch auf die Verhältnisse im<br />
Landhandwerk auswirkte - zumal viele Arbeiter gerade wegen<br />
der schlechten Erwerbslage in der Landwirtschaft vermehrt<br />
als Landhandwerker ihr Auskommen suchten - wurde als äuße-<br />
re, weniger erhebliche, Einwirkung eingeschätzt. 299 Ein ef-<br />
299 Vgl. Art. „Ueber die Mittel gegen die überhandnehmende<br />
Verarmung der arbeitenden Classen (Vortrag des Beamten in<br />
der Sitzung der Spezial=Armen=Inspection und des Kirchspielausschusses<br />
zu H. in der Erbherrschaft Jever)“, in:<br />
Neue Blätter für Stadt und Land v.14.6.1843, S.229-232.<br />
Die Auswirkungen der Besitzkonzentration, verbunden mit der<br />
Einführung der Dreschmaschinen um 1830, in den Marschgebieten<br />
des Jeverlandes und der Unterweser werden von Parisius
613<br />
fektives Mittel, der zunehmenden Verelendung abzuhelfen,<br />
sah er einmal in der Unterbringung der Armenkinder in Fami-<br />
lien, andererseits in der Erziehung der Kinder von Landar-<br />
beitern und Handwerkern in sogenannten Arbeitsschulen. Sie<br />
(vgl. Parisius, B., Vom Groll der „kleinen Leute“ ... ,<br />
S.28ff) als katastrophal für die Kleinbesitzer bewertet.<br />
Zwei Drittel der Bevölkerung waren von jeglicher Landnutzung<br />
ausgeschlossen; besonders zwischen 1817 und 1835 ging<br />
die Zahl der Hausmannsstellen deutlich zurück; die größten<br />
Veränderungen der Besitzverhältnisse fanden im Jeverland<br />
und in Nordbutjadingen statt; die Vergrößerung der verbliebenen<br />
Hausmannsstellen vollzog sich in erster Linie durch<br />
das Zusammenlegen großbäuerlicher Besitzungen, in Hohenkirchen<br />
allerdings auf Kosten der Häuslingsstellen. Die Beobachtungen<br />
der Arbeiter werden von Parisius in die schon so<br />
benannte Auflösung ihrer traditionellen Arbeitsordnung eingeordnet.<br />
Arbeiter wurden tatsächlich nur noch befristet<br />
als Tagelöhner beschäftigt und erhielten jetzt einen reinen<br />
geringeren Geldlohn; die anfallende Arbeit konnte mit Hilfe<br />
der Dreschmaschinen hauptsächlich vom Gesinde, das meist<br />
aus Ostfriesland kam und schlecht bezahlt wurde, erledigt<br />
werden. Insgesamt stagnierte das Bevölkerungswachstum, in<br />
einigen Gebieten, wie in Hohenkirchen, nahm die Einwohnerzahl<br />
ab. 1848 forderten dann auch die Landarbeiter und<br />
Handwerker in den Marschgebieten einen höheren Tagelohn,<br />
Pachtland, Einstellung Einheimischer etc. In einer Petition<br />
aus den vier Kirchspielen Minsen, St.Joost, Wiarden und Hohenkirchen<br />
an den Landesherrn wurde die möglichste Wiederherstellung<br />
der alten Besitz- und Arbeitsverhältnisse gefordert<br />
(vgl. Wegmann-Fetsch, M., Die Revolution von 1848<br />
... , S.114f.). Die von dem Amtsvorsteher genannten Ursachen<br />
und Begleiterscheinungen von Armut, die zeitgenössischen<br />
Auffassungen von Verelendung als „entsittlichender<br />
Dürftigkeit“ nahekamen, trafen für die Oldenburger<br />
Marschgebiete nicht zu. [ Pauperismus wurde von ihren Vertretern<br />
als Begriff für die in der ersten Hälfte des 19.<br />
Jahrhunderts zunehmenden Verarmung der ländlichen Unterschichten,<br />
die aus dem Nebeneinander von starkem Bevölkerungswachstum,<br />
einer zunächst nur langsam steigenden Nahrungsmittelproduktion<br />
sowie Mangel an neuen Arbeitsplätzen<br />
und Verdienstmöglichkeiten gleichsam unverschuldet entstand,<br />
abgelehnt. Sie sahen in der Verelendung hauptsächlich<br />
die gewohnte traditionelle Armut (vgl. Hardtwig, W.,<br />
Vormärz. Der monarchische Staat und das Bürgertum, München<br />
1985, S.70f., vgl. Lenger,F., Sozialgeschichte ... ,<br />
S.36)]. Im Jeverland waren die Landarbeiter zwar der Kirche<br />
entfremdet, jedoch begingen sie weder kriminelle Handlungen<br />
oder weigerten sich zu arbeiten, noch lockerte sich ihre<br />
Sexualmoral. Parisius stellt fest, daß der Zusammenbruch<br />
der traditionellen Arbeitsordnung gerade nicht zu einer<br />
Auflösung der „Sittlichkeit“, sondern eher zu deren Anstieg<br />
führte (vgl. Parisius, B., Vom Groll der „kleinen Leute“<br />
... , S.42ff).
614<br />
sollten den öffentlichen Schulen eingegliedert werden.<br />
Frauen aus der Umgebung müßte die Aufgabe übertragen wer-<br />
den, dort die Kinder zu verschiedenen häuslichen Tätigkei-<br />
ten anzuleiten und zu erziehen.<br />
Etwa zwei Monate später wurde in einem Artikel Bezug auf<br />
die Äußerungen des Amtmanns genommen. Der Verfasser bean-<br />
standete, daß ausschließlich in der sittlichen Hebung der<br />
Handarbeiter und nicht in der Veränderung der Arbeitsver-<br />
hältnisse ein Mittel gegen die zunehmende Verelendung gese-<br />
hen werden würde. Gäben die Bauern ihnen auch im Winter<br />
beim Dreschen Arbeit, so würde die Mehrzahl die angebotene<br />
Gelegenheit zum Verdienst auch nutzen und damit der Verar-<br />
mung entgehen. Sodann begrüßte der Verfasser ausdrücklich<br />
die Einführung von Arbeitsschulen für die Jugend. Außerdem<br />
müßte aber auch etwas für das Wohl der Dienstboten getan<br />
werden. Die Einführung von Zwangssparkassen bis zu ihrer<br />
Verheiratung würde sie davor schützen, unbemittelt eine Fa-<br />
milie zu gründen und später von Armenunterstützung leben zu<br />
müssen. 300<br />
Daraufhin meldete sich eine weitere Stimme zu Wort, die die<br />
Erörterung der Ursachen des Pauperismus in allgemeine wirt-<br />
schaftliche Zusammenhänge einbettete. Die Landwirtschaft<br />
sei trotz gestiegener Produktivität und Nachfrage nicht in<br />
der Lage, die fast überall enorm anwachsende Bevölkerung zu<br />
beschäftigen. Die zunehmende Konzentration von Grundbesitz<br />
in den Händen von Großbauern sowie der Verdrängungswettbe-<br />
werb zugunsten großer, über Kapital verfügender Fabrikbe-<br />
triebe oder Verlage führe zur Polarisierung in der Land-<br />
wirtschaft sowie in Handel und Gewerbe. Folge davon sei zu-<br />
nehmende Erwerbslosigkeit im selbständigen Mittelstand bei<br />
insgesamt steigendem nationalen Wohlstand. In der unglei-<br />
chen Verteilung der Güter und des Erwerbs sah der Verfasser<br />
die Hauptquelle des Pauperismus. Lohnarbeit nehme zu, selb-<br />
ständige Tätigkeit hingegen ab. Der wirtschaftliche Struk-<br />
300 Vgl. Art. „Ueber die Mittel gegen die überhandnehmende<br />
Verarmung der arbeitenden Classen“, in: Neue Blätter für<br />
Stadt und Land v.2.8.1843, S.293f.
615<br />
turwandel in Handel und Gewerbe, die veränderte Nachfrage<br />
sowie der Ausbau des Verkehrswesens schafften jedoch auch<br />
neue Arbeitsmöglichkeiten, freilich oft in anderer Form und<br />
an anderen Orten. Um den Pauperismus zu überwinden, müsse<br />
es Erwerbslosen ermöglicht werden, ihr Kirchspiel zu ver-<br />
lassen und in anderen Regionen Arbeit zu suchen. Als weite-<br />
re Ursachen der Verarmung nannte der Verfasser dann den<br />
Verfall der Sittlichkeit sowie das staatlich organisierte<br />
Armenwesen. Die Einrichtung, daß jeder Bezirk seine Armen<br />
ernähren müsse, führe zur Beschränkung der Freizügigkeit.<br />
Dem erwerbslosen Teil der Landbevölkerung würde es durch<br />
die Regelungen des Erwerbs der Kirchspielsmitgliedschaft<br />
sehr erschwert werden, an einem anderen Ort im Herzogtum<br />
Arbeit zu suchen und sich dort dauerhaft niederzulas-<br />
sen. 301 Der Unbemittelte ziehe es daher oft vor, Tagelöh-<br />
nerarbeiten in seiner Heimatgemeinde zu verrichten und im<br />
Fall der Erwerbslosigkeit Armenunterstützung zu beziehen.<br />
Dieses System vermindere den Erwerbswillen und verwalte die<br />
Armut, anstatt sie zu bekämpfen. Zu diesem Zweck müsse auch<br />
dort, wo keine Arbeit zu vergeben ist, die Übersiedlung in<br />
fremde Länder befördert werden. Der Verfasser sah in der<br />
freiwilligen privaten Wohltätigkeit der Bürger anstelle der<br />
301 Vgl. Art. „Die Armenpflege und der Pauperismus“, in:<br />
Ebenda v.9.9.1843, S.341-344.<br />
Die Abstimmung zwischen Armenunterstützung, Freizügigkeit<br />
und Heimatrecht in den Gemeindeordnungen muß vor dem Hintergrund<br />
der Bestrebungen der Gemeinden gesehen werden, jede<br />
Vermehrung möglicher Empfänger von kommunalen Unterstützungsmitteln<br />
und die Entstehung von Rechten Zuziehender,<br />
mit denen eine Nutzung am Gemeindeland verbunden war, zu<br />
verhindern oder möglichst zu erschweren. Nach Rössler gewährte<br />
die oldenburgische Landgemeindeordnung von 1831 im<br />
Vergleich mit entsprechenden Regelungen anderer Länder des<br />
Deutschen Bundes ein hohes Maß an Freizügigkeit, das auch<br />
für Vermögenslose galt. Als potentielle Unterstützungsempfänger<br />
mußten sie zunächst nachweisen, daß das Kirchspiel,<br />
das sie verlassen hatten, für ihren Unterhalt weiterhin<br />
aufkam. Meist erhielten sie dann ein vorläufiges Aufenthaltsrecht<br />
in der neuen Gemeinde. Nach einer zwei- bis<br />
vierjährigen Anwartschaft, in der sie keine Armenmittel in<br />
Anspruch nehmen durften, konnten sie die Kirchspielsmitgliedschaft<br />
erwerben. (vgl. Rössler, L., Die Entwicklung<br />
der kommunalen Selbstverwaltung ...S.121ff).
616<br />
staatlich organisierten Armenunterstützung ein wirksameres<br />
Mittel zur Bekämpfung des Pauperismus. Die Gelder könnten<br />
gezielter zur Förderung von Erwerbstätigkeit eingesetzt<br />
werden; außerdem würde wahrscheinlich auch mehr gespendet<br />
werden.<br />
1845 hielt Ratsherr Schröder einen Vortrag in der Monats-<br />
versammlung des Gewerbe- und Handelsvereins über den Paupe-<br />
rismus, dessen wirtschaftliche Bedingungen - besonders die<br />
Absatzstockungen im Gewerbe - er in einem einheitlichen<br />
Handels- und Zollraum für überwindbar hielt. Wenn erst die<br />
Hansestädte und die nordwestlichen Staaten des Deutschen<br />
Bundes dem Zollverein beigetreten wären, könne der Ausfuhr-<br />
handel gesichert und ausgebaut sowie neue Arbeitsmöglich-<br />
keiten geschaffen werden. Zudem würde sich auch die bisher<br />
oft von Sorglosigkeit und Unüberlegtheit bestimmte Verwen-<br />
dung des Verdienstes seitens der Arbeiter bei regelmäßiger<br />
Beschäftigung ändern. 302 Die anwachsende Unzufriedenheit un-<br />
ter den Handarbeitern sei damit aber nicht behoben, denn<br />
sie gründe auf der unverhältnismäßigen Steuerbelastung ge-<br />
genüber den vermögenden Mitbürgern. Diese werde besonders<br />
drückend empfunden, wenn zusätzlich indirekte Steuern auf<br />
Güter des alltäglichen Bedarfs erhoben würden. Die Einfüh-<br />
rung einer gerechteren allgemeinen Einkommenssteuer könne<br />
in der Öffentlichkeit unbedenklich vorgeschlagen werden, da<br />
hier im Herzogtum das Ausmaß der Verelendung, verglichen<br />
mit anderen deutschen Staaten, noch sehr gering sei und we-<br />
nig Unruhe zu befürchten sei. Die Steuerreform diene daher<br />
eher der Vorbeugung als der Abhilfe eines Notstandes. Ein<br />
Überfluß an Arbeitskräften sei höchst selten anzutreffen,<br />
zur Zeit herrsche sogar Mangel daran. Sodann wies Schröder<br />
302 Vgl. Art. „Die Dringlichkeit einer Verbesserung des Zustandes<br />
der handarbeitenden Klassen“, in: Neue Blätter für<br />
Stadt und Land v.16.4.1845, S.137-139. Schröder wies in<br />
diesem Zusammenhang besonders auf den durch Veränderungen<br />
der Binnennachfrage sowie die englische Konkurrenz bedingten<br />
Rückgang des Absatzes für Leinen im In- und Ausland, zu<br />
dessen Folgen dann die schlesischen Weberunruhen von 1844<br />
zählten, hin. - Oldenburg trat 1854 dem Deutschen Zollverein<br />
bei.
617<br />
auf die vielfältigen Bemühungen hin, der hiesigen Wirt-<br />
schaft aufzuhelfen: Förderung von teilweise zurückgegange-<br />
nen oder ruhenden Industriezweigen, wie dem Leinengewerbe,<br />
Verbesserung der Land- und Wasserstraßen. Hinzu trete die<br />
fortschreitende Verbesserung des Schulwesens sowie erste<br />
Erfolge der für Arbeiter eingerichteten Sparkassen. Im Ver-<br />
gleich mit anderen Staaten hätten die hiesigen Arbeiter we-<br />
sentlich weniger zu den öffentlichen Lasten beizutragen.<br />
Dies gelte besonders für die staatliche Steuerbelastung. In<br />
der Stadt Oldenburg würden jedoch als kommunale Abgaben ei-<br />
ne indirekte Steuer auf Fleisch und Brennmaterial sowie<br />
Servicegeld erhoben, die sowohl unverhältnismäßig die ärme-<br />
ren Einwohner als auch besonders die kleinen Hausbesitzer<br />
bedrücke. Schröder forderte daher die Aufhebung des Octroi<br />
und ihre Ersetzung durch eine direkte Einkommenssteuer so-<br />
wie eine Revision der bestehenden Einrichtung der Service-<br />
pflichtigkeit. Die Höhe der Serviceabgabe sollte sich nicht<br />
nach der bisherigen registerlichen Qualität, sondern nach<br />
dem tatsächlichen Kapital- oder Mietwert des Hauses rich-<br />
ten. 303<br />
303 Vgl. Art. „Die Dringlichkeit einer Verbesserung des Zustandes<br />
der handarbeitenden Klassen“, in: Ebenda<br />
v.19.4.1845, S.141-144; vgl. dazu auch die Diskussion in<br />
den Zeitschriften über die Beibehaltung oder Abschaffung<br />
des Octroi sowie die städtische Servicegeldpflichtigkeit in<br />
Kap.6.2.2.2.<br />
Schröder führte aus, daß die Servicepflichtigen nach Listen<br />
steuern müßten, die seit langer Zeit unverändert geblieben<br />
waren. Dort seien die Häuser ungeachtet des tatsächlichen<br />
Werts oder Mietpreises in ihrer Qualität als ¼ bis ganze<br />
Häuser, z.T. auch als 1 1/2 oder doppelte Häuser aufgeführt.<br />
Die Einteilung war nach Maßgabe ihrer Breite, welche<br />
sie an den öffentlichen Straßen einnahmen, erfolgt. Jedoch,<br />
so kritisierte Schröder, würden in Einzelfällen auch Häuser<br />
von kaum 15 Fuß Breite als ganze Häuser darin aufgeführt<br />
werden. Andere von doppelter Breite besäßen eine geringere<br />
registerliche Qualität. Häuser, die bei der Brandkasse hoch<br />
versichert wären, würden oft niedrigerer eingestuft als<br />
Häuser mit geringer Versicherungssumme. Außerdem sei die<br />
Zuziehung der bislang von der Servicelast befreiten Häuser<br />
immer noch nicht gelungen. In der Stadtordnung von 1833<br />
wurde zwar die Eximierung aufgrund älterer Privilegien aufgehoben,<br />
doch über die dafür an die Hausbesitzer zu lei-
618<br />
Im April 1849 kritisierte ein Handwerker die Forderung an<br />
seinen Stand, sich gegenüber dem Konkurrenzdruck durch<br />
Mehrarbeit und persönliche Einsparungen bei Kleidung, Nah-<br />
rung, Wirtshausbesuchen zu behaupten. Die Mahlzeiten für<br />
die Gesellen könnten nicht geschmälert werden, der Besuch<br />
von Wirtshäusern sei erforderlich, um Aufträge zu erhalten.<br />
Es gebe jetzt viele Handwerker, die gut und billig arbeite-<br />
ten, hingegen wenige, die genug Arbeit hätten. Weiterhin<br />
sprach sich der Verfasser strikt gegen die Verleumdung der<br />
Demokraten aus, die sich hauptsächlich daraus ergäbe, daß<br />
diese sich allein der bedrängten Lage der Handwerker ange-<br />
nommen hätten. Die zunehmende Not resultiere aber nicht aus<br />
dem Revolutionsjahr 1848, sondern grassiere schon seit<br />
Jahrzehnten. Die Revolution habe den Anlaß gegeben, Maßnah-<br />
men zu fordern. Sie sei aus der Not und Unzufriedenheit der<br />
arbeitenden Klassen entstanden. Nicht die Demokraten müßten<br />
beschimpft werden, sondern die gegenwärtigen Regierungen<br />
und politischen Gruppierungen, die nichts für das Handwerk<br />
täten. Schließlich appellierte der Verfasser an den Staat,<br />
dem bedrohten gewerblichen Mittelstand Schutz und Arbeit<br />
zukommen zu lassen. Nur so könnten die Handwerker die ge-<br />
sellschaftliche Aufgabe, für Ruhe und Ordnung zu sorgen,<br />
erfüllen und damit zur Beendigung der Revolution beitragen.<br />
Die Form der Verfassung, republikanisch oder monarchisch,<br />
sei dann unerheblich, wenn sie nur die oben genannte Forde-<br />
rung erfülle. 304 Neben diesen noch maßvollen Äußerungen ent-<br />
lud sich in der Revolution auch einfach sozial motivierter<br />
Unmut. Ein „Handwerksarbeiter aus Oldenburg“ machte für die<br />
zunehmende Erwerbslosigkeit und gedrückte Lage unter Hand-<br />
werkern und Tagelöhnern die Ausbeutung ihrer Arbeitskraft<br />
durch die Wohlhabenden und Mächtigen verantwortlich. Er<br />
forderte die Verbesserung der arbeitsrechtlichen Stellung,<br />
höhere Löhne sowie menschlichere Behandlung.<br />
stende Entschädigungssumme habe noch keine Einigung erzielt<br />
werden können (vgl. Kap.5.3.3).<br />
304 Vgl. Art. „Einige Worte über den Handwerkerstand“, in:<br />
Der Beobachter v.27.4.1849, S.133f.
619<br />
„Wer schuld daran ist, daß so viel Müssiggänger sind<br />
unter den Menschen? - Die sind schuld daran, die da<br />
gerne oben ansitzen. [...] - und ich frage: ist es<br />
nicht also? - sind wir armen Handwerker und Tagelöhner<br />
nicht das Opfer der reichen Habsüchtigen,<br />
Herrschsüchtigen und Ehrfürchtigen? All´ ihr Gemästetes<br />
und Geschlachtetes, all´ ihr Sammt und Seide,<br />
Purpurmantel und reichen Gewebe und alle andre Ueppigkeiten,<br />
muß solches nicht alles der arme Handwerker<br />
und Tagelöhner, der zuweilen kaum einen halben<br />
Groten für Salz übrig hat, aufbringen? Und wie wird<br />
ihm dafür gedankt, wie dafür gelohnt? - Das muß aufhören,<br />
wir müssen besser gestellt, besser belohnt,<br />
wir müssen menschlicher behandelt werden. Wo Menschlichkeit<br />
herrscht, da geschieht der Wille Gottes“. 305<br />
Anzeichen für umsichgreifende Verelendung im Handwerk der<br />
Stadt Oldenburg konnten für die 30er/40er Jahre weder der<br />
Tatsache entnommen werden, daß die Gesellen im zunehmenden<br />
Maße heirateten noch der Tatsache, daß die Zahl der ar-<br />
beitslos umherziehenden Gesellen im Herzogtum anstieg. Auch<br />
anhand der Klagen von Handwerkern über Übersetzung sowie<br />
drückende Konkurrenz, die sich besonders in den Auseinan-<br />
dersetzungen der Innungen mit neu gegründeten Fabrikbetrie-<br />
ben, dem Landhandwerk, ausländischen Gewerbetreibenden etc.<br />
offenbarten, kann dies nicht nachgewiesen werden. Außerdem<br />
äußerten sich weder der Magistrat noch die staatlichen Be-<br />
hörden über gravierende soziale Veränderungen im städti-<br />
schen Handwerk. Der Begriff Pauperismus tauchte in diesem<br />
Zusammenhang in dem zur Verfügung stehenden Quellenmaterial<br />
nicht auf. 306 In den in diesem Abschnitt präsentierten Arti-<br />
305 Vgl. Art. „Einige Worte über den Handwerkerstand“, in:<br />
Ebenda v.11.5.1849, S.151<br />
306 Vgl. dazu die entsprechenden Abschnitte des Kap.6 der<br />
vorliegenden Arbeit.<br />
Der Pauperismus in Form enormen Bevölkerungsanstiegs und<br />
stagnierendem Nahrungsspielraums erfaßte auch das Handwerk.<br />
Seit den 30er Jahren wurden die Struktur- und Wettbewerbsprobleme<br />
des Kleingewerbes vielfach diskutiert. Seit 1831<br />
wuchs der Anteil der handwerklich Beschäftigten an der Bevölkerung<br />
deutlich. Die leicht zu ergreifenden Grundhandwerke,<br />
wie Schneider, Schuster und Tischler gehörten zu den<br />
wachstumsstärksten Handwerkszweigen in den Städten. Die Dominanz<br />
von Klein- und Alleinmeistern, die in der Nähe des<br />
Existenzminimums lebten, das Vordringen verlagsmäßiger Ab-
620<br />
keln aus den Jahren 1843 bis 1849 wurde Pauperismus als Be-<br />
griff und ernstzunehmendes Problem auch für das Herzogtum<br />
diskutiert. Anlaß zur Erörterung gab die gestiegene Inan-<br />
spruchnahme der Armenunterstützung. Nur im Fall des Jever-<br />
landes ging ein Verfasser einmal ausführlicher auf die<br />
wirtschaftlichen Ursachen des Verelendungsprozesses in die-<br />
ser Region ein, die aber hier wie in allen anderen Artikeln<br />
relativiert wurden. Der Verfall der Sittlichkeit sowie die<br />
Mobilität und Erwerbsstreben hindernde Organisation des ol-<br />
denburgischen Armenwesens standen als Hauptkritikpunkte im<br />
Vordergrund. Eine Stimme aus dem Rat der Stadt Oldenburg<br />
beurteilte die wirtschaftliche Lage im Herzogtum sogar eher<br />
positiv im Vergleich zu anderen Ländern und schlug Maßnah-<br />
men zur Vorbeugung des Pauperismus vor. 307 Die beiden Einzel-<br />
hängigkeit bei wenig veränderter Arbeitstechnik kennzeichneten<br />
den sich verschärfenden Übersetzungsprozeß. Hinzu<br />
trat der z.T. durch die Gewerbepolitik entfesselte innerhandwerkliche<br />
Wettbewerb, der verkehrsmäßig erleichterte<br />
Zustrom auswärtiger Waren sowie die Konkurrenz der industriellen<br />
Produktion. Der Ausbruch der Agrarkrise 1846/47,<br />
der zur Verknappung und Verteuerung der Nahrungsmittel<br />
führte, erhöhte zum einen die Aufwendungen für den eigenen<br />
Lebensbedarf der Handwerker; andererseits verringerte sie<br />
die Massenkaufkraft und Nachfrage nach gewerblichen Produkten.<br />
In Preußen nahm die Zahl der Selbständigen zwischen<br />
1846 und 1849 zu, die durchschnittliche Betriebsgröße hingegen<br />
ab. Viele Gesellen versuchten den unzulänglichen Arbeits-<br />
und Einkommensbedingungen sich durch „Flucht in die<br />
Selbständigkeit“ zu entziehen, verschärften damit aber die<br />
Übersetzung und den Erwerbsmangel in vielen Handwerkszweigen.<br />
Die Agrarkrise wirkte sich auch noch 1848 aus trotz<br />
guter Ernte und fallenden Nahrungspreisen. Dies lag daran,<br />
daß die unteren Bevölkerungsschichten ihrer Subsistenzmittel<br />
beraubt waren („Entsparungsprozeß“) und auch die Nachfrage<br />
nach gewerblichen Waren sich nicht sofort besserte.<br />
Der Revolutionsausbruch verschärfte diese Situation nochmals<br />
(vgl. Bergmann, J., Das Handwerk in der Revolution von<br />
1848. Zum Zusammenhang von materieller Lage und Revolutionsverhalten<br />
der Handwerker 1848/49, in: Engelhardt, U.,<br />
(Hg.), Handwerker in der Industrialisierung ... , S.324ff;<br />
Lenger, F., Sozialgeschichte ... , S.36,39-41,49ff).<br />
307 Daß sehr wohl soziales Elend aus Bevölkerungsanstieg und<br />
sozialökonomischen Strukturveränderungen in den einzelnen<br />
Regionen des Herzogtums entstand, erweisen die entsprechenden<br />
Beschreibungen von E.Hinrichs und C.Reinders (vgl. Hinrichs,<br />
E., Reinders, C., Zur Bevölkerungsgeschichte des Oldenburger<br />
Landes, in: Eckhardt,A., Schmidt,H., (Hg.), Geschichte<br />
des Landes Oldenburg ... , S.661-708). Ausdrück-
621<br />
klagen von Handwerkern aus dem Revolutionsjahr 1849 geben<br />
zunächst nur Hinweise auf ihre Einschätzung der eigenen so-<br />
zialen Lage sowie der Position des Handwerks zur Revolution<br />
und ihren Zielen. Daß das städtische Handwerk vom Pauperis-<br />
mus nicht erfaßt wurde, erweist sich auch an seinem Verhal-<br />
ten in der Märzrevolution. Weder Arbeiter und Tagelöhner<br />
noch Dienstboten und Handwerksgesellen aus der Stadt waren<br />
aktiv beteiligt. An den Volksversammlungen, Debatten, Bera-<br />
tungen beteiligten sich zumeist Vertreter des gehobenen<br />
Mittelstandes, Handwerker und Gewerbetreibende, die sich<br />
hauptsächlich mit den politischen Neuerungen und der ange-<br />
strebten liberalen Verfassung beschäftigten, nicht aber mit<br />
den sozialen Belangen der unteren Bevölkerungsschich-<br />
ten. 308 Sie befaßten sich jedoch, angeregt durch die sich<br />
überall in den Ländern regende Handwerkerbewegung, mit so-<br />
zialen Forderungen des eigenen Berufsstandes.<br />
Am 31. Mai 1848 wurde in den „Neuen Blättern für Stadt und<br />
Land“ ein Auszug aus den Verhandlungen des Gewerbe- und<br />
lich wird von ihnen der Begriff Pauperismus zur Kennzeichnung<br />
der Lage der Heuerlinge auf der Münsterschen Geest in<br />
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verwendet. Der überproportional<br />
angewachsenen Schicht der nichtbesitzenden<br />
Heuerlinge wurde ihre Existenzgrundlage, die auf hausindustrieller<br />
Leineweberei, Hollandgängerei sowie Mitbenutzung<br />
der Marken beruhte, durch die Krise der osnabrückischtecklenburgischen<br />
Leineweberei und die Markenteilungen entzogen.<br />
Als sich ihnen weder in der Landwirtschaft noch in<br />
der Industrie Arbeitsmöglichkeiten eröffneten, reagierte<br />
die Bevölkerung mit Massenauswanderung (vgl. Ebenda,<br />
S.689f.).<br />
308 Vgl. Reinders-Düselder,C., Oldenburg im 19. Jahrhundert<br />
... , S.95,98f.<br />
Dies entspricht auch der Charakterisierung der Märzbewegung<br />
im Herzogtum durch M.Wegmann-Fetsch als eine in erster Linie<br />
verfassungspolitische Bewegung, die von der Stadt Oldenburg<br />
ausging. Soziale Unruhen erfaßten das Jeverland,<br />
Butjadingen, die Wesermarsch und die Gegend um Vechta (vgl.<br />
Wegmann-Fetsch, M., Die Revolution von 1848 ... , S.67,<br />
109ff). Als weiterer Beleg für diese Ausrichtung kann die<br />
Einschätzung von E.Hinrichs und C.Reinders dienen, die für<br />
die Stadt keine tiefgreifenden Veränderungen der sozialökonomischen<br />
Struktur ausmachen (vgl. Hinrichs,E., Reinders,C.,<br />
Zur Bevölkerungsgeschichte des Oldenburger Landes<br />
... , S.688; vgl. dazu auch Anmerkung 67 (Kap.6.2.1.1)
622<br />
Handelsvereins abgedruckt, der sich mit den Ursachen der<br />
allgemeinen Absatz- und Erwerbskrise sowie der Erfordernis<br />
einer zeitgemäßen freiheitlichen Reichsgewerbeordnung für<br />
Deutschland auseinandersetzte. 309 Unmittelbaren Anlaß für<br />
entsprechende Initiativen städtischer Gewerbetreibender gab<br />
das infolge der Feruarrevolution in Frankreich am 25.2. er-<br />
lassene Gesetz über das „Recht auf Arbeit“. Der Staat ga-<br />
rantierte damit allen Bürgern entlohnte Arbeit in sogenann-<br />
ten Nationalwerkstätten. 310 Befürchtet wurden gesteigerte An-<br />
sprüche der Arbeiter vor dem Hintergrund der um sich grei-<br />
fenden Wirtschaftskrise. Ihre Ursachen sah der Gewerbe- und<br />
Handelsverein in der Ausbreitung freier Konkurrenz sowie<br />
der Veränderung nationaler Wirtschaftsbeziehungen. Eine<br />
Rolle spielten dabei die Unabhängigkeitserklärung Nordame-<br />
rikas, die englische Kontinentalsperre und die industrielle<br />
Erzeugung von Produkten, besonders von Baumwollstoffen, in<br />
England. Die international verschärfte Konkurrenz habe be-<br />
wirkt, daß sich auch in Deutschland unter dem Schutz des<br />
Zollvereins und, wie in Preußen, unter den Bedingungen ei-<br />
ner freiheitlichen Gewerbeordnung eine deutsche Industrie<br />
entwickelte. Der frühere Zustand gesicherten Erwerbs könne,<br />
so das Urteil des Vereins, weder durch die Wiedereinführung<br />
des alten Zunftsystems noch durch staatlich begründeten An-<br />
spruch auf Arbeit und Lohn wiederhergestellt werden. Die<br />
Oldenburger Handwerksverfassung entspreche durchaus den Be-<br />
dürfnissen der Zeit und erfülle den selbst gesetzten Zweck,<br />
309 Vgl.Art. „Oldenburgs Schritte für eine reichsgesetzliche<br />
Gewerbeordnung (Verhandlungen des Gewerbe=und Handels=Vereins<br />
im Mai 1848)“, in: Neue Blätter für Stadt und<br />
Land v.31.5.1848, S.231-233<br />
310 Nach H.-O.Sieburg wurden in der Bannmeile von Paris, vor<br />
allem auf dem Marsfeld, in den folgenden Monaten ca.100.000<br />
Arbeiter, die etwa 75 Berufsgruppen entstammten, für je<br />
zwei Francs Tageslohn mit wenig produktiven Erdarbeiten beschäftigt.<br />
Allgemein wurden Maximalarbeitstage von 10 Stunden<br />
in der Hauptstadt sowie 11 in der Provinz eingeführt.<br />
Sieburg meint, daß dieses öffentlich finanzierte Unternehmen<br />
mit zur schweren Wirtschaftskrise im revolutionären<br />
Frankreich beitrug, die die Arbeitslosigkeit anwachsen ließ<br />
(vgl. Sieburg, H.-O., Geschichte Frankreichs, 3.Aufl.,<br />
Stuttgart 1983, S.305,307).
623<br />
der in einer Ausbildung, der Vervollkommnung der Gewerbe<br />
sowie einer geregelten Freiheit bestünde. Zu kritisieren<br />
sei oftmals eher die Gesetzesanwendung durch die Behör-<br />
den. 311 Diese Auffassung würde auch von den Versammlungen der<br />
Gewerbetreibenden und Handwerker in Oldenburg geteilt. Wei-<br />
terhin ging der Verein auf die bisher erfolgten Maßnahmen<br />
für eine reichseinheitliche Gewerbeordnung seitens der<br />
Handwerker in den Ländern ein. Verschiedene Städte hatten<br />
zunächst einen entsprechenden Antrag bei dem Fünfziger-<br />
Ausschuß in Frankfurt gestellt. 312 Dieser setzte eine Kommis-<br />
311 Die Einschätzung des Gewerbe- und Handelsvereins entsprach<br />
der allgemein verbreiteten Vorstellung unter den<br />
Handwerkern von einer „zeitgemäßen Gewerbeordnung“<br />
(vorausgesetzt wurde dabei eine geregelte Ausbildung mit<br />
Meisterprüfung sowie Zwangsinnungen, die auch als Träger<br />
von Sozialeinrichtungen fungieren sollten) (vgl. Simon, M.,<br />
Handwerk in Krise und Umbruch ... , S.3).<br />
312 In Reaktion darauf wurden in Oldenburg verschiedene Bürgerversammlungen<br />
abgehalten. Am 11.5. hielt Ratsherr Hoyer<br />
in einer Versammlung einen Vortrag über die verheerenden<br />
Auswirkungen unbeschränkter Gewerbefreiheit, den er mit einem<br />
Plädoyer für die Erhaltung eines zeitgemäßen Zunftwesens,<br />
wie es in Oldenburg bestünde, schloß. Der Gewerbetreibende<br />
müsse sich nicht nur im eigenen Interesse sondern<br />
auch zum Wohl der Allgemeinheit mit allen Kräften gegen ungezügelten<br />
freien Wettbewerb sowie gegen die selbständige<br />
Berufsausübung, die an keine Ausbildungsvoraussetzungen geknüpft<br />
war, wehren. Tischlermeister Inhülsen teilte die mit<br />
hiesigen Ansichten übereinstimmenden Ansichten der Bremer<br />
Handwerker mit. Es wurde beschlossen, der nächsten Versammlung<br />
einen Auszug der Rede Hoyers sowie der Inhülsens, die<br />
er 1846 im Volksbildungsverein über das gleiche Thema gehalten<br />
hatte, vorzulegen. Hoyer schlug außerdem vor, die<br />
Ansicht der hiesigen Handwerker über Gewerbefreiheit dem<br />
oldenburgischen Abgeordneten beim deutschen Parlament, Hofrat<br />
von Buttel, mitzuteilen und ihn aufzufordern, deren<br />
Interessen, die die des gesamten Gewerbestandes Deutschlands<br />
seien, in Frankfurt kräftig zu vertreten (vgl. Art.<br />
„Auszug aus den Verhandlungen der Bürgerversammlung im Almers´schen<br />
Hause (Oldenburg den 11.Mai, Abends 8 Uhr)“, in:<br />
Der Beobachter v.16.5.1848, S.175f.).<br />
Am 18.Mai wurden in der Versammlung, an der etwa 50 Bürger<br />
teilnahmen, u.a. folgendes beschlossen: 1. Der Antrag um<br />
eine Vertretung der Stadt Oldenburg bei der künftigen Ständeversammlung<br />
durch zwei Deputierte wurde abgelehnt, um<br />
nicht Mißtrauen und Eifersucht im Land hervorzurufen. Die<br />
Interessen des Gewerbestandes würden ebenso gut durch Petitionen<br />
an die Ständekammer gewahrt werden. 2. Teilnahme der<br />
hiesigen Handwerker an einer Zusammenkunft von Handwerkern<br />
am 13.6. in Hannover, zu der der Osnabrücker Handwerkerver-
624<br />
sion ein, die dem Ausschuß am 15.Mai berichtete. Der Be-<br />
richt wurde dann der Nationalversammlung „zu umfassender<br />
Prüfung, unter Vernehmung von Sachverständigen aller Fä-<br />
cher, besonders des Handwerker= und Arbeiterstandes aus<br />
ganz Deutschland, und unter Rücksprache mit den Regierungen<br />
wegen lokaler Verhältnisse und Maßnahmen“ überwiesen. Noch<br />
ehe dieser Beschluß bekannt wurde, hatten einige norddeut-<br />
sche Städte eine Versammlung der Gewerbetreibenden aus den<br />
verschiedenen Ländern nach Hamburg für den 2.Juni berufen<br />
mit dem Ziel, einen Antrag auf eine reichsgesetzliche Ord-<br />
nung an das deutsche Parlament zu formulieren. Dies war<br />
dann zwar durch den Beschluß des Fünfzigerausschusses über-<br />
flüssig geworden, aber die Initiatoren hielten an dem Kon-<br />
greß als einer Gelegenheit fest, die deutschen Gewerbever-<br />
hältnisse, die aktuellen wirtschaftlichen und sozialen An-<br />
forderungen sowie die Richtung der neuen Gewerbeordnung<br />
sachverständig zu erörtern und Fragen, die später der loka-<br />
len Beratung anheimfallen sollten, vorzubereiten. Zwei Ver-<br />
treter der Innungen, darunter Tischlermeister Inhülsen, so-<br />
wie ein Vertreter des Gewerbe- und Handelsvereins wurden<br />
gewählt, um dem Hamburger Gewerbekongreß beizuwohnen. 313 Über<br />
ein eingeladen hatte. Es sollten dort Möglichkeiten, die<br />
gedrückte Lage des Handwerkerstandes zu verbessern, erörtert<br />
werden. 3. Beantragung verschiedener Abänderungen der<br />
HWO (vgl. Art. „Bürgerversammlung (Oldenburg, den 18.Mai<br />
1848, im Hause des Hrn.Almers)“, in: Ebenda v.23.5.1848,<br />
S.185f.).<br />
Als Beginn der Handwerkerbewegung wird in der Literatur oft<br />
die am 19.4.1848 an das preußische Ministerium für Handel<br />
und Gewerbe übergebene Bittschrift von 391 Handwerksmeistern<br />
der Stadt Bonn erachtet. Leipzig, Gotha, Magdeburg,<br />
Karlsruhe, Offenbach u.a. Orte folgten dem Bonner Vorbild.<br />
Die Petitionen richteten sich gegen die unbeschränkte Gewerbefreiheit.<br />
Die neuen Gewerbeordnungen oder Abänderungen<br />
der alten, die in Hannover am 15.6.1848, in Preußen am<br />
9.2.1849 und in Nassau am 3.4.1849 erlassen wurden, kamen<br />
den Wünschen der Handwerker entgegen, indem sie die Anforderungen<br />
für die selbständige Niederlassung verschärften<br />
(vgl. Goldschmidt, E.F., Die deutsche Handwerkerbewegung<br />
... , S.18ff,24f., 52,67; Simon, M., Handwerk in Krise und<br />
Umbruch ... , S.174ff).<br />
313 Zu den Vorschlägen, die die Oldenburger Deputierten der<br />
Versammlung unterbreiten sollten vgl. Kap.6.3.1; vgl. auch<br />
Art. „Der 2.Juni in Hamburg“, in: Der Beobachter
625<br />
Anträge, Auseinandersetzungen sowie Beschlüsse des vom 2.<br />
bis 6.Juni in Hamburg tagenden Vorkongresses, der von 188<br />
Deputierten besucht wurde, berichteten auch die Oldenburger<br />
Zeitungen. Die Tagung begann mit einer heftigen Kontroverse<br />
über Form und Inhalte der anzustrebenden neuen Gewerbeord-<br />
nung. Die Vertreter der Hamburger „Vereinigung zur Hebung<br />
des Gewerbestandes“, die sich aus einem Zusammenschluß der<br />
Freimeister, vieler Nichthandwerker und einiger Amtsmeister<br />
gebildet hatte, forderten die „Aufhebung des Zunftzwanges<br />
und Einführung einer zeitgemäßen Gewerbeordnung“. 314 Dagegen<br />
wandten sich die Vertreter der hamburgischen Ämter und Bru-<br />
derschaften. 315 Als Grundlage der neuen reichseinheitlichen<br />
Gewerbeordnung wurde von der Mehrzahl der Deputierten die<br />
Mitte zwischen Gewerbefreiheit und Zunftzwang gesehen. Der<br />
Kasseler Gewerbeschullehrer Professor Georg Winkelblech sah<br />
in einer alle Produktionszweige umfassenden Zunftverfassung<br />
sowie der Einrichtung einer aus Vertretern der Gewerbetrei-<br />
benden Deutschlands gebildeten „sozialen Kammer“ beim Par-<br />
lament den Schlüssel zur Lösung der Sozialen Frage. Der<br />
zweite Antrag wurde einstimmig angenommen; der erste Vor-<br />
schlag, mit dem Winkelblech die Erstellung einer auch das<br />
Fabrikwesen umfassenden Gewerbeordnung verbunden hatte,<br />
v.23.5.1848, S.186; Art. „Die Wahl der Deputierten nach<br />
Hamburg“ in: Ebenda v.26.5.1848, S.189f.<br />
314 zit.n. John, P., Handwerk im Spannungsfeld ... , S.187<br />
315 Vgl. Ebenda, S.187f.; vgl. Art. „Die Hamburger Congresse“,<br />
in: Neue Blätter für Stadt und Land v.13.6.1848,<br />
S.251f.; Art. „Der Gewerbe=Congreß in Hamburg“, in: Der Beobachter<br />
v.16.6.1848, S.213: Schon im Vorfeld des Kongresses<br />
waren diese beiden Parteien aneinandergeraten. Die<br />
„Vereinigung“ hatte zusammen mit dem Lauenburger Kommittee<br />
zum Vorkongreß eingeladen. Eine Deputation der Ämter und<br />
Bruderschaften Hamburgs erklärte daraufhin durch ein<br />
Schreiben, daß sie nicht teilnehmen werde, weil sie keine<br />
spezielle Einladung erhalten hätte. In einem Zeitungsartikel<br />
forderte sie dazu auf, die Tagung zu verhindern. Die<br />
Deputierten des Vorkongresses, die davon ausgegangen waren,<br />
daß alle Meister der Stadt Hamburg gemeinsam die Einladung<br />
ausgesprochen hätten, wünschten mit Rücksicht auf ihre Wähler<br />
die Beteiligung der Amtsmeister. Eine Erklärung seitens<br />
des Präsidiums des Kongresses bewirkte, daß dies auch geschah.
626<br />
wurde abgelehnt. 316 Auch in der Frage, ob und wie die Gesel-<br />
len sich an den Beratungen zur zukünftigen Gewerbeordnung<br />
beteiligen könnten, kam es zu einer erregten Debatte. Ver-<br />
wirrung wurde zusätzlich zu der gereizten Stimmung der bei-<br />
den Hamburger Parteien durch das Auftreten einiger Gesellen<br />
sowie durch die fehlende Geschäftsordnung für die „wenig im<br />
parlamentarischen Takt“ geübte Versammlung gestiftet.<br />
„Dieser Anlaß fand sich denn auch, als ein Gesell die<br />
Tribüne bestieg und die Frage stellte: ob auch die<br />
Gesellen mit ihren Interessen vertreten würden? Der<br />
Sturm erreichte den höchsten Grad, als ein anderer<br />
Gesell die Tribüne mit Gewalt erklimmen wollte und<br />
nur mit Gewalt davon zurückgehalten wurde. Ein Vorstandsmitglied<br />
der „Vereinigung“ sagte mir, bevor die<br />
Versammlungen anfingen: „Jeder Anwesende kann dort<br />
seine seine Ansichten frei aussprechen, aber abstimmen<br />
werden nur die Deputierten“. Dies hatte aber der<br />
Präsident der Versammlung nicht mitgetheilt, und daher<br />
entstand die Verwirrung“. 317<br />
Die Auseinandersetzung entzündete sich am Wahlmodus, der<br />
für die Deputierten des Frankfurter Handwerkerkongresses<br />
festgelegt werden sollte. Viele Meister sprachen sich gegen<br />
die Teilnahme der Gesellen aus. Die Wahl solle sich nur auf<br />
selbständige Meister beziehen, die die Gesellen dann mit-<br />
vertreten würden. Der Kongreß beschloß, die Frage des Wahl-<br />
modus den einzelnen Städten und Ländern zu überlassen. Als<br />
Beschränkung war jedoch vorgesehen, daß die Gesamtheit der<br />
Deputierten nur den sechsten Teil der Nationalversammlung<br />
bilden durfte. 318 Am 10.Juni wurden die Beschlüsse des Vor-<br />
kongresses bekanntgegeben. Das wichtigste Ergebnis bestand<br />
in der Einberufung eines allgemeinen Handwerker- und Gewer-<br />
bekongresses für den 15.Juli nach Frankfurt a.M.. Dort<br />
316 Vgl. Art. „Der Norddeutsche Gewerbe=Congreß in Hamburg“,<br />
in: Der Beobachter v.13.6.1848, S.208; Vgl. John, P., Handwerk<br />
im Spannungsfeld ... , S.188f.<br />
317 Art. „Der Gewerbe=Congreß in Hamburg“, in: Der Beobachter<br />
v.16.6.1848, S.214<br />
318 Vgl. John, P., Handwerk im Spannungsfeld ... , S.190; die<br />
Stadt Hamburg faßte demzufolge die Wahlausschreibung so ab,<br />
daß lediglich die Handwerksmeister die Möglichkeit der<br />
Wahlbeteiligung hatten (S.192).
627<br />
sollte ein Gewerbeordnungsentwurf abgefaßt und der Natio-<br />
nalversammlung vorgelegt werden. Der Vorschlag Winkel-<br />
blechs, eine „soziale Kammer“ einzurichten, wurde fallenge-<br />
lassen. In einer Adresse an die Nationalversammlung, die<br />
von 19 Deputierten unterschrieben worden war, erklärten<br />
sich die Handwerksmeister gegen Gewerbefreiheit und ver-<br />
langten, daß diesselbe, in so weit sie in Deutschland be-<br />
stünde, durch einen besonderen Paragraphen der künftigen<br />
Reichsverfassung abgeschafft werden sollte. Gleichzeitig<br />
erklärten sie, die Lösung der Sozialen Frage zu ihrer Ange-<br />
legenheit. Schließlich gaben sie Termin und Ort der näch-<br />
sten überregionalen Handwerkerversammlung bekannt. 319<br />
Auch die Nationalversammlung beschäftigte sich seit der 5.<br />
Sitzung (24.5.1848) mit den wirtschaftlichen und sozialen<br />
Problemen Deutschlands und gründete einen Volkswirtschaft-<br />
lichen Ausschuß. In der Grundrechtsdebatte vom 3. bis<br />
21.Juli wurden die gewerberechtlichen Prinzipien im Zusam-<br />
menhang mit Freizügigkeit und Niederlassungsrecht erörtert.<br />
Drei Entwürfe darüber, in welcher Form die Gewerbeausübung<br />
in die „Grundrechte des deutschen Volks“ aufzunehmen sei,<br />
lagen vor. Der Verfassungsausschuß beantragte in seinem<br />
Entwurf, daß jeder Deutsche an jedem Ort eines deutschen<br />
Staates sein Gewerbe ausüben dürfe und zwar vorläufig unter<br />
denselben Bedingungen, die für die Angehörigen des betref-<br />
fenden Staates gelten würden, bis eine Reichsgewerbeordnung<br />
eine einheitliche Regelung herbeiführe. Die Verschiedenhei-<br />
ten des Gewerberechts in den einzelnen Ländern sollten je-<br />
doch behutsam und nur allmählich ausgeglichen werden. Der<br />
Verfassungsausschuß trat eher für eine Rahmenregelung durch<br />
die Reichsgewalt ein, bei deren Ausgestaltung Rücksicht auf<br />
die regionalen Verhältnisse genommen werden sollte. Der<br />
Mehrheitsentwurf des Volkswirtschaftlichen Ausschusses<br />
sprach sich deutlich für das Prinzip der Einheitlichkeit,<br />
die Aufhebung aller Zunftprivilegien und Regierungsbefug-<br />
nisse zur Erteilung von gewerblichen Konzessionen in den<br />
319 Vgl. Art. „Kleine Chronik“, in: Neue Blätter für Stadt<br />
und Land v.11.7.1848, S.294
628<br />
einzelnen Ländern sowie für eine Gewerbeordnung aus, die<br />
die Ausübung einer Tätigkeit an berufliche Qualifikationen<br />
binden sollte. Eine Minderheit des Volkswirtschaftlichen<br />
Ausschusses schlug eine Fassung vor, die noch vorsichtiger<br />
als der Verfassungsausschuß die gewerberechtlichen Verhält-<br />
nisse der Einzelstaaten angleichen wollte. In der sich an-<br />
schließenden Debatte wurden die Vor- und Nachteile der Ge-<br />
werbefreiheit ausführlich diskutiert. Sie zeichnete sich<br />
nach Ansicht M.Simons durch die Bereitschaft aus, die Mei-<br />
nungsäußerungen der Hauptbetroffenen, der Gewerbetreiben-<br />
den, anzuhören und, soweit es dem Gemeinwohl zuträglich<br />
war, zu berücksichtigen. Petitionen, die Gründung von Hand-<br />
werkervereinen und die beginnende Kongreßaktivität wurden<br />
ernstgenommen.<br />
Nur wenige Parlamentsmitglieder sprachen sich für unbe-<br />
schränkte Gewerbefreiheit aus; viele, die innerlich zwar<br />
dem gewerbefreiheitlichen Prinzip anhingen, sahen ihre Ein-<br />
führung zur Zeit als nicht realisierbar in Deutschland an.<br />
Eine knappe Mehrheit votierte für den Mehrheitsentwurf des<br />
Volkswirtschaftlichen Ausschusses und damit für die Abfas-<br />
sung einer reichsrechtlichen einheitlichen Regelung der Ge-<br />
werbeverhältnisse. Der Volkswirtschaftliche Ausschuß wurde<br />
daraufhin beauftragt, einen entsprechenden Entwurf bis zur<br />
zweiten Lesung der Grundrechte auszuarbeiten. Bis dahin<br />
sollten alle Deutsche mit den betreffenden Landeskindern<br />
gleichgestellt werden. 320<br />
Der seit dem 14.7. (bis 18.8.) in Frankfurt tagende Hand-<br />
werkerkongreß hatte die Nationalversammlung schon vor den<br />
Abstimmungen über die Grundrechtsbestimmungen gebeten, den<br />
Volkswirtschaftlichen Ausschuß zu beauftragen, die Frage<br />
der Gestaltung der Gewerbeverhältnisse gemeinsam mit den<br />
Deputierten zu erörtern. Daraufhin lud der Ausschuß fünf<br />
Abgesandte des Kongresses in seine Sitzung am 5.August ein.<br />
Ein weiteres Treffen wurde nicht verabredet. Am 15.August<br />
schickte der Kongreß seinen Gewerbeordnungsentwurf der Na-<br />
320 Vgl. Simon, M., Handwerk in Krise und Umbruch ... ,<br />
S.124ff
629<br />
tionalversammlung zu. Dem Volkswirtschaftlichen Ausschuß<br />
hingegen gelang es nicht, den vom Parlament verlangten Ent-<br />
wurf bis zur zweiten Lesung der Grundrechte vorzule-<br />
gen. 321 Die Veränderung des politischen Klimas, hervorgerufen<br />
durch die Herbstereignisse in Wien und Berlin, die die lan-<br />
desfürstlichen Gewalten stärkten, mag dabei eine Rolle ge-<br />
spielt haben. Das Bestreben der konservativ eingestellten<br />
Parlamentsmehrheit, auch auf gewerberechtlichen Gebiet die<br />
Stärkung reichseinheitlicher Regelungen zu verhindern,<br />
stand den Vorstellungen des Ausschusses entgegen. 322 Der Ver-<br />
fassungsausschuß empfahl daraufhin am 30.11., die Über-<br />
gangsregelung - Gleichbehandlung aller Deutschen mit den<br />
Landeskindern des betreffenden Staates bei der Ausübung ei-<br />
nes Gewerbes bis zur Einführung einer reichseinheitlichen<br />
Gewerbeordnung - fallen zu lassen. Aufgenommen in die am<br />
28.3.1849 beschlossene Reichsverfassung wurde das allgemei-<br />
ne Recht auf Freizügigkeit sowie der Grundsatz der Gewerbe-<br />
freiheit. Die Bedingungen für den Aufenthalt und Wohnsitz<br />
sollten durch ein Heimatgesetz, jene für den Gewerbebetrieb<br />
durch eine Gewerbeordnung für ganz Deutschland von der<br />
Reichsgewalt festgelegt werden. 323 Die Aussicht auf eine<br />
reichseinheitliche Gewerbeordnung, wie sie vom Handwerker-<br />
kongreß sowie vom Parlament im Sommer 1848 noch vertreten<br />
worden war, verschlechterte sich zusehends. 324<br />
321<br />
Vgl. Ebenda, S.159ff<br />
322<br />
Vgl. Traupe, K., Die deutsche Handwerkerbewegung 1848/49<br />
..., S.53<br />
323<br />
Die Übergangsregelung war mit der Begründung aufgehoben<br />
worden, daß sonst bei Ausbleiben einer reichseinheitlichen<br />
Regelung der Niederlassung und der Gewerbebetätigung ein<br />
Land, in dem besonders gewerbefreiheitliche Bedingungen<br />
herrschten, von Gewerbetreibenden allmählich überschwemmt<br />
werden würde (vgl. Simon, M., Handwerk in Krise und Umbruch<br />
... , S.162f.).<br />
324<br />
Allerdings unterschieden sich die Positionen von Handwerk<br />
und Parlament deutlich. Der Mehrheitsentwurf über die Form<br />
der Gewerbeausübung, wie sie in den Grundrechten festgehalten<br />
werden sollte, bekannte sich zur Gewerbefreiheit. Zwar<br />
erachtete die Mehrheit des Parlaments es für notwendig, eine<br />
geregelte Berufsausbildung mittels Gesellen- und Meisterprüfung<br />
aufrechtzuerhalten und sie zur Bedingung der<br />
Gewerbetätigkeit zu machen. Jedoch konnten die weiterrei-
630<br />
Der Entwurf des Frankfurter Handwerkerkongresses rief einen<br />
starken Widerhall in Handwerkerkreisen hervor, fand aber<br />
nicht ungeteilte Zustimmung. 325 Am 29.8. erschien im<br />
„Beobachter“ ein Artikel des Klempnermeisters Fortmann, der<br />
die Öffentlichkeit darüber informierte, daß der Deputierte<br />
Tischlermeister Inhülsen den Frankfurter Entwurf in einer<br />
Versammlung im „Neuen Hause“ vorgestellt habe. 326 Der Inhalt<br />
sei im allgemeinen von den anwesenden Handwerksmeistern gut<br />
aufgenommen worden. Fortmann strich dann besonders die in<br />
dem Entwurf ausgesprochene Berechtigung für das Handwerk,<br />
die eigenen Angelegenheiten unter Oberaufsicht des Staates<br />
selbständig zu regeln, heraus. Besonders den Gewerberäten<br />
und Gewerbegerichten würde ein Großteil der Arbeit zufal-<br />
len. Wie sie ihre Aufgaben lösen und dabei von ihren Kolle-<br />
gen unterstützt würden, davon hänge der Erfolg der neuen<br />
Gewerbeordnung ab. Im übrigen war Fortmann davon überzeugt,<br />
daß das Handwerk sich rege an der Arbeit in den neuen<br />
Selbstverwaltungsorganen beteiligen werde, da es sie als<br />
„Zeichen der Freiheit“ begrüßen würde. „Demokratische Ein-<br />
richtungen“ setzten, wenn sie einen Nutzen für das Ganze<br />
bringen sollten, also eine größere Beteiligung des Einzel-<br />
nen voraus. Dies müsse durch regelmäßige Zusammenkünfte und<br />
Besprechung der Handwerkerangelegenheiten eingeübt werden.<br />
chenden vielfältigen Beschränkungen, wie sie sich im Gewerbeordnungsentwurf<br />
des Meisterkongresses abzeichneten, nicht<br />
deren Zustimmung finden.<br />
325 Die Idee einer einheitlichen Gesetzgebung stieß beispielsweise<br />
in Bayern auf Protest. Die Landhandwerker des<br />
Ghzgts.Weimar bestritten, daß der Kongreß alle zünftigen<br />
Handwerker vertrete. Dieser Ansicht schlossen sich Hildesheimer<br />
und Braunschweiger Landhandwerker an. Auf einem Kongreß<br />
in Neustadt a.d.Hardt am 14.1.1849, der von 78 Vertretern<br />
pfälzischer Städte besucht wurde, sprach sich die<br />
Mehrheit für Gewerbefreiheit aus (vgl. Stieda, W., Art.<br />
„Handwerk“ ... , S.380). Von den 334 Petitionen, die sich<br />
mit den Beschlüssen des Kongresses auseinandersetzten und<br />
an die Nationalversammlung gerichtet waren (besonders September<br />
bis Dezember 1848), äußerten jedoch 280 vollständige<br />
Zustimmung; 19 stimmten im allgemeinen zu; 28 äußerten Kritik<br />
an einzelnen Punkten und nur 8 lehnten den Entwurf ab<br />
(vgl. Simon, M., Handwerk in Krise und Umbruch ... , S.99).<br />
326 Vgl. Art. „Handwerkerangelegenheit“, in: Der Beobachter<br />
v.29.8.1848
631<br />
Fortmann berichtete dann, daß am Schluß der Versammlung<br />
diesbezüglich geplant wurde, eine Handwerkervereinigung ins<br />
Leben zu rufen. 327 Die Haltung der Oldenburger Landhandwerker<br />
gegenüber dem an sie gerichteten Ansinnen, sich zu vereini-<br />
gen sowie in gemeinschaftlicher Beratung an der Gestaltung<br />
der nationalen Gewerbeordnung teilzunehmen, schien eher von<br />
Skepsis geprägt zu sein. 328 Mit dem Mißtrauen gegenüber der<br />
verbreiteten Hoffnung, daß der Frankfurter Entwurf eine<br />
Verbessserung der Allgemeinen Gewerbeverhältnisse herbei-<br />
führen werde, verband sich eine Kritik an der bisher prak-<br />
tizierten Handhabung der gewerberechtlichen Vorschriften in<br />
Oldenburg. Die hiesige Handwerksordnung sei den Buchstaben<br />
nach durchaus in der Lage, die Rechte und die wirtschaftli-<br />
che Entwicklung des Landhandwerks zu befördern. Am Beispiel<br />
der unrechtmäßigen Ausübung der Weißbrotbäckerei durch<br />
Schenkwirte und Kaufleute in Abbehausen, Waddens, Ruhwar-<br />
den, Eckwarden u.a.Orten wies dann der Verfasser des Arti-<br />
kels aber auf die zahlreichen von den Behörden zugelassenen<br />
Ausnahmen hin, die das Bäckerhandwerk in seiner Existenz<br />
bedrohten. Solange es kein offenes Gerichtsverfahren gebe<br />
und Entscheidungen allein dem Ermessen der Beamten oblägen,<br />
könne der Landhandwerker auch zu neuen Gewerbeordnungen nur<br />
wenig Vertrauen fassen. Schaffe der Frankfurter Entwurf al-<br />
lerdings in diesem Punkt Abhilfe, gewährleiste also, daß<br />
Eingriffe in die Rechte der Handwerker nunmehr unmöglich<br />
werden würden, so sei mit der tätigen Mithilfe des Land-<br />
handwerks bei der Neuregelung der deutschen Gewerbeverhält-<br />
nisse zu rechnen. Da diese auf sich warten ließ und die Zu-<br />
kunft des Frankfurter Entwurfs ungewiß war, beschloß der<br />
Handwerkerverein der Stadt Oldenburg in seiner Sitzung vom<br />
10.11., ihn eigenständig schon einmal einer gründlichen Be-<br />
ratung zu unterziehen und den Oldenburger Verhältnissen an-<br />
zupassen. Das Ergebnis sollte dem nächsten Landtag mitge-<br />
teilt sowie in den deutschen Gewerbeblättern und hiesigen<br />
327 Es wird sich dabei um die Gründung des Handwerkervereins<br />
gehandelt haben.
632<br />
Lokalzeitungen veröffentlicht werden. 329 Am 13.11. wurden die<br />
ersten fünf Artikel über die Gründung von Innungen darauf-<br />
hin geprüft, ob sie unverändert oder mit einigen Modifika-<br />
tionen versehen in einen Revisionsentwurf zur HWO übernom-<br />
men werden konnten. Die Passage über die allgemeinen Ziel-<br />
setzungen von Innungen - Vertretung der gewerblichen Inter-<br />
essen, Begründung einer Ordnung des Gewerbebetriebs, Förde-<br />
rung des Gemeinwohls, indem speziell der grassierenden Mas-<br />
senverarmung entgegengewirkt werden sollte - sowie die Be-<br />
stimmungen über den allgemeinen Innungszwang wurden unver-<br />
ändert übernommen. Neu gegenüber der HWO war auch die Er-<br />
fordernis für Landhandwerker, sich jetzt ausnahmslos den<br />
städtischen Innungen anzuschließen oder selbst eine Innung,<br />
bestehend aus mindestens fünf am Orte wohnenden Meistern,<br />
zu bilden. Schließlich rief der Artikel die Handwerkerver-<br />
eine des Landes dazu auf, ähnliche Beratungen über den<br />
Frankfurter Entwurf durchzuführen und die Resultate dem Ol-<br />
denburger Verein mitzuteilen. 330 In einer weiteren Sitzung<br />
328 Vgl. Art. „Der Handwerker auf dem Lande“, in: Der Beobachter<br />
v.10.10.1848, S.352<br />
329 Vgl. Art. „Der Handwerkerverein“, in: Ebenda<br />
v.10.11.1848, S.389f.; Art. „Der Handwerkerverein“, in:<br />
Ebenda v.21.11.1848, S.401f.<br />
In Braunschweig wurden schon Mitte Oktober Anstrengungen<br />
unternommen, eine Revision der Gildeordnung von 1821 für<br />
das Herzogtum herbeizuführen, um wenigstens Kernpunkte des<br />
Frankfurter Programms zu retten. Wie auch in Preußen, Bayern<br />
u.a. Ländern wurde ein Handwerkerkongreß einberufen,<br />
der in Wolfenbüttel vom 5.11.-9.11.1848 tagte. Der Entwurf<br />
einer braunschweigischen Handwerks- und Gewerbeordnung auf<br />
der Grundlage des Frankfurter Entwurfs wurde hier beraten<br />
und im Dezember 1848 dem Staatsministerium zugesandt mit<br />
der Bitte, ihn dem Landtag vorzulegen und ihn wenigstens<br />
provisorisch in Kraft treten zu lassen. Danach wollten die<br />
Handwerker sich an die Nationalversammlung wenden und nochmals<br />
nachdrücklich für die Schaffung einer reichseinheitlichen<br />
Gewerbeordnung sowie für die Beseitigung der Gewerbefreiheit<br />
eintreten. Doch der Entwurf stieß auf Bedenken.<br />
Erst am 24.1.1852 erließ die Landesregierung das „Gesetz<br />
über den gildenmäßigen Gewerbebetrieb“, das den Vorschlägen<br />
der Handwerker besonders hinsichtlich des Maßes an Selbstverwaltung<br />
nur teilweise entgegenkam ( vgl. Traupe, K., Die<br />
deutsche Handwerkerbewegung 1848/49 im Herzogtum Braunschweig<br />
... , S.55ff).<br />
330 Vgl. Art. „Der Handwerkerverein in Oldenburg“, in: Ebenda<br />
v.21.11.1848, S.402
633<br />
wurden die Bestimmungen über die Lehrlinge fast unverändert<br />
übernommen. Sie brachten gegenüber der HWO keine wesentli-<br />
chen Neuerungen. 331 Am 18.12. teilte der Vorstand mehrere<br />
Schreiben von Handwerkervereinen des Landes über die Bera-<br />
tung des Frankfurter Entwurfs mit. Die übrigen, noch untä-<br />
tig gebliebenen Vereine wurden aufgefordert, dies nachzuho-<br />
len, denn im März kommenden Jahres sollte eine Versammlung<br />
sämtlicher Vereine des Herzogtums stattfinden, in der die<br />
Ergebnisse zusammengefaßt werden würden. 332 Am 29.1.1849 wur-<br />
den in einer Versammlung die Anzahl der Unterschriften von<br />
Gewerbetreibenden mitgeteilt, die der Aufforderung des Ver-<br />
eins, sich gemeinsam mit ihm dem „Allgemeinen Deutschen<br />
Verein zum Schutze der vaterländischen Arbeit“ anzuschlie-<br />
ßen, Folge geleistet hatten. Der Verein schloß sich weiter-<br />
hin dem Wunsch einiger Handwerkervereine des Landes um Mit-<br />
teilung des Zolltarifentwurfs der in Frankfurt ansässigen<br />
protektionistischen Vereinigung, an. 333 Inzwischen beriet der<br />
Volkswirtschaftliche Ausschuß seit dem 8.12. die künftige<br />
deutsche Gewerbeordnung. Am 24.2.1849 lag ein Majoritäts-<br />
331 Vgl. Art. „Im Handwerkerverein zu Oldenburg“, in: Ebenda<br />
v.12.12.1848, S.426<br />
332 Vgl. Art. „In der Versammlung des Handwerkervereins am<br />
18.December“, in: Ebenda v.29.12.1848, S.445<br />
333 Der „Allgemeine Deutsche Verein zum Schutze der vaterländischen<br />
Arbeit“ wurde am 1.9.1848 aus Sorge vor dem überlegenen<br />
ausländischen Import gegründet und v.a. von der Metallurgie-,<br />
Montan- und Textilindustrie im Rheinland, in<br />
Sachsen, Württemberg und Baden wie auch vom Kleingewerbe<br />
und Handwerk getragen (vgl. Wehler, H.-U., Deutsche Gesellschaftsgeschichte<br />
... , Bd.2, S.736).<br />
Die Unterschriften lagen für Berne (36), Burhave (19), Delmenhorst<br />
(20), Dinklage (43), Driefel (40), Löningen (23),<br />
Neuenburg (21), Varel (54), Westerstede (32) und Zetel<br />
(130) vor (vgl. Art. „In der Versammlung des Handwerkervereins<br />
am 29.Januar“, in: Der Beobachter v.6.2.1849, S.43).<br />
In einem Artikel des Oldenburgischen Volksfreundes vom Mai<br />
1849 wurde die Verbindung des Handwerkervereins mit den<br />
Schutzzöllnern heftig kritisiert. Die angestrebten Zollsätze<br />
würden den Wohlstand des Herzogtums gefährden und nur<br />
das Fabrikwesen schützen und fördern. Die eigene Landesregierung<br />
habe sich gegen die Erhöhung der Zollsätze ausgesprochen.<br />
Auch der Gewerbeverein erkenne die Nachteile<br />
(vgl. Art. „Der Handwerker=Verein in Oldenburg und der allgemeine<br />
deutsche Verein zum Schutze der vaterländischen Ar-
634<br />
vorschlag, der eine recht liberale Gewerbeordnung, aller-<br />
dings unter der Voraussetzung des Befähigungsnachweises für<br />
die selbständige Berufsausübung anstrebte, vor. Hinzu trat<br />
ein Minoritätsgutachten, das die vollständige Gewerbefrei-<br />
heit forderte. 334 Im April druckten die „Neuen Blätter für<br />
Stadt und Land“ die Kritik an einem weiteren Minoritätsent-<br />
wurf des Volkswirtschaftlichen Ausschusses ab. Es handelte<br />
sich dabei um das Gutachten der Abgeordneten Degenkolb,<br />
Veit, Becker und Lette, das den Wünschen der Handwerksmei-<br />
ster am weitesten entgegenkam. Es wurden dort die Zwangsin-<br />
nung sowie der große Befähigungsnachweis für Handwerksmei-<br />
ster und Industrielle gefordert. In der Kritik, die sich<br />
hauptsächlich gegen das Prüfungswesen wandte, drückte sich<br />
auch die Unzufriedenheit mit den stagnierenden Bemühungen<br />
um eine reichseinheitliche Gewerbeordnung aus. Die Befürch-<br />
tung, daß der Plan überhaupt scheitern könne, sollte sich<br />
bewahrheiten. Seitdem die Vorschläge am 26.2. der National-<br />
versammlung übergeben worden waren, geschah in der Sache<br />
nichts mehr. 335<br />
Die eher zünftlerisch-restaurative Position der stadtolden-<br />
burger Handwerker auf wirtschaftlichem und sozialen Feld<br />
hinderte sie jedoch nicht daran, sich für die Märzforderun-<br />
gen des politischen Liberalismus sowie für eine konstitu-<br />
tionelle Monarchie im Herzogtum einzusetzen. Gemeinsam war<br />
allen Oldenburger Bürgern der Wunsch nach Zurückdrängung<br />
der Machtbefugnisse des absolutistischen Staates und der<br />
Bevormundung durch seine Beamtenschaft, verbunden mit mehr<br />
Selbst- und Mitbestimmung in Politik und Wirtschaft. 336 Das<br />
beit, in: Der Oldenburgische Volksfreund v.26.5.1849,<br />
S.169f.).<br />
334<br />
Vgl. Simon, M., Handwerk in Krise und Umbruch ... ,<br />
S.163ff<br />
335<br />
Vgl. Ebenda, S.173; vgl. Art.“Der Entwurf zur Gewerbeordnung<br />
für das deutsche Reich“, in: Neue Blätter für Stadt<br />
und Land v.4.4.1849, S.112-114; vgl. Art. „Der Entwurf zur<br />
Gewerbeordnung für das deutsche Reich“, in: Ebenda<br />
v.7.4.1849, S.115f.<br />
336<br />
Handwerker initierten beispielsweise die erste Volksversammlung<br />
der Stadt Oldenburg am 9.3.1848 (einige Hinweise
635<br />
zur Teilnahme von Handwerkern an der Petitionsbewegung für<br />
die Einführung einer konstitutionellen Verfassung bei Wegmann-Fetsch,<br />
M., Die Revolution von 1848 ... ,<br />
S.29f.,40,65).<br />
Die Wünsche nach Schutz des Handwerks durch Aufrechterhaltung<br />
spezieller Handwerksordnungen mit weitgehenden Beschränkungen<br />
der Konkurrenz von Handel und Industrie konnten<br />
sich, wie schon in Kap.5.1.3 erwähnt, mit unterschiedlichen<br />
politischen Vorstellungen verbinden. Für die Revolutionszeit<br />
ist die Behauptung, daß das Handwerk allgemein<br />
politisch liberal sowie ökonomisch konservativ und rückwärtsorientiert<br />
eingestellt war, spezifiziert worden.<br />
J.Bergmann findet in der Revolution drei Kombinationen heraus:<br />
politisch und ökonomisch konservativ, politisch demokratisch<br />
- ökonomisch konservativ, konsequent demokratische<br />
Orientierung (vgl. Bergmann, J., Das Handwerk in der Revolution<br />
von 1848 ... , S.320-346). Bei C.Lipp, die am Beispiel<br />
der württembergischen Handwerkervereine die Aufspaltung<br />
der Handwerkerbewegung in wirtschaftlich und politisch<br />
konservative sowie insgesamt demokratisch orientierte Handwerker<br />
nachweist, wird deutlich, daß regionale bzw. lokale<br />
Faktoren, wie der wirtschaftliche Entwicklungsgrad oder das<br />
politische Angebot, die Einstellung der Handwerker beeinflußten<br />
(vgl. Lipp, C., Württembergische Handwerker und<br />
Handwerkervereine im Vormärz und in der Revolution 1848/49,<br />
in: Engelhardt, U., (Hg.), Handwerker in der Industrialisierung<br />
... , S.347-380).<br />
Für Oldenburg konnte im Rahmen dieser Arbeit nur die Tendenz<br />
des Handwerks zu einer konservativen wirtschaftlichen<br />
sowie einer liberalen politischen Haltung erkannt werden.<br />
Diese Kombination wurde durch das mittelständisch geprägte<br />
Gesellschaftsbild des vormärzlichen Liberalismus erleichtert.<br />
Gewerbefreiheit wurde in der Periode der Frühindustrialisierung<br />
nicht uneingeschränkt bejaht. Viele Liberale<br />
sprachen sich für die Erhaltung des Zunftsystems, allerdings<br />
in Form freier Assoziationen, aus. Hinzu kam, daß<br />
auch die Vorstellungen des alten Handwerks von Begriffen,<br />
wie Unabhängigkeit, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und<br />
Würde der Arbeit geprägt waren. Im Unterschied zum Liberalismus<br />
verstand man sie aber nicht universalistisch prinzipiell;<br />
sie entstammten der Sphäre lokalen Wirtschaftens sowie<br />
tradierter handwerklicher Leitbilder der Zunftepoche.<br />
„Die Delegierten [der Handwerkerkongresse in Hamburg und<br />
Frankfurt, Anm.d.Verf.in] fühlten sich als Vertreter des<br />
gesellschaftstragenden Mittelstandes, der, patriarchalisch<br />
strukturiert, im Hause sein Gewerbe ausübend mit der Erziehung<br />
und Ausbildung der Lehrlinge und Gesellen zentrale gesellschaftliche<br />
Aufgaben wahrnehme und entsprechend der Arbeitsteilung<br />
Stadt - Land allein in der korporativen Gemeinschaft<br />
der Zunft/Innung die gewerblichen Produkte bedarfsdeckend<br />
und in bewährter handwerklicher Qualität produziere“<br />
(Offermann, T., Mittelständisch-kleingewerbliche<br />
Leitbilder ... , S.529f.).<br />
Dort, wo diese Wirtschaftsform und das damit verbundene<br />
Selbstverständnis durch Forderungen nach Öffnung und womög-
636<br />
politische Interesse der städtischen Handwerkerschaft zeig-<br />
te sich beispielhaft an ihrer regen Beteiligung an den<br />
Wahlmännerwahlen zum konstituierenden Landtag, die zwischen<br />
dem 17. und 22.7.1848 stattfanden. Unter den 34 zu wählen-<br />
den Wahlmännern der Stadt befanden sich 16 Handwerker, 11<br />
Kaufleute und Fabrikanten, 2 Lehrer, ein Advokat, ein Revi-<br />
sor, ein Auditor, ein Sekretär sowie ein Hofrat. 337 In den<br />
Zeitungen entspann sich nun ein Disput darüber, ob Handwer-<br />
ker in den Landtag gewählt werden sollten. Vertraten sie<br />
nur ihre Sonderinteressen oder waren sie befähigt, über<br />
allgemeine Belange der Bürger des Herzogtums kompetent und<br />
unabhängig zu entscheiden? Die erforderlichen Eigenschaften<br />
und Befähigungen eines zukünftigen Abgeordneten wurden in<br />
diesem Zusammenhang erörtert. Dem Verfasser eines Artikels<br />
war hinterbracht worden, daß in der Beratung der 34 Wahl-<br />
männer über die bevorstehenden Abgeordnetenwahlen sich ei-<br />
nige für die Wahl von Gewerbetreibenden ausgesprochen hat-<br />
ten, damit das Gewerbe auch im Landtag vertreten sei. Dies<br />
nahm der Verfasser nun zum Anlaß, sich gegen die Wahrneh-<br />
mung von Standesinteressen, die nur den alten beschränkten<br />
Zustand des Untertanenverbandes widergäbe, zu wenden und<br />
für den am Allgemeinwohl orientierten Deputierten zu plä-<br />
lich nach einer dem wirtschaftlichen Entwicklungsstand entsprechenden<br />
Gewerbeordnung bedroht wurde, endete die Akzeptanz<br />
liberaler Freiheit und Gleichheit (vgl. dazu Thamer,<br />
H.-U., Emanzipation und Tradition ... , S.55, der die spannungsreiche<br />
Verbindung zwischen liberalem politischen Gedankengut<br />
und handwerklicher Mentalität anhand der Person<br />
des Buchbindermeisters Adam Henß aus Weimar beschreibt).<br />
Auch Wilhelm C.D.Fortmann, der, allerdings dem Typus des<br />
Unternehmer-Handwerkers angehörend, sich von der kleingewerblichen<br />
Handwerkermentalität wohl schon erheblich entfernt<br />
hatte, setzte sich auf der einen Seite für die liberalen<br />
Märzforderungen und eine Verfassung in Oldenburg ein.<br />
Andererseits vertrat er die sozialdefensiven Interessen des<br />
Handwerkervereins (vgl. auch Friedl, H., Art. „Wilhelm<br />
C.D.Fortmann“, in: Biographisches Handbuch ... , S.200f.).<br />
337 Vgl. Art. „Kleine Chronik“, in: Neue Blätter für Stadt<br />
und Land v.28.7.1848, S.316. Die Wahlbeteiligung im Herzogtum<br />
war allerdings überaus gering und wird auf 10-20% geschätzt;<br />
in der Stadt Oldenburg betrug sie 33,3% (vgl. Wegmann-Fetsch,<br />
M., Die Revolution von 1848 ... , S.151).
637<br />
dieren. 338 Der sich anschließende Artikel wehrte sich gegen<br />
Bestrebungen, die Gewerbetreibenden zu veranlassen, aus-<br />
schließlich Akademiker in den Landtag zu wählen. Gerade<br />
nichtstudierte Leute hätten in den Versammlungen zu Berlin<br />
und Frankfurt zu den tüchtigsten Mitgliedern gehört. Es kä-<br />
me nur darauf an, „[...] unabhängige, freisinnige, cha-<br />
racterfeste und patriotisch gesinnte Männer zu wählen, wes<br />
Standes sie auch seien.“ 339 Ein anderer Artikel begrüßte aus-<br />
drücklich die Entscheidung des Wahlmännergremiums, zumin-<br />
dest einen Handwerker zum Abgeordneten zu wählen und ver-<br />
neinte ausdrücklich im Namen der Handwerker, daß diese nur<br />
ihre gewerblichen Interessen im Landtag vertreten wollten.<br />
Für eine solche Wahl spreche die damit verbundene größere<br />
Vielseitigkeit des Urteils des Parlaments sowie die Mög-<br />
lichkeit, Genaueres über die Lage der Arbeiter und der Un-<br />
bemittelten zu erfahren, da der Handwerker diesen Bevölke-<br />
rungsgruppen näher stehe als Gelehrte, Kaufleute etc. Au-<br />
ßerdem gebe es auch unter den Handwerkern durchaus kompe-<br />
tente Personen, die zur Beratung des Staatsgrundgesetzes<br />
befähigt seien. Schlimm wäre es, wenn Beratung und Verein-<br />
barung desselben „[...] nur durch juristische Kniffe [...]“<br />
erfolgten. Die unabhängigen, freisinnigen, charakterfesten<br />
und patriotisch gesinnten Männer finde man überdies vor-<br />
zugsweise unter den Handwerkern. 340 Die Gegenposition vertrat<br />
ein Artikel vom 2.8., der den Handwerkern die Fähigkeit ab-<br />
sprach, Vertreter des Landes oder auch nur der Stadt in der<br />
Kreiswahlversammlung zu sein. Die Kammer dürfe nicht über-<br />
wiegend aus Handwerkern und Bauern bestehen, denn sie seien<br />
nicht fähig, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Dazu bedür-<br />
fe es einer höheren Bildung. Der Verfasser riet den Wahl-<br />
männern, wissenschaftlich gebildete Männer, wie akademisch<br />
gebildete Beamte und Advokaten, gerade auch aus dem Grund<br />
338 Vgl. Art. „Deputirtenwahl in Oldenburg“, in: Der Beobachter<br />
v.28.7.1848, S.262<br />
339 Vgl. Art. „Wie unsere Abgeordneten sein müssen!“, in:<br />
Ebenda, S.262f.<br />
340 Vgl. Art. „Ein Handwerker zum Abgeordneten“, in: Ebenda<br />
v.1.8.1848, S.267f.
638<br />
zu wählen, weil im ersten Landtag nur allgemeine Landesan-<br />
gelegenheiten, hauptsächlich das Staatsgrundgesetz, beraten<br />
werden sollten. Besondere Interessen der einzelnen Distrik-<br />
te des Landes würden dabei nur wenig oder gar nicht be-<br />
rührt. Außerdem müsse ein Abgeordneter dem Regierungsbe-<br />
vollmächtigten an Sachkenntnis gewachsen sein und zugleich<br />
diese in öffentlicher Rede geltend machen können. Insgesamt<br />
gab sich der Verfasser unzufrieden mit dem Ausgang der<br />
Wahlmännerwahlen, unterstellte den Handwerkern, sich abge-<br />
sprochen zu haben und warf den Einwohnern vor, sich in zu<br />
geringer Anzahl an der Wahl beteiligt zu haben. 341 In der<br />
gleichen Spalte meldete sich wiederum eine Stimme zu Wort,<br />
die für die Handwerker Partei ergriff. 342 Ob die Stadt<br />
schließlich einen Handwerker in den Landtag wählte, konnte<br />
anhand der benutzten Quellen nicht festgestellt werden. Al-<br />
lerdings verschob sich die soziale Gliederung der Landtags-<br />
abgeordneten gegenüber den Wahlmännern im Herzogtum. Domi-<br />
nierte bei den Urwahlen noch das besitzende Bürgertum<br />
(Vollbauern, Kaufleute, Wirte, Bauern- und Kirchspielsvög-<br />
te, Handwerksmeister, Fabrikanten etc.), so machten jetzt<br />
die Juristen mit 11 Vertretern (von insgesamt 28 Abgeordne-<br />
ten) den größten Teil aus. Es folgten Bauern (6), Pastoren<br />
(3) und Gutsbesitzer (2). 343 Auch an den Urwahlen zum ersten<br />
oldenburgischen Landtag, der am 2.8.1849 zusammentreten<br />
sollte, beteiligte sich die Bevölkerung im allgemeinen nur<br />
wenig. In der Stadt Oldenburg lag die Wahlbeteiligung bei<br />
19,7%. Es kursierten hier drei Wahlmännerlisten; eine be-<br />
stand fast nur aus Gewerbetreibenden. 344 Nun hielt sich unter<br />
den Mitgliedern des noch amtierenden Landtags das Mißtrauen<br />
gegenüber der Befähigung von etwa in das Wahlmännergremium<br />
gewählten Handwerkern, einen Vertreter in den Landtag zu<br />
341<br />
Vgl. Art. „Die Wahl der Wahlmänner in der Stadt Oldenburg“,<br />
in: Neue Blätter für Stadt und Land v.2.8.1848,<br />
S.322f.<br />
342<br />
Vgl. Art. „Unter den Wahlmännern“, in: Ebenda, S.323<br />
343<br />
Vgl. Wegmann-Fetsch, M., Die Revolution von 1848 ... ,<br />
S.152ff<br />
344<br />
Vgl. Ebenda, S.225; vgl. Art. „Wahlen“, in: Neue Blätter<br />
für Stadt und Land v.19.5.1849, S.166
639<br />
wählen. Im Handwerkerverein kritisierte Klempnermeister<br />
Fortmann das Vorurteil, daß Handwerker mit der Wahl aus-<br />
schließlich ihre Sonderinteressen verfolgten und deshalb<br />
nicht gewählt werden dürften. Im Gegenteil müßten Handwer-<br />
ker, die doch das Gros der Urwählerschaft ausmachten, dem-<br />
entsprechend auch in der Wahlmännerversammlung vertreten<br />
sein. So forderte er die anwesenden Handwerker auf, bevor-<br />
zugt ihresgleichen zu wählen. Daraufhin beschuldigte Rats-<br />
herr Hoyer seinen Widersacher der unlauteren Wahlbeeinflus-<br />
sung. Ihm gelang es, mittels dieser Gerüchte die Wahl Fort-<br />
manns zum Wahlmann zu verhindern. Fortmann erreichte die<br />
erforderliche Stimmenanzahl nicht. Der Verfasser des Arti-<br />
kels verurteilte dieses Vorgehen und forderte nun Hoyer<br />
seinerseits auf, sich vor der Wahlmännerversammlung zu er-<br />
klären. 345 Über den Ausgang der Wahlen berichteten die vor-<br />
liegenden Zeitungsartikel nicht. Acht Handwerker wurden in<br />
das Wahlmännergremium gewählt. 346<br />
6.3.3.4 Gewerbefreiheit oder Beibehaltung der bisherigen<br />
gewerblichen Beschränkungen (allgemeine Grund-<br />
sätze der Gewerbeordnung 1858/59)?<br />
Die Oldenburger Handwerkerbewegung hatte keinen Einfluß auf<br />
eine restriktive Gestaltung der hiesigen Gewerbegesetzge-<br />
bung nehmen können, da ihr Entwurf in Anlehnung an die<br />
Handwerker- und Gewerbeordnung des Frankfurter Meisterkon-<br />
gresses nie fertiggestellt worden war. Die Entwicklung nahm<br />
indes eine andere Richtung. Die Rechtsunsicherheit der HWO,<br />
die als ein entscheidender Mangel von der Handwerkerbewe-<br />
gung beklagt worden war, wurde auch vom Magistrat 1858 her-<br />
ausgestellt, jedoch von ihm zum Anlaß genommen, Gewerbe-<br />
345 Vgl. Art. „Wahlumtriebe und - der Ratsherr Hoyer“, in:<br />
Der Beobachter v.1.6.1849, S.175<br />
346 Vgl. Art. „Kleine Chronik“, in: Neue Blätter für Stadt<br />
und Land v.26.9.1849, S.319
640<br />
freiheit zu fordern. 347 Buchholtz hatte dann, wie schon er-<br />
wähnt, die Aufgabe erhalten, eine Kommission zu ernennen,<br />
die dem nächsten Landtag einen auch das Handwerk umfassen-<br />
den Gewerbegesetzentwurf vorlegen sollte. Der Ministerial-<br />
rat sprach sich für eine gewerbefreiheitliche Ordnung aus,<br />
wies aber die Regierung an, vor Beginn der Kommissionsar-<br />
beit verschiedene Gutachten zur Frage: Gewerbefreiheit oder<br />
Konzessionszwang einzufordern, um dem Entwurf eine mög-<br />
lichst breite Zustimmung in der Bevölkerung zu sichern. Im<br />
Vordergrund dieses Kapitels stehen daher auch die Stellung-<br />
nahmen des Magistrats, des Gewerbe- und Handelsvereins, des<br />
Stadtrats, der Innungen sowie der Regierung selbst. Ein be-<br />
sonderer Disput entstand bei der Frage, ob das besondere<br />
städtische Bürgerrecht beibehalten werden sollte.<br />
Der Magistrat hatte zwei seiner Mitglieder, Stadtdirektor<br />
Wöbcken und Amtsrichter Strackerjan, beauftragt, ihre An-<br />
sichten kurz in einem Protokoll darzulegen, das nach vor-<br />
hergehender Beratung dann einstimmig angenommen wurde. 348 Der<br />
Magistrat stellte darin fest, daß in den eigentümlichen<br />
Verhältnissen des Herzogtums, seiner Ansicht nach, keine<br />
besonderen Gründe vorlägen, die Gewerbefreiheit nicht ein-<br />
zuführen. Der Art.56 des Staatsgrundgesetzes, der den<br />
Grundsatz der Gewerbefreiheit ausspreche und eine Änderung<br />
des Gewerbegesetzes in Aussicht stelle, sähe nur dort Be-<br />
schränkungen vor, wo dies aus Gründen des Gemeinwohls er-<br />
forderlich sei. 349 Nicht mehr berechtigt waren in den Augen<br />
des Magistrats die Beschränkungen im Handwerk. Im allgemei-<br />
nen Interesse sei es notwendig, das Zunftwesen sowie alle<br />
347 Vgl. Kap.6.3.3<br />
348 Wöbcken und Strackerjan zogen u.a. zur Vorbereitung des<br />
angeforderten Gutachtens die preußische Gewerbeordnung von<br />
1845, den Entwurf einer Gewerbeordnung für das Kgr. Sachsen,<br />
die Schrift von Bening über die hannoversche Gewerbeordnung<br />
(1857), Victor Böhmert, Freiheit der Arbeit!, Beiträge<br />
zur Reform der Gewerbegesetze (Bremen 1858) heran<br />
(vgl. Magistratsbericht v.17.11.1858, in: StAO Best.262-1A,<br />
Nr.1998).<br />
349 Vgl. im folgenden das Magistratsprotokoll v.12.10.1858<br />
(Anhang des Magistratsberichts v.17.11.1858), in: StAO<br />
Best.31-15-43-1
641<br />
bisher geltenden Voraussetzungen für die Niederlassung des<br />
Handwerks aufzuheben. Weiterhin lehnte er das Konzessions-<br />
wesen in der bisherigen Form ab und forderte die Freigabe<br />
der Mühlen, Fabriken und fabrikähnlichen Betriebe<br />
(Brauereien, Branntweinbrennereien, Buchdruckereien), des<br />
Handels (insbesondere des Buchhandels), der Gewerbe der<br />
Rechnungssteller und Verfasser schriftlicher Aufsätze. Mit<br />
Rücksicht auf Sittlichkeit, Gesundheit und Leben, auf<br />
Schutz des Eigentums und auf Rechtssicherheit müßten ande-<br />
rerseits bestimmte Gewerbe eine besondere Erlaubnis bean-<br />
tragen. Dies sei der Fall bei Ärzten, Hebammen, Rechtsan-<br />
wälten, beim Hausierhandel, der Herstellung und dem Verkauf<br />
von Medikamenten, der Fabrikation und dem Handel mit<br />
Schießpulver, den Wirtschaften und dem Verkauf von Brannt-<br />
wein, den Schornsteinfegern, den Gesindemäklern, den Agen-<br />
ten von Lebens- und Feuerversicherungsgesellschaften. Zur<br />
selbständigen Betreibung eines Gewerbes hielt der Magistrat<br />
nur Dispositionsfähigkeit und die Anmeldung bei der Behörde<br />
für notwendig. Besonders heraus stellte er die Möglichkeit,<br />
künftig mehrere Gewerbe gleichzeitig betreiben zu können.<br />
Schließlich hielt er es für überflüssig, die Ansicht der<br />
Innungen zur neuen Gewerbeordnung einzuholen. Sie würden<br />
voraussichtlich nur für die Beibehaltung des Zunftwesens<br />
plädieren. Allerdings sollte dem Stadtrat das Gutachten zur<br />
Stellungnahme vorgelegt werden. 350<br />
Das Direktorium des Gewerbe- und Handelsvereins bedauerte<br />
es zunächst in seiner Erklärung, daß eine prinzipielle Dis-<br />
kussion über Vor- und Nachteile der Gewerbefreiheit nicht<br />
geführt werden sollte. Sie gewährleiste es doch erst, daß<br />
Kriterien gefunden würden, mittels derer die wirtschaftli-<br />
che Lage im Herzogtum daraufhin geprüft werden könne, in<br />
welchem Ausmaß es ratsam sei, Gewerbefreiheit einzufüh-<br />
350 Vgl. Magistratsbericht v.17.11.1858, in: StAO Best.262-<br />
1A, Nr.1998; das Gutachten des Magistrats wurde im Oldenburgischen<br />
Gemeindeblatt v.7.12.1858 veröffentlicht (StAO<br />
Best.262-1A,Nr.1998).
642<br />
ren. 351 Im einzelnen forderte das Direktorium die Aufhebung<br />
des Zunftsystems sowie der Niederlassungsbeschränkungen,<br />
die die Entwicklung von Handwerk, Handel und Fabrikwesen<br />
nicht beförderten. Der Nachweis der zunftgemäßen Ausbil-<br />
dung, der die gewerbliche Geschicklichkeit des einzelnen<br />
Gewerbetreibenden sowie des Gewerbestandes erhalten sollte,<br />
sei heutzutage weder der einzige noch der beste Weg, dieses<br />
Ziel zu erreichen. Außerdem spiele er keine entscheidende<br />
Rolle für den Erfolg eines Unternehmens. Dieser hänge eher<br />
von der Befähigung zur Unternehmensleitung als von persön-<br />
lich erworbener Geschicklichkeit ab. Auch das Argument der<br />
Übersetzung sowie der Nachweis des erforderlichen Betriebs-<br />
kapitals könnten den einzelnen Gewerbetreibenden in seinem<br />
Erwerb nicht sichern. Da das Eindringen fertiger Handwerks-<br />
waren, der Handel mit fertigen Handwerksartikeln keinerlei<br />
Beschränkungen unterliege und der Export von Handwerksar-<br />
beiten nach transatlantischen Plätzen einen so ungeheuren<br />
Umfang angenommen habe, entwickle sich das Auskommen des<br />
Einzelnen, mit Ausnahme rein lokaler Gewerbe, völlig unab-<br />
hängig von der Zahl der konkurrierenden Meister am Ort. Die<br />
Einführung der Gewerbefreiheit nun würde bewirken, daß der<br />
Handwerksbetrieb künftig billiger produziere und dadurch<br />
der größten Gefahr, der von außen kommenden Konkurrenz, be-<br />
gegnen könne. Durch den Eintritt Oldenburgs in den Zollver-<br />
ein sei Gewerbetreibenden aus Ländern mit gewerbefreiheit-<br />
lichen Regelungen der hiesige Markt geöffnet worden. Schon<br />
jetzt würden beispielsweise Möbel aus Berlin sowie Klei-<br />
dungsstücke und Wäsche aus Magdeburg hierher importiert<br />
werden. Abschließend forderte das Direktorium den Übergang<br />
zu einer größeren Gewerbefreiheit, die allerdings zusätz-<br />
lich mit einer Revision der bisher sehr ungleichen Besteue-<br />
rung der Gewerbebetriebe einher gehen müsse.<br />
Die Regierung wandte sich im Januar 1859 nochmals an den<br />
Magistrat mit der Frage, wie dieser über die Zukunft des<br />
gewerblichen Bürgerrechts denke. Bei Einführung von Gewer-<br />
351 Vgl. Gutachten des Direktoriums des Gewerbe- und Handelsvereins<br />
v.6.12.1858, in: StAO Best.31-15-43-1
643<br />
befreiheit könne die Berechtigung zum Gewerbebetrieb nicht<br />
vom Erwerb der Gemeindeangehörigkeit abhängig sein, also<br />
die in der Gemeindeordnung enthaltende Verpflichtung für<br />
den in der Stadt ansässigen Gewerbetreibenden zum Erwerb<br />
des gewerblichen Bürgerrechts schwerlich beibehalten wer-<br />
den. 352 Der Stadtrat, der sich allen Anträgen des Magistrats-<br />
gutachten anschloß, plädierte für die Beibehaltung dessel-<br />
ben im Interesse der Stadt. Würde nämlich Gewerbefreiheit<br />
hier im Herzogtum früher als in den Nachbarstaaten einge-<br />
führt werden, schütze das Bürgerrecht die Stadtwirtschaft<br />
vor dem Zustrom ausländischer Gewerbetreibender. In diesem<br />
Zusammenhang forderte der Stadtrat die Abänderung des<br />
Art.260 der Gemeindeordnung dahingehend, daß der Magistrat<br />
nur noch mit Zustimmung des Gemeinderats über die Aufnahme<br />
von Ausländern zu entscheiden befugt sein sollte. 353 Der An-<br />
sicht der Regierung folgend, argumentierte der Magistrat<br />
prinzipiell und wiegelte die Befürchtungen des Stadtrats<br />
ab. Gewerbefreiheit lasse nur Staatsangehörigkeit und Dis-<br />
positionsfähigkeit als Voraussetzungen für den selbständi-<br />
gen Gewerbebetrieb im ganzen Land, also auch in den Städ-<br />
ten, zu. Die durch das Staatsgrundgesetz und die Gemein-<br />
deordnung verbürgte Freizügigkeit sowie die in ersterem po-<br />
stulierte Gewerbefreiheit verböten es, das besondere städ-<br />
tische Bürgerrecht oder das Gemeindebürgerrecht vorauszu-<br />
setzen. Jeder dispositionsfähige Staatsbürger müsse sich in<br />
jeder Gemeinde, ohne in derselben sofort das Gemeindebür-<br />
gerrecht zu erwerben, niederlassen können und dort auch<br />
sein Gewerbe frei ausüben dürfen. Die Freiheit des Umzugs<br />
erfordere die Verbindung mit der Freiheit der Ar-<br />
beit. 354 Weiterhin hielt der Magistrat die Furcht des Stadt-<br />
rats angesichts der bestehenden Gesetze über den Erwerb des<br />
352<br />
Vgl. Regierungsreskript v.4.1.1859, in: StAO Best.70,<br />
Nr.6736<br />
353<br />
Vgl. Stadtratsprotokoll v.14.1.1859 im Anhang des Magistratsberichts<br />
v.10.4.1859, in: StAO Best.70, Nr.6736; Protokoll<br />
der gemeinschaftlichen Sitzung von Magistrat und<br />
Stadtrat v.28.3.1859, in: Ebenda.<br />
354<br />
Vgl. Magistratsbericht v.10.4.1859, in: StAO Best.70,<br />
Nr.6736
644<br />
Heimatrechts für unbegründet. Derzeit hänge es von dem<br />
selbständigen Beschluß jeder Gemeinde ab, ob sie den Ange-<br />
hörigen eines anderen Staates aufnehmen wolle. Keine Ge-<br />
meinde würde dies lediglich tun, um ihm die Möglichkeit zu<br />
eröffnen, in eine andere Gemeinde überzuwechseln. Die Ge-<br />
meinde, die einen Ausländer aufnehme, bleibe nämlich drei<br />
Jahre hindurch für ihn zuständig, wenn er beispielsweise in<br />
einer anderen Gemeinde verarme oder wegen Verstoßes gegen<br />
Art.32 der Gemeindeordnung in die aufnehmende Gemeinde zu-<br />
rückgewiesen würde. 355 Schließlich lehnte der Magistrat noch<br />
den Antrag auf Abänderung des Art.260 mit der Begründung<br />
ab, daß die Magistrate in den Städten die Aufnahme von Aus-<br />
ländern oder Inländern in die Gemeinde mit größerer Unbe-<br />
fangenheit und Umsicht prüfen würden. Sie verführen dabei<br />
nach festeren Grundsätzen als die dreifach größere Gemein-<br />
devertretung, die sich bei jeder Versammlung nach unter-<br />
schiedlichen Berufsgruppen zusammensetze und besonders dann<br />
Standesinteressen oder Parteieinflüssen unterliegen würde,<br />
wenn die Aufnahme von Gewerbetreibenden beschlossen werden<br />
sollte. Die Zulassung von Ausländern dürfe nicht in das Be-<br />
lieben willkürlicher Gemeinderatsmehrheiten gestellt wer-<br />
den.<br />
Das Ergebnis der Beratungen des Stadtrats muß auch vor dem<br />
Hintergrund der Übereinkunft der städtischen Handwerker in<br />
der Gewerbefreiheitsfrage gesehen werden. Sie leiteten dem<br />
Stadtrat eine umfangreiche Stellungnahme zu, in der sie<br />
Gründe gegen die Einführung von Gewerbefreiheit aufführten,<br />
die in den besonderen Verhältnissen der hiesigen Stadtwirt-<br />
355 Art.32,1 setzte die Bedingungen zum Erwerb des Heimatrechts<br />
durch Niederlassung fest. Das Heimatrecht konnte<br />
nicht erworben werden, wenn der Antragssteller innerhalb<br />
der drei Jahre aus Armenmitteln versorgt werden mußte, in<br />
Konkurs geriet, Straftaten beging oder wegen Bettelei, unsittlichen<br />
Lebenswandels straffällig wurde. Entweder mußte<br />
er dann weitere drei Jahre auf Anerkennung warten, oder die<br />
Gemeinde wies ihn aus. Grundsätzlich gestatteten die Heimatreglungen<br />
der Gemeindeordnung es jedoch erst einmal jedem<br />
sich in einer Gemeinde Niederlassenden, sein Gewerbe<br />
dort voraussetzungslos zu betreiben (Art.26: Erwerb des<br />
Heimatrechts durch selbständige Niederlassung).
645<br />
schaft lagen. Sie plädierten dafür, mit der Einführung ge-<br />
werbefreiheitlicher Verhältnisse zumindest so lange zu war-<br />
ten, bis die Nachbarländer damit begonnen hätten. 356 In der<br />
Schrift wurde zunächst dargelegt, warum die Oldenburger<br />
Handwerker nicht mit den Werkstätten in größeren Städten<br />
konkurrieren konnten. Oldenburg sei eine kleine Stadt, in<br />
der Handwerkserzeugnisse nur geringen lokalen Absatz finden<br />
würden. Kaufleute würden viele Gegenstände, die billiger<br />
als in Oldenburg hergestellt werden könnten, von auswärts<br />
beziehen und in der Stadt verkaufen. Auch vermögende Hand-<br />
werker, die Lager von fertigen Handwerksprodukten zum Ver-<br />
kauf hielten, könnten nicht mit denen der Kaufleute konkur-<br />
rieren. Der größere Markt und der raschere Absatz in großen<br />
Städten ermöglichte es dem Handwerk, seine Betriebe zu er-<br />
weitern, eine weit höhere Anzahl von Gesellen zu beschäfti-<br />
gen und Arbeitskosten zu sparen. Während in Oldenburg der<br />
Meister mit zwei oder drei Gesellen arbeite, sie in seinem<br />
Haushalt verköstige und ihnen Wochenlohn zahle, würden sich<br />
die Gesellen in größeren Städten selbst ernähren und für<br />
Stücklohn arbeiten. Außerdem könne durch Arbeitsteilung<br />
billiger produziert und schneller geliefert werden. Von<br />
Fabriken würden dem Handwerk Fertigteile zugeliefert, die<br />
wiederum dem Handwerksbetrieb dazu verhielfen, Zeit und Ko-<br />
sten zu sparen. Hinzu trete die erleichterte Materialbe-<br />
schaffung durch große Niederlagen am Ort. Der größere Ab-<br />
satz gestatte dann, frischere Ware zu niedrigen Preisen zu<br />
liefern. Schließlich führe die Abgelegenheit Oldenburgs da-<br />
zu, daß das Handwerk kaum die erforderliche Anzahl tüchti-<br />
ger Gesellen erhalten könne und gezwungen sei, den wenigen<br />
höhere Löhne zu zahlen. In einem zweiten Teil führte die<br />
Schrift angesichts der beschränkten Lage des Oldenburger<br />
Handwerks die ruinösen Folgen der Einführung von Gewerbe-<br />
freiheit vor Augen. Oldenburg würde mit den Produkten grö-<br />
ßerer Städte nahezu überschwemmt werden, eine Masse an Pfu-<br />
356 Vgl. Vorstellung der in der Stadt ansässigen Handwerker<br />
v.13.1.1859 im Anhang des Magistratsberrichts v.10.4.1859<br />
...
646<br />
schern ihre qualitativ minderwertigen Erzeugnisse zu Spott-<br />
preisen auf den Markt werfen. Der solide, zünftig ausgebil-<br />
dete Handwerker aber würde mit seiner Familie zugrunde ge-<br />
hen oder versuchen müssen, durch schlechte Arbeiten und Ma-<br />
terialien seine Waren billiger zu verkaufen. Die Perspekti-<br />
ve, daß mit der Zeit sich die Nachfrage nach höherwertigen<br />
Erzeugnissen wiederherstelle, helfe dem einzelnen Handwer-<br />
ker nicht, da er diesen Umschwung nicht abwarten könne. Die<br />
Petition ging dann in einem weiteren Abschnitt auf die von<br />
den Verfassern für erforderlich erachteten Voraussetzungen<br />
zur Betreibung eines Handwerks auch unter gewerbefreiheit-<br />
lichen Bedingungen ein. Wie zu erwarten, waren dies Lehr-<br />
und Wanderjahre sowie die Meisterprüfung. Der Magistrat<br />
kritisierte diese vom Stadtrat mitgeteilte Eingabe heftig.<br />
Der in der Schrift eingenommene Standpunkt sei rein parti-<br />
kularistisch und gebe überdies nur die Sicht der Handwerker<br />
der Stadt Oldenburg wider. Das Bild, das von der Situation<br />
des hiesigen Handwerks gezeichnet werde, fordere entgegen<br />
der damit beabsichtigten Wirkung geradezu dazu heraus,<br />
durch freie Konkurrenz diesen Zustand zu überwinden. Außer-<br />
dem seien die als Folgen der Gewerbefreiheit bezeichneten<br />
Verhältnisse hier schon längst eingetreten. Der Magistrat<br />
wies darauf hin, daß die HWO die freie Einführung fremder<br />
Handwerksprodukte gestatte und daß seit dem Anschluß Olden-<br />
burgs an den Zollverein die vom Handwerk befürchteten Ge-<br />
fahren eines freieren Warenaustauschs bestünden. Die Stadt<br />
habe aber bisher nicht unter sprunghaft angestiegener Ein-<br />
fuhr aus größeren Städten gelitten. Eine Diskussion über<br />
die Beibehaltung der Lehr- und Wanderzeit sowie der Mei-<br />
sterprüfung lehnte der Magistrat kategorisch ab, weil un-<br />
vereinbar mit der Entscheidung für Gewerbefreiheit. 357<br />
Die Regierung konnte am 6.9. schließlich dem Staatsministe-<br />
rium mitteilen, daß sich die weit überwiegende Anzahl der<br />
Erklärungen, die aus dem gesamten Herzogtum vorlagen, für<br />
die Annahme des Prinzips der Gewerbefreiheit ausgesprochen<br />
357 Vgl. Magistratsbericht v.10.4.1859, in: StAO Best.70,<br />
Nr.6736
647<br />
hätten. Strittig sei allerdings noch, ob die selbständige<br />
Ausübung eines Gewerbes nach wie vor an den Nachweis der<br />
Geschicklichkeit geknüpft werden solle. Einmütig äußerten<br />
sich hingegen alle Gutachten dahingehend, daß nur disposi-<br />
tionsfähige Personen zugelassen, einzelne Gewerbe nur mit<br />
besonderer behördlicher Erlaubnis ausgeübt und bestimmte<br />
Gewerbe besonderen polizeilichen Beschränkungen unterworfen<br />
sein sollten. Die Regierung selbst lehnte den Geschicklich-<br />
keitsnachweis ab und riet, diese Frage erst bei der Ausar-<br />
beitung des Entwurfs zu klären. 358 Dem Bericht über die Er-<br />
gebnisse der Gutachten schloß sich eine ausführliche Darle-<br />
gung der Ansicht der Regierung an. Zunächst glaubte diese,<br />
ihren theoretischen Standpunkt in der fraglichen Sache klä-<br />
ren zu müssen, da dies den Gang der Untersuchung beeinflus-<br />
se. Gegner der Gewerbefreiheit würden besonders die Gründe,<br />
die ihre Einführung in Oldenburg ratsam erscheinen ließen,<br />
kritisch untersuchen; Befürworter speziell diejenigen, die<br />
gegen eine Einführung gewerbefreiheitlicher Regelungen<br />
sprächen, erörtern. Die Regierung war nun der Ansicht, daß<br />
das Prinzip der Gewerbefreiheit in politischer, gewerbli-<br />
cher sowie in sozialer Hinsicht die allein richtige Grund-<br />
lage einer Gewerbeordnung bildete. Die im Konzessionszwang<br />
liegenden Beschränkungen würden als theoretisch nicht ge-<br />
rechtfertigt erscheinen. Denn einmal sei die Zunftverfas-<br />
sung keine das Gemeinwohl fördernde Institution mehr; ande-<br />
rerseits könne und würde die Abhängigkeit der Gewerbe von<br />
einer obrigkeitlichen Erlaubnis nur noch als bloße Form<br />
oder Quelle der Willkür empfunden werden. Auch die besonde-<br />
ren Verhältnisse des Landes ließen es nicht bedenklich er-<br />
scheinen, das theoretisch als richtig erkannte Prinzip in<br />
der neuen Gewerbeordnung anzuwenden. Gemäß dieses Ansatzes<br />
setzte sich die Regierung im folgenden zunächst mit Grün-<br />
den, die gegen die Einführung erhoben wurden, auseinander.<br />
Ein Bedenken wies auf den unzureichenden Entwicklungsstand<br />
des Gewerbes, insbesondere des Handwerks, sowie auf den<br />
358 Vgl. Regierungsbericht v.6.9.1859, in: StAO Best.31-15-<br />
43-1
648<br />
Vorrang der landwirtschaftlichen Betätigung im Herzogtum<br />
hin. Abgesehen von den Verhältnissen in wenigen Städten,<br />
stünden die Handwerker der geringeren Arbeiterklasse nahe,<br />
wanderten nicht über die Grenzen des Amtes oder Kreises<br />
hinaus, ermangelten daher der erforderlichen gewerblichen<br />
und allgemeinen Ausbildung, um ihr Gewerbe zu heben und<br />
fielen oft der Armenkasse zur Last. Die Einführung der Ge-<br />
werbefreiheit würde diese Übelstände noch vergrößern. Die<br />
Regierung leugnete diese Mißstände nicht ab, wies aber dar-<br />
auf hin , daß sie sich unter dem Konzessionssystem entwik-<br />
kelt hätten bzw. dieses zumindest keine Abhilfe hätte<br />
schaffen können. Gewerbefreiheit müsse als Chance begriffen<br />
werden, eine Veränderung herbeizuführen, zumal für den er-<br />
folglosen Gewerbetreibenden immer die Möglichkeit bestünde,<br />
auf eine Tätigkeit in der Landwirtschaft zurückzugreifen.<br />
Unter den Beschränkungen des geltenden Zulassungssystems<br />
war dies oft nicht mehr möglich, da der Versuch sich zu<br />
spät als verfehlt herausstellen konnte. Ein zweites Beden-<br />
ken wies allgemein auf die Folgen der unqualifizierten Aus-<br />
übung eines Gewerbes für den Betroffenen und die Bevölke-<br />
rung hin. Die Regierung entgegnete, daß die bestehenden Be-<br />
schränkungen die befürchteten Nachteile von Gewerbefreiheit<br />
nicht hätten abwehren können und im Gegenteil sogar bewirk-<br />
ten, daß tüchtige Arbeiter der Armenkasse anheim fielen,<br />
weil sie nicht betreiben durften, was sie konnten. Die Be-<br />
hauptung, Gewerbefreiheit würde den Zudrang der Gewerbe-<br />
treibenden in die Städte befördern, entkräftete die Behörde<br />
mit dem Hinweis, daß dieser durch die immer noch nur aus-<br />
nahmsweise Zulassung des Landhandwerks verursacht worden<br />
sei und in Zukunft unter freiheitlichen Bedingungen eher<br />
abnehmen würde. Daß Gewerbefreiheit die Sittlichkeit ge-<br />
fährden würde, verneinte die Regierung. Auch die Befürch-<br />
tung, daß Oldenburg von Gewerbetreibenden überhäuft würde,<br />
wenn es früher als Hannover Gewerbefreiheit herstelle,<br />
hielt sie für unangemessen. In Hannover sei die Ausübung<br />
vieler Gewerbe auf dem Land frei; in den Landdrosteibezir-<br />
ken Stade und Osnabrück herrsche sogar völlige Gewerbefrei-
649<br />
heit. Mit einem Ansturm sei daher wohl nicht zu rechnen.<br />
Außerdem hänge die Aufnahme von Ausländern vom Entschluß<br />
der einzelnen Gemeinde ab, und der Zuzug könne andererseits<br />
noch dahingehend geregelt werden, daß die neue Gewerbeord-<br />
nung den Ausländern im hiesigen Land nur diejenigen Befug-<br />
nisse gewähre, die auch oldenburgische Staatsangehörige im<br />
Ausland beanspruchen dürften. 359 Bezüglich der Gründe, die<br />
für die Einführung von Gewerbefreiheit sprachen, verwies<br />
die Regierung auf die Berichte der Ämter Abbehausen und Ol-<br />
denburg sowie des Magistrats der Stadt Oldenburg. Darüber<br />
hinaus sprach sie noch die Prinzipien des Staatsgrundgeset-<br />
zes, mit denen die Gewerbefreiheit im Einklang stünde, so-<br />
wie das allgemeine Bedürfnis nach Angleichung der Gewerbe-<br />
ordnung an die tatsächliche Zulassungspraxis an. Die Erfor-<br />
dernis einer Revision sei auch schon seit langer Zeit von<br />
den Behörden erkannt worden, was diese dazu veranlaßt habe,<br />
die Bestimmungen milder zu handhaben oder zu durchbrechen.<br />
So hätten sie praktisch der Gewerbefreiheit vorgearbeitet,<br />
und ihre Einführung würde daher weniger schroff in die be-<br />
stehenden Verhältnisse eingreifen. Schließlich stellte die<br />
Regierung noch die soziale Bedeutung des Oldenburger In-<br />
nungswesens in Abrede. Weder trügen die hiesigen Zwangsin-<br />
nungen zur sittlichen und gewerblichen Ausbildung der ange-<br />
henden Handwerker bei, noch dienten sie der gegenseitigen<br />
genossenschaftlichen Unterstützung und der Entfaltung der<br />
Gewerbe. Im Vordergrund stünde allein das Interesse der<br />
Handwerker, etwaige Konkurrenz niederzuhalten. Damit nun<br />
die Innungen ihren sozialen Aufgaben womöglich besser nach-<br />
kämen, schlug die Regierung vor, ihnen ihren Zwangscharak-<br />
ter zu nehmen und es Handwerkern künftig zu ermöglichen,<br />
wirtschaftliche Vereinigungen zu begründen.<br />
Schon bald darauf, nachdem der Bericht beim Staatsministe-<br />
rium eingegangen war, wies Buchholtz die Kommission an, auf<br />
359 Daß sich die Gemeinden auch nach Einführung der Gewerbefreiheit<br />
vor dem Zuzug ausländischer Gewerbetreibender<br />
schützen konnten, zeigt beispielhaft die nur beschränkte<br />
Vergabe des Gemeindebürgerrechts an Angehörige fremder<br />
Staaten durch den Magistrat (vgl. Kap.6.2.2.3).
650<br />
der Grundlage des Prinzips der Gewerbefreiheit mit der Aus-<br />
arbeitung des Entwurfs zu beginnen. 360 Den Befürwortern von<br />
Gewerbefreiheit war es damit gelungen, daß ihr Ziel, das<br />
Gewerbe und insbesondere das städtische Handwerk angesichts<br />
der Anforderungen eines größeren Marktes, dem Oldenburg als<br />
Mitglied des Zollvereins angehörte, durch Abbau staatlicher<br />
Regelungen wettbewerbsfähig zu machen, verfolgt wurde. Der<br />
Schritt schien nicht so groß zu sein, da teilweise schon<br />
gewerbefreiheitliche Verhältnisse beim Import von Waren in<br />
die Stadt bestanden, und die Behörden eine liberale Konzes-<br />
sionspraxis verfolgten.<br />
6.3.3.5 Exkurs: Stand der badischen Gewerbegesetzgebung<br />
1861<br />
Im März 1861 wandte sich die badische Regierung an das<br />
Staatsministerium mit der Bitte, ihr den Entwurf des olden-<br />
burgischen Gewerbegesetzes sowie das darüber verfaßte Gut-<br />
achten des Landtagsauschusses zuzusenden. Sie selbst habe<br />
die diesbezüglichen Vorarbeiten abgeschlossen und einen er-<br />
sten Entwurf erstellt. 361 Demzufolge sollte in Baden eine nur<br />
durch polizeiliche Vorschriften beschränkte Gewerbefreiheit<br />
eingeführt werden. Weder der Nachweis eines bestimmt vorge-<br />
schriebenen Bildungsganges (Lehr- und Wanderzwang, Meister-<br />
prüfung) noch der Eintritt in eine gewerbliche Genossen-<br />
schaft war zur gewerblichen Niederlassung erforderlich. Je-<br />
der Gewerbetreibende sollte außerdem in jeder Gemeinde des<br />
Großherzogtums seinen Beruf ausüben dürfen.<br />
360<br />
Vgl. Anweisung Buchholtz´an die Kommission v.12.9.1859,<br />
in: Ebenda<br />
361<br />
Vgl. Schreiben der ghzgl. badischen Regierung<br />
v.25.3.1861, in: Ebenda. Das Gewerbegesetz war in erster<br />
Lesung im Oldenburger Landtag angenommen worden, die angeforderten<br />
Unterlagen wurden der badischen Regierung zugeschickt<br />
(vgl. Antwortschreiben des Staatsministeriums<br />
v.10.4.1861, in: Ebenda
651<br />
Das Gewerbegesetz umfaßte die einzelnen Bestimmungen sowie<br />
eine allgemeine Begründung, die zunächst Einblick in die<br />
Entstehungsbedingungen der Gewerbeordnung und das Verfahren<br />
der Behörden, die Ansichten der Gewerbetreibenden über das<br />
zugrunde zu legende Prinzip des Gesetzes sowie über die<br />
Grundzüge seines speziellen Inhalts zu ermitteln, gibt. Au-<br />
ßerdem wurden die Ergebnisse der Vorbefragung beschrieben<br />
und die Entscheidung der Regierung begründet. Die Einfüh-<br />
rung der Gewerbefreiheit in Baden sollte den Zunftzwang,<br />
die zünftigen Arbeitsgebiete und die Verbietungsrechte un-<br />
tereinander sowie den Lehr-, Wander- und Prüfungszwang ab-<br />
schaffen. Anschließend beschrieb die Regierung ihr Bemühen,<br />
die Interessen des Gemeindebürgertums mit der von dem<br />
Grundsatz der Erwerbsfreiheit unzertrennlichen Freizügig-<br />
keit in Einklang zu bringen. Sie trat dabei den Befürchtun-<br />
gen entgegen, daß wenn die gewerbliche Niederlassung beson-<br />
ders in den größeren Städten nicht mehr von dem vorherigen<br />
Erwerb des Bürgerrechts abhängig gemacht werde, keiner der<br />
Zugezogenen von sich aus dem Bürgerverband mehr beitreten<br />
würde. Die Gegner unbeschränkter Freizügigkeit sahen, zumal<br />
wenn zusätzlich der Innungszwang abgeschafft werden würde,<br />
den Zerfall des bisherigen Kerns der Bürgerschaften und da-<br />
mit den Niedergang der alten Stadtbürgergemeinde voraus.<br />
Die Regierung lehnte verschiedene Vorschläge zur Beschrän-<br />
kung der Freizügigkeit ab und war der Ansicht, daß gerade<br />
unter gewerbefreiheitlichen Bedingungen, die die Strebsam-<br />
keit und Selbständigkeit der Gewerbetreibenden förderten,<br />
diese selbst die Vorteile erkennen würden, die aus der Be-<br />
teiligung am politischen Leben der Gemeinde sowie aus dem<br />
Einfluß auf die Entwicklung der Gemeindeverwaltung für ihre<br />
Interessen erwüchsen, und so aus freier Einsicht das Bür-<br />
gerrecht erwerben würden. Das Bedenken andererseits, daß<br />
der unbeschränkte Zuzug von Gewerbetreibenden das ansässige<br />
Handwerk in seinem Bestand gefährden könnte, wurde von der<br />
Regierung verworfen. Auch die Befürchtung, daß die Heimat-<br />
gemeinden darunter leiden würden, wenn Angehörige ihr Ar-<br />
beitsleben in anderen Gemeinden verbrächten und erst im Al-
652<br />
ter oder in Armut nur deswegen zurückkehrten, um Unterstüt-<br />
zung in Anspruch nehmen zu können, wurde abgetan. Dagegen<br />
hielt es die Regierung für wichtig, Leute, die in der Hei-<br />
matgemeinde oder am ersten Niederlassungsort verarmt waren,<br />
wegen Trunksucht, unsittlichen Lebenswandels ihres guten<br />
Namens sowie des Kredits verlustig gegangen waren, vom Ge-<br />
brauch der Freizügigkeit abzuhalten. Weiterhin begründete<br />
die Regierung ihre Entscheidung für ein freies gewerbliches<br />
Vereinswesen. Hierbei konnte sie sich auch auf die Mehrheit<br />
der Zunftmeister stützen. Die Gutachten lehnten jeglichen<br />
neuen, gar umfassenderen staatlichen Genossenschaftszwang,<br />
der sich nicht mehr wie vormals nur auf die Innungen er-<br />
strecken würde, ab. Zumal stellte sich einer staatlichen<br />
Ordnung die Verschiedenartigkeit der Zusammensetzung sowie<br />
der mit der Gründung beabsichtigten Zwecke der gewerblichen<br />
Vereinigungen in den Weg. Schließlich wurde die Einführung<br />
von Gewerbekammern befürwortet.<br />
Obwohl Baden in seiner wirtschaftlichen Entwicklung weiter<br />
vorangeschritten war, mehr Fläche und Einwohner besaß und<br />
von Ländern umgeben war, die schon Gewerbefreiheit einge-<br />
führt hatten, lassen sich anhand der „Allgemeinen Begrün-<br />
dung“ des Gesetzentwurfs Ähnlichkeiten mit Oldenburg hin-<br />
sichtlich der staatlichen Gewerbepolitik erkennen. Sie zei-<br />
gen sich in den zu lösenden Problemen, des dabei benutzten<br />
Verfahrens sowie in den von verschiedenen Seiten geäußerten<br />
Bedenken, wie sie beispielsweise von Angehörigen des Ge-<br />
meindebürgertums gegenüber der Freizügigkeit geäußert wur-<br />
den. Bevor die Badener Gewerbepolitik weiter verfolgt wird,<br />
sollen einige Daten zur Entwicklung der Bevölkerung sowie<br />
ihrer anteilsmäßigen Erwerbstätigkeit in Landwirtschaft,<br />
Handwerk und Industrie Einblick in die unterschiedliche so-<br />
zialökonomische Entwicklung der beiden Länder in der ersten<br />
Hälfte des 19. Jahrhunderts geben.<br />
H.Sedatis hebt den vorindustriellen Charakter Badens in<br />
diesem Zeitabschnitt hervor: Mitte der 20er Jahre seien von<br />
rund 270.000 steuerlich erfaßten Erwerbstätigen noch nicht<br />
2% in der fabrikartigen Industrie beschäftigt gewesen. 1829
653<br />
noch setzte sich die Mehrheit der Bevölkerung aus Handwer-<br />
kern (36,4%) und Bauern (37,7%) zusammen. 362 Baden umfaßte<br />
1841 eine Fläche von 15.330 km², auf der 1.294.000 Einwoh-<br />
ner lebten. Das Großherzogtum Oldenburg wies hingegen nur<br />
6.264 km² und 268.000 Einwohner auf. 363 Zwischen 1816 und<br />
1848 wuchs die badische Bevölkerung von 971.000 auf<br />
1.367.000 Einwohner an. Dieser rund 40%ige Anstieg lag, so<br />
Fischer, unter dem Durchschnitt der deutschen Staaten. Die<br />
Bevölkerungsdichte von 88 pro km² im Jahr 1848 wurde aller-<br />
dings nur von Sachsen, dem Herzogtum Hessen und Nassau<br />
übertroffen. In Oldenburg wuchs die Bevölkerung zwischen<br />
1816 und 1846 um 22,7%, die Bevölkerungsdichte lag 1816 bei<br />
34 pro km², 1855 bei 43 pro km². 364 Der Bevölkerungsanstieg<br />
führte in Baden zu einem starken Zuwachs des gewerblichen<br />
Sektors, insbesondere des Handwerks. Zwischen 1809 und 1829<br />
nahm das gesamte Kleingewerbe um 38%, die Bevölkerung hin-<br />
gegen nur um etwas mehr als 20% zu. Bis 1843 nahm die Zahl<br />
der Handwerksmeister nochmals um 20,5% zu und stieg damit<br />
im Verhältnis zur Bevölkerung um etwa das Doppelte. Für das<br />
Herzogtum Oldenburg ergibt sich ein Zuwachs der selbständi-<br />
362 Vgl. Sedatis, H., Liberalismus und Handwerk in Südwestdeutschland.<br />
Wirtschafts- und Gesellschaftskonzeptionen des<br />
Liberalismus und die Krise des Handwerks im 19. Jahrhundert<br />
(Geschichte und Theorie der Politik: Unterreihe<br />
A,Geschichte; Bd.4), Stuttgart 1979, S.119; auch W.Fischer<br />
weist darauf hin, daß Baden weder besonders früh noch besonders<br />
heftig in den Prozeß der Industrialisierung eingetreten<br />
sei. Angesichts des industriellen Aufbaus Europas<br />
ordne es sich seiner geographischen Lage gemäß zwischen dem<br />
relativ frühen Ansatz in der Schweiz und im Elsaß und den<br />
um eine bis zwei Generationen späteren in den meisten deutschen<br />
Mittelstaaten ein. Nur in Sachsen sowie einzelnen Gebieten<br />
Preußens, besonders am Niederrhein und in Schlesien,<br />
fänden sich frühere Ansätze als in Baden (vgl. Fischer, W.,<br />
Ansätze zur Industrialisierung in Baden 1770-1870, in:<br />
ders., (Hg.), Wirtschaft und Gesellschaft ... , S.363<br />
363 Die Angaben wurden Fischer,W./Krengel,J./Witog,J., (Hg.),<br />
Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch. Materialien zur Statistik<br />
des Deutschen Bundes 1815-1870, Bd.1, München 1982,<br />
S.40 entnommen.<br />
364 Vgl. Fischer, W., Staat und Gesellschaft Badens im Vormärz,<br />
in: ders., (Hg.), Wirtschaft und Gesellschaft ... ,<br />
S.107; vgl. Kollmann, P., Statistische Beschreibung der Gemeinden<br />
des Herzogthums Oldenburg, Oldenburg 1897, S.64f.
654<br />
gen Handwerker zwischen 1816 und 1831 um 28,4% bei einem<br />
Bevölkerungsanstieg von 11,6% im Zeitraum bis 1828. Auch<br />
hier wuchs das Handwerk schneller als die Bevölkerung. 365 Ein<br />
Überblick über die Verteilung der Erwerbstätigen Badens im<br />
Jahr 1843 zeigt, daß nur noch 32,6% als Landwirte arbeite-<br />
ten, 43% als Meister und Gesellen sowie 4,6% als Fabrikan-<br />
ten und Lohnarbeiter. Im Herzogtum Oldenburg arbeiteten<br />
noch 1861 60,9% in Land- und Forstwirtschaft, 21,1% in In-<br />
dustrie und Handwerk. 366<br />
Auch in Baden war das Zunfthandwerk durch die Gründung<br />
zahlreicher Fabrikbetriebe außerhalb beschränkender Vor-<br />
schriften, den zunehmenden Handel mit Waren aus dem Gebiet<br />
des Zollvereins, den der staatlich betriebene Ausbau des<br />
Eisenbahnnetzes zusätzlich erleichterte, immer stärker in<br />
Bedrängnis geraten. 367 Um der mißlichen Lage der Handwerker,<br />
die durch die Beschränkung der Arbeitsgebiete sowie zahl-<br />
reicher Verbietungsrechte untereinander an der Ausdehnung<br />
und Veränderung ihrer Betriebe gehindert wurden, abzuhel-<br />
fen, handhabten die Behörden die diesbezügliche Gesetzge-<br />
bung großzügig. Dies hatte aber zur Folge, daß Dispensatio-<br />
nen und Konzessionen nicht nach einem einheitlichen Maßstab<br />
365 Vgl. Sedatis, H., Liberalismus und Handwerk ... , S.120;<br />
vgl. Hinrichs,H./Krämer,R./Reinders,C., Die Wirtschaft des<br />
Landes Oldenburg ... , S.188,190<br />
366 Vgl. Sedatis, H., Liberalismus und Handwerk ... , S.120;<br />
vgl. Kollmann, P., Statistische Beschreibung ... , S.94.<br />
Über die Gesamtzahl der badischen Erwerbstätigen in der<br />
Landwirtschaft enthält die Tabelle keine Angabe. W.Fischer<br />
gibt an, daß 1809 noch mehr als die Hälfte der Bevölkerung<br />
ihren hauptsächlichsten Unterhalt in der Landwirtschaft<br />
fand; 1843/44 seien es nur noch 40-44% gewesen (vgl. Fischer,<br />
W., Staat und Gesellschaft Badens im Vormärz ... ,<br />
S.108) - Leider weist P.Kollmann Industrie und Handwerk<br />
nicht getrennt aus. Auch liegen für Oldenburg bedauerlicherweise<br />
keine weiteren Angaben zur Entwicklung der Gesamtzahl<br />
der Beschäftigten in den drei Sektoren in der ersten<br />
Hälfte des 19. Jahrhunderts vor.<br />
367 Baden trat 1836 dem Zollverein bei. 1840/41 entschied<br />
sich die badische Regierung für den staatlich betriebenen<br />
Ausbau des Eisenbahnnetzes (vgl. Fischer, W., Planerische<br />
Gesichtspunkte bei der Industrialisierung in Baden, in:<br />
ders., Hg., Wirtschaft und Gesellschaft ... , S.76; vgl.<br />
ders., Ansätze zur Industrialisierung ... , S.366).
655<br />
vergeben wurden, Ungewißheit unter den Gewerbetreibenden<br />
über ihre tatsächlichen Befugnisse entstand und Beschwerden<br />
in Form von Petitionen an die Landtage sich häuften, doch<br />
die Verhältnisse definitiv zu ordnen. Die badische Regie-<br />
rung hatte sich dann seit dreißig Jahren immer wieder mit<br />
der Aufgabe einer neuen Gewerbegesetzgebung befaßt, ohne<br />
jedoch konkrete Ergebnisse in diesem Zeitraum vorgelegt zu<br />
haben.<br />
Wie in Oldenburg suchte die Regierung möglichst umfassend<br />
Gewerbetreibende und Behörden in die Entscheidung darüber<br />
einzubeziehen, ob die Einführung der Gewerbefreiheit den<br />
Verhältnissen Badens auch zuträglich sei. Das Handelsmini-<br />
sterium veröffentlichte zu diesem Zweck am 10.10.1860 per<br />
Erlaß elf Fragen, die sich hauptsächlich mit der prinzipi-<br />
ellen Position: Gewerbefreiheit oder Reform des Zunftwesens<br />
in Baden, eventuellen Beschränkungen der Gewerbefreiheit<br />
durch Lehr-, Wander- und Prüfungszwang oder nur durch all-<br />
gemeine polizeiliche Vorschriften, der altersmäßigen Be-<br />
grenzung der Geschäftsfähigkeit, des Erwerbs des Gemeinde-<br />
bürgerrechts als Voraussetzung der selbständigen Niederlas-<br />
sung, dem Umfang der Gewerbebefugniß sowie der künftigen<br />
Organisation von gewerblichen Vereinigungen beschäftigten.<br />
Diesen Fragen waren Erläuterungen beigegeben, die allgemein<br />
verbreitete Argumente für das Für und Wider bereitstellten.<br />
An dieser Vorbefragung nahmen 16 Handelskammern und Handel-<br />
sinnungen, 1 Handelsverein, 20 Gewerbevereine, 23 Bezirks-<br />
versammlungen zünftiger Meister, 43 Bezirksversammlungen<br />
zünftiger und unzünftiger Gewerbetreibender, 102 Stadt- so-<br />
wie 75 Landgemeinden, 64 Bezirksämter und 4 Kreisregierun-<br />
gen teil. 368 Die Mehrheit sprach sich für eine Einführung der<br />
Gewerbefreiheit aus, die nur durch polizeiliche Vorschrif-<br />
ten beschränkt sein sollte. Die Regierung hob hervor, daß<br />
sich darunter nicht nur die Mehrzahl der Gemeindebehörden<br />
sondern besonders die größten Städte und diejenigen Landes-<br />
teile befänden, in denen sich schon eine umfangreiche Indu-<br />
368 Der Fragenkatalog des Handelsministeriums v.10.10.1860<br />
liegt dem badischen Gesetzentwurf bei (=Beilage A).
656<br />
strie- und Handelstätigkeit ausgebildet habe oder die die<br />
Auswirkungen gewerbefreiheitlicher Regelungen im benachbar-<br />
ten Frankreich unmittelbar beobachten könnten. Auch die<br />
Mehrzahl der Gewerbetreibenden , unter Einschluß der zünf-<br />
tig Organisierten, würden in den eben erwähnten Gegenden<br />
das Prinzip der Gewerbefreiheit bejahen. Die Regierung<br />
selbst begründete dessen Einführung einmal grundsätzlich<br />
mit der notwendigen Verbindung der politischen Freiheits-<br />
rechte des Staatsbürgers mit der Freiheit der wirtschaftli-<br />
chen Betätigung. Andererseits habe die Entwicklung von<br />
Technik, Industrie, Handel, Verkehr und Banken in Baden da-<br />
zu geführt, daß die Beschränkungen des alten Zunft- und<br />
Konzessionswesens den Erwerb des Einzelnen nicht mehr si-<br />
chern und ihn vor den Auswirkungen der Konkurrenz nicht<br />
mehr schützen könnten. Daher müsse das Handwerk in den<br />
Stand gesetzt werden, dieser Konkurrenz beispielsweise<br />
durch Ausdehnung der Handelsbefugnisse, gleichzeitige Be-<br />
treibung mehrerer Gewerbe sowie durch den ungehinderten<br />
Wechsel von einem Gewerbe zum anderen zu begegnen. Die<br />
Mehrzahl der Gutachten lehnte daüber hinaus zwar den Lehr-,<br />
Wander- und Prüfungszwang ab, doch wurden von den Zünften<br />
Argumente für dessen Erhalt vorgebracht. Hauptsächlich wur-<br />
de die endgültige Herrschaft des Kapitals über die Arbeit,<br />
insbesondere der Niedergang des für Gemeinde und Staat so<br />
wichtigen selbständigen Handwerks befürchtet, wenn jeder,<br />
der über ausreichend Geld verfüge, ein Unternehmen gründen<br />
und andere für sich arbeiten lassen dürfe. Die Regierung<br />
hielt dem entgegen, daß die alte Stadtbürgergemeinde, deren<br />
Kern der selbständige Handwerker mit aktivem Bürgerrecht<br />
und Innungszugehörigkeit war, nicht mehr existiere. Die<br />
Ausübung politischer Pflichten mochte es angesichts der<br />
Leistungsfähigkeit der Körperschaft in der Vergangenheit<br />
ratsam erscheinen lassen, keinem Mitglied die Handwerksnah-<br />
rung irgendwie zu verkürzen. Heute würden Beschränkungen<br />
dieser Art als Unrecht gegen den Unternehmensgeist und die<br />
Fähigkeiten des Einzelnen empfunden werden. Große, erfolg-<br />
reiche Betriebe würden schon jetzt neben kleinen, am Rande
657<br />
der Armut sich bewegenden vorhanden sein. Die mit Erfolg<br />
absolvierte Meisterprüfung habe letztere nicht vor diesem<br />
Schicksal bewahren können. Die Zukunft des Handwerks be-<br />
stünde darin, sich mit dem Kapital zu verbinden. Außerdem<br />
sei die Bedeutung der Selbständigkeit nicht überzubewerten.<br />
Gesellen und Meister, die nicht über ausreichende Fähigkei-<br />
ten und finanzielle Mittel zur Gründung eines Betriebs ver-<br />
fügten, könnten sich als Lohnarbeiter ihr Auskommen si-<br />
chern. Befähigte Fabrikarbeiter hindere andererseits nichts<br />
daran, zum selbständigen Geschäftsbetrieb gemeinsam oder<br />
allein überzugehen. Schließlich profitiere das Kleingewerbe<br />
auch oftmals von der Existenz der Fabriken, indem es deren<br />
Produktion ergänze. Die der Frage, ob der Zwangscharakter<br />
der Innungen aufgehoben und künftig jede genossenschaftli-<br />
che Vereinigung oder die Teilnahme an derselben dem freien<br />
Willen des einzelnen Gewerbetreibenden anheim gestellt wer-<br />
den solle, beigelegten Erläuterungen geben Auskunft über<br />
die den Innungen Mitte des 19. Jahrhunderts zugemessenen<br />
Bedeutung. Sie enthalten zwei verbreitete Positionen zu den<br />
noch verbliebenen Funktionen des Zunftwesens. Die Befürwor-<br />
ter der alten gewerblichen Ordnung, die sich meist für<br />
Lehrzwang sowie Prüfungen aussprachen, sahen weiterhin in<br />
der Überwachung der Lehrvorschriften sowie der Abnahme der<br />
Prüfungen eine wichtige Aufgabe der Innungen. Werde der<br />
Zwang zur geordneten Ausbildung aufgehoben, so sei es um so<br />
dringender erforderlich, daß die Innungen auf die Erziehung<br />
und gewerbliche Ausbildung der Lehrlinge einwirkten. Zudem<br />
hätten sie sich um ein geregeltes Verhältnis zwischen Mei-<br />
stern und Gesellen, die Schlichtung ihrer Streitigkeiten,<br />
den Erhalt des Körperschaftsvermögens, die Armen- und Kran-<br />
kenpflege der Genossenschaftsmitglieder, überhaupt um die<br />
Wahrnehmung der Interessen des Gewerbes und die Vermittlung<br />
der Beziehungen zu den Staatsbehörden zu kümmern. Die Geg-<br />
ner schätzten die künftigen Leistungen dieser reformierten<br />
Innungen für die Gewerbetreibenden hingegen gering ein. Die<br />
Zunftgenossen würden jetzt schon wenig Interesse an der<br />
Mitgliedschaft in ihrem Verband bekunden. Das familienarti-
658<br />
ge Verhältnis zwischen Lehrlingen, Gesellen und Meistern<br />
sei ebenso geschwunden wie die wohltätige Einwirkung der<br />
Zunftvorstände auf die Behandlung der Gehilfen in der Werk-<br />
statt. Das Verfahren bei den Meisterprüfungen zeuge von den<br />
eigennützigen Gesinnungen der Meister, die sich auch bei<br />
den Streitigkeiten über die Grenzen der Gewerbsbefugnisse<br />
in den Vordergrund schieben würden. Schaffe die Regierung<br />
dann das Recht, Unzünftigen gewisse Arbeiten zu verbieten,<br />
ab, so fiele damit die einzige noch nennenswerte Tätigkeit<br />
weg, und die Innungen lösten sich wahrscheinlich selbst<br />
auf. Dieser Funktionsverfall zeige sich auch darin, daß<br />
sich die Meister über neue Entwicklungen ihrer Gewerbe<br />
nicht mehr in der Zunft, sondern in größeren gewerblichen<br />
Vereinen oder Lesezirkeln informierten. Sie träten Kredit-<br />
vereinen, Assoziationen zur Beschaffung der Rohstoffe oder<br />
geselligen Vereinen, Sparvereinen, Witwenkassen etc. bei.<br />
Der Handwerker finde eben nicht mehr wie früher, so das Fa-<br />
zit, in der Innung den einen maßgeblichen Kreis vor, der<br />
alle Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens um-<br />
schließe, sondern trete bald dem einen bald einem anderen<br />
Verein, der seinen jeweiligen Bedürfnissen entspreche, bei.<br />
Der Staat dürfe in diese Entwicklung, die den freien Zu-<br />
oder auch Abgang der Gewerbetreibenden erfordere, nur inso-<br />
weit eingreifen, als es die allgemeinen Vereinsgesetze zu-<br />
ließen. Den Innungen solle es dabei gestattet werden, so-<br />
fern sie ohne Zunftzwang Lebensfähigkeit besäßen, ihre Tä-<br />
tigkeit weiterhin auszuüben.<br />
Die bei der Durchsicht der „Allgemeinen Begründung“ festge-<br />
stellten Ähnlichkeiten weisen, bei aller ersichtlichen Be-<br />
schränktheit ihrer Aussagemöglichkeiten, auf grundsätzliche<br />
Probleme staatlicher Gewerbepolitik vor Einführung der Ge-<br />
werbefreiheit in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts hin.<br />
Die Gewerbeordnung mußte der expandierenden Entwicklung in<br />
Handel, Gewerbe, Technik, Verkehr angepaßt werden. Doch der<br />
dazu erforderliche Abbau staatlich-korporativer Regelungen<br />
in der Wirtschaft wurde nur zögernd begonnen, nicht zuletzt<br />
deshalb, weil damit auch Eingriffe in die Struktur des Ge-
659<br />
meindelebens verbunden waren. Den gegenüber der Einführung<br />
von Gewerbefreiheit und Freizügigkeit angeführten Bedenken<br />
ging es hauptsächlich um den Erhalt der alten Stadtbürger-<br />
gemeinde. In der Praxis entschieden die Behörden allerdings<br />
schon oft nicht mehr nach den Buchstaben der geltenden Ge-<br />
werbeordnung, was einerseits zu einer überall als mißlich<br />
empfundenen Rechtsunsicherheit führte, aber auch später den<br />
Schritt zur Gewerbefreiheit erleichterte. Angesichts der<br />
fortschreitenden Industrialisierung sowie der Vergrößerung<br />
der Märkte hielten die Regierungen es für erforderlich, das<br />
Kleingewerbe von seinen zünftigen Beschränkungen, die ihnen<br />
keinen wirklichen Schutz mehr bieten konnten, zu befreien,<br />
um es damit wettbewerbsfähig machen zu können. Sowohl in<br />
der Begründung der Einführung von Gewerbefreiheit und Frei-<br />
zügigkeit, der Entscheidung für ein freies gewerbliches<br />
Vereinswesen, als auch in der Ablehnung des Lehr- und Prü-<br />
fungszwangs setzte die badische Regierung auf die Anpas-<br />
sungsfähigkeiten des Handwerks an den Industrialisierungs-<br />
prozeß. 369<br />
Die Haltung der zünftigen Handwerker selbst gegenüber der<br />
Gewerbefreiheit schien gespalten zu sein und auch von dem<br />
wirtschaftlichen Entwicklungsgrad der einzelnen Landesteile<br />
369 In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, daß die badische<br />
Regierung nicht gezielt die Modernisierung von Wirtschaft<br />
und Gesellschaft betrieb, es also an einer Industrialisierungspolitik,<br />
die auf bestimmten planerischen Gesichtspunkten<br />
beruhte, fehlen ließ. Dies lag zum einen daran, daß bis<br />
in die 60er Jahre Arbeitsbeschaffung und Stärkung des Mittelstandes<br />
bzw. die Bewahrung der alten agrarischkleingewerblichen<br />
Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur<br />
die entscheidenden Motive für Gewerbeförderung bildeten.<br />
Außerdem setzte sich in diesem Zeitabschnitt, wie in anderen<br />
Ländern auch, erst einmal die Überzeugung durch, daß<br />
die Wirtschaft am besten den Gewerbetreibenden in eigener<br />
Verantwortung überlassen bleibe. Auch für das noch stärker<br />
von der Landwirtschaft bestimmte Oldenburg kann diese konservative,<br />
gleichsam konservierende Grundrichtung der Wirtschafts-<br />
und Gesellschaftspolitik festgestellt werden. Dennoch<br />
bewirkten praktische Erfordernisse, daß die Gewerbeförderung<br />
in Baden weit über die eigentlich verfochtenen<br />
Ansichten hinausging und die Entwicklung der Industrie voran<br />
brachte (vgl. Fischer, W., Planerische Gesichtspunkte<br />
bei der Industrialisierung in Baden ... , S.75ff).
660<br />
abzuhängen. Das wenig entwickelte, kleinbetrieblich struk-<br />
turierte sowie noch vorwiegend an der Stadtwirtschaft aus-<br />
gerichtete Oldenburger Zunfthandwerk wandte sich gegen Ge-<br />
werbefreiheit. In höher industrialisierten Regionen Badens<br />
und in an Frankreich grenzenden Landesteilen sprach sich<br />
auch die Mehrheit der zünftigen Gewerbetreibenden für Ge-<br />
werbefreiheit aus. Der Erhalt des Lehr-, Wander- und Prü-<br />
fungszwangs wurde von vielen Zünften in Baden befürwortet<br />
und findet sich auch als Forderung in dem Gutachten der<br />
Handwerker der Stadt Oldenburg wieder. Der Mehrzahl der ba-<br />
dischen Zünfte war indessen wenig an der Aufrechterhaltung<br />
des Innungszwangs sowie eines umfassenden staatlichen Ge-<br />
nossenschaftswesens gelegen; eine Haltung, die die damals<br />
schon verbreitete Ansicht über den Funktionsverlust der In-<br />
nungen nur bestätigte.<br />
6.3.4 Die Begründung des Kommissionsentwurfs von 1860,<br />
Petitionen der Handwerker, die endgültige Fassung<br />
des Gewerbegesetzes 1861<br />
Die Kommission legte am 9.3.1860 einen Gesetzentwurf nebst<br />
einer ausführlichen Begründung vor. 370 Gleichsam den Regie-<br />
rungsbericht vom 6.9.1859 ergänzend, in dem die Ergebnisse<br />
der eingezogenen Gutachten mitgeteilt und besonders die ge-<br />
gen die Einführung der Gewerbefreiheit ins Feld geführten<br />
Argumente widerlegt wurden, beschreiben diese Erläuterungen<br />
nochmals den aktuellen Zustand der Oldenburger Gewerbeord-<br />
nung, begründen die Erfordernis einer Revision sowie die<br />
Entscheidung der Kommission zugunsten von Gewerbefreiheit.<br />
Auf diese drei Punkte soll zunächst näher eingegangen wer-<br />
den, weil sie die Position der Befürworter nochmals zusam-<br />
menfassend deutlich machen und sich daran in Konfrontation<br />
370 Vgl. Kommissionsbericht v.9.3.1860, in: StAO Best.70,<br />
Nr.6736
661<br />
mit den Handwerkerpetitionen der unüberbrückbare Gegensatz<br />
zur Sicht- und Argumentationsweise der Oldenburger Handwer-<br />
ker herausarbeiten läßt.<br />
Die Kommmission hob in ihrem Bericht hervor, daß das hiesi-<br />
ge Gewerbewesen nur teilweise auf bestimmten Gesetzen, zu-<br />
meist aber auf nicht publizierten Erlassen der Verwaltungs-<br />
behörden und einer daran sich allmählich ausbildenden Pra-<br />
xis beruhe. Zu den freien stehenden Gewerben gehöre der<br />
Großhandel, der Einkauf von Waren jeder Art, der Handel mit<br />
Erzeugnissen der Land- und Gartenwirtschaft, mit Brennmate-<br />
rialien, Baumaterialien, die Bierbrauerei und die Brannt-<br />
weinbrennerei. Sie könnten von jedem Bewohner des Herzog-<br />
tums, auch von Fremden, die allerdings ihren Heimatschein<br />
vorzulegen hätten, betrieben werden. In den Städten müsse<br />
zu diesem Zweck das gewerbliche Bürgerrecht erworben wer-<br />
den. Konzessionspflichtig hingegen seien der Betrieb von<br />
Ziegeleien, Kalkbrennereien, Mühlen, Schiffshelgen, Fabri-<br />
ken, der Kleinhandel mit nicht zu den freien Gewerben gehö-<br />
renden Gegenständen, die Schenk- und Gastwirtschaft sowie<br />
das Handwerk. Die Stadt Oldenburg sei von dem polizeilichen<br />
Konzessionszwang befreit; dort dürfe mittels des Bürger-<br />
rechts jedes Gewerbe betrieben werden. Ausnahmsweise müsse<br />
hier für den Betrieb von Mühlen, der Schenk- und Gastwirt-<br />
schaft, des Handels und des Handwerks eine Zulassung bean-<br />
tragt werden. Das Handwerk werde durch eine besondere Ge-<br />
setzgebung geregelt. Die Handwerksordnung hielte den Lehr-,<br />
Wander- und Prüfungszwang, Zwangsinnungen in den Städten<br />
und einigen Orten, die nur beschränkte Zulassung von Land-<br />
handwerkern in deren Umkreis sowie die Abgrenzung der Ar-<br />
beitsgebiete aufrecht. Die Zulassung zur selbständigen Nie-<br />
derlassung von Meistern hänge v.a. von dem Nachweis der<br />
zünftigen Erlernung des Handwerks ab, aber auch von dem Ur-<br />
teil der Ortsobrigkeit darüber, ob der betreffende Beruf<br />
übersetzt sei oder nicht. Die Kommission hob in diesem Zu-<br />
sammenhang bedauernd hervor, daß die Vorschriften der HWO,<br />
die ursprünglich das Zunfthandwerk regeln sollten, allmäh-<br />
lich durch besondere Verordnungen und durch die Praxis auch
662<br />
auf das unzünftige Handwerk und das Landhandwerk ausgedehnt<br />
wurden. Zahlreiche Unstimmigkeiten seien die Folge gewesen.<br />
Bei den nichtstehenden Gewerben werde zwischen freiem und<br />
konzessionsgebundenem Hausieren unterschieden. Frei sei das<br />
Hausieren mit Produkten der Natur, der Landwirtschaft, mit<br />
gewöhnlichen Lebensmitteln sowie mit eigenen Erzeugnissen<br />
der kleinen ländlichen Hausindustrie. Eine Revision der Ge-<br />
werbeordnung sei nun schon deswegen anzuraten, um die<br />
schwankende Praxis der Verwaltungsbehörden, die den Ent-<br />
scheidungen in Gewerbesachen wesentlich zugrunde liege,<br />
durch umfassende einheitliche Normen zu ersetzen. Zur<br />
Rechtsunsicherheit trage außerdem wesentlich bei, daß die<br />
der HWO zugrunde liegenden Prinzipien der alten Zunftver-<br />
fassung längst nicht mehr den freieren Anschauungen der Be-<br />
hörden entsprächen. Diese versuchten im Zweifel durch Dis-<br />
pensationen vorhandene Härten zu mildern. Schließlich mache<br />
der Art.56 des Staatgrundgesetzes eine Revision zur<br />
Pflicht, dem zufolge gewerbliche Beschränkungen nur den Er-<br />
fordernissen des Gemeinwohls dienen dürften. Die Kommission<br />
stellte daraufhin fest, daß sie sich auch nach weiterer<br />
Prüfung der Frage, welche Form der Gewerbeordnung den Be-<br />
dürfnissen im Herzogtum am meisten entgegenkomme, nur der<br />
Ansicht der Regierung anschließen könne, Gewerbefreiheit<br />
einführen zu lassen. Auch im Herzogtum habe der gewerbliche<br />
Fortschritt die beengenden Fesseln in immer weiteren Krei-<br />
sen fühlen lassen, und es dürfe angenommen werden, daß der<br />
größte Teil der Gewerbetreibenden eine freiere Gesetzgebung<br />
begrüßen würde. Dadurch, daß der Staat sich aus der Wirt-<br />
schaft zurückziehe, könne das Prinzip der freien Konkurrenz<br />
wirken und so die Gewerbeentwicklung sowie der allgemeine<br />
Wohlstand gefördert werden. Das gewerbliche Wachstum würde<br />
auch nicht zu einer Verschlechterung der sozialen Zustände<br />
führen, da in dem dünnbesiedelten Herzogtum kein Gewerbe-<br />
zweig unter übermäßigem Zulauf leide und noch genügend Raum<br />
für die verschiedensten wirtschaftlichen Entwicklungen vor-<br />
handen sei. Auf keinen Fall müsse der Anstieg der Armenlast<br />
von den Gemeinden befürchtet werden. Die Kommission wandte
663<br />
sich zuletzt noch der zünftigen Handwerksordnung zu, die<br />
sie in Bausch und Bogen verurteilte und dringend abge-<br />
schafft wissen wollte. Weder Lehr-, Wander- und Prüfungs-<br />
zwang, der Nachweis eines Betriebskapitals, die Abgrenzung<br />
der Arbeitsgebiete sowie des Handwerks zur Fabrik, noch die<br />
Übersetzungsregelung und die Zwangsinnungen fanden vor ih-<br />
ren Augen Gnade. Behielte man das bisherige Innungs- und<br />
Konzessionswesen bei, so würde außerdem die eingeführte und<br />
von der Zustimmung der Gemeinde unabhängige Niederlassungs-<br />
freiheit unterlaufen werden. 371 Der Entwurf gründe also, nach<br />
dem bisher Gesagtem, auf dem gewerbefreiheitlichen Prinzip,<br />
das nur ausnahmsweise dort durch Konzessionszwang für be-<br />
stimmte Tätigkeiten und gewerbliche Anlagen beschränkt wer-<br />
de, wo es aus Gründen des öffentlichen Wohls erforderlich<br />
sei.<br />
Im Juli, August und September wurde der Kommissionsentwurf<br />
zweimal ausführlich in der „Oldenburger Zeitung“ bespro-<br />
chen. Auch im „Bremer Handelsblatt“ wurde er erörtert. Es<br />
schlossen sich noch drei Einzelbeiträge über den Sinn der<br />
Rekognitionspflicht bestimmter Gewerbe und speziell über<br />
die Besteuerung der Ziegeleien an. 372 Daraufhin wurde er<br />
371 Wie schon erwähnt, wurde dennoch nur eine durch das Heimatrecht<br />
beschränkte Freizügigkeit gewährt. Einem Staatsangehörigen<br />
war es zwar gestattet, frei in eine andere Gemeinde<br />
umzuziehen, doch das dort geltende Gemeindebürgerrecht<br />
erhielt er nur unter verschiedenen Voraussetzungen.<br />
Sein Erwerb blieb damit vom Entschluß der Gemeinde abhängig.<br />
372 Vgl. Art. „Bemerkungen zu dem Entwurfe eines Gewerbegesetzes“,<br />
in: Oldenburger Zeitung v.14.7.1860; Art.<br />
„Bemerkungen ...“ (Fortsetzung), in: Ebenda v.15.7.1869;<br />
Art. „Der Commissions=Entwurf eines Gewerbegesetzes für das<br />
Herzogthum Oldenburg“, in: Ebenda v.28.8.1860; Art. „Der<br />
Commissions=Entwurf ...“ (Fortsetzung), in: Ebenda<br />
v.30.8.1860; Art. „Der Commissions=Entwurf ...“<br />
(Fortsetzung), in: Ebenda v.1.9.1860; Art. „Der Commissions=Entwurf<br />
...“ (Fortsetzung), in: Ebenda v.2.9.1860; Art.<br />
„Noch einige Worte über den Commissions=Entwurf eines Gewerbegesetzes<br />
für das Herzogthum Oldenburg, in: Ebenda<br />
v.9.9.1860; Art. „Der Entwurf des neuen Gewerbegesetzes“,<br />
in: Ebenda v.18.9.1860; Art. „Der Entwurf eines Gewerbegesetzes“,<br />
in: Ebenda v.23.9.1860.
664<br />
nochmals einer Revision unterzogen und im Dezember dem<br />
Landtag zugeschickt. 373<br />
Die Reaktion des Handwerks auf diese „Zumutung“ blieb nicht<br />
aus. Handwerker aus der Stadt versammelten sich am 2.8. im<br />
Butjadinger Hof und sprachen sich dort einstimmig gegen die<br />
Einführung von Gewerbefreiheit im Herzogtum aus. Es wurde<br />
ein Kommittee gebildet und der Beschluß gefaßt, an den For-<br />
derungen der Petition vom 13.1.1859 nach Sicherung des<br />
Handwerks durch die gesetzliche Vorschrift bestimmter Lehr-<br />
und Wanderjahre sowie der Gesellen- und Meisterprüfung<br />
festzuhalten. Außerdem sollte eine weitere Bittschrift an<br />
die Regierung formuliert werden, in der noch einmal aus-<br />
drücklich die Gefahren einer unbeschränkten Gewerbefrei-<br />
heit, wie sie der Kommissionsentwurf vorsah, für die Hand-<br />
werkerschaft geschildert würden. Daraufhin verfaßte das<br />
Kommittee ein Schreiben an die Handwerker der Städte im<br />
Herzogtum, das die erwähnten Beschlüsse enthielt und dazu<br />
aufforderte, sich dem Protest anzuschließen. Sie sollten<br />
ihre Ansichten den Oldenburgern schriftlich mitteilen sowie<br />
sich dazu äußern, ob sie die Einführung eines allgemeinen<br />
Handwerkertages für das Herzogtum befürworten würden. Eine<br />
Abschrift der Petition vom 13.1.1859 an den Stadtrat wurde<br />
angelegt. 374<br />
In Jever wurde daraufhin am 27.8. eine Versammlung abgehal-<br />
ten, in der die Vorsteher der Innungen sämtlichen Handwer-<br />
kern der Stadt die Fragen unterbreiteten. Alle sprachen<br />
sich gegen unbeschränkte Gewerbefreiheit aus; die Einfüh-<br />
rung eines Handwerkertages hielten sie hingegen nicht für<br />
notwendig. Eine kurze Stellungnahme sowie eine Liste mit<br />
120 Unterschriften wurde schließlich an das Oldenburger<br />
Kommittee geschickt. 375 Aus Apen schlossen sich 7, aus We-<br />
373 Vgl. Vortrag Buchholtz´über den Entwurf des Gewerbegesetzes<br />
v.5.10.1860, in: StAO Best.31-15-43-1; Schreiben des<br />
Staatsministeriums an den Landtag v.13.12.1860, in: Ebenda<br />
374 Vgl. Aufruf des Kommittees der Handwerker der Stadt Oldenburg<br />
v.2.8.1860 im Anhang der Petition der Handwerker<br />
der Stadt Oldenburg v.20.11.1860, in: StAO Best.31-15-43-1<br />
375 Vgl. Stellungsnahme des Handwerkerkommittees der Stadt<br />
Jever v.1.9.1860 im Anhang Ebenda
665<br />
sterstede 33, aus Rastede 39 sowie aus der Bauerschaft Loy<br />
und Barghorn 15 Handwerker dem Oldenburger Protest an. We-<br />
sterstede und die Bauerschaft befürworteten außerdem die<br />
Durchführung eines Handwerkertages. 376 Varel meldete sich mit<br />
einem ausführlicheren Schreiben. Die Konkurrenz belebe das<br />
Gewerbe auch dann ausreichend, wenn nur ausgebildete Hand-<br />
werker im Herzogtum, ohne Nachweis von Betriebskapital und<br />
frei von der alten Übersetzungsregelung, arbeiten dürften.<br />
Der Erhalt des Lehr-, Wander- und Prüfungszwangs bilde al-<br />
lerdings die Grundvoraussetzung eines tüchtigen und gebil-<br />
deten Handwerkerstandes. Würden damit Pfuscher u.a. fach-<br />
lich nicht ausgewiesene Personen von der Ausübung eines<br />
Handwerks ausgeschlossen, so könnten dann auch die Arbeits-<br />
grenzen zwischen den einzelnen Handwerken zugunsten einer<br />
größeren Beweglichkeit der Meister ausgeweitet werden. Die<br />
obligatorische Ausbildung hindere außerdem Handwerker, sich<br />
zu früh niederzulassen, sich zu verheiraten und im Fall des<br />
Scheiterns der Armenkasse zur Last zu fallen. 377 Handwerker<br />
aus Brake und Elsfleth wiesen besonders auf die durch den<br />
Schiffbau geprägten örtlichen Verhältnisse hin, die bei-<br />
spielhaft die Auswirkungen der Gewerbefreiheit vergegenwär-<br />
tigten. In Brake werde der Schiffbau fabrikmäßig betrieben.<br />
Die Schiffbaumeister beschäftigten neben gelernten Schiffs-<br />
zimmerleuten auch Tischler- und Schmiedegesellen im Tage-<br />
lohn. Seit einigen Jahren führe nun die sich verschlech-<br />
ternde Auftragslage zu Lohnherabsetzungen und vermehrten<br />
Entlassungen der Helgenarbeiter. 378 Diese versuchten, sich<br />
376 Vgl. Schreiben der Handwerker aus Apen v.28.8.1860, aus<br />
Westerstede v.1.9.1860, aus Rastede v.10.9.1860, aus Loy<br />
und Barghorn v.18.9.1860 im Anhang Ebenda<br />
377 Vgl. Schreiben von 84 Handwerkern aus Varel v.2.11.1860<br />
im Anhang Ebenda<br />
378 Den Großteil der auf den Werften Beschäftigten machten<br />
aber die ungelernten und häufig fluktuierenden Arbeiter aus<br />
den umliegenden Geestdörfern aus. Den Hintergrund für die<br />
Entlassungen bildete die sinkende Nachfrage nach Holzschiffen<br />
seit der Wirtschaftskrise von 1857.<br />
Parisius weist außerdem nach, daß in Brake die Relation der<br />
abhängig Beschäftigten zu den Selbständigen in der Industrie<br />
mit 2,1 (1867) im Herzogtum am höchsten war. Das alte<br />
zünftige Handwerk sei in Brake hingegen von untergeordneter
666<br />
einen neuen Lebensunterhalt zu verschaffen, indem sie den<br />
ansässigen Meistern ins Handwerk pfuschten. Die Erwerbsmög-<br />
lichkeiten im Handwerk seien hier in Brake überdies gering<br />
und beschränkten sich ausschließlich auf die Schiffahrt.<br />
Die im Freihafen wohnenden Handwerker könnten wegen der<br />
Zollschranken nicht für Auswärtige arbeiten. Der<br />
Schiffahrtsbetrieb dauere auch nur den Sommer über an, und<br />
Schiffahrtszubehör würde oft von den hiesigen Kaufleuten<br />
gekauft werden, die ihre Waren von auswärtigen Fabriken be-<br />
zögen. Hinzu käme, daß nur die Handwerks- und Gemeindeord-<br />
nung bisher den Zustrom Ansiedlungswilliger abhalte, der in<br />
Brake gar kein Auskommen finden könnte. In Bremerhaven und<br />
Geestemünde sei die Lage dagegen vollkommen anders. Sie<br />
bildeten die Zentren der Schiffahrt und würden darin auch<br />
durch den Bau von Dockanlagen sowie den Ausbau des Eisen-<br />
bahnnetzes befördert. Weder die besonderen Verhältnisse<br />
Brakes noch die des gesamten Herzogtums, die sich durch<br />
mangelnden Ausbau der Infrastruktur sowie Kleinheit aus-<br />
zeichneten, eigneten sich für die Einführung von Gewerbe-<br />
freiheit. Die Elsflether Handwerker befürworteten ausdrück-<br />
lich die Durchführung eines allgemeinen Handwerkertages im<br />
Herzogtum. Anschließend klagten sie über die ruinösen Fol-<br />
gen der Gewerbefreiheit, unter denen die Elsflether Schmie-<br />
demeister schon jetzt zu leiden hätten. Hier war es den<br />
Schiffbaumeistern gestattet, alle erforderlichen Schmiede-<br />
arbeiten in einer eigenen Schmiede herstellen zu lassen.<br />
Viele hätten von dieser Erlaubnis Gebrauch gemacht und zu<br />
diesem Zweck Gesellen eingestellt. Die Erwerbsmöglichkeiten<br />
der Handwerker seien außerdem beschränkt, da Elsfleth und<br />
Umgebung von allen Verbindungswegen abgeschnitten und auf<br />
sich selbst angewiesen sei. Unbeschränkte Gewerbefreiheit<br />
Bedeutung gewesen. Bis 1861 bildete sich dort nur eine Innung,<br />
die der Schuster, mit 11 Meistern (vgl. Parisius, B.,<br />
Vom Groll der „kleinen Leute“ ... , S.84,94f.). Dem ist<br />
hinzuzufügen, daß immerhin 84 Handwerker die Braker Petition<br />
unterschrieben (vgl. Vorstellung der Handwerker der<br />
Stadt Brake o.D. im Anhang Ebenda).
667<br />
würde die Lage der hiesigen Handwerker nur noch verschlim-<br />
mern. 379<br />
Mitte Januar 1861 leitete das Staatsministerium die Petiti-<br />
on der Handwerker der Stadt Oldenburg, in deren Anhang sich<br />
die übrigen Vorstellungen aus dem Herzogtum befanden, dem<br />
Landtagsausschuß zur Begutachtung des Gewerbegesetzentwur-<br />
fes zu. 380 Im Gegensatz zum Kommissionsbericht malten die<br />
Handwerker die Zukunft des gewerblichen Mittelstandes im<br />
Herzogtum nach der Einführung von Gewerbefreiheit in düste-<br />
ren Farben. Das Beispiel Preußen zeige, daß unter gewerbe-<br />
freiheitlichen Verhältnissen zwar bedeutende Industrien in<br />
großen Städten wie Berlin entstünden, aber dieser wirt-<br />
schaftliche Erfolg auf Kosten der sich rapide verschlech-<br />
ternden Arbeitsbedingungen großer Teile der Bevölkerung er-<br />
rungen werde. Handwerkliche Selbständigkeit nehme ab; zu-<br />
nehmend mittellose Handwerker arbeiteten in Fabriken und<br />
seien dabei fortwährend von Arbeitslosigkeit und Hungerlöh-<br />
nen bedroht. Anstelle von Talent und Befähigung des Einzel-<br />
nen gebe der Einsatz von Kapital und die Verfügungsgewalt<br />
über Arbeitskräfte den Ausschlag über wirtschaftliches<br />
Fortkommen und Wohlstand. In Oldenburg gebe es dagegen noch<br />
einen breiten Mittelstand, der sich vorrangig durch kleine<br />
Handwerksbetriebe in den Städten auszeichne. Die Qualität<br />
ihrer Erzeugnisse könne sich allemal auch unter den jetzt<br />
geltenden gewerberechtlichen Bestimmungen sehen lassen und<br />
stünde ausländischen Produkten nicht nach. Dieser Zustand<br />
müsse zugunsten der arbeitenden Bevölkerung erhalten wer-<br />
den, und es dürfe nicht der Fehler gemacht werden, mit<br />
Blick auf die in ganz anderen Dimensionen sich vollziehende<br />
379 Vgl. Schreiben des Elsflether Handwerkerkommittees<br />
v.27.8.1860 im Anhang Ebenda<br />
380 Vgl. Petition der Handwerker der Stadt Oldenburg<br />
v.20.11.1860 an das Staatsministerium, in: StAO Best.31-15-<br />
43-1; die Oldenburger hatten daraufhin zwei weitere Petitionen<br />
an den Großherzog sowie direkt an den Landtag geschickt<br />
(vgl. Petition v.30.11.1860, in: Ebenda, Petition<br />
v.17.1.1861 in der Anlage zum Bericht des Landtagsausschusses<br />
zur Begutachtung des Gewerbegesetzentwurfes<br />
v.29.4.1861, in: Ebenda).
668<br />
wirtschaftliche Entwicklung großer Städte auch in der klei-<br />
nen Stadt Oldenburg ähnliches mittels Einführung der Gewer-<br />
befreiheit bewirken zu wollen. Weder bestünde hier wegen<br />
des beschränkten lokalen Absatzes die Möglichkeit, Hand-<br />
werksbetriebe zu vergrößern, noch eine fabrikmäßige Produk-<br />
tion aufzunehmen. Geschähe dies dennoch, so müsse dies mit<br />
dem Niedergang vieler Betriebe einer Branche erkauft wer-<br />
den. Die innerstädtische Konkurrenz sei groß genug: auf<br />
12.000 Einwohner kämen jeweils 40 Tischler, Schneider und<br />
Schuster, 24 Klempner, 20 Sattler und Tapezierer sowie<br />
ca.30 Maler. Die Oldenburger befürchteten außerdem die Zu-<br />
wanderung mittelloser Handwerker aus anderen Ländern, in<br />
denen noch keine Gewerbefreiheit bestand. Gegenüber der<br />
scharfen Kritik des Kommissionsberichts an der Handwerks-<br />
ordnung räumten die Handwerker Mißstände in der gewerbli-<br />
chen Entwicklung ein. Es fehle zu sehr an Einheit im gesam-<br />
ten Gewerbewesen. Außerdem seien die verschiedenen zünfti-<br />
gen Handwerkszweige noch zu sehr geteilt von einander. Die<br />
strikte Begrenzung des Tätigkeitsbereichs eines Handwerks<br />
führe öfters zu mangelhaften und verteuerten, weder Meister<br />
noch Publikum zufriedenstellenden Produkten. Auch ermangele<br />
es den nichtzünftigen Gewerben an einer Ordnung. Hier müsse<br />
Abhilfe geschaffen werden, ohne aber dabei das existenzsi-<br />
chernde Handwerksrecht aufzuheben und Gewerbefreiheit ein-<br />
zuführen. Zu diesem Zweck müßte eine Kommission, deren Mit-<br />
glieder sich theoretisch wie praktisch in gewerblichen Din-<br />
gen auskennen würden, das Gewerbe regeln und ordnen.<br />
Schließlich bekräftigten die Oldenburger nochmals, daß der<br />
Lehr-, Wander- und Prüfungszwang sowie ein bestimmtes Alter<br />
zur Erreichung der Geschäftsfähigkeit Grundvoraussetzungen<br />
für tüchtige und gut ausgebildete Handwerker bildeten. Zu<br />
einigen Konzessionen waren sie dennoch bereit. Verkürzte<br />
Gesellenjahre oder die Dispensation von der Wanderschaft<br />
überhaupt sollten möglich sein. Eine bestimmte Dauer der<br />
Lehrzeit müsse nicht festgelegt werden. Es genüge ein ein-<br />
faches und weniger kostspieliges Meisterstück.
669<br />
Die Zeichen der Zeit standen aber hinsichtlich der gewerbe-<br />
politischen Zielsetzungen in den 60er Jahren auf Befreiung<br />
der Wirtschaft von jeglichen einengenden korporativen Fes-<br />
seln. Dahinter verbarg sich der noch ungebrochene Glaube an<br />
die wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten sowie Selbst-<br />
regulierungskräfte eines freien Marktes. Dieser optimisti-<br />
sche Fortschrittsglaube prägte auch die Position des<br />
Staatsministeriums und des Landtagsausschusses gegenüber<br />
den vom Handwerk vorgetragenen Bedenken. Lehrzeit , Wander-<br />
jahre, Meisterstück wurden als Relikte einer vergangenen<br />
Epoche zünftig gebundener Stadtwirtschaft, als ausschließ-<br />
lich den berufsständischen Interessen des Handwerks dienen-<br />
den Regelungen aufgefaßt. 381 Die handwerkliche Ausbildung<br />
sollte geöffnet, alternative Wege, abseits des bisherigen<br />
Innungsmonopols, zu ihrem Erwerb ermöglicht werden. Vor al-<br />
lem sollte dies freiwillig geschehen, aus der Einsicht des<br />
Einzelnen heraus in die Notwendigkeit, sich die erforderli-<br />
chen Kenntnisse und Fähigkeiten für den angestrebten Beruf<br />
aneignen zu müssen, um erfolgreich bestehen zu können. Die<br />
dreiteilige Hierarchie von Lehrling, Geselle, Meister wurde<br />
als überflüssig und ständisch verworfen. In den Augen der<br />
Verfechter einer unbeschränkten Gewerbefreiheit würde die<br />
Entscheidung des Einzelnen über den ihm gemäßen Ausbil-<br />
dungsweg zu besseren Ergebnissen führen als die aufgezwun-<br />
gene Lehrzeit bei einem Meister. Diese sei bei Lichte bese-<br />
hen durch viel Leerlauf geprägt und werde oft mit fachfrem-<br />
den Tätigkeiten gefüllt. Die Aussagekraft des Meisterstücks<br />
hinsichtlich des Geschicks und der künftigen Qualität der<br />
Arbeit eines Handwerkers sei gering. Darüber hinaus könnten<br />
so nicht verschiedene Grade der Geschicklichkeit geprüft<br />
werden. Der Tagelöhner beispielsweise, der seine handwerk-<br />
liche Nebentätigkeit aus finanziellen oder gesundheitlichen<br />
Gründen zur Hauptbeschäftigung machen und nur einfache Fuß-<br />
bänke oder Bürsten herstellen will, müßte sich einer Mei-<br />
381 Vgl. zum folgenden die Anlage zum Bericht des Landtagsausschusses<br />
zur Begutachtung des Gewerbegesetzentwurfs<br />
v.29.4.1861, in: Ebenda
670<br />
sterprüfung unterziehen. Schließlich könnten die detail-<br />
lierten und schwerfälligen Prüfungsregelungen gar nicht mit<br />
dem Entstehen neuer Betriebszweige im Handwerk Schritt hal-<br />
ten. Die Möglichkeit, sich zu spezialisieren und dann auch<br />
diese Fähigkeit frei auszuüben, müsse aber unter allen Um-<br />
ständen befördert werden. Als weitere Argumente gegen die<br />
Anfertigung eines Meisterstücks wurde der in Zukunft ver-<br />
mehrt notwendige Wechsel von einem Handwerk in ein anderes<br />
sowie die Betreibung mehrerer Gewerbe zugleich angeführt.<br />
Der Landtagsausschuß hatte in seinem Gutachten, das die in<br />
erster und zweiter Lesung beschlossenen Änderungen im Ge-<br />
werbegesetz zusammenstellte, der Handwerkerfrage immerhin<br />
über zwanzig Seiten gewidmet. Doch, wie schon in Kap.6.3.1<br />
erwähnt, sah er keinen Anlaß, auf die Forderungen einzuge-<br />
hen. Die Petitionen und Stellungnahmen wurden, ohne etwas<br />
im Sinne der Handwerker bewirkt zu haben, zu den Akten ge-<br />
legt. Am 11.7.1861 verkündete der Großherzog mit Zustimmung<br />
des Landtags das neue Gewerbegesetz, das unbeschränkte Ge-<br />
werbefreiheit unter Vorbehalt der Volljährigkeit als Bedin-<br />
gung zur selbständigen Niederlassung sowie eine durch das<br />
kommunale Heimatrecht und besondere Regelungen für auslän-<br />
dische Gewerbetreibende beschränkte Freizügigkeit beinhal-<br />
tete.<br />
Doch das Handwerk ließ nicht nach, sein spezifisches Be-<br />
rufsrecht sowie die dahinter stehenden Wertvorstellungen<br />
gegenüber der zu Beginn der 60er Jahre überall in den Län-<br />
dern des Deutschen Bundes eingeführten Gewerbefreiheit zu<br />
verteidigen. In Oldenburg stießen dessen Bemühungen jedoch<br />
auf kein Entgegenkommen. Den Verfassern der Denkschrift des<br />
Deutschen Handwerkerbundes von 1863 ging es besonders dar-<br />
um, dem liberalen Lehrsatz, daß der Wert der menschlichen<br />
Arbeitskraft von Angebot und Nachfrage bestimmt werde, ihre<br />
Grundanschauung vom natürlichen Anspruch jedes Handwerkers<br />
auf auskömmliche Entlohnung entgegenzusetzen. Den existenz-<br />
sichernden Tagelohn gegenüber Schwankungen, die aus dem<br />
Mißbrauch der ökonomischen und sozialen Übermacht der Be-<br />
sitzenden gegenüber den Besitzlosen entstehen könnten, ab-
671<br />
zusichern, sei die ursprüngliche Aufgabe und Norm des Hand-<br />
werksrechts. 382 Das Recht des Arbeiters, das Gesellenrecht,<br />
bilde also dessen Grundlage. Aus dem Anspruch auf einen ge-<br />
setzlich geregelten Lohn leite sich notwendigerweise eine<br />
leistungsorientierte, mit bestimmten Qualifikationen verse-<br />
hene Erlernung des Handwerks, Lehr- und Wanderjahre, ab.<br />
Aus dem natürlichen Grundrecht des Handwerksberufs folge<br />
weiterhin, daß jeder, der ein bestimmtes Handwerk ge-<br />
schäftsmäßig ausübt, in allen handwerksrechtlichen Bezie-<br />
hungen der Eigengerichtsbarkeit des bestimmten Handwerks<br />
untersteht. Die staatliche Anerkennung des Handwerksrechts<br />
wiederum forme die Handwerker zu Korporationen. Diese Aner-<br />
kennung rechtfertige sich auch dadurch, daß das Handwerk<br />
seine Armen- und Krankenversorgung sowie die Unterhaltung<br />
der handwerksrechtlichen Institute selbst finanziere. Das<br />
Handwerksrecht müsse auch deswegen aufrechterhalten werden,<br />
weil es der um sich greifenden Notlage und den Problemen<br />
der Arbeiterschaft - niedrige Löhne, unsichere Arbeitsplät-<br />
ze, Arbeitslosigkeit infolge der Einführung von Gewerbe-<br />
freiheit - Abhilfe schaffen könne. Selbst Repräsentanten<br />
der modernen Nationalökonomie, wie John Stuart Mill, for-<br />
derten jetzt angesichts der massenhaften Verarmung die ge-<br />
setzliche Feststellung des Arbeitslohnes. Die Lösung des<br />
Problems sehe der Genannte allerdings eher in der Eindäm-<br />
mung des Bevölkerungsanstiegs, die in seinen Augen mögli-<br />
cherweise durch die Beschränkung der Kinderzahl pro Familie<br />
erreicht werden könne. Eine weniger drastische Lösung biete<br />
dagegen das herkömmliche Handwerksrecht, indem der Handwer-<br />
ker erst nach langwieriger Ausbildung eine Familie gründen<br />
dürfe. Anstatt „Proletariertransporte“ nach überseeischen<br />
Kolonien zu fordern, um den Arbeitsmarkt zu entlasten, kön-<br />
ne man doch auf die ausgleichenden Regelungen des alten<br />
Handwerks zurückgreifen, die die Lehrlingszahl pro Betrieb<br />
382 Vgl. im folgenden die Petition des Deutschen Handwerkerbundes<br />
vom Januar 1863 (=Beschluß des 1. Deutschen Handwerkertages,<br />
der am 5.-8.9.1862 in Weimar abgehalten wurde),<br />
in: Ebenda
672<br />
beschränkten sowie eine bestimmte Anzahl von Gesellenjahren<br />
vorschrieben. Die Verfasser der Denkschrift schlossen mit<br />
dem Hinweis darauf, daß sowohl in England als auch in<br />
Frankreich die Arbeiter gegen die sozialen Auswirkungen der<br />
Gewerbefreiheit verzweifelt ankämpfen würden und baten<br />
dringend, die Gewerbefreiheit zurückzunehmen, das Hand-<br />
werksrecht anzuerkennen sowie zusammen mit dem Deutschen<br />
Handwerkerbund eine bundeseinheitliche Gewerbeordnung zu<br />
erarbeiten.<br />
1865 bat der Deutsche Handwerkerbund die oldenburgische Re-<br />
gierung, an der Ausarbeitung der zugesandten „Grundzüge“ zu<br />
einer übergreifenden Handwerkerordnung teilzunehmen. 383 Die<br />
Organisation hob hervor, daß sie nur eine gesetzliche Rege-<br />
lung handwerksrechtlicher Rahmenbedingungen in einer der<br />
Zeit entsprechenden Form in Verbindung mit gewissen Mit-<br />
spracherechten sowie möglichster Selbstverwaltung handwerk-<br />
sinterner Belange wünsche. Es ginge nicht darum, herkömmli-<br />
che starre Privilegien, die dem Handwerk letztendlich nicht<br />
genutzt hätten, wieder aufzurichten. Zugleich müsse aber<br />
auch eine staatliche Bevormundung des Handwerks, wie sie<br />
der Privilegienwirtschaft zunehmend im 18. Jahrhundert<br />
folgte, künftig vermieden werden. Die Anpassung an den<br />
wirtschaftlichen Strukturwandel werde durch eigenständige<br />
Bemühungen des Handwerks im vorgegebenen Rahmen eines frei-<br />
heitlichen Berufsrechtes am besten gewährleistet. Dieses<br />
gebe den notwendigen Spielraum, um auf wirtschaftliche Ver-<br />
änderungen schneller und besser reagieren, die Entwicklung<br />
des zünftigen Handwerks zum Wohl seiner Mitglieder sowie<br />
der Bevölkerung besser steuern zu können. Ein Blick in die<br />
„Grundzüge“ zeigt aber, daß die Forderungen der Handwerker<br />
viel weiter gingen und dabei die Wiederherstellung herkömm-<br />
licher Organisations- und Machtstrukturen des Zunfthand-<br />
werks bezweckten. Hinter ihrer ausführlichen Rechtfertigung<br />
383 Vgl. Schreiben des Vorstandes des Deutschen Handwerkerbundes<br />
v.30.1.1864, anliegend: Denkschrift sowie Grundzüge<br />
zu einer allgemeinen deutschen Handwerksordnung vom Dezember<br />
1864 (= Beschlüsse des 2.Deutschen Handwerkertages<br />
v.25.,26.u.28.9.1863 in Frankfurt a.M), in: Ebenda
673<br />
in der den „Grundzügen“ vorgeschalteten Denkschrift trat<br />
außerdem das herkömliche Zunftdenken hervor. Diesmal setz-<br />
ten die Verfasser nicht beim Gesellenrecht, beim Anspruch<br />
auf gesetzlich geregelten auskömmlichen Lohn, an, um die<br />
Notwendigkeit des Handwerksrecht in Zeiten von Hungerlöhnen<br />
und unsicheren Arbeitsplätzen herauszustreichen. Jetzt be-<br />
schrieben sie die Aufgaben des Handwerks im Staat, die dar-<br />
auf hinausliefen, Erwerbsmöglichkeiten zu schaffen sowie<br />
die Ausbildung handwerklicher Kenntnisse und Erfahrungen zu<br />
befördern. Um ihnen nachkommen zu können, bedürfe es der<br />
gesetzlichen Absicherung der Handwerkslehre, folglich dann<br />
auch der geprüften Meisterschaft, der Innungen sowie der<br />
Abgrenzung der einzelnen Handwerke untereinander. Berufs-<br />
ständisches Denken zeigte sich hier besonders in der Auf-<br />
fassung von der Innung als eine die Meister und deren Fami-<br />
lien, die Gesellen und Lehrlinge umschließende<br />
„Erwerbsgemeinde“. Sie übe gegenüber ihren Mitgliedern re-<br />
ligiöse, sittliche sowie der Ausbildung dienende Aufgaben<br />
aus und bilde neben der Familie die Grundlage eines gedeih-<br />
lichen Gemeinde- und Staatslebens. Innungsgeist sei körper-<br />
schaftlicher Gemeinsinn, der das Handwerk am besten förde-<br />
re. Zu bedenken ist aber auch, daß die Verfasser der Denk-<br />
schrift über weite Passagen hinweg sachlich argumentierten<br />
und triftige Gründe für den Erhalt des Prüfungswesens ins<br />
Feld führten. Aber diese Mischung aus ernstzunehmender<br />
Sachlichkeit und Ideologie rührte aus dem Doppelcharakter<br />
der Innungen als Vertreter öffentlich-rechtlicher Aufgaben<br />
sowie eigener erwerbswirtschaftlicher Interessen her.<br />
Letztendlich kreisten die Gedanken der Verfasser jedoch um<br />
den Erhalt scheinbar altbewährten wirtschaftlichen Tuns.<br />
Innovatives Denken war ihnen fremd. Vielleicht war auch<br />
deshalb ein konstruktiver Dialog zwischen Gewerbefreiheits-<br />
verfechtern und Traditionalisten in der Form, daß sinnvolle<br />
Einzelvorschläge des Handwerks aufgenommen wurden, zu die-<br />
ser Zeit kaum möglich, weil Handwerksvertreter dann so-<br />
gleich das ganze „Handwerkssystem“ wieder hergestellt wis-<br />
sen wollten. Die „Grundzüge“ beinhalteten Zwangsinnungen,
674<br />
die Festschreibung von Lehrzeit, Gesellenprüfung, Gesellen-<br />
zeit sowie Meisterprüfung (Meisterstück). Die Handwerksge-<br />
biete sollten abgegrenzt, die Hierarchie von Lehrling, Ge-<br />
selle, Meister aufrechterhalten bleiben. Die Werkstatt wur-<br />
de dabei als „erweiterte Familie“ aufgefaßt. Dem Gesellen<br />
in seiner Funktion als „entlohnter Mitarbeiter“ solllten in<br />
den neu zubildenden Handwerkerräten auf Landes-, Provinzi-<br />
al- und Ortsebene sowie in den Innungen keinerlei Mitspra-<br />
cherechte eingeräumt werden. Nur der Vorstand der Gesellen-<br />
schaft durfte an den Innungsversammlungen, in denen Belange<br />
der Gesellen gehandelt wurden, teilnehmen. Den Handwerker-<br />
räten oblag die Leitung und Kontrolle der Innungsangelegen-<br />
heiten. Der Landeshandwerkerrat sollte berechtigt sein, zu<br />
handwerkspolitischen Vorhaben der Regierung Gutachten abzu-<br />
geben oder selbst initiativ zu werden und Anträge in eige-<br />
ner Sache zu stellen. Zusätzlich sollten Handwerkergerichte<br />
eingeführt werden. Der Lehrling sollte weiterhin der<br />
„Botmäßigkeit“ seines Meisters unterstellt bleiben und in<br />
seinem Haushalt leben.<br />
Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Kommission ähn-<br />
lich wie Buchholtz Gewerbefreiheit als Stimulanz für ge-<br />
werblichen Fortschritt und allgemeinen Wohlstand betrachte-<br />
te. Über diese vagen Vorstellungen und Hoffnungen hinaus<br />
entwickelte sie jedoch keine konkreten Pläne gewerblicher<br />
Förderung. Auch der Landtagsausschuß vertrat zwar interes-<br />
sante und neue Gedanken über Möglichkeiten eines geöffneten<br />
handwerklichen Ausbildungswesens, das sich auf der Basis<br />
der Freiwilligkeit gründen sollte, aber die Umsetzung in<br />
der Öffentlichkeit fehlte. Dies mußte sich auf die Bereit-<br />
schaft der Handwerker auswirken, alternative Vorstellungen<br />
wirtschaftlicher Entwicklung zu akzeptieren und selbst neue<br />
Wege zu beschreiten. Gewerbefreiheit als Postulat blieb für<br />
sie mit der Herrschaft des Kapitals, der Zerstörung des<br />
selbständigen gewerblichen Mittelstandes, der Ausbreitung<br />
von Lohnarbeit unter schlechtesten Bedingungen verknüpft.<br />
Für die begrenzten Oldenburger Verhältnisse sahen sie die<br />
Abschaffung des Handwerksrechts als gänzlich ungeeignet an.
675<br />
Die Beharrungskraft handwerklicher Leitbilder schien in den<br />
Oldenburger Petitionen dort durch, wo die Überzeugung geäu-<br />
ßert wurde, daß Talent und Befähigung des Einzelnen diesem<br />
auch seinen Lebensunterhalt sichern müsse. Der zünftig aus-<br />
gebildete Handwerker hatte moralischen Anspruch auf aus-<br />
kömmliche Nahrung. Daher hielten die Petenten auch an den<br />
Lehr- und Wanderjahren sowie der Meisterprüfung als Kern<br />
handwerklichen Selbstverständnisses fest. Deutlich ausfor-<br />
muliert wurde dieses „natürliche“ Anrecht auf gesetzlich<br />
festgelegte ausreichende Entlohnung sowie seine handwerks-<br />
rechtlichen Implikationen vom Deutschen Handwerkerbund.<br />
Auch hier stand die Vermittlung handwerklicher Kenntnisse,<br />
die herkömmliche Ausbildungsfunktion des Handwerks, im Mit-<br />
telpunkt der Argumentation zur Verteidigung eines spezifi-<br />
schen Berufsrechtes mit Zwangsinnungen, großem Befähigungs-<br />
nachweis, weitgehenden Selbstverwaltungs- und gewerbepoli-<br />
tischen Mitspracherechten. Der Verband stützte seine Forde-<br />
rungen zusätzlich ab, indem er ihnen zünftige Wertvorstel-<br />
lungen unterlegte. Indem die hausrechtliche Verfügungsge-<br />
walt des Meisters über seine Lehrlinge und Gesellen wieder-<br />
beschworen, die Innung als Gemeinde und Familie sowie der<br />
berufständische Staatsaufbau idealisiert wurden, verab-<br />
schiedeten sich die Verbände der Handwerker endgültig von<br />
der sozialen und politischen Realität.