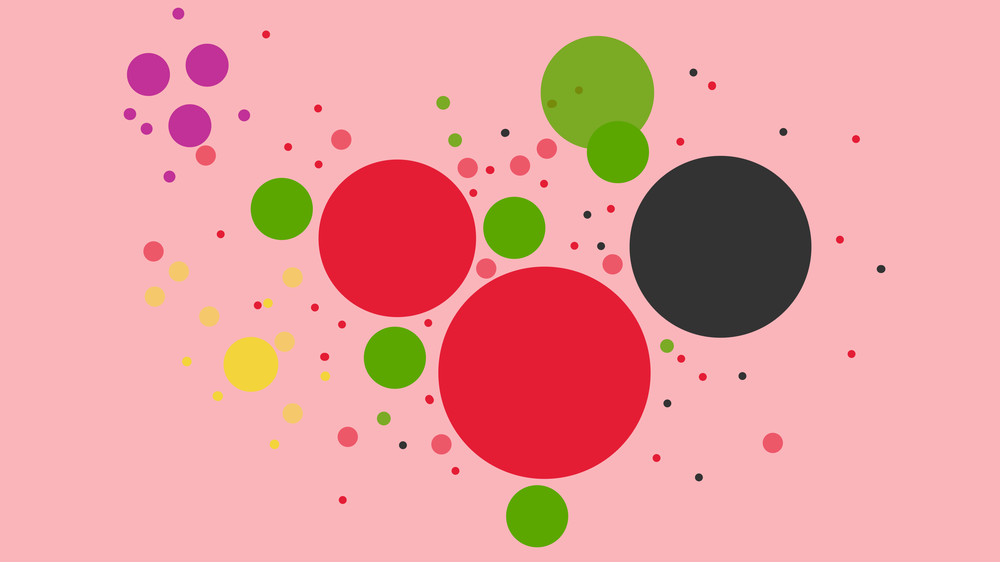Erstmals in der deutschen Geschichte könnte es sein, dass keine zwei Parteien nach der Bundestagswahl zusammen eine Mehrheit haben. Wie sollte die Politik damit umgehen? Der Politikwissenschaftler Michael Koß schlägt eine Minderheitsregierung vor.
Im Wahlkampf ist jetzt wohl die Zeit der Ausschlussforderungen angebrochen. Als Faustregel gilt: Je schlechter eine Partei dasteht, desto energischer fordert sie ihre Mitbewerber auf, bestimmte Koalitionen auszuschließen. Die abgestürzte Union verlangt so nicht nur von der SPD, der Linken eine Absage zu erteilen, sondern auch von der FDP, ein Bündnis mit der SPD auszuschließen. Noch eine Woche sinkender Umfragewerte und Armin Laschet fordert ultimativ die Selbstauflösung der Grünen. Man könnte dies im kalauernden Tonfall verhandeln, wenn hinter den Ausschlussforderungen nicht politische Dynamiken lägen, die dem Land nach der Wahl am 26. September noch gehörig zu schaffen machen werden.
Ausweislich der aktuellen Umfragewerte ist zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl keine einzige Zweierkoalition mehr möglich, auch nicht die nur noch sogenannte große Koalition aus Union und SPD. Inhaltlich kompatibel und koalitionswillig sind nur SPD und Grüne sowie Union und FDP, die jeweils allerdings einen weiteren, dritten Partner benötigen. Solchen Dreierbündnissen stehen echte Hürden im Weg: In der Wirtschaftspolitik liegt die FDP quer zu allen potenziellen Partnern. In der Außenpolitik hingegen ist die Linke nicht koalitionsfähig. Wer die Mitwirkung in der Nato als "Bekenntnisquatsch" (Dietmar Bartsch) abtut, hat entweder die Staatsraison der Bundesrepublik übersehen oder – und das ist das Wahrscheinlichere – es auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht vermocht, die innerparteilichen Gesinnungsethiker in die Schranken zu weisen.
Ein falsches Tabu
Was also tun, wenn allen möglichen Dreiparteienkoalitionen schon vorab für nicht verhandelbar erklärte inhaltliche Hindernisse im Weg stehen? Frei nach Sherlock Holmes dürfte diejenige Lösung die richtige sein, die nach Ausschluss aller unmöglichen übrigbleibt – eine Minderheitsregierung. Dass diese Lösung bisher gar nicht erwogen wird, dass sie in der Bundespolitik noch immer als Tabu gilt, ist nicht nur erstaunlich, es ist angesichts der Veränderungen im Parteiensystem auch fahrlässig. Eine Demokratie ist ohne Mehrheitsentscheidungen unmöglich. Wer festgefügte Mehrheiten – und nichts anderes sind die klassischen Koalitionen – ausschließt, muss bereit sein, flexible Mehrheiten einzuschließen. Das wäre dann eine Minderheitsregierung.
Um gleich mit dem größten Missverständnis aufzuräumen: In Minderheitsregierungen regieren keine Minderheiten. Stattdessen ermöglichen es Minderheitsregierungen, in verschiedenen Politikfeldern unterschiedliche Mehrheiten zu bilden. Die in Demokratien unerlässlichen Mehrheiten werden also nicht für Jahre im Nachgang einer Wahl durch eine feste Mehrheitskoalition zementiert, sondern flexibel im Vorfeld gesetzgeberischer Entscheidungen gebildet. "Flexibel" ist dabei keineswegs mit "willkürlich" gleichzusetzen, dann natürlich können sich die Parteien über gemeinsame grundsätzliche Projekte in verschiedenen Politikfeldern verständigen, die über einzelne Gesetzesvorhaben hinausgehen. Wenn die Parteien in den verschiedenen Politikfeldern nur in verschiedenen Konstellationen über mehrheitsfähige inhaltliche Schnittmengen verfügen, warum sollten sie dann nicht selektiv eine Minderheitsregierung unterstützen, um "ihre" Inhalte, beispielsweise in der Außen-, Wirtschafts-, Finanz- und Klimapolitik auch umsetzen zu können? Zumal sie sich ja dann ihre Siege nicht durch ein Übermaß an Koalitionskompromissen in anderen Bereichen erkaufen müssen.
Trotz dieser Vorteile haben Minderheitsregierungen in Deutschland einen miserablen Ruf. Sie gelten als instabil und sind zudem noch mit dem Makel behaftet, zum Scheitern der Weimarer Republik beigetragen zu haben. Ersteres trifft nur bedingt zu, siehe oben, und letzteres gar nicht. Die Weimarer Republik scheiterte, weil sich schlichtweg keine gesellschaftliche und parteipolitische Mehrheit für die Demokratie mehr fand. Nach 1930 war jede Form der demokratischen Mehrheitsbildung ausgeschlossen. Die im Januar 1933 gebildete Koalition verfügte zwar über eine Mehrheit, schloss aber die NSDAP ein. Der Todeskuss für die Weimarer Republik war die Abkehr der Konservativen von der Demokratie, die in ihrer Bereitschaft zum Ausdruck kam, mit den Nationalsozialisten zu koalieren. Die Regeln der Mehrheitsbildung hatten mit dieser demokratischen Selbstentleibung nichts zu tun.
Anders als in der Weimarer Republik wird der demokratische Leumund fast aller Parteien im nächsten Bundestag über jeden Zweifel erhaben sein. Mehr als 80 Prozent der Abgeordneten – alle bis auf AfD und einige besonders jenseitige Linke – dürften für demokratische Mehrheiten in den einzelnen Politikfeldern zur Verfügung stehen.
Aber nicht nur wäre die machtpolitische Basis stabil: Minderheitsregierungen passen besser als alle anderen Formen der Mehrheitsbildung zu den sich fundamental wandelnden politischen Rahmenbedingungen.
Erstmals in der deutschen Geschichte könnte es sein, dass keine zwei Parteien nach der Bundestagswahl zusammen eine Mehrheit haben. Wie sollte die Politik damit umgehen? Der Politikwissenschaftler Michael Koß schlägt eine Minderheitsregierung vor.
Im Wahlkampf ist jetzt wohl die Zeit der Ausschlussforderungen angebrochen. Als Faustregel gilt: Je schlechter eine Partei dasteht, desto energischer fordert sie ihre Mitbewerber auf, bestimmte Koalitionen auszuschließen. Die abgestürzte Union verlangt so nicht nur von der SPD, der Linken eine Absage zu erteilen, sondern auch von der FDP, ein Bündnis mit der SPD auszuschließen. Noch eine Woche sinkender Umfragewerte und Armin Laschet fordert ultimativ die Selbstauflösung der Grünen. Man könnte dies im kalauernden Tonfall verhandeln, wenn hinter den Ausschlussforderungen nicht politische Dynamiken lägen, die dem Land nach der Wahl am 26. September noch gehörig zu schaffen machen werden.